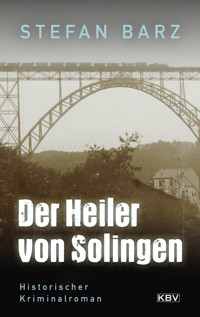
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: KBV-Krimi
- Sprache: Deutsch
Wunden, die nie verheilen werden April 1945: Kurz vor Kriegsende werden 71 Häftlinge am Wenzelnberg hingerichtet. Ein junger, an dem Massaker beteiligter Soldat will kurz darauf desertieren und kommt an der Müngstener Brücke in Solingen ums Leben. Es vergehen fünf Jahre, in denen sich die Menschen im Bergischen Land nach und nach wieder an die Normalität gewöhnt haben. Die Erinnerungen an den schrecklichen Krieg verblassen. Da wittert die aufstrebende Journalistin Edith Hartkop eine heiße Story: In Solingen macht der Pastor Magnus Eichenlaub mit Wunderheilungen auf sich aufmerksam. Edith hält das alles für faulen Zauber – selbst dann noch, als sie in einem Heilungsgottesdienst erlebt, wie der erblindete Besenbinder Ben Laddach durch Magnus' Gebete wieder sehen kann. Edith forscht nach – und erkennt bald, dass Krankheit, Heilung und ungesühnte Schuld aus den Kriegsjahren eng miteinander verbunden sind. Dieser Verdacht erhärtet sich, als Ben Laddach eines Tages nur mit knapper Not einem Mordanschlag entkommt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Barz
Der Heiler von Solingen
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Schandpfahl
Nimmerwiedersehen
Spiel des Bösen
Die Schreie am Rande der Stadt
Der Heiler von Solingen
Stefan Barz, geboren 1975 in Köln, wuchs in Kommern auf und lebt heute in Wuppertal. In Bonn studierte er Germanistik und Philosophie und arbeitete nebenbei als freier Journalist. Nach dem Studium wurde er Lehrer und begann mit dem Schreiben fiktionaler Texte.
2014 erschien sein erster Kurzkrimi Erbsünde, mit dem er für den Agatha-Christie-Krimipreis nominiert wurde. Im selben Jahr erschien sein Debütroman Schandpfahl, für den er den »Jacques-Berndorf-Förderpreis« verliehen bekam. Seither veröffentlichte er eine Eifel-Krimi-Reihe um den Kommissar Jan Grimberg und Krimis aus seiner Wahlheimat, dem Bergischen Land.
www.stefan-barz.de
Stefan Barz
Der Heilervon Solingen
Historischer Kriminalroman
© 2024 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung von »Kaiser-Wilhelm-Brücke« (Frits Freerks, 1907) Rijksmuseum Amsterdam
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-703-2
E-Book-ISBN 978-3-95441-714-8
Die Sünde besteht darin, dass die Seele ihre Ordnung verliert, so wie die Krankheit in einer Unordnung des Leibes besteht.
Thomas von Aquin, Quaestiones disputatae: De malo 7, I
Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.
Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt?
Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde?
Johannes 9, 1-2
Sünden und böse Geister scheuen das Licht der Welt.
Friedrich Schiller, Kabale und Liebe
Inhalt
Prolog
Kapitel 1: TAG FÜR TAG
Kapitel 2: EINE NEUE GESCHICHTE
Kapitel 3: LICHT UND SCHATTEN
Kapitel 4: ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE
Kapitel 5: DER KLANG VON SCHREIBMASCHINEN UND WAGNER
Kapitel 6: VON WUNDERN UND WEHKLAGEN
Kapitel 7: ENTSCHLUSS
Kapitel 8: BARTIMÄUS
Kapitel 9: DER SÜNDE FLUCH
Kapitel 10: DIE GERECHTIGKEIT KOMMT BALD
Kapitel 11: DIE BRÜCKE DES TODES
Kapitel 12: DAS SPIEL
Kapitel 13: NEUE NACHRICHTEN
Epilog
Nachwort
Quellenverzeichnis
Prolog
13. April 1945
Schnaubend startet der Motor des Lastkraftwagens. Der Fahrer löst die Bremse und setzt den Wagen zügig in Bewegung. Ein ganz normaler Arbeitstag. Der Beifahrer öffnet das Fenster, doch sein Kollege am Steuer bittet ihn sofort, es wieder zu schließen. Er vertrage die Kälte und die Zugluft nicht, das mache ihn sofort krank, sagt er. Für einen Frühlingstag ist es tatsächlich noch sehr kühl. Weniger als 10 Grad, schätzt der Fahrer. Dazu das übliche bergische Schmuddelwetter: stark bewölkt und ein bisschen Regen. Für eine Weile sagt keiner ein Wort, dann meint der Beifahrer, dass der Krieg wohl bald vorbei sei, nur noch eine Frage von Tagen, daher wohl auch der heutige Auftrag der Sonderbehandlung.
So ein Unsinn, widerspricht sein Kollege. Der Krieg sei noch lange nicht vorbei. Nicht, bis die Angreifer zurückgedrängt und dahin verschwunden seien, wo sie herkommen. Ob er schon gefrühstückt habe?
Der Beifahrer verneint. Dafür sei es noch zu früh.
Mehrere Dutzend Gefangene sollen sie mit Lastkraftwagen zur Sonderbehandlung abtransportieren. Ursprünglich hieß es, sie sollten zur Ohligser Heide gebracht werden, nun ist das Ziel Langenfeld.
Ob ihnen also der Prozess gemacht werden solle, fragt der Fahrer.
Es gebe keinen Prozess, entgegnet sein Kollege, die Sonderbehandlung habe unverzüglich zu erfolgen.
Es seien ja überwiegend Kommunisten, stellt der Fahrer fest, sein Kollege bleibt stumm.
In Langenfeld steigen sie schließlich am Wenzelnberg aus. Ein paar andere Polizisten und einige Soldaten sind schon vor Ort, öffnen die Ladeklappe und lassen die Gefangenen schnell aussteigen. Die Gefangenen sollen sich paarweise aufstellen, dann werden sie zu einem Graben geführt, der so breit ist, dass auch Panzer durchfahren könnten. Der Fahrer und sein Kollege helfen den anderen dabei, jeweils zwei Männer an den Daumen zusammenzubinden. Mit zwei Lastkraftwagen haben sie 55 Gefangene aus der Haftanstalt Lüttringhausen hergekarrt, 16 weitere wurden aus anderen Anstalten angeliefert.
Dann geht alles ganz schnell.
Pistolen werden durchgeladen.
Synchrone, manchmal nur leicht versetzte Schüsse knallen immer wieder aus zwei Waffen und treffen die Gefangenen im Genick. Wie Mehlsäcke kippen die Getöteten in die Gruben. Der Fahrer und sein Kollege beobachten die Sonderbehandlung ganz genau. 36-mal wiederholt sich das Verfahren. 71 Gefangene. Der Fahrer ist sich jedoch nicht sicher, ob am Ende alle wirklich tot sind.
Auf Befehl eines Polizisten schaufeln einige Männer, darunter auch Kriegsgefangene, denen das Entsetzen ins Gesicht geschrieben steht, die Grube zu. Dann sind bereits alle, die in der Grube liegen, mit Erde bedeckt.
Schließlich ist die Grube zugeschüttet. Alles ist still. Als wäre nichts geschehen. Als hätte es die Gefangenen nie gegeben. Die Sonderbehandlung ist beendet. Ein Soldat fragt, ob sie ihn mit zurück nach Lüttringhausen fahren können.
Auf dem Rückweg spricht keiner ein Wort. Der Lastkraftwagen fühlt sich leichter an ohne Ladung.
Erst kurz hinter Solingen bricht der Soldat das Schweigen. Der Fahrer hält an. Sie steigen aus und schreien sich gegenseitig an, doch auf dem Waldweg hört sie niemand. Schließlich fällt ein Schuss.
Kapitel 1:TAG FÜR TAG
23. Februar 1950
Ben Laddach streckte die Hand langsam in die ewige Dunkelheit hinein und suchte nach den Rosshaarbürsten. Als er sie endlich ertastete, setzte er seine Arbeit fort. Mit der rechten Hand umklammerte er die Haare, mit der linken suchte er den Draht, und als er ihn gefunden hatte, zog er die Rosshaare mit dem Draht in den Holzrohling vor ihm ein. Der Vorgang dauerte eine Weile, und als er ihn beendet hatte, wiederholte er ihn. Tag für Tag, Stunde für Stunde die immer gleichen Handgriffe, für die er eigentlich völlig überqualifiziert war – wenn er nicht blind geworden wäre. Ben lebte seit fünf Jahren in der Unterwelt, wie er seinen Zustand nannte. Sie war dunkel, kalt, manchmal Furcht einflößend, und sie war unerträglich langweilig. Er erlebte in unendlich langen Stunden diese Ödnis in der Finsternis. Was er Tag für Tag tat, war völlig absurd, denn er konnte das Ergebnis seiner Arbeit nicht einmal sehen. Aber er musste irgendwie weiter Geld verdienen. Und am Ende des Tages sagte er sich, dass es seine Arbeit, sein Leben, sein Schicksal sei, und manchmal half ihm das für kurze Zeit, seinen Lebensekel zu überwinden.
Ein kalter, unangenehmer Luftzug drang in die Werkstatt, dann vernahm er Schritte.
Heute war Donnerstag, da holte ihn Iris ab, seine Schwester, und lud ihn zu sich nach Hause zum Abendessen ein. Jeden Donnerstag. Eine kleine Abwechslung, eine kleine Auszeit von der Unterwelt.
»Bin gleich so weit«, sagte Ben tonlos, fummelte die letzten Haarbüschel in den Rohling und legte ihn vorsichtig ab. Dann schob er seine Hand vor, bis er seinen Blindenstock zu fassen bekam, stand auf und schlurfte zu Iris.
»Vorsicht!«, rief sie und schob einen Hocker zur Seite. »Manchmal glaube ich, du machst das mit Absicht!«
Ben antwortete nicht darauf. Iris hakte sich bei ihm ein, und sie verließen die Werkstatt. Eine Weile gingen sie stumm den Hügel zum Ronsdorfer Ortskern hinunter.
»Am Wochenende besucht mich meine Freundin Maria aus Osnabrück. Sie bleibt für ein paar Tage hier«, sagte Iris schließlich. »Wenn du magst, hole ich dich auch ab, und wir unternehmen was zusammen.«
»Ich weiß noch nicht«, antwortete Ben. »Ich habe schon so viele Termine am Wochenende.«
»Sehr witzig!«, erwiderte Iris. »Du solltest wirklich mal mehr unter Menschen gehen.«
»Das lässt sich manchmal nicht vermeiden!«
Er hörte ein lautes Stöhnen, dann sagte Iris: »Ihr würdet gut zusammenpassen.«
»Ich bin blind!«
»Aber immer noch ein Mann!«, erwiderte Iris. »Also: Kommst du mit, wenn ich sie abhole?«
Na schön, dachte Ben. Es gab doch immer zwei Möglichkeiten. Entweder war diese Maria nett, und das Schicksal meinte es gut mit ihm – oder er blieb allein, und nichts würde sich ändern. Er beschloss, seine Entscheidung vom Zufall abhängig zu machen. Wenn er den Nachhauseweg diesmal schaffte, ohne sich zu erschrecken, würde er sich verweigern und Iris’ Freundin nicht kennenlernen wollen.
Am Ronsdorfer Marktplatz vernahm er ein Gewirr aus unterschiedlichen Stimmen: hellen, dunklen, kindlichen, männlichen, weiblichen Sprachfärbungen. Dazwischen Motorgeräusche. Er hatte Ronsdorf als schönen Ort mit vielen Bergischen Schieferhäusern in Erinnerung, außerdem erinnerte er sich an die braunen Steine der Lutherkirche und an das Zweikaiserdenkmal am Marktplatz. Er fragte sich, ob alles wieder so aufgebaut worden war wie vor der Bombardierung. Vielleicht stellte er sich den Ort, an dem er gerade war, ganz anders vor, als er heute tatsächlich aussah.
Ein lauter Knall ertönte ganz in der Nähe. Ben zuckte zusammen.
»Es ist alles in Ordnung, Bruderherz. Das war nur die Ladeklappe eines Lastwagens.«
Eines Lastwagens …
Eigentlich hatte er in den Jahren gelernt, die Geräusche des Alltags von Kriegsgeräuschen zu unterscheiden. Aber hin und wieder warf er sie durcheinander. Sein Herz klopfte immer noch. Der Zufall hatte also entschieden. Ben musste Maria kennenlernen.
»Du musst wieder ins Leben zurückfinden, Ben. Jeden Tag Besen zu binden, ist doch nichts für dich.«
»In meinen alten Beruf kann ich ja wohl schlecht zurück …«
»Ben, es gibt viele Berufe, die man auch als Blinder machen kann.«
»Nenn mir ruhig alle, dann suche ich mir einen aus.«
»Lass uns noch kurz bei dir vorbeigehen, dann nehme ich deine Wäsche mit«, warf Iris ein.
Sie schwiegen sich eine Weile an, während sich Ben auf den Weg konzentrierte und zu erraten versuchte, ob er schon am richtigen Haus war. Es war ihm auch nach fünf Jahren Blindheit immer noch zu mühsam, Schritte zu zählen. Stattdessen wollte er sich auf seine Intuition verlassen.
»Hier sind wir«, sagte er.
»Es ist noch ein kleines Stück«, lachte Iris und führte ihn einige Meter weiter. »Hier!«
Plötzlich hielt sie inne.
»Verdammt noch mal! Diese Plagegeister!«
»Was ist?«, fragte Ben.
Iris antwortete nicht, stattdessen hörte er, wie sie mit dem Schlüssel hektisch an der Holztüre kratzte.
»Hat mir wieder jemand eine Nachricht auf die Tür geschrieben?«
»Es ist nichts«, sagte Iris und kratzte weiter.
»Was steht diesmal dran? Schweine? Verbrecher? Oder gar Mörder?«
Iris kratzte weiter. »Die meinen ja gar nicht dich oder mich. Die meinen alle. Vielleicht sogar sich selbst.«
»Ja, wahrscheinlich …«
»Ich meine, was können wir denn dafür? Was haben wir denn schon getan? Es waren halt andere Zeiten. Aber das wird sicher bald aufhören. Komm, ich bring dich rein, dann mache ich es mit warmem Wasser weg.«
»Ich kann es auch wegmachen …«
»Dein Zynismus ist manchmal nicht zu ertragen, Ben.«
»Du sagst doch selbst, es gibt viele Berufe für Blinde. Und gute Putzkräfte werden immer gebraucht. Man muss mir hinterher nur sagen, ob es noch dreckig ist.«
»Lass uns reingehen«, sagte Iris, nahm seinen Schlüssel und schloss die Tür auf.
* * *
Das Abendmahl, ein voller Käseteller und zwei Scheiben Brot, hatte er gerade beendet, als es an der Tür klingelte. Magnus Eichenlaub war kurz davor zu fluchen, konnte sich aber im letzten Moment beherrschen. Der Käse lag ihm schwer im Magen, die beiden Gläser Wein hatten ein Übriges getan, Magnus war müde, ihm war leicht schwindelig, daher beschloss er, heute niemandem mehr zu öffnen – schließlich war es schon nach zehn – und schnell ins Bett zu gehen. Entschlossen schaltete er das Licht im Flur aus, um dem ungebetenen Besucher vor seinem Haus in Solingen-Ohligs unmissverständlich klarzumachen, dass er heute nicht mehr zu sprechen war. Auch ein Pastor hatte mal Feierabend.
Langsam schlich Herbert durch den Flur die Treppen zum Schlafzimmer hoch, zog seine Pantoffeln aus, fühlte den weichen Teppich mit dem Blumenmuster unter seinen Füßen und hob die blau karierte Bettdecke an.
Es klingelte erneut.
Nein, ärgerte sich Magnus. Nicht jetzt. Er hatte Magenschmerzen und war nicht mehr ganz klar im Kopf. Er brauchte seinen Schlaf …
Magnus atmete tief durch, legte seinen Kopf aufs Kissen und faltete die Hände zum Abendgebet, doch bevor er sprechen konnte, vernahm er eine Stimme. Sie war hell und klar.
Geh hin, forderte sie ihn auf. Er kannte diese Stimme gut. Sie kam von seinem Herrn. Geh, um meinetwillen, sagte sie.
Mit einem tiefen Seufzer schwang sich Magnus aus dem Bett, knipste das Flurlicht wieder an und stapfte die Treppe hinunter.
Es klingelte zum dritten Mal.
Magnus legte die Hand auf den Türgriff, atmete einmal tief durch, dann öffnete er seine Tür.
Draußen stand ein blonder Mann mit grauen Schläfen, den Magnus auf Mitte vierzig schätzte, jedoch fragte er sich, ob der Mann vielleicht einfach deutlich älter aussah, als er eigentlich war. Schließlich war im Krieg für viele Menschen die Zeit einfach stehen geblieben, einige waren schneller gealtert. Erst jetzt sah er, dass sein Besucher am ganzen Leib zitterte, obwohl es für diese Jahreszeit ungewöhnlich mild war.
»Kann ich etwas für Sie tun?«, fragte Magnus, obwohl die Antwort auf der Hand lag.
»Helfen Sie mir, Pastor!«, wimmerte der Mann. »Helfen Sie mir bitte! Es wird immer schlimmer!«
Magnus hielt kurz inne, dann nickte er, trat zur Seite und gewährte dem armen Mann Einlass. Er führte ihn in die enge Küche, in der der alte Herd viel zu weit in den Raum ragte, machte Licht und bot ihm einen Platz an dem kleinen Tisch in der Ecke am Fenster. Dann wartete er, setzte sich zu seinem Gast, und nach einer kurzen Stille begann der Mann: »Mein Name ist Thomas Freiberg. Mein Vater hat mal bei Ihnen in der Rasierklingenfabrik gearbeitet, bevor Sie … bevor Sie Ihren Beruf gewechselt haben.«
Magnus’ Erinnerung blitzte kurz auf. Seine Rasierklingenfabrik in Solingen … Die Erweckung … Dann der Krieg und seine Abkehr von Gott … Schließlich das zerbombte Haus und die Rückkehr zu seinem Herrn, dem einzig wahren Herrn …
Der späte Gast zitterte immer noch. »Seit ich im Krieg war«, fuhr Thomas Freiberg fort, »habe ich immer diese verfluchten – Verzeihung … diese schlimmen Zitteranfälle. Tag für Tag, sie kommen immer aus dem Nichts. Dabei wurde ich gar nicht richtig verletzt. Nicht verletzt, aber ein bisschen irre geworden, hat mein Hausarzt gesagt.« Während er sprach, wurde Freiberg langsam ruhiger. »Es beginnt immer ohne Vorwarnung, wissen Sie? Oft beim bloßen Anblick von Schuhen. Lächerlich, nicht? Aber ich kann gar nichts dagegen machen. Zunächst fängt mein linker Arm an zu vibrieren, als würde ich unter Strom stehen. Ein paar Sekunden später schüttelt sich der rechte Arm wie von Geisterhand, dann werden meine Beine weich wie Brei, ich kann nicht mehr stehen, falle hin und liege hilflos da wie ein Säugling, der seinen Körper nicht kontrollieren kann. Und wenn ich endlich wieder aufstehen kann, zittere ich immer noch und glaube jedes Mal, es hört gar nicht mehr auf.«
Magnus sah den Mann mitleidig an und nickte immer nur, ohne selbst zu sprechen.
Freiberg fuhr fort: »Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Mein Hausarzt hält mich für bekloppt, er sagt, ich solle doch froh sein, dass ich kein Bein verloren habe wie andere Soldaten, und außerdem meint er, wegen Weicheiern wie mir, die beim Anblick von Schuhen Panik kriegen, hätten wir den Krieg verloren.«
Wieder zitterte Freiberg, diesmal, weil er in Tränen ausbrach.
»Helfen Sie mir, Pastor! Helfen Sie mir! Machen Sie, dass es weggeht!«
Diesem Mann ging es nicht gut, eine bemitleidenswerte Kreatur. Dieser Mann war voller Sünde. »Sie tragen immer noch den Schweinehund in sich«, murmelte Magnus, fast unverständlich.
»Was?«, fragte Freiberg verwirrt.
»Der Schweinehund ist es, der Sie plagt«, antwortete Magnus nun laut und streng. »Es gibt Menschen, die ihn immer noch in sich tragen. Sie gehören auch dazu.«
»Was reden Sie da?«
»Sie waren Soldat der Wehrmacht?«
Beschämt sah Freiberg auf seine Füße. »Ja …«
Das Zittern wurde wieder stärker.
Magnus fasste Freibergs Hände an und versuchte, das Zittern durch einen festen Griff zu bändigen.
»Es ist nicht normal, dass Sie krank sind«, sagte er. »Krankheit ist anormal, verstehen Sie? Das Normale ist Gott.«
Freiberg nickte irritiert, und Magnus sah ihm an, dass er ihn nur halb verstand.
»Krankheit entsteht durch Ungehorsam gegenüber Gott, verstehen Sie das?«
Freiberg nickte, und das Nicken ging über in ein wildes, ungebändigtes Zittern, sein ganzer Körper schüttelte sich – Nicken und Zittern und Schütteln, Nicken und Zittern und Schütteln.
Magnus konnte seine Hände nicht länger festhalten, er ließ los und schrie seinen Gast an: »Sie müssen von der Sünde gereinigt werden, verstehen Sie? In jeder Sünde liegt ein Fluch! Bekennen Sie Ihre Sünden, bekennen Sie Ihren Glauben, dann kann ich Sie heilen!«
Zu dem Nicken und Zittern und Schütteln verzog Freiberg sein Gesicht wie jemand, der jeden Moment zu weinen beginnt – und dann platzten die Tränen nur so aus ihm heraus.
»Die Sünde muss raus!«, wiederholte Magnus, drückte seine Hand auf Freibergs Stirn und sprach ein Gebet.
Kapitel 2:EINE NEUE GESCHICHTE
24. Februar 1950
Tacker-tacker-tacker. Die Schreibmaschine klapperte ununterbrochen. Edith Hartkop wollte den Artikel über die Feierlaune während der Karnevalstage heute unbedingt noch fertig schreiben, bevor sie zum nächsten Pressetermin eilen musste. Als die zweite Seite halb voll war, legte sie eine kurze Pause ein, zündete sich eine Maryland an und las sich den Text durch.
Tanzen in der Vorhölle, lautete ihre Überschrift, und weiter: Die Feierlaune der Solinger war an den Karnevalstagen ungebrochen. In vielen Stadtteilen wurde geschunkelt, gesungen und getanzt. So etwa im Alt Solingen, wo die Menschen in Narrenkostümen tanzten, nein, wüteten, als ginge es um ihr Leben. Auf dem braunen Holz tummelten sich 200 Männer und Frauen wie in einer Grube in siedender Hitze. Wie die Körper der Verdammten in der Vorhölle wandten sie sich zu fröhlicher Musik. Wird unsere Gesellschaft langsam wieder gesund? Ist die ganze Zivilisationsbarbarei der letzten Jahre schon vergessen? Der Karneval zeigt doch die ganze Janusköpfigkeit einer Gesellschaft, die vor fünf Jahren noch gemordet und gemeuchelt hat und nun zur verordneten Fröhlichkeit ein neues, selbstbewusstes Lächeln aufsetzt. Aber sind all die Narren nicht in Wahrheit traurige Clowns und das gute Essen zum Karnevalsfest nicht eigentlich ein Leichenschmaus? Nun haben die Solinger sogar ihren eigenen Karnevalsschlachtruf: »Solig lot jonn!«, was so viel heißt wie: »Solingen, los geht’s!« Aber wohin? In eine neue Zeit? Sind denn die Trümmer, die Toten und die Gräueltaten der Nazi-Zeit schon vergessen? Müssten wir nicht viel mehr die jüngste Vergangenheit unserer Stadt, die jüngste Vergangenheit unseres Landes aufarbeiten? Es ist ja nicht so, dass unsere wunderbare Stadt es nicht verdient hätte, alte Traditionen wieder aufleben zu lassen. Aber die momentane Feierlaune der Deutschen ist doch ein wenig unheimlich.
Mit einem zufriedenen Lächeln führte sie die Zigarette zwischen ihre Lippen und legte die Finger wieder auf die Tasten.
Sie liebte das, was sie gerade tat. Sie war jetzt 21 und wollte in ihrem ganzen Leben nichts anderes mehr machen als lesen und schreiben. Aber sie hatte es nach einem Jahr bei der Bergischen Tagespost satt, immer nur Schönwetterberichte über die drei bergischen Hauptstädte Solingen, Remscheid und Wuppertal zu schreiben. Und sie konnte einfach nicht glauben, wie die Menschen fünf Jahre nach den Gräueltaten im Nationalsozialismus wieder so taten, als wäre das alles nicht geschehen. Wieso sprachen die Menschen nicht mehr darüber? Ein Großteil der Bevölkerung hatte dabei zugesehen, wie Millionen von Juden bestialisch ermordet wurden, viele waren selbst zu Mördern geworden. Und nun lebten alle so, als wäre das alles einfach unter den Teppich gekehrt worden. Edith band ihre dunkelbraunen Haare zu einem Zopf zusammen und setzte sich aufrecht hin, um weiterzuschreiben.
Plötzlich riss eine Hand von hinten das Blatt ruppig aus der Hermes-Maschine. Erschrocken drehte sie sich um, denn sie hatte niemanden reinkommen hören. Hinter ihr stand Hans Greuler, der Redaktionsleiter der Bergischen Tagespost, die sich in nur einem Jahr zu einer renommierten Regionalzeitung für das Bergische Städtedreieck gemausert hatte.
»Was soll das denn schon wieder werden?«, murmelte Greuler. »Spielst du wieder Sprachrohr der Witwen und Waisen?«
Edith fingerte unruhig an ihrer Zigarette. Greuler hatte mit seiner seebärenhaften Statur, seinem dunklen Vollbart und seinen zusammengewachsenen Augenbrauen eine Präsenz, die jeden selbstbewussten Menschen verunsichern konnte, sobald er nur den Raum betrat.
»Ich hatte das Thema mit Ihnen abgesprochen«, protestierte sie vorsichtig.
Greuler schüttelte den Kopf. »Aber nicht so, Mädchen! Wir hatten ausgemacht, dass du eine Zusammenschau über die Karnevalsfeiern schreibst und einen eigenen Blickwinkel einbringst. Aber doch nicht so mit dem moralischen Zeigefinger!«
Edith ballte ihre Hände. Sie dachte an die Leichenberge von KZ-Insassen, die sie sich wie die meisten anderen Deutschen vor vier Jahren in den Wochenschauen hatte ansehen müssen. Sie hatte in die offenen Augen der bis zur Unmenschlichkeit abgemagerten Toten geschaut und sofort das ganze Ausmaß der deutschen Bestialität verstanden. Während der Vorführung hatte Edith geweint, viele andere auch, aber einige Zuschauer hatten sich auch darüber empört, was die Alliierten ihnen da zumuteten, und ein Mann neben ihr hatte sogar die Echtheit des Dokumentarfilms angezweifelt. Diese Bilder waren ein Schock für die meisten Deutschen gewesen, die in den Himmel schrien, dass sie von alldem nichts gewusst hatten. Und jetzt tanzten und schunkelten sie wieder und riefen in den Himmel nur noch Solig lot jonn. Edith hatte ein Recht darauf, sich über die Feierlaune zu empören.
Mit einem schneidenden Geräusch riss Greuler das Blatt in zwei Hälften. »Lass dir was anderes einfallen, wir drucken diese Geschichte nicht. Aber überleg nicht zu lange, ja? Wenn du es hier nicht bringst, kannst du besser als Haushälterin arbeiten.«
»Ich mache hier gute Arbeit, Herr Greuler …«
»Die Frage ist nur, wie lange noch«, fiel ihr Greuler ins Wort. »Wenn der letzte Mann aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen ist, findest du vielleicht irgendwann auch mal einen, und dann bist du als Hausfrau eingespannt, und dann wirst du sicher auch bald kleine Quälgeister in die Welt setzen, oder wie alt bist du jetzt? 20?«
»21! Und ich bestimme selbst, ob und wann ich Kinder möchte!«
Greuler lachte hämisch und streichelte ihren Rücken. »Das haben schon ganz andere gesagt, mein Mädchen …«
»Ich bin nicht Ihr Mädchen!«, fauchte Edith.
Greuler sah sie finster an. Der kurze Moment der Stille war kaum zu ertragen. Dann riss er ihr die Zigarette aus dem Mund, steckte sie sich zwischen die Zähne und sagte: »Wenn du hier wirklich arbeiten willst, dann musst du dich immer wieder bewähren, Mädchen! Schreib erst einmal den Bericht über den Karneval neu. Ich betone: den Bericht. Wenn du richtig kreativ sein willst und eine echte Reportage schreiben möchtest: nur zu, sehr gerne sogar. Aber bitte eine anständige Reportage! Ich gebe dir drei Tage Zeit, eine gute Geschichte zu liefern. Und jetzt beeil dich, dein Termin in Solingen-Wald wartet, du weißt schon: Da stellt dieser Unternehmer Helmut Schmidt das Frei- und Fahrtenschwimmer-Abzeichen vor, das er erfunden hat und nun in hoher Auflage produzieren will. Deine Straßenbahn kommt gleich!«
Edith schnappte sich Jacke, Stift und Papier und hastete aus dem Redaktionsgebäude.
* * *
Ben war unendlich müde. Er war aus einem verstörenden Traum erwacht, an den er sich schon nicht mehr erinnern konnte. Seine Träume waren oft schrecklich, aber wenigstens konnte er in seinen Träumen noch Bilder sehen. Nun ging er tastend durch die Stadt, durch die dunkle Unterwelt, Geräusche an jeder Ecke, die ihn aufhorchen ließen, überall Gefahr. Geführt von seiner Schwester wie ein hilfsbedürftiges Kleinkind. Er brauchte Schlaf und wäre am liebsten im Bett geblieben. Wozu musste er sich an einem solchen Tag zur Arbeit quälen, um einer sinnlosen Tätigkeit nachzugehen, sinnlos wie das Leben selbst. Das Einzige, was ihm hin und wieder Sinn verlieh, war die Musik, die er erst zu schätzen gelernt hatte, als die Ohren nach seiner Erblindung zu seinem wichtigsten Sinnesorgan geworden waren. Er hätte nie gedacht, dass er mal Wagner-Opern für sich entdecken und lieben lernen würde.
Dann hörte er, wie das Türschloss geöffnet wurde. An den Schritten erkannte er Iris.
»Guten Morgen«, begrüßte sie ihn. »Wie sieht es denn hier wieder aus? Komm, ich räume schnell ein bisschen auf und bringe dich dann zur Arbeit.«
»Ich brauche dringend noch mal eine neue Schallplatte«, sagte er zu Iris. »Der Parsifal könnte mir einige vergnügliche Stunden bereiten.«
»Eine neue Oper auf gleich mehreren Schallplatten? Weißt du, was das kostet?«
»Als Besenbinder verdiene ich doch fürstlich.«
»Du müsstest zumindest mal anfangen, fürstlich dafür zu sparen, Brüderchen. Dein Monatsgehalt ist schon wieder fast aufgebraucht.«
»Fast aufgebraucht? Das kann doch gar nicht sein!«
»Du trinkst zu viel billigen Wein.«
»Der Mensch muss täglich trinken, um nicht zu verdursten.«
»Ich meine es ernst, Ben. Du musst besser auf dein Geld achten. Ich verstehe ja, dass dir das Musikhören wichtig ist, aber das kostet alles Geld, und du gibst zu viel aus.«
»Das war mir wirklich gar nicht bewusst, dass ich schon wieder zu wenig übrighabe. Manchmal glaube ich, nachts kommt jemand in meine Wohnung und stiehlt mir mein Geld. Du bist übrigens der einzige Mensch, der einen Schlüssel hat.«
»Das ist nicht komisch, Ben.«
»Entschuldige.«
»Wir sind da. Und denk daran, dass wir morgen Maria abholen. Zeig dich von deiner besten Seite.«
* * *
Der Termin bei dem Unternehmer Schmidt war wie erwartet gähnend langweilig gewesen, höchstens dreißig Zeilen wert. Das waren eine Stunde Gespräch vor Ort und eine halbe Stunde Bahnfahrt für wenig Zeilengeld.





























