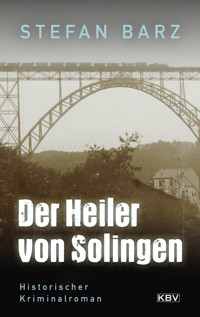Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: KBV-Krimi
- Sprache: Deutsch
Wenn die Erinnerungen geweckt werden ... Im Frühling des Jahres 1993 findet der Journalist Martin Tesche bei der Auflösung der Wohnung seines verstorbenen Vaters Johannes ein sechzig Jahre altes Tagebuch. Martin ist erschüttert: Sein Vater verrät darin unmissverständlich, an einem Mord beteiligt gewesen zu sein. Martin begibt sich auf Spurensuche und reist an Johannes Tesches früheren Wohnort Wuppertal. Dort macht er Gerda Steinjans ausfindig, deren Name ihm in den Aufzeichnungen mehrfach begegnet ist. Die alte Frau kann sich noch gut an seinen Vater erinnern. Und auch an die Freunde Georg, Henri und Friedrich, an die Wandervogel-Gruppe, in der sie damals ihre jugendliche Freiheitsliebe auslebten und sich an der Natur berauschten … Aber mit den Erinnerungen kehren auch die Schreie wieder zurück, die von der Putzwollfabrik im Ortsteil Kemna zu ihnen herüberdrangen, einer Anlage, in der den Gerüchten nach ein Konzentrationslager eingerichtet worden war. Und der Nebel des Vergessens, der sich über die Mordtat gelegt hat, lichtet sich langsam …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
SchandpfahlNimmerwiedersehenSpiel des Bösen
Stefan Barz, geboren 1975 in Köln, wuchs in Kommern auf und lebt heute in Wuppertal. In Bonn studierte er Germanistik und Philosophie und arbeitete nebenbei als freier Journalist. Nach dem Studium wurde er Lehrer und begann mit dem Schreiben fiktionaler Texte. 2011 erschien seine erste Kurzgeschichte Klassenzimmer, 2014 sein erster Kurzkrimi Erbsünde, mit dem er gleich für den Agatha-Christie-Krimipreis nominiert wurde. Einen weiteren großen Erfolg feierte Stefan Barz im Jahr 2014 mit seinem Debütroman Schandpfahl, für den er den Jacques-Berndorf-Förderpreis verliehen bekam. Seither veröffentlichte er eine Eifel-Krimi-Reihe um den Kommissar Jan Grimberg.www.stefan-barz.de
Stefan Barz
Die Schreieam Rande derStadt
Originalausgabe
© 2021 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
unter Verwendung von © Roedie - stock.adobe.dom
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Print-ISBN 978-3-95441-585-4
E-Book-ISBN 978-3-95441-595-3
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
NACHWORT
Die traurige Wahrheit ist,dass das meiste Bösevon Menschen begangen wird,die niemals entschieden haben,ob sie gut oder böse sein wollen.
Hannah Arendt
Prolog
30. August 1933
Er hatte von grünen Wiesen geträumt und von Bäumen, die in den blauen Himmel ragten und zum Wandern durch die herrliche Natur einluden. Als er die Augen öffnete, war immer noch tiefschwarze Nacht. Er suchte nach dem Lichtschalter, fand ihn aber nicht. Dann bemerkte er, dass er nicht mehr in seinem Bett lag. Er musste rausgefallen sein. In unnatürlicher Haltung saß er auf dem Boden. Als er ruckartig aufstand, rammte er seinen Kopf gegen die Decke, noch ehe er aufrecht stehen konnte. Benommen sackte er wieder zu Boden.
Wo war er?
Plötzlich hörte er Schritte. Und Stimmen, die ihm fremd waren. Stimmen von lachenden Männern. Aber dann erkannte er eine Stimme, die er irgendwo schon einmal gehört hatte.
Die Erinnerung kam zurück.
Er war gerade nicht zu Hause.
Er war in der Hölle.
Wie lange schon, hatte er vergessen.
Wie lange noch – er hatte keine Ahnung, wann er jemals wieder in den Himmel ragende Bäume und grüne Wiesen sehen würde. Die Vorstellung, dass es jetzt für immer so bleiben würde, trieb seinen Puls in die Höhe. Er atmete zu schnell. Die Luft war ohnehin schon zu dick in dieser kleinen Kammer, in der er seit gestern eingesperrt war.
Er zwang sich, langsamer zu atmen.
Ruhig atmen!
Das hier war ein Albtraum, der irgendwann vorbei sein musste.
Ruhig atmen.
Er wollte überleben. Dafür brauchte er genügend Sauerstoff. Er versuchte sich daran zu erinnern, für welches Unrecht er diese Strafe hier erdulden musste. Eigentlich hatte er nichts getan, was dieses Martyrium rechtfertigte.
Sie würden nach ihm suchen, und bald würde man ihn befreien.
Er hörte wieder Schritte. Zwei oder drei Personen liefen draußen umher.
Und dann hörte er auf einmal diese Schreie, die ihn daran erinnerten, dass er nicht allein war in der Hölle.
1. Kapitel
26. April 1993
Die Schreibtischlampe warf ein schwaches Licht in das Arbeitszimmer seines Vaters, das gegen die einsetzende Dunkelheit nicht viel ausrichten konnte und ihn daran erinnerte, dass es in diesem Haus kein Leben mehr gab. Es war zu dunkel und zu still. So kannte Martin Tesche das Zuhause seiner Kindheit nicht. Er war noch nie allein hier gewesen. Ohne seinen Vater war das Haus unheimlich.
Neben dem rotbraunen Mahagoni-Schreibtisch, der sicher noch viel wert war, lag auf dem Boden eine liberale Wochenzeitung – ungelesen, allerdings schon drei Wochen alt. So hatte er das Arbeitszimmer vorgefunden. Es sah aus, als würde sein Vater jeden Augenblick wiederkommen.
Aber er würde nicht mehr wiederkommen. Sie hatten Johannes Tesche letzte Woche beerdigt, hier in Kommern. Er war mit 78 Jahren kurz und beinahe schmerzlos an einem Herzinfarkt gestorben. Eigentlich ein Tod, wie man ihn sich für seine Angehörigen, die man liebt, nur wünschen konnte. Sein Vater hatte einen Weltkrieg überlebt und war von Krankheiten und Unfällen verschont geblieben. Er hatte es verdient, von dieser Welt zu gehen, ohne leiden zu müssen. Wenn der Tod nur nicht so plötzlich und unerwartet gekommen wäre.
Und nun war es Martins Aufgabe als einziger Erbe, das schöne Haus aufzulösen. Es war ein frei stehendes Einfamilienhaus mit einer schützenden Backsteinfassade. Martin sah durch das Sprossenfenster im Arbeitszimmer auf den verwilderten Garten. Sein Vater hatte sich nie besonders um das Gartengewächs gekümmert. Er fühle sich wohl, wenn die Natur um sein Haus herum ein bisschen ihrer eigenen Wege gehen könne, hatte er mal gesagt. Das Grundstück grenzte an den Wald, das war der Grund, weswegen sein Vater das Haus überhaupt gekauft hatte. Er hatte den Wald geliebt, und als Aita, seine Labradorhündin, noch gelebt hatte, war er jeden Tag stundenlang spazieren gegangen. Die Vorstellung, dass bald andere Menschen hier leben würden, erzeugte Unbehagen, aber Martin hatte pragmatisch entschieden, dass er das Haus verkaufen würde. Für sich und Melanie war es einfach zu groß, und die Bonner Zeitung, bei der er arbeitete, war zwar aus der Eifel erreichbar, aber die Strecke war einfach zu weit, um sie jeden Tag zwei Mal zu fahren. Martin lief durch den Flur des Obergeschosses, die Holztreppe hinunter, sah sich noch einmal das Schlafzimmer, sein Kinderzimmer und im Erdgeschoss die Küche und das Wohnzimmer an. Das Haus seines Vaters war immer noch dasselbe.
Nur verlassener.
Aber das war es nicht, was sich so verändert hatte. Es war vielmehr der Klang. Als würde ein fast unmerkliches Zischen und Rauschen und Dröhnen die Stille des Hauses hier am Waldrand zu durchbrechen versuchen.
Martin hatte die Redaktion heute früher verlassen, um von Bonn aus in die Eifel zu fahren. Vorgestern hatte er mit der Auflösung begonnen und Hunderte von Büchern sortiert: insbesondere natürlich Werke der Weltliteratur, Gesamtausgaben von Goethe, Schiller, Mann, Kafka und so weiter. Sein Vater hatte sich als Germanistikprofessor an der Universität Bonn zwar auf Literatur des 20. Jahrhunderts spezialisiert, aber er hatte sich natürlich immer wieder durch die gesamte Literaturgeschichte gelesen. Martin erinnerte sich an keinen einzigen Tag in seiner Kindheit, an dem sein Vater kein Buch in der Hand gehabt hatte. Daneben fanden sich viele Bücher zur Geschichte, Politik und Philosophie, die Martin selbst behalten wollte, dann einige Werke, die er an Antiquariate verkaufen konnte, und Taschenbücher, die wertlos waren und an die Tafel für Bedürftige verschenkt werden konnten.
Er ging zurück ins Arbeitszimmer. Den Stapel mit Kladden, die er in einem Schrank gefunden hatte, legte er auf den Mahagonitisch, schlug das erste Büchlein auf und überflog einige Seiten. Das waren alte Tagebücher.
Martin schlug die Kladde sofort wieder zu. Die Tagebücher seines Vaters waren privat, sie gingen ihn nichts an. Sein Blick fiel auf den Einband. 1933 war dort handschriftlich vermerkt worden. Das Jahr, das in Deutschland alles verändert und die Welt in eine unvergleichliche Katastrophe geführt hatte. Wie mochte sein Vater diese Zeit erlebt haben?
Martin schlug die Kladde wieder auf und las die ersten Seiten. Sofort war er gefangen von dem, was sein Vater dort schrieb. Er rieb sich mit der Hand über die Koteletten und fuhr sich dann über die kurzen, dunklen Haare. Das machte er immer, wenn er auf ein Thema stieß, das ihn interessierte. Die Handschrift seines Vaters konnte er gut lesen. Die Tagebücher stammten aus der späten Jugend seines Vaters. Ein kurzer Blick auf die ersten Seiten genügte, dann war ihm sofort klar, dass er die Sachen behalten würde. Nicht in erster Linie, weil ihn die intimen Gedanken seines Vaters interessierten. Solche seltenen Zeitdokumente waren ein besonderer Schatz. Und als Journalist interessierte er sich für Dokumente aus vergangenen Zeiten, von denen er sich neue Erkenntnisse erhoffte – und vielleicht neue Geschichten, die er schreiben konnte.
Er sah auf die Uhr. Halb neun am Abend. Für heute reichte es. Melanie wartete bestimmt schon. Martin Tesche packte die Tagebücher in einen kleinen Karton und machte sich auf den Heimweg.
Der nächste Tag verlief zunächst routiniert, nur dass Martin noch die zusätzliche Arbeit bewältigen musste, die gestern liegen geblieben war. Dazu gehörte eine Geschichte über den Alltag von Krankenhauspflegern, einige kurze Berichte über die letzte Stadtratssitzung und die Planung weiterer Reportagen. Er kam erst nach 20 Uhr nach Hause, aber da seine Frau Melanie heute ihren Chorabend hatte, spielte es keine Rolle, da niemand auf ihn wartete.
Martin aß eine aufgebackene Tiefkühlpizza, öffnete einen Acolon-Wein, dann setzte er sich bequem hin und blätterte in drei ausgewählten Tagebüchern seines Vaters. Schließlich entschied er sich wieder für die Lektüre des Jahres 1933 – in diesem Jahr war sein Vater aus Deutschland geflohen, weil er mit den Sozialdemokraten sympathisierte und es für seinesgleichen gefährlich wurde. Erst nach dem Krieg war er zurückgekehrt. Früh schon hatte sein Vater dem kleinen Martin erzählt, was in Deutschland damals passiert sei und warum er das Land verlassen habe. Als Martin noch zu jung war, um die politischen Zusammenhänge zu verstehen, hatte sein Vater ihm erzählt, dass damals ein böser Zauberer in das Land gekommen sei und alle Menschen verhext habe. 1933 – das Jahr des Hexers …
Martin schlug das Tagebuch auf und las:
1. März 1933
Gestern für das Abitur gelernt, den Faust noch mal gelesen und endlich auch die Mathematik begriffen. Ich will es schaffen und Literaturprofessor werden, immer noch. Aber was bedeutet die neue Zeit, in der wir jetzt leben, für meine Zukunftsplanung? Wird freies Denken bald noch erlaubt sein?
Der Reichstag hat gebrannt. Die Kommunisten sollen es gewesen sein. Ich habe das keinen Moment geglaubt. Hitler und seine Schreckgespenster waren es doch selbst. Ich schreibe hier kein Buch für die Nachwelt, muss aber doch meine Erschütterung niederschreiben.
Martin war fasziniert von der Authentizität dieser Worte. Das hier war nicht vergleichbar mit den Geschichtsbüchern, die er bisher zum Thema gelesen hatte. Das Tagebuch zeigte doch, dass sich die großen geschichtlichen Ereignisse nicht einfach nur unter Hitler, Hindenburg und Mussolini abgespielt hatten, sondern auch bei den Individuen, beim einfachen Volk. Und dass Johannes Tesche selbst ein Teil dieser großen Geschichte gewesen war, die bis zu ihm, Martin, nachwirkte. Hier bekam er einen viel tieferen Einblick in das, was sein Vater gefühlt und gedacht hatte, als er von der Welle der Machtergreifung Hitlers überrollt worden war – als junger Mensch, der Pläne hatte und sich plötzlich, über Nacht, in einer Zeit wiederfand, die alles infrage zu stellen schien.
Martin wusste natürlich eine Menge über seinen Vater und seine Vergangenheit. Johannes Tesche floh zunächst nach Dänemark, später schaffte er es dann in die USA, wo er bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs blieb und sich mit Gelegenheitsjobs durchschlug. Im Krieg hatte er nie gekämpft, auch nicht gegen die Deutschen. Er sei froh gewesen, dass er im Krieg nie einen Menschen habe töten müssen, hatte er immer wieder mal gesagt. Johannes Tesche war kein Mitläufer gewesen, er hatte von Anfang an gegen das Nazi-Regime rebelliert und war mit gerade mal achtzehn Jahren im Exil auf sich allein gestellt gewesen – dafür hatte Martin seinen Vater bewundert. Für ihn war Johannes Tesche immer ein Held gewesen, weil er sich nicht hatte gleichschalten lassen.
Martin schenkte sich noch ein Glas Wein ein und las weiter, bis er zutiefst erschüttert die Kladde zuschlug und die Welt nicht mehr verstand.
Kurz darauf kam seine Frau Melanie zurück.
»Hallo Schatz, wie war dein Abend?«, fragte sie und gab ihm einen Kuss.
Martin umarmte seine Frau stumm, streichelte ihre glatten, blonden Haare und fragte nach ihrem Abend. Melanie erzählte von den Schwierigkeiten, die der neu einstudierte Mozart-Kanon »Cantate Domino« bereitet habe, und von einem schwierigen Kundengespräch, das sie heute Nachmittag in der Bank, in der sie arbeitete, geführt habe.
Martin nickte immer wieder, hörte aber kaum zu und sagte schließlich, dass er müde sei.
Am späten Vormittag des nächsten Tages traf sich Martin Tesche in einem Café mit einem Philosophiedozenten, der eine Praxis für Lebensberatung eröffnen wollte. Martin wollte ein Portrait über den Mann schreiben. Er zeichnete das Interview mit einem Diktiergerät auf, und der Philosoph redete viel zu lange. Als das Interview nach fast zwei Stunden endlich beendet war, blieb Martin noch allein im Café sitzen, bestellte sich zum Mittagessen einen Salat und holte das Tagebuch aus seiner Tasche. Er las noch einmal die Seite, mit der er seine Lektüre gestern beendet hatte, als könnte er nicht glauben, was da stand.
17. September 1933
Die Flucht nach Dänemark ist mir tatsächlich gelungen. Diese grausame Diktatur. Ich sollte mich glücklich schätzen, dass ich noch lebe. Aber die Gespenster lassen mich nicht einfach los. Manchmal kommt es mir vor wie ein böser Traum, und dann wache ich auf und realisiere, dass mein Freund nun wirklich tot ist. Vor gerade einmal zwei Wochen haben wir ihn alle im Wald begraben, um die Leiche spurlos verschwinden zu lassen, und niemand hat ihn bisher gefunden.
Einige glauben an einen Unfall. Einige glauben, er ist untergetaucht. Aber niemand ist bisher auf die Idee gekommen, dass er ermordet worden sein könnte. Mord, die Todsünde der Zivilisation. Mord an einem Freund. Und doch weiß ich, dass es richtig war.
Ich vermisse Gerda.
Immer wieder las Martin diese eine Zeile:
Niemand ist auf die Idee gekommen, dass er ermordet worden sein könnte. Was hatte das zu bedeuten?
Mord an einem Freund. Und doch weiß ich, dass es richtig war.
Diese Worte gingen Martin immer wieder durch Mark und Bein. Sein Vater war ein Mörder?
Martin las die letzte Seite noch einmal.
Dass sein Vater den Mord selbst begangen hatte, ließ sich nicht eindeutig aus dem Tagebucheintrag feststellen. Aber es ließ sich auch nicht ausschließen.
Eine Erinnerung stieg in ihm auf. Er war ungefähr sechs Jahre alt und ging mit seinem Vater an einem Sommertag im Wald spazieren. Plötzlich sahen sie auf dem Weg einen Vogel liegen, dessen Flügel so verletzt war, dass er nicht fliegen konnte. Sein Vater nahm das Tier behutsam auf den Arm, und sie liefen zum Tierarzt, der den Vogel versorgte und bei sich behielt. Am nächsten Morgen erkundigte sich sein Vater telefonisch nach dem Tier, und dann teilte er Martin mit, dass der Vogel am Morgen gestorben sei. Martin hatte angefangen zu weinen und gesagt, dass alles umsonst gewesen sei, aber sein Vater hatte ihm gesagt, dass es nicht umsonst gewesen sei, denn der Vogel habe noch einen Tag länger gelebt, und jeder Tag, den man lebe, sei wertvoll.
Jetzt bröckelte das Bild von seinem Vater, den er immer so bewundert hatte. Der sich für andere einsetzte, nach hehren Werten lebte, der bei vielen Menschen so beliebt gewesen war.
Martin trank seinen dritten Kaffee, dann fuhr er in die Redaktion, schrieb zwei Artikel und machte für heute pünktlich Feierabend.
Beim Abendessen weihte er Melanie in das ein, was er in dem Tagebuch gelesen hatte. Sie hörte ihm ruhig zu und fragte: »Und was glaubst du?«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater je einen Menschen getötet hat«, sagte Martin.
»Ich mir auch nicht«, sagte Melanie.
Dann verzog Martin sein Gesicht wie jemand, der im nächsten Moment in Tränen ausbricht, und schließlich platzte es aus ihm heraus, und er heulte dazu wie ein Kind: »Aber er schreibt eindeutig, dass er eine Leiche beseitigt hat. Die Leiche eines Freundes. Mein Vater, Melanie. Mein Vater vergräbt doch keine Menschen im Wald!«
Melanie stand auf und nahm ihren Mann sanft in den Arm. Schweigend durfte er sich ausweinen. Als er ruhiger wurde, streichelte sie seinen Kopf und sagte: »Das Tagebuch hat dich sehr erschüttert, nicht?«
»Ja«, flüsterte Martin.
»Du solltest nachforschen, es lässt dir ja sonst doch keine Ruhe.«
Melanie hatte recht. Melanie kannte es von Martin, dass er als Journalist oft bis spät am Abend über seine Reportagen, an denen er schrieb, nachdachte und ihr von seinen Geschichten, an denen er arbeitete, erzählte. Sie war eine geduldige Zuhörerin und akzeptierte es, dass Martin nicht abschalten konnte, wenn er für ein Thema brannte.
»Wie soll ich das anstellen? Ich kann ihn ja wohl kaum mehr fragen«, gab er zu bedenken.
»Du bist doch der Journalist, Martin. Es müssen sich doch in den Tagebüchern weitere Hinweise finden lassen, ob Johannes diesen Mord wirklich begangen hat oder ob er nur darin verwickelt war. Und was wirklich passiert ist.«
Martin nickte. »Und vielleicht finden wir in den Büchern auch Hinweise auf andere Menschen, die darüber etwas wissen könnten.«
»Wir?«
»Ja, wir. Hilfst du mir dabei, Melanie? Wir könnten uns die Tagebücher aufteilen und gemeinsam darin lesen.«
»Wenn du das möchtest und du mir vertraust, dass ich in das Leben deines Vaters eintauchen darf, helfe ich dir gerne. Lass uns gleich damit anfangen.«
Gegen Mitternacht hatten sie vier Tagebücher durchgelesen. Hinweise auf den Mord gab es kaum, nur immer wieder einzelne Einschübe wie heute Nacht wieder von dem Toten geträumt, ich kann seine toten Augen nicht vergessen oder ich denke weniger an diese Nacht, aber ganz vergessen kann ich es nicht. Aber keine Hinweise auf den Täter oder auf das Opfer.
Verdammt, dachte Martin, wenn er sich so vage zu der Tat äußerte, konnte man das auch schon fast als Bekenntnis werten. Wollte sein Vater nicht mehr dazu schreiben, weil ihn das Gewissen so quälte? Oder weil er Angst hatte, dass die Tagebücher gefunden werden und ihn belasten könnten?
An anderer Stelle schrieb er: Es ist kaum vorstellbar, dass man fast 19 Jahre jung ist und das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann, schon hinter sich hat.
Melanie hatte schließlich festgestellt, dass ein Name immer wieder auftauchte: Gerda. An einer Stelle erwähnte Johannes sogar ihren vollen Namen: Gerda Steinjans.
»Dieses Mädchen scheint ihm damals viel bedeutet zu haben«, sagte sie. »Hat er dir je von ihr erzählt?«
»Nein.«
»Sie hatten wohl eine innige Beziehung«, sagte Melanie. »Wie alt war dein Vater 1933?«
»Achtzehn …«
»Hier schreibt er: Gerda, wo bist du gerade? Ich muss immerzu daran denken, wie du in der Nacht, als wir in der Höhle waren, deine Unschuld verloren hast.«
Martin musste schmunzeln. »Mein Vater war also auch mal jung … Melanie, was tun wir hier? Wir lesen im Tagebuch meines alten Herrn, wie er mit achtzehn ein Mädchen zur Frau gemacht hat.«
»Vielleicht lebt sie noch«, sagte Melanie.
»Ja, vielleicht«, stimmte Martin zu. »Und mit ein bisschen Glück sogar noch in der Stadt, in der mein Vater damals gelebt hat.«
»Ruf doch morgen früh bei der Auskunft an und frag, ob es eine Gerda Steinjans in Wuppertal gibt«, fuhr Melanie fort.
»Ja, und dann? Soll ich dann einfach hinfahren und sagen: Entschuldigen Sie, mein Vater, der vor zwei Wochen gestorben ist, hatte Ihren Namen vor sechzig Jahren in einem Tagebuch erwähnt. Und übrigens: Wissen Sie, ob ein gewisser Johannes Tesche 1933 einen Mord begangen hat?«
»Du wirst das Gespräch schon feinfühliger führen können. Aber sie ist vielleicht die Einzige, die dir die wahre Geschichte zu dem Mord erzählen kann.«
»Schatz, ich weiß nicht …«
»Ich weiß, du hast Angst. Die hätte jeder an deiner Stelle. Aber wenn du es nicht versuchst, wird dir die Geschichte auch keine Ruhe lassen. Oder?«
Martin sah seine Frau liebevoll an und streichelte ihr Knie. »Nein, wird sie wohl nicht.« Er gab ihr einen Kuss. »Ich überleg’s mir. Und jetzt lass uns schlafen gehen.«
Natürlich musste Martin es sich nicht überlegen. Das war ihm sofort klar, als er am nächsten Morgen aufstand. Melanie hatte völlig recht. Er hatte gar keine Wahl, weil ihn zwei Motive antrieben: Als Sohn konnte er es nicht einfach auf sich beruhen lassen, ob und inwieweit sein Vater vor sechzig Jahren in einen Mord verwickelt war. Und als Journalist hatte er im Laufe seines Berufslebens eine so instinktive Neugier entwickelt, dass er gar nicht anders konnte, als einer Geschichte nachzugehen, wenn er auf eine gestoßen war. Und das hier war eine Geschichte, die sich hinter den Tagebüchern seines Vaters verbarg. Trotz der Angst, etwas über seinen Vater zu erfahren, was er vielleicht gar nicht wissen wollte, hatte Martin die Hoffnung, dass es zur bestmöglichen Wendung kommen würde: Er würde herausfinden, dass sein Vater kein Mörder war und es eine gute Erklärung für das gab, was er in seinen Tagebüchern gefunden hatte – und er würde am Ende vielleicht sogar eine Geschichte dazu erzählen können. Er zog sich an und fuhr ohne Frühstück zu seiner Zeitung.
In der Redaktion arbeitete er nur am Vormittag und rief nebenbei die Auskunft an. Tatsächlich gab es den Namen Steinjans mehrmals in Wuppertal, und tatsächlich hieß eine der Personen, die ihm die Dame von der Telefonauskunft nennen konnte, Gerda mit Vornamen. Neben der Telefonnummer konnte ihm auch ein Straßenname mitgeteilt werden: Im Vogelsholz 114. Auch wenn Martin sich nicht sicher sein konnte, dass es sich tatsächlich um dieselbe Gerda Steinjans handelte, die im Tagebuch seines Vaters erwähnt wurde, hatte er das untrügliche Gefühl, einen Volltreffer gelandet zu haben. Der Name Steinjans war nicht ganz alltäglich, der Name Gerda passte eher zu einer älteren als zu einer jüngeren Frau, und dass sie in Wuppertal lebte, war auch ein Indiz, dass es sich um die Frau handelte, die sein Vater gekannt hatte. Martin beschloss, gleich vor Ort der Sache auf den Grund zu gehen, anstatt diese Gerda Steinjans zunächst anzurufen. Er hatte Sorge, am Telefon abgewimmelt zu werden. Dann meldete er sich beim Ressortleiter ab, um auf Recherchetour zu gehen, ohne schon genau zu sagen, worum es ging. Er hatte sich als Redakteur einen gewissen Status erarbeitet, sodass er es sich leisten konnte, sich so davonzuschleichen. Er sagte seinem Vorgesetzten nur, dass er einer brisanten Story auf der Spur sei, aber dem Informanten bisher größte Verschwiegenheit zugesichert habe. Ein Teil seiner Angaben stimmte ja sogar. Dann setzte er sich in seinen Vectra, fuhr auf die Autobahn in Richtung Köln und dann weiter nach Wuppertal.
Die Fahrt dauerte eine gute Stunde. Unterwegs hatte er sich an einer Raststätte einen Straßenplan von Wuppertal besorgt. Er war nur ein Mal dort gewesen, und zwar als Student. Den Vater hatte es, soweit Martin wusste, nie in seine Geburtsstadt getrieben. Stattdessen war Johannes Tesche in der Eifel sesshaft geworden, und als Martin ihn mal gebeten hatte, mit ihm nach Wuppertal zu fahren, um ihm die Stadt zu zeigen, in der Johannes Tesche aufgewachsen war, hatte dieser nur abgewehrt und erklärt, dass Wuppertal keine schöne Stadt sei, völlig verdreckt und heruntergekommen, und dass man sich den Weg sparen könne. Martin war dann irgendwann mal allein nach Wuppertal gefahren. Die Schwebebahn machte diese Stadt interessant, aber ansonsten wusste Martin auch nicht, was er von Wuppertal halten sollte. Viele Häuser in der Talachse, die er während seiner Schwebebahn-Tour gesehen hatte, waren grau, aufgewertet wurde die Stadt hingegen von den vielen grünen Hügeln.
Heute führte es ihn in den Stadtteil Ronsdorf, wie er dem Plan entnehmen konnte. Ronsdorf lag am Rande der Stadt, weitab von der Talachse, eine Kleinstadt in der Großstadt mit vielen bergischen Schieferhäusern. Hier sah es ganz anders aus, als er die Stadt in Erinnerung hatte. Die Straße Im Vogelsholz lag auf der Mitte eines Hügels. Vor einem alten Fachwerkhaus mit der Nummer 114 hielt Martin an, stieg zügig aus und drückte auf die Klingel, um es sich nicht noch anders zu überlegen.
Eine Frau mit gepflegten, grauen Haaren öffnete die Tür. Sie musste Mitte siebzig sein und hatte ihre Schönheit über all die Jahre bewahrt. Als sie Martin sah, hielt sie sich erschrocken die Hand vor den Mund.
»Johannes!«, flüsterte sie. »Mein Gott, Johannes!«
Martin nickte verlegen. »Ich bin sein Sohn.«
Die Frau sah ihn immer noch entgeistert an.
»Sind Sie Gerda Steinjans?«
Die Frau atmete tief ein und aus, um sich wieder zu fassen. Dann nickte sie. »Entschuldigen Sie, junger Mann. Sie sind der Sohn von Johannes Tesche? Sie sehen Ihrem Vater so unheimlich ähnlich. Sie sehen genauso aus wie er.«
»Ich muss mich entschuldigen, dass ich so mit der Tür ins Haus falle …«
»Wie geht es ihm?«, unterbrach ihn Gerda Steinjans.
»Er … er ist kürzlich verstorben.«
»Oh …« Sie blickte zu Boden. »Mein Beileid, junger Mann.« Dann sprach sie eher zu sich selbst: »Er hat also all die Jahre überlebt …«
»Ja, das hat er. Sie haben also lange nichts mehr von ihm gehört?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, seit … vielleicht seit dem Krieg? Nein, schon viel länger. Aber es war notwendig, dass er untertauchte …«
Martin witterte eine Chance. »Ich weiß. Soll ich Ihnen erzählen, wie es ihm ergangen ist?«
Gerda Steinjans stand mit nachdenklichem Blick im Türrahmen. Dann sagte sie: »Kommen Sie rein, Herr Tesche. Möchten Sie einen Kaffee?«
Martin sah sich in dem gemütlichen Wohnzimmer mit den vielen Holzbalken, die wie altehrwürdige Säulen aus den Wänden ragten, um, während Gerda in der Küche verschwand. Auf dem Parkettboden lag ein blau gemusterter, orientalischer Teppich, der sofort ins Auge fiel. An der Wand hinter dem Sofa hing ein abstraktes Bild von einem Künstler, den Martin nicht kannte. Grüne und rote Farben gingen ineinander über in Formen, die für Martin nichtssagend waren. Kurz darauf kam Gerda Steinjans mit zwei Tassen und einem Teller mit Plätzchen zurück.
»Warum sind Sie noch gleich hergekommen, junger Mann?«
»Mein Vater hat Sie mehrmals in seinen Tagebüchern erwähnt. Er schien Sie sehr gemocht zu haben, aber er hat nie von Ihnen erzählt. Ich dachte … ich dachte … ich weiß auch nicht, ich bin noch ganz durcheinander von seinem Tod. Vielleicht will ich einfach noch etwas über ihn wissen, auch, um die Erinnerung wachzuhalten. Und ich dachte, vielleicht haben Sie ein Recht darauf, von seinem Tod zu erfahren, wenn Sie ihm mal wichtig waren. Ich könnte Ihnen von ihm erzählen und Sie mir von ihm. Ich möchte mich einfach noch ein wenig mit ihm beschäftigen. Ich denke, man nennt das Trauerarbeit, verstehen Sie?«
»Was könnte ich Ihnen denn von ihm erzählen, was Sie nicht wissen?«, fragte Gerda Steinjans in einem Tonfall, den Martin schwer einordnen konnte.
Er redete weiter: »Es ist schwer zu glauben, dass er nicht mehr da ist. Er hatte einen Herzinfarkt. Es kam so plötzlich. Er war immer gesund.«
»Er war ein guter Mensch«, sagte Gerda Steinjans. »Sie sehen aus wie er. Ich habe viel Zeit in meiner Jugend mit ihm verbracht. Wir waren enge Freunde. Und dann ist er vor den Nazis ins Ausland geflohen. Er war im Herzen Sozialist.« Sie reichte Martin den Teller mit Keksen.
»Ich weiß«, sagte Martin. »Davon hat er viel erzählt. Ich war immer stolz darauf, dass er kein Mitläufer war. Er hat alles richtig gemacht und sich schon 1933 abgesetzt, zunächst nach Dänemark, dann in die USA.«
»Hat er es also in die USA geschafft?«
»Sie hatten wirklich keinen Kontakt mehr, seit er geflohen ist?«
»Nein, ich wusste, dass er raus aus Deutschland musste, und ich wusste, dass es ein Abschied für immer sein könnte, auch wenn ich immer gehofft habe, ihn irgendwann noch mal wiedersehen zu können.«
»In Amerika hat er sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs durchgeschlagen, bis der Krieg zu Ende war. Und er hat seine erste Frau dort kennengelernt, Linda.«
Gerdas Blick wurde kurz starr, dann lächelte sie ihn an. »Reden Sie weiter!«
»Sie sind nach dem Krieg zusammen nach Deutschland gekommen, haben geheiratet, während mein Vater Germanistik in Frankfurt studiert hat. Aber die Ehe hat nicht lange gehalten. Linda hatte Heimweh nach Amerika und ging ohne meinen Vater zurück. Nach dem Studium hatte mein Vater eine Stelle an der Frankfurter Uni, dann bekam er eine Professur in Bonn, heiratete meine Mutter und kümmerte sich viel um mich, als sie an Krebs starb – da war ich zehn Jahre alt. Nebenbei engagierte er sich immer wieder politisch, forschte über Kriegs- und Nachkriegsliteratur, schrieb ein Buch über Paul Celan, und als er emeritiert wurde, schrieb er weiter Bücher und genoss es, in der Natur spazieren zu gehen. Er lebte bis zu seinem Tod in der Eifel.«
»Ja, das kann ich mir vorstellen, dass er sich in der Eifel wohlgefühlt hat.«
»Er ist in seiner Jugend auch viel gewandert, nicht?«
»Ja …« Gerda Steinjans wirkte für einen Moment geistesabwesend, als würde sie sich in Erinnerungen verlieren.
»Er hatte eine Wandervogel-Gruppe«, fuhr Martin fort. »Waren Sie auch dabei?«
»Der Wandervogel war damals hochbrisant«, sagte Gerda Steinjans. »Ja, ich war auch dabei. Wir waren nur eine kleine Gruppe. Ihr Vater, ich, dann noch Georg, Friedrich und … wie hieß der andere noch gleich?« Sie dachte nach. »Jetzt habe ich den Namen vergessen … Sie wissen, was der Wandervogel war?«
»Eine Wanderbewegung. Jugendliche, die die Natur wiederentdeckten …«
Gerda Steinjans lächelte. »Damals war das eine sehr populäre Bewegung. Die Städte wurden immer dreckiger. Überall Fabriken und Schornsteine. Auch hier in Wuppertal. Aber zum Glück hatten wir ja immer viel Natur drumherum. Sie sind nicht von hier, oder?«
»Nein.«
»Wissen Sie, dass Wuppertal eine der grünsten Städte Deutschlands ist? Wir wollten raus aus der Stadt, die Natur genießen, die wir hier in so vielen Ecken haben. Wir waren als Schüler begeistert von der Romantik, lasen mit Vorliebe Gedichte und Romane von Eichendorff, Tieck, aber auch von Hermann Hesse. Natur war für die Wandervögel nicht nur eine Umgebung, sondern ein Zuhause. In den Wäldern fühlten wir uns frei und glücklich. Alles war weit weg. Die Stadt, die Sorgen und …«
»Und was?«
Gerda Steinjans stockte, rührte in ihrem Kaffee und fuhr fort: »Ach nichts! Wir machten auch Musik in der Natur, sangen derbe Volkslieder. Johannes spielte dazu auf seiner Waldzither. Wir waren nicht einfach eine Wanderbewegung. Wir entwarfen eine eigene Lebensart. Wenn wir draußen in der Natur waren, spürten wir eine grenzenlose Freiheit. Obwohl Nazi-Deutschland gerade begonnen hatte und die Menschen in unsichtbare Ketten gelegt wurden. Wir glaubten, das könnte uns nichts anhaben, und lebten unser eigenes Leben. Streiften gesellschaftliche Konventionen ab wie Kleider. In den Wäldern konnten wir sein, wer wir sein wollten.«
»Das war der nationalsozialistischen Bewegung wohl ein Dorn im Auge …«
»Das können Sie laut sagen. Die Nazis haben versucht, alle Jugendbünde in die HJ einzugliedern. Was wir aber nicht mit uns machen ließen. Wir dachten damals noch, dass wir uns so einfach gegen die Ideen Hitlers wehren konnten. Wir waren sehr naiv.«
Martin hatte das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen war, um mehr über den Vorfall aus dem Tagebuch zu erfahren. »Wurde Ihre Bewegung gewaltsam zerschlagen?«
Gerda Steinjans lächelte amüsiert. »Nein, Herr Tesche, dafür waren wir eine zu kleine Gruppe. Unsere Ideen passten zwar nicht mit dem völkischen Wahn zusammen, aber letztendlich waren wir zu unbedeutend für die Nazis.«
»Aber die HJ trat doch schon aggressiv auf? Es gab nie Auseinandersetzungen mit denen?«
»Wir wurden von denen schon mal provoziert. Mehr nicht.«
Hatte der Mord, der in dem Tagebuch erwähnt wurde, mit dieser Wandervogel-Bewegung zu tun? Gab es vielleicht einen tödlichen Konflikt mit der Hitlerjugend? Martin fuhr fort: »Das ging ja für einige in dieser Zeit nicht so glimpflich aus. 1933 gab es doch regelmäßig Straßenkämpfe zwischen roten und braunen Jugendlichen. Gerade auch hier in Wuppertal.«
»Ja, in Wuppertal hatten es die Nazis anfangs schwer. Sehr sozialistisch geprägt, unsere Stadt …«
»Manche Straßenkämpfe endeten auch tödlich, habe ich gehört«, warf Martin ein.
»Davon habe ich auch gehört.«
»War mein Vater mal in so einen Kampf verwickelt?«
»Nicht dass ich wüsste. Er kämpfte lieber mit Worten als mit Fäusten.«
»Sind Sie sicher …?«
»Was wollen Sie eigentlich?«, fuhr Gerda Steinjans ihn plötzlich an. »Irgendwas führen Sie doch im Schilde. Ich fühle mich gerade wie in einem Verhör. Sie verschaffen sich hier Eintritt, lassen mich vom Wandervogel erzählen, dann plötzlich reden wir über Straßenkämpfe und Tote. Was soll das?«
Martin antwortete nicht, fuhr sich mit der Hand durch die Scheitelfrisur und blickte beschämt zu Boden. Sie hatte ja recht. Eigentlich stand es ihm nicht zu, einfach als Wildfremder in ihr Haus einzudringen und sie in ein Gespräch zu verwickeln, ohne dass sie wusste, worauf er hinauswollte. »Es tut mir leid, Frau Steinjans, ich hätte es Ihnen gleich sagen sollen. Ich bin hergekommen, weil ich eigentlich nur eine einzige Frage an Sie habe. Es ist wichtig für mich, darauf eine Antwort zu finden.«
»Und die wäre?«, fragte Frau Steinjans, die immer noch aufgebracht war.
Martin holte tief Luft, dann fragte er: »Hat mein Vater 1933 einen Menschen getötet?«
Gerda Steinjans stellte ihre Tasse ab. Sie starrte ihn mit weit geöffneten Augen an. »Wie kommen Sie darauf?«, flüsterte sie.
»Ich habe in den letzten Tagen sein Haus ausgemistet und seine Tagebücher gefunden. Darin deutet er an, dass er in einen Mord verwickelt war.«
»Nein …«
»Vielleicht war er auch selbst gar nicht der Täter, sondern hat nur Beihilfe geleistet. Seine Worte sind nicht eindeutig. Er hat nie mit mir darüber gesprochen. Ich habe zufällig in seinen Tagebüchern geblättert, weil ich fasziniert von dem Einblick in die damalige Zeit war, und dann fand ich plötzlich diese Andeutung.«
»Sie waren fasziniert von dieser Zeit? Junger Mann, Sie wissen doch gar nichts. 1933 war alles andere als faszinierend. Es war der Beginn eines finsteren Tals, aus dem es zwölf Jahre kein Entkommen gab. Wir dachten anfangs, wir könnten trotzdem noch frei sein, aber eigentlich waren wir es nie. Und wie kommen Sie dazu, die Tagebücher Ihres Vaters zu lesen? Tagebücher sind privat, egal, ob der Verfasser noch lebt oder nicht. Was wissen Sie noch über mich?«
Martin fühlte sich wie ein kleiner Junge, der etwas ausgeheckt und dabei ein Geheimnis entdeckt hat, das er gar nicht erfahren durfte. »Bitte, Frau Steinjans, wissen Sie irgendetwas darüber? Irgendwas muss doch damals passiert sein? Und wenn Sie so eng mit meinem Vater befreundet waren, hat er Ihnen doch sicher etwas erzählt. Ich muss wissen, ob mein Vater ein Mörder war. Ich muss!«