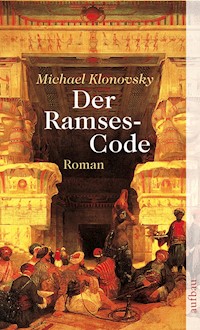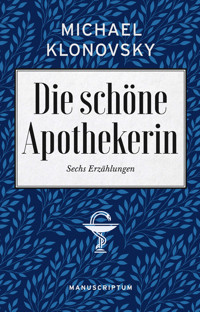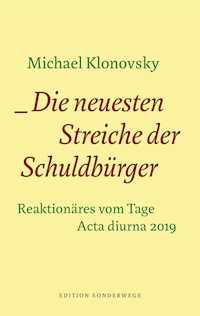5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diederichs
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mann, Du hast es nicht leicht. Von Natur aus Jäger, Sammler und Verführer bist Du seit 68ff., Feminismus und Patchmurks völlig ortlos. Du bevölkerst Spielplätze, liest Ratgeber und gehst in Elternzeit. Soziologen bezeichnen Dein Befinden als „postheroisch“. Anders gesagt: Du bist ein Weichei, ein Selbsterfahrungskrüppel.
Was ist aus dem guten, alten Helden geworden? Dem Vater Courage, der nicht zuallererst an sich und sein Wohlbefinden denkt? Rückgrat, Mut, Leidenschaft - Werte wie diese sind zäher als vermutet. Und sogar wieder en vogue. Darf/soll Mann also wieder männlich sein?
Der Journalist und Publizist Michael Klonovsky geht in seinem Essay diesem Thema auf den Grund. Sein Credo lautet: Der Held ist tot. Es lebe der Held.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Für Lena
Inhaltsverzeichnis
»Ob gut oder böse: Held bleibt Held.«
La Rochefoucauld [REF 1]
»Der Himmel erhalte dich, wackres Volk, Er segne deine Saaten, Bewahre dich vor Krieg und Ruhm, Vor Helden und Heldentaten.«
Heinrich Heine
VORBEMERKUNG
DIE TATSACHE, DASS ES KEINE HELDEN MEHR GIBT, ist leicht daran festzumachen, dass mir niemand einen zeigen kann. Selber noch mit Heldensagen aufgewachsen, erscheint es mir jedenfalls auf rein empirische Weise vollkommen einleuchtend, dass deren Personal ausgestorben sein muss. Wir leben in einem Zeitalter der Talkshows, der Partnerschaftsprobleme, der Feinstaubgrenzwerte, der Reiserücktrittsversicherungen und der Verbraucherrechte. Ein Held, wie weit man den Begriff auch fassen mag, hat hier nichts verloren. Ein Held würde keinen Helm aufsetzen, bevor er durch die Fußgängerzone radelt. Ein Held würde sich keinen Anwalt nehmen, weil der Nachbar zu laut Musik hört. Ein Held würde sich nicht zum Pinkeln hinhocken. Ein Held würde weder an Diskussionsrunden teilnehmen noch sich welche im Fernsehen anschauen. Ein Held würde sich nicht gegen Glasbruch versichern. Ein Held wäre weder »teamfähig« noch »demotiviert«. Ein Held würde Freiheit definieren als die Möglichkeit, sich frei einen Herren zu wählen. Ein Held hielte seine Gene für prädestiniert, das Abenteuer der Evolution auch fortan zu bestehen. Ein Held würde seine Frau, seine Familie, sein Land und seine Ehre verteidigen, ohne auch nur einen Lidschlag lang an seine Gesundheit und sein berufliches Fortkommen zu denken. Ein Held würde für seine Freunde ohne viel Federlesens Kopf und Kragen riskieren. Ein Held würde seine Überzeugungen nicht abhängig davon machen, ob sie mehrheitsfähig sind, und auch dem Agamemnon seine Meinung sagen. Ein Held würde sich kein virtuelles Alter Ego verschaffen, das ano- oder pseudonym im Internet herumkrakeelt. Ein Held hätte keinen »Lifestyle« und würde die Demoskopen vor erhebliche Einsortierungsprobleme stellen. Alles in allem: Ein Held wäre letztlich ein Fall für den Psychologen und sogar die Polizei.
Aber, gottlob, es gibt ja keine Helden mehr. Nicht nur, dass mir selber nichts Heldisches eignet; auch in meiner Umgebung wollte sich im Laufe vieler Jahre nicht die Nasenspitze eines heroischen Menschen zeigen. »Umgebung« schließt hier durchaus jene durch die Medien vermittelte ein. Die große Ausnahme waren jene Männer, die als Rettungsmannschaften zu den Unglücksreaktoren von Fukushima aufbrachen und damit das Risiko des Strahlentods auf sich nahmen. Als sie sich vor den Kameras verneigten, sah ich das erste Mal in meinem Leben Zeitgenossen, über die man in Hexametern schreiben könnte. Dabei läuft gerade in den Medien der permanente Versuch, Helden oder zumindest sogenannte Lichtgestalten zu konstruieren, allerdings in der Regel nur, um sie ein paar Tage später wieder abzuräumen und in ihrer allzumenschlichen Erbärmlichkeit vorzuführen. Eine hier schon mal in den Raum gestellte Frage lautet, ob dieses Abräumen mit Otto von Bismarck genauso leicht gelungen wäre wie mit Guido Westerwelle, mit Nofretete ebenso wie mit Britney Spears. Es liegt zumindest der Verdacht nahe, dass irgendein globales Verzwergungsprogramm läuft. Halten wir zunächst fest: Die Versorgung mit Helden lässt zu wünschen übrig.
Nun kann man sich dazu auf verschiedene Weise verhalten. Man kann diesen Umstand bedauern oder gar beklagen. Man kann ihn gutheißen. Man kann ihn auch rundweg bestreiten und die heroische Potenz des Menschen zur historisch relativ konstanten Gegebenheit erklären. Umgekehrt kann man bestreiten, dass es überhaupt jemals Helden gegeben habe, und alle Berichte über diesen Typus ins Reich der Legenden verweisen. Man kann den Märtyrer zum einzigen wirklichen Helden erheben, gerade im christlichen beziehungsweise restchristlichen Kulturkreis (beziehungsweise Restkulturkreis), wobei dieser Kulturkreis derzeit bekanntlich von aggressiven Märtyrern punktuell angegriffen wird, denen man dann ebenfalls einen gewissen Heldenstatus zubilligen müsste, es sei denn, man einigte sich a priori darauf, dass Heroismus primär vom »richtigen« Motiv abhinge. Ohnehin, unterstelle ich, wird eine Mehrheit von Zeitgenossen mit zweierlei Maß messen und eine mutige Tat nicht als Heldentat akzeptieren, wenn sie nicht von aus ihrer Sicht edlen Absichten motiviert wurde. Wir werden also auf eine gewisse Dehn- und Wandelbarkeit des Heldenbegriffes stoßen, quer durch die Zeiten und Völker, wenngleich unsere Zeit die erste sein dürfte, die sich vom Helden generell zu verabschieden gedenkt, zumindest in einem Teil der Welt.
Parallel dazu findet eine Abdankung des Mannes beziehungsweise der Männlichkeit statt. Beide Phänomene hängen selbstredend zusammen, weshalb dem Schrumpfmann ein gesondertes Kapitel gewidmet ist.
Diese Betrachtung geht von der Prämisse aus, dass die Helden in unserem Weltteil ausgestorben sind. Ihr Verschwinden wird weniger beklagt als vielmehr konstatiert. Keineswegs mag der Autor den Eindruck erwecken, die von ihm zuweilen vorgetragene Aversion gegen den heute mehrheitsfähigen Typus des flexiblen, anpassungsfähigen, charakterarmen und verantwortungsscheuen Überallhinkömmlings, der sich für ein Individualisten hält, obwohl es buchstäblich nichts gibt, wozu er eine persönliche Haltung vertritt, verbinde sich mit der Sehnsucht nach Zweikämpfen und dem Feld der Ehre. Wenn es dennoch so scheint, nun, so scheint es eben nur so.
»Die Tapferkeit ist die einzige Tugend, die sich der Heuchelei entzieht. Kein Wunder, daß sie nicht in hohem Ansehen steht.«
Johannes Gross [REF 2]
BLOSS NICHT DEN HELDEN SPIELEN!
WAS ABER WAR ODER WÄRE ÜBERHAUPT EIN HELD? Diese Frage offenbart schnell eine gewisse Relativität des Begriffes, die Abhängigkeit vom Standpunkt des Betrachters. Sie ist ohne Ambivalenzen nicht zu stellen, geschweige zu beantworten, so wie der Spötter angesichts der vielen Heldenfriedhöfe fragt, wo denn die Feiglinge lägen.
Eine halbwegs verbindliche, epochenübergreifende und wertfreie Definition könnte zunächst lauten: Ein Held ist ein Mensch, der unter Hintanstellung persönlichen Glücks und persönlichen Nutzens sein Leben für eine Sache oder für die Gemeinschaft einsetzt und manchmal sogar opfert. Dieses Sein-Leben-Einsetzen kann zehn Minuten dauern oder 60 Jahre; das unterscheidet den Situations-Helden vom »großen Mann« (es kann mitunter auch eine Frau sein). Der Held zerstört nicht, er vollbringt. Er ist der schlechthin freie Mensch und allein imstande, die unerhörte Tat auszuführen und den Status quo zu ändern.
Der Held manifestiert sich durch sein Verhältnis zum Schmerz und vor allem zum Tod. Ein Held ist ein Mensch, dem eine Sache, ein Ideal, ein Wert im Zweifelsfalle mehr gelten als das eigene Dasein. Wobei wir prompt auf das Paradoxon stoßen, dass der Held der einen der Terrorist der anderen ist. Und dem unbeteiligten Dritten mögen beide Lesarten nicht ganz geheuer sein. [REF 3], [REF 4]
Erinnern wir uns gleichwohl der berühmten Worte des Generals Pierre Cambronne, der anno 1815 bei Waterloo die Kapitulation der Kaiserlichen Garde mit dem sprichwörtlich gewordenen Satz abgelehnt haben soll: »Die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht!« (Tatsächlich hat er oder irgendein anderer wohl nur ein Wort gerufen, das auf deutsch mit Sch- beginnt.) »Und ob die sich ergibt, die Garde!«, echot es anderthalb Jahrhunderte später durch den Mund eines römischen Legionärs in »Asterix bei den Belgiern«; ein guter Witz, gewiss, doch wie sehr illustriert er den veränderten Zeitgeist!
Lieber sterben als sich ergeben oder unters Joch gehen – in den Worten des friesischen Freiheitshelden Pidder Lüng: »Lever düad üs slav« – : Diese Maxime klingt heutigen Ohren absurd. Aber sie galt vielen Menschen jahrhundertelang als unumstößlich. Wie viele davon mag es heutzutage noch geben? Und wäre eine große Zahl überhaupt wünschenswert? Schließlich sind wir frei und niemand will uns unterwerfen. Was aber, wenn? Und sind wir wirklich frei? Existieren nicht Hunderte subtile Zwänge, die den modernen Menschen fesseln und ihm die Luft nehmen wie die feinen Fädchen der Lilliputaner dem schlafenden Gulliver? Denken wir nicht daran. Der Mensch der Gegenwart hängt nicht so sehr an der Freiheit, er hängt weit mehr am Leben. Aber taten dies nicht die meisten Menschen zu allen Zeiten? »Woran soll man denn hängen, wenn nicht am Leben, wo es doch das einzige Geschenk ist, das uns der liebe Gott nicht zweimal macht?«, fragt weise die Magd Françoise bei Marcel Proust, und zwar angesichts vorbeimarschierender junger Soldaten, die angeblich nicht daran hängen. Es liegt auf der Hand, dass zum einen die meisten Menschen, vorsichtig gesagt, kein Interesse an Heldentaten haben, und dass zum anderen die friedlichen Zeiten von der Mehrheit als die glücklicheren empfunden werden. Mögest Du in großen Zeiten leben, lautet ein chinesischer Fluch. Man könnte vielleicht so formulieren: Eine Gesellschaft ist umso glücklicher, je mehr Menschen in ihr mit aller Entschiedenheit am Leben hängen. Je feiger, desto glücklicher also. In den 1980er-Jahren erschien sogar ein populärwissenschaftliches Buch unter dem Titel »Feig, aber glücklich«, das den notorischen Konfliktvermeider zum Erfolgstypus der Evolution küren wollte. [REF 5]
Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Wir sind allesamt die Nachfahren von Davonläufern – aber auch von Totschlägern. Die Mutigen mögen im Schnitt zwar eher sterben als die Hasenfüße – doch durch Konfliktvermeidung allein ist die Menschengattung nicht an die Spitze des terrestrischen Daseinswettbewerbs gelangt. Davon abgesehen, dass die Ressourcenknappheit es oft gar nicht erlaubte, einem Kampf aus dem Weg zu gehen, und die gesamte Gattung längst vertilgt worden wäre, hätten keine heroischen Männer gelebt. Überdies vollzieht sich kein Rückzug und kein Kneifen, ohne Spuren im Inneren des Ausweichers zu hinterlassen. Wirklich glücklich ist der Feige nie. Im Gegenteil: Das Bewusstsein seiner Feigheit, mag er sie auch zynisch eingestehen oder, gegen die möglichen Folgen des Mutes verrechnet, als Klugheit rechtfertigen, wird sein Selbstwertgefühl zerfressen. Das gilt übrigens für Individuen wie für Gesellschaften; Feigheit und mangelndes Selbstwertgefühl stehen stets in direktem Zusammenhang, wie unter anderem das Beispiel der Bundesrepublik zeigt.
Auch eine zur vernünftigen Maxime erhobene Konfliktscheu kann den Scheuen in erhebliche Selbstzweifel und Depressionen stürzen. Eine Gegend zu verlassen, weil es dort zu viele Raubtiere gab, hieß für unsere Altvordern ja auch, ein nahrungsreiches Gebiet aufzugeben. Vor dem feindlichen Stamm kampflos sein Land zu räumen bedeutete, es mitsamt seiner Ehre zu verlieren. Das Problem existiert heute noch, sogar rudimentär in den Wohlstandswelten des Westens, wo auch der endaufgeklärte Habermas-Leser lieber Wohngegend und Schule wechselt, wenn die Zahl derjenigen eine gewisse Grenze überschreitet, die nicht an den »zwanglosen Zwang des besseren Arguments« glauben, weil sie die robusteren Argumente und die größere Anzahl männlicher Familienmitglieder besitzen.
Für normale Bürger ist ein Teil des öffentlichen Raums nur noch mit einem gewissen Risiko betretbar. In diversen Stadtteilen herrschen Migrantengangs (»Problemjugendliche«), in anderen walten Linksextremisten (von den Medien liebevoll »Chaoten« oder »Autonome« genannt), wieder anderswo machen fremdenfeindliche Deutsche (»Neonazis«) ihre Revieransprüche geltend. In diesen Gebieten findet ein Kampf um die Straße statt, der teils ethnisch, teils politisch motiviert ist und überwiegend von Kombattanden betrieben wird, die mit dem Begriff »Zivilgesellschaft« nicht nur nichts anfangen können, sondern die sich dahinter verbergende Einstellung als Schwäche verachten. Noch sind diese Räume klein, und man kann sie meiden, noch ist die Zahl der Toten und Verletzten nicht erschreckend hoch. [REF 6]
Hin und wieder greifen die Zustände in den Problembezirken auf die besseren Gegenden über, und der »Zusammenprall der Kulturen«, den Samuel Huntington prophezeit hatte und für dessen Triftigkeit u.a. die Anwesenheit der Bundeswehr in Afghanistan zeugt, findet als lokale Miniaturversion statt. Deutschland müsse nicht nur am Hindukusch, sondern auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln verteidigt werden, sprach der CSU-Mann Peter Gauweiler, nachdem zwei ausländische Jugendliche einen vorlauten Rentner in der Münchner U-Bahn nahezu totgeschlagen hatten. Gemeinhin leugnet das Gesinnungsproduktions-Establishment die ethnische Dimension solcher Vorfälle und definiert die Ursache als ausschließlich soziale. In unserem Zusammenhang ist das einerlei; hier interessiert einstweilen nur: Wie reagiert die Zivilgesellschaft, wenn sie punktuell von innen angegriffen wird? Bekanntlich mit dem Ruf nach Zivilcourage – Courage allein genügt offenbar nicht. Die Deutschen haben nach 1945 »eine Sonderausgabe von Beherztheit« in die Welt gebracht, »die vielgelobte Zivilcourage, die Magerstufe des Muts für Verlierer«, notiert der Kulturphilosoph Peter Sloterdijk. Dem Ruf nach ihr ist, als eine Art siamesischer Zwilling, stets die Aufforderung beigesellt, man möge aber in entsprechenden Situationen nicht den Helden spielen. Die Formulierung impliziert, dass die Option, ein Held zu sein, offenkundig nicht mehr existiert. Wer dagegen den Helden spielt, veranstaltet dies auf eigene Rechnung und darf auf Unterstützung nicht zählen (aber das ist die Definition heroischen Handelns). Mehr noch: Er muss auch dann Konsequenzen in Kauf nehmen, wenn sein Heldenspielen von Erfolg gekrönt war.
Warum wurde der Münchner Dominik Brunner, der sich zwei jugendlichen (abwechslungshalber deutschen) Schlägern in den Weg gestellt hatte und diese Entscheidung mit seinem Leben bezahlte, als »S-Bahn-Held« gefeiert? Brunner hatte jene vielgepredigte Zivilcourage gezeigt, die ungefähr 98 Prozent seiner Zeitgenossen in einer vergleichbaren Lage gemeinhin nicht aufzubieten geneigt sind, indem er sich schützend vor Wehrlose stellte. Aber er wusste mit ziemlicher Sicherheit nicht, worauf er sich da einließ. War er tatsächlich bereit, zu sterben, um ein paar Kinder vor nahezu Gleichaltrigen zu schützen? Andernfalls wären die Kinder eben verprügelt worden, wie allenthalben Kinder verdroschen werden, aber er, Dominik Brunner, würde heute noch leben. Allerdings: Hätte Brunner einen anständigen Schlag am Leib oder einfach nur weniger Pech gehabt, gälte er heute nicht als ein couragierter Mitbürger, der leider den Helden spielen musste, sondern er säße womöglich als überreagierender Problemjugendlichen-Zusammenschläger im Gefängnis. Brunner war es, der Zeugenaussagen zufolge den ersten Schlag führte, und man kennt deutsche Richter inzwischen; viele von ihnen akzeptieren Notwehr bei sozial Bessergestellten ohne Migrationshintergrund nicht so schnell. Wenngleich Brunner in diesem Fall den Helden nicht nur gespielt hätte und sich ebenfalls großer Sympathien aus der Bevölkerung erfreuen dürfte. So oder so: Es schien für ihn wie für jeden in ähnlicher Situation nur die Wahl zu bestehen zwischen Wegschauen auf der einen und zweierlei Arten von Martyrium auf der anderen Seite.
Dieser Gedankengang führt zum sogenannten Kern des Problems. Unsere Gesellschaft ist so organisiert, dass sie heroisches Handeln zu unterbinden und, wofern dies nicht präventiv gelingt, es im Nachhinein zu bestrafen trachtet. Politisch, zeitgeistig, polizeilich und juristisch leben wir in einem rigide heldenfeindlichen Milieu. Wer seine Angelegenheiten im echten Konfliktfall in die eigenen Hände nimmt, wird als Feind der Gesellschaft behandelt. Er darf auf jene Nachsicht nicht hoffen, die denjenigen gegenüber oft aufgebracht wird, die ihm den Konflikt aufnötigen.
Aber wir Homines bundesrepublikanensis wollen ohnehin nicht den Helden spielen. Wir haben uns viel zu gut in unseren bequemen Verhältnissen eingerichtet, und noch ist die statistische Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich hoch, dass dort jemand ausgerechnet uns stört. Im Gegensatz beispielsweise zu den etwas robusteren und in puncto persönliche Freiheitsrechte fundamentalistischeren Amerikanern hat sich der deutsche Bürger entwaffnen lassen. Wir haben uns dem Schutz eines Staates anvertraut beziehungsweise ausgeliefert, dessen Verlässlichkeit allerdings zunehmend zum Zweifel Anlass bietet. Dafür regiert er inzwischen bis in die Ehebetten (außer in den bereits erwähnten Problembezirken, dort wagt er es nicht). Unsere Auseinandersetzungen lassen wir von Anwälten führen. Wenn unsere Familie beleidigt wird, sind wir zwar ganz demonstrativ sauer, aber wir fordern den Beleidiger nicht zum Duell. Wenn uns jemand bedroht, rufen wir nach der Polizei (sofern wir nicht den Eindruck haben, es sei sicherer, dies gerade nicht zu tun). Wird unser Land beleidigt, hören wir weg oder stimmen zu. Ohnehin versuchen wir, uns bei der Äußerung politischer Ansichten am derzeit gerade Opportunen zu orientieren (außer in der Anonymität des Internets). Wenn uns der Chef mobbt, kündigen wir; ist es der Nachbar, ziehen wir um. Werden unsere Kinder auf dem Pausenhof schikaniert, wechseln wir entweder die Schule oder wir sagen ihnen, so sei nun mal das Leben und sie müssten sich möglichst früh daran gewöhnen. Lieber den Schwanz einkneifen und keine Verletzungen oder Schlimmeres riskieren, als seine Würde verteidigen. Sie ist ja bereits im Grundgesetz verbrieft. Den Begriff Männlichkeit halten wir für sexistisch, kulturelle Selbsterhaltung für Rassismus. Diese Mischung aus Indifferenz und Feigheit bei der Nichtverteidigung des Eigenen nennen wir Toleranz. Es handelt sich dabei keineswegs um eine Schwundstufe der preußischen Toleranz, sondern um ihr exaktes Gegenteil. Wir sind alle Feiglinge geworden. Und glücklich? Das mag jeder selbst sehen.
»Mann – du alles auf Erden, fielen die Masken der Welt, fielen die Helden, die Herden – : weites trojanisches Feld –
immer Gewölke der Feuer, immer die Flammen der Nacht um dich, Tiefer und Treuer, der das Letzte bewacht,
keine Götter mehr zum Bitten keine Mütter mehr als Schoß – schweige und habe gelitten, sammle dich und sei groß!«
Gottfried Benn [REF 7]
DER SCHRUMPFMANN
THEORETISCH MÜSSTE EIN NEKROLOG auf den Helden mit einer Darlegung dessen anheben, was diesen Typus einstmals auszeichnete. Das würde uns aber fürs Erste zu weit in die Geschichte führen. Ich gestatte mir also, in der Gegenwart zu beginnen. Der Held war in der Regel männlich, es scheint folglich angebracht, diese Betrachtung mit einer Darlegung des aktuellen Zustandes der Männlichkeit zu eröffnen.
Der feministisch zugerichtete, von seiner tradierten Rolle weitgehend emanzipierte westliche Mann der Gegenwart ist üblicherweise ein Geschöpf, das weder Heroismus noch Größe kennt oder gar verkörpert. Er hat sich vielmehr damit arrangiert, dass bereits der Begriff Männlichkeit jenseits der Welt der Parfüms längst tabu ist. Er glaubt zu wissen, dass zwar nicht er selber, noch irgendein Mann, den er persönlich kennt, aber der Mann an sich ein unangenehmer Geselle ist, der Frauen unterdrückt, seine eigene womöglich schlägt, ständig an der Grenze zur Vergewaltigung lebt und als sozialer Idiot mit seiner Aggressivität das gesellschaftliche Zusammenleben gefährdet, indem er Kriege anzettelt, gläserne Decken gegen den beruflichen Aufstieg von Frauen errichtet und sich mit anderen Männern von morgens bis abends Weitpinkelwettbewerbe liefert. Der durchschnittliche westliche Gegenwartsmann selbst steht allerdings ebenso wenig wie die Männer, die er kennt, im Verdacht des Testosteronüberschusses, sondern eher permanent an der Schwelle zum Burn-out. Er bevölkert weniger die Arenen als vielmehr die psychologischen Praxen; statt auf dem Kampfplatz sieht man ihn auf dem Spielplatz, das heißt: sofern er noch den Schneid besaß, Kinder in diese Welt zu setzen. Er selbst ist, wie die Männer, die er kennt, leistungskritisch, existenziell erschöpft, heimatlos, wellness-orientiert, ernährungsbewusst, anpassungswillig und frei von verzehrenden Leidenschaften. Um irgendetwas unter Einsatz seiner Gesundheit oder seines Lebens zu kämpfen, läge ihm fern. Er ist so liberal, dass ihm kaum etwas Verteidigenswertes einfällt. Er glaubt, dass man über alle Probleme reden muss und sie nur so lösen kann, weshalb er bevorzugt Ratgeberliteratur liest. Befehlen ist ihm unangenehm; dem Kindermädchen oder der Putzfrau Anweisungen zu geben, überlässt er lieber seiner Ehefrau bzw. Partnerin. Er spricht mit anderen Männern in einem eigenen Befindlichkeitsjargon (Ich finde, Ich würde sagen) und kennt weder Indikativ noch Imperativ. Er ist vollkommen immun gegen jede Art von Pathos, wenngleich er manchmal heimlich ergriffen weint. Gegen Schmerzen hat er Tabletten. Sein Geld verdient er im Sitzen und nicht mit seiner Hände Arbeit, das von ihm Produzierte schätzt er gering. Obwohl er nicht genau weiß, warum, lebt er eigentlich gerne, und obwohl viele seiner Tage ungenutzt verstreichen, möchte er unendlich viele davon. Um das zu erreichen, achtet er auf seine Figur und trinkt öfter auch mal ein alkoholfreies Bier. Er denkt ständig an Sex, hat aber selten welchen. Die sanfte Melancholie, die sich über sein Dasein gelegt hat, ist ein Produkt der Werbung und der Pornoindustrie, soll heißen: der Erkenntnis, was ihm in seinem realen Leben an Leibern und sexuellen Praktiken alles versagt bleiben wird. Mit der zweiten Haut von Jack Wolfskin schützt er sich nicht nur beim Spaziergang in der Natur, sondern auch beim Weg zum Bäcker und zum Plastikmüllcontainer. Klaglos stellt er beim Check-in seine Schuhe aufs Band; Sicherheit ist das Allerwichtigste. Sein Lieblingsgespräch auf Partys mit den Männern, die er kennt, ist die Altersvorsorge. Ihr Dasein ist ein Sein-zur-Rente.
Interessanterweise ist es genau dieser Typus, der Männer für bösartige, dominante Kreaturen hält. Ob das nicht auch daran liegt, dass der raue Geselle ein beinahe feuchter Traum des Schrumpfmannes ist? Freilich, um ein solches Exemplar zu sehen, muss er in die Dritte Welt fahren oder sich in schlechte Gegenden wagen oder ein Geschichtsbuch aufschlagen oder ins Kino gehen. Die modernen Krieger in ihren Boss-Anzügen sind ja auch bloß Schrumpfversionen der Waffenträger von dereinst. Wobei angesichts eines solchen Trupps auf dem Weg in eine Bar oder zu einem jener Meetings , wo sie sich dann gegenseitig Flipcharts zeigen, schon die Frage vorstellig wird, was das wohl für eine Evolutionsform sein mag. Oder ob sie gar ihr Walten eingestellt hat, die Evolution, so um 1965 herum ...
Wer beherrscht heute noch Überlebenstechniken, mit denen er in der Natur über längere Zeit sein Dasein erhalten könnte? Wer kennt jemanden, auf den man sich in Krisenzeiten verlassen dürfte, der die archaische Sicherheit eines Kriegers ausstrahlt? Die jahrtausendealten männlichen Verrichtungen: auf die Jagd gehen, in der Wildnis überleben lernen, ein Tier schlachten und ausweiden, Wölfe und Bären verjagen, Pferde bändigen, den Feind abwehren, um Frauen kämpfen, neuen Lebensraum erschließen, den Wald roden, sein eigenes Haus bauen, ein Feld bestellen, nach Erz graben, ein Schiff besteigen, um zu schauen, was hinter dem Horizont liegt, Kontinente erobern, Teufe-lspakte schließen, göttliche Gebote in Empfang nehmen, als Patriarch der Familie gebieten, als Mönch heilige Berge besiedeln – all das existiert so gut wie nicht mehr. Sogar der stolze Torero soll, wenn es nach dem Willen der Wohlmeinenden geht, sein blutig-gefährliches Kampfspiel für immer einstellen. Entsprechend hat sich die Mentalität des westlichen Mannes verändert. Wer keine Kontinente mehr zu erschließen hat, der verbrennt auch keine Schiffe mehr hinter sich. Der Schrumpfmann möchte schon zur »Tagesschau« daheim sein. Den Abenteuerurlaub bucht er zusammen mit Reiserücktritts- und Unfallversicherung. Da er die Angstlustgefühle der realen Jagd und des echten Kampfes nicht mehr genießen kann, sieht er sich Horrorfilme an oder bläst virtuelle Feinde am PC weg. [REF 8]
Doch der Mentalitätswandel endet dort, wo die Biologie letzte Grenzen zieht. Auch der im Kopf zum Neutrum umerzogene Mann bleibt körperlich und hormonell einer. Wenn er keine Muskulatur, keinen Willen zur Herrschaft und keine Schmerztoleranz mehr besitzt, so spürt er doch immer wieder einen Rest von Scham deshalb. Er ahnt, dass er keinen Ernstfall überstehen würde, obwohl er eigentlich, Zelle für Zelle, dafür geschaffen worden ist. Was Jahrmillionen geformt haben, lässt sich – trotz zahlreicher beeindruckender Dressurerfolge – nicht in einer oder zwei Generationen wegtherapieren.
Genau dieser Versuch findet freilich statt, und er kann nirgendwo anders erfolgreicher stattfinden als in einer überalterten, feminisierten, wehleidigen, von historischen Schuldgefühlen gesteuerten, der Gleichheit und der Androgynität huldigenden Gesellschaft wie der deutschen, die Männlichkeit mit halb priesterlichem, halb irrenärztlichem Gestus bekämpft.
»Nach der Entnazifizierung kommt jetzt die Entmachoisierung, die Verwandlung des Mannes in ein sorgendes Haustier. Letztlich geht es um die Ausrottung von Stolz und Ehrgeiz«, resümiert der Philosoph Norbert Bolz. Das Maskottchen für diese gewünschte Umerziehung könnte die baden-württembergische Landtagsabgeordnete Monika Strub abgeben, ehemals Horst Strub, früher NPD, heute Linkspartei: Strub hat nicht nur in die richtige Richtung das Geschlecht gewechselt, sondern auch die politische Gesinnung, sodass eine rechtskonservative Zeitung spotten konnte: »Was bleibt von einem NPD-Mann übrig, wenn man ihm das Gemächt nimmt? Eine Linken-Politikerin.« [REF 9], [REF 10]
Für die Alterskohorte der heute ins Berufsleben eintretenden jungen deutschen Männer wurde der reizende Begriff »Generation Schrottpresse« in Vorschlag gebracht: Sie geraten als Ausquetschmasse zwischen die immer zahlreicher und älter werdenden Rentner, deren Pensionen sie zahlen sollen, und das ebenfalls immer zahlreicher werdende, zu großen Teilen aus virilen Zugewanderten bestehende Prekariat, für dessen Alimentierung sie aufkommen müssen, wenn sie wollen, dass seine Angehörigen ruhig bleiben und sich nicht einfach nehmen, was ihnen begehrenswert erscheint.
Dafür, dass die »Generation Schrottpresse« mental nahezu verteidigungsunfähig ist, wurde lange vorgearbeitet. Sie wuchs auf in einem Klima nationaler und kultureller Selbstgeringschätzung und vor allem in einer Gesellschaft ohne männliche Werte. »Auch einstmals positive Qualitäten des Mann-Seins werden mittlerweile gesellschaftlich umgedeutet«, notiert der Soziologe Walter Hollstein. »Mut wird als Aggressivität denunziert; aus Leistungsmotivation wird männlicher Karrierismus, aus Durchsetzungsvermögen männliche Herrschsucht, aus sinnvollem Widerspruch Definitionsmacht, und das, was einst als männliche Autonomie hochgelobt war, wird nun als Unfähigkeit zu Nähe und Hingabe diffamiert. Männer müssen sich seit circa vier Jahrzehnten als Unterdrücker, Schweine, Ungeziefer, Vergewaltiger oder – bestenfalls – Trottel denunzieren lassen.«
Wenn man den Buchmarkt als einen Indikator nimmt (und intellektuell ist er’s allemal noch), dann stehen seit ungefähr zwei Dekaden bezüglich der Geschlechterfrage die beiden Trends bolzenfest: Frauen steigen auf, Männer ab. Während zu der ersten Entwicklung offiziell nur die Haltung uneingeschränkter Akklamation möglich ist, wird der Abstieg des Mannes teils mit tribunalistischer Schadenfreude, teils aber auch mitleidig oder sorgenvoll kommentiert. Da Mitleid ebenfalls eine Form der Aggression sein kann, zumindest aus der Sicht eines Mannes, darf von einer flächendeckenden Aggressivität gegen das vermeintlich aggressive Geschlecht durchaus gesprochen werden.
Folgende Buchtitel kamen in den letzten Jahren in den Handel (die Auswahl ist höchst unvollständig): »Männer haben keine Zukunft«, »Weißbuch Frauen/Schwarzbuch Männer: Warum wir einen neuen Geschlechtervertrag brauchen«, »Der Mann in der Krise«, »Nur ein toter Mann ist ein guter Mann«, »Sternzeichen Scheißkerl«, »Der Mann. Ein Irrtum der Natur?«, »Keine Zukunft für Adam«, »Männerversagen«, »Der blockierte Mann«, »Warum der Mann nicht lieben kann«, »Die sieben Irrtümer der Männer. Der Mann muss zur Besinnung kommen«, »Man gewöhnt sich an alles, nur nicht an einen Mann«, »Blöde Männer«, »Männer sind doof«, »Männer taugen zu nichts«, »Warum Männer nichts taugen«, »Der Mann als logische und sittliche Unmöglichkeit und als Fluch der Welt«, »Trau niemals einem Mann«, »Wie ändere ich meinen Mann«, »Männer-Versagen«, »Wie erziehe ich meinen Mann«, »Ein bisschen Männerhass steht jeder Frau«, »Hunde sind die besseren Männer«, »Auslaufmodell Mann. Wie das starke Geschlecht zum schwachen wurde«, »Der Mann ein Auslaufmodell?«, »Was tun mit nutzlosen Männern?«, »Mimosen in Hosen. Eine Naturgeschichte des Mannes«, »Männer – das schwache Geschlecht«. Nicht zu vergessen die Neuauflage von Valerie Solanas’ »Manifest zur Vernichtung der Männer«. Und so fort. [REF 11], [REF 12], [REF 13], [REF 14], [REF 15]
Die Floskel, jemand oder etwas sei »frauenfeindlich«, ist heutzutage ein arger Vorwurf, dessen Anwendung schnell Sanktionen nach sich zieht oder politischen Zins abwirft, während die multimediale Kollektivschmähung von Männern völlig normal geworden ist. So erklärte etwa die stellvertretende FDP-Vorsitzende Cornelia Pieper, der Mann sei »auf seiner Entwicklungsstufe stehen geblieben« und »von der Evolution und dem weiblichen Geschlecht überholt« worden. »Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden«, schrieben die Sozialdemokraten schneidig in ihr »Hamburger Programm«. »Warum Männer früher sterben sollten«, lautete die Schlagzeile einer »Spiegel-online«-Geschichte; »Eine Krankheit namens Mann« überschrieb der »Spiegel« eine Titelstory. Im März 2011 strahlte die ARD zur besten Sendezeit einen Film namens »Freilaufende Männer« aus. »Er schläft, schnarcht und sabbert«, lautete darin die Kurzbeschreibung eines der Protagonisten aus dem Mund seiner Geliebten; »Ein Käfig für drei Narren« überschrieb die FAZ ihre Rezension. Der Mann: ein Idiot, ein schweineähnliches Tier.
Zugleich soll Homo sapiens maskulinensis an allem schuld sein, was immer falsch läuft in der Welt, ob Kriege oder Wirtschaftskrisen, ob die Erosion des Sozialgefüges oder der Partnerschaften. Nachdem er Säbelzahntiger und Höhlenbären besiegt, Pyramiden und Paläste gebaut, Länder urbanisiert, Kontinente erschlossen, das Kindbettfieber besiegt und sogar den Mond betreten hat, soll er nun abdanken. Ein bisschen unfair ist das schon. [REF 16], [REF 17], [REF 18], [REF 19]
Es ist einer Avantgarde des schwachen Geschlechts gelungen, der öffentlichen Meinung eine Dosis Misandrie zu verpassen, neben der sich sämtliche Stammtisch-Mysogynien wie Chorknabengespräche ausnehmen. Drei Klassikerinnen des Feminismus sollen hier als Beispiele genügen: »Durch seine Unfähigkeit zu menschlichem Kontakt und zum Mitleid hat das männliche Geschlecht die ganze Welt in einen Scheißhaufen verwandelt«, schrieb Valerie Solanas, »Männer sind Nazis, durch und durch. Ihr Tod ist also historisch gerechtfertigt«, sekundierte Marilyn French, und Andrea Dworkin war der Ansicht: »Terror strahlt aus vom Mann, Terror erleuchtet sein Wesen, Terror ist sein Lebenszweck. «
Die Männlichkeitsverachtung breitet sich unter dem Vorwand aus, sie wende sich gegen die »Frauenfeindlichkeit« in der Gesellschaft, gibt sich also defensiv. Tatsächlich rollt die Gesellschaft den Frauen eifrig überall rote Teppiche aus. Das Establishment behängt sogar eine Sexistin und verkrachte Existenz wie Alice Schwarzer mit seiner höchsten Auszeichnung, dem Bundesverdienstkreuz. Sämtliche feministischen Basalmärchen haben sich in den multimedial verdrehten Köpfen als vermeintliche Tatsachen durchgesetzt. Obwohl es x-fach widerlegt ist, beklagen Medien und Politik beharrlich die 23 Prozent, die Frauen angeblich weniger verdienen als Männer (bei gleicher Tätigkeit gibt es kaum Unterschiede; nur wenn man die Einkommen von beispielsweise Ärzten und Schwestern und Pflegern oder Piloten und Stewardessen munter in einen Topf wirft, entstehen solche Zahlen). Obwohl alle Parteien, bei denen Frauenquoten durchgedrückt wurden, die Männer bei der Vergabe von Führungsposten benachteiligen – immer sitzen prozentual mehr bis deutlich mehr Frauen auf solchen Posten, als die Partei prozentual weibliche Mitglieder hat –, soll nun auch die Wirtschaft für Aufsichtsräte eine Quote einführen, egal, ob sich dafür geeignete oder überhaupt nur willige Frauen finden lassen. Obwohl quer durch die westliche Welt zahlreiche Studien ergeben haben, dass häusliche Gewalt, wozu übrigens auch jene gegen Kinder gehört, in beinahe gleichem Maße von Schrumpfmännern und Powerfrauen ausgeht, wobei Letztere ihre körperliche Unterlegenheit oft durch den Einsatz von Gegenständen kompensieren, reißt die notorisch einseitige Klage über Männergewalt gegen Frauen nicht ab. [REF 20]
Hier ist ein kleiner Einschub nötig, denn dieses Thema ist des feministischen Spottes so sicher wie die vermeintliche gläserne Decke, welche Frauen am Aufstieg hindere, des feministischen Geplärrs. Frauengewalt gegen Männer? Gibt es denn so was? Die Männer sind doch körperlich viel stärker! Wie witzig: der arme, von seiner Frau verprügelte Mann! Wo frau doch heutzutage nicht mal mehr ein Nudelholz hat, weil sie nur noch Fertiggerichte kann. Welcher Mann lässt sich von einer Frau schlagen?
Die Antwort ist denkbar einfach: fast jeder. Es ist ja in höchstem Grade unmännlich, eine Frau zu schlagen, auch für den Schrumpfmann. Mädchen haut man nicht, lautet eine der elementarsten Regeln, die ein Junge lernt, zumindest in unserem Kulturkreis. Jede Frau, die sich mit ihrem Partner auf einen handfesten Krach einlässt, kann zunächst mit diesem Tabu rechnen. Sollte er sich darüber hinwegsetzen, dann darf sie sicher sein, dass die herbeieilende brave Polizei ihn mitnimmt und nicht sie, dass ein allfälliger Richterspruch ihm verbietet, die Wohnung wieder zu betreten, und nicht ihr, dass im Zweifelsfall immer sie die Kinder behält und nicht er. Er hat also keineswegs nur die schwache Frau und die Sitte gegen sich, sondern quasi die gesamte Gesellschaft, wenn er zulangt, weshalb Männergewalt gegen Frauen tatsächlich meist in den prekären Milieus stattfindet, wo es dem Kerl eher wurst ist, was die Sitte sagt, was die Nachbarn denken, ob die Polizei kommt, wer die Kinder behält und ob er im Gefängnis landet – oder er zumindest so blau war, dass ihn das alles erst zu spät wieder interessiert. Wir hatten bereits festgestellt, dass eine postheroische Gesellschaft gegenüber solchen Milieus erhebliche Probleme hat, ihre Werteordnung durchzusetzen, weil es ihr dafür an hinreichend brutalen Männern mangelt. Jedenfalls kommen die wohlfeilen Kampagnen des Feminats gegen Männergewalt dort, wo diese Gewalt stattfindet, natürlich überhaupt nicht an.
Für unser Thema bleibt festzuhalten: Männlichkeitsabwertung ist so sicher ein Kennzeichen einer postheroischen Gesellschaft, wie dies ganze Geplärr beim leisesten Pieps des Weltgeistes sofort ängstlich verstummen würde. Das Ausmaß feministischer Propaganda ist immer auch ein Wohlstandsindikator, denn die Schwestern fordern ja nie wirkliche Teilhabe, sondern stets nur die an den Privilegien. Hat man je von einer Kriegs- oder Krisensituation gehört, in welcher Frauen den Männern gleichgestellt werden wollten? Natürlich funktioniert die Männerabwertung bei gleichzeitiger Frauenprivilegierung nur durch kräftige männliche Mithilfe (es gibt dafür das Gleichnis von gewissen Nagetieren, die sinkende Schiffe verlassen), und sie mag viele Frauen, womöglich sogar eine Mehrheit von ihnen, anwidern, zumal der männlichkeitshassende Mann auch in seinem sonstigen Habitus nicht gerade der Typ ist, von dem sie schon als Mädchen immer geträumt haben. Selbstredend findet der vermeintliche Krieg der Geschlechter nicht wirklich statt, nicht einmal im Ansatz, weil die bekämpfte Seite die Waffen gar nicht erst aufnimmt. Unter dem Feldzeichen von Feminismus und Frauenemanzipation marschiert eine Armee, die noch nie auf einen Gegner getroffen ist, der immer alle Tore geöffnet stehen und die beim ersten echten Konflikt in alle Winde auseinanderstieben würde. Dass die angegriffene Seite sich nicht wehrt, und zwar letztlich aus Gründen immer noch rudimentär vorhandener Manieren, ist übrigens abwechslungshalber mal kein Zeichen männlichen Niedergangs, sondern ein letzter Rest von Männlichkeit – man könnte auch sagen: Restritterlichkeit. Ein echter Mann kämpft nicht gegen Frauen. Er konkurriert auch nicht mit ihnen, so wenig, wie er sich mit einer Frau um den letzten Platz im Rettungsboot schlagen oder die »Emma« abonnieren würde. Da sitzt er nun fest.
Etwas anders sieht es für die Jungen aus, denen ritterliches Verhalten abzuverlangen doch ein wenig frivol wäre. Es gibt für einen heranwachsenden Knaben überhaupt kein positives Männerbild, an dem er sich orientieren oder abarbeiten könnte. Stattdessen schlagen die intellektuellen Wortführer der Gesellschaft vor, die Jungen mögen sich nach den Mädchen richten, weil die Zukunft ohnehin weiblich (»sozial«) und Männlichkeit etwas Zerstörerisches sei. Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen setzen dies pädagogische Ideal durch, indem sie feminines Verhalten prämieren und maskulines im Zweifelsfalle bestrafen. Den Jungen bleiben später, sofern sie der erwünschten Domestikation nicht völlig erlegen sind, zwei Fluchträume: der Sport und die Kriminalität. Kämpferische Männlichkeit darf sich heutzutage nurmehr noch im Sport entfalten; nur im Sport darf der Sieger über den Besiegten triumphieren, wenngleich auch dort die ersten fortschrittlichen Pädagogen mit der Umerziehung des Nachwuchses beginnen, dem solch verwerflicher Diskriminierungswille abtrainiert werden soll, auf dass verlogene Parolen wie »Dabeisein ist alles« als gemeingültige Maximen etabliert werden. Auf der anderen Seite beweisen Symptome wie Rap, Gangsta-Kult und Jugendgewalt keineswegs, dass wir in einer männlichen Gesellschaft leben, sondern ganz im Gegenteil in einer feminisierten; nur wo es keine Männer gibt, können sich Jugendgang-Fatzkes und »Arschficksong«-Schreiber wie echte Kerle vorkommen.
Eine spezielle Option bildet das Schwulsein oder wohl besser: Schwulwerden. Während der effemierte Mann hofft, dass ihn die Frauen von der Last befreien, ein männlicher Mann sein zu müssen, nimmt der homosexuelle Mann die Verweiblichung an, ohne sich auf den Beziehungsstress mit deren Vorbildern einzulassen.
Der Schwule ist jedenfalls das selten bis nie, was der Mann jahrtausendelang nahezu immer und hauptsächlich war: Vater. Sorgend, strafend, liebend und zornig stand Gott, der Herr, als der schlechthinnige Vater der Menschenfamilie vor, und der irdische Patriarch versuchte, diesem Bild en miniature zu entsprechen. Die Figur des Vaters ist in den vergangenen hundert Jahren radikal entwertet worden, beginnend mit Psychoanalyse und Expressionismus, einstweilig endend im Feminismus und der Familienrechtsprechung. Der Angriff auf die Macht der Väter hatte viele plausible Gründe, doch sie alle zusammen rechtfertigen nicht das Ergebnis. Aus dem würdevollen Familienoberhaupt und fleißigen Ernährer ist eine Niete, ein Macho, Pascha, Ausbeuter, Prügler, potenzieller Sexualmissbrauchstreiber, Langweiler, kurz: ein Beziehungsschreck geworden. Immer häufiger kann er seine Familie weder ernähren noch zusammenhalten. Öffentliches Väteranpinkeln avancierte zum beliebten und zuweilen lukrativen Gesellschaftsspiel, wie zuletzt ein Helmut-Kohl-Sohn mit hoher Buchauflage vorführte.
»Die vaterlose Gesellschaft« nannte der Journalist Matthias Matussek den familiären beziehungsweise familienpolitischen Scherbenhaufen, vor dem wir heute stehen. So hat es die deutsche Sozialpolitik vermocht, aus 160 000 Kindern auf Sozialhilfe anno 1960 heuer zwei Millionen zu machen, und eine Million davon wachsen ohne Vater auf. Quer durch alle Milieus werden jeden Tag hierzulande in Folge von Scheidungen an die 400 weitere Kinder vaterlos (mitunter auch mutterlos). Wie die bei Sorgerechtsprozessen zuhauf entsorgten Männer demonstrieren, stellen Väter in der Gesellschaft keinen Wert, nichts Schutzwürdiges dar, sie gelten als entbehrlich. Der Staat nimmt – juristisch wie finanziell – bei einer Scheidung die Vaterrolle ein und ersetzt den Versorger durch Sozialhilfe. Den Vater als maskulines Leitbild vermag er freilich nicht zu ersetzen. Selbstredend rächt sich das bereits auf mittlerer Sicht. Wie Statistiken zeigen, ist zum Beispiel eine gewaltige Mehrheit der männlichen Kriminellen ohne Vater aufgewachsen. Und Scheidungskinder produzieren, wenn sie erwachsen sind, signifikant häufig wieder Scheidungskinder.
Männlichkeit muss man erwerben, Weiblichkeit »wird«. Immer mehr Männer verzichten auf den Erwerb von Männlichkeit, indem sie bis ins Alter große Jungen bleiben und möglichst jeder Verantwortung aus dem Wege gehen. Im Wesentlichen besteht die Verantwortungsscheu im Unwillen, Kinder zu zeugen und eine Familie zu gründen, während die Verantwortungsflucht einsetzt, wenn es versehentlich doch passiert ist. Es gibt ja keineswegs nur entsorgte Väter, auch wenn die meisten Scheidungen von Frauen eingereicht werden, sondern immer mehr Bindungs-Aversionisten, einzig an ihrer Triebabfuhr interessierte Männer, die Frau und Kind(er) sitzen lassen, weil sie, ebenso wie die scheidungsentschlossene Frau, davon ausgehen können, dass Vater oder besser: Mutter Staat schon für die Verlassenen sorgen wird. Außerdem ächtet die Gesellschaft auch ein solches Verhalten nicht im Geringsten; das Schäbigste, was ein Mann tun kann, nämlich seine Kinder verlassen, gilt in einer Welt ohne Kavaliere als Kavaliersdelikt.
In den zerschredderten Familien findet so täglich im Großen statt, was Politiker zuletzt mit wachsender Häufigkeit im Kleinen vorgeführt haben: Man schmeißt eine Sache eben hin, wenn einem irgendetwas gegen den Strich geht und man keinen Bock mehr verspürt. Zwei der größten Großmäuler in der deutschen Politik der letzten zwanzig Jahre sind von einem Tag auf den anderen aus ihren Ämtern desertiert, der eine als Berliner Wirtschaftssenator, der andere als Bundesfinanzminister, beide aus demselben Grund, weil sie ihre linke Weltsicht so wenig in erfolgreiche Wirtschaftspolitik verwandeln konnten wie ein mittelalterlicher Alchemist Blei in Gold. Wenn man Männlichkeit mit dem noblen Wort Trostunbedürftigkeit charakterisiert, war Horst Köhlers weinerlicher Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten ein Akt von exzessiver Unmännlichkeit. Wie kann der Inhaber des höchsten Amtes im Staate, ein Mann, der im Ernstfall das Parlament auflösen muss, wegen irgendwelcher Medienkritiken mit tränenerstickter Stimme verkünden, man lasse es an Respekt ihm gegenüber fehlen, und sich davonmachen? Angenommen, Köhler ist in Wirklichkeit aus anderen Gründen zurückgetreten, nämlich weil er es als Wirtschaftsfachmann nicht verantworten konnte, mit seiner Unterschrift den sogenannten Euro-Rettungsschirm zu bewilligen, wie verschiedentlich gemutmaßt wurde: Warum hat er es dann nicht öffentlich gemacht? Dem Bundespräsidenten hätte doch jeder Sender jeden beliebigen Sendeplatz freigeräumt.
Es gab auch einmal eine Zeit, da nahmen Unternehmenschefs, die ihre Firma in den Ruin gewirtschaftet hatten, nicht Millionenabfindungen mit nach Hause, sondern sich eher das Leben. Die Gier eines gewissen Schlages von Wirtschaftsführern nach leistungsfreien Bezügen mag eine zu allen Zeit vorkommende Charakterlosigkeit sein, sogar in deutschen Landen, doch die inzwischen dabei an den Tag gelegte Schamfreiheit scheint eine neue Qualität darzustellen. Sie diskreditiert nicht nur das männliche Leistungsprinzip, sondern hat eine verheerende Wirkung auf die allgemeine Moral, die ohne prinzipienfeste Männer in Führungspositionen zügig verlottert. [REF 21]
Neben dem Hinschmeißen von Ämtern ist das öffentliche Bereuen und Abbitteleisten zu einer Mode geworden, wobei nicht etwa Reue und Abbitte, sondern die Einbeziehung des großen Publikums unmännlich sind. Ein besonders kruder Fall war die öffentliche Reuebekundung des prominenten Fußballtrainers Ottmar Hitzfeld, der wegen einer brasilianischen Geliebten um Vergebung bat, für die man sich, wie die von der Boulevardpresse mitgelieferten Fotos zeigten, nun wirklich nicht zu schämen brauchte. Zum festen Bestandteil bundesrepublikanischer Folklore gehören die Entschuldigungen, welche Politiker vortragen, weil sie irgendetwas Missverständliches oder falsch Interpretierbares zu einem der hiesigen Tabuthemen gesagt haben.
Ein typischer Fall als pars pro toto: Als Christian Wulff, damals noch niedersächsischer Ministerpräsident, anno 2008 von einer »Pogromstimmung« gegen Manager redete oder faselte, folgten die üblichen Medienreaktionen. Wulff verharmlose das Dritte Reich, hieß es unisono; wie immer in solchen ideologisch eindeutigen und politisch unwichtigen Fällen ertönte die maßlose Forderung nach seinem Rücktritt. Wulff schlug nicht etwa mit der Faust auf den Tisch und sagte: Ihr spinnt wohl!, nein, er tat, was deutsche Politiker am liebsten tun: Er entschuldigte sich. Und zwar mit den Worten: »Nichts kann und darf mit der Judenverfolgung und den schrecklichen Pogromen gegen die Juden verglichen werden.« Das ist zwar das offizielle Glaubensbekenntnis der Bundesrepublik Deutschland, war jedoch insofern seltsam, als Wulff nichts dergleichen getan, sondern nur von einer Pogromstimmung an sich gesprochen hatte – ein übertriebenes, womöglich ein bisschen dämliches Bild, aber ohne Übertreibungen und Dämlichkeiten ist freie Rede nicht zu haben. Man wüsste natürlich gern, wie ein Christdemokrat zu der ethisch fragwürdigen Behauptung kommt, Pogrome gegen Hugenotten, Armenier oder Bosniaken seien weniger schrecklich als Pogrome gegen Juden. Aber in diesen heiklen Fragen wie Pudel dressiert, wissen deutsche Politiker selbstverständlich genau, was sie reden (man achte in diesem Zusammenhang auf das Wörtchen »darf«). Nur Menschen, die dergleichen Lippenbekenntnisse roboterhaft abzusondern verstehen, besetzen hierzulande die politischen Spitzenämter, und das ist einer der Gründe, warum sich vor meinem sogenannten inneren Auge zuweilen die Begriffe Deutscher Bundestag und Volkskammer der DDR träumerisch vermengen. Davon abgesehen, dass in einem freien Land alles mit allem verglichen werden können muss, würde ein Mann mit Rückgrat, auch wenn er exakt dasselbe meinen würde, was Wulffs verbaler Eiertanz zum Ausdruck brachte, sich niemals so devot äußern. Rückgratlosigkeit ist aber nur ein Synonym für Unmännlichkeit. Wohin sie Wulff geführt hat, ist bekannt.
Es handelt sich bei den Entschuldigung Erbittenden fast immer um Männer, bei denen plötzlich die Angst vor der eigenen Courage vorstellig geworden ist; ein Problem, das Frauen kaum kennen, da sie risikoscheuer sind und seltener Streit anzetteln. Wer aber einmal den Streit gesucht hat, soll ihn auch ausfechten. Ein Mann hat sich seinen Kontrahenten zu stellen, und wenn der Gegner die von HysterikerInnen wie Claudia Roth oder Wolfgang Thierse vertretene deutsche Öffentlichkeit ist, wird das Einknicken besonders peinlich. [REF 22]
In Deutschland muss nämlich niemand ein Held sein, um seine Meinung zu äußern. Wer im öffentlichen Meinungsstreit die Rolle des Parias zu übernehmen wagt, riskiert ja außer gesellschaftlicher Isolation, Rufmord, Jobverlust, dem Zwangsausschluss aus Vereinen, Telefonterror, körperlichen Attacken auf der Straße, dem Gemobbtwerden seiner Kinder in der Schule und ähnlichen Symptomen der Sippenhaft (Frau Sarrazin wüsste davon wohl ein garstig Lied zu singen) nicht viel. Er darf weiter zur Miete wohnen und die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, was nicht ganz unwichtig ist, denn zuweilen haben engagierte »Chaoten« sich einen Jux gemacht und unter seinem Auto einen Brandsatz platziert ...
Querköpfe wie der Historiker Ernst Nolte oder Thilo Sarrazin sollen hier also nicht als Helden präsentiert werden, insbesondere Letzterer nicht, der ja das Glück besaß, einen Bestseller geschrieben zu haben; ihn trösteten siebenstellige Einnahmen und ein gewaltiger Zuspruch der »Menschen da draußen im Land« (Angela Merkel) darüber hinweg, dass seine Einlassungen »wenig hilfreich« (wieder Merkel) waren und er fortan in den Augen des politisch-medialen Establishments und der Kulturschickeria ein Tschandala sein würde. Aber wenn Männer wie Nolte und Sarrazin auch nicht zum Heros taugen, so kann ihnen getrost bescheinigt werden, dass sie, wie man sagt, Eier haben, dass sie sich nicht dem Sturm der aggressiv Wohlmeinenden und abrufbereit Empörten gebeugt haben und das ganze meutenhafte Gesinnungsgouvernantentum – »Wie erschrak die Gouvernante,/ als sie die Gefahr erkannte!« (Wilhelm Busch) – stoisch über sich ergehen ließen, ohne die von ihnen als richtig erkannten Positionen zu räumen. Das ist einfach hinreißend in einem Land, wo sich jeden Tag jemand entschuldigt oder etwas widerruft, weil irgendein Diskurslinienrichter hochfrequent mit seinem Fähnchen gewedelt hat.
Männlich ist die Selbstbehauptung, nicht die Diskussion vulgo das Gequatsche. Eine diskursive Gesellschaft ist – so sehr sie dem rhetorisch begabten Gockel Gelegenheit gibt, auf den televisionären Misthäufen herumzukrähen – eine tendenziell unmännliche Gesellschaft, zumal das Ergebnis der Diskurse gewöhnlich von vornherein feststeht. Mit einem gewissen Recht haben inzwischen auch Moderatorinnen die Herrschaft im Reich des Gequassels errungen. Die Gestalt des Schrumpfmannes verkörpern in dieser Sphäre idealtypisch zwei TV-Unterhalter: Johannes B. Kerner und Reinhold Beckmann. Zunächst einmal sind beide keine Männer, sondern in die Jahre gekommene Jungen. Der Betrieb hat sie nach oben – nein: nach vorn – gespült, und sie danken es ihm als zwei abgeschliffene Kiesel mit vollendeter Unanstößigkeit. Hinter beider lebensspurenfreien Gesichtern wohnte nie ein Gedanke, der ihrer Karriere hätte schädlich werden können. Beide würden niemals etwas anderes tun, als dem jeweils herrschenden Zeitgeist zu dienen, beide haben es oft und je einmal besonders exemplarisch vorgeführt, der eine, indem er die medial ohnehin fangschussreif zugerichtete Anti-Feministin Eva Herman nach Plan und anscheinend vorheriger Absprache mit den anderen Gästen aus seiner Sendung warf, der andere, indem er den ähnlich als erledigenswert vorpräparierten ehemaligen Bundesbanker Thilo Sarrazin zwar einlud, ihm aber sage und schreibe fünf Gegner zur Seite setzte, auf deren Seite er sich natürlich auch noch selber schlug. Die Herstellung politisch korrekter Mehrheitsverhältnisse waltet ohnehin über jeder Talkshow, doch nie zuvor hatte man es so unfair erlebt wie in den beiden genannten Fällen. Als besonders pikante Form von angepasster Verlogenheit sollte dabei erwähnt werden, dass Kerner eine Frau abstrafte, die exakt das predigte, was er selber bei sich daheim praktiziert: dass Kinder bis zu einem gewissen Alter von ihrer Mutter betreut werden sollen, die dafür ihren Job aufgibt.
Der unmännliche Zeitgeist der Konfliktbehandlung durch folgenarmes Dauergerede ist erst möglich ab einem gewissen Luxus. Mag sein, dass er wieder verschwindet, wenn dieser Luxus einmal unterschritten wird, wobei es dann fraglich ist, ob der Menschenschlag überlebt, der von diesem Zeitgeist geprägt wurde. Die Verlagerung des Schlachtfeldes auf die diskursive Ebene hat einen Typus hervorgebracht, für den der Begriff Maulheld wie geschaffen ist, natürlich erst, seitdem das Duell abgeschafft wurde, sonst bliebe man auch heute von ihm unbehelligt. So aber lungert und lärmt er allenthalben, in Universitäten, politischen Zirkeln, Redaktionsbüros und hier an diesem Schreibtisch.
Der Zeitgeist hat immer wieder versucht, der jeweiligen Schwundstufe des Mannes Etiketten anzupappen, die statt eines Niedergangs bloß eine veränderte Normalität suggerieren sollten. So tauchte etwa in der Bundesrepublik der 1970er- und 80er-Jahre der sogenannte »neue Mann« auf, ein Typus, der sich angeblich als Reaktion auf die Frauenbewegung herausgebildet hatte. Über die 68er lässt sich viel Negatives sagen, aber die meisten von ihnen waren insofern normale Kerle, als sie mit ihrem Rebellionsgetue nur nebenher die bürgerliche Gesellschaft, hauptsächlich aber die Schlüpfer der Kommunardinnen aus dem Weg räumen wollten; Feministen waren sie jedenfalls nicht. Das Hauptmerkmal des »neuen Mannes« sollte dagegen nun ein »Hinterfragen« seiner »Geschlechterrolle« sein, wobei Hinterfragen nichts anderes als einen allmählichen Verzicht darauf meinte – »Re-education Teil II«, wie Norbert Bolz spottet. Untrennbar damit verbunden war der Abbau der »Zwangsheterosexualität«, das heißt, der »neue Mann« war gehalten, sowohl seine weibliche als auch seine homosexuelle Seite »zu entdecken«. Kurz gesagt führte also die Geschichte des abendländischen Mannes in den letzten 500 Jahren von der Entdeckung Amerikas zur Entdeckung seiner weiblichen Seite. Der Kolonist steht im Begriffe, ein Kolonisierter zu werden. [REF 23]
Eine andere Zwischenstufe dieser Metamorphose wurde unter der Chiffre »metrosexuell« ver- oder besser: gehandelt. Der Begriff entstand als ein Wortspiel aus den englischen Begriffen »metropolitan« und »heterosexual«. Dahinter verbarg sich ein angeblich zu Beginn des 2 1. Jahrhunderts zur Massenerscheinung gewordener sogenannter Lifestyle unter großstädtischen, beruflich erfolgreichen Männern in der westlichen Welt. Es ist in diesem Zusammenhang übrigens unwichtig, ob solche Trends tatsächlich die Realität oder bloß Wunschwelten widerspiegeln, denn die Existenz von Wünschen über den Zustand einer Gesellschaft innerhalb meinungsprägender Kreise ist bereits Symptom genug.
© 2011 Diederichs Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Weiss | Werkstatt | München
eISBN 978-3-641-06344-3
www.diederichs-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe