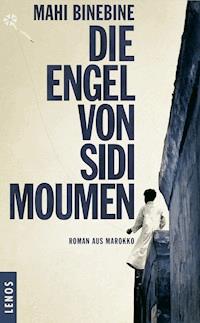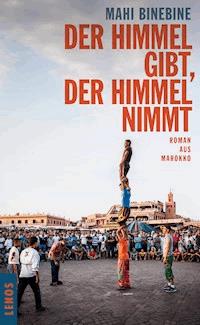
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Arabische Welten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Krümelchen wurde in der Medina von Marrakesch geboren und überflügelt seine fünf Geschwister schon als Säugling in der Kunst des Bettelns: An arme Frauen vermietet, beschert er seiner Familie ein florierendes Geschäft. Doch das Talent wird ihm bald zum Verhängnis, denn seine Mutter unternimmt alles, um das rentable Baby am Wachsen zu hindern. An einen Kinderwagen gefesselt und körperlich verkümmert, findet er immer neue Wege, sich als Attraktion zu inszenieren und den Leuten Staunen, Mitleid und Geld zu entlocken. Als er bei einem spanischen Professor heimlich lesen und schreiben lernt, eröffnen ihm die Bücher eine neue Welt. Sein Blick auf das Leben verändert sich radikal. Mit der ersten Liebe gelingt ihm die Emanzipation von der Mutter und der Beginn eines eigenständigen Lebens. Mahi Binebines wunderbare Entwicklungsgeschichte gibt den Vergessenen dieser Welt eine Stimme. Sie beleuchtet die allzu bekannte, tragische Situation vieler Kinder in Armut aus einer Perspektive, deren Humor und Menschlichkeit überraschen. Sie ist kein Abgesang, sondern eine Hymne auf das Leben, die Bildung und die Poesie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Ähnliche
Der Autor
Mahi Binebine, geboren 1959 in Marrakesch (Marokko). Studium der Mathematik in Paris. Lehrer. Hinwendung zur Literatur und Malerei. Heute gilt er als bekanntester Maler Marokkos, seine Bilder hängen u.a. im New Yorker Guggenheim-Museum. Sein schriftstellerisches Werk –er schrieb acht Romane– wurde in mehrere Sprachen übersetzt und u.a. mit dem Prix de l’Amitié Franco-Arabe ausgezeichnet. Nach Jahren in Frankreich und den USA lebt Mahi Binebine seit 2002 wieder in Marrakesch. Im Lenos Verlag erschien ausserdem Die Engel von Sidi Moumen (2011).
www.mahibinebine.com
Die Übersetzerin
Hilde Fieguth, geboren 1944 in Schwabach (Mittelfranken), lebt seit 1983 in Freiburg i.Ü. Langjährige Beschäftigung mit meist literaturbezogener Malerei, daneben 1991–1998 Leitung einer Kunstgalerie. Seit 2000 freie Literaturübersetzerin; sie übertrug vor allem Werke von S. Corinna Bille und, zusammen mit Rolf Fieguth, von Maurice Chappaz ins Deutsche. Für den Lenos Verlag übersetzte sie 2015 den Roman Dunkler Weg zum Teich von Jean-François Haas. www.fieguth.ch.
Titel der französischen Originalausgabe:
Le Seigneur vous le rendra
Copyright ©2013 by Librairie Arthème Fayard
E-Book-Ausgabe 2016
Copyright ©der deutschen Übersetzung
2016 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Hauptmann & Kompanie, Zürich, Dominic Wilhelm
Coverfoto: Keystone/laif/Lutz Jäkel
ISBN 978 3 85787 951 7
www.lenos.ch
Für José und Alfredo
1
Das Metier eines Babys fachgerecht auszuüben ist nicht jedermann gegeben. Es reicht nicht, ein unförmiger oder plärrender Verdauungsapparat zu sein, um glaubhaft zu erscheinen; echtes Talent ist nötig, vor allem wenn man es wie ich über lange Zeit betreibt. Über sehr lange Zeit. »Säugling« war also meine erste Arbeitsstelle. Und ich sage es in aller Bescheidenheit, kein anderes in der Medina vermietetes Kerlchen war so lukrativ wie ich. Schon am frühen Morgen rückten routinierte Bettlerinnen vor unserer Behausung an, warteten darauf, dass Mutter das in Lumpen gewickelte Huhn, das goldene Eier legte, herausbrachte, und sogleich schnellten die Angebote in die Höhe. Nie hat mich Mutter für weniger als zwanzig Dirham am Tag hergegeben: Greif zu, oder lass es sein. Mein Mindestpreis war nicht zu drücken. Dabei war ich nicht blind, nicht einarmig und nicht verwachsen, hatte weder Hasenscharte noch Buckel; kein Vergleich zu den Krüppeln der Konkurrenz. Vollkommen gesund an Körper und Geist! Vielleicht ein bisschen mager, aber auch nicht mehr als die anderen Knirpse im Quartier. Mein Ruf als »sicherer Wert« war also allgemein bekannt. Man brauchte mich nur einer armen Frau, die im Schneidersitz unter einer Mauer hockte, in die Arme zu legen, und schon quoll ihr Becher von Münzen über. So wie manche mit einer erstaunlichen Begabung für Musik, Tanz oder Fussball geboren werden, war ich als Genie in der Kunst des Bettelns auf die Welt gekommen. Ich war von dieser Gnade berührt worden, lange bevor ich meine Nase in diese Welt gesteckt hatte; diese Gnade soll ich, wie mein Bruder Taschfin meinte, einem mitleidigen Engel im Himmel abgeluchst haben! Laut Mutter hatte die Hebamme, die mir auf die Welt verholfen hat, ihr Honorar zurückgewiesen, so empfänglich war sie für den dankbaren Blick gewesen, mit dem ich sie, noch ehe die Nabelschnur durchtrennt war, anschaute. Sie hatte gesagt: »Guten Tag, kleiner Mann, willkommen im Leben!« Meine Mutter beteuerte, ich hätte dann ein engelgleiches Lächeln angedeutet, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass sie damals in ihrem Zustand in der Lage war, auf ein solches Detail zu achten. Sie behauptete auch, die Hebamme habe vor dem Weggehen einen Geldschein unter mein Kopfkissen gesteckt, was Tante Sinab später bestätigte, die sogar den genauen Betrag angab. So war ich also nicht nur gratis geboren worden, sondern hatte sogar derjenigen, die mir den Weg ins Licht erleichtert hatte, etwas abgeknöpft. Mutter sah darin ein gutes Omen, das deutliche Vorzeichen einer glänzenden Karriere. Sie wiederholte bei jeder Gelegenheit: »So schmächtig es auch ist– das Engelchen, das ihr hier seht, wird uns eines Tages aus der Misere holen!« Engel hatte sie jedoch schon einen ganzen Haufen. Sechs, um genau zu sein: zwei Mädchen und vier Jungen.
Wie dem auch sei, sie hatte mir die schwere Aufgabe zugeteilt, unseren Haushalt vor dem Ruin zu retten. Und meine ersten Schritte im Leben schienen ihre Vorhersagen zu bestätigen. Schon sehr früh wurde mir die Hässlichkeit der Welt bewusst, in der ich zweifellos per Zufall gestrandet war, denn ich war ganz anders als die Meinen. Nicht alle Makel, die eigentlich meiner Situation entsprochen hätten, hatten sich auf mir vereint. Arm, gewiss, aber nicht blöd. Auch nicht hässlich. Manche fanden an mir sogar einen gewissen Beduinencharme: Adlernase, leicht mandelförmige Augen, ein wenig hohlwangig, braun gebrannt und krauses Haar, alles sprach also eher für ein verführerisches Schnäuzchen. Der Himmel hatte mich nicht ganz und gar verdammt. Tief unten im Abgrund sah ich undeutlich eine Luke, durch die ein merkwürdiger Schimmer drang, wie der Ruf nach einem besseren Leben. Und es fehlte mir nicht an Trümpfen und nicht an Ehrgeiz, um es erreichen zu können. So machte ich mich daran, die Menschen und die Dinge in meiner Umgebung aus der Nähe zu erforschen. Ziemlich schnell schätzte ich die Wichtigkeit eines Blicks und die Wirkung eines Lächelns in den menschlichen Beziehungen ab, das Sesam-öffne-dich, das auf meinem Weg entscheidend werden sollte. Ich gehörte zum Stamm der Auserwählten, und das wusste ich. Mutter wusste es auch; mehr noch, sie war so überzeugt davon, dass sie schliesslich die ganze Sippschaft dafür gewann: Brüder, Schwestern, Cousins, Nachbarn, Onkel, Tanten und sogar die fernen Verwandten, die noch in ihren Bergen wohnten. All die guten Leute erwarteten nun von mir das Wunder, die Arche Noah für die Familie.
Zunächst aber bestand meine Arbeit nur darin, es mir wohl sein zu lassen, vom Morgen bis zum Abend schmiegte ich mich dösend an die Bäuche, die ich beim Aufwachen vorfand. Ich amüsierte mich dann damit, sie zu erkunden, rieb mir also die Wangen an ihnen, leckte sie mit der Zungenspitze ab, um der neuen Mama ein Gesicht zu geben, die mich den ganzen Tag über an ihrer schweren Brust mit dem beissenden Geruch ihrer Achselhöhlen und dem ekligen Gestank ihrer alten Kleider ersticken würde. Was habe ich für Wänste erlebt während meiner Säuglingskarriere! Ich könnte mich lange auslassen über die verschiedenen weiblichen Formen, von einladenden bis zu unbequemen, von wohlriechenden bis zu ranzigen. Ich könnte die Beschaffenheit ihrer Haut schildern, ihre Behaarung, Geschmeidigkeit, ihren Teint, wie sanft sie war oder wie rau, ihren Duft, ihre Leberflecken. Ich könnte genauestens das Aussehen ihrer Nabel beschreiben, Napf oder Knopf, konkav oder konvex, die eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf meine Finger ausübten… Ich könnte die tausendundein Formen der Brüste beschreiben, die ich betasten und drücken musste, um eine Milch einzusaugen, die nicht kam. Runde und weiche Brüste, schlaffe, ohne Geschmack, arrogante, hoch angesetzte, reife Klementinen, stolze Birnen, trockene Feigen, Kugeln mit Schlupfwarzen, halbvolle Schläuche, dralle, von blauen Adern durchzogene Melonen, feste, aber leere Brüste, oder tröpfelnd, aber selbstherrlich, meinen Händchen und meinem unersättlichen Mund dargeboten… Kaum fand ich mich eingerollt in einem neuen Schoss, schon machte ich mich daran, ihn abzuhorchen, an ihm zu schnuppern wie ein Kannibale, der gleich zubeissen wird, alle seine Falten und Fältchen zu erforschen, seine Konsistenz, die Wülste, die Einbuchtungen, die flachen Stellen, die Rundungen, die Vorsprünge, ich schritt zu einer regelrechten Erforschung der Bleibe, die mich diesmal von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang aufnehmen würde. Noch mehr als all die wie Schiffsrümpfe gebogenen Bäuche, die sich als schützende Hülle boten, schätzte ich die merkwürdige Empfindung, gleichzeitig innen und aussen zu sein, ein Embryo, der ein Bad von Licht und Seeluft nehmen und bei derselben Gelegenheit das Chaos kennenlernen durfte.
2
Es war kein Zufall, dass man sich in der Medina weiterhin um meine Dienste riss. Von zwanzig war ich auf vierzig Dirham pro Tag gekommen, und die Bettlerinnen, die mich mieteten, machten dabei trotzdem noch ihren Schnitt. Zahlreiche Bedürftige drängten sich in unsere Nähe, damit unser Nährengel auch ihnen ein paar Brocken zuwerfe, aber vergeblich: Sie mussten sich weiterhin selbst plagen. Wenn ich mich damals so hätte ausdrücken können wie heute, dann hätte ich diesen Stümpern gern das Grundwissen über das Almosensammeln vermittelt. Ich hätte ihren falschen Eifer, mit dem Elend Theater zu spielen, gedämpft. Mit einem echten oder vorgetäuschten Gebrechen über den Vorübergehenden herzufallen bringt nicht unbedingt etwas, auch wenn sich sensible Seelen vielleicht von einem jungen Einarmigen rühren lassen, der mit seinem Stumpf winkt, oder von einem Blinden, der die pupillenlosen, glasigen weissen Augen, die sein Gesicht verdüstern, aufreisst, oder wenn ein beinloser Krüppel ihnen auf seinem Rollbrett nachjagt und sie an einem Zipfel ihres Gewands packt. Nein, Würde ist entscheidend in der Bettelkunst. Einen möglichen Wohltäter zu belästigen kann sich als kontraproduktiv erweisen. Es braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl, eine Annäherung mit aller Finesse, sozusagen aristokratisch. Meine Technik war einfach: auf angemessene Weise eine Beute auswählen, am besten eine gutgekleidete; dabei besonders auf die Qualität der Schuhe achten, denn die gibt wertvollen Aufschluss über die Höhe des Vermögens– und dann nicht mehr von ihr ablassen. Vor allem nie auf zwei Hasen gleichzeitig zielen, der klassische Anfängerfehler: Das bringt überhaupt nichts. Wenn sich dann ein solcher Passant in meiner Schusslinie befand, setzte ich all meine Energie ein, ihm auf den Fersen zu bleiben. Auch wenn er sich seinen Weg durch die überladenen, von halbtoten Eseln gezogenen Karren bahnte, durch klapprige Fahrräder hindurch, durch Nichtstuer und Geschäftige, durch kreischende Gören, Bauerntrampel, Viehhändler, Taschendiebe– ich radierte sozusagen alle diese für unsere Angelegenheit unbrauchbaren Gestalten aus, so dass nur noch er, meine Pseudomutter an diesem Tag und ich existierten. Ich bemühte mich dann, eine sanfte Melancholie in meine Augen zu legen, deutete zart ein Lächeln an, das weder wirklich fröhlich noch ganz und gar kummererfüllt war, und suchte dabei den ausweichenden Blick meines Kunden auf mich zu ziehen und mich daran zu klammern wie an einen Rettungsring. Die Absicht war, in ihm ein leichtes Schuldgefühl zu erzeugen, einen Hauch Mitleid, den Gedanken, dass sein eigenes Kind sich an dieser Stelle hätte befinden können, an meinem Platz, mumifiziert in schmutzigen Windeln, hungrig, dem Staub und der Hitze der Strasse ausgesetzt… Und das wirkt! Jeder Zweite greift wie von einer unwiderstehlichen Macht magnetisch angezogen in seine Tasche und wirft mir eine Münze hin. Dann geht er seines Weges, im Reinen mit seinem Gewissen. In diesem Moment greift meine provisorische Mutter ein, mit einem Wortschwall über die Belohnungen, die ihn im Paradies erwarten, sie fleht Gott an, seine Kinder vor einem ähnlichen Schicksal wie dem meinen zu bewahren. Und die Sache ist gelaufen. Eigentlich denke ich, dass ich diesem Passanten einen Dienst erwiesen habe, er ist jetzt glücklicher, als er es vor der Begegnung mit mir war; gewiss zwar um einiges Kleingeld erleichtert, aber beglückt von dem, was die Zukunft für ihn bereithält, und mit der beruhigenden Überzeugung, den Seinen die Qualen des Notleidens zu ersparen, da ich ihm ja die Gelegenheit zu einer guten Tat gegeben und mich damit zu seinen Gunsten beim Allerhöchsten eingesetzt hatte. Dies alles hätte ich im Wesentlichen den armen Schluckern erklärt. Hätten sie auf mich gehört? Da bin ich nicht sicher. Ihr Neid auf meine Erfolge machte sie blind. Andererseits, mit einer Spur Intelligenz hätten sie mich beobachtet und verstanden, dass ich es niemals mit meinen Wohltätern übertrieb, oder wenn, dann so subtil, dass sie es unterliessen, ihr Herz zu verhärten und den unerbittlichen Panzer der Gleichgültigkeit anzulegen.
Als mein Vater kurz vor meiner Geburt in der Sahara auf eine Mine getreten war, dachte Mutter, sie komme niemals wieder auf einen grünen Zweig. Sie war nicht mehr jung genug, um ihr Leben mit dem Hintern verdienen zu können (obwohl sie sich recht gut gehalten hatte), und beschied sich also damit, meine Schwestern Hind und Nawâl, zehn und acht Jahre alt, als Haushaltshilfen zu reichen Leuten in den guten Quartieren zu geben. Für Taschfin, sechs Jahre alt, kaufte sie einen Schuhputzkasten, und so wurde er zum »Schuhfachmann«, wie er sich gern selbst vorstellte, und bei den Zwillingen Omar und Ali liess sie zu, dass sie sich auf dem Grossen Platz herumtrieben, da sie es sowieso in keiner Lehre aushielten: Nach einer Woche schmiss man sie hinaus, denn schon immer hatten sie sich jedem Befehl verweigert, egal von wem er kam. Solange Mutter rein körperlich den Wildfängen überlegen war, hatte sie noch den Ton angeben können; aber eben nur für kurze Zeit! Die zwei Halbwüchsigen durften nun im Haus nur noch übernachten. Bis auf den Freitagskuskus mussten sie sich mit ihren Mahlzeiten selbst behelfen. Aber sie beklagten sich nicht. So gesund, wie sie aussahen, starben sie ja auch nicht vor Hunger. In ganz dringenden Fällen konnten sie im Übrigen auf Mutter zählen. Aber wehe, sie übertrieben es! Trotz der Rente, die Mutter jeden Monatsersten erhielt, kam sie kaum über die Runden. So erwiesen sich meine Geburt und der Enthusiasmus, den meine Vermietung bei den Bettlerinnen hervorrief, als segensreich. Manche meiner Gelegenheitsmamas waren so zufrieden mit meinen Diensten, dass sie mich am Abend mit Geschenken zurückbrachten: einer Tüte Kichererbsen, Sonnenblumenkernen, gerösteten Erdnüssen und anderen Leckerbissen zur Freude meiner Brüder und Schwestern. Wer hätte gedacht, dass wir drei Jahre nach dem Tod meines Erzeugers sozusagen ausgesorgt haben würden? Unaufhörlich lobte Mutter den Herrn und alle die Marabuts, die sie kannte, denn unsere materielle Situation war merklich besser geworden. Aus dem Haus, das wir bisher mit mehreren Familien bewohnt hatten, waren wir allein in eine Bude am Strassenrand gezogen. Ein unerwarteter Luxus, wenn auch einen Monat später Tante Sinab mit ihren drei Töchtern zu uns kam, denn ihr vielgeliebter Ehemann hatte mit einer jungen Hexe (so sagte Mama, die echte) das Weite gesucht. Wir waren daran gewöhnt, uns wie Sardinen im selben Raum aneinanderzudrängen, und jetzt hatten wir drei Zimmer zur Verfügung, einen Innenhof, eine grosse Küche und Klosetts, von denen die Knaben nicht ausgeschlossen waren. Nun mussten wir uns also nicht mehr wie früher auf der Strasse oder in einem Café erleichtern. Wir waren unter uns, und meine Mutter war Herr im Haus. Kein Streit und keine Spannungen mehr mit den Nachbarn. Mutter und Tante Sinab verstanden sich prächtig. Eine war so geschwätzig wie die andere, und ihr Lebensinhalt bestand nun darin, sich an dem Tratsch zu ergötzen, den sie donnerstags im maurischen Bad aufschnappten. Lästern war ihr Lieblingssport. Sobald sie von einem neuen Gerücht erfuhren, feilten sie an ihm, spickten es mit pikanten Details, ergänzten es nach Belieben, je nach den Umständen, um es dann lauthals am Waschtag auf der Terrasse zu verbreiten. Von weitem hörte man sie gackern und schallend lachen, oft wegen einer Lappalie. Die Witwe und die Verstossene hatten sich eine neue Jugend verpasst. Der Verlust ihrer Ehemänner drückte sie nicht nieder, er verlieh ihnen im Gegenteil eine eigenartige Freude, ein Gefühl von bisher ungekannter Freiheit. Sie stellten fest, dass in ihrem Alter das Leben ohne Mann ein Segen war. Keinen alten Meckerer mehr zu haben, der ihnen den Tag vergällte, war wohl ein paar kleine Opfer wert. Die zwei Frauen hatten sich schon immer gut verstanden. Als Tante Sinab noch Onkel Achmads Frau war, seines Zeichens Kaufmann, verging keine Woche, ohne dass sie ihrer Schwester heimlich Vorräte zukommen liess: einen halben Beutel Weizen, einen Liter Olivenöl, Zuckerhüte, grünen Tee, Trockenfrüchte. Wenn wir sie an Festtagen besuchten, stopften wir unaufhörlich Bittermandelkuchen in uns hinein, mit Butter und flüssigem Honig getränkte Fladen und ähnliche Köstlichkeiten. Taschfin meinte, einen Lebensmittelhändler zum Vater zu haben sei mehr wert als einen Soldaten. Mutter und Tante Sinab waren glücklich, wenn sie ihre Küken im Festgewand um sich versammelt sahen. Und es wurde gegrölt, getobt, gelacht. Beim Abschied am Abend waren die Schwestern immer traurig und bitter. Aber nun, da die Vorsehung sie vereinigt hatte, als zwei Hälften desselben Wesens, wussten sie, dass es fürs ganze Leben war.
Mein Bruder Taschfin bekam den Auftrag, mich wie einen Schatz zu bewachen. Kindischerweise (Tante Sinab meinte, eine Wahrsagerin sei schuld daran) hatte sich Mutter eingeredet, dass ich einmal gestohlen werde, eine Furcht, die schon an Irrsinn grenzte, denn von meinem Verschwinden hätte niemand etwas gehabt. Mit der Zeit hatten wir einen festen Rhythmus gefunden: Drei Bettlerinnen, die Mutter sehr gut kannte, kümmerten sich abwechselnd um mich. Das Risiko, von einer von ihnen gekidnappt zu werden, schien also gering. Trotzdem, Karten sind Karten, und die Hellseherin hatte ausdrücklich gesagt: »Man wird dir deinen Augenstern stehlen, man wird dir deinen wertvollsten Besitz nehmen: deinen Letztgeborenen!« Mutter war fast in Ohnmacht gefallen, dann hatte sie sich wieder gefasst. Sie hatte versucht, Genaueres zu erfahren, es ging darum, dem »man« einen Namen zu geben, damit man ihm erst die Eingeweide herausreissen und dann seine Baracke anzünden konnte, aber die Karten hatten sich geweigert, den künftigen Schuldigen auszuliefern. Dafür hatte die Kartenlegerin versprochen, ihr von ihrem Ehemann, einem namhaften Zauberer, einen Talisman verfertigen zu lassen, der das uns beschiedene Los neutralisieren sollte. Um auf der Stelle den Fluch an den Absender zurückzuschicken, brauchte man einen zweiten, und zwar einen fürchterlichen, leider etwas teureren. Mutter hörte nur auf ihr in den Adern kochendes Blut, bestellte alles, zahlte im Voraus, ohne zu feilschen, verlangte aber, die Amulette innerhalb kürzester Frist zu bekommen. Das war nach einer Woche der Fall. Aber trotz der übernatürlichen Mauern, die sie zwischen dem Unheil und mir aufgerichtet hatte, fand sie keinen Frieden. Mehrere Nächte lang quälte sie ein schrecklicher Albtraum: Ratten nagten an dem Teppich, auf dem sie lag, dann machten sie sich über ihre Zehen her, dann über die Füsse und krochen an den Knochen entlang hoch, an denen sie gierig knabberten. Sobald sie ihren Unterleib erreicht hatten, fuhr sie aus dem Schlaf hoch, schweissgebadet, mit zitternden Händen und Sturm im Herzen. Sie machte in der Nacht kein Auge mehr zu. Zwar wollte Tante Sinab sie zur Vernunft bringen, aber nichts half.
Taschfin blieb nichts anderes übrig: Er musste seinen Putzkasten meinem Arbeitsplatz gegenüber aufstellen und durfte sich unter keinem Vorwand davon entfernen. Mutter hatte ihn vorgewarnt, dass er sich beim kleinsten Vergehen ein Ersatzheim suchen müsse, denn unseres wäre ihm dann für immer verschlossen. Und wenn meine korpulente Mutter ihre grossen, kajalumrandeten Augen mit strengem Blick auf einen richtete, bekam man Gänsehaut. Taschfin war der Leidtragende: Er wusste, dass es von grossem Nachteil für sein eigenes Geschäft war, wenn er auf mich aufpassen musste, denn der Erfolg eines Schuhputzers liegt in seiner Mobilität: Strassencafés, Plätze, Ladenpassagen… Er wusste aber auch, dass Mutter ihn verdächtigen würde, in die Kasse zu greifen, wenn er nicht mehr die gewohnten Einnahmen heimbrachte. Wohl hatte er einen schüchternen Protest angedeutet, aber die Antwort war ein pathetisches »Es geht um das Leben deines Bruders!«. Ich glaube, von diesem Moment an mochte mich Taschfin nicht mehr. Eine Abneigung, die sich über Jahre halten sollte. Ich musste all meine Phantasie und eine unendliche Geduld aufbieten, sie zu überwinden. Es lag nicht an mir, dass ich so viel Platz in dieser Familie einnahm, aber es drehte sich alles um mich, ich war der Mittelpunkt der Unterhaltungen, ich wurde verhätschelt wie jedes andere Nesthäkchen auch, aber immer im Hinblick darauf, dass ich ja den Topf am Kochen hielt. Taschfin war eifersüchtig, und das war völlig normal: An seiner Stelle wäre das jeder gewesen. An dem Tag, als Mutter mit grossem Trara die drei Jahre meines ununterbrochenen Erfolgs im Beruf feierte, wäre er vor Ärger fast draufgegangen, denn noch nie war etwas, was ihn betraf, gefeiert worden. Nicht einmal seine Beschneidung, die ein Friseur auf die Schnelle im Hinterzimmer seines Salons vorgenommen hatte. Ausser einer schlimmen Entzündung, die drei Monate lang dauerte, hatte er nichts bekommen, nichts von dem, was mir zuteilwurde: kein Opferlamm für Sidi Bel Abbâs, einen der Schutzheiligen unserer Stadt, keine Abendgesellschaft, in der Sängerinnen bis spät in der Nacht das Tamtam schlugen, zum grössten Vergnügen der komplett versammelten Familie, der Nachbarinnen und meiner zahlreichen Mamas. Als Reaktion auf diese Ungerechtigkeit war Taschfin zwei ganze Tage lang verschwunden, aber man hatte seine Abwesenheit kaum bemerkt, so geschäftig ging es im Haus zu. Ohne die Zwillinge, die ihn auf einer Bank im Stadtpark auflasen– sein Schuhputzkasten und seine Adidas-Kappe waren weg, und er war in einem jämmerlichen Zustand, denn man hatte ihn geschlagen, vergewaltigt, in den Hals gebissen
3
Schwierig, noch wie ein Säugling auszusehen, wenn man drei Jahre alt ist. Der Konkurrenzkampf wurde hart, denn es gab Babys, die man schon für einen Pappenstiel mieten konnte. Meine Glückssträhne war nicht für die Ewigkeit, das wussten wir. Auch göttliche Gaben verkümmern im Lauf der Zeit und gehen ein. Damit ich konkurrenzfähig blieb, kontrollierte Mutter meine Ernährung aufs genaueste, sie war nun eingeschränkt auf Magermilch, Eisenkrauttee und leichte Gemüsesuppen, die ich im Fläschchen zu mir nahm. Einzige Ausnahme: der Freitag, an dem es unmenschlich gewesen wäre, mir den Kuskus vorzuenthalten. Aber auch da bereitete Mutter nur in kleinen Mengen Sultansbuletten für mich zu, aus Griess, Kürbis, Rüben und Fleisch, die sie mir in den Mund steckte: ein köstlicher Moment, den ich immer ungeduldig erwartete! Im Gegensatz zu meinen Kollegen bettelte ich freitags nicht an den Moscheen- und Friedhofstüren, wenn auch das Geschäft dort florierte. Mutter war zu stolz dafür: Es war der Beweis, dass sie nicht aufs Geld aus war und es nicht dem Stil des Hauses entsprach, sich mit den Armen aus der Gosse auf eine Stufe zu stellen. In Wirklichkeit machte sie aus der Not eine Tugend: Die Bettlerinnen hatten meine Gegenwart nicht nötig, denn am Tag des Herrn waren die Gläubigen sowieso grosszügig.
Mutter hatte es sich angewöhnt, meine Beine mit Bändern zu umwickeln, die sie so fest zurrte, dass sich mein Körper damit abfand, sein Wachstum auf später zu verschieben. So eingeschnürt, sah ich weiterhin wie ein Baby aus. Mein abgezehrtes Gesicht und mein Kopf, kaum grösser als eine Pampelmuse, verrieten den Trick nicht. Die Passanten spürten in mir etwas Merkwürdiges, konnten es sich aber nicht erklären. Waren es meine in ein Säuglingsgesichtchen eingesetzten Erwachsenenaugen? Jedenfalls war die Verwirrung, in die sie diese Anomalie brachte, hervorragend für das Geschäft: Da sie stehen blieben, um mich anzuschauen, waren sie umso leichter zu angeln. Ich verdiente also weiterhin gewitzt meinen Lebensunterhalt und den der Meinen. Aber die Zeit arbeitete gegen uns, denn allem und jedem zum Trotz entwickelte ich mich. Und je mehr Mutter mich beobachtete, umso mehr peinigte sie die Angst, mich wachsen zu sehen. Anfangs hatte sie mich bis zur Taille in ihre Bandagen gewickelt, aber je mehr Veränderungen, echte oder eingebildete, sie an meinem Körperumfang bemerkte, umso höher ging sie mit dem Stoff hinauf und umso fester zurrte sie ihn. Immerhin hörte sie unter den Achseln auf und liess meine Arme frei, denn das war praktischer, um an eine Brust heranzukommen, an ein Spielzeug oder um die Intimität einer Zufallsmama auszukundschaften. So kam es vor, dass ich meine Hand etwas unterhalb des Nabels spazieren führte und, wenn man mir keinen Widerstand entgegensetzte, dieses verlockende Gebiet mit den einzigartigen Ausdünstungen erforschte; blind berührte ich dieses feuchte Relief, das manchmal rau und dicht behaart, manchmal heiss und glatt war und aus Graten und Einbuchtungen bestand, und dabei zeichnete ich im Geist die Umrisse dieses merkwürdigen Tiers nach. Ich fand Gefallen daran, ich genoss diese gesegneten Momente, die ein jäher Klaps unweigerlich unterbrach. Ich beruhigte mich dann zwar, gab aber noch lange nicht klein bei. Sobald ich eine neue Mama bekam, musste ich auf die eine oder andere Weise ihr Tier betasten. Es brauchte Jahre, ehe ich endlich eines in Wirklichkeit sah. Es war Mûnia, die mir diese Gnade schenken würde, in ihrem möblierten Zimmer in unserer ersten Nacht in Casablanca. Ich werde Ihnen ihre Geschichte später erzählen. Unsere Geschichte…