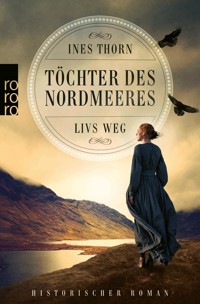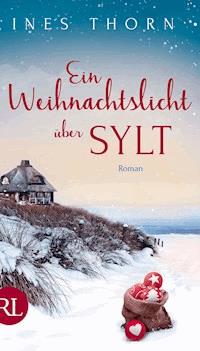8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau in den Wirren der Revolution.
Frankfurt 1848. Die Stadt ist in heller Aufregung. Die Nationalversammlung tagt in der Paulskirche. Auch der Verleger Joseph Rütten wird von dieser Aufbruchsstimmung angesteckt. Mit seinem Geschäftspartner Zacharias Löwenthal möchte er all die wesentlichen Texte drucken, um die Revolution zu befördern – allen voran den Roman »Wally – die Zweiflerin « von Gutzkow. Doch seinen Verlag plagen nicht nur Probleme mit der Zensur, sondern zudem große Geldsorgen. Und er ist verliebt – in Wilhelmine Pfaff, die Witwe eines Druckers. Die revolutionäre Atmosphäre in der Stadt droht umzuschlagen. Zwei Delegierte werden ermordet – und bald hat die Obrigkeit eine Verdächtige gefunden: Henriette Zobel, eine Freiheitskämpferin und Wilhelmines beste Freundin ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Ines Thorn
Ines Thorn wurde 1964 in Leipzig geboren. Nach einer Lehre als Buchhändlerin studierte sie Germanistik, Slawistik und Kulturphilosophie. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Als Aufbau Taschenbuch sind lieferbar: »Die Walfängerin«, »Die Strandräuberin« sowie »Ein Stern über Sylt«. Bei Rütten & Loening ist zudem erschienen »Ein Weihnachtslicht über Sylt«.
Informationen zum Buch
Eine Frau in den Wirren der Revolution.
Frankfurt 1848. Die Stadt ist in heller Aufregung. Die Nationalversammlung tagt in der Paulskirche. Auch der Verleger Joseph Rütten wird von dieser Aufbruchsstimmung angesteckt. Mit seinem Geschäftspartner Zacharias Löwenthal möchte er all die wesentlichen Texte drucken, um die Revolution zu befördern – allen voran den Roman »Wally – die Zweiflerin « von Gutzkow. Doch seinen Verlag plagen nicht nur Probleme mit der Zensur, sondern zudem große Geldsorgen. Und er ist verliebt – in Wilhelmine Pfaff, die Witwe eines Druckers. Die revolutionäre Atmosphäre in der Stadt droht umzuschlagen. Zwei Delegierte werden ermordet – und bald hat die Obrigkeit eine Verdächtige gefunden: Henriette Zobel, eine Freiheitskämpferin und Wilhelmines beste Freundin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ines Thorn
Der Horizont der Freiheit
Roman
Inhaltsübersicht
Über Ines Thorn
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Zweiter Teil
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Epilog
Nachwort
Impressum
Prolog
Der Morgen hing schwer über den Dächern der Stadt. Es nieselte, und der kalte Wind kühlte Joseph Rüttens Gesicht. Wilhelmine Pfaff neben ihm hatte die Arme um ihren Oberkörper geschlagen. Sie war blass, doch sie rang sich ein Lächeln ins Gesicht. Sie standen vor den Toren der städtischen Irrenanstalt zu Frankfurt und blickten in das Innere einer Kutsche.
»Habt Ihr alles?«, fragte Rütten.
Der Mann in der Kutsche nickte. »Ja. Danke. Habt herzlichen Dank. Ohne euch …« Er brach ab.
Die Frau neben ihm hatte das Gesicht gegen das Kutschenfenster gelehnt und die Augen geschlossen. Sie sah erschöpft aus.
»Gute Reise«, sagte Wilhelmine leise. »Sie soll mir schreiben. Sagt ihr das. Unbedingt!«
Der Mann in der Kutsche nickte. »Ich sage es ihr, wenn wir in Leipzig sind.«
Dann gab er dem Kutscher ein Zeichen, und das Gefährt setzte sich in Bewegung.
Wilhelmine zog ein weißes Taschentuch aus ihrem Ärmel und winkte. Eine heimliche Träne stahl sich über ihre Wange.
Auch Joseph Rütten winkte. Als die Kutsche um die Ecke gebogen war, ließen beide die Arme sinken.
Rütten legte eine Hand auf Wilhelmines Arm. »Es ist geschafft«, sagte er.
Wilhelmine nickte. Sie fühlte sich so müde und abgekämpft.
»Ihr solltet nach Hause gehen und Euch noch ein wenig hinlegen«, sagte er. »Wir können sonst nichts mehr tun.«
Wilhelmine lächelte kläglich. »Ich bete, dass sie es schaffen.«
Dann stieg sie neben Joseph Rütten in die Mietdroschke, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartete. Sie fuhren durch eine Vorstadtlandschaft. Nebel hing über den Wiesen, schnitt Bäume ab. Am Horizont kündigte ein silbrig-roter Streifen die Morgendämmerung an. Als sie in die Stadt hineinkamen, klapperten die Hufe der Pferde auf dem nassen Pflaster. Für Wilhelmine hörte es sich wie Gewehrschüsse an.
Im Großen Hirschgraben stiegen beide aus, Joseph entlohnte den Kutscher.
»Legt Euch hin«, wiederholte er. »Ihr habt viel durchgemacht.«
»Und Ihr?«, wollte Wilhelmine wissen.
Joseph Rütten blickte am Haus, das seine Literarische Anstalt beherbergte, nach oben. Er steckte die Hände in die Hosentaschen und zog die Schultern zusammen. »Ich werde mit Loewenthal reden. Es gibt viel zu besprechen.«
Wilhelmine nickte. Dann strich sie Rütten kurz über den Arm und überquerte die Straße, öffnete die Haustür und verschwand dahinter.
Joseph Rütten verharrte noch einen Augenblick auf der Straße. Er hob das Gesicht zum Himmel und ließ sich die Stirn vom Nieselregen kühlen. Dann seufzte er und begab sich ins Haus.
Er fand seinen Compagnon Loewenthal in dessen Arbeitszimmer. Loewenthal saß hinter seinem Schreibtisch. Die Petroleumlampe zeichnete seine Züge weich. Vor ihm stand ein leeres Glas Rotwein, doch die Karaffe daneben war noch halb voll.
»Möchtest du?«, fragte er.
Rütten ließ sich auf einen hohen Lehnstuhl fallen, streckte die Beine von sich. »Rotwein zum Frühstück? Warum eigentlich nicht?« Sein Lächeln saß ein wenig schief.
Loewenthal erhob sich, goss dem Freund ein Glas ein und reichte es ihm. »Ist alles gutgegangen?«
»Ja.«
Loewenthal zog die Augenbrauen nach oben. Eine solch knappe Antwort war er von seinem Partner nicht gewöhnt.
Rütten trank das Glas in einem Zug leer, dann erhob er sich und trat ans Fenster. Er blickte hinüber zu Wilhelmines Schlafzimmer, das keinen Aufschluss darüber gab, ob sich die Freundin bereits zu Bett begeben hatte. Zwei Häuser weiter holte Hildemarie Bingel die schwarzrotgoldene Fahne ein, zerrte an dem Stoff, ließ ihn schließlich verärgert auf den Gehweg fallen und schlug ihr Fenster mit einem lauten Krachen zu. Die Fahne blieb im Rinnstein liegen.
Loewenthal war zu Rütten getreten.
»Siehst du das?«, fragte er. »Bald wird es in der ganzen Stadt keine schwarzrotgoldenen Fahnen mehr geben.«
Rütten nickte. Plötzlich fühlte auch er sich unsagbar müde. Doch es war nicht nur der fehlende Nachtschlaf, der ihm in den Knochen hockte. Er hatte so viel gewollt, so viel gehofft. Und nun?
»Glaubst du, wir sind gescheitert?«, fragte er Loewenthal.
Sein Partner schwieg eine kleine Weile, ehe er antwortete: »Wir haben noch unsere Literarische Anstalt. Wir werden weiterkämpfen.«
Erster Teil
1. Kapitel
Frankfurt, 1845
Mit Politik haben wir nichts am Hut«, erklärte Wilhelmine Pfaff und strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Sie stand in Frankfurt am Main vor dem Haus Großer Hirschgraben 4 und funkelte Joseph Rütten verärgert an. »Das lohnt die Mühe kaum, und Ärger gibt es obendrein.« Um ihre Meinung zu bekräftigen, verschränkte sie die Arme vor der Brust, so dass das blaue Tuchkleid ein wenig in die Höhe rutschte. An Sonn- und Feiertagen trug sie einen Reifrock und ein wunderbar geschnittenes Kleid, oben eng und unten weit, das sich über dem Reifrock bauschte. Auch steckte sie sich das volle braune Haar hoch und drehte sich Löckchen in die Strähnen, die ihr Gesicht umrahmten. Aber heute war Donnerstag und also nicht einmal Markttag, und mit ihrem Reifrock würde sie am Ende noch in die Gewindepresse geraten oder sich mit der Druckerfarbe beschmutzen. Sie hatte zugenommen in der letzten Zeit, doch das störte sie nicht, weil es Walther nicht störte. Selbst das Salzweib, das auf jedem kleinen Fehler endlos herumhackte, hatte nur gesagt: »Da habt Ihr was zum Zusetzen, wenn Ihr mal krank werdet.« Im Augenblick tat die Haushälterin so, als würde sie die Fensterbretter in der Wohnstube der Pfaffs sauber wischen, dabei wusste jeder, der Frau Salzmann kannte, dass sie dort nur wischte, um zu hören, was die Pfaffin mit dem Verleger Joseph Rütten zu besprechen hatte.
»Jetzt seid doch nicht so hartherzig, Wilhelmine, wir kennen uns nun schon so lange. Wir sind Nachbarn, die Literarische Anstalt Rütten und Loewenthal liegt Eurer Druckerei genau gegenüber. Und wir sind wirklich in Not. Ihr braucht die Schriften ja auch gar nicht zu lesen, sondern nur zu drucken.« Rütten schob sich das schon ein wenig schüttere, dunkle Haar aus der Stirn und fuhr mit dem Finger in den engen Kragen, als würde ihm die Luft abgeschnürt.
»Damit wir die Obrigkeit an den Hals kriegen?« Wilhelmine Pfaff schüttelte den Kopf. »Und damit wir dieselben Schwierigkeiten bekommen wie Ihr mit Euren wirrköpfigen Freunden? Außerdem müssen die Sachen gesetzt werden, und das kann man nun mal nicht mit zugekniffenen Augen.«
»Nur dieses eine Mal!«
Wilhelmine seufzte. Ihr ging es gar nicht gut. Es fühlte sich an, als würde sie eine kräftige Erkältung bekommen. Zum Streiten fehlte ihr die Kraft. Sie wusste genau, dass der Verleger Joseph Rütten zu ihrem Mann ging, ihn ins nächste Gasthaus lockte und dort um den Finger wickelte. Wenn sie jetzt ja sagte, bliebe ihrem Mann ein Besäufnis erspart. Doch sie schüttelte erneut den Kopf, denn die Pfaffin war eine kluge Frau. Walther Pfaff würde nichts sagen, wenn sie wieder einmal die Geschäfte an sich riss, doch Wilhelmine wusste, dass er heimlich darüber seufzte. Schließlich war er der Inhaber der Pfaff’schen Druckerei, und ihm stand es zuvörderst zu, Aufträge anzunehmen oder abzulehnen. Und Wilhelmine ließ ihn im Glauben, dass er die Geschäfte fest in seinen Händen hielt, auch wenn es nicht so war.
»Walther soll entscheiden«, sagte sie also. »Rütten, Ihr könnt gleich mitkommen und Euch den Bescheid abholen.«
Sie drehte sich um und verschwand im Haus.
Der Eingang der Pfaff’schen Druckerei befand sich im Erdgeschoss des Hauses Großer Hirschgraben 4, direkt gegenüber der Literarischen Anstalt von Joseph Rütten und Dr. Zacharias Loewenthal, und zog sich im rechten Winkel zum Graben und zum Pfaff’schen Wohnhaus nach innen.
Wilhelmine öffnete die Tür und verzog das Gesicht. Der Lärm war ohrenbetäubend, der Geruch der Druckerfarbe setzte sich auf der Stelle in den Kleidern und Haaren fest. Walther Pfaff stand an einer Druckpresse und drehte am Griff. Der Geselle suchte im Setzkasten herum, den Winkelhaken unter den Arm geklemmt, und holte ein paar Lettern heraus. Wilhelmine stellte sich neben ihren Mann und tippte ihm leicht auf die Schulter. Walther Pfaff war einen halben Kopf kleiner als seine Frau, trug einen beachtlichen Bauch vor sich her und eine vom Wein rot geäderte Nase im Gesicht. Seine hellblauen Augen blickten klug und neugierig in die Welt. Er war nicht nur Drucker mit Leib und Seele, sondern auch ein Genießer vor dem Herrn. Es gab beinahe keinen Tag, an dem er am Nachmittag nicht in eines der Kaffeehäuser ging und sich dort eine heiße Schokolade und eine Zigarre bestellte. Kam er dann nach Hause, küsste er sein Weib herzhaft und fragte, während er sich die Hände rieb: »Was hat das Salzweib gekocht? Soll ich einen Riesling aus Rheinhessen, einen Dornfelder oder einen Grauburgunder aus dem Elsass öffnen?«
Doch es war gerade einmal kurz nach halb zehn am Vormittag, die leiblichen Genüsse daher noch fern.
Walther fuhr herum, als er Wilhelmines Hand auf seiner Schulter spürte. »Rütten ist da«, brüllte sie über den Lärm hinweg. »Er will, dass du ihm etwas druckst.«
Walther nickte, wandte sich zu Joseph Rütten um und lächelte. »Sie hat Euch bereits abgewiesen?«, fragte er.
Joseph Rütten nickte. »Wie immer.«
Wilhelmine zog die Schultern hoch, schürzte die Lippen, dann winkte sie ab und begab sich durch eine Seitentür in die Küche des Wohnhauses.
»Was soll ich drucken?«, fragte Walther und wischte sich die schwarz verschmierten Hände an einem alten Lappen ab.
»Wally, die Zweiflerin von Karl Gutzkow«, erwiderte Rütten. »Und zwar so schnell Ihr könnt.«
»Worum geht es darin?«
Rütten schüttelte den Kopf. »Das wollt Ihr gar nicht so genau wissen.«
»Doch!«, beharrte Pfaff. »Ich kann es mir nicht leisten, mich mit der Obrigkeit anzulegen. Ist das der Roman, für den der Gutzkow vor ein paar Jahren wochenlang im Gefängnis gesessen hat? Damals, als er noch Mitarbeiter beim Verleger Sauerländer war? Mir scheint, Gutzkow ist keiner, der in Frankfurt gut angeschrieben ist. Am Ende war er auch auf dem Hambacher Fest dabei. Zumindest trägt er einen der Bärte, die als Hambacher Bärte verschrien und – wenn mich nicht alles täuscht – verboten sind. Ein Revoluzzer also, ein Krawallmacher.« Er brach ab und strich sich nachdenklich über das Kinn, das vor Jahren ebenfalls von einem Hambacher Bart bedeckt gewesen war. »Sein Vortrag hat mir gefallen, das muss ich zugeben. Die Museumsgesellschaft hatte ihn eingeladen. Es gab viel Applaus, und auch meinen Beifall hatte er.«
»Na, seht Ihr, Pfaff. Ihr kennt den Gutzkow und wisst, dass er kein schlechter Mann ist.«
»Trotzdem!«, beharrte der Drucker. »Ich habe eine Familie. Ginge es nur nach mir, dann wäre vieles anders. Aber ich habe die Wilhelmine, habe den Gesellen und das Salzweib, um die ich mich kümmern muss. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das, was Ihr von mir gedruckt haben wollt, dem Rat Freude bereiten würde.«
Rütten seufzte. »Ich will Euch nicht belügen, Walther. Ja, der Obrigkeit wird’s nicht gefallen. In Mannheim ist der Roman bis heute verboten. Loewenthal hatte ihn dort vor ein paar Jahren gedruckt. Die Hölle war los! Es gab sogar einen Ächtungsbeschluss. Seither will niemand mehr die Wally von Gutzkow drucken.«
»Also, worum geht es in dem Buch?«
Rütten seufzte. »Die junge Wally, Heldin des Romans, und ihr Freund Cäsar ringen um sexuelle Freiheit. Sie zweifeln an Gott, Papst und Kaiser und …«
»Hört auf, ich habe genug gehört.« Walther runzelte die Stirn. »Also, Rütten, wir wissen beide, dass sich etwas ändern muss in diesem Land. So, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen.«
Rütten nickte. »Ihr spielt auf den Schlesischen Weberaufstand an?«
Walther schüttelte den Kopf. »Schlesien ist weit weg. Ich meine die Veröffentlichung von Heinrich Heines Deutschland, einWintermärchen bei Hoffmann und Campe. Und damit meine ich natürlich auch das zersplitterte Land, die zahlreichen, manchmal winzigen Herrschaftsgebiete, die immer mal wieder aufkommenden Aufstände, die Veränderung der Arbeitswelt durch die Dampfmaschine. Wir brauchen Reformen an jeder Ecke, wir brauchen ein richtiges Parlament. Aber das wisst Ihr, Rütten, alles viel besser als ich.«
»Möglich«, erwiderte Rütten. »Aber wie sollen wir unsere Ansichten verbreiten, wenn die Drucker uns einen Korb geben?«
Walther fuhr sich durch das schüttere graue Haar, so dass es hernach an den Seiten etwas abstand. »Ich kann Euch das Buch nicht drucken. Es kann allerdings sein, dass ich in den nächsten Nächten vergesse, die Tür der Druckerei abzuschließen. Wilhelmine und ich haben einen sehr tiefen Schlaf. Und der Geselle kann immer einen zusätzlichen Groschen gebrauchen.«
Rütten nickte. »Ihr seid kein Feigling, Walther. Aber ich hoffe, ich finde noch anderswo einen Drucker, der mir das Buch ganz ohne solche Umstände setzt und druckt. Habt Dank, Walther, ich weiß Euer Angebot zu schätzen.«
Rütten nickte Pfaff zu, dann verließ er die Druckerei, blieb vor dem Haus stehen und blickte nach oben. Dort lehnte Wilhelmine aus dem Fenster. »Und?«, rief sie zu ihm hinunter. »Macht er es?«
Rütten hob bedauernd die Schulter.
»Wusste ich es doch.« Mit einem Knall schlug Wilhelmine Pfaff das Fenster zu.
Sie blieb mitten in der Wohnstube stehen und sah sich um. Die Haushälterin Frau Salzmann wischte mit dem Wedel die Spinnweben aus den Ecken. »Wir haben für all das hier schwer gearbeitet, Salzweib«, sagte Wilhelmine. »Rütten muss doch verstehen, dass wir das nicht wegen seiner konspirativen Druckwerke aufs Spiel setzen können.«
»Hmm«, machte die Haushälterin. Sie hieß eigentlich Gertrud Salzmann, doch dass Wilhelmine und Walther sie »Salzweib« getauft hatten, störte sie nicht. Sie war eine kleine, magere Frau mit schlohweißen Haaren, einer großen Nase und einem Mund, der ganz spitz wurde, wenn sie sich ärgerte. Walther nannte sie manchmal liebevoll »unser Frankfurter Schlappmaul«, denn niemand konnte besser mit Worten beißen als Frau Salzmann.
»Was soll ›hmm‹ denn heißen, Salzweib?« Wilhelmine stemmte die Hände in die Hüften.
»Ich meine nur: Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.«
»Das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun«, erwiderte Wilhelmine barsch und beschloss wieder einmal, Frau Salzmann zu entlassen. Sie wusste genau, was die Haushälterin gemeint hatte: dass Walther nämlich die Druckerei von seinem kinderlosen Onkel geerbt hatte, samt dem Haus im Großen Hirschgraben, nur ein paar Häuser von Goethes Geburtshaus entfernt. Und dann hatte das Salzweib wahrscheinlich noch Wilhelmines Mitgift gemeint, die es Walther ermöglicht hatte, neue Druckpressen anzuschaffen. Und Wilhelmine wusste auch, dass das Salzweib sich schon seit einer ganzen Weile Gedanken darum machte, wer die Druckerei einmal erben würde, denn Walther und sie hatten leider keine Kinder bekommen, während Frau Salzmanns älteste Tochter in den vergangenen zehn Jahren gefühlt immer schwanger gewesen war. Sie hätte es liebend gern gesehen, wenn Wilhelmine die Patentante eines der vielen kleinen Salzkinder geworden wäre, doch zu Wilhelmines Glück hatte sie nie danach gefragt.
Plötzlich wurde Wilhelmine ganz schwindelig. Eben noch hatte sie sich wieder ein wenig besser gefühlt, doch nun zitterten ihr die Knie, der Schweiß brach ihr aus allen Poren. Ihr war schon schwummerig gewesen, als sie am Morgen aufgestanden war, doch auf einmal taten ihr Kopf und Rücken weh, und sie schlug die Zähne aufeinander, als hätte sie Schüttelfrost.
Das Salzweib ließ den Staubwedel sinken. »Ihr seid ja weiß wie eine Wand.«
Wilhelmine nickte. »Ich muss mich setzen. Besser noch hinlegen.« Sie hielt sich an der Stuhllehne fest. »Kannst du mir helfen, Salzweib?«
»Soll ich den Doktor Hoffmann holen?«
»Nein, nein. Ich muss mich nur eine halbe Stunde hinlegen, dann wird es mir gleich besser gehen.«
Sie stützte sich auf Frau Salzmann, die sie mehr in die Schlafstube trug als führte.
»Hoffentlich sind das nicht die Blattern«, sagte sie besorgt und suchte Wilhelmines Haut aufmerksam nach den typischen roten Flecken ab. »Zur Messe soll ein Engländer die Blattern nach Frankfurt mitgebracht haben.« Sie schüttelte die Kissen auf und schlug die Bettdecke zurück.
Wilhelmine ließ sich stöhnend auf das Lager sinken. »Einen furchtbaren Durst habe ich«, sagte sie. »Ich könnte einen ganzen Melkeimer austrinken.«
Das Salzweib begab sich in die Küche, füllte einen Krug mit Wasser, trug ihn und einen Becher in die Schlafstube. »Ich schaue nachher nach Euch. Und wenn es nicht besser geht, hole ich Doktor Hoffmann.«
Wilhelmine nickte schwach und trank gierig von dem Wasser.
***
Am nächsten Tag ging es ihr nicht besser, und zu allem Unglück zeigte Walther die gleichen Krankheitszeichen wie seine Gattin. Doktor Hoffmann, gut bekannt mit Walther, verzog besorgt das Gesicht. Er hatte schon geahnt, dass das die Blattern waren. Herrje, die halbe Vorstadt war daran erkrankt. Er hatte vergeblich gehofft, dass sich die Blattern an den Stadtmauern aufhalten ließen. Er seufzte schwer und blickte besorgt zu Walther, der neben dem Bett seiner Frau stand und beinahe so bleich war wie sie. »Du solltest Frau Salzmann sogleich in die Apotheke schicken, damit sie Mumienpulver kauft. Aber sie soll zusehen, dass es das gute Pulver von Merck aus Darmstadt ist und nicht eines, das jemand aus einem Mainkiesel geschliffen hat. Dann soll sie das Pulver in reichlich Wasser auflösen und deinem Weib zu trinken geben.«
Walther Pfaff rief nach dem Salzweib und schickte sie auf der Stelle los, wobei er ihr androhte, sie selbst zu Mumienpulver zu machen, wenn sie sich nicht eilte.
Doch das Pulver half nicht. Auch Walther wurde von Tag zu Tag schwächer, und nach zwei Tagen bekam er Fieber und Schüttelfrost, nach drei Tagen wies er den Gesellen in die Auftragslage ein, und am vierten Tag zog er seinen Rock aus und begab sich in die Schlafstube.
Walther und Wilhelmine lagen nebeneinander in ihren Betten, und nach fünf Tagen zeigten sich bei Walther die ersten Blasen im Gesicht und an den Händen und überzogen schon bald den gesamten Körper mit übelriechenden Eiterbläschen, während das Salzweib bereits dabei war, Wilhelmines Ausschlag mit einer Salbe aus Zink und Hammelfett einzureiben, die entsetzlich stank. Auch ihr Fieber, das zwischenzeitlich schon gesunken war, stieg wieder. Das Salzweib hatte an den schlimmen Tagen neben dem Ehebett gesessen und hatte abwechselnd kühle Tücher auf Wilhelmines oder Walthers Stirn gelegt. Sie hatte keine Angst vor den Blattern, weil sie als Kind daran erkrankt gewesen und nun immun dagegen war. Sie eilte zwischen Küche und Bett hin und her, braute heilende Tränke, machte kalte Wickel. Wilhelmine bekam nicht viel davon mit. Genau wie Walther dämmerte sie mehr tot als lebendig dahin. Nur einmal erwachte sie, griff nach der Hand von Frau Salzmann und fragte leise: »Muss ich jetzt sterben?« Das Salzweib schüttelte heftig den Kopf, zog ein wenig die Nase hoch, damit Wilhelmine ihre belegte Stimme für ein Erkältungszeichen hielt, und sagte leise: »Wer wird denn gleich mit dem Schlimmsten rechnen? Ihr seid zäh wie altes Leder, glaubt mir.«
Wilhelmine beruhigte sich und schlief und schlief, während Walther neben ihr hoch fieberte, manchmal sogar ins Delirium abglitt und nach seiner Mutter rief.
Während es Wilhelmine allmählich wieder besser ging, siechte Walther neben ihr dahin. Nach zwei Wochen stand Wilhelmine mit Hilfe des Salzweibes das erste Mal wieder auf, während Walther nicht mehr ansprechbar war. Und nach drei Wochen war Wilhelmine wieder gesund, wenn auch noch sehr schwach. Walther hingegen starb in der Nacht.
Wilhelmine saß, kaum genesen, auf der Küchenbank und grub die Zähne in die Unterlippe, um nicht zu schreien. Walther war tot; sie war nun ganz auf sich allein gestellt. Was sollte sie tun? Wilhelmine wusste, dass viele sie für eine starke Frau hielten, aber das hatte sie nur sein können, weil Walther hinter ihr gestanden hatte. Plötzlich fühlte sie sich einsam, allein und verlassen wie ein ausgesetztes Kind.
»Was soll nun werden?«, fragte sie das Salzweib.
»Wir werden sehen. Vielleicht findet sich ja jemand, der Euch heiratet, obgleich der Apfelschimmer der Jugend nicht mehr auf Eurer Haut liegt.«
Wider Willen musste Wilhelmine über diesen Vergleich lächeln, aber dann wurde sie ernst. »Ich will nicht wieder heiraten«, sagte sie leise. »So gut wie Walther wird keiner mehr sein.«
»Er wird Euch einiges vererbt haben. Ich bin sicher, Ihr habt ausgesorgt«, erklärte das Salzweib.
Das hoffte Wilhelmine auch von ganzem Herzen, aber eine merkwürdige Unruhe nagte an ihr. Sie zog sich den Witwenschleier über und begab sich zu ihrer Hausbank, der Bethmann-Bank, gleich um die Ecke.
»Mein Gatte ist gestorben«, erklärte sie.
Der alte Baron Bethmann nickte. »Ich habe es gehört. Einen Kranz werden wir zur Beerdigung schicken; immerhin war er ein jahrelanger Kunde.«
»Gekommen bin ich, weil ich den Bestatter bezahlen muss, den Sarg, den Leichenschmaus. Sagt mir, wie es um meine Finanzen steht.«
Der alte Bethmann kratzte sich am Kopf. »Nun, viel hat er nicht hinterlassen, der Eure.« Der Bankier zog einen Registerkasten auf und blätterte in den Akten. Endlich hatte er ein Kontobuch gefunden, auf dem der Name »Walther Pfaff« stand. Er blätterte darin, dann seufzte er auf.
»Wie viel Geld habe ich?«, drängte Wilhelmine.
»Nichts«, erwiderte Bethmann leise.
»Wie bitte? Ich habe doch tatsächlich ›nichts‹ verstanden.« Wilhelmine legte eine Hand hinter ihr Ohr und neigte den Kopf.
»Nun … das sagte ich auch. Ich sagte: ›Nichts.‹ Eigentlich ist es sogar noch schlimmer: Ihr habt Schulden bei mir. Nicht viel, nur noch die Zinsen für einen kleinen Kredit, der als solcher kurz vor dem Tod Eures Mannes abgelöst wurde.«
Wilhelmine Pfaff spürte, wie ihr die Knie wieder weich wurden. Ich bin doch noch nicht gesund, dachte sie. Wahrscheinlich sind mir die Blattern aufs Gehör geschlagen. »Zeigt mir das Kontobuch her«, verlangte sie, und der Bankier Bethmann tat wie geheißen.
Wilhelmine blätterte mit spitzen Fingern die Seiten durch und konnte nicht glauben, was sie da sah.
»Wo ist denn unser ganzes Geld hin?«, wollte sie wissen.
Bethmann räusperte sich. »Nun, er hat investiert, der verehrte Herr Pfaff.«
»Investiert? Was heißt das genau?«
Wieder räusperte sich Bethmann.
Wilhelmine zog die Augenbrauen in die Höhe. »Habt Ihr ihm das Geld aus der Tasche geluchst?«
Bethmann schüttelte den Kopf. »Nun, ich habe ihn zu nichts gezwungen. Aber Kapital vermehrt sich eben nur, wenn es arbeitet. Er selbst hatte den Einfall, sein Geld anzulegen. Er hat in die städtische Dampfbootflotte investiert.«
»Es gibt keine städtische Dampfbootflotte«, erklärte Wilhelmine und funkelte Bethmann misstrauisch an.
»Genau.«
»Und woher wusste mein verstorbener Gatte von der Dampfbootflotte? Wer hat ihm diesen verdammten Floh ins Ohr gesetzt?« Wilhelmine wurde ein wenig lauter.
»Es hieß, die Stadt würde Dampfboote anschaffen, die auf dem Main von Aschaffenburg bis Mainz verkehren sollen. Und ab Mainz dann den Rhein hinauf nach Norden. So, dass die Messleute mit dem Schiff kommen können. Ein Umschlagplatz für alle Waren aus dem Norden sollte Frankfurt werden.«
»Aber geworden ist nichts! Wo ist das Geld jetzt, will ich wissen?«
Die Pfaffin blickte sich um und sah den Kronleuchter aus bestem Muranoglas an der Decke hängen, sie sah auch die Seidentapeten und den neuen Schreibtisch aus echtem Mahagoniholz, hinter dem der Baron Bethmann hockte. Sein Anzug war aus feinstem flandrischem Tuch, das Halstuch war aus federleichter Seide, und an seinem kleinen Finger prangte ein dicker Siegelring.
»Ich verstehe Euren Ärger, Pfaffin. Das Bankhaus Bethmann wird sich seinen treuen Kunden gegenüber wie immer sehr kulant zeigen. Hier, seht!« Er tunkte eine Feder in das Tintenfass, dann strich er schwungvoll die Schulden aus dem Kontobuch und blickte Wilhelmine Beifall heischend an.
Wilhelmine, zu erschüttert, um irgendetwas zu sagen, drehte sich um und ging davon.
2. Kapitel
Wir haben heute Jahrestag, dachte Joseph Rütten und malte ein kleines rotes Kreuz in seinen Kalender. Genau vor einem Jahr, am 1. Juli 1844, hatte im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels die Anzeige gestanden, dass in Frankfurt am Main von Herrn Joseph Rütten und unter Mitwirkung von Dr. Zacharias Loewenthal eine Literarische Anstalt gegründet worden war. Joseph Rütten hatte es sich nicht nehmen lassen, voller Stolz zu bekennen: »Wir wollen unsere Arbeit zum Wohle und Gedeihen unserer Literatur ausführen und wenigstens nie dazu beitragen, die Zahl der unnützen Bücher zu vermehren.«
Ein hoher Anspruch, und so manch einer in Frankfurt fragte sich verwundert, wer denn dieser Joseph Rütten war. Außerdem wimmelte es in Frankfurt geradezu von Verlagen und Druckereien. Die Messestadt am Main war seit Beginn des Buchdrucks eine Literaturstadt.
Doch von Joseph Rütten hatte man noch nie gehört, jedenfalls nicht in der belesenen, ehrenwerten Gesellschaft der Stadt, und so manche Dame und so mancher Herr rümpften die Nase ob der Unverfrorenheit dieses Rütten, der obendrein noch Jude war. Im Gegensatz dazu war Dr. Zacharias Loewenthal einigen der Frankfurter als Mannheimer Verleger bekannt, wenn er auch den Ruf hatte, streitbar zu sein. Aber zumindest hatte er einen Doktortitel vorzuweisen, er hatte zudem sein Judentum abgestreift und war – wie die meisten Frankfurter – evangelisch geworden. Das war nicht viel, aber immerhin etwas.
Joseph Rütten wiederum amüsierte sich über die beflissenen Bildungsbürger und dachte gar nicht daran, seine Herkunft publik zu machen. Denn er war in manchen Kreisen durchaus bekannt. Allerdings nicht als Joseph Rütten, sondern als Sohn des unlängst verstorbenen jüdischen Bankiers und Handelsmanns Jacob Beer Rindskopf, dessen Vater reicher gewesen sein sollte als dereinst Rothschild und dessen Witwe zu den reichsten jüdischen Bürgern der Stadt Frankfurt gehörte.
Geldsorgen hatte der Achtunddreißigjährige nie, er sah in der Literarischen Anstalt auch keine Unternehmung, um sein Vermögen zu vermehren. Das hatte er bereits erledigt, und zwar im Manufakturhandel seines Vaters, der nun vom ältesten Bruder allein weitergeführt wurde. Der Verlagsbuchhandel, so stand es in einer Ausgabe des Intelligenz-Blattes, war ein Unternehmen, das einem vermögenden Mann in erster Linie zur Zierde gereichte. Und ein wenig Zierde hatte Joseph Rütten nötig. Ganz gleich, ob als Rütten oder als Rindskopf, er war ein »israelitischer« Bürger und als solcher noch immer ein Mensch zweiter Klasse, gleichgültig, wie reich er war. Die geltenden Gesetze verwehrten ihm die Staatsbürgerrechte, und so versuchte er nun, mit der Literarischen Anstalt zu seinem Recht zu kommen.
Ein wenig bange war ihm jedoch schon. Er hatte zwar Geld und Enthusiasmus, aber doch eigentlich vom Verlagswesen keine Ahnung. Er konnte handeln und besaß das Frankfurter Bürgerrecht, mehr allerdings nicht.
Sein Partner Dr. Zacharias Loewenthal dagegen, dreiunddreißig Jahre alt, besaß literarische Bildung, verlegerische Erfahrung, und obendrein gaben sich in seinem Hause die Schriftsteller und Literaten die Klinke in die Hand. Leider besaß er das Frankfurter Bürgerrecht nicht und hatte keine Aussicht, es in nächster Zeit zu erhalten, und galt somit als »ausländischer Jude«. Das hieß, er war in der Stadt nicht geschäftsfähig und hatte lediglich den Status eines Permissionisten, eines geduldeten Ausländers, dessen Aufenthaltsrecht ohne weitere Begründung aufgehoben werden konnte. Obwohl er sich hatte evangelisch taufen lassen und nun ein Christ war, sah man ihn weiterhin als einen Juden an.
Loewenthal war zwar fünf Jahre jünger als Rütten, sah aber älter aus. Er war nicht besonders groß, das Haar war ihm schon in jungen Jahren aus der Stirn gewichen. Er hatte – genau wie Rütten – eine lange spitze Nase, die man hinter vorgehaltener Hand auch als »Judennase« bezeichnete. Überdies trug er einen Hambacher Bart, der den schmalen Mund einrahmte und ihm weit über das Kinn reichte. Er war mit Anna, geborene Reinach, verheiratet und hatte mit ihr zwei Söhne. So aufregend sein Geistesleben war, so normal war sein privates Leben.
Ganz anders sah es bei Joseph Rütten aus. Auch er war eher mittelmäßig groß, hatte eine ausgeprägte Stirnglatze und einen schmalen Mund. Er trug das übrige Haar bis hinab zu den Ohren und wirkte alles in allem ein wenig unscheinbar.
Nein, Joseph Rütten war kein schöner Mann, doch an heiratswilligen jüdischen Mädchen hatte es ihm nie gemangelt; schließlich war er reich und seine Familie hoch angesehen. Und so sehr er das Familienleben seines Compagnons bewunderte, so ängstlich hielt er sich von der Damenwelt entfernt.
»Warum heiratest du nicht endlich?«, fragte ihn Loewenthal. »Du bist achtunddreißig Jahre alt. Willst du keine Familie gründen, keine Kinder zeugen?«
Rütten wandte ein wenig peinlich berührt den Blick ab. »Ich halte es nicht so mit dem bürgerlichen Leben«, erklärte er.
»Das ist kein Grund«, befand Loewenthal, aber er bekam von seinem Compagnon keine weitere Antwort.
***
Joseph Rütten ging zur Tür seines Arbeitszimmers der Literarischen Anstalt, die sich im Großen Hirschgraben, gar nicht weit von der Hauptwache entfernt befand, und rief nach Aurelie, der Magd. »Ist Loewenthal im Hause?«, wollte er wissen.
Aurelie nickte. »Er ist in seinem Arbeitszimmer. Vor zehn Minuten ist er eingetroffen. Mit dem Marktschiff aus Mainz ist er angelandet.«
»Dann sage ihm Bescheid, dass ich ihn heute Mittag zum Essen einlade. Er soll sich um zwölf Uhr, wenn die Glocken vom Bartholomäus-Dom schlagen, bereithalten.«
»Gibt es etwas zu feiern?«, wollte Aurelie wissen und lehnte sich an den Türrahmen. Sie nahm sich für eine Magd allerhand heraus, und Rütten wusste nicht, ob sie das tat, weil sie einfach so war oder weil sie oft noch spät am Abend für ihn da sein musste, der zwar noch immer im Haus Rindskopf in der Judengasse 84 sein Zuhause hatte, aber doch immer häufiger auch nachts im Hirschgraben blieb und sich bereits zwei Kammern im oberen Stock eingerichtet hatte, gleich neben Aurelies Kammer. Wahrscheinlich dachte Aurelie, die nicht gerade vor Intelligenz sprühte, dass es ausreichte, mit dem Chef Wand an Wand zu schlafen, um sich lockere Manieren zu erlauben und manchmal sogar plump vertraulich zu werden. Rütten störte das nicht. Er war ein freundlicher, toleranter Mann, der ohnehin fand, dass man Frauen nicht schlechter behandeln sollte als Männer und Mägde nicht schlechter als Damen.
»Wie bitte?«, fragte Rütten, der sich bereits wieder seinem Schreibtisch zugewandt hatte.
»Ob es was zu feiern gibt«, wollte das Hausmädchen wissen.
Rütten drehte sich um, betrachtete das schlanke junge Ding mit den glänzenden Augen und dem verspielten Mund ein paar Augenblicke lang, dann antwortete er: »Ja, es gibt etwas zu feiern. Heute besteht unsere Literarische Anstalt ein Jahr. Und du warst vom ersten Tag an dabei.«
Er erinnerte sich noch genau, wie sie am Gründungstag an die Tür geklopft und gesagt hatte, dass eine Anstalt ein Hausmädchen brauche. Rütten hatte sie gefragt, ob sie etwas mit Literatur anfangen könne, doch Aurelie hatte den Kopf geschüttelt und gesagt: »Muss ich Romane lesen, um gescheit kochen und putzen zu können?« Rütten hatte verneint und sie kurzerhand eingestellt.
»Oh!«, rief Aurelie überrascht aus und lehnte dabei noch immer im Türrahmen. Sie machte Anstalten, etwas zu sagen, doch Rütten unterbrach sie: »Ja, ja, du solltest auch etwas bekommen. Wir werden dir ein wenig Gebäck und Naschwerk mitbringen.«
Aurelie lächelte, stieß sich vom Türrahmen ab und sagte: »Am liebsten mag ich die mit Pudding gefüllten Hefestücke vom Café Schneider und die Weinbrandpralinen.«
3. Kapitel
Als Wilhelmine nach Hause kam, durchstöberte sie jeden Schrank, jede Truhe, jeden Schubkasten. Sie hatte genau wie ihre Mutter früher immer wieder ein Sümmchen vom Haushaltsgeld abgezweigt, um sich ein neues Band für das Kleid, eine neue Haube oder eine Schachtel Schokolade kaufen zu können. Sie hatte sich stets für eine nicht sonderlich reiche, aber gutgestellte Frau gehalten. Nun suchte sie in allen Ecken und Taschen nach Kleingeld.
Das Salzweib stand mit verschränkten Armen hinter ihr und sah zu. »Was genau macht Ihr da?«, wollte sie irgendwann wissen.
»Ich suche Geld.«
»Aha. Und warum?«
Wilhelmine hielt inne, ließ sich auf die Bettkante fallen und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Weil wir keines mehr haben. Walther hat spekuliert und verloren.«
»Alles?«, wollte das Salzweib wissen.
»Ja, alles.« Wilhelmine schlug die Hände vor das Gesicht. Sie hätte gern geweint und hätte sich zu gern von dem Salzweib trösten lassen, doch dazu fühlte sich die Haushälterin nicht befugt, wie sie wusste.
Das Salzweib zuckte lediglich mit den Schultern. »Dann müsstet Ihr die Druckerei eigentlich weiterführen. Aber schlagt Euch das besser gleich aus dem Kopf. Eine Druckerei ist Männerarbeit. Nicht nur wegen der schweren Druckerpressen und der Papierballen. Da muss Farbe angemischt werden, da müssen Entscheidungen getroffen werden. Ihr seid eine Frau. Wer sollte sich an Eure Entscheidungen halten? Die Männer werden Euch ins Gesicht lachen. So sieht es aus.«
Wilhelmine seufzte, während das Salzweib weitersprach. »Mit der Druckerei seid Ihr eine halbwegs gute Partie, allerdings seid Ihr auch nicht mehr die Jüngste. Der Geselle wird vermutlich kommen und Euch um Eure Hand bitten. Würde ich jedenfalls machen, wenn ich Geselle wäre.«
»Salzweib, der Geselle ist Jahre jünger als ich. Wahrscheinlich will er noch Kinder. Nun, über Kinder bin ich hinweg. Ich hätte schon gern einen ganzen Stall voll gehabt, aber Gott hat anders entschieden. Nein, der Geselle soll mir bloß gestohlen bleiben.«
»Und was gedenkt Ihr sonst zu tun?«
Wilhelmine richtete sich ein wenig auf. »Das weiß ich noch nicht, darüber muss ich erst noch nachdenken. Aber mir wird etwas einfallen. Um deine Arbeit brauchst du nicht zu fürchten, Salzweib.«
»Tue ich auch nicht. Ich bin schon so lange hier; ich kann mich gar nicht mehr an einen anderen Haushalt gewöhnen.«
»Vielleicht braucht deine Tochter dich ja«, gab Wilhelmine zu bedenken. »Immerhin hat sie gerade das siebte Kind bekommen. Wahrscheinlich hätte sie dich ja gern bei sich gehabt.«
»Nein. Da sei Gott vor. Ich liebe sie sehr, aber wir würden uns furchtbar in die Haare kriegen, wenn wir täglich aufeinander hocken müssten. Sie würde mir vorwerfen, dass ich alles besser weiß, und ich ihr, dass sie alles falsch macht. Nein, nein, ich bin bei Euch recht gut aufgehoben.«
»Dann ist es ja gut«, erwiderte Wilhelmine und begab sich in die Druckerei.
Dort stand der Geselle Johannes und schnitt lustlos Papier in Druckbögen. Der Boden um ihn herum war mit Papierfasern übersät.
»Wie sieht es aus?«, fragte Wilhelmine.
»Was denn?« Der Geselle tat, als würde Wilhelmine ihn bei einer wichtigen Arbeit stören.
»Ich möchte wissen, wie es um die Auftragslage steht.«
Johannes zuckte mit den Schultern. »Da wäre noch ein Traktat zu drucken und eine pietistische Schrift, dazu noch ein kleines Curriculum der Höheren Töchterschule, und das war’s.«
»Ist noch etwas angekündigt? Ein Buch vielleicht?«
Der Geselle zog die Stirn in Falten. »Nein, da ist nichts. Vielleicht wird der Rechtsanwalt Gruber noch etwas für uns haben, ein paar Briefbögen wahrscheinlich. Auch hat er gesagt, dass er Visitenkarten bräuchte. Die, die er bislang vom Kupferstecher hatte, sind ihm wohl zu teuer.«
Wilhelmine blickte sich um. Das Papierregal war noch zur Hälfte gefüllt, die Behälter mit der Frankfurter Druckfarbe noch zu zwei Dritteln.
Dann begab sie sich in das kleine Kontor im hinteren Teil der Druckerei, in der Walther immer seine Buchhaltung gemacht hatte. Sie blätterte in den Kontorbüchern und stellte fest, dass sie allesamt ordentlich geführt waren, aber so recht schlau wurde sie nicht aus ihnen.
Plötzlich räusperte sich hinter ihr jemand.
Wilhelmine fuhr herum.
Der Geselle stand in der Tür, einen fleckigen Putzlappen in der Hand, an dem er sich die schwarzen Finger sauberwischte.
»Was ist?«, wollte Wilhelmine wissen.
»Ich frage mich, wie es hier weitergeht«, sagte Johannes und strich sich über den Bart.
»Mich solltest du fragen, wie es hier weitergeht.«
Der Geselle kratzte sich am Kopf. »Na ja, das meine ich doch.«
»Zunächst einmal geht alles weiter wie bisher. Walther muss erst unter die Erde. Du wirst alles so zeitig wie möglich erfahren. Das verspreche ich dir.«
***
Die Beerdigung verlief merkwürdig, fand Wilhelmine. Und ihre Freundin Henriette Zobel, die normalerweise gegenteiliger Meinung war, pflichtete ihr bei. Auf dem Hinweg zum Friedhof hatte der Geselle Wilhelmines Arm genommen und war wie ein Bräutigam zum Altar an das Grab von Walther geschritten. Als der Sarg in die Erde gesenkt wurde, blieb Johannes einfach neben der Witwe stehen, neben Wilhelmine und dem Zunftmeister, und nahm die Beileidsbekundungen mit einer Trauermiene entgegen, als wäre sein eigener Vater soeben verstorben.
Wilhelmine, tränenblind, bemerkte sein Verhalten erst im Nachhinein. Joseph Rütten schüttelte ihr die Hand, fasste mit der anderen an ihren Ellenbogen. »Wenn etwas ist, Nachbarin, Ihr könnt Euch auf uns verlassen«, sagte er leise und betrachtete tatsächlich den Gesellen verblüfft, als auch er ihm die Hand reichte. »Ihr wart dem Drucker Pfaff sehr verbunden?«, fragte Rütten und zog dabei eine Augenbraue in die Höhe.
»Wir waren wie Brüder«, erwiderte der Geselle Johannes ergriffen und wischte sich dabei über die Augen.
»Wie Brüder. Sieh mal einer an.« Rütten verbeugte sich leicht vor der Witwe und wandte sich dann noch einmal an den Gesellen. »Dann seid Ihr wohl auch ein Schweizerdegen?«
»Schweizerdegen?« Der Geselle zog die Stirn in Falten.
»Ein Schweizerdegen ist eine Waffe, die man sowohl als Hieb- als auch als Stichwaffe benutzen kann. Nun, und ein Schweizerdegen in der Druckerwelt ist ein Drucker, der auch ein Setzer ist. Walther Pfaff war ein solcher.«
Der Geselle kaute auf seiner Unterlippe; es war ihm anzusehen, dass er sehr wohl gewusst hatte, was oder wer ein Schweizerdegen war, er nun allerdings nicht dazugehörte und deshalb so getan hatte, als wüsste er mit diesem Begriff nichts anzufangen.
Dann bewegte sich der Trauerzug auch schon in Richtung Römer, wo im Schwarzen Stern der Leichenschmaus gereicht wurde.
Am nächsten Tag steckte Wilhelmine die Beerdigung noch tief in der Seele, sie hielt stets ein Taschentuch in ihrem Ärmel bereit und fühlte sich ihrer Trauer gänzlich hilflos ausgeliefert. Bis zur Beerdigung war viel zu tun gewesen; der Bestatter, der Tischler, der Friedhofswächter, der Bankier, der Zunftmeister, mit allen hatte sie reden müssen, so dass sie im Grunde nicht einmal Zeit für Tränen gehabt hatte, aber plötzlich spürte sie Walthers Verlust mit einer Kraft, die ihr schier die Füße wegriss.
Unvermittelt kam der Geselle und klopfte an die Küchentür. Das Salzweib öffnete.
»Zur Meisterin möchte ich«, erklärte Johannes.
Das Salzweib betrachtete ihn von oben bis unten. Er war frisch gewaschen und frisch rasiert, ja, er roch sogar ein wenig nach einem Duftwasser. Seine Schuhe waren blank geputzt und die Hände und Nägel blitzsauber geschrubbt.
»Was willst du von der Meisterin?«, fragte das Salzweib und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Das geht nur die Meisterin und mich etwas an.«
»So? Nur die Meisterin und dich, ja? Jetzt hör mir mal gut zu, du Schwengel. Als der Meister noch lebte, bist du da gekommen und hast uns mit den schweren Waschwannen geholfen?«
»Waschwannen? Wieso?«
»Nun, der Meister kam und half. Und hast du gegrüßt, wenn du mich morgens gesehen hast?«
»Ich bin Geselle, und du bist nur die Haushälterin.«
Das Salzweib nickte. »So ist es. Und deshalb schleichst du dich jetzt. Die Meisterin ist nicht zu sprechen. Nicht heute, nicht morgen, und wenn es nach mir ginge, dann für dich überhaupt nie mehr.«
Der Geselle öffnete den Mund, um zu protestieren, doch das Salzweib hatte ihn schon aus der Küche geschoben und die Tür zugeschlagen. Dann lauschte sie, bis seine Schritte verklungen waren, und begab sich in die Wohnstube, wo Wilhelmine an ihrem zierlichen kleinen Kirschholzsekretär saß und seufzend und mit rotgeweinten Augen damit begonnen hatte, die Trauerpost zu beantworten.
»Es war, wie Ihr es gesagt hattet. Das Grab ist kaum zugeschaufelt, schon steht der Geselle Johannes im Türrahmen.«
Wilhelmine drehte sich um und erblickte das Salzweib, das vor Zorn regelrecht bebte.
»Bist du sicher, dass er mir einen Heiratsantrag machen wollte? Es heißt doch, er hätte ein Liebchen.«
»Natürlich bin ich sicher«, stieß das Salzweib empört hervor. »Seine Liebste ist als Magd drüben beim Rütten in der Literarischen Anstalt. Ihr kennt sie. Aurelie heißt sie. Für meinen Geschmack ein bisschen zu nobel für eine Magd dieser Name.«
»Und woher willst du wissen, dass er mir einen Antrag gemacht hätte?«
»Weil er blitzsaubere Fingernägel gehabt hat und weil er nach einem Duftwasser gerochen hat wie ein Weihnachtsbaum in der guten Stube.«
Wilhelmine lächelte ein trauriges Lächeln. »Es war gut, dass du ihn weggeschickt hast.«
Unten klopfte es gegen die Haustür, das Salzweib spitzte die Ohren und eilte zum Fenster. »Ich wette, da draußen steht schon der Nächste, der in die Druckerei einheiraten will«, sagte sie, riss das Fenster auf und beugte sich hinaus. Dann schnellte sie zurück. »Eure Freundin ist es – Henriette Zobel. Wollt Ihr sie sehen?«
Wilhelmine nickte. »Henriette und du, ihr seid die Einzigen, die ich im Augenblick um mich haben mag.«
Das Salzweib nickte und verkniff sich im Angesicht von Wilhelmines Trauer jede böse Bemerkung über Henriette Zobel, die sie so gar nicht leiden mochte. Stattdessen erklärte sie brav: »Dann mache ich eine heiße Schokolade und schicke die Zobelin zu Euch.«
Wenig später saßen sich die Freundinnen in zwei Sesseln gegenüber. Dort, wo Henriette nun Platz genommen hatte, hatte Walther immer gesessen. Die Decke, die er manchmal über seine Knie gelegt hatte, hing noch über der Lehne. Als Wilhelmine das sah, schluchzte sie auf.
Henriette beugte sich zu ihr und tätschelte ihr die Hand. »Wie geht es dir?«, fragte sie.
»Ich weiß es nicht, ich habe bislang noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Eigentlich kann ich noch immer nicht glauben, dass ich Walther niemals wiedersehen werde.« Wilhelmine schaute hoch, wischte sich eine lose Strähne aus der Stirn. »Er war doch noch nicht so alt. Gerade mal fünfundfünfzig Jahre, einundzwanzig Jahre älter als ich. Wir hatten noch gar nicht ans Sterben gedacht.«
»Na ja, mit dem Tod sollte man immer rechnen, und doch rechnet niemand mit ihm.«
»Wir sind pleite«, brach es aus Wilhelmine heraus, und schon strömten die Tränen. »Ich bin pleite.« Sie begann zu schluchzen.
»Pleite? Wieso?« Henriette strich sanft über Wilhelmines Hand.
»Walther hat spekuliert und verloren. Ich habe keinen Heller mehr.«
Henriette wich erschrocken zurück. Sie glaubte daran, dass ein Unglück weiteres Unglück anzog. Es hatte sie Überwindung gekostet, Wilhelmine zu besuchen. Und nun noch das! Am liebsten wäre sie aufgesprungen und davongelaufen. Zurück in ihr behagliches Haus, zurück zu ihrem Ehemann, der voll Saft und Kraft steckte – für Henriettes Geschmack sogar zu viel Saft – und der als Lithograph in Bornheim lebte und arbeitete. Niemals würde Karl spekulieren. Er hasste Banken, hasste alles, was mit Geld zu tun hatte. Er war ein Demokrat reinsten Wassers, war in Hambach dabei gewesen und träumte von einer Republik, in der alle die gleichen Rechte hatten. Auch die Frauen.
Ihrem ersten Mann, ja, dem hätte sie so etwas auch zugetraut, aber nicht Karl.
Früher hatte Henriette die Freundin immer ein wenig beneidet. Ihr Karl war ein treuer, braver Mann, aber eben auch ein bisschen eintönig und langweilig mit seinem ewigen Gerede über Politik. Zwar interessierte sich auch Henriette sehr für das Geschehen im Land, doch hin und wieder hätte sie gern ein wenig mehr Romantik gehabt. Politik war nun einmal unromantisch, dafür aber wichtig. Und für Henriette war die Sache der Frauen so bedeutend wie fast sonst nichts auf der Welt. Trotzdem. Manchmal vermisste sie etwas.
Während Walther das Leben und seine Frau herzlich geliebt und dies auch gezeigt hatte, schenkte Karl seine Leidenschaft in erster Linie dem politischen Geschehen, dafür war er beständig und verlässlich. Und dass wenigstens das so blieb, dafür würde Henriette schon sorgen.
»Und nun?«, fragte Henriette.
Wilhelmine hob die Schultern. »Ich weiß es nicht.«
»Na ja, viel Auswahl hast du nicht. Du wirst wieder heiraten müssen.«
»Der Geselle stand schon auf der Türschwelle, aber das Salzweib hat ihn weggeschickt.«
»Und? Wirst du ihn anhören?«
»Ich bitte dich, Henriette.« Wilhelmine schüttelte den Kopf. »Er ist fünf Jahre jünger als ich, neunundzwanzig Jahre alt, und die Tinte auf seinem Gesellenbrief ist noch nicht lange trocken.«
»Na und?« Henriettes Blick wurde für einen Augenblick verträumt. »Ich wette, er hat Qualitäten, die das Tageslicht scheuen. Er ist ein gestandenes Mannsbild mit der rechten Gesinnung.«
»Nein, ich will ihn nicht. Ich mag ihn nicht einmal besonders. Ach, und die Bettgeschichten. Mein Gott, ich bin über dreißig. Da denke ich nicht mehr so oft an das, was im Schlafzimmer passiert.«
»Was willst du sonst tun? Warten, dass ein anderer um dich freit?«
»Du meinst, um die Druckerei freit?«
Henriette nickte.
»Am liebsten würde ich gar nichts tun«, gestand Wilhelmine. »Mir fehlt es an jedweder Lust. Am liebsten würde ich den ganzen Tag nur hier sitzen und aus dem Fenster sehen.« Sie erhob sich und trat an das Fenster. Gegenüber kam der Verleger Joseph Rütten von Besorgungen zurück und öffnete die Tür seines Hauses. Als er Wilhelmine sah, lüpfte er seinen Hut und vollführte eine kleine Verbeugung in ihre Richtung. Sie hob die Hand zu einem Gruß, seufzte und drehte sich zu Henriette um.
»Du könntest die Druckerei verkaufen«, schlug Henriette vor.
Wilhelmine zuckte mit den Schultern. »Wer soll sie kaufen? Es gibt viele Druckereien in Frankfurt. Aber du hast recht: Wenn jemand käme und mir ein Angebot machte, würde ich wohl zusagen. Noch nicht sofort, versteht sich. Ich muss erst einmal wieder zu mir selbst finden. Im Augenblick werde ich gar nichts tun. Ich habe noch ein bisschen Geld gefunden. Über die nächsten Monate werden wir kommen. Und was dann wird, wird sich zeigen.«
Von der Straße her waren laute Rufe zu hören. Henriette und Wilhelmine erhoben sich und blickten aus dem Fenster. Ein Bäckerjunge mit weißer Schürze stand auf der Straße und wurde von seinem Meister am Jackenzipfel gepackt.
»Du kommst auf der Stelle zurück in die Backstube!«, schrie der Bäcker.
Der Junge stieß seinen Meister von sich und duckte sich, als ob er Schläge erwartete. Sein Gesicht war rosig und bartlos, und er sah noch ganz wie ein Kind aus. »Nein, das tue ich nicht. Ihr habt mir so viel versprochen und nichts davon gehalten. Ihr esst jeden Tag Zuckerwerk, und ich muss mich mit dem alten Brot begnügen. Ihr lasst mich die Backstube schrubben, und an einen Teig habt Ihr mich noch immer nicht gelassen, obschon ich über ein Vierteljahr bei Euch bin. Nun könnt Ihr schauen, wo Ihr einen neuen Lehrling herbekommt. Zeit wird es, dass sich etwas ändert«, schrie er zornig.
Überall im Großen Hirschgraben wurden die Fenster aufgerissen. Hausfrauen lehnten darin, und auf den Türschwellen standen die Mägde beieinander.
»Was ist denn hier los?«, rief eine und schüttete schwungvoll einen Eimer mit Wischwasser in den Straßengraben. »Was soll denn das Geschrei und Gekeife?«
Der Bäckerjunge, durch die vielen Zuschauer erst recht entflammt, reckte die Faust. »Freiheit und Gerechtigkeit. Brüderlichkeit und Gleichheit«, schrie er, doch der Bäcker verpasste ihm eine gewaltige Maulschelle, so dass der Junge aufheulte. Dann packte der Meister ihn beim Ohr und zerrte ihn hinter sich her um die nächste Straßenecke.