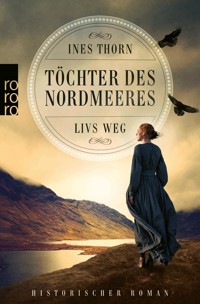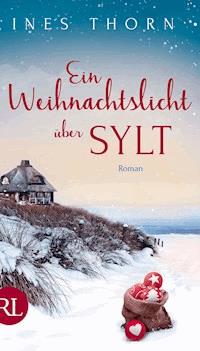14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Verlorene Geschichten
- Sprache: Deutsch
1940, Paris ist von den Deutschen besetzt. Nur in das weltberühmte Grand Hotel Le Bristol dürfen die Nazis keinen Fuß setzen ...
Mit Verstand und Leidenschaft geht Hippolyte Jammet seinem Lebenstraum nach: Er führt das Le Bristol, eines der großen Luxushotels von Paris. Selbst die Schatten des Zweiten Weltkriegs lassen ihn keine Sekunde daran zweifeln, wo er hingehört. Als die Deutschen Paris besetzen, braucht es sein ganzes diplomatisches Geschick, um das Hotel geöffnet und Gäste sowie Bedienstete sicher zu halten. Keine leichte Aufgabe – zumal er zwischen den Mauern auch einige Schätze des Louvre vor dem Zugriff des Feindes hütet. Doch als ein wertvoller Fragonard verschwindet und die Stadt immer grauer und trister zu werden droht, beginnt Monsieur Jammet langsam zu verzweifeln. Was kann er noch tun, um seine Heimatstadt wieder erstrahlen zu lassen?
Inspiriert von der wahren Lebensgeschichte des Hoteliers Hippolyte Jammet, der unter großen persönlichen Gefahren sein Hotel und sogar Paris selbst rettete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Mit Verstand und Leidenschaft geht Hippolyte Jammet seinem Lebenstraum nach: Er führt das Le Bristol, eines der großen Luxushotels von Paris. Selbst die Schatten des Zweiten Weltkriegs lassen ihn keine Sekunde daran zweifeln, wo er hingehört. Als die Deutschen Paris besetzen, braucht es sein ganzes diplomatisches Geschick, um das Hotel geöffnet und Gäste sowie Bedienstete sicher zu halten. Keine leichte Aufgabe – zumal er zwischen den Mauern auch einige Schätze des Louvre vor dem Zugriff des Feindes hütet. Doch als ein wertvoller Fragonard verschwindet und die Stadt immer grauer und trister zu werden droht, beginnt Monsieur Jammet langsam zu verzweifeln. Was kann er noch tun, um seine Heimatstadt wieder erstrahlen zu lassen?
Inspiriert von der wahren Lebensgeschichte des Hoteliers Hippolyte Jammet, der unter großen persönlichen Gefahren sein Hotel und sogar Paris selbst rettete.
Autorin
Ines Thorn wurde 1964 geboren. Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin studierte sie Germanistik, Slawistik und Kulturphilosophie, um danach als Fotogestalterin, Werbetexterin und auch immer wieder als Buchhändlerin zu arbeiten. Die Liebe zum Schreiben hat sie schon der nächsten Generation vermacht, ihre Tochter Hella ist mittlerweile ebenfalls Schriftstellerin. Ines Thorn lebt mit Familie und Hund in einem 300-Seelen-Dorf in Nordhessen und träumt dort selbst immer gern von Besuchen in den Grand Hotels auf aller Welt.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Ines Thorn
Monsieur Jammet und der Traum vom Grand Hotel
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Redaktion: Stefan Lutterbüse, Wiesbaden
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Everett Collection, Ysbrand Cosijn) und stock.adobe.com (blantiag, FreeProd, Anneleven.com, Ericus, Markus, Vasilius)
BSt · Herstellung: sam
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-28971-3V001
www.blanvalet.de
Karte
Teil 1 Paris 1940
Kapitel 1
Monsieur Hippolyte Jammet schob seine Brille auf die Nase und verschränkte die Hände hinter dem Rücken. Die Personalbesprechung war fast zu Ende, die heutigen Aufgaben verteilt. »Wie lautet das oberste Gebot im Le Bristol?«, fragte er wie jeden Morgen am Ende der Besprechung.
»Diskretion!«, riefen alle wie aus einem Mund.
Die Kellner und Zimmermädchen, die Hotelpagen und Laufjungen, die Tor- und Wagenwächter sowie die Concierges und Fahrstuhlführer standen mit durchgedrücktem Kreuz in einer Reihe vor dem Besitzer des Hotels. Nur das Küchenpersonal fehlte. Vor dem Krieg waren es beinahe doppelt so viele männliche Angestellte gewesen, aber seit Frankreich Deutschland den Krieg erklärt hatte, waren viele junge Männer eingezogen wurden. Jammet hatte einige ehemalige Angestellte aus ihrem verdienten Ruhestand holen müssen, um den Hotelbetrieb am Laufen zu halten.
Jeder Kellner trug einen schwarzen Frack mit gestärkter Hemdbrust, die Zimmermädchen lange schwarze Kleider, darüber eine weiße, mit Rüschen besetzte Schürze und ein weißes Häubchen im zum Knoten gedrehten Haar, die Übrigen die hoteleigene Uniform. Im Speisesaal für die Angestellten hingen noch der Geruch des Morgenkaffees und der Duft frisch gebackener Croissants. Aus der Spülküche war das Klappern von Tellern zu hören, ein Koch rief nach einem Küchenjungen. Ein Beikoch verteilte auf einem Tisch kleine Kostproben der Tagesmenüs und die dazugehörigen Weine. Gleich nach der Besprechung würden die Kellner davon kosten und anschließend die Gerichte vor den Ohren des Souschefs beschreiben, damit sie diese den Gästen so gut wie möglich empfehlen konnten. Auch der Geschmack der Weine musste charakterisiert, Rebsorten, Lagen und Weingüter unterschieden werden.
Die Zimmermädchen würden von der ersten Hausdame eingeteilt werden und danach ihre Wagen mit Bettwäsche, Handtüchern, parfümierter Seife und Reinigungsmitteln beladen und sich unter den strengen Augen der Etagenaufsicht an die Arbeit machen. Die Torwächter in ihren schwarzen Capemänteln und den steifen Zylindern würden vor dem Hotel Aufstellung nehmen, die Gäste begrüßen und ihnen die Tür aufhalten, während die Wagenwächter deren Autos parkten. Die Rezeptionisten würden telefonieren, Fragen beantworten und dabei alles, was in der Empfangshalle geschah, im Blick behalten. Die Pagen würden sich mit den Koffern abmühen, der Fahrstuhlführer seine Knöpfe bedienen und die Etagen ansagen.
Aber noch war es nicht so weit, noch schritt der Hoteldirektor die Reihe ab und musterte einen nach dem anderen. Sie alle sahen frisch gewaschen und ordentlich gekämmt aus. Da war keine Falte in der Kleidung, keine Haarsträhne hing lose. Da blitzten die Schuhe und die Messingknöpfe der Uniformen.
»Genau. Diskretion. Was in diesem Haus passiert, dringt nicht nach draußen. Die unbedingte Verschwiegenheit ist der Boden, auf dem das Le Bristol steht und gedeiht. Auch und besonders in diesen schwierigen Zeiten.« Hippolyte Jammet war besorgt, doch er bemühte sich, es nicht zu zeigen. Vor genau einem Monat war die deutsche Wehrmacht in Belgien und Nordfrankreich einmarschiert, und sie kam der Hauptstadt Paris immer näher. Jammet hatte ausgezeichnete Beziehungen in der Stadt. Es gab beinahe nichts, das ihm verborgen blieb, und so war ihm auch bekannt, dass sich die Regierung unter Führung von Paul Reynaud auf eine Flucht vorbereitete. Und was dann geschah, das wusste der Himmel. Er hatte seiner Frau Yvonne aufgetragen, in der Kirche Notre-Dame eine Kerze anzuzünden, aber er glaubte selbst nicht, dass das etwas nützte. Der Hoteldirektor hatte am Morgen im Radio gehört, dass die Maginot-Linie von den Deutschen überrannt worden war. Die Maginot-Linie, an der sich die Bunker wie an einer Perlenkette entlang der französischen Grenze zu Belgien, Luxemburg, Deutschland und Italien aneinanderreihten. Die Maginot-Linie, die als unüberwindbar gegolten hatte. Nur Gott wusste, was nun kommen würde. Jammet rechnete mit dem Schlimmsten.
Am liebsten hätte er Yvonne und seine Kinder in Sicherheit gebracht. Sein ältester Sohn Pierre besuchte ein Internat, aber die anderen neun Kinder lebten im Le Bristol. In der Provence würde sich sicherlich noch ein kleines Hotel finden, in dem sie den Krieg überdauern konnten. Aber Yvonne weigerte sich strikt. Sie und Hippolyte Jammet liebten sich von ganzem Herzen, und Yvonne musste da sein, wo auch Hippolyte war.
»Jawohl, Monsieur Jammet«, riefen die Bediensteten wieder im Chor.
»Dann an die Arbeit. Jeder weiß, was er zu tun hat.« Monsieur Jammet klatschte in die Hände.
Die Angestellten schwirrten wie ein Bienenschwarm auseinander, und Monsieur Jammet hatte jetzt Zeit für einen Café au Lait mit dem Empfangschef, der ersten Hausdame und dem Küchenchef.
»Was steht heute auf der Tageskarte?«, wollte er wissen, und Monsieur Trudeaux seufzte und zählte auf: »Geeiste Gurkensuppe, frische Langusten, noch keine 24 Stunden aus dem Wasser, mit Trüffeln gefülltes Kalbsbries, zarte Täubchen mit einer Füllung aus provenzalischen Kräutern, geschmort in Rotwein, und als Dessert Birnenküchlein mit Champagner. Dazu das übliche Angebot aus der Speisekarte.«
Michel Trudeaux arbeitete seit sechs Jahren im Le Bristol. Er war einer der wenigen Küchenchefs eines Pariser Hotels, der sich einen Michelin-Stern erkocht hatte. Fünf Jahre hintereinander!
Jammet staunte: »Es gibt nichts zu kaufen, die Leute stehen stundenlang für eine Packung Mehl an, und wir haben eine solche Speisekarte?« In seiner Stimme schwang Stolz mit.
»Nun, wir kaufen die wenigsten Sachen auf dem Markt, weil es dort kaum noch etwas zu kaufen gibt. Die Gurken brachte uns ein Bauer aus der Nähe, ebenso die Nudeln. Trüffel haben wir noch vom letzten Jahr, und ich muss zugeben, dass mir ein Nachbar seine Brieftauben geschenkt hat, als er sich auf die Flucht begeben hat. Nun, ich kann mit Tauben außerhalb der Küche wenig anfangen.«
»Welche Einkäufe stehen morgen früh an?«
Monsieur Trudeaux ließ es sich gewöhnlich nicht nehmen, jeden Morgen um vier Uhr höchstselbst zum Großmarkt Halles de Paris im 1. Arrondissement zu fahren und den frischen Fisch, das Obst und Gemüse und natürlich den Käse vor Ort auszuwählen. Normalerweise herrschte dort ab dem Morgengrauen reges Treiben. Händler und Köche aus der ganzen Stadt eilten dann durch die Hallen, unzählige Gemüsestände reihten sich aneinander. Glänzende Auberginen lagen neben gelben und grünen Zucchinis, prächtige Spargelstangen mit violetten Köpfen reihten sich neben grüne Spargelstangen, die Monsieur Trudeaux lieber briet als kochte. Dort sah man frisches Geflügel hängen, schneeweiße Hühner, pralle Gänse aus dem Elsass, Enten jeder Art. In einer Wanne lagen gelbe Hühnerfüße, in einer anderen Hahnenkämme. Da wurden Fische angeboten, die noch gestern im Meer oder einem Fluss geschwommen waren.
Im nächsten Gang prangte prächtiges Obst. Die ersten Erdbeeren aus dem Süden waren eingetroffen, und Monsieur Trudeaux überlegte, ob er daraus ein Dessert machen sollte.
In einem anderen Gang roch es nach Milch und Käse, in dem danach wurde Fleisch angeboten. Halbe Schweinshälften hingen an riesigen Haken, Ochsenzungen neben Rinderfilets, und am nächsten Stand gab es Wild zu kaufen. Rehkeulen, Wildschweinseiten, ausgenommene Karnickel. Die Gummischürzen der Verkäufer waren rot von Blut, darüber lag ein schwerer, eisenartiger Geruch. Karren mit Kisten wurden vorübergezogen, Körbe mit Früchten gepackt, Fleisch abgewogen und Fisch filetiert. Es herrschte ein unbeschreiblicher Lärm, doch die meisten Händler und Einkäufer waren bester Laune. Die Männer hinter den Ständen hielten Henkeltassen mit heißem Kaffee in ihren kalten Händen und riefen sich Grußworte zu. Monsieur Trudeaux kannte viele von ihnen persönlich und wusste, wo er die besten Waren bekam.
Während die Küchenjungen den kleinen Lastkraftwagen des Hotels mit Kisten beluden, kostete Monsieur Trudeaux gewöhnlich einen Rohmilchcamembert aus der Normandie, die ersten frischen Kirschen der Camargue oder ein Stückchen geräucherten Aal aus der Provence. Er roch an Muscheln und Austern, betrachtete die Augen der Fische, ließ sich ein Stück Rinderfilet aufschneiden, orderte sechs Dutzend Stubenküken, suchte Lammlachse aus und brauchte nicht länger als zwei Stunden für seine Einkäufe. So war es wenigstens vor dem Einmarsch der Deutschen gewesen, und es gab nichts, was Monsieur Trudeaux mehr bedauerte. Denn im Augenblick hatten die meisten Stände geschlossen. Ein paar unermüdlich hoffnungsvolle Köche streiften bedrückt durch die leeren Hallen. Wenn sie Glück hatten und zeitig genug da waren, bekamen sie vielleicht ein paar Fische aus der Seine, eingemietetes Gemüse oder ein bisschen Käse. Doch die meisten Restaurants hatten derzeit nur wenige Gäste.
»Morgen würde ich gern Austern kaufen. Dazu vielleicht ein paar Wolfsbarsche, wenn ich sie bekomme. In dieser Woche soll es ein wenig Kalbfleisch geben, aber es kostet sehr viel mehr. Die Tagesgerichte stelle ich immer erst nach dem Einkauf zusammen«, erklärte Trudeaux. »Es ist schwierig, dieser Tage eine Speisekarte zu erstellen.«
»Wie sieht es mit den Vorräten aus?« Monsieur Jammet trank einen Schluck von seinem Café au Lait.
»Mehl haben wir ausreichend, ebenso Zucker und Salz. Mit den frischen Kräutern sieht es schlecht aus. Ich habe neulich schon den Küchenjungen in den Bois de Boulogne geschickt, um ein wenig Löwenzahn zu sammeln. Die Bauern bringen uns zwar noch Fleisch und Milch und Quark und Käse, aber die Preise sind gestiegen.«
»Wie lange können wir unseren üblichen Küchenbetrieb noch aufrechterhalten?«
Monsieur Trudeaux zuckte mit den Schultern. »Wenn ich das nur sagen könnte. Es weiß ja keiner, was noch kommt.«
»Das ist wohl wahr.« Monsieur Jammet seufzte. »Wie sieht es mit den Reservierungen aus?« Er wandte sich an den Empfangschef Monsieur Grunwald, den er vor Jahren aus dem Hotel Adlon in Berlin abgeworben hatte. Grunwald war ein großer, schmaler Mann mit einer griechischen Nase und einer vornehmen Art zu sprechen. Obwohl sein deutscher Akzent noch hörbar war, setzte er seine Worte mit französischer Noblesse. »Nun, wir erwarten heute einige Gäste, die noch nie bei uns gewesen sind. Darunter etliche Deutsche. Außerdem reist heute ein griechischer Diplomat an, Monsieur Katarandis, mit seiner Gemahlin und seinem Sekretär sowie fünf Wirtschaftsgrößen aus Athen, die den Diplomaten begleiten. Er bekommt eine Suite in der sechsten Etage mit Blick auf den Eiffelturm, seine Begleiter werden auf derselben Etage untergebracht. Für den Abend haben sie einen Tisch in unserem Restaurant reserviert. Außerdem hat sich Madame la Comtesse Baluard mit ihrer Tochter angemeldet. Sie benutzen die Suite in der fünften Etage. Allerdings nicht mit Blick auf den Eiffelturm, da die Damen mit ihren Hunden anreisen und diese beim letzten Besuch mit ihrem Gebell die anderen Gäste gestört haben. Ich dachte an die Suite 507. Sie liegt etwas entfernt von den anderen Räumen.«
»Wie konnte das geschehen?« Monsieur Jammet zog die Augenbrauen in die Höhe.
»Die Damen waren zum Einkaufen unterwegs und ließen die beiden Hunde allein.«
»Nun, das wird dieses Mal anders sein. Einer der Laufjungen wird sich um die Hunde kümmern. Ich denke, das kann der kleine Marcel übernehmen. Er stammt meines Wissens vom Dorf, er wird sich mit Hunden auskennen.«
»Des Weiteren erwarten wir eine Delegation aus dem amerikanischen Außenministerium und die Starsopranistin Lily Pons, die für ihre Entourage gleich die gesamte vierte Etage gemietet hat.«
»Lily Pons.« Über Monsieur Jammets Gesicht glitt ein Lächeln. »Was für eine Stimme! Sorgen Sie dafür, dass ein großer Strauß mit weißen Rosen in ihrer Suite steht. Und im Obstkorb dürfen auf gar keinen Fall Erdbeeren sein, Madame Pons hasst Erdbeeren.«
»Sechs Diamantenhändler aus Amsterdam haben bei uns Zimmer für zwei Nächte gebucht und möchten ihre Juwelen in dem hauseigenen Stahltresor hinter der Rezeption deponieren. Die Herren mit ihren Familien reisen anschließend weiter nach Marseille. Sie hoffen, dort eine Schiffspassage über Lissabon nach Amerika zu bekommen.«
»Sorgen Sie gut für deren Wohl. Sie haben es nicht leicht dieser Tage.« Jammet dachte an die vielen Pariser Juden, die sich schon ins Exil begeben hatten, und an die, die ihre Reise in letzter Minute vorbereiteten. Sie ließen alles zurück: das, wofür sie ein Leben lang gearbeitet hatten, Freunde, Familie, Häuser, sogar ihre Haustiere, vor allem aber ihre Sprache.
»Dann stehen heute einige Abreisen an«, sprach Grunwald weiter. »Da wären das Ehepaar Brown aus New York und der englische Diplomat Monsieur Dunker. Dazu die Schweizer Bankiers von der Swiss International Bank aus Zürich und der Champagnerhändler, der unser Haus beliefert.«
»Monsieur Bollinger?«
»Ebender.«
»Monsieur Bollinger ist selbstverständlich eingeladen. Grunwald, zerreißen Sie seine Rechnung«, bestimmte Monsieur Jammet.
»Wirklich? Er bewohnt eine unserer besten Suiten.«
»Wir befinden uns im Krieg. Jeden Moment können die Deutschen einfallen. Wir brauchen gute Kontakte, damit uns auch während des Krieges der Champagner nicht ausgeht. Monsieur Bollinger wird unsere Großzügigkeit nicht vergessen.«
»Gut, ich sage an der Rezeption Bescheid.«
»Tun Sie das, mein lieber Grunwald.« Dann wandte sich der Hoteldirektor an die erste Hausdame, Madame Colette. »Haben Sie daran gedacht, für Madame la Comtesse Baluard zwei Kissen aufzulegen? Sie nimmt immer zwei Kissen.«
»Natürlich, Monsieur Jammet. Übrigens sind wieder zwei Morgenmäntel abhandengekommen, die heute selbstverständlich ersetzt werden. Im Zimmer 311 ist eine Glühbirne an der Deckenleuchte kaputt, und in der 234 wackelt das Bett. Ich habe dem Hausmeister schon Bescheid gesagt. Ansonsten ist alles in Ordnung. Das neue Zimmermädchen macht sich gut.«
Monsieur Jammet erhob sich. »Ich habe eine kleine Besprechung außer Haus. In zwei Stunden, denke ich, werde ich wieder hier sein.«
Monsieur Trudeaux, Monsieur Grunwald und Madame Colette nickten. Sie wussten, was sie zu tun hatten.
Monsieur Jammet fuhr mit dem Lift hoch in die siebte Etage, in der er, seine Frau Yvonne und seine Kinder in einer Maisonettewohnung lebten.
»Yvonne, mein Herz«, rief er und fand seine Frau im Salon, wo sie mit dem Kindermädchen sprach. »Yvonne, ich gehe zum Louvre. Ich bin mit dem Direktor verabredet. Warte nicht mit dem Kaffee auf mich. Es könnte ein Weilchen dauern.«
Hippolyte Jammet und Yvonne hatten sich angewöhnt, gegen elf Uhr gemeinsam Kaffee zu trinken.
Madame Jammet war eine hochgewachsene Frau mit hellem dichtem Haar, das ihr in leichten Wellen bis auf die Schulter reichte. Sie trug ihr blaues Kleid mit bewunderungswürdiger Anmut und sah aus, als würde sie in Kürze ausgehen wollen. Sie hielt einen Brief in der Hand. »Pierre hat geschrieben«, erzählte sie ihrem Mann. »Aus dem Internat.«
»Oh, wie schön!« Monsieur Jammet deutete auf den Brief seines ältesten Sohnes. »Wie geht es ihm?«
»Oh, es geht ihm gut. Seine Zensuren sind in Ordnung. Er spielt neuerdings gern Kricket.«
»Das ist schön. Was wirst du ihm antworten?«
»Dass seine beiden jüngsten Geschwister einen Infekt hatten, dass die anderen ihm Bilder gezeichnet haben und ihn vermissen.«
»Was hast du heute vor, meine Liebe?«, wollte Jammet wissen.
»Oh, nicht viel. Am Vormittag habe ich einen Termin zur Anprobe bei meiner Schneiderin, und am Nachmittag werde ich einen Besuch bei Tante Lorette machen. Wirst du allein in den Louvre gehen?«
»Da ich nicht weiß, was Monsieur Jaujard von mir will, gehe ich zunächst allein. À bientôt, mon amour! Hab einen schönen Tag.«
Jammet ließ sich in einen leichten Mantel helfen, nahm den frisch gebürsteten Hut vom Hausmädchen entgegen und nickte noch einmal dem Kindermädchen zu, das den jüngsten Spross der Familie auf dem Arm ins Spielzimmer trug. Die anderen Kinder folgten der jungen Frau. »Und ihr seid schön brav, nicht wahr?«, rief er ihnen zu, verließ die Wohnung und fuhr mit dem Fahrstuhl nach unten. Wie immer, wenn er das Le Bristol verließ, überquerte er die Rue du Faubourg Saint-Honoré und schaute von der gegenüberliegenden Straßenseite auf sein Hotel, das er vor fünfzehn Jahren erbaut hatte. Sein Blick glitt über die strahlend weiße Fassade des achtstöckigen Gebäudes, streifte die rot-weißen Markisen, den Eingangsbereich, in dem das Messing wie Gold leuchtete, den roten Teppich, der hinein in die Halle führte, in eine Welt des Luxus und der Pracht. Er nickte zufrieden und eilte weiter zum Louvre. Es war ein warmer Maitag im Jahr 1940. Die Sonne schien, und der Himmel strahlte im reinsten Blau. Ein paar Tauben gurrten in den Bäumen, ungewohnt viele Autos, Fuhrwerke und Lastenräder rollten auf den Straßen, ein Bäckerjunge transportierte auf seinem Fahrrad Baguettes zu den Kunden, eine Frau kippte einen Eimer mit Wischwasser in den Rinnstein, ein alter Mann zog einen voll beladenen Handwagen vorüber, auf dem eine dreiteilige Matratze schwankte. Noch war alles friedlich in dieser Stadt. Noch war die deutsche Wehrmacht nicht in Paris, aber ganz Frankreich bereitete sich auf die Invasion der Deutschen vor. Etliche Pariser waren aufs Land geflüchtet, aber ein solcher Gedanke war Hippolyte Jammet gänzlich fremd. Er war mit Leib und Seele Hotelbesitzer, und er dachte nicht im Traum daran, das Le Bristol zu verlassen. Als unverbesserlicher Optimist wartete er lieber erst einmal ab und hoffte das Beste. In Amsterdam und Brüssel, so sagte man, hätten die Deutschen alle Hotels beschlagnahmt, um ihre Leute darin unterzubringen. Nun, er würde sich mit Klauen und Zähnen dagegen sträuben, die feindlichen Soldaten ins Le Bristol zu lassen. Das war er sich und seinen Gästen schuldig. Er hatte viele nützliche Kontakte in Paris, dazu kamen seine außerordentlich guten Beziehungen zum Außenministerium und zu den zahlreichen Botschaften.
Das Le Bristol war dafür bekannt, die erste Adresse für Diplomaten in Paris zu sein, und Jammet hatte nicht vor, daran etwas zu ändern. Doch zunächst war er neugierig, was Jacques Jaujard, mit dem er seit vielen Jahren befreundet war, von ihm wollte. Jaujard galt unter den Parisern als Held und das vollkommen zu Recht. Er hatte im August des letzten Jahres, genau einen Tag nachdem die Russen und die Deutschen einen Pakt unterzeichnet hatten, laut welchem Hitler freie Hand hatte, den Westen anzugreifen, den Louvre für drei Tage geschlossen. Es hieß, die Rohre im Haus müssten repariert werden. In Wirklichkeit aber verpackten die Angestellten des Museums mit Hilfe der Studenten der École du Louvre und den Mitarbeitern des berühmten Warenhauses La Samaritaine behutsam so viele Kunstschätze, wie sie nur konnten. Jacques Jaujard hatte extra dafür von der hauseigenen Tischlerei Transportkisten herstellen lassen. »Die Hochzeit zu Kana« von Veronese, eines der kostbarsten Stücke der Sammlung, wurde behutsam um einen Zylinder herumgerollt und in eine mit Holzwolle gepolsterte Kiste gelegt. Die Bilder von Peter Paul Rubens waren zu brüchig, um die Leinwände zu rollen. Sie wurden, wie sie waren, auf die Ladefläche eines Lastkraftwagens gehoben, den sich Monsieur Jaujard von der Comédie-Française ausgeliehen hatte und in dem normalerweise Kulissen und Wandbilder transportiert wurden. Das Auto war für solche Zwecke passend ausgerüstet und Boden und Wände gepolstert.
Jacques Jaujard hatte die Meisterwerke nach ihrer Berühmtheit kategorisiert. Die kostbaren Stücke erhielten einen gelben Punkt. Bilder, die als bedeutende Kunstwerke galten, wurden mit grünen Punkten versehen, und Kunstschätze der Welt bekamen einen roten Punkt. Das Prunkstück des Louvre, die weltberühmte Mona Lisa von Leonardo da Vinci, wurde in eine weiße Kiste gepackt und mit drei (!) roten Punkten versehen. Das Ölgemälde wurde in einem Krankenwagen mit einer speziellen Gummifederung inmitten eines Konvois aus acht Lastwagen an sein neues Zuhause transportiert und von einem Kurator begleitet, der die Kiste nicht eine Sekunde aus den Augen ließ. Insgesamt brachen an diesem Augustmorgen des letzten Jahres 203 Fahrzeuge mit insgesamt 1862 Holzkisten an geheime Orte auf, in denen die Kunstwerke vor den Boches versteckt werden sollten. Das letzte Meisterstück, das in Sicherheit gebracht wurde, war die dreieinhalb Meter hohe Statue der Nike von Samothrake, entstanden um 190 v. Chr. Am 3. September 1939, genau zwei Stunden bevor Frankreich Deutschland den Krieg erklärte, verließ der Lastkraftwagen mit der Statue Paris in Richtung Loire.
Monsieur Jaujard, der Direktor des Louvre, erwartete ihn in seinem Büro an seinem Schreibtisch und stand auf, als Hippolyte Jammet eintraf.
»Wie schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind, mein lieber Jammet. Lassen Sie uns dort Platz nehmen.« Jaujard deutete auf zwei bequeme Clubsessel an der Wand, zwischen denen ein kleiner Tisch stand. »Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?«
»Danke sehr, ich hatte gerade einen.« Hippolyte Jammet blickte sich neugierig um. Er war lange nicht mehr hier gewesen und hatte seinen Freund Jaujard meist auf Veranstaltungen getroffen. Der Schreibtisch war mit Büchern überladen. Zwei von ihnen lagen aufgeschlagen auf einer Unterlage aus grünem Leder. Es waren Bildbände über Gemälde. Neben dem Schreibtisch befand sich ein Bücherschrank mit Glastüren, und Jammet erkannte einige Kataloge, die der Louvre aus Anlass seiner Ausstellungen herausgebracht hatte. Auf der anderen Seite zog sich ein Regal an der Wand entlang, das mit beschrifteten Ordnern gefüllt war. »Italienische Meister«, las Jammet und »Künstlerkolonie Skagen und dänische Malerei«. Über der kleinen Besprechungsecke hingen zwei Gemälde, von denen Jammet nicht wusste, wer sie gemalt hatte. Das eine zeigte eine Stadtansicht von Paris, auf dem anderen war die berühmte Kirche Notre-Dame dargestellt. Der Boden war mit einem Teppich in verschiedenen Rottönen belegt und neben dem Fenster, das einen Blick auf den Jardin des Tuileries erlaubte, hingen Vorhänge in einem Farbton, der gut zum Teppich passte. Das ganze Zimmer wirkte gediegen und trotz des Schreibtischs und der vielen Ordner behaglich.
»Nun, ich denke, dass das, was wir zu besprechen haben, so delikat ist, dass es nach einem Cognac verlangt.« Der Direktor lächelte, aber es war kein frohes Lächeln und erreichte seine Augen nicht.
Monsieur Jammet zog die Brauen leicht in die Höhe und nahm in einem der Sessel Platz, während Jaujard den Cognac eingoss. Der Direktor des Louvre war ein Mann mittlerer Größe, in dessen Haar sich die ersten grauen Strähnen zeigten. Sein schmales Gesicht mit der etwas zu langen Nase war ernst, und Jammet sah ein paar Falten, die vor Wochen noch nicht da gewesen waren. Er trug einen maßgeschneiderten Anzug, ein blütenweißes Hemd und eine Seidenkrawatte. Am Zeigefinger der rechten Hand glänzte ein Siegelring.
»Wie geht es der Familie, mein lieber Jammet?«
»Danke sehr. Es geht allen gut.«
»Und die Geschäfte?«
»Ich kann nicht klagen. Obschon ich dem Einmarsch der Deutschen besorgt entgegensehe.«
»Das tun wir alle, mein lieber Jammet, das tun wir alle. Und damit bin ich auch schon beim Grund unseres Treffens.«
Er ließ denn goldgelben Cognac in seinem Schwenker kreisen, dann sagte er: »Seit geraumer Zeit bin ich dabei, die wertvollsten Stücke unserer einmaligen, weltberühmten Sammlung aus Paris wegzubringen. Ich darf sagen, dass unsere bekanntesten Gemälde bereits in Sicherheit sind.« Er gestattete sich ein kleines Lächeln.
»So wie die Mona Lisa?«
»Leonardo da Vincis Meisterwerk ist an einem geheimen Ort, weit weg von Paris. Sie verstehen sicher, dass ich Ihnen nicht mehr dazu sagen kann.«
Monsieur Jammet nickte zufrieden. Er war ein Pariser durch und durch und liebte – wie die meisten Pariser – den Louvre und seine Gemälde von ganzem Herzen. »Ich bin sehr froh, das zu hören.«
Jaujard bot Hippolyte Jammet eine Zigarette aus einem silbernen Etui an, und der Hotelier griff zu. Schweigend rauchten die beiden Herren die ersten Züge, dann sprach Jaujard weiter: »Für einige kleinere Gemälde suche ich noch ein neues Zuhause. Es handelt sich dabei um Landschaftsmalereien aus dem 18. Jahrhundert. Ein kleines und ein mittleres Gemälde von Watteau, zwei Canaletto-Zeichnungen, zwei Fragonards, eines von Richard Wilson. Insgesamt sieben Werke. Ein Teil davon hängt in der Ausstellung, ein anderer Teil lagert im Archiv. Aus Amsterdam hörte ich, dass die Deutschen die berühmtesten niederländischen Gemälde beschlagnahmt und nach Berlin gebracht haben. Vermeer, Rembrandt, all die alten Meister. Es ist eine Schande. Dieses Schicksal will ich dem Louvre ersparen.«
»Das ist verständlich, und ich bin bereit, Ihnen dabei zu helfen.«
Jaujard lächelte. »Dafür danke ich Ihnen sehr.«
»Sie wünschen, dass ich die Bilder in meinem Haus verstecke?« Jammet schlug ein Bein über das andere.
Jaujard nickte. »Ich weiß, das ist ein großes Risiko. Unter anderen Umständen wäre ich niemals mit einer solchen Bitte an Sie herangetreten.«
Hippolyte Jammet zog an seiner Zigarette. Was Jaujard da von ihm verlangte, war tatsächlich gefährlich. Nicht nur für seine Angestellten, sondern auch für seine Familie. »Sie verstehen sicher, dass ich die Gäste meines Hauses auf gar keinen Fall einer Gefahr aussetzen kann.«
»Natürlich, mein lieber Jammet. Aber Sie haben einen Schutzbunker im Le Bristol.«
»Wenn es schlimm kommt, werden wir den auch brauchen.«
Die beiden Männer rauchten wieder ein paar Züge lang schweigend. Hinter der geschlossenen Tür hörten sie Jaujards Sekretärin telefonieren. Dann räusperte sich der Hotelier. »Ich denke nicht, dass man die Bilder im Bunker verstecken sollte. Dort ist es ein wenig feucht. Aber in den Zimmern würden sie sich sicher sehr gut machen. Im Augenblick hängen gut gerahmte Zeichnungen Pariser Künstler und gut gemachte Kopien bekannter Gemälde dort, und ich habe ohnehin vor, einen Teil des Hotels zu renovieren. Allerdings kann ich die Bedingungen, unter denen man so berühmte Bilder normalerweise lagern sollte, nicht garantieren.«
Über Jaujards Gesicht glitt ein Lächeln. »Das ist genial, mein lieber Jammet. Das ist perfekt. Niemand wird etwas dabei finden, wenn ein Watteau über dem Bett hängt oder ein Canaletto über einem Schreibtisch. Landschaftsmalerei passt vorzüglich zu Ihrem Hotel.«
»Ich werde natürlich behaupten, dass es sich bei den Gemälden um Kopien handelt. Es wäre vielleicht von Nutzen, wenn Sie, mein lieber Jaujard, mir für ein oder zwei Werke eine entsprechende Expertise ausstellen könnten. Sagen wir, ich bin zu Ihnen gekommen, um die Echtheit der Bilder bestätigen zu lassen. Sie jedoch mussten mir bedauerlicherweise attestieren, dass es sich um bloße, wenn auch gut gemachte Kopien handelt. Und wo nur eine einzige Kopie auftaucht, glaubt niemand mehr an Originale.«
»Sehr gut, sehr gut. Allerdings sind die Werke allesamt mit dem Siegel des Louvre versehen.«
»Sorgen Sie dafür, dass sie eine neue Rückwand bekommen.«
»Nun, das ist schnell erledigt. Meine Tischler stehen bereit.«
»Und ich kann nicht dafür garantieren, dass den Gemälden nichts zustößt. Ich werde sie hüten wie meine eigenen Kinder, aber versprechen kann ich nichts.«
»In diesen Tagen kann niemand etwas versprechen. Aber unsere Gemälde sind der Stolz der Nation. Ich könnte es nicht ertragen, gerieten sie in die Hände unseres Feindes. Noch einen Cognac?«
Hippolyte Jammet trank vor dem Abend üblicherweise nichts als ein kleines Glas Rotwein zum Mittagessen, so wie die meisten Franzosen. Doch jetzt hatte er tatsächlich einen zweiten Cognac nötig. Er trank in langsamen Schlucken und spürte, wie der Alkohol seine strapazierten Nerven beruhigte. Er würde Yvonne erst einmal nichts davon sagen können, damit sie sich keine Sorgen machte. Auch den Angestellten würde er nur erklären, dass er einige Zimmer des Le Bristol mit neuen Bildern ausstatten würde. Und trotzdem blieb es eine heikle Angelegenheit, die sie in Teufels Küche bringen konnte. Hippolyte Jammet gab vor sich selbst zu, dass er ein wenig Angst hatte.
»Bleibt nur die Frage, wie die Bilder in mein Hotel kommen. Wir können nicht einfach einen LKW beladen und die Bilder von hier nach dort bringen. Die Situation auf den Straßen ist dramatisch. Überall Menschen auf der Flucht. Und die Späher der Deutschen werden sich unter sie gemischt haben.«
»Vielleicht in der Nacht?«
Jammet schüttelte den Kopf. »Nein, das wäre zu auffällig. Nachts liegt der Louvre so verlassen da wie die übrige Stadt. Jede Störung würde die Neugierigen aufmerksam werden lassen. Ich werde heute Nachmittag jemanden mit dem Kinderwagen unserer Jüngsten zu Ihnen schicken. Und einen Hotelangestellten mit einem Lastenfahrrad.«
»Warum nicht mit dem Auto?«
Wieder verneinte Jammet. »Die Straßen sind verstopft. Es gibt kaum ein Durchkommen. Und auf meinem Wagen steht das Logo des Hotels. Was soll ein Auto des Le Bristol vor dem Louvre? Lastenfahrräder dagegen gibt es unendlich viele in Paris. Genau wie Kinderwagen. Niemand wird sich etwas dabei denken. Die meisten Leute haben ohnehin andere Sorgen. Heute Morgen bin ich kaum zu Ihnen gelangt, sogar Pferdefuhrwerke habe ich gesehen.«
Jaujard räusperte sich. »Auch ich werde in den nächsten Tagen aufbrechen. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für einen Feigling, aber die Deutschen werden sich wundern, warum sie einige der berühmtesten Gemälde nicht mehr im Louvre vorfinden. Sie werden Fragen stellen, und diese Fragen will ich nicht beantworten. Offiziell bin ich also die nächsten Wochen auf Dienstreise. Die Geschäfte wird mein Stellvertreter weiterführen. Es wäre unklug, den Louvre gänzlich zu schließen.«
»Das verstehe ich sehr gut, Monsieur Jaujard. Und ebendeshalb bleibe ich hier. Ein Hotel lässt sich schlecht auf ein Pferdefuhrwerk laden.«
»Ich wusste, dass Sie der richtige Mann für so eine Aktion sind«, freute sich Jaujard. »Nicht umsonst nennt man Ihr Haus auch das ›Hotel des Schweigens‹.«
Kapitel 2
Jean stand vor dem Le Bristol auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Er rauchte eine Zigarette und blickte mit Herzklopfen auf den Hoteleingang. Er war gerade vom Bahnhof gekommen, sein alter Holzkoffer stand vor seinen Füßen. Der Weg vom Zug hinaus aus dem Bahnhof war eine regelrechte Schlacht gewesen, die ihn ins Schwitzen gebracht hatte. Die Bahnsteige waren bis auf den letzten Quadratzentimeter mit Menschen voll gewesen. Frauen hatten weinende Kinder hinter sich hergezogen, auf dem Rücken übergroße Rucksäcke mit dem Nötigsten. Männer schleppten Koffer und Kisten, eine alte Frau hielt ein Heiligenbild unter dem Arm. Dazu herrschte ein unbeschreiblicher Lärm. Die Menschen drängten sich in die Züge. Verzweifelte versuchten, die Dächer der Waggons zu erklimmen, andere stürmten die Fenster. Nach Süden, nach Süden! Jean hatte zugesehen, dass er diesem Chaos entkam.
Hingerissen glitt sein Blick jetzt über die strahlende Fassade. Das berühmte Le Bristol! Eine der angesehensten Adressen in Paris. Und schon bald würde er dazugehören. Er hatte so lange auf diesen Tag gewartet und konnte kaum glauben, dass er nun tatsächlich vor dem weltberühmten Haus stand.
Einmal, dachte er, nur ein einziges Mal möchte ich durch diese Tür treten und als Gast den roten Teppich unter den Füßen fühlen. Er zog noch einmal an der Zigarette, warf den Stummel in den Rinnstein und trat ihn aus. Dann nahm er seinen Koffer und überquerte die Straße. Er nickte dem Türsteher zu und begab sich auf die Rückseite des Gebäudes, wo sich der Dienstboteneingang befand. Er drückte auf die blank geputzte Messingklingel und wartete. Eine Dame in den besten Jahren öffnete ihm die Tür. »Sie wünschen?«
»Mein Name ist Jean Bressot. Ich bin der neue Concierge.« Der Blick der Frau wanderte prüfend von seinem frischen Haarschnitt bis hinunter zu den blank gewienerten Schuhen.
»Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick.« Madame Colette schloss die Tür und begab sich zur Rezeption. Sie wartete einen Augenblick, bis Monsieur Grunwald ein Telefongespräch beendet hatte. »Monsieur Grunwald, draußen steht ein junger Mann mit Namen Bressot. Er sagt, er wäre Ihr neuer Concierge.«
»Oh, ist er schon da? Er wollte erst am Nachmittag kommen. Bitte geben Sie ihm ein Zimmer und eine Uniform. Ich werde mich nachher um ihn kümmern. Der Zug aus Holland ist vor einer halben Stunde am Bahnhof Gare du Nord eingetroffen. Wir erwarten Gäste aus Amsterdam. Die Juwelenhändler, von denen ich vorhin schon sprach.« Monsieur Grunwald beugte sich über die Rezeption und flüsterte: »Seit die Niederlande besetzt sind, flüchten noch mehr Juden nach Frankreich, um von hier nach Amerika zu gehen. Bald werden wir hier alle Hände voll zu tun haben.«
Die erste Hausdame seufzte. »Wenn ich an all die Flüchtenden denke … Vor allem die Juden. Die vielen Kinder. Es bricht mir das Herz. Im Haus wohnte unter mir eine junge Familie. Die Frau ist hochschwanger. Ich bin nur froh, dass sie gute Kontakte nach Amerika haben. Auch sie haben sich auf die Flucht begeben müssen. Ich denke jeden Tag an sie.« Sie klopfte leicht mit der Hand auf den Tresen. »Aber was kann ich schon tun? Wir müssen weitermachen. Von Tag zu Tag.«
Dann holte sie Jean vom Eingang ab und begab sich mit ihm in die Kleiderkammer. Auf einem Gestell hingen bald ein Dutzend Uniformen, daneben schwarze Fräcke und die Kleider der Zimmermädchen. Madame Colette musterte Jean noch einmal, dann griff sie nach einer der Uniformen und hielt sie ihm hin: »Hier, die müsste Ihnen passen. Sie bekommen noch eine zweite zum Wechseln. Aber danach sehe ich später.«
Sie führte ihn zum Dienstbotenfahrstuhl und fuhr mit ihm bis unters Dach zu den Kammern der Angestellten. Nicht alle Bediensteten schliefen im Haus, aber die meisten. Sie ging vor Bressot her, auf dem Arm frische Bettwäsche und ein Handtuch, während Jean seinen kleinen abgewetzten Koffer und über dem anderen Arm die Uniform trug. Vom Fahrstuhl der Dienstboten bogen sie in einen Gang, der in unauffälligem Lichtgrau gestrichen war. Vom Gang gingen zahlreiche Türen ab, und Madame Colette blieb schließlich vor der Nummer 14 stehen. »Hier ist Ihr Zimmer, junger Mann. In diesem Korridor befinden sich ausschließlich die Räume der männlichen Angestellten. Die Frauen schlafen im Gang rechts des Fahrstuhls. Es versteht sich von selbst, dass die Männer diesen Gang meiden.«
»Selbstverständlich.«
Madame Colette öffnete die Tür zu der Kammer, in der sich zwei schmale Betten, ein Schrank, ein Tisch mit zwei Stühlen und ein Waschbecken befanden. Zwischen den beiden Betten zeigte sich ein schmales Fenster, durch das der helle Himmel leuchtete.
»Sie teilen sich die Unterkunft mit Olivier. Er ist einer der Kellner. Richten Sie sich ein, dann melden Sie sich in einer Stunde an der Rezeption. Monsieur Grunwald, unser Empfangschef, wird Sie in Ihre Arbeit einführen.«
»Vielen Dank, Madame.«
»Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie mir Bescheid. Das Frühstück wird ab 6.00 Uhr im Speisesaal für die Angestellten gereicht. Dort findet danach auch die morgendliche Besprechung statt. Mittagessen gibt es ab 13 Uhr, und das Abendessen wird auf Platten angerichtet. So kann jeder eine kleine Mahlzeit zu sich nehmen, wenn er gerade Zeit dafür hat. Am Abend ist das Haus sehr belebt. Ihre Wäsche können Sie in die hauseigene Wäscherei geben. Ein Beutel mit Ihrem Namen gebe ich Ihnen nachher. Reparaturen an Ihrer Uniform melden Sie bitte mir, ich werde Ihre Kleidung an die Schneiderei weiterleiten. Herzlich willkommen im Le Bristol.«
Kaum hatte Colette die Tür geschlossen, sah Jean sich um. Die Matratze auf dem Bett war etwas dünn, aber bequem. Die Wände leuchteten frisch gekalkt, auf dem Boden lagen einfache Holzdielen. Eine Kammer, wie er sie schon öfter gesehen hatte. Zuletzt im Hotel Savoy in Marseille und davor im La Fleur in Lyon. Er kannte das Hotelgewerbe gut und freute sich sehr, nun im Le Bristol zu sein. Es war schwer, in diesem Haus eine Stelle zu bekommen. Die Ansprüche an einen Concierge waren sehr hoch. Jean sprach neben Französisch noch Englisch, Deutsch und Holländisch, er konnte fehlerfrei mit zehn Fingern Schreibmaschine schreiben und beherrschte die Stenografie. Seine Referenzen waren also erstklassig. Und das mussten sie auch sein, denn Jean Bressot hatte noch viel vor. Er benötigte Geld und Kontakte, um an die Pariser Kunstakademie zu gehen. Und beides wollte er sich im Le Bristol verdienen. Und vielleicht würde er sich tatsächlich den Traum erfüllen können, ein erfolgreicher Maler zu sein.
Er öffnete seinen Koffer, hängte das Jackett in den Schrank, legte seine Wäsche in eine freie Schublade. Dann stellte er seinen Wecker auf das kleine Nachtkästchen neben dem Bett, legte das Buch daneben, das er am Bahnhof gekauft und im Zug zu lesen begonnen hatte, und trat ans Fenster.
Jean staunte über den Anblick des Eiffelturmes. Gegenüber des Hotels befand sich der Élysée-Palast, der Amtssitz des Regierungsoberhauptes der Französischen Republik, Albert Lebrun. Jean war von dem prächtigen Gebäude beeindruckt. Auf der Stelle sehnte er sich danach, den Palast zu malen. Doch er hatte seine Malutensilien zu Hause in der Bretagne gelassen. Es waren einfache Farben und Pinsel gewesen, die seinen Ansprüchen schon lange nicht mehr genügten. Er musste den ersten Lohn abwarten, ehe er sich ein paar echte Marderhaarpinsel und Ölfarben in glänzenden Tuben kaufen konnte, so wie sie die »richtigen« Maler benutzten.
Doch jetzt brannte er darauf, das Hotel kennenzulernen. Er zog seine Uniform an, überprüfte in einem kleinen Spiegel über dem Waschbecken sein Aussehen, dann verließ er das Zimmer. Zuerst fuhr er nach unten in die Empfangshalle, die ganz mit hellem Marmor ausgelegt war. Er nickte dem Jungen zu, der den Fahrstuhl bediente, und half einem schmächtigen Pagen, der sich an einem Überseeschrankkoffer zu schaffen machte. Jean bewunderte die prächtigen Blumenarrangements, die Teppiche, die sich die Marmortreppen emporzogen, die kostbaren Möbel. Alles hier atmete Eleganz und Noblesse, ohne überladen zu wirken. An den Wänden hingen riesige Gobelins, die so kunstvoll hergestellt waren, dass es Jean beinahe den Atem raubte. Noch nie zuvor hatte er solche Pracht gesehen. Sein Herz schlug einen Takt schneller, als er daran dachte, dass er all diese auserlesenen Kostbarkeiten von nun an jeden Tag betrachten durfte.
»Excusez moi«, hörte er eine helle Stimme hinter sich. Ein junges Zimmermädchen trug eine riesige Vase mit einem überdimensionalen Strauß frischer weißer Lilien.
»Oh, darf ich Ihnen das abnehmen?«, fragte er höflich.
»Merci. Ich dachte schon, mir fallen die Arme ab.« Das Zimmermädchen lachte leise. »Da drüben auf den Tisch zwischen die beiden Recamieren bitte.«
Jean setzte die wirklich schwere Vase auf dem kleinen Tisch mit den zierlichen Beinen ab. Das Zimmermädchen lächelte ihn an. Sie hatte kleine Grübchen in den Wangen, wenn sie lachte, und ihre Augen strahlten wie honigfarbenes Gold. »Du bist neu hier, nicht wahr?«
Jean nickte hingerissen. »Heute angekommen. Ich bin der neue Concierge.«
»Ich bin Coralie, eines der Zimmermädchen. Herzlich willkommen bei uns. Wir sagen uns übrigens untereinander ›Du‹.«
»Coralie!« Wie aus dem Nichts stand plötzlich Madame Colette vor ihnen. »Du bist nicht zum Schwatzen hier. Da, diese eine Blüte ist noch nicht aufgegangen. Sie hat im Strauß nichts zu suchen.«
»Jawohl, Madame Colette.« Coralie knickste, dann entfernte sie die besagte Blüte, rückte noch ein wenig an der Vase herum und verschwand. Jean starrte ihr verzückt hinterher.
»Jean. Auch Ihnen rate ich, Ihre privaten Angelegenheiten niemals, ich wiederhole NIEMALS, in der Empfangshalle zu besprechen. Es würde einen sehr schlechten Eindruck auf die Gäste machen.«
»Sie haben recht, Madame. Bitte entschuldigen Sie.«
»Monsieur Grunwald wird Sie gleich rufen. Zuvor schauen Sie sich aber bitte den Salon Castellane genau an. Es ist unser schönster Raum, in dem sich die Gäste sehr gern aufhalten. Er liegt nahe bei der Rezeption, deshalb müssen Sie ihn so gut kennen wie Ihre Westentasche. Auf dem Weg in den Salon Castellane werden die Gäste sich an Sie wenden. Sie müssen Anrufe im Salon weitergeben, von vorgefahrenen Taxis berichten, Reservierungen für Restaurants und Theater vornehmen, Bahn- und Flugtickets bestellen, während die Gäste sich einen Aperitif gönnen.«
»Sehr wohl, Madame.« Jean machte eine kleine Verbeugung und begab sich sogleich in das Herzstück des Le Bristol.
Er blieb stehen und blickte sich begeistert in dem beinahe zweihundert Quadratmeter großen Raum um. Die Wände des Salons waren mit Holz in Honigtönen getäfelt, dazwischen prangten prächtige Wandmalereien. Unzählige Kristallleuchter schickten ihr Strahlen und Funkeln in den Raum, der Boden war mit dicken Teppichen belegt, die Decke mit vergoldetem Stuck geschmückt. Ehrfürchtig ging Jean durch den Salon und konnte sich kaum sattsehen. Zwei Hausmädchen waren gerade dabei, noch schnell den Saum einer gestickten Leinentischdecke aufzubügeln. Die Aschenbecher strahlten kristallen rein, die roten Rosen in den kleinen Vasen wirkten so frisch, dass Jean meinte, noch Tautropfen auf ihren samtigen Blütenblättern zu sehen. Um diese Vormittagsstunde war noch niemand im Castellane, doch Jean konnte sich gut vorstellen, dass nach dem Mittagessen die Gäste im Salon ihren Kaffee tranken. Der Aperitif am Abend musste hier drin ein wahres Vergnügen sein. Jean meinte, in Gedanken die leisen Gespräche und das perlende Lachen der Damen zu hören, er roch den Duft teurer Parfüms, sah die prächtigen Kleider und glaubte sogar, ein leises Vibrieren von Schritten zu vernehmen. Nur ungern verließ er den Salon Castellane. In der Eingangshalle bewunderte er die marmornen Säulen, die mit ihrem matten Glanz beinahe geweiht wirkten. Ein großer schlanker Herr kam gemessenen Schrittes durch die Empfangshalle und blieb vor Jean stehen. »Wer sind Sie, wenn ich fragen darf?«
Jean verbeugte sich leicht. »Mein Name ist Jean Bressot, Concierge hier im Haus. Wie kann ich Ihnen dienen?« Er betrachtete den schlanken Mann mit dem energischen Kinn, der Autorität ausstrahlte. Das Haar lag ordentlich und war nach der neuesten Mode geschnitten. Der Anzug und die Schuhe Maßanfertigungen – dafür hatte Jean in seinen Hoteljahren einen Blick bekommen. Alles in allem sah der Fremde nicht nur aus wie jemand, der eine Armee befehligen konnte, sondern auch wie ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der erwartete, dass man widerspruchslos tat, was er befahl.
»Ah, der Neue.« Monsieur Jammet strich ein unsichtbares Stäubchen vom Ärmel seines schwarzen Jacketts. »Nun, junger Mann, dann kennen Sie wohl das oberste Gebot des Hauses? Die drei goldenen Regeln?«
»Es tut mir sehr leid, Monsieur, ich bin heute erst angekommen. Wenn Sie eine Minute warten möchten? Ich erkundige mich auf der Stelle.«
»Das brauchen Sie nicht. Die drei goldenen Regeln heißen: Diskretion, Pünktlichkeit und Höflichkeit. Die wichtigste aber ist die Diskretion.«
Erneut verbeugte sich Jean ein wenig. »Das versteht sich von selbst, mein Herr.«
Der Herr winkte in Richtung Rezeption. Monsieur Grunwald eilte herbei. »Monsieur Jammet, was kann ich für Sie tun?«
»Mein lieber Grunwald, bitte erklären Sie diesem jungen Mann unsere Regeln.«
»Sehr gern. Die Mitarbeiter dieses Hauses hören nichts als Anweisungen, sehen nichts als ihre Arbeit und schweigen über alle Angelegenheiten des Hotels. Was im Le Bristol geschieht, das bleibt im Le Bristol.«
Jean nickte. »Sehr wohl. Selbstverständlich.«
Plötzlich reichte der Herr Jean seine rechte Hand. »Dann auf ein gutes Miteinander«, sagte er. »Wie Monsieur Grunwald schon gesagt hat: Mein Name ist Hippolyte Jammet, und mir gehört dieses Hotel.«
»Es freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Monsieur Jammet.«
»Machen Sie Ihre Arbeit ausgezeichnet, dann freue ich mich auch.«
Jammet drehte sich zum Empfangschef: »Sie denken an das, was wir besprochen haben?«
»Natürlich. Alles wird zu Ihrer Zufriedenheit erledigt werden.«
»Vielleicht nehmen Sie gleich den Neuen dafür?« Jammet winkte Grunwald ein paar Schritte zur Seite und flüsterte: »Ihn kennt noch niemand hier. Aber ich bin sicher, dass wir uns auf ihn verlassen können.«
»Aber wir wissen doch im Grunde nichts über ihn«, brachte der Empfangschef seine Bedenken vor. »Und er ist sehr, sehr jung …«
»Er hat ausgezeichnete Referenzen. Ich habe mich bei seinen vorigen Arbeitgebern über ihn erkundigt. Er wird sich hüten, unser Vertrauen zu missbrauchen.«
»Wie Sie wünschen, Monsieur Jammet.«
Der Hoteldirektor verschwand mit einem Nicken.
Grunwald musterte Jean aufmerksam, aber er schien nichts zu finden, das er bemängeln konnte. »Nun, bis zum Mittag sind die Aufgaben schon verteilt. Aber ab heute Nachmittag kümmern Sie sich um die Gästekartei. Jeder Gast, der eincheckt, bekommt eine Karteikarte, auf der das Anreise- und Abreisedatum steht sowie die Zimmernummer und die Ausgaben. An der Rezeption finden Sie eine Liste mit der aktuellen Zimmerbelegung. Aktualisieren Sie die Kartei. Morgens sorgen Sie dafür, dass die Zeitungen pünktlich auf die Zimmer kommen. Wir besprechen täglich in der Frühe, welche Räume neu belegt und welche Gäste abreisen werden. Haben Sie noch Fragen?«
»Ja, Monsieur. Wo finde ich die Nummer des Taxirufes, des Krankenhauses und der … äh …äh …«
»… der Etablissements?«
»Ja.« Jean spürte, wie seine Wangen zu glühen begannen.
»Alle Telefonnummern, die wir brauchen, finden Sie in dem roten Lederbuch in der Schublade der Rezeptionstheke. Wir helfen in allen Angelegenheiten. In allen!«
»Ich habe verstanden. Wir nehmen Sendungen und Telefonate entgegen und leiten sie sofort weiter. Wir besorgen Blumen, kümmern uns um kleinere Besorgungen, halten Briefmarken und Umschläge vor, übernehmen Reservierungen außer Haus. Wir haben einen Fahrplan für Züge vorrätig und buchen Bahntickets. Wir kennen die Sehenswürdigkeiten der Stadt und wissen, wie man am besten dorthin kommt. Außerdem entgeht uns kein Wunsch der Gäste. Wir erraten sie, bevor der Gast sie aussprechen muss.«
»Gut.« Monsieur Grunwald nickte zufrieden. »Vergessen Sie bitte die Buchung der Flugtickets nicht. Die meisten Gäste unseres Hauses sind in der Lage, sich diesen Luxus leisten zu können.«
Jean schluckte. Er hatte noch nie jemanden getroffen, der schon einmal mit einem Flugzeug geflogen war, selbst in dem Hotel in Marseille nicht. Doch im Le Bristol schien das Fliegen an der Tagesordnung zu sein.
»Sie können jetzt in den Speisesaal gehen und zu Mittag essen. Danach legen Sie Ihre Uniform ab, nehmen sich ein Lastenfahrrad hinter dem Dienstboteneingang und fahren zum Louvre. Sie sagen, Sie kämen vom Le Bristol und sollen ein Paket abholen. Man wird es Ihnen geben. Dann kommen Sie auf dem schnellsten Weg hierher zurück, liefern das Paket bei Madame Colette ab. Anschließend fahren Sie erneut zum Louvre, holen das nächste Paket und so weiter und so fort. Ich erwarte äußerste Vorsicht. Nicht ein einziger Kratzer darf an die Pakete kommen.«
»Was ist denn darin?«, wollte Jean wissen.
Monsieur Grunwald maß ihn mit einem strengen Blick. »Das braucht Sie nicht zu kümmern. Sie werden drei Mal dorthin fahren. Wenn Sie unterwegs unser Zimmermädchen Coralie treffen – ich weiß nicht, ob Sie sich schon begegnet sind –, tun Sie, als ob Sie sie nicht kennen. Sie wird einen Kinderwagen schieben. Machen Sie sich deswegen keine Gedanken. Es hat alles seine Richtigkeit damit.«
»Sehr wohl.« Jean verbeugte sich, dann fragte er nach einem Stadtplan, prägte sich den Weg zum Louvre ein und ging in den Speisesaal für die Angestellten, der sich unten im Keller befand. Er aß einen kräftigen Bohneneintopf mit kleinen Hammelfleischstücken darin, danach eine Vanillecreme. Sein Blick schweifte immer wieder zur Tür und suchte nach Coralie. Doch das Zimmermädchen mit den goldenen Augen sah er nicht.
Nach dem Mittagessen zog er seine Uniform aus und die Straßenkleidung an und bestieg eines der Lastenräder hinter dem Hotel. Er fuhr auf der Rue du Faubourg Saint-Honoré nach Südosten und bog nach zehn Minuten in die Avenue de L’ Opéra ab, danach in die Rue de Rohan und weiter bis zum Place du Carrousel. Schon nach wenigen Minuten war Jean verschwitzt. Das lag nicht nur an der strahlenden Sonne, sondern auch daran, dass ganz Paris auf den Beinen zu sein schien. Autos mit Matratzen auf den Dächern, Schubkarren, deren Schieber unter ihrer Last schwankten, Kinderwagen, auf denen Deckbetten und Kissen lagen, alles, alles drängte, strömte ihm entgegen. Frauen trugen, was sie hatten greifen können. Wäschekörbe, Koffer, Säcke, Stiegen. Kinder hielten Puppen oder Holzautos umklammert, manche weinten, ein kleines Mädchen rief nach seiner Mutter. Jean fluchte leise, denn er musste in die entgegengesetzte Richtung. Er wich Autos und Fuhrwerken aus, drängte zwischen anderen hoch beladenen Lastenrädern hindurch, zwischen Frauen, Kindern und Alten. Die Menschen drängelten, rempelten, schimpften und weinten. Manchmal war er schier eingekeilt, doch nach einigen Minuten ging es weiter, und Jean, der so etwas noch nie gesehen hatte, spürte Mitleid mit den von Angst und einer unsicheren Zukunft getriebenen Menschen. Die meisten Geschäfte hatten bereits geschlossen, an anderen rasselten Gitter herunter. An einer Tankstelle drängte sich ein Auto hinter das andere.
Nach einer guten Stunde hatte er den Weg, für den er eine Viertelstunde eingeplant hatte, geschafft und klingelte am Hintereingang des Louvre. Ein Mann öffnete ihm. »Sie kommen vom Le Bristol?«, fragte er.
»Ja, mein Herr.«
Der Mann, der die Uniform eines Pförtners trug, spähte verstohlen nach rechts und links. »Schnell, kommen Sie herein.«
Jean betrat einen Gang, der unterhalb der Ausstellungsräume lag. Rechts führte eine Treppe an ihm vorbei. Ein Handwerker kam von unten, einen Bilderrahmen unter dem Arm. Er grüßte und ging weiter die Treppe hinauf. Es roch nach Holz und Farbe und ein wenig nach Staub, Zigarettenrauch und Seife. Der Mann, der ihn eingelassen hatte, überreichte ihm ein unhandliches, flaches Paket, das in einen dicken Stoff eingeschlagen und an den Rändern vernäht war. »Seien Sie vorsichtig damit. Und lassen Sie sich von nichts und niemandem aufhalten.«
»Sehr wohl.« Jean ahnte, was in dem Paket war, doch er getraute sich nicht zu fragen. Im Le Bristol arbeiten hieß schweigen. Das Paket war halb so groß wie ein Badetuch, hatte aber harte Ecken und Kanten. Behutsam lud Jean die Fracht in das Lastenfach des Fahrrades und passte auf, dass die Ecken geschützt waren. Er fuhr langsam, darauf bedacht, niemandem in die Quere zu kommen. Unweit des Louvre waren gerade zwei Polizisten dabei, einen jungen Mann zu befragen. Jean blieb stehen und verbarg sich hinter einer Litfaßsäule. Zwar hatte er niemanden sagen hören, dass er die Polizei meiden soll, doch Jean wusste, dass das, was er in seinem Lastenrad transportierte, nicht für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt war. Endlich gingen die Polizisten weiter, und Jean setzte seinen Weg fort. Er wich einer kleinen Menschenmenge aus, die aus einem Metro-Schacht ans Tageslicht strömte und, ohne zu schauen, die Straße überquerte. Ein kleiner Junge riss sich von seiner Mutter los und stolperte auf die Fahrbahn. Jean musste scharf bremsen. Er hörte, wie das Paket gegen die Blechwand der Lastenbox stieß. Sogleich stieg er von seinem Rad und kontrollierte sorgfältig die Ladung. Beruhigt stellte er fest, dass das Paket unbeschädigt war.
In der Rue de Rohan erblickte er Coralie mit einem Kinderwagen in der Menschenmenge. Sie hatte Mühe, vorwärtszukommen. Fast hätte er sie in ihrem Straßenkleid und ohne das Häubchen nicht erkannt. Die Sonne malte goldene Strähnen in ihr Haar und ließ das grüne Kleid leuchten. Jean fand sie noch schöner als am Vormittag.
Er wusste natürlich längst, was in den Paketen war. Er kannte den Geruch von Terpentin und Holzleim, und was außer Bildern gab es sonst noch im Louvre? Er war so gespannt, welches Gemälde in seinem Paket versteckt war. Hoffentlich durfte er es sehen. Dieses und auch die anderen, die er aus dem Louvre holen sollte. Hoffentlich durfte er Zeit mit ihnen verbringen, die Strichführung genau studieren, das Licht, den Auftrag. Ob auch ein paar Bilder der französischen Impressionisten dabei waren? Oh, er liebte die Bilder von Claude Monet, ganz besonders die berühmten Seerosen. Sie hatten im Louvre gehangen. Wo sie jetzt waren, wusste Jean nicht. Er hatte sie noch nie im Original gesehen und hätte alles darum gegeben, ihnen einmal ganz nahe zu sein. Wenn er an die Bilder dachte, dann hatte er Ameisen im Bauch. Ein Freund aus Marseille hatte ihm erzählt, dass diese Ameisen immer dann im Bauch waren, wenn man sich verliebt hatte. Aber Jean war noch nie verliebt gewesen. Jedenfalls noch nie so sehr, dass er darüber seine Malerei vergessen hätte.
Plötzlich kreischten die Bremsen eines Autos, ein Mann drohte ihm mit der Faust, und Jean nickte entschuldigend. Aber schon drohte neues Unheil von der anderen Seite. Es herrschte ein Gedränge und Gehupe, kleinere Autos schwankten unter der Last ihrer Ladung. Dort drüben steuerte ein hoch beladenes Fuhrwerk auf Jean zu. Jemand fluchte. Jemand schimpfte. Jemand weinte. Und ganz Paris schien heute auf den Beinen zu sein! Nach Süden, nach Süden! Auf einem LKW saß eine ganze Familie, die Mutter hielt eine Bettdecke auf ihrem Schoß. Von einem anderen fiel eine Kiste herunter. Der Mann, der auf der Ladefläche saß, schrie, dass der Fahrer anhalten sollte. Aber wie inmitten all der Autos und Fuhrwerke und Lastenräder, Motorräder und Lastkraftwagen? Auf den Trottoirs zogen die Menschen Koffer hinter sich her, waren mit Taschen und Kindern beladen. Eine Frau schleppte einen Rucksack, an dem eine Bratpfanne hing. Ein weinendes Kind trug seine Puppe im Arm.
Kapitel 3
Erschöpft und verschwitzt kam Jean im Hotel an. Madame Colette reichte ihm ein Glas Wasser und nahm ihm das Paket ab.
»Ist es auch nicht beschädigt?«, wollte sie wissen.
»Aber nein, ich habe gut aufgepasst. Einfach war es nicht.«
»Gut gemacht, Jean. Am besten wäre es, wenn Sie sich gleich noch einmal auf den Weg machen würden.«
Als Jean endlich mit dem dritten Paket im Le Bristol eintraf, lächelte Madame Colette ihn besonders freundlich an. »Danke sehr, Jean«, sagte sie und legte ihm kurz eine Hand auf die Schulter. »Und jetzt machen Sie sich frisch, an der Rezeption wartet man bereits auf Sie.«