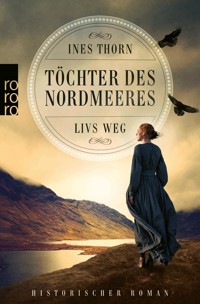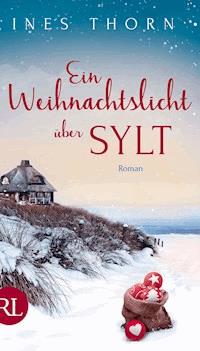9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historischer Frankfurt-Roman
- Sprache: Deutsch
Frankfurt, 1950. Christa hat ihre große Liebe, den Lyriker Jago, wiedergefunden. Doch die Vergangenheit wirft allzu schwarze Schatten auf das junge Glück. Auch sonst merkt Christa überall, wie schwer es ist, ihrem Herzen zu folgen: beim Schreiben ihrer Doktorarbeit und bei ihrem Wunsch, als Buchhändlerin den Menschen Freude durch Literatur zu schenken, ihren Horizont zu erweitern – und ihnen den Staub aus den Köpfen zu fegen. Alle sehnen sich nach einer heilen Welt, im Leben und in Büchern. Doch damit Christas Welt – und auch ihr Herz – wieder heil werden kann, braucht sie allen Mut, den sie aufbringen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ines Thorn
Die Buchhändlerin: Die Macht der Worte
Roman
Über dieses Buch
Große Träume in einer zu engen Welt
Frankfurt, 1950. Christa hat ihre große Liebe, den Lyriker Jago, wiedergefunden. Doch die Vergangenheit beider wirft allzu schwarze Schatten auf das junge Glück. Auch sonst merkt Christa überall, wie schwer es ist, ihrem Herzen zu folgen: beim Schreiben ihrer Doktorarbeit und bei ihrem Wunsch, als Buchhändlerin den Menschen Freude durch Literatur zu schenken, ihren Horizont zu erweitern – und ihnen den Staub aus den Köpfen zu fegen. Viele sehnen sich nach einer heilen Welt, im Leben und in Büchern. Andere lehnen sich mit Macht gegen Konventionen und Zwänge auf. Damit Christas Welt – und auch ihr Herz – wieder heil werden kann, braucht sie allen Mut, den sie aufbringen kann.
Spießigkeit und Wagnisse, heile Welt und Skandale – eine aufregende Zeit für die deutsche Bücherlandschaft.
Vita
Ines Thorn wurde 1964 in Leipzig geboren. Nach einer Lehre als Buchhändlerin studierte sie Germanistik, Slawistik und Kulturphilosophie. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main und schreibt seit Langem erfolgreich historische Romane.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Heike Brillmann-Ede
«Ulm 1592», aus: Bertolt Brecht, Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 12: Gedichte 2. © Bertolt-Brecht-Erben / Suhrkamp Verlag 1988.
Erich Fried, Das Land / Was es heißt aus: und Vietnam und, 41 Gedichte. Mit einer Chronik © 1966, 1996 Verlag Klaus Wagenbach, Berlin
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Berlin: Buecherstube Marga Schoeller, 1958; Richard Jenkins; ullstein bild – Fritz Eschen; Renee Quost/Trevillion Images
ISBN 978-3-644-01214-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Name: Christa Hauff, geborene Schwertfeger
Anschrift: 6000 Frankfurt-Bornheim, Berger Straße 168
Geburtsdatum und -ort: 1.6.1929 in Frankfurt/Main
Familienstand: verheiratet mit Werner Hauff
Kinder: Vormundschaft für Heinz Nickel, geboren am 21.9.1937
Christa setzte den Stift ab und blickte zum Fenster. Sie sah den grauen Himmel. Regentropfen rannen über die Scheiben. Es war kalt, im Wetterbericht hatte es geheißen, dass es Nachtfrost geben würde. Genauso ein Wetter war, als sie Heinz quasi auf der Türschwelle gefunden hatte. Damals, 1945. Sechzehn Jahre alt war sie gewesen, und der kleine Heinz gerade mal sieben. Sie hatte ihn sofort ins Herz geschlossen, war für ihn eine Mischung aus großer Schwester und Mutter geworden. Sie überlegte, ob sie ein eigenes Kind mehr lieben konnte als Heinz. Nein, das war unvorstellbar. Aber Kinder wollte sie auf jeden Fall einmal haben. Am liebsten zwei, einen Jungen und danach ein Mädchen.
Sie wandte sich wieder ihrem Lebenslauf zu. Eine Anstellung suchte sie zwar gerade nicht, aber es schadete nichts, alles auf den neuesten Stand zu bringen.
Ausbildung:
1945 Abitur an der Musterschule
1945–1946 Besuch der Bräuteschule Fiedler
Christa hatte die Bräuteschule gehasst und ihre Mutter Helene damit traurig gemacht. Sie hatte keinen erstklassigen Schweinebraten auf den Tisch bringen wollen, sie wollte nicht wissen, wie man Strümpfe stopfte oder es dem Ehegatten so behaglich wie möglich machte. Die Bräuteschule, das war für Christa das Relikt einer alten Zeit. Sie aber war eine junge, moderne Frau, die sich ihren Platz im Leben erkämpfen wollte. Ein Studium schien ihr dafür am besten geeignet.
1946–1951 Studium der Germanistik an der Universität Mainz; seitdem Promotion
Bevor sie nach Mainz zum Studium gegangen war, hatte sie sich zunächst an der Frankfurter Universität eingeschrieben und gelernt, dass der Krieg zwar vorüber war, sich aber an der Stellung von Frau und Mann nichts geändert hatte. Professor Habicht. Den Namen würde sie nie vergessen. Er hatte sie und die vier anderen Frauen aus dem Hörsaal vergrault und ihnen zu verstehen gegeben, dass sie den Männern nur den Platz wegnahmen. Wie groß war ihre Freude gewesen, als sie an der Mainzer Universität eine Dozentin hatte. Sogar eine mit Doktortitel. Ja, Christa war wirklich stolz darauf, nun mit Frau Dr. Gunda Schwalm befreundet zu sein.
Beruf:
seit 1946 Tätigkeit als Buchhändlerin
Sie war gern Buchhändlerin. Doch, das war sie. Aber damals, 1946, da hatte sie gemusst. Ihr Onkel Martin war ins Gefängnis gekommen. Verstoß gegen die Paragraphen 175 und 175a, die beiden Schwulenparagraphen. Und sie hatte seine Buchhandlung weiterführen müssen. Sie hatte es gern getan, keine Frage. Noch lieber hätte sie sich mit ganzer Kraft ihrem Studium gewidmet. Aber es war, wie es war. Sie war noch jung. Sie konnte ihre Träume noch leben.
Frankfurt/Main, den 26. März 1951
Christa Hauff
Teil 11951–1954
Kapitel 1
Christa hielt den Brief in der Hand und kämpfte mit den Tränen. Sie riss am obersten Knopf ihrer Bluse, um mehr Luft zu bekommen. Ihr Magen krampfte sich zusammen. Sie sollte sich für Heinz freuen, stattdessen geriet sie in Panik. Sie griff zum Telefonhörer und rief Werner an, ihren Ehemann, der die Hälfte der Zeit mit Christas Onkel Martin in einer homosexuellen Beziehung in der Schweiz, in Basel, lebte. Ein Arrangement, mit dem alle drei zufrieden, wenn auch nicht glücklich waren. Sie hatten diese Lebensform so vereinbart, um Martin, der so hatte leiden müssen, endlich glücklich zu sehen.
«Musikhaus Hauff.»
«Martin? Bist du das?»
«Ja, ich bin’s. Hallo, Christa. Ist was passiert?»
«Ihr müsst kommen. Sofort. Ihr müsst beide nach Frankfurt kommen.»
«Mein Gott, du klingst fürchterlich aufgeregt. Was ist denn los?»
«Heinz. Das Rote Kreuz hat uns einen Brief geschickt. Sie haben seinen Vater gefunden. Er will morgen nach Frankfurt kommen und seinen Sohn abholen. Morgen! Was sollen wir nur tun?»
«Was? Wie bitte? Aber Heinz gehört zu uns», stammelte Martin.
«Kommt her. Alle beide. Vielleicht finden wir eine Lösung.»
Sie hörte noch, wie Martin nach Werner rief, dann klickte es in der Leitung. Das Gespräch war beendet.
Christa legte den Hörer auf und ging zurück in die Küche, in der ihre Mutter Helene saß und heulte. «Er kann ihn uns nicht wegnehmen. Er ist ein Teil unserer Familie.»
Christa seufzte und schluckte ihre eigenen Tränen herunter. «Doch, er kann. Es ist sein Sohn. Wir hätten damit rechnen müssen, wir haben kein Anrecht auf ihn.» Aber ich habe nicht damit gerechnet, dachte sie leise. Nie ist mir der Gedanke gekommen, Heinz könnte zu seinen Verwandten gehen, obwohl er sich ihnen vielleicht näher fühlt als uns. Ja, ich habe mir Heinz immer allein gedacht und uns als seine Nächsten. Wie egoistisch das doch war.
«Aber wir haben ihn gefunden, als er mutterseelenallein durch Frankfurt streifte. Wir haben ihn aufgenommen, verpflegt, gekleidet. Wir haben ihn zur Schule geschickt und die Hausaufgaben kontrolliert. Wir haben ihm das Klavier gekauft und ihn Unterricht nehmen lassen. Und Werner und du, ihr habt ihn doch adoptiert. Eines Tages wird er Werners Musikverlag übernehmen oder unsere Buchhandlung oder beides.» Helene wischte sich mit ihrem Taschentuch über die Augen.
«Ich weiß, Mama», erwiderte Christa und dachte an den Abend vor sechs Jahren zurück, als sie den siebenjährigen Heinz auf der Hausschwelle gefunden hatte, mit Pappkartons statt Schuhen an den Füßen, verdreckt, hungrig und allein. Ein Wolfskind war Heinz gewesen. Er hatte seine Mutter auf einem Treck verloren. Sie war gestorben, als eine Kuh durchging und sie mitgeschleift hatte. Er hatte sich ganz allein durchgeschlagen, war ein Stück mit den russischen Soldaten mitgezogen, hatte vor Hunger Gras gegessen und sich endlich einem anderen Treck angeschlossen, der ihn nach Frankfurt führte.
«Wir müssen es ihm sagen. Gleich wenn er aus der Schule zurückgekehrt ist.» Christa blickte zur Uhr. In einer halben Stunde würde Heinz da sein. Und sie musste jetzt runter in die Buchhandlung und ihrer Freundin und Kollegin Gertie Volk den Schlüssel übergeben, damit sie nachher das Geschäft schließen konnte.
Sie eilte die Stufen hinab in ihren Laden, der im Erdgeschoss des Hauses lag, das der Familie Schwertfeger gehörte und in dem sowohl Helene als auch Christa und Werner ihre Wohnungen hatten.
«Wie läuft es?», fragte Christa und ließ ihren Blick durch die Buchhandlung schweifen. Die Bücher standen ordentlich in den Regalen, der Zeitungsständer war gut bestückt, der Tisch mit den Neuerscheinungen aufgeräumt, die Schaufenster blinkten vor Sauberkeit. Gerade wischte Gertie noch das letzte Stäubchen von der Kasse.
«So wie immer am Freitag. Die Leute erledigen ihre Wochenendeinkäufe und schauen noch mal kurz bei uns vorbei. Dr. Friedrichs hat seine Bestellungen abgeholt, Frau Dörr hat drei Bücher für ihre Enkelkinder bestellt, von Rowohlt ist neue Ware gekommen und von Ullstein eine Rechnung. Die habe ich dir auf den Schreibtisch gelegt.» Gertie Volk betrachtete ihre Chefin genau. «Christa, du hast doch was. Das sehe ich doch. Ist was passiert?»
Christa hatte einen Kloß im Hals und musste mehrfach schlucken, ehe sie antworten konnte: «Heinz. Man hat seinen Vater gefunden. Er kommt morgen.»
«Oh!» Gertie legte kurz eine Hand auf Christas Schulter. «Das tut mir leid. Meinst du, er will ihn mitnehmen?»
Christa hob die Schultern. «Ich weiß es nicht sicher. Aber welcher Vater will seinen Sohn nicht zurückhaben?»
«Wissen es die Baseler schon?»
«Ja, und sie kommen noch heute nach Frankfurt. Wahrscheinlich sind sie schon auf dem Weg.»
«Wenn ich irgendwie behilflich sein kann?»
«Danke, Gertie. Es würde mir schon helfen, wenn du dich heute und morgen um den Laden kümmern könntest.»
Gertie nickte. «Ich kann am Montag auch den Laden allein übernehmen, wenn du willst. Montags ist nicht so viel los.»
«Das sehen wir dann. Aber ich danke dir, Gertie.»
Christa hatte eigentlich nach oben gehen wollen. Zurück in ihre Wohnung, zurück in eine Sicherheit, die es nicht gab, weil auf dem Küchentisch der Brief vom Roten Kreuz lag. Jago kam ihr in den Sinn. Jago von Prinz, ihre große Liebe, die sie verloren und vor zwei Jahren wiedergefunden hatte. Jago, der Mann, mit dem sie ihre persönliche Liebesgeschichte schreiben wollte. Aber auch er würde nicht helfen können. Wie auch?
Ach, ihr Leben war so kompliziert. Sie liebte Jago, war aber mit Werner Hauff verheiratet, der wiederum Martin, ihren Onkel, liebte. Sie hatte Werner geheiratet, um Heinz adoptieren zu können. Und um Werner und Martin zu schützen. Homosexualität war eine Straftat. Wer gegen den Paragraphen 175 verstieß, musste mit einer Haftstrafe rechnen. Martin hatte das am eigenen Leib erfahren. Während des Krieges war er im Konzentrationslager Buchenwald gewesen, weil er verbotene Bücher verkauft hatte, und kurz danach kam er erneut ins Gefängnis wegen Unzucht mit einem Minderjährigen, der neunzehn Jahre alt war, aber bei seinem Alter gelogen hatte.
Als Martin endlich aus dem Gefängnis kam, war er nach Basel gegangen, um dort ein Musik- und Musikaliengeschäft zu eröffnen, denn in der Schweiz wurden die Homosexuellen nicht verfolgt. Und Werner, der Martin liebte, lebte jede zweite Woche bei ihm und die restliche Zeit bei Heinz und Christa in Frankfurt. Werners Vater gehörte der Musikverlag Hauff, und da dieser nun über eine Dependance in Basel verfügte, war die Reiserei für Werner kein Problem. Die Geschäfte liefen gut. Das Leben war schön.
Früher hatte Martin die Buchhandlung Schwertfeger auf der Berger Straße gehört, doch als er ins Gefängnis musste, hatte seine Nichte Christa den Laden übernommen. Sie hatte dafür auf ihr Germanistikstudium verzichtet, bis Gertie Volk als Buchhändlerin bei ihr angefangen hatte. Christa war es schwergefallen, einstweilen auf ihren Traum vom Studium zu verzichten, aber die Familie ging vor. Das war schon immer so gewesen, und Christa wollte daran auch nichts ändern.
Sie hatte danach in Mainz bei Dr. Gunda Schwalm zu Ende studiert, die unterdessen eine gute, wenn nicht gar Christas beste Freundin geworden war. Nach dem Studium hatte sie dann doch die Buchhandlung weitergeführt. Zuerst ein wenig enttäuscht, aber immer mit einer unbedingten Liebe zur Literatur. Bücher waren ihr Ein und Alles. Bücher waren Lebensmittel für sie, ähnlich wichtig wie Brot und Wasser. Sie hätte sich auch eine Arbeit an der Universität im literaturwissenschaftlichen Bereich vorstellen können. Forschen, lehren. Aber sie war eine Frau, und für Frauen gab es sehr wenig Platz in der akademischen Welt. Selbst Gunda Schwalm hatte nur einen befristeten Vertrag und war für einen kriegsversehrten Professor eingesprungen. Sobald dieser wieder lehren konnte, würde sie ihm Platz machen müssen. Man hatte ihr gesagt, sie könnte danach als Sekretärin arbeiten, aber Gunda hatte einen Doktortitel und konnte und wollte sich nicht in ein dienendes Frauchen verwandeln. Dann war in Gundas Fachbereich eine Doktorandenstelle frei geworden, und Christa hatte zugegriffen. Nun schrieb sie an ihrer Dissertation mit dem Titel Die Beziehungen zwischen Mensch und Sprache in der Literatur des 20. Jahrhunderts unter Einbeziehung der deutschen Blut-und-Boden-Literatur und der Emigrationsliteratur und teilte ihre Zeit zwischen Promotion und Buchhandlung auf.
Christa griff nach dem Telefon in dem kleinen Büro, das zur Buchhandlung gehörte, und rief nun doch Jago an, der bei seinen Eltern im Taunus wohnte, wenn er nicht gerade bei ihr in der Berger Straße war.
«Herrenhaus von Prinz, guten Tag.» Die Stimme klang gelangweilt, und Christa glaubte, das Dienstmädchen am Apparat zu haben.
«Christa Schwertfeger, guten Tag. Ich würde gern Jago von Prinz sprechen.»
«Der junge Herr widmet sich seiner Kunst und möchte nicht gestört werden.»
Ach, dachte Christa, die Kunst. Jago war Dichter, hatte sogar schon ein Buch mit Gedichten veröffentlicht. Daneben hatte er ein abgeschlossenes Studium in Geschichte und Philosophie und arbeitete an einem Manuskript, in dem sich Gedichte mit kurzen Prosastücken abwechselten. Ein großes Werk sollte es werden. Eines, das Deutschland so noch nie gelesen hatte.
«Geben Sie ihn mir bitte, es ist wirklich wichtig.»
Das Dienstmädchen brummte noch etwas, dann hörte Christa, wie sie den Hörer hinlegte und jemanden anwies, Jago zu holen.
«Christa, geht es dir gut?», wollte Jago gleich darauf wissen, denn es geschah nicht oft, dass Christa bei ihm zu Hause anrief.
«Nein, mir geht es nicht gut. Morgen … Morgen kommt Heinz’ Vater. Wahrscheinlich will er ihn mitnehmen. Ach, Jago, Martin und Werner sind schon auf dem Weg. Heute Abend werden wir besprechen, was geschehen muss.» Christa spürte, wie sich erneut ihr Herz abschnürte.
«Ich … Ich komme. In einer Stunde bin ich da. Ich bitte meinen Vater, mir seinen Wagen zu leihen.»
«Danke …»
Christa fiel ein riesiger Stein vom Herzen. Mit Jago an ihrer Seite konnte ihr nichts passieren. Sie liebten sich, genossen jede Minute ihres Zusammenseins. Schwere Zeiten lagen hinter ihnen, aber sie hatten einen Rhythmus gefunden, und Christa fühlte sich bei Jago angekommen. Einzig, dass er sie noch nie in die Kronberger Villa mitgenommen und seinen Eltern vorgestellt hatte, war immer wieder ein empfindliches Thema zwischen den beiden. Sie hatte ihn ein paarmal darauf angesprochen, doch Jago hatte jedes Mal geantwortet: «Mein Vater ist kein netter Mann. Glaub mir, du willst ihn nicht kennen.» Nicht immer, aber an ihren schlechten Tagen glaubte sie, dass sich Jago vielleicht ihrer bürgerlichen Herkunft schämte, dass sie nicht in seine Familie passte. Immerhin war sein Vater ein Freiherr und Jago würde nicht nur seinen Titel, sondern auch den weitläufigen Besitz der Familie erben. An den guten Tagen wusste sie, dass Jago weder der Titel noch die Ländereien wichtig waren. Er war ein Dichter und war nur glücklich, wenn er vor der Schreibmaschine saß.
Christa winkte Gertie Volk noch einmal zu, dann stieg sie die Treppe hinauf in ihre Wohnung im zweiten Stock. Helene, ihre Mutter, stand am Herd und schälte Kartoffeln. «Ich koche uns eine kräftige Suppe. Egal, was kommt, gegessen werden muss.»
Christa lächelte, denn die Worte «Egal, was kommt, gegessen werden muss» waren so etwas wie das Motto ihrer Mutter.
Im selben Augenblick hörten sie einen Schlüssel im Schloss. Heinz kam von der Schule nach Hause.
Er betrat die Küche, gab Helene einen Kuss auf die Wange, küsste auch Christa und rieb sich die Hände. «Was gibt’s zum Essen?»
«Kartoffelsuppe mit Würstchen», erwiderte Helene und wagte ein schmales Lächeln.
Heinz grinste begeistert und warf seinen Schulranzen in die Ecke, doch nach einem Blick auf Christa hob er ihn auf und trug ihn in sein Zimmer. Dann hörten die Frauen, wie er sich die Hände wusch. Als er zurück in die Küche kam, lächelte er noch immer. So wie üblich. Er war ein fröhlicher Dreizehnjähriger, der in der Schule gute Noten bekam und nachmittags mit seinem Freund Willi die Gegend unsicher machte. Er hatte zwei große Leidenschaften. Die eine war das Klavierspiel. Niemand musste ihn zum Üben zwingen, denn das tat er jeden Abend gut zwei Stunden lang ganz allein. Die zweite Leidenschaft war das Lesen. Er liebte Abenteuerbücher, und Christa versäumte es nie, ihn mit gutem Lesestoff zu versorgen. Wenn er ein Buch von Jack London oder Mark Twain vor sich hatte, vergaß Heinz sogar das Essen. Das passierte ihm sonst nie.
Er würde einmal einen künstlerischen Beruf ergreifen, da war sich Christa sicher. Pianist würde er wohl nicht werden, er hatte zu spät mit dem Klavierunterricht begonnen. Aber er konnte den Musikverlag übernehmen, konnte in einer Jazzband spielen oder in einer der Combos, die sich nun überall zusammenschlossen.
«Setz dich mal hin. Ich muss dir etwas sagen.» Christa deutete auf den Stuhl neben sich. Sie nahm den Brief in die eine Hand, mit der anderen zupfte sie an ihrem Ohrläppchen. Das tat sie immer, wenn sie aufgeregt war. «Das Rote Kreuz hat deinen Vater gefunden. Morgen wird er hierherkommen.»
Auf Heinz’ Gesicht zeichnete sich eine riesige Überraschung ab. «Mein Vater?»
«Ja.»
«Mein Vater», flüsterte Heinz vor sich hin. «Mein richtiger Vater.»
Der Junge wirkte erschüttert, doch Christa tat das Herz weh. Sie hatte ihm all ihre Liebe gegeben. Sie hatte für ihn gesorgt, ihm sogar das Leben gerettet. Damals, kurz nach dem Krieg, als er so schwer an Diphtherie erkrankt war. Sie hatte ihre Jungfräulichkeit an einen amerikanischen GI verloren, um Penicillin für Heinz zu besorgen. Heinz wusste nichts davon. Niemand wusste davon.
«Freust du dich?», fragte Helene. Auch ihr Gesicht war blass, der Blick besorgt.
Heinz zuckte mit den Schultern. «Ich bin gespannt, wie er aussieht. Wie er ist.» Er blieb seltsam ruhig. Seine Worte klangen begeistert, aber nicht überschwänglich.
«Kannst du dich noch an ihn erinnern?», wollte Christa wissen.
«Eine einzige Erinnerung habe ich, aber ich weiß nicht, ob es wirklich eine Erinnerung ist oder ob ich mich nur an die Erzählung meiner Mutter erinnere. Ein Mann kommt zur Tür herein, breitet die Arme aus und ruft: ‹Wo ist denn mein Heinzchen?›»
«Und was ist, wenn …»
«Christa, jetzt lass ihn doch erst einmal diese Nachricht verdauen. Alles andere sehen wir später. Und jetzt essen wir.» Helene erhob sich und stellte die Suppenteller auf den Tisch.
Am Abend saßen sie alle zusammen. Die ganze Familie und Jago, der für Christa ebenso zur Familie gehörte wie die anderen.
Christa hatte im Wohnzimmer sechs Gläser auf den großen Tisch gestellt, für Werner, Martin, Helene, Jago, Heinz und für sich. Eine Flasche Rotwein atmete, die Gläser blinkten. Christa nahm ein Paket Salzstangen aus dem Schrank, öffnete es, verteilte die Stangen in zwei weitere Gläser und stellte sie auf den Tisch. Dann setzte sie sich, verschränkte die Arme und fragte: «Was nun?»
Alle Blicke waren auf Heinz gerichtet. Der Junge rutschte auf seinem Stuhl herum, als säße er auf Ameisen. «Was meinst du?»
Christa, die für Heinz immer eher eine Schwester als eine Mutter war, griff nach seiner Hand. «Es ist wahrscheinlich, dass er dich mitnehmen möchte. Nach Hause.»
Heinz schluckte. «Du meinst nach Litzmannstadt?»
«Ja, Heinz. Aber es heißt jetzt Lodz. Würdest du denn mitgehen wollen?»
Wieder rutschte Heinz auf seinem Stuhl herum, dann brach er plötzlich in Tränen aus. Werner legte eine Hand auf seinen Rücken. «Es ist schwer für dich, wir wissen das. Aber wie immer du dich entscheidest, wir werden deine Entscheidung respektieren und dich für den Rest unseres Lebens lieben. Das weißt du doch, oder?»
Heinz nickte, wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht, doch seine Miene zeigte pure Verzweiflung. «Ich möchte ja mit ihm mitgehen. Er ist mein Vater. Und ich möchte hierbleiben, weil ihr meine Familie seid. Ich weiß nicht, was ich tun soll.»
Martin räusperte sich. «Ich bin nicht sicher, dass dein Vater zurück nach Lodz will. Dort ist jetzt alles polnisch. Vielleicht möchte er sich anderswo niederlassen. Vielleicht sogar ganz in unserer Nähe.»
Heinz schwieg, und Christa hatte nicht den Eindruck, dass er Martins Worte überhaupt gehört hatte. Er zitterte ein wenig. Werner goss ihm ein halbes Glas Wein ein. «Hier, trink das. Eigentlich wollte ich dir zu deiner Konfirmation im nächsten Jahr das erste Glas Wein einschenken, aber jetzt ist es wohl nötiger.»
Heinz nahm das Glas, trank, verzog den Mund. «Sauer!», stellte er fest. Für einen Augenblick lächelte er, dann fiel sein Gesicht wieder in sich zusammen. «Was soll ich nur tun?», fragte er und sah dabei Jago an. «Was soll ich tun? Du warst auch allein und bist dann zu deinen Eltern zurückgegangen.»
«Ja, da hast du recht. Bis heute weiß ich allerdings nicht, ob das richtig war. Mein Vater und ich, wir … wir verstehen uns nicht. Aber nachdem mein älterer Bruder im Krieg gefallen war, dachte ich, meine Mutter braucht mich.»
Heinz trank noch einen Schluck Wein. «Und wenn mein Vater mich auch braucht?» Er seufzte tief, dann blickte er in der Runde umher. «Ihr habt euch. Aber was, wenn mein Vater ganz allein ist?»
«Du musst tun, was dein Herz dir sagt», schlug Christa vor und konnte doch nicht verhindern, dass ihr Tränen in die Augen traten. «Du wirst das Richtige tun, da bin ich mir ganz sicher. Und du hast hier ein Zuhause. Immer.»
Am nächsten Tag klingelte es Punkt 15 Uhr an der Wohnungstür von Christa, Werner und Heinz. Sie waren allein in der Wohnung. Martin war bei Helene, Jago noch in der Nacht zurück in den Taunus gefahren. Heinz trug seine gute Hose, dazu ein weißes Hemd. Christa hatte ihm die Haare mit Wasser gekämmt und einen schnurgeraden Scheitel auf seinem Kopf platziert. Jetzt stand sie neben ihm an der Tür. Sie sahen sich an, und in Christas Augen las er: Ich werde dich immer lieben. Da nickte Heinz kurz und öffnete die Tür.
Davor stand ein Mann, den Heinz uralt genannt hätte, dabei war er noch nicht einmal vierzig. Sein Haar war grau und hing ihm bis auf die Schulter. Er trug einen alten Armeemantel, der sauber, aber verschlissen war. Ausgezehrt wirkte er. Er sah aus, wie viele Kriegsheimkehrer aussahen.
«Guten Tag», sagte er mit einer Stimme, die Heinz zu leise vorkam, und reichte ihm die Hand.
«Guten Tag», erwiderte Heinz und schluckte.
Der Mann betrachtete ihn von oben bis unten. «Bist groß geworden.»
«Kommen Sie … Komm doch herein.»
Heinz trat einen Schritt zur Seite, um seinen Vater vorbeizulassen. Er führte ihn ins Wohnzimmer. Christa hatte Kaffee gekocht und einen Kuchen gebacken.
Sie reichte dem fremden Mann die Hand. «Ich bin Christa Hauff. Sie können mich gern Christa nennen.»
«August Nickel.»
Inzwischen war auch Werner aufgestanden und neben seine Frau getreten. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter, die andere streckte er dem Vater hin. «Und ich bin Werner Hauff. Wir haben Heinz vor drei Jahren adoptiert.»
«Adoptiert, so.» Der Vater presste die Worte, als passten sie nicht zwischen seinen Zähnen hindurch.
Christa bat ihn, Platz zu nehmen. Sie goss Kaffee ein und legte jedem ein Stück Kuchen auf den Teller. «Trinken Sie ihn mit Sahne und Zucker?», fragte sie.
«Ich habe seit Jahren keinen Kaffee getrunken. Früher mit Milch und Zucker. Sahne. Nein, wir hatten nie Sahne für den Kaffee.» Seine Worte klangen bitter, aber Christa schob ihm die Zuckerdose und das Sahnekännchen hin.
Dann blickte sie zu Heinz, der mit der Kuchengabel einen Bissen abtrennte und in den Mund schob. Er saß kerzengerade, die Ellenbogen ausreichend vom Tisch entfernt, die Stoffserviette auf dem Schoß platziert. Der Mann, der sein Vater war, legte beide Ellenbogen auf den Tisch, nahm den Kuchen in die Hand, biss große Stücke ab und schlang gierig. Erst jetzt fiel Heinz auf, wie unfassbar dünn der Mann war. Seine Augen lagen in tiefen Höhlen, sein Gesicht war grau, und am Hals hing die Haut viel zu locker. Es musste ihm schlecht gegangen sein in den letzten Jahren. Heinz wartete, dass der Mann etwas fragte oder sagte, aber das tat er nicht. Als ob der Kuchen seine gesamte Aufmerksamkeit beanspruchte.
Werner räusperte sich: «Wir hörten, Sie galten lange Zeit als vermisst.»
«Im Lager war ich. Sibirien.»
«Oh, das tut mir sehr leid.»
«Ich habe jahrelang Dreck gefressen.» Er hustete nach diesen Worten und schlug sich auf die Brust, um sich Erleichterung zu schaffen.
«Was haben Sie jetzt vor?», fragte Werner weiter.
«Ich habe ein Stück Land gekriegt. Neubauernland. Drüben, in Brandenburg. Ich werde mir eine neue Existenz aufbauen.»
Eine Frage lag in der Luft, aber niemand wagte es, sie zu stellen.
«Noch ein Stück Kuchen?», fragte Christa stattdessen, mit jedem Augenblick wurde ihr banger ums Herz. Der Mann hatte so gar keine Herzlichkeit in sich, und Christa wagte nicht, sich vorzustellen, wie er mit seinem Sohn umgehen würde. Andererseits war er gerade aus Sibirien zurückgekehrt und musste wohl erst ankommen. Immerhin hatte er gleich nach seinem Sohn gesucht. Das bewies doch, dass ihm etwas an Heinz lag. Sie lächelte August Nickel an und legte ihm ein großes Stück Kuchen auf den Teller. Sie selbst hatte keinen Bissen heruntergebracht, und auch auf Werners Teller lag noch ein halbes Stück Kuchen. Einzig Heinz hatte aufgegessen und spielte jetzt mit der Kuchengabel.
«Möchten Sie etwas von sich erzählen?», bat Christa vorsichtig.
«Da gibt es nichts zu erzählen. Ich habe mit meiner Familie in Litzmannstadt gelebt. Kein gutes, aber ein anständiges Leben. Dann kam der Krieg, dann die Gefangenschaft und jetzt sitze ich hier.»
«Heinz’ Mutter ist umgekommen», berichtete Werner. «Auf der Flucht.»
Der Mann starrte auf seinen Teller und nickte.
«Heinz war als Wolfskind unterwegs.»
Wieder nickte der Mann, dann sah er endlich auf. «Das ist jetzt vorbei. Wir müssen neu anfangen.»
«Ja», bestätigte Christa.
«Das ist wohl wahr», erwiderte Werner.
Dann schwiegen sie. Christa blickte zu Heinz, der auf seinem Stuhl immer kleiner wurde. «Willst du deinem Vater nicht erzählen, was du in all den Jahren gemacht hast?», forderte sie ihn auf.
«Ich … Ich bin in die Schule gegangen. Und ich habe Klavier spielen gelernt. Außerdem lese ich sehr gern. Ich möchte nach dem Abitur gern studieren.»
August Nickel trank seinen Kaffee aus, ohne seinen Sohn anzusehen. Dann erhob er sich plötzlich. «Nimm deine Sachen, wir gehen jetzt.» Er wandte sich an Werner und streckte ihm die Hand hin. «Ich danke Ihnen für alles, was Sie für meinen Sohn getan haben.»
Werner war verblüfft. «So schnell wollen Sie schon fort? Wollen Sie sich nicht erst einmal kennenlernen? Sie können hier wohnen, bei uns.»
«Am besten lernt man sich bei der Arbeit kennen. Davon gibt es genug in Brandenburg.»
«Aber Sie werden ihn doch weiter zur Schule schicken?» Christas Stimme klang klein und blass.
«Wir Nickels waren niemals bessere Leute.»
Heinz blickte hilfesuchend zu Werner. Er fürchtete sich ein wenig vor dem wortkargen Mann, das konnte Christa sehen. Deshalb wandte sie sich jetzt an ihn: «Willst du mit nach Brandenburg, Heinz?»
Heinz trat von einem Bein aufs andere, und Christa merkte, wie schwer ihm die Antwort fiel.
«Die Frage stellt sich nicht», erklärte Nickel knapp. «Er ist mein Sohn. Er macht, was ich sage.»
«Hören Sie.» Werner klang beschwörend. «Lassen Sie dem Jungen doch etwas Zeit. Sie sind ihm fremd, er kommt in eine fremde Gegend, ohne Schulfreunde, ohne Bekannte.»
«Ich bin auch fremd dort», erwiderte Nickel. «Los, Junge, nimm dein Gepäck.» Sein Blick streifte die Wanduhr. «Der Zug geht in einer Stunde.»
Da brach Christa in Tränen aus. Sie hatte sich so fest vorgenommen, tapfer zu sein, aber jetzt konnte sie nicht mehr. Werner legte den Arm um sie, drückte sie an sich.
Heinz holte einen Koffer und eine Reisetasche aus seinem Zimmer. Er hatte heute früh seine Sachen gepackt, weil er das nicht vor den Augen seines Vaters hatte tun wollen. Und vielleicht auch, weil er insgeheim gehofft hatte, sein Vater würde eine Entscheidung für ihn treffen. Er zog den neuen Mantel an, band sich den weichen Schal um, den Helene ihm gestrickt hatte, setzte die passende Mütze dazu auf.
August Nickel betrachtete den Sohn mit leisem Argwohn. «Hast schicke Kleider. Überleg dir, ob du sie noch brauchst auf dem Land.»
«Es sind nicht nur Kleider», antwortete Heinz leise. «Es sind auch Erinnerungen.»
Der Vater nickte Werner und Christa zu, dann schob er Heinz durch die Tür.
Ihre Schritte waren noch nicht im Treppenhaus verklungen, als sich Christa weinend an Werners Brust warf. Sie hatte gerade etwas verloren, das sie liebte, das zu ihnen gehörte. Und im Moment konnte sie sich kein Leben ohne Heinz vorstellen.
Kapitel 2
Es war Mai, über ein Jahr war Heinz nun schon fort, aber Christa vermisste ihn noch immer, an jedem einzelnen Tag. Er hatte anfangs beinahe jede Woche geschrieben. Briefe, die Christa am liebsten nicht gelesen hätte. Heinz schrieb, dass er morgens um vier Uhr aufstand, um die Kühe zu melken. Er schrieb, dass er Kartoffeln geerntet und gesetzt hatte. Er schrieb vom Schlachten. Eigentlich schrieb er ausschließlich über seine Arbeit. Kein Wort von Freunden, kein Wort über die Dinge, die Vierzehnjährige gern taten, keine Zeile über die Bücher, die er gelesen hatte. Christa antwortete, erzählte von der Buchhandlung, erzählte, dass sein Freund Willi nach ihm gefragt hatte. Jeden Monat schickte sie ein Paket nach drüben. Mit Kaffee, Schokolade, Kakao, Büchern, Noten und ein wenig Kleidung. Auch Zigaretten für August packte sie ein. Und Heinz bedankte sich dafür, aber sie erfuhr nie, ob die Sachen passten, hörte nicht, ob ihm die Bücher gefallen hatten. Von Heinrich Böll und Anna Seghers waren Erzählungen erschienen, und Gottfried Benn hatte den Preis der Gruppe 47 erhalten. Sie schrieb ihm auch, dass die Wilhelmsbrücke repariert und wieder befahrbar war und nun Friedensbrücke hieß, der Börsensaal, das Goethe-Haus und die städtischen Bühnen ihren Betrieb wieder aufgenommen hatten. Sie schrieb von all dem, was ihn hier interessiert hatte, aber sie ahnte, dass er nun andere Vorlieben hatte.
Christa machte sich Sorgen. Große Sorgen. Einmal fragte sie, ob sie Heinz nicht besuchen könnten. Die Reise wäre weit gewesen, 600 Kilometer. Sie wären einen ganzen Tag mit der Hinreise und einen ganzen Tag mit der Rückreise beschäftigt. Wie die Hotels oder Pensionen im Osten waren, daran wagte sie gar nicht zu denken.
Aber Heinz antwortete, dass er nicht wolle, dass sie zu Besuch kämen. Ja, er lud sie regelrecht aus, schrieb, es gäbe weder Hotels noch Pensionen oder Fremdenzimmer. Sie weinte, als sie das las. Sie hätte gern mit ihm telefoniert, doch die Nickels hatten kein Telefon.
Auch Werner konnte sie nicht trösten. «Du musst loslassen, Christa» war alles, was ihm zum Trost einfiel.
Nicht einmal Jago verstand ihren Kummer. «Du wirst eigene Kinder bekommen, Christa. Wenn es nach mir ginge, könnten wir gleich heute mit der Produktion beginnen.» Sie lächelte zwar, wenn er das sagte, aber das Lächeln erreichte ihre Augen nicht.
Jago. Es war nicht leicht für ihn, dass sie einen Ehemann hatte. Und allmählich verlor er die Geduld. Kurz nach Heinz’ Auszug hatte er das erste Mal gefragt: «Warum lässt du dich nicht scheiden? Ich verstehe ja, dass ihr gute Eltern für Heinz sein wolltet. Vater, Mutter, Kind, eine richtige Familie. Aber jetzt ist Heinz weg. Es gibt keinen Grund mehr für dich, mit Werner verheiratet zu bleiben.»
Er hatte recht, das wusste sie. Doch sie konnte sich nicht so einfach von Werner trennen. Er war ihr Ehemann, vor allem aber war er ihr Freund. Durch seine Homosexualität wäre er in Deutschland gefährdet, aber er konnte nicht einfach ganz zu Martin in die Schweiz ziehen. Da war der Musikverlag seiner Eltern hier in Frankfurt. Und seine Eltern wurden allmählich alt, brauchten Betreuung. Wie oft riefen sie an, weil das Radio nicht mehr lief, die Glühlampe nicht funktionierte oder sie zum Arzt gefahren werden mussten. Das bedeutete sogar, dass Werner seit einigen Monaten häufiger in Frankfurt als – so wie jetzt – in Basel war.
Und obschon Christa keine altmodischen Ansichten hatte, wusste sie doch, dass sie es als geschiedene Frau schwerer haben würde. Noch immer bestimmten die Männer. Das Geschäftskonto der Buchhandlung lief auf Werners Namen, das private ebenso, weil Frauen kein eigenes Konto haben durften. Sie durften auch ohne die Erlaubnis ihrer Ehemänner nicht arbeiten. Ja, es gab sogar Verlage, die keine Bücher an sie versandten, wenn nicht auch Werners Name mit auf der Bestellung stand. Sie brauchte einen Mann, um ihr Geschäft führen zu können.
Und selbst wenn Jago sie heiraten würde, sie bliebe in den Augen der anderen immer die Geschiedene. Das war nicht nur schlecht fürs Geschäft, das wäre sein Untergang.
Manchmal schien es Christa, als hätte sich Jago mit ihrer unmöglichen Liebe abgefunden. Schließlich hatte er sie noch immer nicht seinen Eltern vorgestellt. Das konnte daran liegen, dass sie noch verheiratet war, es konnte aber auch ganz andere Gründe haben. Zum Beispiel brauchte er für seine Arbeit viel Zeit und Ruhe, sein Buch und die Gedichte schrieben sich nicht von selbst. Ob sie heute Abend mit ihm darüber sprechen sollte? Über ihre gemeinsame Zukunft? Nein, sie wartete lieber, bis Jago selbst das Thema anschnitt. Schlafende Hunde sollte man nicht wecken.
Als Jago kam, hatte sie eine kalte Platte mit Hühnchen, Schinken und Käse vorbereitet. Sie hatte Tomaten ausgehöhlt und mit Fleischsalat gefüllt. Sie hatte kurze Stücke von Salzstangen in halbe Eier gesteckt, sodass sie wie Igel aussahen. Und sie hatte eine Maibowle angesetzt. Das alles hatte sie getan, weil Jago und sie heute einen Jahrestag hatten. Der siebte Jahrestag ihres ersten Kusses. Christa vermutete, dass Jago diesem Datum keine große Bedeutung beimessen würde, sie tat es.
Als es klingelte, strich sie sich noch einmal über ihr halblanges Haar, biss sich auf die Lippen und öffnete dann.
Das Erste, was sie sah, war ein großer Strauß mit dunkelroten, prachtvollen Rosen. Die Rosen waren traumhaft schön, sie dufteten wie ein ganzer Rosengarten und mussten ein Vermögen gekostet haben, aber das Schönste war, dass Jago den Jahrestag doch nicht vergessen hatte.
Beim Essen – auf Jagos Teller lagen zwei Eierigel und eine gefüllte Tomate – nahm er plötzlich Christas Hand. «Ich möchte dich nicht länger teilen», sagte er. «Ich kann das einfach nicht mehr. Nie bist du richtig bei mir. Niemals bin ich der einzige Mann in deinen Gedanken. Ich möchte eine Familie, Christa. Ich möchte Kinder, die meinen Namen tragen. Und das alles möchte ich am liebsten mit dir.»
Christa schluckte, legte das Brot aus der Hand, räusperte sich. «Das alles möchte ich auch. Das weißt du. Aber … Aber es geht nicht.»
Jagos Züge wurden hart, seine Miene verdunkelte sich. «Du musst eine Entscheidung treffen, Christa. Ich kann nicht mehr länger so leben. Und ich will es auch nicht.» Er legte die Serviette neben den Teller und erhob sich. «Es tut mir leid. Ich wollte dir den heutigen Abend nicht verderben, aber es geht nicht anders. Am Samstag wird meine Mutter fünfzig. Sie hat dich eingeladen, mit uns zu feiern. Ich wünsche mir, dass du kommst, aber … Ich fahre jetzt, muss erst einmal ein wenig allein sein.»
Er zog aus der hinteren Hosentasche eine Einladung auf Büttenpapier und mit geprägter Schrift und legte sie auf den Tisch. Dann küsste er Christa aufs Haar, seufzte tief und ging davon. Und Christa schlug beide Hände vor das Gesicht und begann zu weinen. Sie schluchzte, dass ihre Schultern bebten. Sie fühlte sich, als hätte ihr jemand einen Arm oder ein Bein ausgerissen. Doch solange sie auch weinte, der Schmerz wurde nicht erträglicher.
Später lag sie im Bett, die Arme unter dem Kopf verschränkt. Sie dachte an Werner, der in Basel sicher neben Martin lag, während sie allein schlafen musste.
War Werner in Frankfurt, so übernachtete er in der kleinen Kammer. Das Schlafzimmer gehörte Christa.
Sie dachte daran, was sie alles auf sich genommen hatte, um Werner und Martin zu helfen. Aber es gelang ihr nicht, ihre eigenen Wünsche in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu stellen. Frauen sollten gehorchen und dienen. So war ihre Großmutter aufgewachsen. Und ihre Mutter hatte vielleicht nicht mehr gedient, aber sie hatte die Familie umsorgt, sich selbst stets das kleinste Stück Fleisch auf den Teller gelegt, dem Vater in allem zugestimmt, hatte getan, was er verlangte. Selbst jetzt, da er für tot erklärt worden war, überzog die Mutter jedes Mal beide Betten. Aber Christa war anders, war anders gewesen. Sie hatte studieren wollen, wollte sich nicht vorschreiben lassen, wie sie leben sollte. Sie wollte ein eigenständiges, eigenverantwortliches Leben führen. Ein Leben, wie sie es sich wünschte. Früher hatte sie genau gewusst, was sie wollte, doch so war es nicht mehr. Sie hatte Heinz gehabt und hatte Werner … Wo aber blieb sie? Sie hatte sich immer neben dem Studium eine eigene Familie gewünscht, einen Ehemann, der nur ihr gehört, und natürlich Kinder.
Am Samstag schien die Sonne. Weiße Federwölkchen spielten wie übermütige Lämmchen am Himmel. Im Haus gegenüber standen alle Fenster offen. Bettdecken und Kissen waren zum Lüften ausgelegt, der Duft nach frisch gebackenem Kuchen zog durch die Luft. Wäsche flatterte an einer Leine, ein Kind flitzte auf einem Holzroller die Straße hinab. Frauen mit Einkaufskörben kamen vom Markt, blieben stehen, wenn sie eine Bekannte trafen. Dann stellten sie die Körbe ab, verschränkten die Arme vor der Brust und tauschten Neuigkeiten aus. Ein Mann polierte sein Auto, ein anderer pumpte ein Fahrrad auf. Ein typischer Samstag in der Berger Straße.
Gertie war heute in der Buchhandlung, und Christa hatte den Vormittag für sich. Sie räumte die Wohnung auf, wischte die Küche, bohnerte die Dielen im Flur. Dann begab auch sie sich zum Markt, kaufte die Kräuter für die berühmte Frankfurter grüne Soße ein, dazu ein paar Erdbeeren, frische Eier und ein halbes Brot und brachte die Einkäufe in die Wohnung ihrer Mutter, die unter ihrer lag. War Werner nicht da, kochte Helene für sie beide das Mittagessen. Auch die Abende verbrachten sie oft gemeinsam. Meist saßen sie vor dem Radio und hörten sich ein Hörspiel an, oft las Christa auch Bücher, die sie für ihre Dissertation brauchte, während Helene strickte. Manchmal traf sie sich auch mit ihrer Freundin Gunda. Letzte Woche waren sie zusammen im Turmpalast-Kino gewesen und hatten sich Casablanca angesehen. Ingrid Bergman stand in diesem Film zwischen zwei Männern. Und entschied sich für den, der sie am meisten brauchte, dachte Christa. Jago brauchte sie nicht. Er liebte sie, aber er brauchte sie nicht. Er hatte seine Gedichte, lebte gut dort, wo er lebte. Werner dagegen brauchte sie. Sie war sein Zuhause.
Nach dem Mittagessen wusch Christa das Geschirr ab und ging nach oben in ihre eigene Wohnung. Sie zog sich ein helles Sommerkleid an, Pumps mit spitzen Absätzen, dazu ein Bolerojäckchen. Sie trug Lippenstift auf, wischte ihn wieder ab. Sie wollte einen guten Eindruck machen bei Jagos Eltern. Besonders seiner Mutter wollte sie gefallen. Deshalb tupfte sie sich nun nur ein wenig Lippenrot auf den Mund. Sie hatte in der Buchhandlung eine wunderbare Schmuckausgabe von Goethes Gedichten ausgesucht und das Buch liebevoll eingepackt. Doch jetzt klopfte ihr Herz rasch und hart in ihrer Brust, wenn sie an den Freiherrn von Prinz dachte. Obschon sie diesen Mann noch nie gesehen hatte, hatte sie doch ein wenig Furcht vor ihm. Er war einmal am Telefon so barsch zu ihr gewesen, dabei wusste er wahrscheinlich nicht einmal das Schlimmste über sie, nämlich dass sie verheiratet war.
Sie seufzte, nahm den Wiesenblumenstrauß aus dem Wasser, umwickelte die Stiele mit Zeitungspapier, dann setzte sie sich in ihren VW Käfer und fuhr nach Kronberg.
Als sie vor dem Haus – nein, der Villa, oder war es sogar ein Schlösschen? – hielt, bekam sie stärkeres Herzklopfen. Zur Villa hinauf führte eine Auffahrt, die an einem Rondell endete, das mit den schönsten Frühlingsblumen bestückt war. Die Villa selbst hatte zwei Flügel. Der weiße Putz leuchtete in der Sonne, die Eingangstür und die Fensterrahmen waren aus dunklem Holz. Zaghaft stieg Christa die drei Stufen hoch und betätigte einen altmodischen Messingklopfer in Form einer Schlange. Es dauerte nicht lange, da stand ein Hausmädchen im schwarzen Kleid und mit weißer Schürze vor ihr.
«Oh, Sie müssen Frau Hauff sein. Bitte treten Sie ein. Die Herrschaften sind im Garten.»
Christa wusste nicht, ob sie die Blumen und die Goethe-Schmuckausgabe dem Hausmädchen oder der Jubilarin übergeben sollte. Schließlich legte sie ihre Geschenke auf einen Tisch in der großen Halle, auf dem bereits andere Geschenke lagen, und hoffte, dass das Hausmädchen die Blumen in eine Vase stellen würde.
«Bitte gehen Sie durch die Halle in den Garten hinaus.» Das Dienstmädchen nahm Christa die Jacke ab und verschwand.
Christa blieb noch einen Augenblick stehen und sah sich um. Rechts und links führten geschwungene Treppen in die oberen Geschosse. An den holzgetäfelten Wänden hingen keine Porträts der Ahnen, sondern Porträts von Windhunden. Sie wünschte sich, Jago käme herein und würde sie holen. Dann atmete sie tief durch und ging in den Garten. Doch was sie fand, ähnelte mehr einem Park als einem Garten, wie sie ihn kannte. In der Mitte des Rasens war ein weißes Zelt aufgebaut. Davor befanden sich bestimmt ein Dutzend Stehtische, die in weiße Tücher gehüllt waren. Eine Kapelle spielte, die Luft war vom Lachen der Gäste und von den aufgelegten Düften erfüllt. Christa hielt nach Jago Ausschau, aber sie fand ihn nicht. Eine junge Frau kam auf sie zu und streckte ihr die Hand hin.
«Guten Tag, sind Sie Frau Hauff? Ich bin Patricia von Prinz, Jagos Cousine. Herzlich willkommen. Wie schön, Sie kennenzulernen.»
Christa drückte die gereichte Hand. «Danke schön. Auch ich freue mich, hier zu sein.»
«Jago hat mir oft von Ihnen erzählt. Sie führen eine Buchhandlung, nicht wahr?»
«Ja, das ist richtig.»
«Dann verstehen Sie sicher auch, was er so schreibt. Dann hat er in Ihnen jemanden, mit dem er sich über Literatur unterhalten kann.»
«Ich gebe mir Mühe. Seine Gedichte sind großartig. Wir verkaufen sie gut und sehr gern. Er hat sich bereits ein Publikum geschaffen.»
Patricia lächelte. «Ich habe sie auch gelesen. Doch wahrscheinlich sind seine Mutter und ich die Einzigen hier, die das getan haben.»
Als Christa das hörte, stieg Traurigkeit in ihr auf. In ihrer Familie hatten alle Jagos Buch gelesen und darüber diskutiert: Martin, Werner, Helene und sogar Heinz. Auch Gunda und Gertie waren begeistert.
«Soll ich Sie mit der Familie und den anderen Gästen bekannt machen?»
Befangen nickte Christa, dann wurde sie von Patricia eingehakt und hinein ins Festgetümmel gezogen.
«Wo ist Jago?» Christa blickte sich suchend um.
Patricia zuckte mit den Schultern. «Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ihn schon seit ein paar Stunden nicht mehr gesehen. Ich schlage vor, dass wir zuerst die Jubilarin begrüßen.»
Sie steuerte mit Christa auf eine große schlanke Frau zu, die unbedingt Ähnlichkeit mit Jago hatte. Sie trug ihr schwarzes, leicht gewelltes Haar bis zu den Schultern. Ihr Kostüm ähnelte den Kreationen von Chanel, die Christa in der Zeitschrift Constanze gesehen hatte. Frau von Prinz war dezent geschminkt und strahlte die Sicherheit aus, die ein großes Vermögen mit sich bringt. Sie wirkte wie die Damen des Frankfurter Hochstiftes, deren Engagement für Kunst und Kultur bekannt war.
Christa reckte die Schultern, dann reichte sie der Freifrau die Hand. «Guten Tag. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu Ihrem Geburtstag. Das … Das Geschenk habe ich auf einen Tisch in der Halle gelegt.» Christa spürte, wie sie bei diesen Worten errötete. Natürlich wusste die Frau des Hauses, wo sich der Geschenketisch befand. Bestimmt war es ein unmögliches Benehmen, das eigene Geschenk bei der Gratulation zu erwähnen. Verdammt, wo war nur Jago? Er konnte sie doch nicht hier allein lassen.
«Es freut mich sehr, liebe Christa – so darf ich Sie doch nennen? –, dass wir uns endlich einmal kennenlernen. Mein Sohn spricht oft von Ihnen. Sie waren ihm damals nach dem Krieg eine große Hilfe.»
«Das habe ich sehr gern getan», erwiderte Christa, für mehr Worte blieb keine Zeit, schon drängten sie die nächsten Gratulanten zur Seite.
«Jetzt zum Herrn des Hauses», bestimmte Patricia und nahm erneut Christas Arm.
Diese blieb stehen. «Sollen wir wirklich? Ich glaube, ihm liegt nichts an meiner Bekanntschaft.»
Jagos Cousine lachte auf. «Oh, da täuschen Sie sich. Ganz im Gegenteil. Er ist regelrecht erpicht darauf, Sie zu treffen.»
Ungläubig hob Christa die Augenbrauen. «Wieso das denn?»
«Er möchte die Frau kennenlernen, wegen der sein Sohn nicht mehr mit ihm spricht. Gideon von Prinz hat nämlich bereits eine Braut für Jago ausgewählt.»
«Oh!» war alles, was Christa zu sagen wusste. Sie blieb stehen, betrachtete den Freiherrn, auf den Patricia sie wortlos aufmerksam gemacht hatte, aus einiger Entfernung. Er war ein großer Mann mit dichtem dunklem Haar. Seine Schultern waren breit, und die Jacke seines Anzugs spannte über dem beeindruckenden Bauch. Er hielt in der einen Hand ein Glas Rotwein, in der anderen Hand eine Zigarre. Sein Lachen dröhnte durch den ganzen Garten.
«Wollen wir?» Patricia drängte Christa sanft vorwärts.
Schließlich stand sie vor dem Freiherrn, der sie gar nicht beachtete. Patricia räusperte sich, doch Herr von Prinz tat, als hätte er nichts gehört. Schließlich zupfte Patricia den Mann am Ärmel. «Onkel Gideon, ich möchte dir Christa Hauff vorstellen.»
Der Freiherr fuhr herum, betrachtete Christa von oben bis unten. Dann wandte er sich wieder ab, ohne ein Wort an Christa gerichtet zu haben.
Sie spürte Ärger in sich hochsteigen. Ärger und Scham. Gideon von Prinz hatte sie gemustert, als wäre sie ein Pferd bei einer Auktion. Und er hatte es nicht für nötig gehalten, ihr auch nur einen Gruß zu entbieten. Christa drehte sich um und begab sich in Richtung Terrassentür, die zurück in die Halle führte.
«Warten Sie, wo wollen Sie hin?» Patricia eilte ihr nach.
«Nach Hause. Ich denke nicht, dass mich hier jemand vermissen wird.»
«Oh doch. Sie haben nämlich die Patriarchin noch nicht kennengelernt. Und das müssen Sie unbedingt noch.»
Christa hatte keine Lust, sich noch mehr demütigen zu lassen, aber sie wollte auch um keinen Preis unhöflich sein. «Also gut. Wo finden wir sie?»
Patricia deutete auf ein kleines weiß gestrichenes Teehaus, das ein Stück abseits lag. «Das ist Omas Refugium. Sie erwartet Sie schon.»
«Warum?»
Patricia ignorierte Christas Frage. Sie schob sie einfach vorwärts, und plötzlich stand Christa der Frau gegenüber. Sie saß in einem Rollstuhl, eine Decke verbarg die Beine. Auch sie wirkte groß und schlank. Das eisgraue Haar trug sie in einem festen Knoten am Hinterkopf. Ihre Augen waren von einem kühlen, intensiven Blau und schienen durch Christa hindurchzublicken. Auf einem weiß gestrichenen Holztisch neben ihr standen eine Teekanne, dazu ein Sahnekännchen, eine silberne Zuckerdose und ein Gedeck.
«Guten Tag, Frau von Prinz. Ich freue mich, Sie kennenzulernen», brachte Christa höflich hervor.
Patricia hatte ihrer Großmutter die Wange geküsst, Christa kurz vorgestellt und sich dann zurückgezogen.
«Guten Tag, mein Kind. Kommen Sie ruhig ein wenig näher. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren.» Die Stimme der Patriarchin klang freundlich, ihre Augen waren voller Güte. «Es ist nicht einfach, in diese Familie einzutreten», fuhr sie fort. «Mein Sohn ist ein grober Klotz ohne Manieren und Anstand. Weiß Gott, was die Kindermädchen bei seiner Erziehung falsch gemacht haben. Meine Schwiegertochter ist klug, aber feige. Sie kennt ihren Gideon sehr gut, aber sie lässt ihn machen, damit sie ihre Ruhe hat.» Die alte Dame lachte, und Christa lächelte ebenfalls, obschon sie über ihre Unverblümtheit verwundert war.
«Und Jago?»
«Jago. Ja.» Freifrau von Prinz nickte. «Jago ist ein Träumer. Er kommt ganz nach meinem Mann, seinem Großvater. Der hat zwar keine Gedichte geschrieben, dafür aber Schubert-Lieder gesungen. Es gab keine Premiere in Frankfurt, bei der er nicht zugegen war.»
«Lieben Sie die Kunst denn nicht?», wollte Christa wissen. Sie hatte ihre Schüchternheit verloren und saß Jagos Großmutter, auf deren Einladung hin, gegenüber.
«Die Kunst. Davon kann keiner leben. Sie mag schön sein, aber wenn ich allein an die heutige Malerei denke! Ich möchte Bilder sehen, auf denen ich erkennen kann, was sie darstellen sollen. Ich mag Musik mit einer Melodie und Gedichte, die sich reimen.»
«Die Kunst reagiert auf die gesellschaftlichen Zustände», wandte Christa ein. «In der Literatur zum Beispiel ist der Krieg ein wichtiges Thema. Erlebnisse werden in Büchern verarbeitet. Ich glaube, dass uns die Kunst dabei hilft, das Leben zu meistern.»
«Ja, das habe ich auch einmal geglaubt. Heute weiß ich, es ist das Geld, das dabei hilft, das Leben zu meistern.» Die alte Dame lächelte ihr zu. «Wie lange kennen Sie meinen Enkel schon?»
«Wir haben uns kurz nach dem Krieg kennengelernt. Er lebte in einer Ruine gegenüber meiner Buchhandlung. Ich mag seine Gedichte sehr.»
«Das ist gut, mein Kind. Denn Sie müssen an ihn glauben.» Sie machte eine allumfassende Handbewegung. «Hier ist Jago recht einsam mit seinen Gedichten. Hier zählen andere Werte. Und jetzt möchte ich zurück in mein Zimmer.» Die Freifrau winkte einer jungen Frau in Schwesterntracht, die Christa noch gar nicht bemerkt hatte.
«Auf Wiedersehen, mein Kind. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Sie sind mir willkommen. Im Haus und in der Familie.»
Christa nickte ihr zu, ein freudiges Zucken im Herzen. Sie mochte die alte Dame auf Anhieb. «Ich danke Ihnen sehr, Frau von Prinz. Aber können Sie mir auch sagen, wo Jago ist?»
Die Patriarchin lächelte. «Er ist da. Er kommt zu Ihnen.» Sie reichte Christa die Hand und wurde sogleich von der Pflegerin davongefahren.
Und plötzlich war Jago da, stand vor ihr, legte die Arme um sie, zog sie an sich.
«Wo warst du?», fragte Christa. «Warum hast du dich versteckt?»
«Ich habe mich nicht versteckt. Ich war hier. Die ganze Zeit. Ich hatte Patricia gebeten, dich ein wenig herumzuführen.»
«Warum hast du es nicht selbst gemacht?»
Jagos Lächeln wurde schief. «Weil ich die meisten Gäste einfach nicht ertragen kann. Und jetzt komm. Lass uns gehen.»
«Schon? Wäre das nicht unhöflich deiner Mutter gegenüber?»
«Wir haben ihre Erlaubnis. Ich lade dich zum Essen ein. Hier in der Nähe gibt es ein gutes Restaurant.»
Er nahm ihre Hand und zog sie zum Haus. Als sie wieder in der großen Empfangshalle standen, blickte sich Christa suchend um. «Wo ist meine Jacke?»
«Wahrscheinlich hat das Dienstmädchen sie weggebracht. Warte kurz, ich werde mich darum kümmern.»
Jago verschwand in einem Zimmer, und im selben Augenblick kam das Dienstmädchen die Treppe herab.
«Suchen Sie etwas?»
«Meine Jacke.»
«Ich habe sie in die Garderobe gehängt. Folgen Sie mir bitte.»