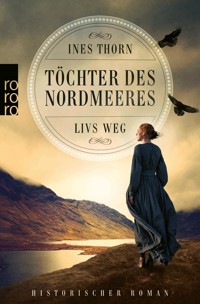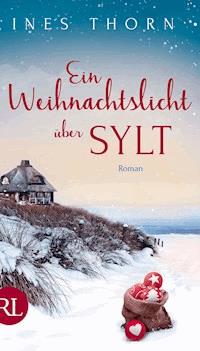9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Buchhändlerin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Bücher und Schicksale: Die Geschichte einer starken Frau, Liebe und Literatur in den 1940er Jahren. Frankfurt, kurz nach dem 2. Weltkrieg: Christa bricht enttäuscht ihr Germanistikstudium ab, weil sie als Frau an der Universität nicht für voll genommen wird. Zunächst aus Verlegenheit fängt sie an, in der Buchhandlung ihres Onkels auszuhelfen, die dieser nach der Enteignung durch die Nationalsozialisten nun wieder aufbaut. Bald schon wird das Bücherverkaufen für Christa zur Passion - und die Buchhandlung zu einem Ort, an dem sich Gleichgesinnte treffen, an dem Freundschaften entstehen und sogar Liebe. Doch noch sind die Wunden der Kriegszeit nicht verheilt, und Christa muss all ihre Klugheit und Tatkraft einsetzen, um die Buchhandlung und ihr eigenes Glück zu bewahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ines Thorn
Die Buchhändlerin
Roman
Über dieses Buch
Bücher und Schicksale: eine starke Frau, Liebe und Literatur in den Nachkriegsjahren.
Frankfurt, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Christa wehrt sich dagegen, den von ihrer Mutter für sie vorgesehenen Weg zu gehen: Bräuteschule, Hochzeit, Hausfrauendasein. Sie träumt von mehr, möchte Literatur studieren. Doch das Germanistikstudium ist eine Enttäuschung, als Frau wird sie an der Universität nicht für voll genommen. Lieber arbeitet sie stattdessen an ihrem Lieblingsort: in der Buchhandlung ihres Onkels, nach der Enteignung durch die Nazis nun wieder in Familienhand. Das Bücherverkaufen wird Christa bald zur Passion – und die Buchhandlung zu einem Ort, an dem sich Gleichgesinnte treffen, an dem Freundschaften entstehen und sogar Liebe. Doch die Wunden der Kriegszeit sind noch lange nicht verheilt, und Christa muss all ihre Klugheit und Tatkraft einsetzen, um die Buchhandlung und ihr eigenes Glück zu bewahren.
Vita
Ines Thorn wurde 1964 in Leipzig geboren. Nach einer Lehre als Buchhändlerin studierte sie Germanistik, Slawistik und Kulturphilosophie. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main und schreibt seit langem erfolgreich historische Romane.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Heike Brillmann-Ede
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Richard Jenkins; Marga Schoeller Bücherstube
ISBN 978-3-644-00865-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Heinz
einander vergeben für alles
was wir nicht sind
und für alles andere:
einander trotzdem lieben.
Caroline Hartge
TEIL 1
Prolog
Frankfurt, 1941
Es klingelte Sturm. Christa stand von ihrem Schreibtisch auf, öffnete das Fenster und schaute auf die Berger Straße hinaus. Unten stand ihr Onkel Martin, winkte und rief zu ihr hoch: «Komm schnell runter, das musst du dir unbedingt angucken.» Christa sah von oben, dass ein Ehepaar vor dem Schaufenster der Buchhandlung Schwertfeger stehen geblieben war. Sie lachten. Der Mann klopfte Martin auf die Schulter, dann eilten sie weiter.
Frau Lehmann von der Metzgerei Lehmann schräg gegenüber drohte Martin spielerisch mit dem Finger. Aber auch sie tat es lachend. Der Pfarrer der St.-Josefs-Gemeinde fuhr mit wehender Soutane auf dem Fahrrad vorbei und rief fröhlich: «Am Ende sind Sie doch ein gottgefälliger Mann, lieber Herr Schwertfeger.»
Martin war der jüngere Bruder ihres Vaters, gerade einunddreißig Jahre alt. Er war nach dem Abitur direkt an die theologisch-philosophische Ordenshochschule der Jesuiten in Frankfurt-Oberrad gegangen. Nicht nur, um dort zu studieren, sondern um ein Ordensmann, ein Mönch, zu werden. Christa hatte das nie verstanden. Natürlich gingen sie an Weihnachten und an Ostern in die Kirche, aber sie konnte sich nicht erinnern, dass in ihrer Familie jemals über Gott gesprochen worden war. Auch Martin hatte offenbar eingesehen, dass er nicht ins Kloster gehörte. Kurz vor den ewigen Gelübden hatte er Orden und Hochschule verlassen und führte seither die Buchhandlung Schwertfeger, schon in der dritten Generation.
In der Wohnung über dem Laden lebten mittlerweile der Onkel, die Mutter und sie. Früher hatte Christa mit ihren Eltern über dem Onkel gewohnt, doch jetzt war Krieg, und das hieß, dass sie alle ein wenig zusammenrücken mussten. In ihrer ehemaligen Wohnung im zweiten Stock lebten zwei ausgebombte Familien, und Mutter und sie waren hinunter zu Martin in den ersten Stock gezogen. Der Vater war gleich zu Beginn des Krieges eingezogen worden. Er war Fernmeldetechniker und an der Front dienlicher als zu Hause.
«Was hast du gemacht?», rief Christa.
Martin breitete die Arme aus und lachte mit blitzweißen Zähnen. «Komm runter!»
Christa warf das Fenster zu und eilte die Treppe hinab. Vor dem Schaufenster der Buchhandlung blieb sie stehen und riss die Augen auf. Martin hatte das gesamte Schaufenster mit der Neuauflage des Südseeromans von Richard Katz drapiert. Heitere Tage mit braunen Menschen hieß er.
«Au weia. Wenn das mal keinen Ärger gibt», orakelte Christa, aber auch sie konnte ein Grinsen nicht unterdrücken.
In diesem Augenblick kam Herr Klein aus dem Haus. Er war der Blockwart, und man sah ihn nie ohne seine SA-Uniform. Er war so klein wie sein Name und seine Gedanken und irgendwie quadratisch. Hoch wie breit, sagte die Mutter dazu. Er trug einen Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart und blickte aus glänzenden Säuferaugen in die Welt.
«Was ist denn hier los?», fragte er misstrauisch, denn er war immer misstrauisch und gleich doppelt, wenn jemand lachte. Das deutsche Volk hatte nichts zu lachen, es sollte kämpfen zum Heile Hitlers.
«Ich habe mein Schaufenster neu dekoriert», erklärte Martin mit Unschuldsmiene. «Gefällt es Ihnen?»
Klein stellte sich breitbeinig davor und starrte auf den Roman. «Neu ist der nicht», erklärte er. «Meine Frau hat ihn schon vor Jahren gelesen.» Dann knallte er die Hacken zusammen, riss den Arm in die Höhe, brüllte «Heil Hitler!» und marschierte davon.
«Wie gut, dass der Klein so dumm ist», bemerkte Christa. Aber da hatte sie sich getäuscht.
Am Abend klingelte es bei Schwertfegers. Vor der Tür standen Herr und Frau Klein. Emma Klein mit Lockenwicklern, darüber ein Netz und vor dem Bauch eine Schürze, die mit Blumen bedruckt war. Horst Klein trug noch immer die SA-Uniform und dazu Filzpantoffeln.
«Was soll das da mit dem Schaufenster?», fragte die Klein säuerlich.
«Was soll damit sein?», fragte Martin freundlich zurück.
«Sie denken wohl, Sie können sich alles erlauben, was?» Emma Klein keifte jetzt.
«Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich habe neue Ware bekommen, und die stelle ich ins Schaufenster. Das mache ich immer so. Was daran ist bitte falsch?»
Die Klein hob den Finger und fuchtelte damit vor Martins Nase herum. «Verarschen lassen wir uns nicht. Das hat Konsequenzen. Das verspreche ich Ihnen. Nicht genug, dass Sie … dass Sie …» Sie brach ab.
«Was?», forschte Martin.
«Sie wissen schon, was ich meine. Eine Schande ist es, mit so einem in einem Haus zu leben.»
Da floh das Lächeln aus Martins Gesicht. Seine Schwägerin zupfte ihn am Ärmel. «Lass gut sein. Wir dekorieren einfach um.»
Aber Martin schüttelte Helenes Hand ab. «Nein, Lenchen. Das werden wir nicht.»
Emma Klein schnappte nach Luft, wollte etwas sagen, aber Martin unterbrach sie brüsk. «Sie können gern ausziehen, wenn es Ihnen hier nicht passt. Nein, Sie werden ausziehen. Das Haus gehört meinem Bruder und mir. Wir kündigen Ihnen. In einer Woche ist die Wohnung leer.»
«Ihr Bruder ist an der Front. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Komm, Horst.»
Martin schlug die Tür zu und hörte die Klein lauthals im Hausflur brüllen: «Warum sind Sie eigentlich nicht an der Front wie jeder andere anständige Mann auch?»
«Weil Bücher kriegswichtig sind», murmelte er vor sich hin.
Helenes Miene war ängstlich. «Oh Gott, Martin. Was hast du nur gemacht?»
Christa stand in der Wohnzimmertür. «Ich fand das gut. Denen hast du es endlich mal gezeigt.»
Martin war blass geworden. Er atmete einmal tief ein und aus. «Ich brauche jetzt einen Schnaps.» Er ging ins Wohnzimmer, goss für Helene und sich einen ordentlichen Schluck von dem wohlgehüteten Kirschwasser ein, trank ihn in einem Zug. Dann fragte er: «Habt ihr heute noch etwas vor?»
Die Glocke der nahen St.-Josefs-Kirche verkündete die achte Abendstunde.
«Was willst du machen?», wollte Helene wissen.
«Ich habe verbotene Bücher im Laden. Schriftsteller, deren Werke 1933 ins Feuer geworfen worden sind. Vicki Baum, Stefan Zweig, Heinrich Heine, Thomas Mann, Robert Musil.»
«Waaas?» In Helenes Gesicht stand die nackte Angst. «Hast du die etwa auch verkauft?»
«Ich kenne meine Kunden, weiß, wem ich trauen kann. Aber jetzt müssen sie weg.»
«Wohin?», wollte Christa wissen. «Wenn du sie verbrennst, kriegen das die Kleins sicher mit.»
Martin schüttelte den Kopf. «Niemals würde ich Bücher verbrennen. Ich mauere sie ein. Unten, im Keller. Ich habe mir das schon vor einer ganzen Weile überlegt. Falls mal was sein sollte. Nun, jetzt ist was.»
Er stand auf, nahm den Ladenschlüssel vom Brett neben der Tür, und wenig später packten Helene und Christa die verbotenen Werke in Kisten, und Martin schleppte sie in den Keller. Zwei Dutzend Kisten packten sie.
«Was für ein Glück, dass unser Keller nicht mehr feucht ist», sagte Christa, während sie den Roman Menschen im Hotel von Vicki Baum an ihre Brust drückte. Martin hatte ihr ein Exemplar zu ihrem vierzehnten Geburtstag geschenkt und dazu gesagt: «Dieser Roman ist ein wahrer Schatz. Schau dir nur an, wie die Figuren gezeichnet sind. In jeder Szene steckt ein ganzer Kosmos. Aber lies es nur hier zu Hause und sprich nicht darüber.»
«Ist sie dafür nicht noch viel zu jung?», hatte Helene eingewandt.
«Für gute Bücher ist man nie zu jung», hatte Martin erwidert. «Wenn sie etwas nicht versteht, kann sie ja fragen.»
Christa hatte es gelesen und verstanden, und seither war Vicki Baum ihre Lieblingsschriftstellerin. Behutsam legte sie das Buch zu den anderen, trug die Kiste in den Keller.
«Woher hast du die Ziegel?», fragte sie.
Martin grinste. «Die Lehmanns. Die haben eine Garage für ihr Auto im Hinterhof gebaut. Die hier waren übrig.»
Christa sah ihm zu, wie er die Kiste auf die anderen an der Wand stapelte, nach einem Ziegel griff und die erste Reihe auf den Boden legte.
Eine ohnmächtige Traurigkeit überkam sie. Da lagen all ihre Lieblinge. Stefan Zweigs Novelle Die unsichtbare Sammlung, Tucholskys Schloß Gripsholm, Der Untertan von Heinrich Mann, die Werke von Erich Maria Remarque und sogar die Traumdeutung von Sigmund Freud. Ihr war, als müsse sie sich von engen Freunden verabschieden. Von Menschen, die ihr viel bedeuteten. Sie war zwar erst vierzehn, aber ein Leben ohne Bücher, ohne Geschichten kannte sie nicht und wollte sie nicht kennen. Sie las, wo immer sie war. In der Schule heimlich unter der Bank, abends in ihrem Lieblingssessel vor dem Küchenfenster oder mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Manchmal kam ihr das Leben in den Büchern realer vor als die Wirklichkeit.
Ihre Mutter schimpfte oft, obschon sie ebenfalls gerne las. «Es ist nicht gut, in deinem Alter so viel zu lesen. Männer mögen keine gebildeten Frauen, die ihnen am Ende noch widersprechen.» Und doch hatte es etliche Abende gegeben, da hatten sie beide im Wohnzimmer gesessen und gelesen. Und ganz selten hatte die Mutter ihr sogar Gedichte vorgetragen. Und nun waren alle diese Bücher in Kisten verpackt und warteten darauf, hinter einer Mauer zu verschwinden.
«Was soll ich denn jetzt lesen?», fragte Christa leise. «Ohne Bücher fühle ich mich nackt.»
Martin sah auf. «Erinnere dich daran, was du gelesen hast und warum es dir so viel bedeutet. Denk über die Bücher nach. Lies die Klassiker: Goethe, Schiller, Hölderlin. Das ist die wahre Literatur.»
«‹Wahre Literatur›. Was ist das?» Christa hatte zu sich gesprochen, aber Martin legte den Ziegel aus der Hand und setzte sich auf eine der gepackten Kisten. «Du willst wissen, was das ist? Das ist nicht einfach zu erklären. Aber ich will es trotzdem versuchen. Wahre Literatur geht über den Zeitgeist, über die Moden hinaus. Noch hundert Jahre nachdem der Autor das Buch geschrieben hat, ist es aktuell. Die Gedanken im Werk sind neu, der Blickwinkel ist überraschend. Und natürlich ist die Sprache entscheidend. Keine Phrasen, höchstens als Stilmittel. Ungewohnte Metaphern. Bislang unbekannte Fragen werden aufgeworfen, das Denken angeregt. Goethe hat seinen Faust 1808 veröffentlicht. Das ist einhundertdreiunddreißig Jahre her. Doch die Fragen, die Goethe aufwirft, Fragen rund um Liebe, Wahrheit, Willensfreiheit, Verantwortung, Gut und Böse, die sind so aktuell, als wäre die Tragödie erst gestern geschrieben worden. Man muss die Klassiker lesen, um die Gegenwart zu verstehen.»
Er blickte auf die Wand, hinter der die Bücher verschwinden sollten, und seufzte. «Lass uns später noch einmal darüber sprechen. Jetzt müssen wir arbeiten.» Er erhob sich und strich Christa über die Schulter. «Außerdem haben wir ja noch Hermann Hesse. Der ist nicht verboten. Lies den Steppenwolf. Eigentlich wollte ich damit noch warten, bis du etwas älter bist. Aber ich suche ihn dir gleich im Laden raus.»
Als alle Kisten eingemauert waren, holte Christa Asche aus dem Küchenofen, kratzte mit einem Messer den Ruß aus dem Inneren des Ofens. Damit beschmierte sie die frisch gemauerte Wand, jetzt konnte niemand mehr erkennen, dass sie neu war. Zum Schluss schoben sie das Regal mit dem Werkzeug vor die Wand, stapelten kaputte Stühle davor und schoben ein Schränkchen daneben, auf das sie den alten Schlitten legten.
Dann verriegelten sie den Keller ordentlich und begaben sich zurück in den Laden, wo Helene dabei war, die Lücken in den Regalen zu schließen. Sie drängte darauf, das Schaufenster noch neu zu gestalten, aber Martin schüttelte den Kopf. «Reicht es nicht, dass meine liebsten Schriftsteller im Exil sind und ihre Bücher hinter einer Kellermauer? Noch mehr lasse ich mir nicht verbieten.»
Dann nahm er den Steppenwolf aus dem Regal und drückte ihn Christa in die Hand.
Einen Tag später erschien Herr Klein mit einem Mitarbeiter der Reichsschrifttumskammer, Herrn Süßmund, im Laden. Es war Sommer. Christa hatte Schulferien und half Martin – wie immer, wenn sie freie Zeit hatte – im Laden. Gerade war sie dabei gewesen, die Bücher aus den Regalen zu holen und abzustauben. Es waren die Blut-und-Boden-Bücher von Hans Friedrich Blunk, Hans Zöberlein, Josefa Behrens-Totenohl und Kuni Tremel-Eggert, die in riesigen Auflagen gedruckt und verbreitet wurden. Christa hatte einmal in ein Buch von Behrens-Totenohl geschaut und es mit Schaudern wieder zurückgestellt. Schwülstig war es, durchdrungen von Pathos und Kitsch.
«Bitte, was kann ich für die Herrschaften tun?» Martin war freundlich wie immer. «Gerade heute ist ein neues Werk für die Jugend von Baldur von Schirach eingetroffen. Ein passendes Geschenk für die werten Nachkommen.»
«Wir haben eine Meldung erhalten, dass Sie volksschädliches Schrifttum vertreiben», schnarrte Süßmund, und Herr Klein nickte dazu.
«Ich? Wie kommen Sie denn darauf? In meinem Laden habe ich bislang nur gute Literatur verkauft.»
Christa musste lächeln, als sie das hörte. Aber es war ein trauriges Lächeln.
«Und was ist mit dem Schaufenster?», mischte sich Herr Klein ein.
«Ja, was ist damit?» Martin blickte mit Unschuldsmiene zu den Heiteren Tagen unter braunen Menschen.
Süßmund verzog das Gesicht, wandte sich an Klein. «Mit dem Schaufenster ist alles in Ordnung. Da ist nichts, wo wir den drankriegen könnten. Obwohl ich weiß, welche Absicht er damit verfolgt.» Sein Gesicht nahm eine leicht rötliche Färbung an, als er plötzlich lauter wurde: «Und jetzt werde ich eine Überprüfung Ihres Ladens durchführen. Hier bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, wenn ich fertig bin. Das können Sie mir glauben.»
«Bitte sehr.» Martin stellte sich hinter den Verkaufstresen, verschränkte die Arme vor der Brust. «Aber gehen Sie vorsichtig mit den Büchern um. Sie sind immerhin wertvolles Kulturgut.»
Christa stellte sich neben ihren Onkel, konnte aber nicht verhindern, dass sie zitterte. Jeder zitterte vor der Reichsschrifttumskammer mit der gefürchteten «Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums», die täglich länger wurde. Hoffentlich haben wir alles Verdächtige weggeräumt, dachte sie und knetete ihre Hände.
Süßmund trat an das Regal, das Christa gerade gesäubert hatte, riss ein Buch nach dem anderen heraus und ließ es auf den Boden krachen. Die Behrens-Totenohl schlug auf und brach in der Mitte durch. Wolter von Plettenberg von Hans Dietrich Blunck, zehn Stück im Regal, fielen eines wie das andere, als wären sie an der Ostfront. Hjalmar Kutzlebs Der erste Deutsche wurde herausgezerrt und in den Laden geschleudert. Christa wunderte sich, dass Süßmund so brutal mit dem deutschen Schrifttum umging, das so hoch geschätzt wurde, doch dann sah sie sein Gesicht. Es war rot, an der Stirn klopfte eine blaue Ader, und Christa erkannte, dass der Mann hier eine Wut austobte, die unmöglich mit diesen Büchern zusammenhängen konnte, und diese Raserei machte ihr noch mehr Angst.
«Wenn Ihre Vorgesetzten von der Reichsschrifttumskammer sehen würden, wie Sie hier mit der Blut-und-Boden-Literatur verfahren, wären sie gewiss nicht begeistert», wandte Martin ein.
Da trat Süßmund ganz dicht an ihn heran, reckte das Kinn vor und zischte: «Ich habe schon ganz andere Kaliber als Sie zur Strecke gebracht. Ganz andere. Aber gestern meinte mein Vorgesetzter, dass ich zu lasch sei. Deswegen werde ich jetzt ein Exempel statuieren.»
Speicheltröpfchen trafen auf Martins Gesicht, aber er rührte sich nicht. Die beiden Männer sahen sich direkt in die Augen. Und auf einmal wischte eine flüchtige Erinnerung durch Martins Kopf. Er hatte diesen Mann schon einmal gesehen. Aber wo? Und wann?
Süßmund räusperte sich, zog sein Sakko zurecht, dann bückte er sich, kramte auch im untersten Regalfach. Und da wusste Martin, woher er ihn kannte. Aus dem Bethmann-Park am Ende der Straße. Plötzlich pfiff der Vertreter der Staatsmacht leise durch die Zähne. Er warf noch eine Reihe weiterer Werke auf den Boden, ging auf die Knie und angelte mit der rechten Hand hinter dem Regal herum. Dann zog er ein Buch heraus, las den Titel und ein Lächeln überzog sein Gesicht. «Wusste ich’s doch!», stellte er triumphierend fest und zeigte Herrn Klein das Fundstück. Der blickte darauf und nickte.
Christa beugte sich ein wenig nach vorn. Der Schreck fuhr ihr in die Glieder. Ihr wurde heiß und kalt zugleich. Süßmund hielt die Liebesgedichte von Bertolt Brecht in den Händen! Die waren mehr als verboten. So verboten, dass nicht einmal Christa sie lesen durfte.
«Dafür, mein Schatz, bist du wirklich noch zu jung», hatte Martin gesagt.
Aber einmal, als ihr Onkel nicht im Laden war, da hatte sie doch in das Buch geschaut. Heiß war ihr geworden, fiebrig fast. Sie hatte die Worte nicht verstanden, nicht richtig. Sie hatte nur verstanden, dass es um Dinge ging, die ebenso so heiß und fiebrig waren wie ihre Haut. Schnell hatte sie den Lyrikband zurückgestellt, aber immer hatte sie geschaut, ob er noch da war. Eines Tages war das Buch weg, und sie hatte ihren Onkel danach gefragt. «Es ist verkauft. Ich habe es gleich noch einmal bestellt», hatte er gesagt, als ob es sich um eine ganz normale Lektüre handeln würde. Ein paar Wochen später war der Band wieder da, jemand hatte ein paar Exemplare aus der Schweiz mitgebracht. Und gestern Nacht war ihr ein Buch hinter das Regal gerutscht. Sie hatte es noch holen wollen, aber dann hatte die Mutter etwas gefragt, und das Buch war vergessen. Und jetzt hielt es der Klein in der Hand, blätterte durch die Seiten und schmatzte dabei. Es war widerlich.
Christa blickte zu Martin. Der war blass geworden und schluckte.
Süßmund riss dem Blockwart das Corpus Delicti aus der Hand und hielt es dem Onkel vor die Nase. «Was ist das?», fragte er.
«Die Liebesgedichte von Brecht», erwiderte Martin, aber auch seine Stimme klang blass.
«Schund ist das. Dreck. Kommunistendreck. Verderbt bis ins Mark», schrie Süßmund, warf den Brecht zu Boden und trampelte auf ihm herum. «Jeder Volksgenosse, der das Machwerk auch nur ansieht, ist vor Entsetzen stumm. Ganz zu schweigen von unseren rechtschaffenen Volksgenossinnen und Müttern. Ekelhaft. EKELHAFT!»
Es dauerte eine ganze Weile, bis er sich halbwegs beruhigt hatte. Er steckte die Gedichte mit spitzen Fingern in seine braune Lederaktentasche. «Sie hören von mir!», erklärte er bissig.
Und Klein fügte hämisch hinzu: «Damit kommen Sie nicht davon. Ich werde Ihren Laden dichtmachen. Verriegeln und verrammeln werde ich ihn. Sie sind die längste Zeit Buchhändler gewesen.»
Süßmund stürzte hinaus und Klein hinterher.
Christa begann zu weinen. «Ich war das», schluchzte sie. «Mir ist das Buch hinters Regal gefallen. Oh mein Gott!!» Sie schlug die Hände vor das Gesicht, ließ sich auf einen Stuhl sinken und weinte gotterbärmlich.
Martin kam zu ihr, strich ihr über die zuckenden Schultern. «Es ist nicht deine Schuld, Kleine», sagte er leise. «Du warst es nicht, die den Titel in den Laden gebracht hat. Mach dir keine Sorgen.»
Drei Tage später wurde Martin Schwertfeger von der Gestapo abgeholt und angeklagt wegen Volksverhetzung, Verbreitung von schädlichem Schrifttum und undeutscher Gesinnung. Die Kleins wurden als Zeugen vorgeladen. Frau Klein, frisch vom Friseur und im Sonntagskleid, sagte aus, dass Martin sogar den Führer und seine hohen Mitstreiter verhöhnt haben soll: «‹Adolf Hitler denkt für uns, Goebbels redet für uns, Göring frisst für uns, nur sterben tut keiner für uns.› Das hat er in der Buchhandlung gesagt. Das habe ich mit eigenen Ohren gehört, weil ich gerade den Hausflur gewischt habe und die Hintertür zur Buchhandlung, die vom Hausflur abgeht, offen stand.»
Martin wurde zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt.
Einmal durfte Helene ihn besuchen. Fünfzig Reichsmark sollte sie mitbringen, um den Transport ihres Schwagers in einem Viehwaggon nach Buchenwald zu bezahlen. Sie sah ihn nur kurz und war erschrocken über sein Aussehen. Das Haar stand ihm wirr vom Kopf ab, seine Lippen waren geschwollen und aufgesprungen.
«Sag Christa, dass es nicht ihre Schuld ist», beschwor Martin die Schwägerin. «Sag es ihr immer wieder. Und sag ihr, dass ich sie liebe.»
Dann war er fort, und kein Brief, keine Nachricht kam je aus Buchenwald.
Einmal ging Helene mit Christa zusammen zur Gestapo. «Wissen möchten wir, wie es Martin Schwertfeger geht. Seit zwei Jahren haben wir nichts mehr von ihm gehört. Wir können ihm nicht schreiben, ihm keine Pakete schicken.»
Der Gestapomann hatte sie verächtlich angeschaut. «Hauen Sie ab!», zischte er. «Schämen sollten Sie sich, so einen in der Verwandtschaft zu haben.» Dann wedelte er angeekelt mit der Hand, und Helene wusste, dass es keinen Zweck hatte, noch einmal wiederzukommen.
Christa aber konnte sich nicht beruhigen. «Ich war es», sagte sie immer wieder. «Ich habe meinen Onkel ins KZ gebracht.»
«Es ist nicht deine Schuld», wiederholte ihre Mutter immer wieder, aber Christa glaubte ihr nicht.
Früher war sie fröhlich gewesen, jetzt ging sie beinahe verbissen zu den Treffen des Bundes Deutscher Mädel. Sie tat es für Martin. Sie riss den Arm zum Hitlergruß nach oben, wann immer sie jemanden der Familie Klein traf. Ich darf nicht auffallen, dachte die Sechzehnjährige. Wenn alle Leute sehen, dass wir dem Führer treu ergeben sind, dann kommt Martin vielleicht frei. Sie strickte Strümpfe und Pulswärmer für die Männer an der Front und schrieb ihnen Briefe. So wie die meisten Mädchen ihres Alters. Briefe an fremde junge Männer, damit die wussten, dass es in der Heimat jemanden gab, der an sie dachte, damit sie wussten, wofür sie kämpften. Ihr Briefpartner war Klaus Lehmann, der Erbe der Metzgerei von gegenüber.
Und abends las sie Narziß und Goldmund von Hermann Hesse, weil es darin auch um Schuld ging.
Kapitel 1
Der Tag, an dem die Amerikaner nach Frankfurt kamen, war ein Mittwoch, der 28. März 1945. Frau Klein passte das gar nicht, sie wollte die große Wäsche machen. Der Kessel im Waschhaus war schon angeheizt, die Bettwäsche abgezogen, die Tischtücher waren eingeweicht. Gerade eben wollte sie nur kurz nach oben in ihre Wohnung, um das Stück Gallseife zu holen, das man ja in diesen Zeiten nicht einfach in der Waschküche liegenlassen konnte.
An der Haustür traf sie auf Helene und Christa, die den Flur schrubbten. «Jetzt lassen Sie mich mal rasch durch, ich hab große Wäsche», drängelte sie und latschte den sauberen Boden wieder dreckig.
«Ich möchte wissen, woher Sie das Holz dafür haben», sagte Christa. «In der Nachbarstraße ist letzten Monat ein Säugling in seinem Bettchen erfroren.»
Ihr Ton war nicht gerade freundlich. Das war er nie, wenn sie mit Frau Klein sprach, denn sie hasste die Familie Klein und hatte dafür auch einen triftigen Grund. Sie waren Denunzianten. Schlechte Menschen, bei denen man nie wusste, was sie gerade im Schilde führten. Wie oft hatte sie sich gewünscht, die Kleins wären ausgezogen damals, vor vier Jahren, als der Onkel ihnen die Wohnung gekündigt hatte. Aber nach Martins Verhaftung wagte die Mutter nicht, die Kündigung durchzusetzen.
«Ach, wissen Sie, mein Mann als Blockwart hat da seine Kontakte», erklärte Frau Klein stolz. Sie war groß und hager und trug das Haar in ondulierten Wellen, als läge die Stadt nicht in Trümmern, als gäbe es noch an jeder Ecke einen Friseursalon.
«Na, Blockwart wird er die längste Zeit gewesen sein, der Herr Klein. Die Amerikaner sind schon über die Wilhelmsbrücke.» Christa kassierte für diesen Satz einen Rippenstoß ihrer Mutter.
Frau Klein pustete sich eine Haarsträhne aus der Stirn, die mitnichten verrutscht war. «Wir standen immer auf der richtigen Seite. Mein Mann hat viel Gutes getan in seiner Position. Gerade für Ihre Familie. Ohne ihn hätten sie den Martin schon viel früher abgeholt. Wenn mein Mann angegeben hätte, dass er nicht nur verbotene Bücher verkauft hat, sondern obendrein ein Hundertfünf…» Emma Klein beendete den Satz nicht, aber ihre Blicke waren vielsagend. «Außerdem hat er im Radio Feindsender gehört. Davon habe ich bei Gericht nichts erzählt.»
Christa biss die Zähne aufeinander. Am liebsten hätte sie Frau Klein mitten ins Gesicht gesagt, was sie von ihr hielt, doch in diesem Augenblick knallte etwas vor der Haustür aufs Pflaster. Ein dumpfer Knall, der nichts Gutes verhieß, und danach herrschte schreckliche Stille. Für einen Augenblick hörten die Vögel auf zu singen, verdunkelte sich die Sonne. Dann schrie draußen eine Frau auf, und Christa und ihre Mutter stürzten hinaus. Vor ihnen auf dem Bürgersteig lag der Blockwart Horst Klein mit aufgeplatztem Schädel, aber in untadeliger SA-Uniform und mit gewichsten Stiefeln.
Christa schluckte. Sie bückte sich, fühlte nach dem Puls des Mannes, dann schüttelte sie den Kopf. «Er ist tot. Er muss aus dem Fenster gesprungen sein.»
Da schrie Frau Klein, presste beide Hände vor den Mund und starrte auf den Toten, als könnte sie ihn kraft ihrer Blicke wiederbeleben.
Helene legte den Arm um Frau Klein. «Kommen Sie weg von hier. Meine Tochter wird sich kümmern.»
Doch Frau Klein stand steif und starrte nach oben. Vor dem Fenster ihrer Wohnung hing eine weiße Fahne. Wie an fast jedem Haus in der Berger Straße. Das Fenster stand offen, ein Stück von der Gardine wehte im Wind.
«Was ist los?», rief Frau Lehmann von gegenüber. Sie hatte sich eine weiße Binde um den Arm gewickelt als Zeichen für die amerikanischen G.I.s.
«Herr Klein hat Selbstmord begangen», antwortete Christa.
«Ach so.» Frau Lehmann kehrte in ihre Metzgerei zurück.
Emma Klein brach in Tränen aus, machte Anstalten, sich auf ihren toten Mann zu stürzen, aber Helene hielt sie fest, führte sie zurück ins Haus und die Treppe hinauf.
Marlies Bielich, Christas Freundin von nebenan, stand inmitten einer kleinen Menschentraube, die ohne große Rührung auf den Blockwart starrte. Dann spuckte sie dem Toten ins Gesicht.
«Lass gut sein, Marlies», sagte Christa. «Er kriegt es ja nicht mehr mit.»
«Er hat es verdient. Wenigstens war er so höflich, sich selbst umzubringen. Musste sich keiner an ihm die Hände schmutzig machen.» Marlies atmete tief ein und aus, dann lächelte sie: «Sehen wir uns heute Abend? Ich muss dir etwas zeigen.»
Die kleine Gruppe löste sich auf. Tote gab es wie Sand am Meer in dieser Zeit, da zählte ein selbstmörderischer Blockwart nicht viel.
Christa zögerte, dann aber packte sie den toten Mann bei den Armen und zog ihn von der Mitte des Bürgersteigs zur Hauswand, damit die Leute vorbeigehen konnten. Noch einen letzten Blick warf sie auf den Mann, der ihnen das Leben so schwer gemacht hatte. Mitleid empfand sie nicht.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite blieb ein Ehepaar vor der Ruine eines Hauses stehen, das von Brandbomben getroffen worden war. Es war das Haus neben der Metzgerei Lehmann. Christa erinnerte sich noch genau an den 18. März 1944, als Frankfurt von Bomben zerstört wurde. Der Römer stand in hellen Flammen, die gesamte Altstadt war zerstört wurden. Leichen und Leichenteile lagen auf den Straßen, Christa hatte das Gefühl gehabt, Asche im Mund zu schmecken. Asche, Staub und diesen Geruch der Toten in der Nase. Es war später Abend gewesen, als die Bomber, vom Taunus kommend, auf die Stadt zuflogen. Eine Stunde später lag der Osten Frankfurts in Schutt und Scherben. Das Hospital zum Heiligen Geist, der Dom, von der Alten Brücke bis hin zur Konstablerwache stand kein Stein mehr auf dem anderen. Auch in der Berger Straße lagen Häuser in Schutt und Asche. Christa erinnerte sich noch genau an den Geruch der nächsten Tage. Rauch in den Kleidern und im Haar, dazu die Leichen. Über vierhundert Opfer hatte es gegeben, und noch immer sah Christa um sich herum die Verwüstungen dieser Nacht. Über der Metzgerei Lehmann befand sich nur noch ein Stockwerk, darüber der Himmel. Das Nebenhaus war bis auf den Keller zerbombt, das Lokal Schützenhof weiter vorn stand einsam und mahnend zwischen Ruinen. Sie hatten im Keller gehockt. Die Kleins, die beiden einquartierten Familien, der Studienrat Grau, die Mutter und sie. Sie hatten es donnern hören, hatten den Rauch gerochen. Christa hatte sich an ihre Mutter geklammert. So ist es also, wenn man stirbt, hatte sie gedacht und darauf gewartet, dass die Bilder ihres Lebens an ihr vorüberzogen.
Aber sie hatten überlebt. Nur die Scheiben waren im ganzen Haus gesprungen. Die Mutter hatte in der Wohnung Pappen vor die Fenster genagelt, neue Scheiben gab es erst ein halbes Jahr später. Die Schaufenster der Buchhandlung waren seither mit Holzlatten verstärkt. Doch jetzt war der Krieg vorüber – und Blockwart Klein lag tot auf der Straße.
Ein Kriegsversehrter an Krücken blieb stehen, den abgerissenen Mantel nur notdürftig verschlossen. «Haben Sie schon in seinen Taschen nachgesehen?», wollte er von Christa wissen. «Am Ende hat er noch Lebensmittelmarken einstecken.»
Christa schüttelte den Kopf. «Er hatte nichts bei sich. Nur die Stiefel.»
Der Versehrte bat: «Ziehen Sie ihm die doch aus, ich kann sie gut gebrauchen. Helfen Sie mir doch.»
Christa schüttelte den Kopf. Das konnte sie nicht, so gern sie dem Mann auch geholfen hätte. Immerhin hatte sie Herrn Klein gekannt. «Bitte, Sie müssen jemand anderen fragen.»
Sie seufzte, dann begab sie sich zur Polizei und gab an, wie der Blockwart zu Tode gekommen war und wo seine Leiche lag.
Als sie zurückkam, blickte Horst Klein noch immer mit toten Augen in den Himmel, und unter dem Schädel hatte sich eine Blutlache gebildet. Niemand hatte ein Tuch über sein Gesicht gelegt. Die Leute warfen nur einen kurzen Blick auf den Mann, dann hasteten sie weiter. Allerdings fehlten dem Toten die Stiefel und der Gürtel. Seine Taschen waren umgestülpt, die Knöpfe der Uniform abgeschnitten.
Christa beachtete ihn nicht weiter, sondern blieb im Hauseingang stehen und schaute auf die Berger Straße. Die sonst so belebte Straße war beinahe leer. Von fern waren ein paar Schüsse zu hören und Motorengeräusche. Jeden Augenblick konnten die Amerikaner da sein.
Zwei Frauen zogen einen Handwagen, auf dem eine uralte Frau lag, die röchelnd hustete. Zwei Jungen kletterten in den Trümmern des gegenüberliegenden Hauses herum, rechts neben dem Trümmerberg lag die Metzgerei, und Frau Lehmann stand wieder mit verschränkten Armen in der Tür. Ihre Metzgerschürze war blütenweiß. Sie hatte schon lange nichts mehr zu verkaufen. Nur vorletzte Woche, da hatte sie einen toten, uralten Gaul geliefert bekommen. Sie hatte Christa Bescheid gesagt und ihr vier Pferdewürste über den Ladentisch gereicht.
Christa winkte ihr zu. «Hast du Post von Klaus bekommen?», wollte Frau Lehmann wissen.
Christa schüttelte den Kopf. «Das hätte ich Ihnen doch sofort erzählt.» Klaus Lehmann war mit Christa in die Schule gegangen. Er war zwei Jahre älter als sie und seit drei Jahren Soldat. Christa hatte ihm jede zweite Woche einen Brief geschrieben. Weil sie ihn kannte, weil sie Nachbarn waren. Im letzten Jahr jedoch hatte Klaus Pläne gemacht, in denen immer wieder der Begriff «gemeinsame Zukunft» vorkam. Christa war darüber zu Tode erschrocken, denn das Letzte, was sie wollte, war, eine Metzgerei gemeinsam mit Klaus zu führen.
«Die Amis. Sie sollen schon auf der Zeil sein. Wird nicht mehr lange dauern», rief Frau Lehmann. «Ist besser, du gehst rein.»
Christa nickte. Sie warf noch einen Blick auf den Laden, der links neben ihr lag. Es war die Buchhandlung, die ihrem Onkel gehört hatte und seit seiner Verhaftung von Frau Reichel geführt wurde, die von der Reichsschrifttumskammer eingesetzt worden war und nichts als Schund verkaufte. Jetzt kroch sie im Schaufenster herum und sammelte die turmhohen Stapel von Hitlers Mein Kampf zusammen. Auch vor ihrer Tür flatterte eine weiße Fahne im Wind.
Schon an der Treppe hörte Christa das Heulen von Frau Klein. Anstatt nach oben zu gehen, ging sie runter in die Waschküche, löschte das Feuer unter dem Waschkessel und rettete ein paar Holzscheite. Sie füllte einen Drahtkorb damit und brachte ihn in den eigenen Keller.
Oben, in der Wohnung, die in der Etage über der Buchhandlung lag, saß Frau Klein in der Küche und schluchzte in ihr Taschentuch. Christa blieb im Türrahmen stehen. Helene setzte einen Kessel mit Wasser auf.
«Ich koche erst mal Kaffee. Kaffee hilft immer.» Dann öffnete sie die obere Küchenschranktür und holte das winzige Päckchen mit dem echten Bohnenkaffee hervor, das sie hütete wie einen Goldschatz und das in diesen Zeiten teurer war als Gold.
Christa wandte sich ab. Sie konnte es nicht ertragen, dass ihre Mutter ihren größten Schatz mit der Frau teilte, die an der Verhaftung ihres Martin beteiligt gewesen war. Aber so war die Mutter. Sie konnte hassen, aber sobald jemand in Not war, musste sie einfach ihre Hilfe anbieten.
Ob Martin noch lebte? Das Letzte, was sie gehört hatten, war, dass er in Buchenwald war. Es hieß, die Amerikaner wären in diesen Tagen nur noch ein Stück entfernt von Thüringen. Und dass die Russen aus Nordosten kamen. Niemand wusste, wer zuerst da sein würde.
Wäre ihr doch nur damals das Buch nicht hinters Regal gerutscht! Hätte sie doch besser aufgepasst!
Christa seufzte. Es waren so viele Menschen verschwunden. Auch ihr Vater. Sein letzter Brief war vor zwei Jahren aus Afrika gekommen. Helene glaubte fest daran, dass er zurück nach Hause kommen würde. Christa war sich da nicht so sicher. Die Mutter war sogar bei einer Wahrsagerin gewesen, und die hatte in den Karten gesehen, dass es dem Vater gut ging.
Und nun sollte der Krieg vorüber sein. Nie wieder Luftangriffe. Nie wieder Sirenen. Nie wieder eingesperrt sein im engen Keller und vor Angst zitternd. Nie wieder Brandgeruch, nie wieder Staub im Mund.
Und keine Leichen mehr sehen.
Unvorstellbar.
Christa war inzwischen achtzehn, hatte im letzten Monat ihr Notabitur an der Musterschule, eine nach damals fortschrittlichen Ideen gegründete Einrichtung aus dem 19. Jahrhundert, abgelegt, obwohl die Mutter dagegen gewesen war. «Wozu Abitur? Du heiratest, bekommst Kinder, machst es deinem Mann gemütlich. Integralrechnung und binomische Formeln brauchst du dafür nicht. Eine Frau sollte den Dreisatz kennen, sich ein bisschen mit Prozenten auskennen und mit Bruchrechnung. Das reicht.» Sie schob ihre Brille nach oben. «Doch ich bin trotzdem stolz auf dich. Schaden tut Bildung nur, wenn man sie falsch anwendet.»
So wie die Mutter dachten die meisten Frauen, aber Christa war anders. Sie träumte nicht von Ehemann und Kindern, obschon sie irgendwann gern einmal heiraten und Kinder bekommen würde. Aber nicht gleich. Sie wusste seit langem, was sie werden wollte: Literaturwissenschaftlerin. Sie wollte an der Universität in Frankfurt studieren, doch der Studienbetrieb war schon eine ganze Weile unterbrochen, und niemand wusste, wann es weitergehen würde. Zudem wusste Christa nicht, wie sie das ihrer Mutter beibringen sollte. Denn Helene Schwertfeger hatte ihre Tochter bereits in Fiedlers Bräuteschule angemeldet, in dem Institut, das sie einst selbst besucht hatte. Gott sei Dank war auch das im Augenblick noch geschlossen.
Auf der Straße erscholl Lärm. Christa trat ans Fenster, öffnete es. Unten liefen Soldaten mit umgehängten Gewehren vorbei. Amerikaner! Auf der Berger Straße! Noch heute früh hatte sie hier einen Mann in SA-Uniform gesehen, sogar eine letzte Hakenkreuzfahne war noch schnell eingeholt worden. Nun hingen überall die weißen Fahnen, die mit dem Hakenkreuz waren im Küchenofen verbrannt. Aus fast allen Fenstern schauten Leute, winkten den Amerikanern, wedelten mit weißen Taschentüchern. Und die Amerikaner winkten zurück mit blitzenden Zähnen und breitem Lächeln. Der Kriegsversehrte bekreuzigte sich, und Christa sah, dass ihm Tränen über die Wangen liefen. Ein altes Mütterchen mit dunklem Kopftuch trat an einen schwarzen G.I. heran und küsste ihm die Hand. In St. Josef läuteten die Glocken so laut und hell wie schon lange nicht mehr.
Hinter den G.I.s fuhr ein Jeep mit einem weißen Stern auf der Motorhaube. Eine Horde Kinder folgte ihm und grabschte gierig nach den Kaugummis und den kleinen Schokoladen, die die Amis um sich warfen. Marlies Bielich stand in der Haustür.
«Frowlein, dancing!» Ein Amerikaner trat auf sie zu, fasste sie um die Hüfte und machte ein paar Tanzschritte auf dem Pflaster mit ihr, direkt neben der Leiche des Blockwarts in SA-Uniform, ehe der junge Soldat von den anderen mitgezogen wurde.
Dann war die Straße wieder ruhig. So still, dass es in Christas Ohren gellte. Frieden! Christa wusste nicht genau, wie sich das anfühlte. Sie war irgendwie ruhig und aufgeregt zugleich. Eine neue Zeit brach an, das spürte sie. Frieden. Ein schönes Wort, fand sie. Frieden. Sie musste es mehrmals aussprechen, um es glauben zu können. Frieden.
Und nun? Was war zu tun? Was geschah jetzt? Musste man sich irgendwo melden? Bei wem? Bekam man noch die kargen Lebensmittelrationen? Hatte die Polizei noch etwas zu sagen? Und am wichtigsten: Kam Martin jetzt frei? Der Vater doch noch zurück?
Hinter dem zerbombten Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite stiegen Rauchwolken auf. Christa ahnte, was das bedeutete. Da verbrannte jemand seine Uniform, die Hitlerbilder. Sie selbst brauchten nichts mehr zu verbrennen. Die Hakenkreuzfahne war schon vor Tagen in den Küchenofen gewandert. Hitlerbilder hatten sie nie gehabt, und die einzige Uniform war Christas alte Kluft vom Bund Deutscher Mädel, die ihr längst nicht mehr passte. Sie wollte gerade das Fenster schließen, als sie den Karren des Bestatters vorfahren hörte. Früher besaß er ein Auto, nun sammelte er die Toten mit dem Pferdefuhrwerk auf. Christa sah, wie zwei Männer den Blockwart an Armen und Beinen fassten und mit Schwung auf das Fuhrwerk warfen.
«Hast du Frau Reichel heute schon gesehen?», fragte die Mutter am Abend.
«Heute Morgen hat sie Mein Kampf aus dem Schaufenster geräumt. Aber der Laden war den ganzen Tag über geschlossen.»
«Gehört er jetzt eigentlich wieder uns?», überlegte die Mutter. «Muss ich jetzt irgendwohin und fragen, ob wir wieder öffnen dürfen? Wir sind ja 1941 enteignet worden. Gibt es jetzt eine Rückübertragung, oder geht alles einfach so weiter wie vor dem Krieg? Dürfen wir diese schreckliche Nazi-Literatur wegwerfen und die Reichel zum Teufel jagen?»
Im Flur rumpelte es, kurz darauf erklang Geschimpfe. Die Spielvogels, Flüchtlinge aus dem Sudetenland, waren zurück. Vor einem Monat waren sie hier einquartiert worden, bewohnten zu viert das Zimmer, das einst Martins Wohnzimmer gewesen war. Christa hörte Frau Spielvogel schimpfen, dann den kleinen Uwe weinen, während von den anderen beiden Söhnen, Bodo und Jürgen, nichts zu hören war. In den letzten vier Wochen hatten sich die Schwertfegers und die Spielvogels aneinander gewöhnen müssen, aber Gisela Spielvogel hatte eine so zupackende und freundliche Art, dass es Christa vorkam, als lebten sie schon viel länger mit der sudetendeutschen Familie zusammen.
«Ich weiß es nicht, Mama. Aber ich gehe gleich mal rüber zu Marlies. Vielleicht weiß sie etwas. Sie arbeitet ja bei der Stadt.»
«Die Amis sind da, das ist ein Ding, oder?» Marlies hatte vor Aufregung rote Wangen, als sie Christa in ihr Zimmer führte. Auch Bielichs hatten Einquartierungen, und so musste sich die Freundin das Zimmer mit ihren zwei jüngeren Schwestern teilen.
«Warst du heute auf dem Amt?», fragte Christa. «Weißt du, was man jetzt tun muss? Sich irgendwo melden?»
«Ach was. Jetzt müssen sich die Amerikaner erst einmal einen Überblick verschaffen. Sie haben das I.G.-Farben-Haus beschlagnahmt. Morgen werden etliche Häuser im Westend geräumt, um Wohnungen für die Soldaten und Offiziere zu bekommen. Frankfurt ist nämlich das Headquarter der Amerikaner in Deutschland.»
«Aha.»
«Ja. Und heute war ein Kommandant bei uns auf dem Amt. Seinen Namen habe ich vergessen. Er hat gefragt, ob hier noch Nazis arbeiten. Da waren alle ganz still. Niemand hat was gesagt, aber es wird gemunkelt, sie hätten die Listen der NSDAP-Mitglieder aus deren Geschäftsstelle geholt, bevor sie verbrannt werden konnten. Einige Kollegen sind aufgestanden und wortlos gegangen. Morgen wird der Ami wiederkommen und uns sagen, wie jetzt zu verfahren ist.» Sie blickte Christa wichtig an. «Euer Laden war heute zu. Die Reichel hat sich bestimmt abgemacht.»
«Abgemacht?»
«Abgehauen, sie war doch im Vorstand der NS-Frauenschaft. Nur deshalb hat sie ja euren Laden bekommen. Die sehen wir bestimmt nicht wieder.»
«Meinst du, wir können morgen schon rein und aufräumen?»
Marlies schüttelte den Kopf. «Nein, ich glaube, im Augenblick dürfen wir gar nichts. Die Amis haben jetzt das Sagen, und die müssen sich erst einfinden.» Marlies blickte auf ihre schmale Armbanduhr, die sie von ihrer Patentante zur Konfirmation bekommen hatte. «Du, es ist gleich acht. Wir haben ab sofort ab 20 Uhr Ausgangssperre. Gilt zwar erst ab morgen, aber vielleicht ist es besser, wenn du jetzt gehst. Die Kleinen müssen auch langsam ins Bett.»
Christa erhob sich von Marlies’ schmaler Liege.
In der Tür hielt die Freundin sie sanft am Arm fest. «Vielleicht können wir jetzt so leben wie andere junge Mädchen.»
«Was meinst du damit?»
«Na, tanzen gehen. Ins Kino. Vielleicht sogar jemanden kennenlernen. Das wär’s doch, oder? Sobald ein Tanzlokal aufmacht, gehen wir hin. Abgemacht?»
Christa nickte. Sie war noch nie tanzen gewesen. Vor zwei Jahren hatte sie in der Tanzschule Wernecke ein paar Tanzstunden absolviert, Walzer, Polka und Quadrille. Aber sie hatte immer nur mit anderen Mädchen getanzt, weil es keine jungen Männer gab und die Schulkameraden alle im Flakeinsatz waren. Tanzen. Sie wusste ja gar nicht, ob sie das konnte.
Als sie auf die Straße trat, stolperte sie beinahe über einen kleinen Jungen, der sich auf der Schwelle von Bielichs Haus eingerichtet hatte. Unter seinem Kopf lag ein fleckiger Stoffbeutel, den er als Kissen benutzte. Ein alter, zerrissener Wehrmachtsmantel ohne Ärmel bedeckte seinen Körper, und statt Schuhen trug er Pappe an den unbestrumpften Füßen. Seine Hand war fest um ein Foto gekrümmt.
«Na, Kleiner», sagte Christa freundlich. «Was machst du denn hier?»
«Ich hab Hunger», erwiderte der Junge, der vielleicht sechs oder sieben war. Er war so dünn wie eine Zaunlatte und vollkommen verdreckt, das Haar verfilzt und viel zu lang.
«Hast du keine Eltern?», wollte Christa wissen. Das Bürschchen sah so elend aus, dass Mitleid in ihr aufstieg. «Was machst du denn hier so allein?»
«Ich hab solchen Hunger.»
«Warte, ich hol dir was.»
Oben in der Wohnung rief sie nach der Mutter, aber Helene war nicht zu Hause. Christa schnitt dem Jungen eine dicke Scheibe Brot ab und strich kräftig Butter drauf. Sie hatte die Butter von zwei Wochen aufgespart, um endlich mal etwas zu schmecken, aber der Kleine brauchte sie nötiger. Dann suchte sie noch ein paar gestrickte Strümpfe aus ihrer Schublade, goss warmen Kräutertee in einen Henkelbecher aus Metall und ging zurück zu dem Kleinen.
Gierig aß er das Brot, riss mit den Zähnen Stücke davon ab wie ein Wolfsjunges.
Als er fertig war, fragte Christa: «Wie heißt du? Woher kommst du?»
«Heinz Nickel, geboren am 21.9.1937 in Litzmannstadt.»
Er rasselte die Angaben so rasch herunter, dass Christa sich fragte, wie oft er schon danach gefragt worden war. Sie betrachtete das Kerlchen noch einmal, dann verabschiedete sie sich: «Schlaf gut. Ich bringe dir morgen früh wieder was zu essen.»
Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn einfach im Hauseingang liegen ließ. Aber was sollte sie machen? Sie hatten doch gar keinen Platz. Drei Zimmer nur und die Küche. Im großen Zimmer schlief Mutter Spielvogel mit ihren drei Söhnen, Helene nächtigte im Schlafzimmer, und in die kleine Kammer hatten sie eine Liege für Christa gestellt. Das Zimmer war so klein, dass Christa beide Wände berühren konnte, wenn sie die Arme ausstreckte. Überall war es furchtbar eng, trotzdem hatten sie es viel besser als andere, die in Ruinen hausten oder sich in Schrebergärten ohne Licht und Wasser aufhielten.
Auf der Treppe hörte sie schon wieder die Stimme von Frau Klein, die wohl auf ihre Mutter einredete. Und richtig. Da stand sie, angetan mit einem schwarzen Kleid, vor der Wohnungstür und gestikulierte mit beiden Händen, während die Mutter wohl gerade mit einem Wäschekorb vom Dachboden gekommen war.
«Meinen Mann will ich natürlich auf dem Bornheimer Friedhof beerdigen. In einem mit Eichenlaubschnitzereien verzierten Eichensarg. Kränze und einen Pfarrer will ich auch. Und das Eiserne Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg am Sonntagsanzug. So gehört es sich. Mein Horst war immer ein Vorbild.» Dann kramte sie in ihrer Schürzentasche und zog ein zerknittertes Schreiben hervor. «Sehen Sie sich das mal an. Das hat heute in meinem Briefkasten gelegen.»
Helene hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt, also nahm Christa das Schreiben und las vor: «Einquartierungsbescheid.» Den Rest überflog sie, erfuhr nur, dass am übernächsten Tag eine sechsköpfige Familie aus Schlesien bei Frau Klein einziehen sollte. Großmutter, Mutter und vier Töchter. Als Christa den Stempel und die Unterschrift sah, musste sie lächeln. Marlies arbeitete in diesem Amt, und die Unterschrift war von ihrem Vorgesetzten, Herrn Dr. Bittner.
«Das kommt natürlich für mich überhaupt nicht in Frage», erklärte Emma Klein und nahm Christa das Schreiben aus der Hand. «Polacken in meiner Wohnung. Nur über meine Leiche. Ich bin schließlich in Trauer und muss eine Beerdigung vorbereiten.»
«Haben Sie keine anderen Sorgen?» Christa konnte ihren Zorn kaum mehr unterdrücken. «Sie haben bislang allein in einer Dreizimmerwohnung gelebt, weil ihr Mann glaubte, er habe hier was zu melden. Jetzt machen Sie gefälligst zwei Zimmer frei für die Flüchtlinge. Wir leben schon seit Wochen zu sechst in drei Zimmern. Und wenn Vater und Martin wiederkommen, sind wir zu acht.»
Darüber konnte Frau Klein nur die Nase rümpfen. «Das habe ich sowieso nie verstanden. Dass Sie die Leute aufgenommen haben, ohne sich zu wehren. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Frau sogar Tschechin! Das weiß ja jeder, was für Zustände bei den Tschechen herrschen.»
Christa brachte es kaum über sich, Frau Klein nicht bei den Schultern zu packen und kräftig durchzuschütteln. «Im Übrigen ist es unser Haus. Und wir werden auf jeden Fall die Behörden unterstützen.»
«Pfft! Ihr Haus!», machte Frau Klein. «Sie sind nicht meine Vermieterin. Sie nicht. Das Haus gehört Ihrem Vater und Ihrem Onkel. Und beide sind nicht da. Also bleibt alles, wie es ist.»
Helene schüttelte den Kopf. «Die Ausgebombten und die Vertriebenen haben alles verloren. Wir sind verpflichtet, ihnen zu helfen.»
Frau Klein reckte das Kinn. «Ich bin auch ein Opfer. Ich habe meinen Mann verloren.»
«Sie? Ein Opfer? Dass ich nicht lache. Die, die in den KZs sind und waren, das sind Opfer – die Zwangsarbeiter, die Verschleppten, die Vertriebenen, die Juden.» Christa hatte vor Ärger rote Wangen bekommen.
«Ich auch», beharrte Frau Klein. «Ich habe Nächte in Luftschutzkellern verbracht, hatte nichts zu essen. Von den Konzentrationslagern haben wir nichts gewusst, und Juden haben wir keine gekannt. Wer weiß, ob das alles so stimmt, was da jetzt erzählt wird.»
Sie reckte das Kinn noch ein Stück weiter vor, bereit, auf jedes von Christas Worten eine deftige Erwiderung zu geben.
Aber Christa drehte sich um, hob den Wäschekorb hoch und sagte laut: «Komm, Mama.»
Am nächsten Morgen schmierte Christa zwei Marmeladenbrote und füllte Kräutertee in eine alte Feldflasche, die ihrem Vater im Ersten Weltkrieg gedient hatte.
«Was machst du da?», wollte Helene wissen.
«Ich habe gestern Abend einen kleinen Jungen getroffen. Er lag bei Bielichs auf der Türschwelle. Ganz abgemagert und abgerissen. Sieben Jahre ist er alt. Ich habe ihm versprochen, heute Morgen etwas zu essen zu bringen.»
«Wir haben selbst nicht viel», erwiderte die Mutter. «Wo sind denn seine Eltern?»
Christa zuckte mit den Schultern: «Ich glaube, er ist ganz allein.»
Der kleine Heinz lag noch immer auf der Schwelle des Nebenhauses. Doch gerade als Christa zu ihm kam, öffnete sich die Tür und die Hausmeisterin stand vor dem Kleinen. «Was willst du hier?», schrie sie ihn an. «Mach, dass du wegkommst.» Sie schwenkte bedrohlich einen Schrubber.
Der Kleine sprang auf, raffte sein weniges Zeug zusammen und wollte weglaufen.
«Heinz», rief Christa. «Dein Frühstück.»