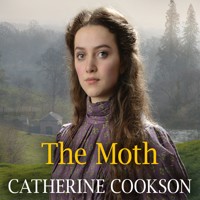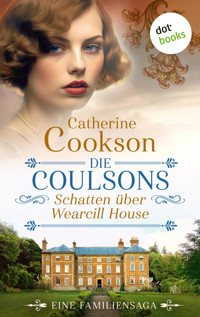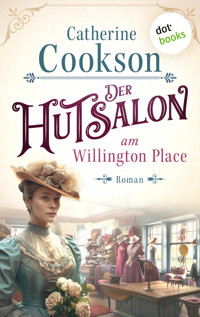
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In den Stürmen der Zeit … Die Frauensaga »Der Hutsalon am Willington Place« von Catherine Cookson jetzt als eBook bei dotbooks. London, 1879. Niemals hätte Emily Pearson zu träumen gewagt, als einfaches, mittelloses Mädchen ein florierendes Geschäft mitten im Herzen der Stadt zu erben: Umso größer ist ihre Überraschung, als sie den Hutsalon von Madam Arkwright vermacht bekommt, den sie jahrelang aufopferungsvoll geführt hat. Doch nun muss Emily sich plötzlich in der rauen und neidvollen Welt der Geschäftsmänner behaupten. Wird sie Madam Arkwrights Vermächtnis bewahren können und außerdem ihren letzten Wunsch erfüllen? Denn Emily soll in jenes prachtvolle Hotel an der französischen Riviera reisen, in welchem die Hutmacherin vor vielen Jahren ihre große Liebe fand … und vielleicht darf Emily hier sogar auf ein ähnliches Glück hoffen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Schicksalsroman »Der Hutsalon am Willington Place« der großen englischen Bestsellerautorin Catherine Cookson wird auch Fans von Marie Lamballe begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 874
Ähnliche
Über dieses Buch:
London, 1879. Niemals hätte Emily Pearson zu träumen gewagt, als einfaches, mittelloses Mädchen ein florierendes Geschäft mitten im Herzen der Stadt zu erben: Umso größer ist ihre Überraschung, als sie den Hutsalon von Madam Arkwright vermacht bekommt, den sie jahrelang aufopferungsvoll geführt hat. Doch nun muss Emily sich plötzlich in der rauen und neidvollen Welt der Geschäftsmänner behaupten. Wird sie Madam Arkwrights Vermächtnis bewahren können und außerdem ihren letzten Wunsch erfüllen? Denn Emily soll in jenes prachtvolle Hotel an der französischen Riviera reisen, in welchem die Hutmacherin vor vielen Jahren ihre große Liebe fand … und vielleicht darf Emily hier sogar auf ein ähnliches Glück hoffen?
Über die Autorin:
Dame Catherine Ann Cookson (1906–1998) war eine britische Schriftstellerin. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern gehörte sie zu den meistgelesenen und beliebtesten Romanautorinnen ihrer Zeit; viele ihrer Werke wurden für Theater und Film inszeniert. In ihren kraftvollen, fesselnden Schicksalsgeschichten schrieb sie vor allem über die nordenglische Arbeiterklasse, inspiriert von ihrer eigenen Jugend. Als uneheliches Kind wurde sie von ihren Großeltern aufgezogen, in dem Glauben, ihre Mutter sei ihre Schwester. Mit 13 Jahren verließ sie die Schule ohne Abschluss und arbeitete als Hausmädchen für wohlhabende Bürger sowie als Angestellte in einer Wäscherei. 1940 heiratete sie den Gymnasiallehrer Tom Cookson, mit dem sie zeitlebens zurückgezogen und bescheiden lebte. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1950; 43 Jahre später wurde sie von der Königin zur Dame of the British Empire ernannt und die Grafschaft South Tyneside nennt sich bis heute »Catherine Cookson Country«. Wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag starb sie als eine der wohlhabendsten Frauen Großbritanniens.
Catherine Cookson veröffentlichte bei dotbooks auch ihre englischen Familiensagas »Die Thorntons – Sturm über Elmholm House«, »Die Lawsons – Anbruch einer neuen Zeit«, »Die Emmersons – Tage der Entscheidung«, »Die Coulsons – Schatten über Wearcill House« und »Die Masons – Schicksalsjahre einer Familie«.
Bei dotbooks erscheinen außerdem ihre Schicksalsromane »Der Himmel über Tollet’s Ridge«, »Das Erbe von Brampton Hill«, »Sturmwolken über dem River Tyne« und »Sturm über Savile House«.
***
eBook-Neuausgabe November 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »The Golden Straw« bei Bantam Press, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Goldener Schatten« im Heyne Verlag.
Copyright © The Catherine Cookson Charitable Trust 1993
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz unter Verwendung von Shutterstock/Oaurea und AdobeStock/4k_Heaven, Masson
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-836-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Hutsalon am Willington Place« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Catherine Cookson
Der Hutsalon am Willington Place
Roman
Aus dem Englischen von Christine Roth
dotbooks.
Erstes Buch:Die Anfänge
Teil 1
1879
Kapitel 1
Emily Pearson ließ ihren Blick durch das leere Zimmer schweifen und fragte sich angesichts der vielen Möbel, die sich draußen auf dem Pferdekarren stapelten, wie sie sich in der Enge des kleinen Häuschens überhaupt hatte bewegen können.
Das war’s, dachte sie, nahm dann den Schlüssel aus ihrer Handtasche, warf einen letzten Blick zurück und ging zur Tür. Tat es ihr leid, dieses Haus zu verlassen? Nein. Nein, gewiß nicht, obwohl sie in diesem Haus geboren worden war und darin sechzehn glückliche Jahre verbracht hatte, bis ihre Mutter starb. Und auch die anschließenden zwei Jahre hatte sie einigermaßen zufrieden dort verlebt. Dann hatte sie Jimmy Pearson geheiratet und die Hochzeitsnacht in dem Schlafzimmer dort drüben verbracht.
Die Ehe mit Jimmy war schrecklich gewesen, das Leben mit ihm so ganz anders verlaufen, als Emily es sich ausgemalt hatte. Von Zärtlichkeit hatte sie geträumt, von gemeinsamen Abenden vor dem Kaminfeuer, wo er ihr von seiner Arbeit in Parkers Warenhaus berichten und sie ihn mit kurzweiligen Geschichten über ihre Kundinnen in Madam Arkwrights Hutsalon unterhalten würde. Aber nichts dergleichen. Seine Kehle sei trocken, pflegte er zu sagen, er müsse sie erst ölen, bevor er sprechen könne. Zugegeben, er hatte sie ein paarmal aufgefordert, ihn ins Pub zu begleiten. Aber das bedeutete, in einer Runde von Frauen zu sitzen, mit denen sie sich nicht unterhalten konnte. Es war, als sprächen sie eine andere Sprache. Nach ihrem zweiten Besuch dort hatte sie ihm erklärt, daß sie keine Lust habe, sich mit diesen liederlichen Frauenzimmern zu langweilen, während er sich nebenan an der Bar volllaufen lasse, zu der nur Männer Zutritt hatten.
Am Morgen danach betrat sie den Hutsalon, The Bandbox, wie er hieß, zum ersten Mal mit einer geschwollenen Wange. Und an diesem Morgen war ihr Mrs. Arkwright zum ersten Mal nicht als Chefin, sondern als Mutter entgegengetreten und hatte sie für ihre Torheit gerügt, sich von diesem gewöhnlichen Individuum einwickeln zu lassen, das dieser Warenhaus Verkäufer in ihren Augen nun mal sei. Habe sie sie nicht oft genug gewarnt, betonte sie, daß dieser Mann weit unter ihrem Niveau liege? Ihre Mutter habe sie doch gut erzogen, und auch sie habe sich alle Mühe gegeben, ihr Stil beizubringen, und nun lasse sie sich behandeln wie eine Hafennutte!
Diese Szene stand ihr jetzt wieder ganz deutlich vor Augen: Mrs. Arkwright, bislang stets die Gelassenheit in Person, die sie bei den Schultern gepackt und gesagt hatte: »Wenn er noch einmal die Hand gegen dich erhebt, dann nimm den nächstbesten Gegenstand und schlag zurück. Zunächst probieren sie es nur, und dann wird es zur Gewohnheit. Wenn du dich jetzt nicht gegen ihn wehrst, dann wirst du, ehe das Jahr zu Ende ist, nicht mehr aus den Augen schauen können. Ich kenne diese Sorte Mann.«
Und sie hatte recht gehabt. Nur wenige Tage später, als sie sich weigerte, ihm fünf Shilling für eine todsichere Wette zu geben, schlug er wieder zu. Doch diesmal war sie gewappnet. Noch ehe seine Hand ihre Wange berührte, hatte sie den Kerzenständer gepackt, der auf dem Kaminsims stand, und ihm damit auf die Fingerknöchel geschlagen, und zwar mit einer solchen Wucht, daß er mit einem lauten Aufschrei zurückwich. In seinem Gesicht spiegelte sich Schmerz, aber auch Verblüffung, als er sie daraufhin mit großen Augen anstarrte. Sein stilles, fügsames junges Frauchen, das ihm bislang bedingungslos gehorcht hatte, wie er vor seinen Freunden gerne angab, hatte doch tatsächlich die Stirn, sich ihm entgegenzustellen. Schlimmer noch, sie erklärte ihm tatsächlich, was passieren würde, wenn er es noch einmal wagen sollte, sie zu schlagen. Sie würde ihm ihren Lohn nicht mehr abliefern, sagte sie, und verlangte zudem einen Teil des seinen als Beitrag zum Haushaltsgeld...
Emily lehnte sich gegen die Tür, schloß die Augen und ließ die Szene noch einmal Revue passieren. Das war der befriedigendste Augenblick in ihrer Ehe gewesen, der Moment, der sie vom Mädchen zur Frau machte, und zwar endgültiger, als es das Ehebett vermocht hatte.
Nach diesem Abend war das Leben an seiner Seite beinahe unerträglich geworden. Es kam die Zeit, da er nachts nicht nach Hause kam. Aber darüber war sie im Grunde nicht allzu unglücklich. Diese Nächte waren für sie willkommene Ruhepausen, die ihr auch der bronzene Kerzenständer nicht hatte gewähren können. Und dann kam der Tag, da er ihr erklärte: »Jetzt kannst du sehen, wo du bleibst. Ich verlasse dich.« Und als diese Erklärung ohne Antwort blieb, hatte er gebrüllt: »Was glaubst du überhaupt, wer du bist? Dein alter Herr war doch bloß ein kleiner Heizer auf einem abgewrackten Kahn.« Darauf bekam er eine Antwort. »Mein Vater war Zweiter Offizier auf einem Frachtschiff und ein Gentleman.«
Ja, sie hatte ihren Vater als Gentleman in Erinnerung. Er ertrank, als sie fünf Jahre alt war. Sie hatte ihn eigentlich nur zweimal gesehen und jedesmal laut geschrien, wenn sie dieser fremde Mann auf den Arm nehmen wollte.
»Dein Vater war ein echter Gentleman«, hatte ihre Mutter immer wieder zu ihr gesagt und dadurch in ihrer Vorstellung das Bild eines schneidigen Schiffsoffiziers geprägt, der durch die Rente, die ihre Mutter nach seinem Tod bezog, quasi mit dazu beigetragen hatte, daß sie dieses Haus hatten kaufen können.
In besagter Nacht hatte ihr Mann auch die Sprache auf die Besitzrechte an diesem Haus gebracht. »Wenn du dieses Haus verkaufst, dann bekomme ich meinen Anteil, daß das klar ist. Was der Frau gehört, gehört auch dem Mann. Genaugenommen kann ich dieses Haus auch über deinen Kopf hinweg verkaufen, wenn ich will. Und das werde ich auch, wenn du mir krumm kommst.«
Aber da sie, was die Gesetze anbelangte, völlig unbewandert war, hatte sie sich einstweilen ruhig verhalten. Sie wollte zuerst mit Mrs. Arkwright über die Angelegenheit sprechen.
Und als sie ihr dann erzählte, daß ihr Mann sie verlassen habe, hatte diese ganz spontan ausgerufen: »Gott sei Dank, daß du den los bist! Aber laß dich nicht auf eine Trennung ein, verlang die Scheidung.«
Scheidung! Das gab es nur in bessergestellten Kreisen. Doch mit Hilfe ihrer mütterlichen Ratgeberin hatte sie die Scheidung durchsetzen können. Drei Jahre hatte die Prozedur gedauert, doch schließlich gab die Tatsache, daß er mit seiner neuen Lebensgefährtin inzwischen drei Kinder hatte, den Ausschlag, und machte zudem endgültig seine Vorstellung zunichte, daß er auf ihren Besitz einen rechtlichen Anspruch erheben könnte.
Daß die Anwaltskosten den größten Teil des Erlöses, den sie mit dem Verkauf des Hauses erzielte, verzehrt hatten, machte ihr insofern wenig Kopfzerbrechen, als Mrs. Arkwright ihr inzwischen in ihrem Haus eine Wohnung angeboten hatte. Und damit nicht genug, hatte sie sie als gleichberechtigte Partnerin in den Hutsalon aufgenommen. Und was das für eine Partnerschaft war! Und was für ein Haus! Was für Häuser, genauer gesagt!
Emily machte die Tür auf, trat auf die Straße, drehte den Schlüssel im Schloß und murmelte dabei: »Leb wohl. Leb wohl, altes Haus. Du hast deinen Zweck erfüllt.«
Ohne einen Blick zurückzuwerfen, ging sie die Straße hinunter zur Droschkenstation und bestieg die nächste Pferdekutsche. Versonnen starrte sie während der Fahrt aus dem Fenster, wie sie es so oft tat, ohne die Straßen und Häuserfronten, die an ihr vorbeizogen, wahrzunehmen, so vertraut war ihr diese Wegstrecke in den vielen Jahren geworden. Als sie mit ihrer Mutter das erste Mal Mrs. Arkwrights Hutsalon aufgesucht hatte, war es nur ein Katzensprung gewesen zum Bertram Close, wo sich der Hutsalon damals befand. Doch kurze Zeit später zog Mrs. Arkwright mit ihrem Salon in die Maddock Street um und etablierte sich zwei Jahre später im Frontlea House am Willington Place, Ecke Barclay Street. Der neue Salon verfügte über ein kleines Schaufenster und bildete den Anfang einer Reihe gut eingeführter Ladengeschäfte. Nebenan gab es eine exklusive Blumen-Boutique, einige Häuser weiter einen Laden, der Briefmarken und Münzen an Sammler verkaufte, und am Ende der Straße ein Hutgeschäft für Herren, über dessen Besitzer und Kunden Madam sich bisweilen köstlich amüsierte.
Nachdem Mrs. Arkwright vier Jahre im Frontlea House Nummer 35 ihren Hutsalon betrieben hatte, unterschrieb sie zur allgemeinen Verwunderung der Anwohner nicht nur einen Pachtvertrag auf 99 Jahre für dieses Haus, sondern mietete auch noch das angrenzende Gebäude dazu, in dem Konteradmiral Proggett bis zu seinem Tod gewohnt hatte.
Ließ sich mit Hüten so viel Geld verdienen? fragten sich die Leute damals verwundert. Und die Gerüchteküche wußte zu berichten, daß die Damengarderobe, die Mrs. Arkwright ebenfalls in ihren Räumen zum Verkauf anbot, nicht ganz ... neuwertig war.
Von der Droschkenstation bis zum Hutsalon war es nur ein kurzer Fußweg. Emily öffnete die Haustür, die in demselben Dunkelgrün gestrichen war wie die Fenstersimse zu beiden Seiten des Eingangs und das eiserne Geländer, das den schmalen Vorgarten begrenzte. Sie durchquerte eine kleine Diele und ging auf die Milchglastür zu, die in das eigentliche Empfangsfoyer führte. Besucher, die zum ersten Mal Mrs. Arkwrights Hutsalon besuchten, hielten angesichts dieses L-förmig geschnittenen, außergewöhnlich großen Raumes erstaunt inne. Von den beiden Längsseiten gingen etliche Türen ab, und am Ende der Halle befand sich eine ausladende Treppe, die in die oberen Räumlichkeiten führte.
Die Wände des Foyers waren mit einer dunkelroten Stofftapete verkleidet, und vor den beiden hohen Fenstern neben der Eingangstür bauschten sich graue Seidenvorhänge. Dasselbe Grau wiederholte sich in den schweren Brokatbezügen der drei Sofas und zweier zierlicher Sessel, die den Besuchern als Sitzgelegenheit dienten. Den Mittelpunkt der Halle bildete ein großer, runder Tisch, und an gut sichtbaren Standorten, die dem Besucher zwangsläufig ins Auge fallen mußten, waren die neuesten Hutmodelle auf schlanken Holzständern dekoriert.
Emily blieb für einen Moment stehen und sah sich um. Aus zwei der angrenzenden Räume drang leises Stimmengemurmel, was bedeutete, daß dort Kundinnen bedient wurden; spezielle Kundschaft in diesem Fall – solche, die ihre Bestellung auch prompt bezahlte.
Gerade als sie sich anschickte weiterzugehen, öffnete sich die Tür zu ihrer Linken, und sie hörte eine lachende Stimme sagen: »Er wird mich umbringen. Ich höre ihn schon sagen: ›Du kannst doch nicht drei Hüte auf einmal tragen!‹ Nun, ich werde einfach die ganze Schuld auf Sie schieben, Miß Esther ... Oh, da ist ja Mrs. Pearson«, flötete die üppige, für die Tageszeit viel zu elegant gekleidete Dame, die nun mit raschelnden Röcken auf Emily zugesegelt kam und dabei unaufhörlich weiterschnatterte. »Stellen Sie sich vor, wegen eines winzigen Hütchens bin ich gekommen, und mit drei Tellerhüten gehe ich nach Hause. Aber schließlich kann ich mich ja nicht ohne Hut auf der Straße blicken lassen, nicht wahr? Sie sehen großartig aus, Mrs. Pearson. Wo stecken Sie denn immer? Und Madam Arkwright?« Vertraulich beugte sie sich zu Emily und erklärte, indem sie die Lippen zu einer Schnute schürzte: »Neuerdings erhasche ich nur noch einen Blick auf Madam, wenn ich meine Rechnungen bezahle.«
»Aber Mrs. Fairbairn. Madam ist stets entzückt, Sie zu empfangen, das wissen Sie doch. Schließlich sind Sie ihre älteste und beste Kundin.«
»Die älteste, das will ich doch nicht hoffen, meine Liebe«, meinte sie eine Spur indigniert und wedelte mit der Hand vor Emilys Nase herum, worauf diese sofort um ein entschuldigendes Lächeln bemüht war: »Das ist doch nur so eine Redewendung, gnädige Frau. Sie waren eine der ersten Damen, die ich kennenlernte, als ich bei Madam anfing, und Sie sind seither keinen Tag älter geworden.«
»Genau dasselbe sagt Wilson Fairbairn auch immer, und ich glaube ihm kein Wort. Aber ich höre es trotzdem gern. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Sie sorgen doch dafür, daß meine Hüte morgen fertig sind, nicht wahr?«
»Aber gewiß, gnädige Frau.« Emily begleitete Mrs. Fairbairn nach draußen. »Ah, da ist ja Benson«, krähte diese, als sie durch die Eingangstür trat, und fügte dann verschmitzt hinzu: »Er haßt es, die Kutsche um den Block zu führen. Sei nicht gut für die Pferde, sagt er. Und gerade deshalb bleibe ich mit Absicht immer ein wenig länger, müssen Sie wissen.«
Emily beobachtete erstaunt, wie die füllige Dame leichtfüßig wie ein junges Mädchen die drei Stufen zur Straße hinuntertrippelte, in der Kutsche Platz nahm und ihr dann zum Abschied noch einmal huldvoll zuwinkte.
Esther McCann hatte im Foyer auf Emily gewartet und meinte nun zu ihr: »Donnerwetter, das ist vielleicht eine Marke. Aber irgendwie mag ich sie. Kürzlich hörte ich, daß die Firma ihres Gatten in Schwierigkeiten steckt. Ob sie das wohl weiß?«
»Denke ich schon. Aber wie ich sie einschätze, hat sie bestimmt beschlossen, keine Notiz davon zu nehmen«, entgegnete Emily und nickte nachdenklich mit dem Kopf. »Und wie läuft es hier?«
»Ganz gut soweit. Lady Steele war da.«
»Lady Steele? Wie nett... was wollte sie denn? Hüte?«
»Ja, einen vorläufig. Es ist schon komisch mit diesen Titeln. Da ist Lady Steele, die keinen Penny in der Tasche hat und dennoch versucht, ihren Standard zu halten und die Liebenswürdigkeit in Person ist, und dann die andere, diese Lady Wearmore ... Ich kann diese Person nicht ausstehen.«
»Da bin ich ganz deiner Meinung, Esther... Wo ist denn Madam?«
»Na, wo wohl? Nebenan, wie immer. Es wird wunderschön, nicht wahr?«
»Ja, großartig«, sagte Emily und senkte dann die Stimme. »Bevor Lena und du heute abend nach Hause geht, möchte Madam noch ein Wort mit euch reden. Lena soll doch die Änderungen übernehmen, und du wirst ihr dabei zur Hand gehen. Aber zusätzlich brauchen wir noch zwei Kräfte für die Werkstatt hier, und darüber möchte sie mit euch sprechen.«
Esther McCann nickte. »Ja, darüber habe ich mit Lena auch schon gesprochen. Wir sind übereingekommen, daß wir lieber die Änderungen oben machen wollen, als weiter hier unten zu arbeiten. Nicht daß Sie denken...«, fügte sie mit veränderter Stimme hinzu, »... daß es uns hier nicht gefällt, aber Sie wissen schon, was ich meine.«
»Ja, ich weiß, was du meinst. Mir wäre es auch lieber so. Hüte sind nun mal mein Beruf; damit kenne ich mich aus, und dabei sollte ich bleiben. Was sagst du dazu?«
»Vollkommen richtig!«
Emily lächelte still vor sich hin, als sie durch den kurzen Flur und die neue Verbindungstür in das kürzlich erworbene Nachbarhaus ging. Diese Tür führte zunächst in einen bis in Schulterhöhe holzvertäfelten, unmöblierten Raum, von dem aus sie die Diele betrat. Diese war ebenfalls holzvertäfelt, hier jedoch vom Boden bis zur Decke, und mit einem Sideboard, einem Hutständer und drei Stühlen ausgestattet. Sie öffnete die Tür zum Salon. Die bewußt spärliche Einrichtung dieses Raumes sollte dem Besucher ein Gefühl von Weite vermitteln, das die blaßblauen Stofftapeten noch wirkungsvoll unterstrichen.
Da sie Mrs. Arkwright im Salon nicht vorfand, ging sie weiter ins Eßzimmer. Auch hier waren die Wände panelliert, aber nur bis zur Höhe der Stuhllehnen. Dieser Raum wirkte als einziger bereits bewohnt und strahlte, vielleicht wegen der silbernen Vorlegeplatten, die in einem Rosenholzregal standen, eine gewisse Behaglichkeit aus.
Emily verzichtete darauf, hinunter in die Küche zu schauen, wo sie um diese Uhrzeit sicherlich Mary Pollock, die Köchin, antreffen würde, die nur sehr widerstrebend ihr neues Reich bezogen hatte. Stattdessen drehte sie sich um und ging auf die Treppe zu, die in die oberen Räume führte.
Die Treppenstufen sowie der Treppenabsatz waren noch nicht mit Teppichen ausgelegt, und als sie gerade weiter ins Dachgeschoß hochsteigen wollte, hörte sie eine gedämpfte Stimme sagen: »Hier oben wirst du mich nicht finden, Emily.«
Lächelnd stieß sie die Tür zu Mrs. Arkwrights Schlafzimmer auf. »Wie konnten Sie wissen, daß ich es bin?«
»Inzwischen kenne ich deinen Schritt. Und zudem würde außer dir keiner mehr auf dem Speicher nach mir suchen. Du meine Güte, was die Leute alles wegwerfen! Stell dir vor, dort oben stehen doch tatsächlich zwei original Sheraton-Stühle. Die Mäuse haben sich zwar an den Sitzpolstern gütlich getan, aber was macht das schon? Ein Stückchen Stoff, und sie sind wieder wie neu ... Na, was guckst du so? Weil ich endlich meine alte Zinntruhe auf gemacht habe? Was da wohl drin sein mag, das interessiert dich schon seit Jahren, nicht wahr? Und vor dir hat es schon deine Mutter beschäftigt. Warum sie wohl immer in meinem Schlafzimmer stand, mit einem Chenilletuch zugedeckt, habt ihr euch gefragt, stimmt’s? Ja, ja, ich weiß Bescheid«, nickte die alte Dame mit wissender Miene und fuhr dann fort: »Nun, langer Rede kurzer Sinn, ich habe diese Truhe jahrelang aufbewahrt, quasi als Warnung für mich, nicht überkandidelt zu werden. Eines Tages, als ich ein bißchen Glück hatte, wollte ich sie ausmisten und den ganzen Kram wegwerfen. Das habe ich auch getan, sie ausgemistet und dann den Deckel zugeklappt. Und nun steht sie da und starrt mich an. Und weißt du, was sie mir sagt?«
Emily lächelte schüchtern und schüttelte den Kopf, ohne zu antworten.
»Sie sagt: ›Setz einen Teufel aufs Pferd, und es reitet direkt in die Hölle.‹ Und genau das habe ich nur zu oft bei Leuten erlebt, die zu ein bißchen Geld gekommen sind. Die vergessen dann mit einem Mal ihre Vergangenheit und ihre alten Freunde. Aber genug jetzt von mir. Wie ist es bei dir gelaufen?«
»Reibungslos. Die Möbel haben tatsächlich alle auf den Wagen gepaßt.«
»Das will ich meinen. Es war sehr töricht von dir, alles für nur fünf Pfund herzugeben. Fünfundzwanzig waren die Sachen allemal wert. Da waren ein, zwei wirklich gute Stücke dabei. Das Roßhaarsofa zum Beispiel, das ich deiner Mutter einmal geschenkt habe.«
Emily enthielt sich wohlweislich einer Bemerkung, denn dieses Sofa mit der stacheligen Füllung hatte ihnen jahrelang das Leben schwergemacht, zumal sie es nicht hatten weggeben können, weil sie immer damit rechnen mußten, daß Mrs. Arkwright doch einmal auf Besuch kam.
»Na, auf jeden Fall ist diese Episode deines Lebens nun endlich abgeschlossen«, sagte Mrs. Arkwright, die sich aus ihrer gebückten Haltung erhob und auf einem Stuhl neben der Truhe Platz nahm. »Sauber und gründlich. Das hättest du übrigens schon vor Jahren machen sollen. Ach, im Grunde hättest du dir diese Episode überhaupt ganz sparen können. Das habe ich dir immer gesagt. Aber du wolltest ja nicht auf mich hören.«
»Nein, wollte ich nicht«, pflichtete ihr Emily bei. »Aber ich habe meine Lektion gelernt, wie Sie mir immer prophezeit haben.«
»Ich wollte nur dein Bestes. Wirst du weiterhin seinen Namen tragen?«
»Nein. Ich nehme wieder meinen Mädchennamen an.«
»Das ist gut. Aber laß dich nicht mit Fräulein Ratcliffe anreden. Bleib bei Frau, und behalte auch deinen Ehering an. Der wird dich beschützen.«
Darüber mußte Emily lachen. »Wovor denn?«
»Stell dich nicht dümmer als du bist, meine Liebe. Und erzähl mir nicht, daß du dich nicht zuweilen im Schaufenster und in dem großen Spiegel betrachtest. Mit deiner Figur ...«
»Mit welcher Figur? Sie haben mir doch jahrelang eingeredet, ich hätte keine. Körbchen sollte ich mir zulegen, haben Sie gesagt«, kicherte sie und deutete auf ihre Brüste, »... damit da überhaupt eine Wölbung sichtbar wird.«
»Ja, das stimmt, manchmal bin ich nicht sehr feinfühlig.
Aber glaub mir, der Tag wird kommen, und zwar recht bald, da die breiten Achterdecks und die Fregatten mit ihren Oberweiten wie Schlachtschiffe in Seenot geraten, wie der alte Konteradmiral gesagt hätte. Ach, der Gute würde sich im Grab umdrehen, wenn er uns hören könnte«, lachte sie und verschluckte sich beinahe. »Weißt du noch, wie er immer mit zackiger Stimme Befehle brüllte, wenn er zu tief ins Glas geschaut hatte? Henry hieß doch der arme Kerl, den er dann zur Schnecke machte, erinnerst du dich?«
Emily lachte so herzlich, daß sie sich die Tränen aus den Augenwinkeln wischen mußte. »Und geflucht hat er wie ein Landsknecht. Aber wenn man ihn auf der Straße traf, war er ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle.«
»Ja«, nickte Mrs. Arkwright. »Er war ein Gentleman. Einmal hat er mir sogar die Hand geküßt, stell dir vor. Damals, als ich nebenan den Salon eröffnete und ihn zu einem Besuch einlud, damit er sich davon überzeugen konnte, daß er eine respektable Nachbarin bekommen hatte.«
Mrs. Arkwright hielt einen Augenblick inne, bevor sie dann mit nüchterner Stimme fortfuhr: »Und das hier ist ein anderer Gentleman... oder war es.« Sie reichte Emily eine Fotografie. »Du hast ihn noch nie gesehen, nicht wahr?«
Emily betrachtete das Bild. Es zeigte einen großen, sehr gutaussehenden Mann mit einem schmalen Oberlippenbart und vollem blonden Haar. Auf ihren fragenden Blick hin erklärte Mrs. Arkwright: »Er war in der Tat ein Gentleman, ein Ehrenmann par excellence. Und zwar in jeder Hinsicht. Und dabei so sanftmütig und freundlich. Das war mein Gemahl, mein Oscar.«
»Er sieht wirklich sehr... gut aus, sehr elegant«, erwiderte Emily leise.
»Ich werde dir jetzt etwas erzählen. Setz dich.« Mrs. Arkwright deutete auf den Sessel neben sich. »Das wollte ich schon seit langem tun, denn du weißt ja so gut wie nichts über meine Vergangenheit, stimmt’s?«
»Überhaupt nichts, um ehrlich zu sein«, gab Emily zu und schüttelte bedächtig den Kopf.
»Nun, meine Liebe. Ich war einmal Zofe. Ja, eine Zofe. Das hat sich ganz zufällig ergeben. Man hatte mich mit zwölf Jahren in Stellung geschickt. Die Familie gehörte zum gehobenen Mittelstand, war aber nicht von Adel. Nein, nein, die kamen nur durch ihr Geld zu Stand und Ehren.« Dabei verzog sie mißbilligend das Gesicht. »Unmöglich, daß man durch Geld allein in die Mittelschicht aufsteigen kann. Pah! Pah!« machte sie, und Emily beeilte sich, ihr zuzustimmen. »Wirklich unmöglich. Das sollte von Gesetzes wegen verboten werden.«
»Du sprichst mir aus der Seele. Um ein Haar wäre es auch tatsächlich dazu gekommen. Aber lassen wir das. Wie gesagt, mit zwölf ging ich in Stellung, arbeitete in der Küche und war mit siebzehn zweites Hausmädchen. Dann starb die Herrin – der Herr war schon einige Jahre vorher gestorben –, und zurück blieb deren einzige Tochter, Miß May. Sie war damals dreißig, ein richtiges spätes Mädchen und prüde bis in die Knochen. Eines Tages fuhr sie zu Freunden zum Tee. Unterwegs geriet sie jedoch in einen schweren Sturm und ließ sich wieder nach Hause fahren. Doch dort erwartete sie ein noch viel größerer Sturm, in Gestalt ihrer Kammerzofe, die sich mit einem der Lakaien vergnügte. Und wo, glaubst du, trieben sie es?« fragte Mrs. Arkwright mit gespannter Miene, die sie einige Sekunden lang hielt, bevor sie Emily aufklärte. »In Miß Mays Bett! O Gott, was für ein Tag! Ohnmachtsanfälle und Gezeter, im Haus war der Teufel los. Miß Elsie Wilson machte sich davon, so schnell sie konnte, aber schließlich mußte sich ja jemand um Miß May kümmern. Ich war wie gesagt zweites Hausmädchen. Das erste, Jane Battle, kam nicht in Frage, denn die hatte ständig eine Rotznase, und Miß May konnte ihren Anblick nicht ertragen. An wem, glaubst du, blieb es schlußendlich hängen, die Gnädigste zu beruhigen? An ihrer ergebenen Dienerin. Und so fing alles an. Sie mochte mich, und ich mochte sie – trotz ihrer Grillen. Drei Jahre später, auf einer Gartenparty bei Freunden, kreuzte ein Major der Indischen Armee ihren Weg, den man wegen eines Fußleidens in die Heimat entlassen hatte. Er war um die Vierzig, sie inzwischen dreiunddreißig. Obwohl allgemein bekannt war, daß Miß May sich bis dahin noch nie für einen Mann interessiert hatte, verliebte sie sich rettungslos in diesen Major und er in sie, und zwei Jahre später waren sie verheiratet.«
Sie drehte lächelnd das Bild ihres Gatten zwischen den Fingern und fuhr mit einem bedeutungsvollen Blick auf Emily fort: »Wie heißt es in der Bibel so schön? Es begab sich also ... daß sie ihre Flitterwochen in Südfrankreich verbrachten. Und es begab sich ebenfalls, daß der Major seinen Offiziersburschen mitnahm und die Lady ihre Kammerzofe.« Mrs. Arkwright tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Brust. »Und dieser Bursche war Oscar. Weißt du, Emily«, seufzte sie leise und legte die Fotografie zu den anderen zurück, ohne jedoch den Blick davon abzuwenden, »es gibt Zeiten im Leben, von denen man sagt, es seien die glücklichsten gewesen. Und in diesem Monat in diesem hübschen Hotel außerhalb von Nizza haben Oscar und ich uns verliebt. Er war zwölf Jahre älter als ich, es war ähnlich wie beim Major und der Lady, nur war ich damals dreiundzwanzig.«
Sie unterbrach sich für eine Weile, als müsse sie sich die längst vergangenen Tage noch einmal ins Gedächtnis rufen, bevor sie weitererzählte. »Ach, war das eine wunderschöne Zeit. Nach dem Dienst gingen wir lachend und plaudernd am Strand spazieren. Wir beide hatten immer etwas zu lachen. Und das Hotel, so gemütlich, und so nettes Personal. Wirklich, das waren wunderschöne Ferien, und eine Woche nach unserer Rückkehr nach England machte Oscar mir einen Heiratsantrag. Er mußte natürlich zuerst den Major fragen, aber der war einverstanden. Nicht so jedoch Miß May. Komisch, für mich blieb sie immer Miß May, denn die Heirat hatte sie kaum verändert. Sie gab sich weiterhin gouvernantenhaft, wenn du verstehst, was ich meine. Anfangs sagte sie, ich könne nicht bleiben, jetzt, da ich verheiratet war und möglicherweise Kinder bekommen würde, aber auf der anderen Seite wollte sie mich auch nicht verlieren. Na, offenbar hat der Major ein gutes Wort für mich eingelegt, denn sie behielt mich schließlich doch in ihrem Dienst. Ich höre sie noch heute sagen...« Mrs. Arkwright hob ihr Kinn und kräuselte die Lippen. »›Mabel‹, sagte sie. ›Ich hoffe, du hältst es nicht für nötig, eine Familie zu gründen‹ Komische Ausdrucksweise, nicht wahr? Und wir bekamen tatsächlich keine Kinder, obgleich es an Versuchen nicht gemangelt hat.«
Sie sah Emily jetzt wieder an. »Aber sie bekam ein Baby, die Ärmste, mit achtunddreißig, und starb dann bei der Geburt. Das Baby lebte noch zwölf Tage. Er war ein hübscher Junge. Der Major zerbrach schier an seinem Leid, denn er hatte Miß May wirklich sehr geliebt. Und von da an drehte sich unser Leben nur noch um den Herrn, der es nicht ertragen konnte, uns nicht in seiner Nähe zu wissen. Er sprach von nichts anderem mehr als von seiner Frau, obwohl er nie wieder ihren Namen in den Mund nahm. Offenbar war er der Meinung, daß ich sehr viel über sie wisse; ja, er glaubte sogar, ich sei mit ihr aufgewachsen. Unglücklicherweise hatte Miß May keine Angehörigen mehr.
Ich war zweiunddreißig/ als der Major starb, und Oscar vierundvierzig. Wir lebten damals in Northumberland im Geburtshaus des Majors. Little Manor hieß es, kein großes, dafür aber ein sehr gemütliches Haus, das weit außerhalb des Dorfes lag. Doch bei der Beerdigung folgten alle Dorfbewohner geschlossen dem Trauerzug, denn der Major genoß großes Ansehen bei den Leuten dort. Nun, was Oscar und mich betraf, wir wußten in jenen Tagen nicht, was aus uns werden sollte. Wir fühlten uns ganz verloren. Und dann wurde das Testament verlesen...«
Sie lehnte sich in ihrem Sessel zurück und schenkte Emily wieder einen bedeutungsvollen Blick. »Das Leben geht mitunter schon recht seltsame Wege. Wenn man glaubt, es geht nicht mehr weiter, öffnet sich irgendwo eine Tür, und plötzlich steht man mitten im hellen Sonnenschein. Und genauso erging es uns. Wir machten uns Sorgen um unsere Zukunft, mußten eine neue Stellung finden, besaßen außer unserer Uniform so gut wie nichts, denn wir hatten kaum etwas sparen können bei dem niedrigen Lohn, den wir bekamen. Schön, insgeheim rechneten wir damit, daß uns der Major eine kleine Summe hinterlassen würde. Aber viel konnte es nicht sein, dachten wir, denn der Major hatte in recht bescheidenen Verhältnissen gelebt. Nun gut, eines Tages saßen wir alle im Salon, wo der Notar das Testament des Majors verlas. Jeder Angestellte sollte die Summe von hundert Pfund erhalten, so verlangte es der Letzte Wille, und alle schienen damit zufrieden. Der Notar verlas daraufhin die Namen der Angestellten, aber unsere waren nicht darunter. Jeweils eintausend Pfund gingen an seinen Neffen und seinen Cousin. Dann nahm der Notar das nächste Blatt zur Hand und las: ›Meinem treuen Diener und Freund Oscar Arkwright vermache ich fünfhundert Pfund und alles, was ich an Schmucksachen besitze; seine Frau Mabel Arkwright, die sich nach dem Tod meiner Gattin so liebevoll um mich gekümmert hat, soll zweihundert Pfund erhaltene Siebenhundert Pfund für uns beide, stell dir das vor! Dazu seine Taschenuhr nebst Uhrkette, die Manschettenknöpfe und allerlei Kleinkram, alles außer seinen Medaillen. Die gingen zusammen mit dem Rest seines Vermögens an sein Regiment. Und weißt du, was Oscar und ich taten, als wir hörten, was er uns hinterlassen hat? Wir fingen beide hemmungslos an zu weinen. Oscar schluchzte freilich nicht laut los, aber die Tränen liefen auch ihm in Bächen über die Wangen. Und so war unsere Zukunft gesichert.«
Mrs. Arkwright unterbrach sich und holte tief Luft. »Ich wollte dir diese Geschichte schon lange erzählen. Und es gibt auch einen Grund, warum ich sie dir jetzt erzähle, aber davon später.«
»Oh, Mrs. Arkwright«, flüsterte Emily gerührt, indem sie sich erhob. Sie ging auf die ältere Frau zu, nahm deren Hände in die ihren und drückte sie herzlich. »Danke. Ich freue mich so, daß Sie mir das erzählt haben. Ich muß zugeben, daß ich mich zuweilen gefragt habe, wie Ihr Leben wohl verlaufen sein mochte und wie Sie das hier angefangen haben. Das klingt ja wie ein Märchen.«
»Nein, nein, meine Liebe, das war kein Märchen. Das war harte Arbeit, von Anfang an. Oscar fragte mich damals, was ich nun zu tun gedenke, und ich sagte ihm, daß ich gerne einen Hutsalon eröffnen würde. Oscar war sofort Feuer und Flamme für meine Idee. Also kauften wir unseren ersten Laden, und damit begann dann die eigentliche Arbeit. Deine Mutter war eine meiner ersten Putzmacherinnen; und dann kamst auch schon du. Nun, den Rest der Geschichte kennst du ja. Und am Ende habe ich doch noch bekommen, wovon ich so lange geträumt habe – ein eigenes Haus. Und das richten wir uns jetzt ganz gemütlich ein, du und ich.« Sie hob die Hand, strich sanft über Emilys Wange, und ihre Stimme nahm plötzlich einen beinahe flehenden Tonfall an, als sie sagte: »Du wirst doch bei mir wohnen, nicht wahr, meine Liebe?«
»Aber selbstverständlich. Es ist doch alles schon ausgemacht. Wo sollte ich denn sonst hin? Ich habe doch niemand außer Ihnen.«
»Haha!« machte Mrs. Arkwright und versetzte Emily einen recht groben Klaps. »Ich werde mich hüten zu sagen, daß du frei und ungebunden bist. Aber du bist ungebunden, und hübsch, sehr hübsch sogar. Und wenn es demnächst die Runde macht, daß du wieder zu haben bist, dann werden die Männer wie die Schakale ums Haus schleichen.«
»Ach, Unsinn. Und vergessen Sie nicht, was Sie einmal über mich gesagt haben.« Jetzt war die Reihe an Emily, den Zeigefinger zu erheben. »›Du bist nur hübsch, wenn du lächelst. Du solltest dir diesen steifen, überheblichen Gesichtsausdruck verkneifen.‹ Das waren Ihre Worte.«
»Ja, ganz recht, das habe ich gesagt«, gab Mrs. Arkwright zu. »In erster Linie, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie das auf die Kundschaft wirkt. Und ich habe dir auch gepredigt, daß du niemals die Kundinnen mit deiner Kleidung ausstechen noch dich ihnen überlegen zeigen darfst.«
»Das weiß ich alles, den Ratschlag haben Sie mir schon vor Jahren gegeben. Inzwischen habe ich noch eine Menge dazugelernt.«
»Ja, das hast du, meine Liebe ... Aber nun haben wir genug salbadert. Was hältst du von einer schönen Tasse Tee? Nein, warte, ich wollte dir ja noch etwas anderes zeigen.« Sie deutete auf einen alten, holländischen Kleiderschrank. »Mach mal auf. Dort drin liegt ein Hut. Mal sehen, ob man damit noch etwas anfangen kann.«
Emily öffnete die Schranktür und hielt unwillkürlich die Luft an, als ihr Blick auf den Hut fiel, der in einem der Fächer lag. Vorsichtig nahm sie ihn heraus und fragte: »Haben Sie den oben im Speicher gefunden?«
»Ja, in einer verstaubten Hutschachtel.«
»Gütiger Himmel! Und ich dachte immer, Strohhüte ohne Garnitur seien langweilig. Aber dieser hier ist eine Wucht! Und diese seltsame Farbe! Wie sie die wohl hingekriegt haben?«
»Das ist eine Mischung aus Weiß, Gelb und Hellbraun, würde ich sagen.«
»Er ist tatsächlich aus Stroh, aber dabei so steif.«
»Nun, den haben sie getaucht, nehme ich an, ansonsten wäre er nicht mehr so stabil. Na, was sagst du dazu?«
Emily besah sich den Hut ausgiebig von allen Seiten, bevor sie antwortete. »Ein sehr außergewöhnlicher Hut. Wunderschön. Und diese Farbe ... so eine Farbe habe ich noch nie gesehen. Eine Art Maisgelb, aber viel zarter.«
»Blaßgold würde ich es nennen.«
»Ja, richtig«, nickte Emily. »Blaßgold. Die Krempe ist ein bißchen verbogen, aber das ist ja verständlich, wenn er jahrelang in einer Schachtel lag. Ein Wunder, daß das Material nicht gebrochen ist.«
»Hm, das habe ich mir auch schon gedacht«, nickte Mrs. Arkwright. »Aber die Krempe läßt sich mit Dampf wieder geradebiegen. Womit sollen wir ihn denn garnieren?«
»Sie möchten ihn garnieren? Irgendwie finde ich ihn so nackt ganz schön«, kicherte Emily und fügte, als ihr bewußt wurde, was sie gesagt hatte, noch rasch hinzu: »Er sieht doch nackt aus, nicht wahr?«
»Ja, das tut er wirklich«, bestätigte Mrs. Arkwright und stimmte in Emilys Kichern ein. »Womit sollen wir ihn denn nun garnieren?«
»Wüßte ich im Augenblick nicht zu sagen. Komisch, aufgeputzt kann ich mir diesen Hut gar nicht vorstellen.«
»Gut, aber nackt läßt er sich wohl kaum verkaufen.«
Ganz spontan ging Emily auf die Frisiertoilette zu, nahm vor dem Spiegel Platz und setzte den Strohhut auf. Eine Weile betrachtete sie aufmerksam ihr Spiegelbild, drehte sich dann langsam auf dem Hocker, um sich Mrs. Arkwright zu präsentieren. »Lieber Himmel!« rief diese aus. »Der ist ja wie für dich gemacht. Die Farbe paßt genau zu deinem Teint.«
»Sie haben doch immer moniert, mein Teint sei so farblos.«
»Deshalb ja. Mit dem Hut kommt er jetzt erst so richtig zur Geltung, finde ich. Nun, sei’s drum, wir werden ihn bestimmt los. Am besten drapieren wir ihn auf dem Ständer gegenüber vom Eingang. Aber ein bißchen Garnitur würde ihm dennoch nicht schaden, meine ich.«
»O nein«, protestierte Emily und sprang auf. »Bitte, putzen Sie ihn nicht auf.«
»Das ist doch Unsinn«, erwiderte Mrs. Arkwright und rutschte bis zur Stuhlkante vor. »Kein Mensch in diesem Laden kann einen nackten Hut verkaufen; ohne Bänder, ohne Blumen oder Federn. Wie stellst du dir das denn vor?«
»Dann kreieren Sie einfach eine neue Mode.«
»Das würde dir so passen, wie? Nein, nein, irgend etwas muß auf den Hut.«
Emily nahm den Hut ab, setzte ihn auf die Hand und gab ihm einen leichten Schubs mit dem Finger, so daß er sich drehte. Dann murmelte sie leise, als spräche sie zu sich selbst: »Eine schlichte Schleife aus mattgrüner Seide, hinten gebunden, das könnte ich mir gerade noch vorstellen. Aber die Bänder dürfen nicht über die Krempe hängen und sich nur ganz schmal an die Krone schmiegen.«
Die beiden Frauen standen sich nun gegenüber und begutachteten den Hut, der sich immer noch auf Emilys Finger drehte. Und dann sagte Mrs. Arkwright ebenso leise: »Ja, ich glaube, du hast recht. Es muß ein zartes Grün sein, eine Art Apfelgrün. Und er muß einen Namen haben – der Hut, meine ich.«
»›Der Goldene Strohhut‹, wie finden Sie das?«
»Hm, nicht schlecht«, nickte Mrs. Arkwright. »Ja, Goldener Strohhut. Das ist gut. Willst du eine Wette darauf abschließen, wie lange es dauert, bis er in einer Schachtel den Laden verläßt?«
»Gut, ich wette zwei Shilling, daß er in einem Monat verkauft ist.«
»Und ich setze fünf Shilling dagegen, daß er in drei Monaten noch immer am Ständer hängt.«
»Abgemacht. Aber keine Garnitur; nur eine einfache Schleife, ja?«
»Ganz wie Sie befehlen: Nur eine Schleife. Hm, Moment mal... Was ist, wenn einer Kundin der Hut tatsächlich zusagt, sie ihn aber unbedingt bestücken lassen will?«
»Nun, dann müssen wir sie eben vom Gegenteil überzeugen, und zwar durch Blicke und das bewährte Schweigen, das lauter tönt als tausend Worte, wenn sie uns nach unserer Meinung fragt.«
»Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, wie ich sehe, Mrs. Ratcliffe.«
»Was Hüte betrifft... ja, da kenne ich mich aus. Und das habe ich hauptsächlich Ihnen zu verdanken, Madam Arkwright.«
»Jetzt aber raus mit dir«, rief diese und schob Emily sanft zur Tür. »Ich könnte hier verdursten, und keiner bringt mir eine Tasse Tee. Laß uns nach unten gehen. Aber ohne den Hut.« Mrs. Arkwright griff nach dem Strohhut und ließ ihn mit einem gezielten Wurf auf ihr Bett segeln. »Ich habe das unbestimmte Gefühl, daß ich meine fünf Shilling verlieren werde. Es wird mir noch leid tun, daß ich den Hut überhaupt gefunden habe. Nun geh schon, der Hut wird inzwischen nicht davonlaufen.«
Kapitel 2
»Was ist es, Doktor?«
»Ein Herzanfall.«
»O mein Gott!« Emily schüttelte langsam den Kopf. »Das ist eine ernste Sache.«
»In vielen Fällen ja, aber sie wird es überstehen. Sie muß sich nur schonen. Gibt es in der unteren Etage einen Raum, den man ihr als Schlafzimmer einrichten könnte? Wegen der Stufen, verstehen Sie?«
Emily dachte einen Augenblick nach. »Doch, natürlich, das Arbeitszimmer. Es ist zwar eine Art Durchgangszimmer zum Nachbarhaus, aber man könnte daraus ein hübsches Schlafzimmer machen.«
»Gut, würden Sie sich darum kümmern?«
»Aber selbstverständlich«, erwiderte Emily und erkundigte sich dann zaghaft: »Wird sie wieder gesund? Ich meine...«
»Ich weiß, was Sie meinen. Und Sie können beruhigt sein, Madam wird wieder gesund, wenn sie sich vorsieht. Das hier war so etwas wie eine Warnung. Alle Herzanfälle sind Warnungen. Das nächste Mal kommt sie möglicherweise nicht so glimpflich davon. Und da sie sehr anfällig ist für Bronchitis, sollte sie sich besonders schonen ... Hat sie sich in letzter Zeit über etwas Sorgen gemacht?«
»Nicht daß ich wüßte.«
Sie standen unten in der Diele, und nachdem der Arzt sich eine Weile interessiert umgeschaut hatte, meinte er: »Ich werde nie begreifen, warum sie dieses Haus auch noch mit dazunehmen mußte. Waren die Räumlichkeiten nebenan denn nicht schon ausreichend genug? Möchte Madam jetzt auch noch zur Großgrundbesitzerin avancieren?«
Emily, die den Doktor wegen seiner brüsken Art und seiner unverhohlenen Neugier nie recht hatte leiden können, sah ihm geradewegs ins Gesicht und antwortete, ohne direkt auf seine Frage einzugehen. »Madam wollte endlich ein privates Zuhause haben, abseits von dem Kommen und Gehen, das in einem Geschäftshaus unvermeidbar ist, und wo sie nicht ständig an ihre Arbeit erinnert wird.«
»Na ja, so wie es aussieht, hat sie diese Arbeit ja weit gebracht. Hüte. Erstaunlich, wieviel Geld man mit Hüten verdienen kann. Reiner Firlefanz, wenn Sie mich fragen: Manche der Damen sehen aus, als züchteten sie Blumen auf ihren Köpfen oder kämen gerade von der Jagd. Neulich sah ich eine, die trug tatsächlich einen ausgestopften Vogel auf ihrer Haube spazieren.« Er hatte inzwischen den Mantel angezogen, nahm jetzt seinen Hut von der Garderobe und sagte abschließend: »Manche Leute verstehen es eben, von der Eitelkeit anderer zu profitieren. Nun, sehen Sie zu, daß die Patientin sich ruhig hält. Ich schaue morgen wieder vorbei.«
Emily öffnete ihm die Tür. Sie sagte weder »Auf Wiedersehen« oder »Vielen Dank, Doktor«, sondern erwiderte nur kühl sein Abschiedsnicken. Doch zu ihrer Überraschung wandte er sich noch einmal zu ihr um. »Sie mögen mich nicht, nicht wahr? Aber seien Sie beruhigt, da sind Sie nicht die einzige.« Damit drehte er sich auf dem Absatz um und stieg in seine Kutsche.
Emily mußte an sich halten, daß sie die Tür nicht laut zuknallte, als sie wieder nach drinnen ging. Er hatte recht, sie konnte ihn wirklich nicht ausstehen. Dr. Smeaton hätte sich nie so benommen. Sein junger Kollege hatte noch viel zu lernen, was den Umgang mit Menschen anbelangte. Sie erinnerte sich noch genau an seine erste Visite hier, als er im Foyer nebenan gestanden und auf den Hutständer gestarrt hatte, auf dem der Goldene Strohhut zwischen zwei anderen, überreich bestückten Modellen hing. »Was ist denn mit dem passiert?« hatte er zynisch bemerkt. »Den hat man wohl vergessen anzuziehen.«
Ihre Wette hatte Emily verloren. Nur eine einzige Dame hatte den Strohhut aufprobiert und ihn dann gleich wieder mit dem vernichtenden Kommentar abgenommen: »Ich kann mir nicht vorstellen, daß dieser Hut überhaupt einer Frau steht, selbst mit Garnitur. Nein, diese ungewöhnliche Form; er ist viel zu groß und im Vergleich zu der Krone völlig unproportioniert.«
Warum es ihr ausgerechnet dieser Strohhut so angetan hatte, konnte Emily selbst nicht recht verstehen. Und als die drei Monate verstrichen waren und Mrs. Arkwright ihre Wette gewonnen hatte, hatte diese sich großzügig gezeigt. »Du kannst deine fünf Shilling behalten; und den Hut auch. Den schenke ich dir. Wie gesagt, es scheint, als habe man ihn eigens für dich gearbeitet, obwohl er schon etliche Jahre alt ist. Ich wundere mich nur, daß man ihn nicht bestückt, aber dennoch so sorgfältig verpackt hat.«
Jetzt lag dieser Hut in einer großen Schachtel in Emilys Schlafzimmer. Immer wieder einmal nahm sie ihn heraus und probierte ihn vor ihrem Spiegel auf. Und je öfter sie das tat, desto mehr verliebte sie sich in diesen Strohhut und fragte sich, warum Hüte immer so überladen sein müssen. Gut, die Modelle aus Filz für den Winter waren schlichter, nur eine Feder und ein paar Bänder, doch neuerdings verlangten die Damen auch in dieser Jahreszeit mehr Garnitur. Dabei fiel ihr der neueste Modeschrei ein, das Korsett, und sie dachte bei sich, daß der Erfinder dieses Folterinstruments ein Nachfahre der spanischen Inquisitoren sein mußte.
Als sie diese Ansicht einmal in Gegenwart von Madam Arkwright kundgetan hatte, erklärte diese lachend: »Oh, ich weiß schon, wie du darauf kommst. Du hast die Bücher gelesen, die unten im Bücherschrank stehen. Du bist schon ein merkwürdiges Mädchen, und ein überaus witziges dazu. The Ladies’ Journal schiebst du beiseite und steckst deine Nase lieber in diese Art von Literatur.«
Später an diesem Tag hatte Emily sich im Spiegel betrachtet und gedacht: »Ja, wahrscheinlich finden mich die anderen tatsächlich merkwürdig.« Aber was an ihr witzig sein sollte, das ging ihr nicht ein. Im Gegenteil, sie hegte eher düstere Gedanken, quälte sich mit einer Unmenge von Fragen, unter anderem nach dem Grund für ihr Gefühl von Einsamkeit, das ihr um so unbegreiflicher war, als sie den ganzen Tag über von den verschiedensten Menschen umgeben war. Was sie allerdings begriff, war, daß sie an dieses Geschäft gebunden war, an dieses Haus und an Mrs. Arkwright. Und war das so schlimm? Diese Frage hatte sie sich nie beantwortet, fiel ihr jetzt auf, sondern sich stattdessen stets hastig auf ihre täglichen Aufgaben gestürzt.
Auch jetzt machte sie sich wieder an ihre täglichen Pflichten. Zunächst einmal ging sie nach oben zu Mrs. Arkwright. »Ich kann diesen Menschen nicht ausstehen«, erklärte sie ihr unumwunden. »Und wissen Sie, was er gesagt hat?«
»Nein, was denn?«
»Nun, er streckte mir sein Gesicht entgegen, etwa so«, sie beugte sich über das Bett, »und sagte: ›Sie mögen mich nicht, nicht wahr?‹«.
»Das hat er nicht getan!« wehrte Mrs. Arkwright lachend ab.
»Doch, hat er. Und dann ist er von dannen stolziert.«
»Nicht zu glauben! Und hat er sonst noch etwas gesagt? Über mich, meine ich. Kann ich mir einen Sarg bestellen?«
»Ja, in fünfzehn bis zwanzig Jahren, würde ich mal sagen. Aber mit der Wahl des Holzes sollten Sie noch warten.«
»Er glaubt wohl, ich simuliere, wie?«
Emily wurde wieder ernst. »Nein, das glaubt er nicht. Sie hatten einen Herzanfall, und wenn Sie nicht noch einen haben wollen, dann müssen Sie sich jetzt wirklich schonen, Madam. Und noch etwas. Er hat angeordnet, daß Sie von jetzt ab unten schlafen. Kein Treppensteigen mehr.« Sie hob die Hand, um etwaige Proteste abzuwehren. »Ist ja nur vorübergehend. Ich werde Molly Stock Bescheid sagen, daß sie das Arbeitszimmer für Sie herrichtet.«
»Das wirst du hübsch bleibenlassen.«
»Nein, das wird so gemacht, Mrs. Arkwright. Jeder Widerstand ist zwecklos.«
Mabel Arkwright ließ schmollend den Kopf sinken, und als kein weiterer Kommentar von ihr folgte, setzte sich Emily zu ihr aufs Bett, nahm ihre Hand und sagte sanft: »Es ist ja nicht für ewig. Das Arbeitszimmer liegt gleich neben dem Laden, und so kann ich immer mal schnell bei Ihnen rein und raus huschen und Sie über alles auf dem Laufenden halten. Und wenn Sie wieder bei Kräften sind, dann sind es nur wenige Schritte, und Sie können uns nebenan wieder herumkommandieren.«
»Richtig!« sagte sie. »Jemand muß hier ein eisernes Regiment fuhren. Du bist nicht energisch genug.«
»Nun, vielleicht nicht in Ihrer Gegenwart. Aber Sie sollten mich mal sehen, wenn ich alleine bin. Im Augenblick ist es jedoch gar nicht nötig, jemandem Beine zu machen. Die Arbeiterinnen machen ihre Sache bestens; Sie haben wirklich Glück gehabt. Die Damen sind alle sehr betroffen. Sie können sich gar nicht vorstellen, daß Sie tatsächlich krank sind. Für sie ist es, als läge der liebe Gott mit Masern darnieder.«
Emily sprang von der Bettkante auf und rang flehend die Hände: »Bitte, lachen Sie nicht so, Madam!« Aber sie mußte selbst kichern. »Ich sollte nicht solche dummen Witze machen.«
Mabel Arkwright hatte die Hände auf die Brust gelegt und brachte mit erstickter Stimme heraus: »Lachen ist immer noch die beste Medizin. Du bist wirklich manchmal zu komisch. Kein Mensch würde hinter der damenhaften Pose, die du zur Schau trägst, solche Sprüche von dir erwarten.«
»Das kommt von meiner gewöhnlichen Herkunft.«
»Unsinn. Deine Mutter war nicht gewöhnlich. Ihren Schilderungen nach zu urteilen war dein Vater ein Gentleman wie mein Oscar ... Emily?«
»Ja, Madam?«
»Warum passieren einem solche Dinge wie jetzt? Gerade habe ich ein Haus gefunden, wie ich es mir immer erträumt habe. Es ist zwar nicht vergleichbar mit Miß Mays Haus, zugegeben, aber es besitzt ein gewisses Flair von ... nun, ich weiß nicht recht, wie ich sagen soll.«
»Von Raffinesse?«
»Ja, ja«, nickte Mrs. Arkwright. »Raffinesse, das ist der richtige Ausdruck. Aber ohne Schnickschnack. Du hast mir einmal gesagt, du könntest verschnörkelte Kaminsimse, Büffelhörner an der Wand und winzige Beistelltischchen, auf denen man nicht einmal eine Nadel flach hinlegen kann, nicht leiden.«
»Das habe ich gesagt?«
»Ganz recht. Deine Mutter hat vor Jahren einmal in einem dieser großen Häuser am Strand eine Bestellung ausgeliefert. Die Besitzer waren nicht zu Hause, und das Dienstmädchen hat dich und deine Mutter voller Stolz durchs Haus geführt. Und du fandest es entsetzlich.«
»Daran kann ich mich nicht mehr erinnern.«
»Du warst damals auch erst vierzehn. Aber ich habe deine Worte nicht vergessen und hier im Haus als erstes die Schnörkel vom Kaminsims schlagen lassen. Und so gerne ich auch die Wände mit Büffelhörnern dekoriert hätte, ich habe es mir wohlweislich verkniffen, wie du siehst.«
Sie lachten beide wieder, aber etwas verhaltener diesmal. Dann streckte Mrs. Arkwright ihre Hand aus, legte sie auf Emilys Wange und zog sie zu sich herab, um ihr einen Kuß zu geben. »Das habe ich noch nie getan«, sagte sie mit belegter Stimme. »Aber man soll gewisse Dinge nicht aufschieben, noch Worte zurückhalten, die man aussprechen möchte, denn man weiß nie, wie lange man noch Gelegenheit dazu hat. Deshalb sage ich jetzt, was ich dir schon lange sagen wollte: Seit du vor wenigen Monaten dein Leben grundlegend geändert hast und nun bei mir wohnst, fühle ich mich so wohl und zufrieden, wie ich mich seit dem Tod meines lieben Oscars nie mehr gefühlt habe. Ich habe die Tochter bekommen, die ich nie hatte. Zu wissen, daß du bis zum Ende meiner Tage bei mir bist, das bedeutet mir mehr, als du dir wahrscheinlich vorstellen kannst.«
Emily war es unmöglich zu sprechen. Sie preßte die Lippen aufeinander und hastete zur Tür. Dort holte sie Mrs. Arkwrights Stimme ein, die nun wieder den alten, etwas bissigen Klang angenommen hatte. »Aber ich bin erst zweiundsechzig, und es kann gut sein, daß du dich noch zehn oder fünfzehn Jahre mit mir rumplagen mußt. Denk an das alte Mädchen und den alten Knaben am Ende der Straße, die jeden Tag bei Wind und Wetter darauf bestehen, daß man sie im Korbstuhl durch den Park schiebt. Die sind angeblich schon über achtzig. Dir steht also noch einiges bevor.«
Emily drehte sich noch einmal um und entgegnete feixend: »Ach wo, in diesem Fall werde ich ein ganzes Heer von Pflegern engagieren, während ich im Park nach Männern Ausschau halten werde, wie es jeder geschiedenen Frau in meinem Alter zukommt. So, jetzt bleiben Sie hübsch liegen und brüten über meine Worte nach.«
Unter beiderseitigem Gekicher verließ Emily das Schlafzimmer und blieb dann vor ihrer eigenen Zimmertür einige Sekunden lang stehen. Zehn, fünfzehn Jahre ... das könnte passieren, dachte sie und hatte plötzlich eine Zukunft vor Augen, die sich zwischen Hüten und einer täglich tiefer in die Senilität abgleitenden Mrs. Arkwright abspielte.
Doktor Montane, der am nächsten Tag zur Visite kam, erklärte, er sei mit dem Zustand der Patientin zufrieden. Sie dürfe in ihr neues Schlafzimmer umziehen, müsse allerdings noch eine Woche das Bett hüten.
Als er sich von Mrs. Arkwright verabschiedete, fragte ihn diese: »Wie wär’s mit einem Täßchen, Doktor?«
»Kaffee?« Er drehte sich zu ihr um, und auf seinem Gesicht erschien ein kleines Lächeln. »Gerne, da sage ich nicht nein. Bei der Kälte.«
»Kaffee mit Schuß dann?«
»Mit Schuß?« Seine Brauen machten einen Satz, und seine vollen Lippen kräuselten sich zu einer Schnute. »Nein, vielen Dank. Nicht zu dieser Tageszeit. Nach dem Dinner ist das etwas anderes. Da lasse ich mich gern zu einem Täßchen mit Schuß überreden.«
Er lächelte jetzt, als er sich zu Emily umwandte, die ihm die Tür aufhielt. Auf seine Frage »Schätzen Sie Kaffee mit Schuß?« antwortete sie: »Ja, hin und wieder.«
»Ts, ts, wer hätte das gedacht«, nuschelte er, winkte Mrs. Arkwright noch einmal zu und verließ mit Emily das Schlafzimmer. Auf der Treppe sagte Emily zu ihm: »Wenn Sie mir in den Salon folgen möchten, lasse ich Ihnen dort den Kaffee servieren, ohne Schuß.«
»Oha! Die Dame gibt sich aber sehr steif.«
»Wie bitte?«
»Sie haben schon richtig verstanden. Sie geben sich sehr steif, sagte ich, verschmähen jedoch selbst ein Täßchen mit Schuß nicht. Na ja, Leben heißt lernen.«
»In diesem Fall kann ich Ihnen nur ein langes Leben wünschen, Doktor, denn Sie haben noch sehr viel zu lernen – besonders Takt.«
»Was Sie nicht sagen«, murmelte er, während sie den Salon betraten. Die nächste Bemerkung, die er machte, schien an niemand Besonderen gerichtet zu sein: »Hm, ein bißchen anders als zu Lebzeiten des Admirals. Definitiv war hier weiblicher Geschmack am Werk, aber ohne Plüsch und Troddeln. Mutet beinahe doch ein wenig männlich an, was meinen Sie?« Als er keine Antwort erhielt, stellte er fest, daß er sich allein im Raum befand.
Emily war bereits unten in der Küche. »Mary, kochen Sie dem Doktor bitte eine Tasse Kaffee. Schwarz und stark. Alice soll sie ihm dann in die Bibliothek bringen.«
»Oh! Doktor Montane ist hier?«
»Ja, ist er. Und jeder scheint sich darüber zu freuen.«
»Sie mögen ihn nicht, hab’ ich recht, Miß?«
»Nein, ich mag ihn nicht, Mary.«
»Seltsam. Wo er doch einen so guten Ruf hat. So sagt man wenigstens. Behandelt die Armen ganz umsonst.«
»Mein Gott, dann gehört ihm ja ein Orden ans Revers geheftet! Sie sollten nicht alles glauben, was die Leute so reden, Mary.«
Die Köchin ließ ein kehliges Kichern hören und meinte: »Er bekommt seinen Kaffee, aber ein Kännchen Sahne darf ich ihm doch dazustellen, oder? Und wie geht es Madam?«
»Recht gut. Wir werden sie nachher nach unten bringen.«
»Ach, welch ein Segen! Endlich Schluß mit dem ewigen Treppensteigen. Alice ist schon ganz fußlahm. Übrigens, ich wollte einmal mit Ihnen reden, Miß. Wir sollten noch ein zweites Mädchen einstellen. Die arme Alice springt von morgens bis abends hier im Haus herum wie eine Katze mit verbrühten Pfoten.«
»Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich werde mit Mrs. Arkwright darüber sprechen, Mary.«
»Vielen Dank, Miß. Das werden wir Ihnen nicht vergessen. Madam ist in Sachen Personal gerne etwas sparsam.«
Sie tauschten einen wissenden Blick, der keine Antwort erforderte. Emily verließ die Küche. Mary hat recht, dachte sie bei sich, als sie die Marmorstufen hochstieg. Mrs. Arkwright war, was das Personal anbelangte, tatsächlich recht knauserig, obwohl sie ansonsten sehr großzügig war, auch mit den Löhnen. Dafür verlangte sie allerdings auch exzellente Arbeit. In ihrem ersten Lehrjahr hatte sie keinen Lohn erhalten, dafür aber täglich einen Teller gute Suppe. Später hatte sich ihr Lohn jährlich gesteigert. Heute verdiente sie 50 Pfund im Jahr, aß und wohnte gratis und bekam, was noch mehr zählte, ihre Garderobe und Hüte von Mrs. Arkwright geschenkt. Sie konnte sich glücklich schätzen, ja, sehr glücklich sogar.
Auf dem Weg nach oben zu Mrs. Arkwright entschied sie, dem Doktor noch rasch Bescheid zu sagen, daß der Kaffee unterwegs sei. Sie fand ihn vor dem Geschirrschrank stehen. »Dresdner Porzellan, nicht wahr? Und ein komplettes Teeservice von Spode«, erklärte er, ohne sich umzuwenden.
»Ja, so sagte man mir.«
»So, so. Sagte man Ihnen. Sie selbst verstehen wohl nichts von Porzellan, wie?«
»Niemand versteht irgend etwas von bestimmten Dingen, bevor man ihn nicht darüber aufgeklärt hat. Das fängt im Kindesalter an. Kindern muß man doch auch erst alles beibringen, oder etwa nicht?«
»Da haben Sie recht. Aber manche Kinder sind klüger als andere. Manche schlucken nicht alles, was man ihnen eintrichtert, sondern fragen nach. Wenn man mir zum Beispiel gesagt hätte, daß dies ein Spode-Service sei, so hätte ich wissen wollen, wo die Manufaktur liegt und wie genau es hergestellt wird. Nicht nur schlucken – nachfragen muß man.«
»Ja, ja. Das stimmt wohl. Und Sie gehören gewiß zu den Menschen, die immer und überall nachhaken.«
»Und Sie haben bestimmt einen anderen Tick.«
»Was?«
»Oh, Sie sagen ›Was?‹ und nicht ›Wie bitte?‹. Junge Damen fragen höflich ›Wie bitte?‹, ›Was?‹ sagen nur gewöhnliche Leute, und so sehen Sie mir gar nicht aus... Vorsicht! Aus dem Weg!« rief er und wedelte mit der Hand. »Das Tablett!«
Emily hatte Alice nicht reinkommen hören und trat rasch einen Schritt zur Seite, ohne den Blick von ihrem unverschämten Gegenüber zu wenden.
Alice stellte das Tablett auf dem Tisch ab und verkündete dann mit einem strahlenden Lächeln: »Die Köchin hat Ihnen ein paar Scones dazugelegt. Ganz frisch aus dem Ofen, Herr Doktor.«
»Bestellen Sie der Dame meinen besten Dank. Das war überaus aufmerksam von ihr. Zumal ich heute auf mein Frühstück verzichten mußte, da ich einem neuen, glücklichen Erdenbürger auf die Welt geholfen habe. Wenn es nach der Mutter gegangen wäre, dann wäre es nie dazu gekommen. Richten Sie ihr das aus.«
»Das werde ich, Herr Doktor. Das werde ich.«
Lächelnd verließ Alice die Bibliothek, und auch der junge Doktor lachte. Emilys Wangen nahmen hingegen eine rötliche Färbung an. Dieser ungehobelte Kerl hatte es offenbar darauf angelegt, sie zu schockieren. Mit der Erwähnung dieser Geburt glaubte er wohl, die sensiblen Gefühle einer jungen Frau verletzen zu können. Ihrer Meinung nach hätte dieser Rüpel niemals Arzt sein dürfen; oder zumindest nicht praktizieren dürfen, solange er nicht wußte, wie man mit Menschen umgeht. Aber abgesehen von seinen ungehobelten Manieren gab es noch etwas, was ihr an diesem Mann aufstieß.
Sie merkte, daß sie rot geworden war, und das ärgerte sie nur noch mehr. Bemüht, sich nichts anmerken zu lassen, erwiderte sie betont lässig: »Nun, ich denke, wenn Ihre Patientin so lange in den Wehen gelegen hat, dann wäre es doch Ihre Pflicht gewesen, sie in ein Krankenhaus zu bringen, wo sich Spezialisten ihrer annehmen und eventuell eine Steißgeburt hätten einleiten können.«
Einen Augenblick lang fühlte Emily sich dem Doktor überlegen, denn seine Brauen hatten wieder einen erstaunten Satz gemacht, und sein Mund stand offen. Doch dann meinte er herablassend: »Man höre und staune, da spricht ja doch ein menschliches Wesen! Und Sie lesen Zeitung; speziell die Artikel, die nicht für die Augen von jungen Damen bestimmt sind. Ja, ja. Wir leben, um zu lernen. Ich weiß, daß junge Damen so was gerne heimlich lesen, aber freimütig darüber sprechen, das würden sie niemals wagen!«