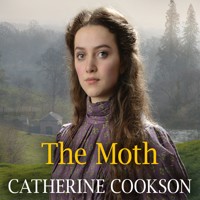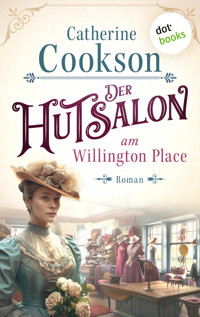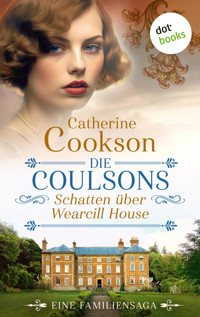5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Zwischen der rauen Landschaft Northumberlands und dem glanzvollen London – eine junge Frau in den Stürmen des Schicksals … Anfang des 20. Jahrhunderts wächst Marie Anne behütet als Tochter wohlhabender Eltern auf. Doch als sie 14 ist, verändert ein einziger Moment alles: Marie Anne sieht etwas mit an, das nicht für ihre Augen bestimmt ist. Sie rennt davon, stürzt – und wird ausgerechnet von dem Mann gerettet, den alle hinter vorgehaltener Hand nur »den Gebrandmarkten« nennen. Marie Anne spürt instinktiv, dass sich hinter seinen Narben eine Geschichte verbirgt, die sich zu ergründen lohnt. Kurz darauf wird sie jedoch nach London geschickt, um in der Obhut ihrer strengen Tante zur perfekten Dame heranzureifen. AberMarie Anne will nicht länger still und gehorsam sein – ihr Herz liegt in Northumerland und dorthin will sie um jeden Preis zurückkehren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 763
Ähnliche
Über dieses Buch:
Anfang des 20. Jahrhunderts wächst Marie Anne behütet als Tochter wohlhabender Eltern auf. Doch als sie 14 ist, verändert ein einziger Moment alles: Marie Anne sieht etwas mit an, das nicht für ihre Augen bestimmt ist. Sie rennt davon, stürzt – und wird ausgerechnet von dem Mann gerettet, den alle hinter vorgehaltener Hand nur »den Gebrandmarkten« nennen. Marie Anne spürt instinktiv, dass sich hinter seinen Narben eine Geschichte verbirgt, die sich zu ergründen lohnt. Kurz darauf wird sie jedoch nach London geschickt, um in der Obhut ihrer strengen Tante zur perfekten Dame heranzureifen. Aber Marie Anne will nicht länger still und gehorsam sein – ihr Herz liegt in Northumberland und dorthin will sie um jeden Preis zurückkehren …
Über die Autorin:
Dame Catherine Ann Cookson (1906–1998) war eine britische Schriftstellerin. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern gehörte sie zu den meistgelesenen und beliebtesten Romanautorinnen ihrer Zeit; viele ihrer Werke wurden für Theater und Film inszeniert. In ihren kraftvollen, fesselnden Schicksalsgeschichten schrieb sie vor allem über die nordenglische Arbeiterklasse, inspiriert von ihrer eigenen Jugend. Als uneheliches Kind wurde sie von ihren Großeltern aufgezogen, in dem Glauben, ihre Mutter sei ihre Schwester. Mit 13 Jahren verließ sie die Schule ohne Abschluss und arbeitete als Hausmädchen für wohlhabende Bürger sowie als Angestellte in einer Wäscherei. 1940 heiratete sie den Gymnasiallehrer Tom Cookson, mit dem sie zeitlebens zurückgezogen und bescheiden lebte. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1950; 43 Jahre später wurde sie von der Königin zur Dame of the British Empire ernannt und die Grafschaft South Tyneside nennt sich bis heute »Catherine Cookson Country«. Wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag starb sie als eine der wohlhabendsten Frauen Großbritanniens.
Bei dotbooks veröffentlichte Catherine Cookson auch ihre englischen Familiensagas »Die Thorntons – Sturm über Elmholm House«, »Die Emmersons – Tage der Entscheidung«, »Die Coulsons – Schatten über Wearcill House« und »Die Masons – Schicksalsjahre einer Familie«.
Bei dotbooks erscheinen außerdem ihre Schicksalsromane »Das Erbe von Brampton Hill«, »Sturmwolken über dem River Tyne«, »Sturm über Savile House«, »Der Himmel über Tollet’s Ridge«
und »Der Hutsalon am Willington Place«.
***
eBook-Neuausgabe Mai 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »The Branded Man«. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Heimkehr ins Herrenhaus« im Heyne Verlag.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1996 by The Catherine Cookson Charitable Trust
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/HiSunnySky, Erik Laan und AdobeStock/Cary Peterson
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-159-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Lawsons« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Catherine Cookson
Die Lawsons – Anbruch einer neuen Zeit
Eine Familiensaga
Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Schulte-Randt
dotbooks.
TEIL I
Kapitel 1
Marie Anne konnte nicht glauben, was sie da beobachtete. Von ihrem Platz im tiefen Schatten der Eibenhecke blickte sie über die schmale Rasenfläche auf die beiden Gestalten, die vom hochstehenden Sommermond beschienen wurden. Sie lehnten an einem alten Weidenbaum, dessen rauhe Borke sich schartig im Gegenlicht abzeichnete, als wäre das Muster mit einem Taschenmesser hineingeritzt worden. Die Frau war ihre Schwester Evelyn, das wußte Marie Anne. Und sie wußte auch, daß sie Evelyn zutiefst haßte und daß dies auf Gegenseitigkeit beruhte. Und dann der Mann, der bei ihr war ... ausgerechnet dieser. Das durfte nicht wahr sein! Robert Cranford! Er gehörte zu The Grange und war ein Cousin zweiten Grades von Mrs. Cranford, wie es hieß. Nach seiner Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt erholte er sich derzeit auf dem Wohnsitz der Familie von einem Fieber. Robert sah gut aus, und wenn er sprach, klang das so angenehm, daß Marie Anne ihm gerne zuhörte. Sie hatte ihn einmal getroffen, und bei diesem Anlaß hatte er sich mit ihr unterhalten und war sehr nett gewesen. Anschließend dachte sie nächtelang an Robert. O ja, ganze Nächte war er ihr nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und erst recht nicht, seit er am vergangenen Samstag beim Familienpicknick auf dem Gelände von The Grange ihr Haar berührt und gesagt hatte, es sehe aus wie poliertes Kupfer. Evelyn war auch dabei gewesen; aber mit ihr hatte Robert kaum gesprochen, und dennoch – die Worte hallten noch immer in ihrem Kopf wider – hatten beide Marie Anne nur benutzt. Evelyn hatte ihrer Mutter gesagt, es wäre gefährlich für Marie Anne, das Gelände von The Grange zu verlassen und zum Fluß hinunterzugehen, denn auf dem Feld von Farmer Harding lagerten Zigeuner.
In letzter Zeit war es bereits dreimal vorgekommen, daß Marie Anne etwas mit Evelyn unternahm und plötzlich Robert Cranford auftauchte. Bei einem dieser Zusammentreffen war Marie Anne zur Grenzmauer gerannt, um zum Zigeunerlager hinüberzuschauen, und als sie zurückkehrte, standen die beiden dicht beieinander und lachten.
Marie Anne blieb der Mund offenstehen, als sie beobachtete, wie ihre Schwester die Hände ausstreckte und das Gesicht des Mannes umfaßte. Dann bog Evelyn ruckartig den Körper vor, während Robert sie fest an sich riß. Ihre Gesichter verschmolzen miteinander, und Marie Anne schloß die Augen, da sie den Anblick nicht ertrug. Das war zuviel für sie. Robert war so nett zu ihr und Evelyn gewesen. Und jetzt? Oh, wie sie Evelyn haßte und verachtete. Evelyn, die von ihrer Mutter immer als leuchtendes Vorbild hingestellt wurde.
Als Marie Anne die Augen wieder öffnete, standen die beiden nicht mehr gegen den Baum gelehnt, sondern ein Stück davon entfernt, und Evelyns hatte den Kopf zurückgelegt, als würde sie vor Robert zurückweichen. Gleichzeitig aber ließ ihre Schwester zu, daß er sie berührte. Oh, lieber Gott! Gott im Himmel! Was sollte Marie Anne nur machen? Sollte sie sich auf die beiden stürzen? Das durfte er nicht tun! Es war schlecht, eine schlimme Sünde. Er hatte seine Hände unter die Sommerbluse ihrer Schwester geschoben, die nahezu aufgeknöpft war. Wieder schloß Marie Anne die Augen und krallte die Hände in der Eibenhecke, bis die zerdrückten Blätter in ihre Handflächen stachen. Sie mußte fort von hier, zurück zum Haus rennen und jemandem davon erzählen.
Sei nicht albern, blamiere dich nicht, hörte Marie Anne eine innere Stimme. Sie kannte dieses Gefühl, das sie oft in ihrem Drang bremste, einfach loszulaufen. Besonders, wenn sie müde war und noch immer das Bedürfnis verspürte, einfach davonzustürmen. Nur in The Little Manor, dem Kleinen Herrenhaus, das ganz in der Nähe lag und der Wohnsitz ihres Großvaters war, genoß sie uneingeschränkte Freiheit.
Als Marie Anne die Augen wieder öffnete und zu dem Paar hinüberblickte, standen die beiden nicht mehr aufrecht.
Im nächsten Augenblick – und nur für eine Minute – sah Marie Anne einen Mann ohne Unterhose, und die Beine ihrer Schwester waren bis zu den Oberschenkeln entblößt, während beide sich verhielten, als wären sie Tiere auf der Weide oder ungenierte Hofhunde.
Den Saum ihres Kleides hochhebend, fuhr Marie Anne auf dem Absatz herum und rannte durch die kurze Eibenallee in den Wald.
Aber sie schlug nicht den Weg zu den Gärten des Herrenhauses ein, sondern schlüpfte durch ein Loch in der Grenzmauer und floh über die Felder, bis sie den Fluß erreicht hatte. Dort überkam sie ein großes Verlangen, sich ins Wasser zu stürzen und überall zu waschen, ohne dabei ihren Körper anzusehen. Nie wieder wollte sie einen Blick auf ihren Körper werfen, niemals im Leben. Atemlos keuchend blieb Marie Anne stehen. In ihrer Brust spürte sie einen heftigen Schmerz. Und in einem weiteren Punkt war sie sich sicher: Die Gegend um das Baumhaus würde sie nie wieder betreten. Früher einmal hatte es oben in den Ästen ein schönes Baumhaus gegeben, bis Pat herunterfiel und sich den Arm brach. Vincent hatte Marie Anne die Leiter hinaufgetragen und sie oben mit brutaler Gewalt auf einen Ast geschoben. Damals war sie sechs Jahre alt gewesen, und ihr kam es vor, als hätte sie ihr Leben lang mit ihrem Bruder gekämpft. Es hatte jedes Mal damit begonnen, daß er sie kitzelte, bevor er sie vom Boden hochhob, ihr ins Gesicht starrte und sie als elendes Balg beschimpfte. Aber an jenem Tag hatte Marie Anne geschrien, daß es durch den ganzen Wald hallte, und ihr Großvater hatte daraufhin angeordnet, das Baumhaus abzureißen.
Von da an schien, von ihr selbst abgesehen, niemand mehr das kleine Rasenstück und den einsam stehenden Baum aufzusuchen. Wann immer Marie Anne vermißt wurde, nahm man an, sie würde irgendwo auf dem Gelände umherrennen. Und das, obwohl man sie meist auf dem Boden sitzend fand, mit dem Rücken an den Baum gelehnt, während sie bizarre Skizzen von Vögeln und Tieren anfertigte.
Später, als sie auf die Schule von Miß Taggert in Hexham geschickt wurde, endete auch diese Zeit, weil Marie Anne fortlief. Sie war nicht wirklich ausgerissen, sondern einfach in einen Zug gestiegen und nach Hause zurückgefahren.
Danach berieten sie wieder darüber, Marie Anne wegzuschicken, doch es war noch nicht beschlossen, wohin. Ihre Mutter sprach sich für Tante Martha in London aus, wo Marie Anne ihre musikalische Ausbildung fortsetzen sollte, denn wenn sie etwas gut konnte, dann war es Klavier spielen. Bereits als kleines Kind hatte sie Melodien spielen gelernt, ohne die Noten zu kennen.
Marie Anne wollte sich eben an das Flußufer setzen, als sie durch ein Rascheln im Unterholz hinter sich aufgeschreckt wurde. Da sie tatsächlich Schritte hörte und eine große Gestalt entdeckte, die sich langsam vom Gebüsch ablöste und ins Mondlicht trat, stieß das junge Mädchen einen Schrei aus, der wie das Kreischen eines Tieres klang, das in der Falle saß. Wieder rannte Marie Anne blindlings und mit gesenktem Kopf davon.
Sie erinnerte sich nicht mehr, daß sie gestolpert war, sondern nur noch daran, wie etwas gegen ihren Kopf schlug.
Als sie wieder zu sich kam, öffnete Marie Anne nicht sofort die Augen. Sie spürte lediglich, daß sie auf hartem Untergrund lag. Bei dem Versuch, sich zu bewegen, stöhnte sie auf, da ihr Fuß schmerzte, doch erst das unheimliche Gesicht, das sich plötzlich über sie beugte, ließ sie laut aufschreien. Als die Person zu sprechen begann, verlor Marie Anne erneut das Bewußtsein.
Als nächstes nahm sie erst wieder wahr, wie sie sanft von einer Seite auf die andere bewegt wurde. Sie hätte es als angenehm empfunden, wäre nicht der Schmerz in ihrem Kopf gewesen, der jetzt bis in ihren Fuß hinunter ausstrahlte.
Es war beinahe zehn Uhr, und das Haus befand sich noch immer in Aufruhr, als Robert Green, der Lakai und Hausdiener, dem zweiten Hausmädchen Fanny Carter erzählte, wie er gerade die Eingangshalle durchquert hatte, als er ein lautes Klopfen an der Vordertür vernahm. Er öffnete, doch niemand war zu sehen. Aber auf der Stufe lag ein Blatt Papier. Und obwohl die Zufahrt vor dem Haus in Mondlicht getaucht und taghell war, konnte er niemanden entdecken. Wer immer die Nachricht abgeliefert hatte, war anscheinend in den Büschen verschwunden. »Nun, auf dem Papier stand etwas gekritzelt«, sagte Green. »Aber ich konnte nichts Genaues erkennen.« Niemals hätte er zugegeben, daß er nicht lesen konnte. »Mr. Pickford«, fuhr er fort, »war bereits schlafen gegangen, da heute sein freier Tag war. Aber ich mußte ihn trotzdem wecken, worüber er sich nicht gerade erfreut zeigte. Nun, wieso auch? Er hatte einen ziemlich schweren Kopf, wie immer an seinem freien Tag, denn da betrinkt er sich jedesmal. Auf alle Fälle sagte er, daß er die Schrift auch nicht entziffern könne. Das war zu erwarten, nicht wahr?«
»Ja, natürlich«, bestätigte Fanny und fügte belehrend hinzu: »Ich kann dir sagen, was das Beste gewesen wäre, Robert. Als nächstes hättest du hinausgehen und Peter Crouch wecken sollen, damit er den Zettel liest. Es ist zum Lachen, wenn man darüber nachdenkt. Crouch ist nur ein einfacher Hofgehilfe und trotzdem der Einzige von uns, der lesen kann.«
»Nun«, sagte Robert Green, »das kann er auch nur, weil er in einem Heim aufgewachsen ist, das gerade mal ein wenig besser war als ein Arbeitshaus, und dort hat man es ihm eingeprügelt, wenn du mich fragst.«
»Ja, mag sein. Und deshalb laßt ihr noch heute jeden Ärger an ihm aus. Aber erzähl weiter, was als nächstes passiert ist.«
»Nun, er las den Zettel, und wir wollten kaum glauben, was darauf geschrieben stand. ›Ihre Tochter liegt verletzt unten an der Mauer am Fluß. Sie braucht Hilfe.‹«
»Peter hatte Angst, dem Herrn die Nachricht zu überbringen«, fuhr Robert fort. »Wir mußten Mrs. Piggott holen, die leise nach oben ging, um nachzusehen, welche der beiden Töchter zu Hause war. Miß Evelyn entkleidete sich gerade für die Nacht, aber Marie Annes Zimmer war leer. Ich dachte, der Herr würde einen Anfall bekommen, denn es sah wirklich danach aus. Die Stimme der Herrin hörte ich nur einmal, als sie sagte: ›Das reicht jetzt. Dieses Mal muß etwas geschehen, hörst du? Und zwar schnell!‹ Er antwortete halblaut: »Was ist mit Vater?‹ Worauf sie entgegnete: »Was soll schon mit Vater sein? Diesem Kind müssen unbedingt Zügel angelegt werden.«
»Arme Miß Mary Anne.«
»Du paßt besser auf mit deinem Mary Anne. Was die Herrin von Mary Anne hält, weißt du.«
»Ja, das weiß ich. Und ich weiß auch, was ich von dieser Frau halte.«
»Sei still! Dir ist doch klar, was passiert, wenn du eines Tages zuviel sagst.«
»Nun, den Weltuntergang würde es nicht bedeuten, und wenn du etwas schlauer wärst, wüßtest du das auch.«
»Und wenn du ein bißchen mehr Verstand hättest, meine Kleine, dann wäre dir klar, daß du nirgends besser lebst als bei uns, was Essen, Kleidung, Ausgang oder dergleichen angeht.«
»Ausgang? Erzähl mir bloß nichts von Ausgang! Ein Tag pro Monat, und das erst ab ein Uhr Mittag, und vor dem Dunkelwerden müssen wir wieder zurück sein. Also komm mir nicht damit.«
Robert stieß Fanny in die Seite und sagte: »Verschwinde in deine Kammer.«
Als Antwort fuhr Fanny ihn spitz an: »Schubs mich nicht, Robert Green«, dann wandte sie sich um und stob davon.
Robert blieb einen Augenblick stehen und sah ihr nach, während er den Kopf schüttelte und sich fragte, warum er sich überhaupt etwas aus Fanny machte. Sie war nur das zweite Hausmädchen und würde kaum aufsteigen, solange Carrie Jones Dienst im Haus tat.
Mrs. Lena Piggott, die Haushälterin, sagte zu Carrie Jones: »Geh rasch nach unten und sag Bill Winters Bescheid, daß der Arzt Holzstäbe zum Schienen braucht.«
»Holz?« fragte Carrie.
»Ja, ich sagte Holzstäbe.«
»Aber in welcher Größe denn, Mrs. Piggott? Es gibt dicke, dünne, lange und kurze Holzstäbe.«
»Warte.« Die Haushälterin wiegte den Kopf hin und her, während sie nachdachte. »Sag ihm, daß damit ein gebrochener Knöchel geschient werden soll. Und jetzt beeil dich!«
Wieder im Schlafzimmer vor ihrer Herrin stehend, verwandelte sich die befehlsgewohnte Haushälterin in ein Bild untertänigster Ergebenheit. Sie flüsterte: »Ihr Auftrag wird ausgeführt, Madam.«
Veronica Lawson antwortete nicht. Sie fixierte den Arzt, der sich über ihre nervenaufreibende und andauernd für Ärger sorgende Tochter gebeugt hatte, und fragte mit gesenkter Stimme: »Was sagt sie?«
Doktor Ridley streckte den Rücken, ohne den Blick von dem jungen Mädchen im Bett zu wenden, als er der Hausherrin kurz angebunden antwortete: »Ich kann es nicht verstehen.« Zur gleichen Zeit fragte sich Ridley, wen dieses Mädchen mit ihren Beschimpfungen meinte. Anscheinend haßte sie die Person zutiefst. »Du bist dreckig und verkommen!« murmelte die jüngste Tochter der Lawsons immer wieder vor sich hin.
»Was ist los mit ihr ... ich meine, außer dem gebrochenen Knöchel?«
Nun wandte der Arzt seine ganze Aufmerksamkeit der Hausherrin zu. Er mochte die Frau nicht und war froh, daß sie nicht zu seinen Patientinnen gehörte. Man hatte ihn gerufen, weil es sich um einen Notfall handelte. Normalerweise war er nur der Arzt des alten Lawson, der The Little Manor bewohnte, das Kleine Herrenhaus am anderen Ende der Ländereien. Mit ihm verstand er sich gut. Der alte Herr unterschied sich völlig von der Familie seines Sohnes, die das größere Herrenhaus, The Manor, bewohnte. Und das, obwohl die eigentliche Macht noch immer in den Händen von Emanuel Lawson lag, soweit der Arzt wußte. »Sie hat eine Gehirnerschütterung«, erklärte Doktor Ridley. »Und an der linken Kopfseite hat sich eine dicke Beule gebildet. Während der nächsten zwei bis drei Tage wird Ihre Tochter die meiste Zeit schlafen, aber der Knöchel macht ihr mit Sicherheit große Schmerzen. Es wird einige Zeit dauern, bis der Bruch verheilt ist, und ich schlage vor ...« An dieser Stelle hielt der Arzt für einen Augenblick inne und blickte Mrs. Lawson direkt in die Augen, bevor er weitersprach. »Sie sorgen dafür, daß Ihre Tochter nicht noch weiterer Aufregung ausgesetzt wird. Ich will damit sagen, man sollte ihr Ruhe gönnen.«
Veronica erwiderte den Blick des jungen Arztes mit derselben starren Miene und wiederholte: »Man sollte ihr Ruhe gönnen.« O ja, Ruhe würde ihre Tochter schon bekommen. Aber sie selbst würde sich keine gönnen, sondern alles daran setzen, daß der Stein des Anstoßes möglichst bald aus ihrem Leben verschwand. Es war merkwürdig, gestand Veronica sich ein, daß sie das Kind vom Tag seiner Geburt an nicht gemocht hatte. Und mit den Jahren war ihre Abneigung noch gewachsen. Außerdem hatte sie einen guten Grund für ihren Widerwillen, denn wenn es tatsächlich Wechselbälger geben sollte, dann war ihre jüngste Tochter, ihr letztes Kind, das sie durch rohe Gewalt empfangen hatte, ganz bestimmt einer. Schon früher hatte Veronica ihren Mann abgewehrt, aber nie zuvor mit der Heftigkeit wie in jener Nacht. Neben zwei Totgeburten sollten fünf Kinder als Gegenleistung dafür genügen, daß James Lawson sie zur Herrin des Hauses erhoben hatte, fand Veronica. Aber dann hatte er ihr das sechste Kind gemacht. Nachdem die Zwillinge nach Kanada ausgewandert waren, hatte Veronica sich erleichtert gefühlt, als wäre ihr eine schwere Bürde genommen, denn die beiden Jungen waren ebenfalls Wildfänge gewesen. Mit Vincent, Pat und Evelyn wäre ihr Leben erträglich gewesen, und tatsächlich verlief es eine Zeitlang in einigermaßen angenehmen Bahnen. Die Einladungen nach The Grange waren zahlreicher geworden, und zuletzt verkehrten sie sogar in The Hall selbst. Die gesellschaftlichen Kontakte hatten Veronicas Hoffnungen, was Evelyns Zukunft anbelangte, neu erblühen lassen.
Oh, was war nur mit Evelyn schiefgegangen? Es fing an, als sie achtzehn wurde und sich in jenen verarmten jungen Leutnant verliebte. Natürlich hatte Veronica der Angelegenheit ein Ende bereitet. Aber jetzt, mit fünfundzwanzig, war ihre älteste Tochter noch immer nicht verheiratet. Außerdem war da Vincent. Oh, Vincent ließ sich nichts vorschreiben, sondern tat nur, was ihm in den Sinn kam. Veronica fragte sich, ob er jemals heiraten würde. Sie hoffte es, denn durch ihn würde sich die männliche Linie ihrer Familie fortpflanzen. Dem alten Lawson lag sehr viel daran, auch wenn er Vincent nicht mochte. Nein, in dieser Hinsicht zeigte der Alte seine Gefühle nur zu deutlich. Wenn es sich um Pat gehandelt hätte ... Pat schien von allen geliebt zu werden, und er kam gut mit seinem Großvater zurecht.
Veronica wandte sich um und blickte auf das weiße Mädchengesicht in den Kissen. Wie fremd es ihr erschien. Alles darin war zu groß geraten, die Augen, der Mund und sogar die Nase. Aber die Haut sah weich und samtig aus. Die Gesichtszüge waren elfenhaft, verblüffend und ungewöhnlich, vor allem wegen ihrer Augen. Wenn sie es dürfte, würde Marie Anne am liebsten im Freien leben. Im Haus gab es nichts, was sie zufriedenstellte. Mit einer Ausnahme, mußte Veronica zugeben – wenn Marie Anne am Klavier saß. War es nicht seltsam, daß das Mädchen so gut spielte? Selbst als sie in der Schule nur schlechte Zensuren erhielt, betonten die Lehrer ausdrücklich, daß Marie Annes Leistungen in Musik hervorragend waren. Nun, möglicherweise bot das Klavierspiel die rettende Lösung für alle. Vielleicht gelang es Veronica, Martha in London zu überreden, Marie Anne bei sich aufzunehmen, was mehr als wahrscheinlich war, das wußte Veronica, denn für Geld tat Martha alles.
Welch eine Erleichterung, wenn Marie Anne erst einmal weg wäre. Dann bräuchte Veronica nicht länger die Launen ihrer Tochter zu ertragen. Oh, diese furchtbaren, wilden Ausbrüche ...
Als sich der Arzt an Mrs. Piggott wandte, fuhr die Haushälterin ebenso wie die Hausherrin zusammen. »Haben Sie veranlaßt, daß diese Holzschienen besorgt werden?« fragte er scharf. »Ich brauche nur kurze Holzstäbe, keine Baumstämme.« In kaum verändertem Ton richtete er dann das Wort an Veronica Lawson. »Würden Sie bitte Ihren Ehemann holen? Ich benötige seine Hilfe!«
Was auch immer Veronica antworten wollte, es wurde durch einen kurzen Hustenanfall erstickt, den eine warnende innere Stimme ihr eingab. Besser, wenn sie dem Mann keine Beleidigungen an den Kopf warf, sondern sich bei Doktor Sutton-Moore über ihn beschwerte.
Veronica fand den jungen Mann als Arzt völlig ungeeignet. Nicht nur mangelte es ihm ihr gegenüber an Respekt, auch seine Stimme klang grob. Überhaupt, er war ein ungehobelter Mensch, der sich nicht im Geringsten wie ein Gentleman benahm.
James Lawson betrat im gleichen Augenblick das Schlafzimmer, als auch das Holz zum Schienen gebracht wurde.
Während der junge Arzt die flachen Holzstücke überprüfte, schien er nicht auf den gereizten Ton des Hausherrn zu achten, der zu wissen verlangte, warum er gebraucht wurde. Schließlich erwiderte er knapp, begleitet von einem direkten Blick in das dickliche Gesicht von James Lawson: »Ich werde ihr etwas Chloroform geben, und dann benötige ich Hilfe.«
»Chloroform? Warum Chloroform? Ich dachte, das Holz würde für einen verstauchten Knöchel gebraucht.«
»Wenn Sie das geglaubt haben, Sir, sind Sie falsch unterrichtet. Ihre Tochter hat eine Pottsche Fraktur erlitten.«
»Eine was? James Lawson verzog das Gesicht. »Wie sagten Sie?«
»Es handelt sich um eine Pottsche Fraktur. Ein komplizierter, schwerer Bruch, um es deutlich zu sagen, und Sie können sich vorstellen, daß es sehr schmerzhaft sein wird, wenn ich versuche, die Knochen wieder an ihren richtigen Platz zu bringen. Außerdem«, Doktor Ridley wandte sich nun zur Haushälterin, »habe ich nicht genügend Verbandszeug bei mir. Reißen Sie einige Leinentücher in Streifen von zehn Zentimeter Breite, und beeilen Sie sich bitte.«
James Lawson starrte den eingebildeten jungen Arzt an. Was glaubte dieser Grünschnabel, mit wem er sprach, daß er sich anmaßte, einfach Befehle zu erteilen? Veronica hatte recht gehabt. Der Mann kannte seine Grenzen nicht. Und indem er die Haushälterin von The Manor, die bereits auf dem Weg zur Tür war, förmlich anherrschte: »Nehmen Sie frisches Leinen von den Ballen im Nähzimmer«, entschied James Lawson, daß einzig er in seinem Haus Befehle erteilen durfte und daher die Initiative an sich reißen sollte. Dann neigte er den Kopf in John Ridleys Richtung und sagte: »Nun gut! Worauf warten Sie noch? Lassen Sie uns anfangen.«
Eine gute halbe Stunde später stand der junge Arzt vor dem Waschtisch in der Zimmerecke und tauchte die Hände in eine Schüssel mit warmem Wasser.
Patrick Lawson saß am Kopfende des Bettes und strich sanft über die schlaffe weiße Hand seiner Schwester, die auf dem Federbett ruhte, und sah dabei in das für ihn wunderschöne Gesicht mit den kindlichen, engelgleichen Zügen. Allerdings wußte er, daß Marie Annes Charakter diese Eigenschaften nicht aufwies, denn im Herzen war sie ein kleiner Kobold. Bei diesem Gedanken lächelte Pat Lawson vor sich hin. Ja, das war sie, ein lebhaftes kleines Mädchen. Warum begriffen die anderen das nicht? Als der Arzt seinen Mantel anzog und noch einmal zum Sprechen ansetzte, wandte Pat sich um. »Ich habe einige Laudanum-Tropfen hiergelassen«, erklärte Doktor Ridley und wies auf eine Flasche auf dem Beistelltisch. »Wenn sie aufwacht, wird sie starke Schmerzen haben. Das wird zwar nicht vor morgen früh sein, aber sie braucht dann etwas zur Schmerzlinderung. Wer wird bei ihr bleiben?«
»Oh ...« Pat schüttelte den Kopf. »Ich weiß noch nicht, aber wahrscheinlich eines der Zimmermädchen.« Er musterte den jungen Mann genauer, der jetzt seine Tasche hochnahm. »Ja, ganz bestimmt.«
Pats Stimme klang, als zweifelte er daran, daß sich jemand um seine Schwester kümmerte, deshalb fügte er zur Beruhigung des Arztes rasch hinzu: »Im Haus gibt es genügend Personal. Es wird Tag und Nacht jemand bei ihr wachen.«
»Sorgen Sie dafür?«
»Nein.« Pat sprach mit hoher Stimme und klang etwas steif. »Das ist Sache der Haushälterin, die ihre Anweisungen von meinen Eltern erhält. Wie kommen Sie auf den Gedanken, daß man meine Schwester nicht ausreichend betreuen könnte?«
»Keine Spur. Ich wollte nur sichergehen. Außerdem werde ich morgen früh wieder vorbeischauen. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Nacht.«
»Gute Nacht.« Pats Antwort war knapp ausgefallen, und nun starrte er auf die geschlossene Tür, während er sich in Gedanken mit der Andeutung des Arztes beschäftigte, man könnte Marie Anne tatsächlich unversorgt lassen. Wie war er auf diese Idee gekommen? Natürlich. Patrick blickte wieder auf das Gesicht in den Kissen. Wenn seine Mutter wie üblich auf ihrem hohen Roß gesessen und sein Vater sich kaum besser verhalten hatte, dürften sie bei dem jungen Mann kaum den Eindruck fürsorglicher Eltern hinterlassen haben. Wahrscheinlich war er deshalb mißtrauisch.
Als die Tür sich erneut öffnete, stand seine Mutter auf der Schwelle, und ohne sich auch nur die Mühe zu machen, die Stimme zu senken, sagte sie: »Du kommst spät. Man hat den Einspänner schon vor über einer Stunde zum Bahnhof geschickt.«
»Der Zug hatte unterwegs einen längeren Aufenthalt und ist mit Verspätung eingetroffen, Mutter.«
Veronica Lawson trat ans Fußende des Bettes und umfaßte den Messingknauf mit der Hand, bevor sie auf ihre Tochter herabblickte. »Eine schöne Bescherung. Wieder eine ihrer Eskapaden. Das muß aufhören.« Dann, ohne eine Pause, wechselte sie das Thema: »Wie lief es in London?«
»Sehr gut, geschäftlich und gesellschaftlich.« »Gesellschaftlich? Was meinst du damit?«
»Genau, wie ich es sage, Mutter. Ich war zu einer Gartenparty bei Lord Dilly eingeladen und zu einem Hausball bei den Admirals.«
»Oh.«
»Ja, Mutter. Bei beiden Anlässen mußte ich an dich denken. Du wärst beeindruckt gewesen.«
Für einen Moment entspannten sich Veronicas Gesichtszüge, doch dann verkrampfte sie sich erneut: »Versuchst du gehässig zu sein?«
»Ich hatte nicht die Absicht, so zu wirken, Mutter, aber ich weiß, daß du solche Anlässe liebst und welche Hoffnungen du damit verbindest. Wäre Evelyn dort gewesen, hättest du bereits die Hochzeitsglocken läuten hören. Wie die Dinge standen«, Pat lächelte, »konnte ich sie auch hören, aber sie kamen aus so vielen Richtungen, daß ich mich nicht entscheiden konnte, welchen ich folgen sollte.«
Seine Mutter wandte sich vom Bett ab. »Du hattest schon immer eine geringe Meinung von dir selbst, Pat«, entgegnete Veronica und hätte beinahe hinzugefügt: Und du wirst deinem Großvater jeden Tag ähnlicher. Was hoffentlich nicht bedeutete, daß sie Pat bald ebenso hassen würde wie den Alten.
»Wer wird sich um sie kümmern?« fragte Pat.
»Was meinst du damit?«
»Wie ich es sage, Mutter. Der junge Arzt hat mir die gleiche Frage gestellt, und ich gebe sie jetzt an dich weiter: Wer wird sich um Marie Anne kümmern?«
»Der junge Mann kennt seine Grenzen nicht. Ich werde mich über ihn beschweren.«
Pat lachte kurz auf, bevor er weitersprach. »Wie ich ihn einschätze, wird ihn das nicht im Geringsten beeindrucken. Aber zurück zu Marie Anne. Wen aus der Dienerschaft wirst du ihr zuteilen?«
Er beobachtete, wie seine Mutter einen Augenblick nachdachte. »Nachts wird sie niemanden brauchen, denn dann schläft sie«, antwortete sie schließlich. »Ich werde Mrs. Piggott anweisen, Fanny Carter, das zweite Hausmädchen, zu schicken. Fanny kann sich tagsüber um Marie Anne kümmern. Das heißt, solange sie im Bett liegen muß.«
»Nun, das wird einige Zeit dauern, glaubst du nicht auch?«
»Was meinst du mit einige Zeit?«
»Der Arzt sprach von drei Monaten.«
»Was!« Der Ausruf war so laut, daß Pat warnend zischte: »Ruhig, Mutter! Du könntest sie aufwecken, und dann wird Marie Anne große Schmerzen haben.« Er wies auf den Tisch. »Der Arzt hat Laudanum für sie hiergelassen. Bist du ihm nicht begegnet, als er ging?«
»Nein, und ich habe auch keine Lust, ihn noch einmal zu sehen.«
Pat beobachtete seine Mutter, die mit beiden Händen das Messinggeländer des Bettgestells umklammerte und wiederholte: »Drei Monate! Drei Monate!«
In scharfem Ton und mit Blick auf das Tischchen fragte er: »Wie oft wird sie diese Tropfen brauchen?«
»Ich weiß es nicht, aber Mrs. Piggott wird sich auskennen. Ich habe mitbekommen, daß der Arzt mit ihr gesprochen hat, bevor er ging.«
»Übrigens«, sagte Pat, »was ist eigentlich mit Evelyn? Sie sollte diejenige sein, die bei Marie Anne sitzt.«
»Sei nicht albern, Pat. Die beiden sind wie Feuer und Wasser. Je weniger sie miteinander zu tun haben, desto besser für beide. So war es immer, und das weißt du genau.«
»So genau weiß ich das nicht, zumindest nicht in deinem Sinn. Ich weiß nur, daß Evelyn zehn Jahre älter als ihre Schwester ist und auf ihre Art Marie Anne ebenso zurückgestoßen hat wie du, Mutter.«
»Patrick! Du wagst es, so zu mir zu sprechen!« Sie sprach in einem zischenden Flüsterton, und jetzt hastete sie zur Tür, wobei sie sagte: »Ich werde mit deinem Vater über dein Benehmen sprechen.«
»Oh, sei nicht albern, Mutter. Du sprichst mit mir, als wäre ich ein kleiner Junge. Ich bin ein Mann von sechsundzwanzig Jahren. Vergiß das nicht, Mutter.« Pat trat näher zu ihr, und seine Worte klangen leise, aber bestimmt. »Und denke daran: Es ist immer noch Großvater, der hier das Sagen hat. Vater mag sich als Familienvorstand aufführen, zusammen mit Vincent, der sich groß aufspielt, und erst dann komme ich. Aber ich bin es, der dafür sorgt, daß die Geschäfte laufen, denn keiner der beiden hat je ein Geschäft in der Reederei erfolgreich zu Ende gebracht. Sie wissen nicht, wie man mit dem Personal umgeht, und erst recht nicht, wie sie mit der Konkurrenz umzugehen haben. Das wollte ich schon lange einmal loswerden, und es ist schlimm genug, daß ich ausgerechnet an diesem Ort«, er blickte zum Krankenbett hinüber, »für klare Verhältnisse sorgen muß, aber jetzt ist es heraus. In Zukunft wirst du daran denken, wie alt ich bin, Mutter. Und jetzt kannst du gehen und Vater, und auch Vincent, Wort für Wort berichten, was ich gesagt habe. Wenn sie die Wahrheit abstreiten, werde ich es einzurichten wissen, daß sie den nächsten Geschäftstermin selbst wahrnehmen müssen. Dann werden wir sehen, was geschieht. Die Situation ist nicht neu, Mutter, nicht wahr? Ihr habt ein großes Problem in diesem Haus, du weißt das. Denn alles, was hier geschieht, hat fast ausschließlich mit Prestigefragen zu tun. Du und Vincent, ihr beide bringt euch beinahe dafür um, daß unser Name in den richtigen Kreisen genannt wird. Und wozu das Ganze? Und noch ein Letztes, und ich bedaure, das sagen zu müssen. Aber vergiß nicht, daß Großvater noch nicht tot ist und jederzeit einschreiten kann. Es könnte Veränderungen geben. Große Veränderungen. Veränderungen, die dieses von Gott heimgesuchte Haus in seinen Grundfesten erschüttern würden.«
Als Pat sich von seiner Mutter abwandte und wieder zum Bett ging, rührte diese sich nicht. Sie hatte eine Hand in ihr Kleid gekrallt, die andere bedeckte die untere Gesichtshälfte und umklammerte das Kinn, als wollte sie verhindern, daß es zitterte. Starr erwiderte Veronica den Blick ihres Sohnes und wußte, daß sie ihn in diesem Augenblick mehr haßte als ihren Schwiegervater, denn der alte Lawson hatte nie offen mit ihr über diese Angelegenheit gesprochen. Zwar mochte er hin und wieder in polterndem Ton Andeutungen gemacht haben, aber damit hatte er sie nie wirklich getroffen. Beinahe stolpernd verließ Veronica das Zimmer.
Um neun Uhr am nächsten Morgen stürmte Emanuel Lawson buchstäblich in Marie Annes Schlafzimmer. Doch beim Anblick ihres totenbleichen Gesichts, über das die Tränen strömten, hielt er abrupt inne. Der Atem seiner Enkelin ging stoßweise, während sie zu sprechen versuchte: »Oh, Großpapa. Großpapa!«
Als er die Arme um Marie Annes Schultern legte, um sie zu trösten, stieß sie einen spitzen Schrei aus, so daß er zurückwich.
»Sie hat große Schmerzen, Sir.«
»War der Doktor schon da?« fragte der alte Lawson und blickte über das Bett zu Fanny Carter.
»Nicht heute morgen, aber er kommt später, Sir. Gestern blieb er bis tief in die Nacht. Der Bruch ist geschient.« Fanny wies auf den Hocker, der neben das Bett gerückt worden war, um die Decken von dem gebrochenen Knöchel fernzuhalten, und fügte hinzu: »Diese Konstruktion taugt nicht viel, Sir. Das Bein sollte durch einen Drahtkäfig geschützt sein.«
»Ja, Mädchen. Du hast recht. Ich werde das veranlassen. Aber mein Liebling, oh, mein armer Liebling!« Emanuel strich über Marie Annes feuchtes Gesicht. »Immer wieder passieren dir solche Geschichten. Was war dieses Mal der Grund? Sie hätten mir noch gestern abend Bescheid geben sollen.«
»Nein, Großpapa. Ich bin gestürzt, weil ich Angst hatte. Ich hatte jemanden gesehen und dachte, sie wären hinter mir her. Deshalb bin ich losgerannt und dabei hingefallen.«
»Aber du warst ganz unten beim Fluß, an der Grenzmauer.«
»Ja, das stimmt. Und ich hatte solche Angst, Großpapa. Ich ... muß geträumt haben, daß ein Ungeheuer hinter mir her war.«
»Ein Ungeheuer?«
»Ja, denn als ich nach einem Schlag auf meinen Kopf wieder zu mir kam, sah ich sein Gesicht. Es war das Gesicht eines Ungeheuers. Aber wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Sie sagen, ich hätte eine Gehirnerschütterung. Was ist das, Großpapa?«
»Oh, das bedeutet nur, daß du ein paar Tage ruhig liegen bleiben mußt. Eine Gehirnerschütterung wird durch einen Schlag gegen den Kopf verursacht. Aber du blutest nicht.« Emanuel fuhr mit dem Finger durch ihr Haar am Hinterkopf und strich sanft darüber, bevor er wiederholte: »Nein, du blutest nicht.«
»Großpapa.«
»Ja, mein Kind, was ist?«
»Es ist furchtbar – diese Schmerzen. Ich ... kann nicht anders und beginne immer wieder zu weinen, und sie sagen, ich müßte lange Zeit das Bett hüten. Lieber sterbe ich, Großpapa. Lieber will ich sterben.«
»Nein, mein Kind, das wirst du nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich werde so oft bei dir sein, wie es mir möglich ist, und dieses nette Mädchen hier kümmert sich ebenfalls um dich. Nicht wahr, meine Liebe?«
Fanny zögerte einen Augenblick, bevor sie antwortete, denn sie war einigermaßen überrascht, daß der alte Lawson sie »meine Liebe‹ nannte, wo er doch als Tyrann verschrien war. »Ja, ich werde sie pflegen, Sir. Meine Mutter habe ich jahrelang versorgt, als sie Wassersucht hatte. Und ... darf ich frei sprechen, Sir?«
»Ja, Mädchen, sprich weiter.«
»Nun, im Haus wurde davon gesprochen, eine Krankenschwester einzustellen, aber ich könnte mich ebensogut um Miß Marie Anne kümmern, da ich ja schon meine Mutter gepflegt habe, und damals war ich noch sehr jung. Sie lag viele Jahre mit Wassersucht im Bett, und außer mir hatte sie niemanden, der ihr beistand. Wissen Sie, mein Vater und die beiden Jungen haben unter Tage in der Grube gearbeitet und sind dabei ums Leben gekommen. Ich hatte noch einen weiteren Bruder, aber der starb zu Hause, und dann kümmerte ich mich jahrelang um meine Mutter, bevor ich hierher kam. Deshalb könnte ich die Miß sehr gut pflegen, Sir. Ja, wirklich.«
Fannys tragische kleine Geschichte, die sie so wortreich erzählte, hatte Marie Annes Tränen zum Versiegen gebracht. »Oh! Du armes Ding, Fanny. Wie leid du mir tust«, stieß sie heftig atmend hervor.
»O nein, Miß.« Fanny lächelte nun über das ganze Gesicht. »Das ist Vergangenheit. Ich bin froh, hier sein zu dürfen und ...« Sie blickte zu dem alten Lawson herüber, als wollte sie noch etwas sagen, fügte aber nur hinzu: »Ich werde mich um Sie kümmern.«
»Hörst du das, mein kleiner Liebling? Wenn das keine gute Neuigkeit ist! Du bekommst in Fanny nicht nur eine Krankenschwester, sondern auch eine Geschichtenerzählerin, jemanden, der die tragischen Ereignisse seines Lebens in lebendige Worte kleiden kann. Das ist eine Kunst.«
Fanny wußte nicht genau, was der alte Herr meinte, aber sie verstand, daß er ihr ein Kompliment gemacht hatte. Sie lächelte ihm zu und sagte dann taktvoll: »Ich lasse Sie jetzt allein, Sir. Aber ich bleibe im Zimmer nebenan. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie einfach.«
»Das mache ich, Mädchen. Und ich danke dir.« Emanuel Lawson nickte ihr lächelnd zu, und als sich die Tür hinter Fanny geschlossen hatte, blickte er auf seine Enkelin herunter. »Nun, meine liebe Marie Anne, das nenne ich Treue«, sagte er. »Dieses Mädchen wird dir nicht nur eine gute Betreuerin, sondern auch eine Freundin sein, und gerade zur rechten Zeit.«
»Ja, Großpapa. Ich mochte Fanny schon immer. Sie war stets nett zu mir. Aber Großpapa, ich fühle mich furchtbar, richtig krank, und ich habe Angst. Sie sagen, ich muß wochenlang liegenbleiben. Das überlebe ich nicht, bestimmt nicht.«
»Jetzt hör aber auf damit. Du wirst nicht sterben, und wenn du wieder bei Kräften bist und dich aufrichten kannst, werden wir dich in den fahrbaren Rohrstuhl setzen und über das Anwesen schieben. Das würde dir gefallen, nicht wahr?«
Marie Anne versuchte zu lächeln und entgegnete: »Nein, Großpapa, ich würde es verabscheuen. Du weißt, wie es mir geht, wenn ich nach draußen komme. Ich kann nicht langsam umhergehen, sondern muß rennen.«
»Ja, mein Liebling, du mußt laufen, immer laufen. Aber warum? Damit beginnt der ganze Ärger jedesmal. Wenn irgend etwas geschieht, das dir nicht gefällt, rennst du los. Wovor läufst du davon?«
Marie Anne dachte einen Augenblick nach, dann schniefte sie laut, bevor sie antwortete: »Ich glaube, Großpapa, ich renne, weil ich weg möchte von den Menschen, die mich nicht mögen.«
»Aber jetzt übertreibst du! Es ist albern zu behaupten, die Menschen würden dich nicht mögen. Jeder ...«
»Bitte, Großvater! Nicht! Du weißt es, und ich weiß es ... Wir haben darüber gesprochen, oder etwa nicht? Daß niemand von allen geliebt werden kann, oder so ähnlich.«
Emanuels Hand lag wieder auf ihrem Haar und strich eine Strähne aus ihrem Gesicht. Dann sagte er sanft: »Du hast recht. Ich schimpfe mit dir wie mit einem dummen Kind, dabei bist du keines mehr. Du bist ein kluges junges Mädchen. Aber kannst du mir sagen, warum du spät abends bis zu Hardings Mauer am Fluß hinunterrennen mußtest?«
Da wandte Marie Anne den Blick von ihm ab und sah auf das Fußende hinunter, wo sich die Decken zu einem Hügel zusammenschoben. Ihre Stimme klang leise, als sie entgegnete: »Nein, Großpapa.«
»Nein? Aber etwas muß dich veranlaßt haben, so weit wegzulaufen. Hat das, was dich dorthin trieb, etwas mit diesem Haus zu tun?«
»Ja, Großpapa«, flüsterte sie.
»Und du kannst mir nicht sagen, was es war? Aber beantworte mir wenigstens eine Frage. Betrifft es eine Person in diesem Haus?«
Marie Anne zögerte, bevor sie erwiderte: »Ja, Großpapa.«
Er wollte fragen: War es ein Mann? Oder eine Frau? Aber es gab nur eine Frau, die sich spät abends draußen aufhalten könnte, vielleicht um einen Spaziergang zu machen, und das war Evelyn. Aber Evelyn sah es überhaupt nicht ähnlich, querfeldein zu gehen. Schließlich könnte sie sich die Füße schmutzig machen. Oder war es eines der Hausmädchen gewesen? Doch wenn es sich nur um eine Angestellte handelte, würde Marie Anne nicht so hartnäckig über das Vorgefallene schweigen, dessen war Emanuel sich sicher. Oder betraf es vielleicht Vincent? Er hätte den Scherzen dieses jungen Mannes schon vor Jahren ein Ende setzen müssen, als er die wahre Bedeutung und den Hintergrund seiner Angriffe entdeckte, die Marie Annes Großvater gleichermaßen erzürnten und schockierten. Denkbar, daß es Vincent war. Aber soweit Emanuel wußte, hatte er sich gestern abend mit seinem Freund Harry Stockfield hier im Haus aufgehalten, und früher am Abend waren sie zusammen draußen auf dem Tennisplatz gewesen, und anschließend hatten sie eine Partie Billard gespielt. Nun, es bestand kein Zweifel, daß er der Sache eines Tages auf den Grund kommen würde. Als Marie Annes Großvater war er ihr Vertrauter gewesen, seit sie auf seine Knie krabbeln konnte, immer auf der Suche nach Liebe, vielleicht als Ausgleich für den Haß, den ihre Mutter dem Kind entgegenbrachte. Emanuel hatte Marie Anne geliebt und sie ihr ganzes junges Leben lang verhätschelt. Doch wie war er auf den Gedanken gekommen, daß Veronica ihre eigene Tochter haßte? Vielleicht war das Wort zu hart, womöglich traf »Abneigung« eher zu – zumindest hoffte er es. Dennoch waren Haß und Abneigung enge Verwandte. Und das Schlimmste an der Sache war, daß das Kind die Gefühle seiner Mutter spürte, seit diese es zum ersten Mal von ihren Knien gestoßen hatte. Emanuel selbst war Zeuge dieser Szene gewesen, und es hatte sich um keinen sanften Schubs gehandelt, sondern um einen Stoß, der die Dreijährige zu Boden warf, so daß sie zu weinen begann.
Jetzt weinte sie wieder, und Emanuel zog sein großes seidenes Taschentuch aus der Brusttasche und trocknete sanft Marie Annes Tränen. Noch während er damit beschäftigt war, erhielt er die Antwort, von der er erwartet hatte, daß er lange danach forschen müßte. Sie kam, als er sich erkundigte: »War Evelyn schon bei dir im ...« Emanuel hatte den Satz noch nicht beendet, als Marie Annes gesamter Körper wie unter einer Erschütterung zu beben begann. »... im Zimmer und hat dich besucht?« Marie Anne stieß einen lauten Schmerzensschrei aus und rief: »Nein! Und ich will sie auch nicht sehen. Auf keinen Fall!«
»Schon gut, mein Liebling. Alles in Ordnung. Wenn du sie nicht sehen willst, brauchst du es auch nicht.«
Aha! Evelyn also. Und das spät abends. Warum wohl sollte sich seine andere Enkelin um diese Zeit draußen aufhalten, und was hatte das junge Mädchen hier veranlaßt, so schnell davonzurennen, daß es mit dem Kopf gegen eine Wand prallte? Nun gut. Er würde den Grund herausbekommen, aber er mußte unauffällig vorgehen. Ja, sehr unauffällig. Mit wem traf sich Evelyn derzeit? Seit der Geschichte vor einigen Jahren, als sie mit aller Gewalt heiraten wollte und ihre Mutter der Sache ein Ende setzte, hatte es ein oder zwei Männer gegeben, die sie näher interessierten, aber es war nichts dabei herausgekommen. Evelyn war von sehr abweisender Art. Sie spielte zu oft die große Dame, ähnlich wie ihre Mutter. O ja, sie schlug sehr nach Veronica. Vincent ebenso, sogar noch stärker als seine Schwester. Die drei bildeten eine Art Kleeblatt in Emanuels Augen, und sie standen sich sehr nah, was ihre Persönlichkeiten wie auch ihre Bestrebungen betraf.
Doch welche Rolle spielte dabei sein eigener Sohn, ihr Vater? Oh, Emanuel hatte schon längst eingesehen, daß er in ihm einen Mann voll prahlerischer Eitelkeit und ohne Rückgrat herangezogen hatte. Andererseits war durch ihn Pat in sein Leben getreten, und Pat stand seinem Großvater so nah, wie er es von einem Menschen kaum zu erhoffen gewagt hatte. Und dann war da noch dieser kleine Kobold. Die Ungewollte. Der Wechselbalg. Sie glich in allem ihm selbst, in ihren Idealen und auch in ihrem Temperament. Marie Annes Gefühle schossen wie seine eigenen in heftigen Schüben hoch, explodierten und ließen die Funken fliegen. Und ihre Ideale? Schon ein paarmal hatte sie bewiesen, daß sie wie ihr Großvater empfand. Sie war für Fairneß, den Menschen wie auch den Tieren gegenüber. Ein Beispiel dafür war die Geschichte mit Simon Pinner, dem sie einen Schlag mit der Reitgerte verpaßte, weil er einen seiner Hunde bestraft hatte. Der Hund hatte eine Reihe mit frisch in die Erde gebrachtem Saatgut aufgewühlt, worauf Pinner ihm die Peitsche überzog, so daß der Hund aufjaulte. Marie Anne zögerte nicht lange. Sie rannte in die Sattelkammer und holte eine zweite Reitgerte. Es hätte wenig Sinn gehabt, auf Pinners Beine zu zielen, denn er trug Stiefel und eine dicke Kordhose. Aber er hatte die Ärmel bis zu den Ellenbogen hochgerollt, und dorthin schlug Marie Anne. Anschließend beschwerte Pinner sich im Haus, und Marie Anne wurde für drei Tage bei magerer Kost in ihrem Zimmer eingesperrt. Der Vorfall spaltete die Dienerschaft in zwei Lager. Als nächstes passierte die Sache mit Peter Crouch und dem Pferdetrog. Dieses Mal galten die Sympathien zu neunzig Prozent Marie Anne, denn Crouch war bekannt für seine harte Hand gegenüber Pferden, besonders wenn es darum ging, sie einzureiten. An diesem Tag hatte Marie Anne auf dem Hof gesehen, wie Crouch einem Pferd mit der Peitsche auf die Flanken schlug, so daß sich das Tier wütend aufbäumte. Das Pferd hatte laut protestierend gewiehert, als Crouch es am Wassertrog vorbeizerrte und ihm nicht zu saufen erlaubte. Also schrie Marie Anne den Stallgehilfen an. Unglücklicherweise stand er mit dem Gesicht zu Marie Anne, und der Trog befand sich hinter ihm, so daß es für das Mädchen ein Leichtes gewesen war, auf ihn zuzulaufen und ihn rückwärts ins Wasser zu stoßen. Auf dem Hof erzählte man sich später, sogar die Pferde hätten gelacht. Aber durch diese Tat hatte Marie Anne den Bogen überspannt, weshalb sie ins Internat gesteckt wurde. Damit begann der Ärger jedoch erst richtig. Wie oft war sie davongelaufen? Und wie oft hatte Emanuel sie heimlich bei sich aufgenommen? Wahrscheinlich war Marie Anne nicht zuletzt wegen ihm so aufsässig, denn wann immer sie zu ihm kam, brachte er ihr Verständnis und Zuneigung entgegen. »Tut es sehr weh, mein Liebling?« fragte er gedankenverloren.
»Furchtbar, Großpapa. Ganz schrecklich. Ich habe noch nie im Leben solche Schmerzen gehabt.«
»Der junge Arzt müßte bald hier sein, und er wird dir etwas geben, das deine Schmerzen lindert. Soll ich dir in der Zwischenzeit etwas vorlesen?«
»Nein, Großpapa.«
»Nein?«
»Nein. Setz dich neben mich und halte meine Hand.«
»Oh, das tue ich gern, mein Liebling. Natürlich mache ich das.«
»Ich bin noch immer sehr müde. Am liebsten möchte ich wieder einschlafen, wenn du nichts dagegen hast.«
»Nun, es wäre sicher das Beste für dich, mein Liebling. Ich halte deine Hand, während du wieder einschläfst, und ich erzähle dir dabei eine lustige Geschichte, die ich kürzlich gelesen habe. Sie handelt von einem Känguru, das nicht mehr springen konnte und ein Baby in seinem Brustbeutel hatte, weißt du, so wie es in den Bilderbüchern zu sehen ist. Na ja, das Baby mußte seiner Mutter beibringen, daß sie wieder springen konnte. Jetzt schließt du die Augen, und ich erzähle dir, wie alles anfing und wie die Geschichte endete.«
Emanuel erzählte, und Marie Anne schlief ein. Während der ganzen Zeit, in der er seine Geschichte über das Känguru erfand, das wieder springen lernen mußte, beschäftigte sich ein Teil in ihm damit, was Evelyn zu jener späten Stunde draußen zu suchen und wodurch sie dieses Kind zu Tode erschreckt hatte.
Kapitel 2
Zehn Tage später saß Marie Anne aufrecht im Bett. Fanny hatte soeben das Frühstückstablett entfernt und stellte fest: »Wirklich! Heute morgen sehen Sie deutlich besser aus. Miß. Fast wieder wie früher. Haben die Schmerzen nachgelassen?«
»Ja, Fanny. Sie sind längst nicht mehr so stark. Das heißt, solange ich das Bein nicht bewege.« Marie Anne lächelte das Mädchen an. »Du mußt mein Gejammer langsam leid sein, aber es tat einfach so weh.«
»Aber natürlich, Miß. Ich wette, ich hätte Sie im Jammern übertroffen, wenn ich an Ihrer Stelle gewesen wäre. Ganz bestimmt. Oh ...« Die Tür wurde geöffnet, und Fanny strich sich über den Schürzenlatz. »Da kommt Master Patrick.«
»Guten Morgen, Fanny.«
»Guten Morgen, Sir.«
»Wie geht es unserer Patientin?« Er sah absichtlich nicht zu Marie Anne, sondern fuhr fort: »Hat sie sich gut benommen?«
»O ja. Sie war sehr folgsam.«
Lachend wandte Patrick sich zu Marie Anne: »Was sagst du dazu? Sehr folgsam, wirklich. Das ist das erste Mal, daß ich von jemandem höre, du wärst brav gewesen. Aber wie geht es dir?«
»Oh, ich fühle mich viel besser, Pat. Mein Kopf tut nicht mehr weh, und er fühlt sich auch nicht mehr benebelt an. Deshalb möchte ich heute etwas zeichnen.«
»Das ist eine gute Idee.«
»Fanny wollte gerade nach oben laufen, um mein Tagebuch zusammen mit den Malsachen aus dem Schrank im Schulzimmer zu holen.«
»Soll ich jetzt gehen, Miß?«
»Ja, Fanny. Das wäre nett.«
»Gut. Dann hole ich die Sachen.«
Als sie allein im Zimmer waren, sagte Marie Anne aufgeregt: »Setz dich eine Minute, Pat. Das heißt, wenn du Zeit hast. Ich möchte, daß du mir etwas von dem neuen Schiff erzählst, das bald auf die Reise geht.«
»Oh, du meinst das neue gebrauchte Schiff, das wir gekauft haben?«
»Läuft es heute aus?«
»Ja, mit der Nachmittagsflut um drei Uhr.«
»Und es heißt Annabella?«
»Ja, Annabella. Und unter uns gesagt, die Dame ist bildhübsch.«
»Was für eine Ladung verschifft ihr?«
»Oh, sehr wenig auf dieser Reise. Nur Leinenballen, Spitze und andere Waren, die auf den Inseln gebraucht werden. Vor allem transportieren wir lebende Fracht, und ich hoffe, daß wir sie auch heil zurückbringen. Das ist das wichtigste.«
»Ja«, nickte Marie Anne ihm zu. »Die Gäste. Es muß wunderbar für sie sein.«
»Bestimmt, vor allem, solange das Schiff sicher vertäut am Kai liegt. Sorgen bereitet mir, was geschieht, wenn unterwegs ein Sturm aufkommt. Drei der mitfahrenden Paare waren noch nie auf See. Ich bedaure sie bereits jetzt, die Ärmsten, denn ich selbst war schon so seekrank, daß ich gebetet habe, sterben zu dürfen.«
»Großpapa sagte, es wäre deine Idee gewesen. Er fand die Vorstellung, Passagiere mitzunehmen, sehr lustig und meinte, sie bräuchten wenigstens nicht mit der Schaufel aufs Schiff befördert zu werden und würden noch dafür bezahlen, von Wind und Seegang gebeutelt zu werden. Kehren sie mit dem gleichen Schiff zurück? Ich meine, machen sie die ganze Reise mit?«
»Ich hoffe es, kleine Schwester. Schließlich möchte ich, daß alle die Fahrt lebend überstehen.« Patrick lachte leise, als er hinzufügte: »Oh, man wird sich gut um sie kümmern. Kapitän Armitage ist ein hervorragender Mann, und er hat zwei ebenso gute Offiziere unter seinem Kommando. Die Mannschaft besteht fast nur aus altgedienten Leuten, die schon seit Jahren für unsere Reederei arbeiten. Einer von ihnen wurde zum Steward ernannt, ein anderer zum Hilfskoch und Kellner. Es hat großen Spaß gemacht, alles vorzubereiten.«
»Du hast gerne mit Schiffen zu tun, nicht wahr Pat?«
»Ja, kleine Schwester. Aber unter uns gesagt«, er beugte sich näher zu ihr, »ich fände es gräßlich, selbst mitfahren zu müssen.«
»Ach, wirklich?«
»Ja. Ganz ehrlich. Wie ich schon sagte, ich werde immer seekrank.« Pat wiegte den Kopf hin und her. »Andererseits gibt es kaum etwas Wissenswertes über Schiffe, das ich nicht wüßte. Seit sieben Jahren klettere ich nun schon über steile Schiffsleitern, und davor schon während der Schulferien. Meist waren sie aus Eisen, und ich ging tief in den Schiffsbauch hinein, um Maschinenräume, Mannschaftsunterkünfte, Lagerräume und, nicht zu vergessen, die Kapitänskajüte zu überprüfen. O ja, man muß darauf achten, daß der Kapitän die besten Sessel und die dicksten Teppiche bekommt und eine Koje, die zum Schlafen einlädt.«
Marie Anne mußte lachen, als sie weiterfragte: »Und was ist mit den Segelschiffen? Wir haben doch noch eines, oder? Wie steht es mit einer Kletterpartie den Mast hinauf?«
»Oh, das ist nicht fair von dir, Marie Anne. Wenn du von Segelschiffen und Masten anfängst, fragst du mich als nächstes, ob ich auch schon oben im Ausguck war.«
»Ja.« Marie Anne stupste ihn mit dem Kopf und lachte laut. »Genau das wollte ich als nächstes von dir wissen.«
Nervös wehrte Patrick sie mit der Hand ab. »Nun ja, jetzt hast du mich erwischt.«
»Du warst noch nicht einmal oben, wenn das Schiff im Hafen lag?«
»Nein, selbst im Hafen bin ich niemals dort hinaufgeklettert. Gott allein weiß, wie diese jungen Kerle es fertigbringen, bei rauher See wie Affen in den Masten zu hängen. Und das mit Gott meine ich ehrlich, denn diese Arbeit muß entsetzlich sein, obwohl ich weiß, daß manche Matrosen sehr stolz auf ihre Kletterkünste sind. Aber jetzt fällt mir ein ... Großvater ist oben im Ausguck gewesen, sogar auf See. Sein Vater hat ihn drei Jahre auf große Fahrt geschickt. Hat er dir nie davon erzählt?«
Marie Anne schüttelte den Kopf.
»Sein Vater, unser Urgroßvater, sagte, wenn er sein Geld mit Schiffen verdienen wolle, müsse er auch praktische Erfahrungen sammeln. Nach drei Jahren hatte er genug von der Seefahrt, aber anscheinend reichte das Gelernte aus, denn danach verdoppelte er den Umsatz.« Patrick hätte noch hinzufügen können, daß es eine Enttäuschung für ihn gewesen sei, mitansehen zu müssen, wie sein eigener Sohn nur durch den Einsatz altgedienter Angestellter die Firma halten konnte.
Als Fanny das Zimmer betrat, bemerkte Marie Anne, daß sie die Schachtel mit den Malsachen nicht bei sich trug, und fragte rasch: »Du konntest sie nicht finden? Es stand alles auf dem oberen Regalbrett.«
»Ja, Miß. Ich hatte die Sachen auch schon und war auf dem Weg nach unten, als ich der gnädigen Frau begegnet bin. Sie fragte mich, was ich in der Hand hätte, und ich sagte ihr, es sei Ihr Tagebuch und die Schachtel mit den Malsachen. Sie befahl mir, alles zurückzubringen.«
Pat war aufgesprungen. »Mach dir keine Sorgen«, sagte er. »Ich werde selbst gehen und alles holen. Ist das Kästchen abgeschlossen?«
»Ja, aber der Schlüssel liegt dort drüben.« Marie Anne wies zum Ankleidetisch. »Er ist in der Schublade mit den Taschentüchern, in der kleinen oben im Aufsatz.«
Als Fanny zum Ankleidetisch ging, sagte Pat: »Keine Angst, Fanny. Ich bringe die Sachen, und Marie Anne kann das Schloß selbst öffnen.« Wieder Marie Anne zugewandt, flüsterte er laut: »Du möchtest doch sicher nicht, daß ich alle deine Geheimnisse lese, oder?« Sie antwortete in dem gleichen lauten Flüsterton: »Das würde mir gar nichts ausmachen, überhaupt nichts. Nicht bei dir. Und ich sage dir etwas. Wenn du das Kästchen herbringst und ich es geöffnet habe, verrate ich dir eines meiner Geheimnisse, mein einziges, um genau zu sein.«
»Das willst du tun? In deiner Schatulle gibt es ein Geheimnis?«
»Ja, und es ist wirklich ein Geheimnis.«
»Etwas, das du getan hast?«
»Ja. Etwas, das ich getan habe.«
»Bist du stolz darauf, es getan zu haben?«
»Nun ja, schon.« Marie Anne wandte den Kopf von Patrick ab. »Einerseits bin ich stolz, und dann wieder finde ich es grausam.«
»Grausam? Du willst mir ein grausames Geheimnis verraten? Da bin ich wirklich neugierig. Und ich eile sofort los, um die Büchse der Pandora zu holen.« Er sprang einen Schritt zur Seite, als wollte er einen Tanz aufführen, was Fanny zum Kichern brachte. Als sich die Tür hinter Patrick geschlossen hatte, sagte sie zu Marie Anne: »Master Patrick ist ein toller Bursche. Na ja, ich meine ...« Sie warf den Kopf in den Nacken. »Zu Ihnen kann ich es schließlich sagen. Ich finde, er ist der beste von allen.«
»Das finde ich auch, Fanny. Darin bin ich mit dir einer Meinung.« "
Der Bursche, von dem die Rede war, rannte die Hintertreppe hinauf, und durcheilte, noch immer im Laufschritt, den oberen Korridor, bevor er die Tür zum Schulzimmer aufstieß, wo er seine Mutter überraschte, die vor dem langen, tintenverschmierten Tisch stand, die offene braune Schatulle vor sich. Daneben lagen einige Zeichnungen auf dem Tisch verstreut, und in der Hand hielt sie ein auf geklapptes Tagebuch. Indem sie das Buch zuschlug und an ihre Brust drückte, fragte sie: »Was willst du?«
Pat ging langsam auf sie zu. Er blickte auf die Schatulle, schloß sie und betastete den auf gebrochenen Verschluß. Dann sah er seine Mutter an. »Natürlich, du konntest nicht abwarten, sondern mußtest es mit Gewalt erzwingen.«
Auf dem Tisch sah er den vielbenutzten scharfkantigen Schürhaken liegen. Ihn interessierte nur eines: »Warum? Es lag ein Kindertagebuch darin, neben ein paar ...« Patrick schob die Zeichnungen zur Seite, zögerte, hob ein Blatt hoch und starrte einen Augenblick darauf, bevor er Veronica ansah. Auf seinen Blick hin entgegnete sie: »Ja, sieh die Zeichnung ruhig an. Hast du jemals etwas derart Scheußliches und Unmenschliches gesehen?«
Patrick breitete die restlichen Blätter aus. Nachdem er sie betrachtet hatte, wandte er sich wieder an seine Mutter. »Unmenschlich? Erkennst du nicht, was das ist?«
»Ja, ich sehe, was das ist. Das sind Zeichnungen von uns, scheußliche Bilder.«
»Mutter, es handelt sich um Karikaturen. Wirklich wunderbare Skizzen. Sie hat uns alle mit wenigen Strichen getroffen. Ein Künstler würde sagen, daß diese Zeichnungen für ein vierzehnjähriges Mädchen genial sind.«
»Genial!« Sie streckte die Hand aus, packte eine Zeichnung und hielt sie ihm vor die Nase. »Sieh dir das an! Das soll ich sein!«
Bei der Frau auf der Zeichnung handelte es sich zweifelsfrei um seine Mutter, aber mit verzerrten Konturen. Der Körper war lang und dürr, das Gesicht hager und hängend, aber erst die scharf gezeichneten Züge zeigten die häßliche Härte, die Marie Anne in dieser Frau sah. Ihre Augen traten stechend wie zwei Nadelspitzen hervor, die Nase ähnelte einem scharfen Schnabel, und ihr Mund erinnerte an das Maul eines Hundes, der die Zähne fletschte. Ein wirklich abstoßendes Porträt. Pat schwieg einen Augenblick, bevor er sich wieder an seine Mutter wandte: »Du bist selbst schuld, daß deine Tochter das in dir sieht.« Als Veronica nichts sagte, fügte Pat hinzu: »Warum empfindest du nur diese Ablehnung für sie?«
Veronica umklammerte das Buch, das sie noch immer in den Händen hielt, als wollte sie es zerdrücken. Dann murmelte sie: »Ich bin machtlos dagegen. Sie war nie wie ein normales Kind. Irgendwie nicht menschlich. Viel zu wild. Du weißt, wie schwer sie zu bändigen war, und immer wieder lief sie davon. Und dann ihr Aussehen.«
»Nun, in der Familie sagen alle, daß sie den Zwillingen ähnelt, und soweit ich mich erinnere, waren die beiden Jungen auch von ungestümer Art. Richtige Wildfänge. Sie sind dir auf die Nerven gegangen, stimmt’s? Und du mußt zugeben, Mutter, daß du sehr erleichtert warst, als die beiden beschlossen, ihr Glück in Kanada zu suchen. Für Vater kam die Nachricht wie ein Donnerschlag, ebenso für Großvater. Aber du nahmst den Entschluß gelassen hin, nicht wahr? Du warst froh, die Zwillinge los zu sein. Ihre dauernden Streiche wurden dir zuviel. Du bist nie mit ihnen zurechtgekommen, vor allem, weil es zwei Jungen waren. Aber mit Marie Anne ist es anders. Sie war ein süßes, kleines Mädchen. Ein Baby.«
Veronica baute sich vor ihm auf. Sie preßte die Worte zwischen den Zähnen hervor, als sie ihn anschrie: »Ein Baby, das ich niemals wollte! Ein Baby, das durch körperliche Gewalt gezeugt wurde. Ich hatte fünf Kinder, sehr schnell hintereinander, und zwei Fehlgeburten. Mehr wollte ich nicht. Evelyn war damals bereits zehn Jahre alt, vergiß das nicht. Für meinen Teil hatte ich mit dem Kinderkriegen abgeschlossen, und er wußte das. Dennoch kam er noch immer in mein Bett. Ich ließ unsere Räume in den Ostflügel verlegen, so daß ihr Kinder die Auseinandersetzungen nicht mit anhören mußtet, wenn er seinen Willen nicht bekam.«
In eher traurigem Ton bemerkte Pat: »Oh, wir haben alles sehr gut gehört, Mutter, zumindest das Geschrei, wenngleich wir nicht verstanden, worum es ging, abgesehen von Marie Anne.«
»Das ist unmöglich. Sie schlief im anderen Flügel.«