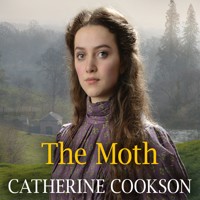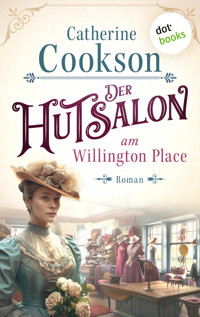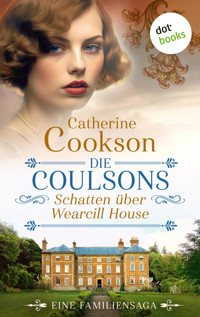5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Werden sie jemals eine Heimat finden? Der bewegende Roman »Die Masons – Schicksalsjahre einer Familie« von Catherine Cookson jetzt als eBook bei dotbooks. England in den 30er Jahren: Vor den Schatten der Vergangenheit flieht Abel Mason mit seinem kleinen Sohn in den Norden Englands. Das Schicksal scheint ihnen endlich wohlgewonnen, als der reiche Unternehmers Peter Maxwell sie auf seinem Anwesen aufnimmt. Doch Abels schmerzvolle Erinnerungen drohen ihn erneut einzuholen, als Maxwells Ehefrau ihm heimlich Avancen macht. Schon einmal hat Abel einen Preis für die Liebe zahlen müssen, der viel zu hoch war. Droht nun alles Dunkle von damals ans Licht zu kommen? Abel weiß, er sollte mit seinem Sohn erneut den Aufbruch ins Unbekannte wagen. Doch da ist auch noch Florrie Maxwell, Hildas Schwester, die in Abel etwas weckt, das er längst vergraben glaubte: ein Sehnen nach Heimat. Aber das scheint unerreichbar … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Roman »Die Masons – Schicksalsjahre einer Familie« der internationalen Bestsellerautorin Catherine Cookson wird Fans von Kate Morton begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Ähnliche
Über dieses Buch:
England in den 30er Jahren: Vor den Schatten der Vergangenheit flieht Abel Mason mit seinem kleinen Sohn in den Norden Englands. Das Schicksal scheint ihnen endlich wohlgewonnen, als der reiche Unternehmer Peter Maxwell sie auf seinem Anwesen aufnimmt. Doch Abels schmerzvolle Erinnerungen drohen ihn erneut einzuholen, als Maxwells Ehefrau ihm heimlich Avancen macht. Schon einmal hat Abel einen Preis für die Liebe zahlen müssen, der viel zu hoch war. Droht nun alles Dunkle von damals ans Licht zu kommen? Abel weiß, er sollte mit seinem Sohn erneut den Aufbruch ins Unbekannte wagen. Doch da ist auch noch Florrie Maxwell, Hildas Schwester, die in Abel etwas weckt, das er längst vergraben glaubte: ein Sehnen nach Heimat. Aber das scheint unerreichbar …
Über die Autorin:
Dame Catherine Ann Cookson (1906–1998) war eine britische Schriftstellerin. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern gehörte sie zu den meistgelesenen und beliebtesten Romanautorinnen ihrer Zeit; viele ihrer Werke wurden für Theater und Film inszeniert. In ihren kraftvollen, fesselnden Schicksalsgeschichten schrieb sie vor allem über die nordenglische Arbeiterklasse, inspiriert von ihrer eigenen Jugend. Als uneheliches Kind wurde sie von ihren Großeltern aufgezogen, in dem Glauben, ihre Mutter sei tatsächlich ihre Schwester. Mit 13 Jahren verließ sie die Schule ohne Abschluss und arbeitete als Hausmädchen für wohlhabende Bürger sowie als Angestellte in einer Wäscherei. 1940 heiratete sie den Gymnasiallehrer Tom Cookson, mit dem sie zeitlebens zurückgezogen und bescheiden lebte. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1950; 43 Jahre später wurde sie von der Königin zur Dame of the British Empire ernannt und die Grafschaft South Tyneside nennt sich bis heute »Catherine Cookson Country«. Wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag starb sie als eine der wohlhabendsten Frauen Großbritanniens.
Catherine Cookson veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre englischen Familiensagas »Die Thorntons – Sturm über Elmholm House«, »Die Lawsons – Anbruch einer neuen Zeit«, »Die Emmersons – Tage der Entscheidung« und »Die Coulsons – Schatten über Wearcill House« sowie ihre Schicksalsromane »Der Himmel über Tollet’s Ridge«, »Das Erbe von Brampton Hill«, »Sturmwolken über dem River Tyne«, »Ein Sturm über Saville House« und »Der Hutsalon am Willington Place«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1979 unter dem Originaltitel »The Man Who Cried«. Die deutsche Erstausgabe erschien 1985 unter dem Titel »Ein Mann kehrt heim« im Franz Schneekluth Verlag, München.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1979 by Catherine Cookson
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1985 Franz Schneekluth Verlag, München.
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Helen Hotson und AdobeStock/Robert Meyner
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98690-893-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Masons« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Catherine Cookson
Die Masons – Schicksalsjahre einer Familie
Roman
Aus dem Englischen von Ilse Pauli
dotbooks.
DER MANN, DER WEINTE
Ich stand nur da und sah ihm zu, dem weinenden Mann. Von Tränen genäßt das Gesicht, zum Schrei verzerrt der Mund.
Sein Kopf schlug gegen den Baumstamm.
Die Schultern bebten wie Wellen,
Von einem Sturm gepeitscht.
Und als ich fühlte, wie seine Qual Gestalt annahm in mir, da wußte ich, sie würde mich begleiten,
Für immer meine Tage durchdringen,
Meine Wege bestimmen
Und Richterin meiner Todsünden sein.
Meines Vaters Tränen waren der Schlüssel,
Der mir erschloß die Welt ‒
In ihrem höchsten Glück und ihrem tiefsten Elend.
C.C.
Teil 1:Die Reise, 1931
Kapitel 1
»Gehste zu dieser Beerdigung, haste zum Trauern nich’ mehr viel Zeit, das versprech’ ich dir. Bis jetzt wissen die nämlich noch nich’, wer der Kerl is’. Aber, bei Gott, die werden’s erfahren, wenn du auf diesem Begräbnis auftauchst. Und wenn die Kerle von Hastings erst mit dir fertig sind, is’ von deiner Visage nich’ mehr viel übrig, soviel is’ sicher.«
Abel Mason starrte quer durch den kleinen Raum der Kate seine wütende Frau an. Die sonnengebräunte Haut umspannte sein Gesicht, als sei sie aufgeklebt; die schmalen Lippen seines großen Mundes lagen aufeinander, nicht fest zusammengepreßt, sondern entspannt, wie in einem gelösten Schlaf. Nur seine Augen waren voller Wachheit, und ihr Ausdruck hob die Bewegungslosigkeit seines Gesichtes voll auf.
Doch der in ihnen lebende Ausdruck war nahezu undeutbar, mit einer einzigen Gefühlsregung nicht zu erklären, denn in den braunen Tiefen dieser Augen loderte nicht nur Abscheu, sondern Mitleid zugleich.
Diese Gefühlsregung war es, die sich seiner Frau mitteilte und sie schreien ließ: »Du hurender Dreckskerl, du!« Mit diesen Worten packte sie die Milchkanne, die auf dem Tisch stand, und schleuderte sie in seine Richtung.
Das Gefäß traf ihn an der Stirn, und die Milch spritzte über seine zerzausten blonden Locken, rann ihm das Gesicht hinunter in das kragenlöse Hemd. Mit erhobener Faust schnellte er vor, ließ sie jedoch nur krachend auf den Tisch sausen. Aus einer Ecke des Raumes erklang eine ängstliche, dünne Stimme: »Dad! O Dad!«
Die Faust noch auf die Platte gestemmt, stand er über den Tisch gebeugt, auf den rötlich gefärbte Milch hinuntertropfte.
Einige Sekunden verharrte er in dieser Stellung, dann richtete er sich wieder auf und ging mit gesenktem Kopf zur Treppe am anderen Ende des Raumes hinüber, die wie eine Leiter steil in das obere Zimmer führte.
Die Blicke seiner Frau verfolgten ihn, bis er endgültig verschwunden war; dann ging sie mit verzerrtem Gesicht in die Küche, kehrte mit einem Tuch zurück und fuhr mit weit ausholenden Bewegungen von einer Seite des Tisches zur anderen. Als sie die Stelle erreichte, wo die Milch vom Blut gefärbt war, wischte sie so heftig darüber, als könne sie damit alles Quälende auslöschen.
Mit ausgestrecktem Arm herrschte sie nun ihren sieben Jahre alten Sohn an: »Heb die Scherben da auf!« Der Junge bückte sich folgsam und sammelte die Überbleibsel der zerbrochenen Kanne ein. Als er mit den Scherben in der Hand den Raum verließ, um durch die Küche hindurch auf den Hof zu gehen, kam seine Mutter hinter ihm her. Ihre Finger gruben sich in seine Schultern und verliehen ihren Wörtern grausamen Nachdruck. »Wenn der meint, der käm’ heute aus diesem Haus raus, dann hat er sich geschnitten.« Sie packte den Jungen beim Kragen, drehte ihn unsanft zu sich herum, ging vor ihm in die Knie, so daß ihr Gesicht auf der Höhe des seinen war, und funkelte ihn aus stahlgrauen Augen an: »Hör zu, Junge. Wenn du mir jetzt nich’ sofort sagst, waste weißt, werd’ ich ihm noch mehr einheizen. Jetzt hältste noch zu ihm, er hat dich gegen mich aufgehetzt, aber lang wirste nich’ mehr brauchen, dann wirste schon wissen, auf welcher Seite dein Brot gebuttert is’. Wo hat er sie immer getroffen? Sag’s mir! Sag’s mir sofort!« Sie schüttelte ihn so heftig, daß die Scherben seinen Händen entglitten. Da verpaßte sie ihm noch eine schallende Ohrfeige und schrie: »Sag ihm nur, daß ich dich wieder geschlagen hab’. Los, geh schon, sag’s ihm, du Wickelkind.«
Er rannte zur Tür, die Hand fest gegen sein Ohr gepreßt. Wie mit tausend Nadeln durchzuckte ihn der Schmerz durch den Kopf, die Nase und die Kehle und machte ihm das Schlucken unmöglich.
Draußen rannte er mitten durch die Hühnerschar, die friedlich im Hof pickte, weiter um den kleinen Teich herum, wo zwei Entenfamilien damit beschäftigt waren, sich zu waschen, und hinunter in das Gehölz, das in den Wald führte. Hier hockte er sich nieder und wiegte sich, den Kopf haltend, hin und her.
Allmählich ließ der Schmerz nach. Er lehnte sich an den Stamm eines jungen Baumes und murmelte halblaut: »Gott sei Dank, daß Dad es nicht gesehen hat«, und auch in ihm glomm dieses Fünkchen Mitleid mit ihr.
Hatte sein Vater sie doch gewarnt, daß, schlug sie ihn wieder gegen sein Ohr, er das gleiche mit ihr tun würde, und genau das hatte er auch schon einmal getan. Es war das erste Mal gewesen, daß er die Hand gegen sie erhoben hatte. Die Wucht des Schlages hatte sie in eine Ecke geschleudert, wo sie liegengelieben war und sich wimmernd den Kopf gehalten hatte, ganz so wie er es jedes Mal tat, wenn sie ihn schlug, was immer dann geschah, wenn es zwischen den Eltern einen Streit gegeben hatte.
Tiefe Traurigkeit überkam ihn. Das Gefühl war so überwältigend, daß er sich vorstellte, es müsse die ganze Welt umfassen, seine Welt, die er kannte und die sich von Rye, das an der Küste links oberhalb von Winchelsea lag, hinüber zur Rechten nach Fairlight, entlang an den Buchten und Tälern bis nach Hastings hin erstreckte.
Seine Gedanken wanderten zu den Buchten und Tälern, und er bezweifelte, daß sein Vater ihn je wieder mit dorthin nehmen würde.
Wann hatte er ihn zum ersten Mal mit nach Fairlight Gien genommen? Oh, das war lange, lange her. War er vier oder fünf gewesen? Er wußte es nicht, nur daß es eine lange Zeit her war. Aber er konnte sich noch ganz genau an den Tag erinnern, an dem er zum ersten Mal Mrs. Alice in Ecclesbourne Gien begegnet war.
In Gedanken nannte er sie immer Mrs. Alice, weil sein Vater sie nämlich Alice nannte und nicht Mrs. Lovina. Er konnte sie natürlich nicht einfach Alice nennen und daher nannte er sie Mrs. Alice. Sie lachte immer, wenn er Mrs. Alice zu ihr sagte. Sie hatte ein so nettes Lachen; erst mußte man selber lächeln und dann unwillkürlich mit ihr lachen.
Es war an einem Sonntag gewesen, als sein Vater zum ersten Mal mit ihr geredet hatte. Viele, viele andere Leute waren an diesem Tag in dem Tal spazieren gegangen, denn es war schön, und die Sonne schien warm. Die Leute machten Picknick und Kinder sprangen zwischen den Felsen herum, die bis an die See hinunterführten. Sein Vater hatte ihm gesagt, er solle die Schuhe und Strümpfe ausziehen und mit den anderen Kindern spielen. Und das hatte er auch getan. Aber hin und wieder hatte er innegehalten und nach oben geschaut, wo sein Vater auf einem trockenen Felsen saß und mit… der Dame sprach. Eigentlich hatte er vom ersten Augenblick an gewußt, daß sie keine wirkliche Dame war, nicht so wie die, die in Winchelsea lebten, besonders die, die eine lange Einfahrt vor ihrem Haus hatten und für die sein Vater arbeitete, seit er vom Krieg zurückgekommen war ...: Nun, nicht wirklich vom Krieg zurückgekommen… Es gab da einen Knoten in seinen Gedanken, der etwas Beschämendes hinsichtlich seines Vaters und dem Krieg verdrängte.
Nein, Mrs. Alice war keine Dame, sie war wie seine Mutter, denn sie redete wie sie, gebrauchte dieselben Wörter wie sie, nur ihre Stimme war nicht hart und kreischend. Wann hatte er bloß angefangen, sich zu wünschen, Mrs. Alice wäre seine Mutter? Das war auch schon eine lange, lange Zeit her, Wochen, Monate.
Auch am darauffolgenden Sonntag waren sie zum Tal gewandert, obwohl das Wetter umgeschlagen hatte und es leicht regnete. Auch Mrs. Alice war dort gewesen. Aber an diesem Tag hatten sie alle drei unter einem Kliff gesessen, und sein Vater hatte eine Tafel Fry’s Schokolade geöffnet, und sie alle hatten einen Riegel gegessen. Seitdem hatte er bei Fry’s Schokolade immer an dieses Tal denken müssen.
Es war Winter geworden, bevor er seinen Vater wieder zu dem Tal begleiten durfte. An jenem Tag hatte seine Mutter zu wissen verlangt, wohin sein Vater ginge. Als er geantwortet hatte: »Spazieren«, da wollte sie wissen, warum er jetzt immer allein fortginge und ihn nicht mehr mitnähme. Da hatte sein Vater gesagt: »Geh und hol dir deinen Mantel. Zieh dich aber warm an.«
Nachdem sie bereits fünf Minuten gewandert waren, flüsterte sein Vater ihm zu: »Dreh dich nicht um, deine Mutter ist hinter uns.« An diesem Tag hatte sein Vater eine andere Richtung eingeschlagen, und sie waren auf der Straße ausgekommen, die zur Kirche nach Fairlight führte, wo sein Vater, nachdem er ihn auf eine hohe Mauer gehoben hatte, sich gegen den Wall lehnte und eine Zigarette anzündete, die er langsam rauchte, wobei er weder nach rechts noch nach links blickte. Die Rast, die sie dort eingelegt hatten, kam ihm wie eine Ewigkeit vor, doch ganz plötzlich hatte sein Vater ihn wieder von der Mauer heruntergehoben und gesagt: »Komm«, und er war mit ihm über Felder gelaufen, durch Zäune geklettert und für einige Zeit hoch oben auf dem Kliff entlang gewandert.
Endlich erreichten sie keuchend und atemlos das Tal. Es regnete jetzt heftig, und ein starker Wind blies. Aber da war Mrs. Alice und wartete im Schutz der Bäume. Bevor sie sie noch erreichten, ließ sein Vater seine Hand los, lief zu ihr und umarmte sie. Es schien, als habe sein Vater ihn an diesem Tag ganz vergessen.
Nach einer Weile hatte sein Vater ihn wieder bei der Hand genommen, und zu dritt waren sie unter den Bäumen zu einem Felsvorsprung gegangen. Dort sagte sein Vater zu ihm, nachdem er ihn unter einen schützenden Felsen plaziert hatte: »Dickie, bleib hier sitzen, nur für eine Minute. Ich… ich bin hier, auf der anderen Seite.«
Was war eine Minute? War es eine lange Zeit oder eine kurze? Er hatte sich sehr allein gefühlt, war sich ganz verloren vorgekommen, während er die eine Minute abwartete. Er hatte angefangen sich zu fürchten, weil er dachte, daß sein Vater fortgegangen sei und ihn zurückgelassen hätte, so wie er dies schon öfters seiner Mutter angedroht hatte, wenn sie sich im Haus stritten. Deshalb war er aus dem schützenden Felsüberhang herausgekrochen und gegen den Wind gelaufen, und als er um den Felsen kam, sah er sie. Sein Vater und Mrs. Alice knieten auf dem Boden. Vater hielt Mrs. Alices Gesicht zwischen seinen Händen und sagte gerade zu ihr: »Sag das nicht, bitte. Du bist das Beste, was mir je in meinem Leben begegnet ist. Du bist das einzig Gute, das ich jemals in meinem Leben erfahren habe. Schau ‒ nimm Florrie und ich meinen Dickie, und wir alle zusammen werden aus diesem gräßlichen Ort fortgehen. Trotz all der Schönheit hier war die ganze Gegend immer verflucht für mich. Willst du? Willst du, Alice?«
Er beobachtete, wie Mrs. Alice in das Gesicht seines Vaters blickte, und er würde sich immer an den Ton ihrer Stimme erinnern. »O Abel! Abel! Wenn ich doch nur könnte …«
»Doch, du kannst«, hatte sein Vater erwidert, »du mußt dich nur zu einer Entscheidung durchringen. Geh einfach weg.«
»Du kennst Florrie nicht. Sie ist zwölf, und alles, woran sie denkt, alles worüber sie spricht, ist ihr Vater. Und der hat mir gedroht, wenn ich ihn jemals verlasse oder irgendwie Schande über ihn bringe, würde er mich vernichten. Und wenn er dazu sein ganzes Leben brauchen würde.«
»Das ist doch nur Geschwätz, leeres Geschwätz. Seeleute reden immer so daher. Wir könnten weit weg sein, bevor er nach Hause kommt. Und ich habe mir auch schon was ausgedacht. Wie wär’s mit Kanada? Die ganze Welt liegt offen vor uns, Alice! O Alice, sag, daß du willst. Wir beide sind lang genug durch die Hölle gegangen, wir haben uns ein kleines bißchen Himmel verdient. Sag, daß du willst!«
»Der Junge!« Sie hatte ihn bemerkt. Doch sein Vater streckte die Hand nach ihm aus und bedeutete ihm näher zu kommen. Er stand auch nicht auf, sondern legte ihm den Arm um die Schulter. »Der Junge ist auf unserer Seite. Er hat auch Schlimmes hinter sich. Das hat ihn älter gemacht, als er in Wirklichkeit ist. Sein Leben ist unglücklich. Er ist hin- und hergerissen, aber im Grunde versteht er mich, nicht wahr?« Fest drückte sein Vater ihn an sich. Dickie sah ihn an und nickte. »Siehst du! Glaubst du’s jetzt, Alice?«
Er beobachtete das Gesicht von Mrs. Alice. Sie schluckte. Der Regen tropfte vom Rand ihres Hutes auf ihre ineinandergelegten Hände, und wieder erschien es ihm wie eine Ewigkeit, bevor sie sagte: »Ja. Ja, Abel, ich werd’s tun …«
Wann war das gewesen? Auch vor langer, langer Zeit, obwohl es nur zwei Wochen, vielleicht drei Wochen her war. Genau konnte er die Zeit nicht bestimmen, aber er erinnerte sich, wie sein Vater gesagt hatte: »Am nächsten Sonntag tun wir’s. Ich werde mit ihm Spazierengehen, ganz so, als machten wir unsere übliche Wanderung. Und du tust das gleiche. O Alice! Alice!«
Dickie fuhr zusammen, als er wieder die kreischende Stimme seiner Mutter vernahm. Zur gleichen Zeit waren dumpfe Schläge zu hören, so als ob jemand eine Tür eintreten wolle. Schnell sprang er auf und bahnte sich seinen Weg durchs Buschwerk, bis er die Kate sehen konnte. Auf dem Hof stand seine Mutter und schrie: »Ich hab’ dir gesagt, du wirst nich’ gehen. Und das wirste auch nich’. Bevor ich dich rauslasse, wird die schon lang zwei Meter unter der Erde sein. Da, wo sie hingehört.«
Wieder waren die dumpfen Schläge zu hören, und er wußte, sein Vater schlug mit seinem Stiefel gegen das Schloß.
Urplötzlich hörten die dumpfen Geräusche auf, und tiefe Stille umgab ihn. Er konnte die Vögel singen hören, eine Waldtaube gurrte über seinem Kopf; ein vorwitziges Kaninchen hastete über die Lichtung zwischen dem kleinen Wald und dem Ententeich. Aus der Feme vernahm er das klare Pfeifen der Eisenbahn, was schlechtes Wetter bedeutete, wie sein Vater immer sagte. In Gedanken sah er die Eisenbahn von Hastings durch Ore weiter nach Deleham Halt und die ganze Strecke nach Rye rattern.
Seine Gedanken an die Eisenbahn wurden plötzlich von splitterndem Glas unterbrochen, begleitet von einem lauten Krachen.
Sein Vater hatte das von der Mutter außen zugenagelte Küchenfenster mit Gewalt gesprengt, stieg durch die Scherben in den Hof und klopfte sich den Staub ab. Seine Mutter stand stocksteif keinen Meter entfernt. Er sah, wie sein Vater ihr den Rücken zukehrte, durch den zerbrochenen Fensterrahmen griff und dann den Filzhut in der Hand hielt.
Zweimal schlug er ihn gegen den Ärmel seines Mantels, drückte die Hutfalte tief, setzte ihn auf, zog ihn tief in die Stirn und ging mit langsamen Schritten davon. Aber noch hatte er nicht den Reitweg erreicht, als seine Mutter kreischte:
»Du bist kein Mann, du bist’n Schlappschwanz! Ein Drückeberger biste! Hat sich vorm Krieg gedrückt! Aus Gewissensgründen? Pah, verdammter Lügner! Gedrückt haste dich, weil du zu feig warst. Anständige Jungs sind getötet worden, abgeschlachtet worden sind sie, während du Kartoffeln rausgebuddelt hast. Du schlappes, erbärmliches Nichts, du!«
Fest preßte sich Dick die Hände gegen die Ohren, und mit den Augen verfolgte er den Vater, der langsam kleiner und kleiner wurde, bis er nur noch winzig aussah und dann verschwunden war.
Die Welt war auf einmal leer, furchtbar leer. Was, wenn er nie wieder zurückkäme? Was, wenn er zu Mrs. Alice Begräbnis ging und dann immer weiter gehen würde, bis in die Gegend, die der Norden genannt wurde? Die Gegend, über die er immer gesprochen hatte, die Gegend, wo er geboren worden war, die Gegend, wo die Leute freundlich und großherzig waren und nicht den lieben langen Tag stritten! Aber daher kam doch auch seine Mutter, und die stritt den ganzen Tag.
Er würde sterben, wenn sein Dad nicht zurückkam. Nein, das würde er nicht. Er würde sich aufmachen und ihn suchen, und er würde laufen und laufen, bis er ihn gefunden hatte.
Er ließ sich auf das trockene Laub nieder und beobachtete aus der Entfernung, wie seine Mutter die Glassplitter aufkehrte und das noch steckengebliebene Glas aus dem Fensterrahmen brach. Dies tat sie mit einem Hammer, mit dem sie gegen den Rahmen schlug, als wolle sie ihn endgültig zerstören. Ab und zu hielt sie inne, sah sich um und schimpfte laut vor sich hin.
Zu Beginn seiner Schulzeit hatte er oft wegen des langen Weges über die Felder bis zur Hauptstraße hin, wo der Bus abfuhr, gemault. Aber wann immer seine Mutter dieses unüberhörbare Gezeter anfing, war er froh, daß sie weit weg von anderen Menschen wohnten. Sonst ‒ das wußte er ‒ hätten die Jungs in der Schule ihn verhöhnt, so wie sie es mit Jackie Benton taten, weil sein Vater wegen Diebstahl im Gefängnis saß.
Nach einer Zeit, die ihm wie ein ganzer Tag vorkam, stand er auf und lief zurück durch das Gehölz in den kleinen Haselnußbaumwald hinein. Sein Vater nannte ihn den vergeblichen Wald, weil die Sträucher dünn waren und eng zusammen standen. Gehörte ihm der Grund, er würde alle diese Büsche fällen und dafür große Bäume pflanzen. Aber große Bäume gab es ja genug in dem hohen Wald, der von dem Haselnußwäldchen durch einen breiten öffentlichen Wanderweg getrennt war. Dieser Weg kam aus der Tiefe des Landesinneren, durchquerte zwei Farmen und endete auf der Klippe.
Er blieb auf dem Pfad stehen und blickte nach oben. Die Sonne stand genau über ihm, was bedeutete, daß sein Vater vor zwei Stunden fortgegangen war. Und doch schien es ihm wie eine Ewigkeit. Es war Zeit zum Mittagessen, aber er war nicht hungrig, obwohl er nicht gefrühstückt hatte. Zweimal hörte er seine Mutter nach ihm rufen, aber er beachtete ihr Rufen nicht. Er würde nicht eher in die Kate zurückgehen, bis sein Vater zurückgekehrt war. Obwohl er in Richtung Landstraße gegangen war, um den Bus nach Hastings zu nehmen, hatte Dickie das Gefühl, daß er nicht auf dem gleichen Weg zurückkehren würde, sondern aus Richtung der Täler. Tat er das, dann würde er den Wanderweg entlang kommen, der vom Kliff herunterführte.
Er wußte nicht, wie lange er schon gelaufen war, wie oft er sich hingesetzt oder ins Gras gelegt hatte. Er wußte nur, daß er des Wartens müde war. Und er hatte Angst, daß er seinen Vater verfehlen würde. Er fürchtete sich auch, weil er jetzt nach Hause zurückkehren mußte, zu seiner Mutter, ihrem Gezeter und den fürchterlichen Ohrfeigen.
Er hatte sich bereits schicksalsergeben umgedreht, um nach Hause zu gehen, als er in der Ferne, da, wo der Weg sich um Farmer Wilkie’s Hof wand, die Gestalt eines Mannes entdeckte. Sie war noch zu weit weg, als daß er hätte ausmachen können, ob es sein Vater war. Es konnte genauso gut ein Wanderer sein oder ein bettelnder Landstreicher.
Sein Herz hüpfte, als er tatsächlich seinen Vater erkannte, obgleich dieser noch weit von ihm entfernt war. Er ging mit gesenktem Kopf und schleppenden Schritten. Als er seinen Vater plötzlich den Weg verlassen und in den Wald laufen sah, blieb Dick abrupt stehen und schüttelte bestürzt den Kopf. Warum war Vater bloß im Wald verschwunden? Ob er vielleicht mal mußte? Aber dann wäre er doch nicht plötzlich so gerannt, oder?
Dick sprang über einen kleinen Graben und lief ebenfalls in den Wald. Hier standen riesengroße Eichen und Buchen und zwischen ihnen eng gedrängt viele Büsche, meistens Brombeersträucher und junge Eichen, die keinerlei Hoffnung hatten, jemals größer zu werden.
Er bahnte sich seinen Weg in die Richtung, die auch sein Vater genommen hatte, und nach einer Weile fand er ihn. Er hörte ihn, bevor er ihn sah, und dabei wurden seine Augen groß, sein Mund öffnete sich, und er preßte die Finger dagegen. Behutsam bewegte er sich in die Richtung, aus der die Laute kamen ‒ und dann erblickte er ihn. Die Arme um den Stamm einer Eiche geschlungen, schlug er mit dem Kopf gegen den Stamm, während er laut weinte.
Dieser Anblick und das Schluchzen waren so grausam, daß es ihn vor Schmerz schier zerriß.
Sein Vater stöhnte auf und wiederholte immer wieder: »O Alice! Alice!… O Alice! Alice!«
Unter den gesenkten Lidern sah Dick, wie sein Vater sich hilflos an den Baumstamm klammerte, wie er sich langsam umdrehte und mit dem Rücken gegen den Baum lehnte. Die Baumrinde hatte den Schnitt oberhalb der Augenbraue wieder aufgerissen, und Blut tropfte ihm über das Auge und die Wange hinunter. Doch er machte keinen Versuch, es wegzuwischen. Er stand nur einfach da, die Schultern gegen den Stamm gepreßt, den Kopf von einer Seite zur anderen werfend, das Gesicht nicht länger ausdruckslos, sondern so verändert, daß es in diesem Moment dem eines alten Mannes glich.
Langsam und behutsam ging Dick auf seinen Vater zu. Er wollte ihn auf gar keinen Fall erschrecken. Als er neben ihm angekommen war, blickte ihn sein Vater ohne jede Überraschung an. Es war, als habe er ihn erwartet. »O Dickie! Dickie!« stöhnte er auf, sank zu Boden und schlang beide Arme um ihn. Fest drückte der Junge das Gesicht an das des Vaters, und als dessen Tränen und Blut ihn benetzten, erwachte in ihm das Bewußtsein von menschlichen Qualen und Mitleid.
»O Dad! Dad!«
»Ist schon gut, Junge. Ist schon gut. Hier, wisch dir das Gesicht ab.«
Abel zog ein Taschentuch heraus und trocknete das Gesicht seines Sohnes, bevor er sein eigenes abwischte. Während er sich das Taschentuch gegen die Augenbraue hielt, um das Blut zu stillen, fragte er mit zitternder Stimme: »Wartest du schon lange?«
»Ja, Dad, schon die ganze Zeit.«
Langsam nickte Abel. Er ergriff die Hand des Jungen, erhob sich und schien eher mit sich selber, als mit seinem Sohn zu sprechen. »Es ist aus. Vorbei. Komm.«
Dick sagte nichts, stellte keine einzige Frage auf dem Heimweg. Er ahnte, daß etwas geschehen würde, daß sein Vater im Begriff war, etwas geschehen zu lassen, und des Vaters Schweigen verriet ihm, daß es etwas Schwerwiegendes sein würde.
Die Küchentür war geöffnet. Abel schob den Jungen vor sich her in den Raum, in dem seine Frau am äußersten Ende des leeren Tisches saß. Als sei er erst vor zwei Minuten fortgegangen, zeterte sie sofort wieder los: »So, biste also doch hingegangen? Ich hoffe, ‚s hat dir gutgetan. Schämen sollteste dich. Wenn ich Lady Parker die Wahrheit sagen würd’, würdste morgen aus deiner Stellung rausfliegen, ‚n Tritt in den Hintern würd sie dir geben.« Sie hielt inne und kniff die Augen zusammen. Dann rief sie mit schriller Genugtuung in der Stimme: »Ach nee, haste wohl geheult, was?«
Wie um ihn zu beschützen, tastete Dicks Hand rückwärts nach seinem Vater, bis er dessen Oberschenkel berührte, und er spürte das Zittern, das ihm durch das Bein lief, als seine Mutter nun verbittert hinzufügte: »Meinetwegen würdste keine Träne vergießen, aber wegen dieser Hure …«
»Halt’s Maul!«
»Was sagste da?« Sie war aufgestanden.
»Ich sagte, halt’s Maul. Wenn du’s nicht hältst, werd’ ich dir’s schon schließen.«
»Du? Ich hab’ dir gesagt, was passieren wird, wenn du jemals wieder versuchst, mich zu schlagen.«
»Lena, wenn ich die Hand dieses Mal gegen dich erhebe, wird’s das letzte Mal sein. Im Krieg war ich aus Gewissensgründen Kriegsdienstverweigerer, bin ins Gefängnis gegangen, weil ich nicht ans Gute im Töten glaube. Aber jetzt bin ich anderer Meinung geworden. Und das schon vor einiger Zeit.«
Während des nachfolgenden Schweigens sah Dick zum ersten Mal Furcht im Gesicht seiner Mutter aufglimmen. Unwillkürlich machte sie einen Schritt rückwärts, bis sie gegen die kleine Kommode stieß. Dick packte die Hand des Vaters und preßte ihm die Fingernägel in die Handfläche. Dies schien seinen Vater zur Besinnung zu bringen, doch seine tonlose Stimme war erschreckender, als hätte er geschrien.
»Du weißt, wie er sie getötet hat. Aber wußtest du auch, daß er es langsam getan hat? Er hat sich vorher alles genau überlegt. Zuerst schoß er ihr in die Füße. Als ihr Bruder von nebenan versuchte einzudringen, da hatte er alles verbarrikadiert. Auch die Polizei konnte nichts tun, denn er bedrohte sie mit seinem Gewehr, und er sagte ihnen, daß er es ihr Stück für Stück heimzahlen würde. Als nächstes schoß er ihr in den Bauch.« Seine Stimme brach ab, und seine Unterlippe zitterte, doch dann fuhr er fort: »Ich weiß nicht, ob sie tot war oder noch lebte, als er ihr die restliche Munition ins Gesicht schoß. Und das, Lena, das hat er wegen dir getan. Ist dir das klar? Wegen dir.« Eine lange Pause entstand, und ihr schwerer Atem war zu hören. Dann redete er wieder. »Du warst sehr schlau, sehr gründlich. Du hast ihm die Briefe nicht nach Hause geschickt, sondern zu seiner Reederei. Du hast deine Arbeit gut gemacht. Das einzige, was du nicht verraten hast, war mein Name. Und warum nicht? Weil sonst die Kerle unten in Old Town mich fertig gemacht hätten, und das wolltest du nicht, stimmt’s? O nein, du wolltest mich für den Rest meines Lebens erpressen können. Nun Lena, da hast du dich verkalkuliert. Und zwar gründlich. Keine Angst«, er hielt jetzt die geöffneten Hände hoch, »ich habe nicht vor, dich umzubringen! Was ich wirklich vorhabe, wirst du in einer Minute sehen.«
Mit diesen Worten drehte er sich um, schob Dick vor sich her auf die Treppe zu und als sie oben auf dem Treppenabsatz standen, befahl er ihm hastig: »Los, pack deine Sachen. Stiefel, Anziehsachen. Roll sie zu einem Bündel zusammen, so eng wie möglich.« Nach diesen Worten ging er ins Schlafzimmer, nahm vom Haken des behelfsmäßigen Kleiderschranks seine Arbeitskleidung herunter, zog aus einer Kommode Unterwäsche, Socken und zwei Arbeitshemden heraus, holte dann unter dem Bett einen Rucksack vor, und nachdem er all seine Sachen hineingestopft hatte, ging er damit an der Treppe vorbei in die winzige Kammer, die seinem Sohn als Schlafzimmer diente und packte die auf dem Bett ordentlich aufgestapelte Unterwäsche, die zwei Pullover, Socken und Hemden wortlos in seinen Rucksack. Dann befahl er Dick in barschem Ton: »Verplemper keine Zeit. Los, komm schon.«
Dick zögerte und sah zu der schmalen Fensterbank hinüber, auf der eine Reihe Vögel und andere Tiere in Ton gefertigt standen. Schnell nahm er zwei Enten an sich. Die eine stand auf einem Bein, während sie sich mit dem anderen Flügel kratzte, und die zweite war etwas kleiner, hatte die Schwimmfüße nach hinten ausgestreckt und den Hals nach vom gereckt. Als er sich die Tiere in je eine Hosentasche stopfte, sagte sein Vater nichts. Vom Türhaken nahm er noch einen Überzieher herunter, und dann gingen beide wieder nach unten.
»Was hast du vor? Was soll das? Hingehen tuste nirgendwo und schon gar nicht mit ihm.«
»Nein? Und wer sollte mich aufhalten?«
»Ich werd’ dir die Polente auf’n Hals schicken.«
»Tu das nur.«
»Du kannst mich nich’ einfach hierlassen, so ganz allein hier draußen.« Sie ging zur Tür hinüber und verstellte ihm den Weg. »Du weißt genau, ich kann nich’ arbeiten.«
»Du kannst bloß nicht arbeiten, weil du zu faul bist.«
»Ich bin nich’ faul. Sieh dich doch um, wie sauber ich das Haus hier halte.«
»Ein fünfjähriges Kind könnte die Arbeit in einer halben Stunde hier erledigen. Seit Jahren sucht Lady Parker eine Hilfe im Haus. Die Stelle des Küchenmädchens ist frei. Die wird sie dir schon geben. Wenn du wegen der Stelle nachfragst, sag ihr, ich hätte dich verlassen. Sie schuldet mir noch drei Tage Lohn.«
»Der Teufel soll dich holen! Ich werd’ kein Küchenmädchen.«
»Dann wirst du eben hungern müssen.«
»Ich werd nich’ hungern. Bei Gott! Ich werd nich’ hungern. Du bist mein Ehemann, und du hast mich zu versorgen.«
»Ich bin’s satt, dich zu versorgen«, ließ er sich von der Küche her vernehmen, aus der jetzt das Geklapper von Töpfen zu hören war.
»Ich werd dich wegen Entführung verklagen.«
»Dagegen kann ich die Tatsache anführen, daß ich ihn davor schütze, von dir völlig taub geschlagen zu werden. Du hast ihn nie gewollt, und du hast ihn das auch vom Tag seiner Geburt an spüren lassen.«
Er war wieder in das Zimmer zurückgekommen und sah zu ihr hinüber. Als er sie so betrachtete, überlegte er, wie sie vor zehn Jahren als Vierundzwanzigjährige ausgesehen hatte. Damals war es ihr gelungen, in ihm Beschützerinstinkte zu wecken.
Schon als Junge hatte er sich geschworen, sich nicht von seinem großen Mitgefühl überrennen zu lassen. Er hatte erkannt, daß Mitgefühl ohne Vorbehalt nur bei Tieren klug war. Jedoch die teuflische Lena hatte seine Schwäche erkannt und sie ausgenutzt. Mein Gott! Und wie sie sie ausgenutzt hatte! Voll hatte sie sich zuerst hinter seine Einstellung der Friedensliebe gestellt, hatte ihn als großen weisen Mann bestätigt. Doch die Ernüchterung war so schnell gekommen, daß es ihn krank gemacht hatte. So schlimm war es gewesen, daß er für einige Zeit all seine Selbstachtung verloren hatte und in sich selber nur den großen, einfältigen Toren sah. Das einzige, was sie vom Leben wollte, war Bequemlichkeit. Jemanden, der für sie arbeitete.
Und Ehrbarkeit, o ja, die Ehrbarkeit als »Frau« angeredet zu werden.
Wegen ihrer unehelichen Geburt und ihrer unerfreulichen Kindheit hatte er ihr zu Anfang ihrer Ehe alle Eigenheiten nachgesehen. Doch keines der vielen Gespräche und Diskussionen konnte sie überzeugen, den Geschlechtsakt nicht als etwas Schmutziges anzusehen. Wie er es überhaupt fertiggebracht hatte, ihr ein Kind zu machen, war ihm noch heute schleierhaft.
»Geh mir aus dem Weg!«
»Ich werde dir nachkommen. Ich werde dich schon finden. Ich weiß genau, wohin du willst. Zurück in den Norden willste, zu dem Abschaum dort oben.«
»Das ist die letzte Gegend, in die ich ziehen würde. Versuch’s mal mit Kanada oder Australien… Mach, daß du mir aus dem Weg kommst!«
Als sie sich nicht rührte, schoß sein Arm wie ein Brett vor und schleuderte sie beiseite. Heulend fiel sie hin.
Für einen Moment stand er da und blickte auf sie hinunter. Seine Stimme bebte vor tiefer Bitterkeit. »Wenn du nachts allein da oben liegst, denk daran, wie’s ist, wenn dein Körper so lange von Kugeln durchlöchert wird, bis du sterben kannst. Denk nur daran und mach dir klar, daß es nicht er war, der das getan hat, sondern du. Du hast sie beide getötet …«
Sein Vater hatte ihn bereits über den Zaun gehoben, als ihre gellende Stimme erneut ertönte. Sein Vater zog ihn an der Hand nach rechts, querfeldein über ein Stoppelfeld in das Haselnußbaumwäldchen und weiter in den großen Wald. Sie hielten sich nicht geradeaus. Ständig wechselten sie die Richtung und kamen außer Atem auf einer kleinen Seitenstraße aus. Hier machte Abel einen Moment Halt und meinte am Wegrand sitzend: »Na, dann wollen wir erst einmal unser Gepäck ordnen.«
Als er den Rucksack öffnete, erkannte der Junge die Pfanne, den Kessel und zwei Blechnäpfe, die alle unter dem Waschbecken in der Küche gestanden hatten. Dann ‒ mitten im Ordnen ‒ hielt sein Vater plötzlich inne, sah ihn an und fragte leise: »Du wolltest doch mitkommen, nicht wahr?«
»O ja, Dad, ja. Ich will immer bei dir sein.«
»Gut.« Er nickte und fuhr fort: »Ich werde dir einen kleinen Rucksack irgendwo auf dem Weg besorgen, und dann werden wir so richtig zum Wandern ausgerüstet sein, was?«
»Ja, Dad… Wohin gehen wir, Dad?«
Abel stand auf, schwang sich den Rucksack auf den Rücken und fuhr mit den Armen durch die Gurte, bevor er erwiderte: »Im Augenblick weißt du genauso viel wie ich, mein Junge. Aber wo immer wir hingehen werden ‒ es wird überall schöner sein. Du wirst schon sehen.«
Kapitel 2
Vier Tage später nahmen sie die Fähre von Gravesend nach Tilbury. Sie waren durch Sussex nach Kent gewandert und jetzt dabei, Essex zu betreten. Dick war so von den Docks, den Schiffen, den Kränen fasziniert, daß er momentan seine wundgescheuerten Zehen, seine Blasen an den Fersen und seine müden Beine vergaß.
Drei Nächte hatten sie im Freien übernachtet. Es war Juni und das Wetter warm. Gestern abend hatte sein Vater ihm mitgeteilt, daß sie nun doch in den Norden gehen würden, weil sie niemals vermuten würde, daß sie doch dorthin gingen. Sie wollten nicht allzu hoch in den Norden, also nicht bis nach Tyne. Das war der Name eines Flusses und der Ort, in dem sein Großvater geboren worden war. Irgendwo auf dem Lande würden sie schon eine Farm finden, hatte ihm sein Vater versichert. Er würde das doch mögen, nicht wahr? Ja, hatte er geantwortet.
Aber er hoffte, daß die Wanderung dorthin nicht zu lange dauern würde, denn seine Füße taten ihm höllisch weh. Er hatte seinem Vater nichts davon gesagt, nicht am ersten Tag, weil er fürchtete, daß sie dann wieder umkehren würden.
Nachdem sie die Fähre verlassen hatten, stellte sich Tilbury als enttäuschend dar: flach und schmutzig mit ein paar spärlichen Läden.
Sie gingen in ein Café und tranken eine Tasse Tee. Dann kaufte Abel einen kleinen Rucksack und etwas zum Essen ein: Wurst, Schinken, Fett, Kartoffeln, Zucker, Tee und einen großen Laib Brot. Als sie die Stadt hinter sich gelassen hatten, wählte Abel einen Platz aus, an dem sie ein Feuer anzünden und kochen konnten. Sie brutzelten sich Würstchen mit Schinken und aßen alles auf. Nach beendeter Mahlzeit und nachdem alle Kochgeräte mit Zeitungspapier gereinigt und wieder in die Rucksäcke verstaut worden waren, ließ sich Abel ins Gras nieder und nahm die Hand seines Sohnes in die seine. »Wir haben jetzt den Fluß überquert und werden nie wieder zurückgehen. Dickie, für dich und für mich fängt jetzt ein ganz neues Leben an. Verstehst du das?«
Der Junge nickte. Und dann stellte er eine Frage, die ihm schon seit zwei Tagen auf dem Herzen lag: »Dad, werde ich wieder in die Schule gehen?«
»Aber selbstverständlich. Haben wir uns erst einmal irgendwo niedergelassen, wirst du auch wieder in die Schule gehen, mein Junge. Und du wirst lernen. Du lernst schnell, und du wirst die verlorene Zeit wieder einholen, denn du bist intelligent. Meine Fertigkeit liegt in meinen Händen.« Er ließ Dick los und betrachtete seine Hände, erst von der einen, dann von der anderen Seite. »Was könnte ich mit denen schaffen, hätte ich Schnitzen gelernt. Ich hätte es zu was gebracht.«
»Du machst doch so schöne Tiere, Dad. Schau mal, meine Enten.« Dick langte hinter sich, griff in seinen Rucksack und entfaltete ein kleines Baumwollhemd, in dem die zwei Enten wie in einem Nest lagen. Sein Vater setzte sich das kleine Modell der sich kratzenden Ente auf die Hand und nickte. »Es hat Leben in sich, und doch ist es nur aus Lehm, aus ganz gewöhnlichem Flußlehm. Gebrannt worden ist es nie. Ein reines Wunder, daß es bis heute deiner Behandlung standgehalten hat.« Er lächelte seinem Sohn zu, dann gab er ihm die Ente wieder zurück, und während er aufstand, meinte er: »Also, dann laß uns mal dafür sorgen, daß das Feuer hier sicher gelöscht wird. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Sind deine Füße besser?«
»Ja, Dad. Ein bißchen.«
»Keine Bange, die werden noch abgehärtet. Je länger wir wandern, um so leichter wird’s dir. Wir werden ja auch nicht ununterbrochen laufen. Ich werde auf unserer Wanderschaft auch Arbeit annehmen, und dann kannst du dich ausruhen.«
»Dad, wie lange wird’s noch dauern, bis wir da sind ‒ im Norden?«
»Oh, das hängt ganz davon ab, was für Arbeit ich zwischendurch bekomme. Einen Monat, vielleicht zwei. Aber keine Angst, vor Winteranfang werden wir schon etwas gefunden haben, wo wir für immer bleiben. Komm jetzt.«
Als sie nach Brentwood kamen, fing es an zu nieseln, und sie stellten sich unter einem Kirchenportal unter. Abel zog eine abgenutzte Landkarte hervor, studierte sie und blickte dann zu Dick hinunter. »Wir werden nach Cambridge gehen.«
»Wie weit ist das, Dad? Wie viele Tage?« Es war wichtig für ihn, die Anzahl der Tage zu wissen, die sie brauchen würden, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, denn dann wußte er auch, wie lange ihm seine Füße wehtun würden.
»Na, so zwischen fünfundvierzig und fünfzig Meilen. Wenn das Wetter anhält, werden wir’s in ungefähr drei Tagen schaffen. Keine Sorge«, er tätschelte den Kopf seines Sohnes, »es wird schon alles werden. Ich werde Watte und Verbandszeug für dich kaufen, und wenn wir heute abend das Lager aufschlagen, werde ich deine Füße behandeln.«
»Dad, werden wir auch mal in einem Gasthof schlafen, so wie die Leute, die in Hastings Ferien machen?«
Abels Lippen verzogen sich zu einem schiefen Lächeln. »Im Augenblick nicht. Wenn ich erst mal Arbeit gefunden habe, sehen wir weiter. Aber bis jetzt haben wir doch Glück gehabt, nicht wahr?«
»Ja, Dad.«
»Na, dann wollen wir’s mal wieder mit den Elementen aufnehmen. Und vielleicht haben wir auch wieder Glück.«
Und sie hatten Glück. Zwei Meilen hinter Brentwood erreichten sie offenes Weideland, und als Abel etwas, das wie eine alte Scheune aussah, am Rand eines der Felder erspäht hatte, hielten sie darauf zu. Als sie den Schuppen betraten, stellten sie fest, daß er keineswegs so baufällig war, wie er zuerst ausgesehen hatte. Zur Hälfte war er trocken, und in der einen Ecke mußte vor kurzem jemand ein Feuer gemacht haben.
»Gut… gut. Na, haben wir nicht Glück? Such ein paar Reisige zusammen. Dann werden wir bald ein schönes Feuerchen haben, und ich werde mir deine Füße ansehen.«
Das Feuer war angezündet, in einem Topf brodelte das Wasser ‒ Abel sorgte immer dafür, daß sie eine Flasche Wasser bei sich hatten ‒ und sie waren soeben dabei, den Speck, der ihnen vom Frühstück übrig geblieben war, auszupacken, als ein Schatten durch den Toreingang der Scheune fiel und eine Stimme fragte: »Weißt du nicht, daß du hier auf Privatgrund stehst?«
Abel erhob sich aus seiner hockenden Stellung und sah sich einem Mann mit einem Tweedmantel und brauner Reithose gegenüber. In höflichem Ton entgegnete er: »Nein, Sir. Mir war klar, daß dies hier alles irgend jemandem gehören mußte, aber wir beschädigen auch nichts.«
»Nichts beschädigen? Aber über meine Felder trampeln und meine Rüben klauen und alles, was nicht niet- und nagelfest ist, was?«
Abels Gesicht verfinsterte sich. »Sir, ich habe nicht die Angewohnheit, etwas zu stehlen.«
»Na, dann mußt du ja ‚ne Ausnahme sein.« Der Mann trat nun vollends in die Scheune herein, und als er Dick gewahrte, wollte er wissen: »Ziehst du mit dem Kind da rum?«
Nach kurzer Pause erwiderte Abel: »Wir sind auf dem Weg nach Norden.«
»Offensichtlich seid ihr auf dem Weg nach irgendwohin, aber man sollte doch meinen …«
»Das ist mein Sohn und geht nur mich etwas an.«
»Ja, ja, das mag schon sein. Aber es ist meine Angelegenheit, darauf zu achten, daß mein Eigentum nicht zerstört wird. Also, mach daß du rauskommst.«
Bevor sich sein Vater noch nach der Feuerstelle umdrehen konnte, hatte Dick bereits begonnen, die Habseligkeiten wieder einzupacken.
Wenige Minuten später traten sie aus der Scheune, wo der Mann sie erwartete, die eine Hand in der Hosentasche, mit der anderen mit einem Stock die Samenbüschel von Löwenzahnstengeln schlagend.
»Ich hoffe, Sir, Sie werden niemals in Not geraten.« Abel sagte dies, während er an dem Farmer vorbeiging. Dann blickte er auf die in der Luft tanzenden Samenbüschel des Löwenzahns und fügte hinzu: »Und daß Ihr Unkraut kräftig wächst.«
Der Stock blieb mitten in der Luft stehen, und knallrot im Gesicht entgegnete der Mann drohend: »Macht bloß, daß ihr wegkommt, bevor ich einen anderen Gebrauch von diesem Stock mache.«
»So… Diese Idee würde ich mir an Ihrer Stelle aus dem Kopf schlagen, Sir.« Für einen Moment starrten sie einander an, dann wandte Abel sich ab, wobei er Dick vor sich herschob. Sie hatten beinahe das Feld hinter sich, als eine Stimme aus dem Graben sie aufschrecken ließ. »Hat sich euch wohl vorgenommen, eh?«
Abel sah auf etwas hinunter, das wie ein Bündel Lumpen aussah, aber mit einem höchst lebendigen Gesicht mittendrin. »Kümmert euch man nich’ um ihn; wartet ab bis’s dunkel is’. Verdammter Neureicher, der. Bist wohl neu in der Zunft, eh? Gesehen hab’ ich dich jedenfalls noch nich’. Wo willste denn hin?«
Abels Antwort fiel knapp aus. »In den Norden.«
»Na so was. Komisch, dahin zu gehen. Glaubste etwa, da findste Arbeit, eh? Die ganze Gegend von dort wandert nämlich hier runter ‒ die Schotten, die Geordies, die Walliser, alle. Haste ‚nen Stummel für mir?«
»Nein.« Abel schüttelte den Kopf.
»Würdste mir auch keinen geben, wenn de einen hättst, eh? Na ja, mach’ ich vielleicht auch so eines Tages.«
»Ich hab’ nun mal keine Zigaretten.«
»Schon gut, ich glaub’ dir’s. Biste pleite?«
Abel lächelte schief. Der alte Bursche war amüsant. Aber war er wirklich so alt? Er war schwer einzuschätzen.
»Weißte was?«
»Was?«
»Dein Gepäck wirste noch los, bevor de im Norden ankommst.«
Abel schob den Rucksack fester auf die Schultern hinauf. »Dann müssen die mich aber schon einsperren.«
»Pah, ‚s gibt Mittel und Wege. Mußt ja auch mal schlafen. Deiner sieht viel zu neu und zu voll aus; Mann, du siehst einfach reich aus. Willste meinen Rat? Zieh dir ‚nen ollen Mantel an, schön zerfetzt/verstau deine Klamotten drunter und kratz dich ‚n bißchen… so«, ‒ er demonstrierte letzteres ‒, »un’ dann rücken die dir nich’ auf’n Pelz.« Er lachte jetzt, ein tiefes, glucksendes Lachen. »Sind alles Neulinge in der Zunft. Ich, ich bin schon dreißig Jahr dabei. Einmal im Jahr mach’ ich die Runde. Manchmal frag’ ich nach Arbeit, dann geben die mir was, nur um mir loszuwerden. Aber du, du siehst ja aus, als hätt’ste noch Eierschalen hinter’n Ohren, dich kann man leicht übers Ohr hauen. Has’ auch noch Sohlen an den Stiefeln un’ dann der Jung da. Willste mit ihm auf so’ne Tour reiten?«
»Was willst du damit sagen?«
»Na ja, von wegen Mitleid wegen dem Balg und so. Kriegste keins, eher kriegste die Bullen auf n Hals, wenn du ihn betteln läßt.«
»Er muß aber mit mir kommen.«
Während er redete, wunderte sich Abel, warum er hier herumstand und nicht weiterging. Und er verachtete sich selbst, weil er den starken Wunsch verspürte, sich in diesen Graben niederzulassen und weiter dem Burschen zuzuhören und zu lernen. Denn er ahnte, daß die Erzählung den Tatsachen entsprach.
Als habe der Mann seine Gedanken gelesen, bot er an: »Wenn ihr wollt, könnt ihr ‚n Stück mit mir kommen… Ich zeig’ euch die Tricks.«
Für eine Sekunde zögerte Abel. »Auf jeden Fall vielen Dank. Beim Trampen werd’ ich’s schon lernen. Nichts für ungut, und danke für deine Ratschläge.«
»Warte! Da haste ‚nen Stummel.«
Er beobachtete, wie eine schmutzige Hand in einer Tasche verschwand, und dann wurde ihm ein Päckchen Zigaretten entgegengestreckt.
»Los, nimm schon eine. Sind sauber. Hab’ sie erst vor kurzem gekauft. Ganz frisches Päckchen. Siehste, fünf sind noch drin.«
Abel griff hinein und zog eine Zigarette heraus. »Vielen Dank.«
»Wiedersehn.«
Er wandte sich zum Gehen. »Mach’s gut, und paß auf dein Zeug auf«, rief ihm der Mann noch nach.
Nur den Kopf drehend, versicherte Abel: »Mach’ ich, mach ich.«
»Dad, das war ein komischer Mann, was?« Dick hatte sich halb umgedreht und lächelte. Als der Mann ihm zuwinkte, hob er zaghaft die Hand und winkte zurück. »Er hat mir zugewinkt, Dad.« Dick lachte.
»Er ist so ulkig und bringt einen richtig zum Lachen.«
»Ja, komisch ist er. Er ist ein alter Hase und weiß alles über die Landstraße. Wir scheinen noch viel lernen zu müssen, was?«
Sie wechselten einen Blick und wanderten schweigend weiter. Nach einer Weile fragte Dick: »Dad, wieviel Geld hast du noch?«
»Beim letzten Zählen waren’s noch zwölf Shilling und drei Pennies.«
»Das ist aber viel.«
»Es wird wohl ausreichen bis wir mehr bekommen.«
Aber woher sollte mehr kommen? Abel wollte sich nicht eingestehen, daß er sich Sorgen machte. Er mußte sich nach Arbeit umsehen, jede Art von Arbeit, und wenn es sie auch nur mit Essen versorgte.
Es war merkwürdig, doch die Notwendigkeit, Nahrung heranzuschaffen, hatte ihn zu einem gewissen Grad die Qual und den Schmerz vergessen lassen, die ihn in den vergangenen Tagen umzubringen drohten. Die Zeitabstände verlängerten sich, in denen er nichts anderes tun wollte, als sich zu Boden zu werfen und mit den Fäusten auf ihn hämmern und endlos weinen wollte. Er schämte sich seiner Schwäche, und während des Tages gelang es ihm auch, ihrer Herr zu werden. Doch des Nachts, wenn er von seinem eigenen Schrei »Alice! Alice!« geweckt wurde, war sein Gesicht tränenüberströmt.
Kapitel 3
Im Verlaufe der drei Tage, die sie brauchten, um Cambridge zu erreichen, erwiesen sich die Voraussagen des professionellen Landstreichers mehr als nur einmal als wahr. Erstens gab es keinerlei Arbeit, nicht einmal die niedrigste, und zweitens hatte ihr Gepäck eine Versuchung für diejenigen dargestellt, denen es noch schlechter als ihnen ging.
Vor vielen Jahren hatte Abel einmal Cambridge besucht, und daher erinnerte er sich noch an die Anlage der Stadt, an die Colleges, die Parks, den Fluß… und an den Bahnhof. Er richtete seine Schritte jetzt in diese Richtung, und Dick fragte interessiert: »Dad, wohin gehen wir?«
»Zum Bahnhof.«
»Fahren wir mit dem Zug, Dad?«
»Nein, nein.« Er lachte kurz auf. »Da kommen viele Leute an, die zum Urlaub hierher kommen und den Fluß hinauf- oder hinunterfahren wollen. Die brauchen Gepäckträger. Wenn wir dort sind, bleibst du ganz fest auf den Rucksäcken sitzen und rührst dich nicht vom Fleck. Um nichts in der Welt, verstanden?«
»Ja, Dad.«
»Gut.«
Am Bahnhof angekommen, erkannte Abel mit einem Blick, daß auf jeden Zugreisenden, dessen Gepäck nicht bereits getragen wurde, ein weiteres halbes Dutzend Gepäckträger wartete.
»Komm weiter.« Langsamer als zuvor gingen sie nun durch viele Seitenstraßen zum Fluß zurück. Dort ließen sie sich am grünen Ufer nieder und beobachteten die Schwäne. In der Ferne zu ihrer Rechten ankerte eine Menge von Mietbooten am Ufer, und ihm fiel auch der Name wieder ein: Banham. Gab es da vielleicht eine Arbeitsmöglichkeit für ihn? Nein, nein. Unwillkürlich schüttelte er den Kopf. »Komm, laß uns weitergehen, Dick.«
Sie überquerten den Fluß und wollten eben die Richtung nach Huntington einschlagen, als Abel seine Schritte verlangsamte. Er zog Dick neben sich und fragte mit dem Kopf deutend: »Na, was meinst du?«
Dick blickte nach vorn. Vor ihnen gingen zwei junge Frauen, die je zwei Koffer trugen, deren Gewicht ihnen offenbar zu schaffen machte. Er grinste zu seinem Vater hinauf. »Du könnst es ja versuchen, Dad. Aber du hast doch selber was zu tragen.«
»Aber meine Arme sind doch noch frei, oder? Los, komm.«
»Kann ich Ihnen beim Koffertragen behilflich sein, Miss?«
Die beiden jungen Frauen blieben stehen, und eine von ihnen meinte völlig außer Atem: »Oh! Da wäre ich Ihnen sehr verbunden. Was meinst du, Mary?«
»O ja. Ja. Meine Arme fallen mir fast ab. Wir haben nicht gedacht, daß es so weit vom Bahnhof entfernt ist.«
»Wo wollen Sie denn hin?«
»Zum Anlegeplatz, Banham’s Anlegeplatz. Der muß irgendwo hier sein. Der Mann sagte, es sei nur hier auf der Straße entlang und die zweite Abbiegung rechts runter.«
»Sie haben einen Umweg gemacht, Miss. Also, zwei kann ich tragen. Geben Sie her.« Er packte die beiden größten Koffer, und während er mit großen Schritten voranging und Dick hinter ihm herlief, folgten die beiden Mädchen kichernd und schnatternd ein Stück weiter hinten.
»Wir waren noch nie auf einem Boot, und das Geld fürs Taxi wollten wir uns sparen.«
»Woher kommen Sie?«
»Von Manchester.«
»Manchester!«
»Ja, seit Monaten freuen wir uns auf diese Tour. Glauben Sie, daß sich das Wetter hält?«
»Ja, ich denke schon.«
»Als wir abreisten, schüttete es… Herrlicher Juni!« Sie lachten, und Dick drehte sich um.
»Sind Sie auf Wanderschaft?« wollten die beiden wissen.
»So was ähnliches.«
Als sie zehn Minuten später am Anlegeplatz ankamen, bot sich ihnen ein Bild fröhlicher Geschäftigkeit. Einige Urlauber verstauten ihre Sachen an Bord ihres jeweiligen Bootes; andere wiederum schleppten Kartons mit Lebensmitteln aus einem Schuppen; einige Boote wurden geschrubbt, während auf anderen geübte Bootsarbeiter den Amateurseeleuten den simplen Steuerungsmechanismus erklärten. Lachen und Gesprächsfetzen erfüllten die Luft.
»Könnten Sie hier warten bis wir wissen, welches Boot wir bekommen?«
»Sei nicht dumm«, unterbrach das größere der beiden Mädchen ihre Freundin, »wir wissen doch genau, welches Boot wir kriegen. Es ist die Firefly. Wir müssen nur noch unsere Rechnung bezahlen.«
Sie lachten wieder und gingen auf das Büro zu.
Abel blickte sich um, und als einer der Bootsarbeiter an ihnen vorbeiging, berührte er den Arm des Mannes leicht und fragte: »Entschuldigen Sie, gibt’s hier ‚ne Möglichkeit zu arbeiten? Ich meine, nur für ‚ne Stunde oder zwei?«
Bedauernd blickte der Mann ihn an. »Tut mir leid, Kamerad, aber hier ist nichts zu machen.«
»Danke.«
Bei ihrer Rückkehr wurden die Mädchen von einem Bootsmann begleitet. Er führte sie zum Kai hinunter.
Die Firefly war ein Boot mit zwei Kojen. Neben ihr lag eine größere Jacht, auf deren Kabinendach eine Frau, angezogen mit einem kurzen Rock und einem weißen Pullover, saß. Als Abels Blick sie streifte, entging ihm nicht der Ausdruck von Verachtung auf ihrem Gesicht, während sie den Aufmarsch der Neuankömmlinge beobachtete.
Der Bootsmann nahm Abel die Koffer ab und verschwand im Inneren des Schiffes. Die Mädchen verabschiedeten sich fast gleichzeitig von Abel mit einem »Tschüs und danke.«
Er blieb stehen, und das Lächeln gefror ihnen auf den Gesichtern ‒ während die eine in die Kabine hinuntersteigen wollte, zischelte sie ihrer Freundin zu: »Er erwartet ein Trinkgeld.«
»Oh!« Worauf ein Kramen in der Handtasche erfolgte und eine Münze gereicht wurde. Er ließ sie auf der geöffneten Hand liegen und sah sie an. Es war ein Penny. Langsam nahm er ihn zwischen Zeigefinger und Daumen und reichte das Geldstück wieder zurück. »Miss, ich glaube, den brauchen Sie nötiger als ich.«
Als er sich abwandte und die Hand auf Dicks Schultern legte, hörte er noch die Worte: »Na, so was! Was erwartet der denn? Hat’s doch von sich aus angeboten, oder? So’ne Frechheit.«
Die Demütigung, die sein Vater erlitten hatte, teilte sich auch Dick mit, während sie auf dem Schleppweg neben dem Fluß entlang gingen. Ein Penny war nichts, und sein Vater hatte die Koffer ein langes Stück getragen. Sein Vater hatte ihm zum Beispiel nie weniger als drei Pennies die Woche Taschengeld gegeben. Die Dinge standen nicht gut. Dick machte sich Sorgen.
Nach einiger Zeit machten sie an einer Schleuse halt. Der Junge lenkte jetzt die Aufmerksamkeit des Vaters auf die Umgebung. »Sieh mal, Dad, wie toll die Boote ausschauen. Alle so schön aufgereiht. Worauf warten die, Dad?«
»Auf die Schleuse.«
»Aha.« Er wußte nicht, was eine Schleuse war, doch der Stimme des Vaters entnahm er, daß es jetzt nicht an der Zeit war, Fragen zu stellen. Kaum ein Wort hatte sein Vater gesprochen, seit sie den Anlegeplatz verlassen hatten.
»Können wir etwas hierbleiben und zuschauen, Dad?«
»Warum nicht?«
Er sah seinem Vater zu, wie dieser den Rucksack vom Rücken herunterrutschen ließ und folgte seinem Beispiel. Dann setzten sie sich beide Seite an Seite oberhalb des Schleppweges.
Ein Boot kam jetzt den Fluß hinunter. Sie beobachteten, wie es auf das Ufer zuhielt. Ein junges Mädchen stand am Bug mit einem Tau in der Hand, und eine Frau lenkte das Steuerrad. Der Wind, der vom Ufer herblies, und die Strömung, die über das Wehr zur Schleuse hin verlief, machten ihr Schwierigkeiten. Zweimal mußten sie in die Flußmitte zurück, bevor es ihnen gelang, mit dem Bug direkt auf das Ufer zuzuhalten.
Das Mädchen sprang vom Boot ans Ufer und zog das Seil an, doch der Wind packte das Heck und ließ es hin und herschlingern.
Dick spürte, wie sein Vater einen Augenblick lang zögerte, bevor er aufsprang. Doch dann lief er zu dem Mädchen hinüber, nahm ihm das Tau aus der Hand und zog das Schiff am Bug auf das Ufer zu, brachte es durch Ziehen und Stoßen in die richtige Position, bis die Frau an Bord ihm einen Bootshaken zuwarf, den er in eine Klampe, eine Vorrichtung zum Festzurren eines Bootes, stieß. Dann brachte er langsam das Boot längsseits.
Er hielt es noch fest, als die Frau, über eine Seite des Cockpits gebeugt, ihm zurief: »Danke. Vielen Dank.«
»Bitte sehr.«
»Hab’… hab’ ich Sie nicht unten am Anlegeplatz gesehen?«
Er hatte sich bereits vom Ufer abgewandt. Kurz sah er wieder zu ihr hinüber: »Ja, ich war da unten.«
Nach einer kurzen Pause meinte sie: »Es wird wohl einige Zeit dauern, bis wir durchkommen. Glauben Sie, es lohnt sich zu ankern?«
»Keine Ahnung, das müssen Sie wissen.«
»Ich glaube, wir sollten’s tun. Würden Sie wohl das Boot für mich festmachen? Hier, Daphne, gib dem Herrn das Ankertau.«
Dick spürte, wie die Spannung in ihm nachließ. Sie hatte seinen Vater einen Herrn genannt. Sie war eine nette Dame. Er beobachtete, wie sein Vater zuerst den eisernen Haken in den Boden schlug. Als er das getan hatte, zog das junge Mädchen das Tau durch den Ring des Eisenstückes.
Als das gleiche am anderen Ende gemacht worden war, lag das Boot parallel zum Flußufer. Die Dame kletterte vom Boot hinunter und näherte sich seinem Vater. Lange musterte sie ihn, bevor sie leise fragte: »Würden Sie uns wohl durch die Schleuse bringen? Ich bin noch etwas unsicher mit dem Boot. Es sind schon ein paar Jahre her, daß ich zum letzten Mal auf einem Fluß war, mit… mit meinem Mann.«
Es schien eine Ewigkeit zu vergehen, bevor sein Vater antwortete: »Was soll ich tun?«
»Oh, nur die Taue halten, damit sich das Boot nicht bewegt, während die Schleuse geleert wird.«
»In Ordnung.«
»Würde Ihr Sohn vielleicht gern an Bord kommen?«
Als sie zu Dick hinunterblickte, leuchtete sein Gesicht auf, und mit verklärtem Blick fragte er: »O Dad, darf ich?«
Wieder entstand eine Pause. »Wie soll er denn wieder runterkommen?«
»Oh, wir könnten ihn auf der anderen Seite der Schleuse wieder herauslassen, und Sie ebenfalls. Sie könnten nämlich oben auf der Schleuse zusteigen, und wir könnten Sie ‒ wo immer Sie wollen ‒ wieder absetzen.«
Dick sah, daß des Vaters Blick fest auf ihm lag. »Nun, schaden kann das ja nicht.«
Es war herrlich aufregend, auf so einem Boot zu stehen und gleichzeitig ein wenig zum Fürchten. Das Mädchen stand am Steuerrad, doch redete es nicht mit Dick; sein Vater und die Dame standen stumm am Ufer, bis auf einmal die Dame aufgeregt wurde und rief: »Da sehen Sie!« Sie deutete auf die vor ihnen liegende Schleuse. »Die Boote da vom sind schon durch, und wir könnten mit den zwei kleineren Booten vor uns durchkommen. Kommen Sie, wir lichten die Anker und machen uns fertig. Bringen Sie Ihre Sachen… Ihr Gepäck an Bord.«
Als er sah, wie sein Vater mit grimmigem Gesicht die eisernen Haken vom Ufer löste, fühlte er sich unsicher. Doch als Abel, die zwei Taue in den Händen, ihm lächelnd zunickte, durchfuhr ihn ein Gefühl des Glücks. Es war das erste Mal seit Wochen, daß er seinen Vater lächeln sah.
Die Frau und das Mädchen waren nun an Bord, und die Frau rief seinem Vater zu: »Den Motor werde ich nicht anlassen. Ich überlasse alles Ihnen. Sobald sich die Schleusentore öffnen, ziehen Sie es hinüber.« Sein Vater antwortete nicht. Er sah zur Schleuse hinüber.
Zum ersten Mal richtete das Mädchen nun das Wort an ihn. »Komm mit nach vom«, forderte es ihn auf, »du kannst dort stehen und dir alles von oben anschauen.«
Er folgte ihr eine steile Leiter hinunter in die Kabine, die zu beiden Seiten mit gepolsterten Sitzen ausgestattet war, dann durch eine Luke hinauf in den vorderen Teil des Bootes.
»Willst du dich aufs Kabinendach setzen?«
Er schüttelte den Kopf und hielt sich am Handlauf fest.
»Wie alt bist du?«
»Sieben.«
»Wie heißt du?«
»Dickie.«
»Sieben.« Sie wandte den Kopf ab und blickte über den Fluß und fügte kaum hörbar hinzu: »Noch sehr jung.« Dann sah sie ihn wieder an und erklärte: »Ich bin fünfzehn.«
Er wußte nicht, was er darauf erwidern sollte, aber irgendwie empfand er, daß sie es ihm anlastete, daß er erst sieben war.
Als das Boot sich langsam vom Ufer fort bewegte, zitterte er vor Aufregung. Sie lächelte. »Du bist wohl zum ersten Mal auf einem Boot, was?« meinte sie.