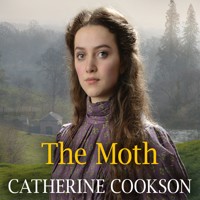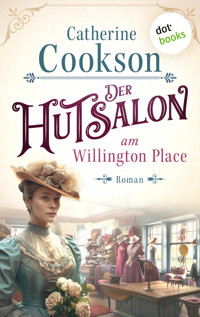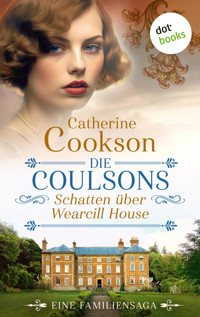5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Welchen Preis wird sie für das Glück zahlen müssen? Der Roman »Ein Sturm über Savile House« von Catherine Cookson als eBook bei dotbooks. Als ihre Familie eine Dinner-Einladung des Herzogs von Moorshire erhält, ist Maggie überwältigt. So viel hat ihr Mann Rod bereits für den Wohlstand der Stadt getan, so viele Opfer hat sie selbst gebracht. Noch ahnt Maggie nicht, dass diese Einladung zu ihrer härtesten Prüfung werden wird: Ein Abend, der sie alles kosten könnte. Sie begeht einen Fehltritt, der in den Augen der engstirnigen feinen Gesellschaft ein unverzeihlicher Skandal ist und plötzlich wenden sich alle von ihr ab. Selbst Rod scheint sie nur noch als Last zu sehen, die sein Ansehen als Bauunternehmer schmälert. Bald muss Maggie sich der Frage stellen, was sie noch zu geben bereit ist – oder ob das Leben noch viel mehr zu bieten hat, wenn sie nur mutig genug ist, für sich selbst und ihre Träume zu kämpfen … »Feiner Humor, Entschlossenheit und Großzügigkeit sind Cooksons Tugenden. . . In der Welt der Frauenromane hat Cookson ihre ganz eigene Handschrift geschaffen.« The Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Schicksalsroman »Sturm über Savile House« der großen englischen Bestsellerautorin Catherine Cookson wird Fans von Barbara Taylor Bradford begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als ihre Familie eine Dinner-Einladung des Herzogs von Moorshire erhält, ist Maggie überwältigt. So viel hat ihr Mann Rod bereits für den Wohlstand der Stadt getan, so viele Opfer hat sie selbst gebracht. Noch ahnt Maggie nicht, dass diese Einladung zu ihrer härtesten Prüfung werden wird: Ein Abend, der sie alles kosten könnte. Sie begeht einen Fehltritt, der in den Augen der engstirnigen feinen Gesellschaft ein unverzeihlicher Skandal ist und plötzlich wenden sich alle von ihr ab. Selbst Rod scheint sie nur noch als Last zu sehen, die sein Ansehen als Bauunternehmer schmälert. Bald muss Maggie sich der Frage stellen, was sie noch zu geben bereit ist – oder ob das Leben noch viel mehr zu bieten hat, wenn sie nur mutig genug ist, für sich selbst und ihre Träume zu kämpfen …
Über die Autorin:
Dame Catherine Ann Cookson (1906–1998) war eine britische Schriftstellerin. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern gehörte sie zu den meistgelesenen und beliebtesten Romanautorinnen ihrer Zeit; viele ihrer Werke wurden für Theater und Film inszeniert. In ihren kraftvollen, fesselnden Schicksalsgeschichten schrieb sie vor allem über die nordenglische Arbeiterklasse, inspiriert von ihrer eigenen Jugend. Als uneheliches Kind wurde sie von ihren Großeltern aufgezogen, in dem Glauben, ihre Mutter sei ihre Schwester. Mit 13 Jahren verließ sie die Schule ohne Abschluss und arbeitete als Hausmädchen für wohlhabende Bürger sowie als Angestellte in einer Wäscherei. 1940 heiratete sie den Gymnasiallehrer Tom Cookson, mit dem sie zeitlebens zurückgezogen und bescheiden lebte. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1950; 43 Jahre später wurde sie von der Königin zur Dame of the British Empire ernannt und die Grafschaft South Tyneside nennt sich bis heute »Catherine Cookson Country«. Wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag starb sie als eine der wohlhabendsten Frauen Großbritanniens.
Catherine Cookson veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre englischen Familiensagas »Die Thorntons – Sturm über Elmholm House«, »Die Lawsons – Anbruch einer neuen Zeit«, »Die Emmersons – Tage der Entscheidung«, »Die Coulsons – Schatten über Wearcill House« und »Die Masons – Schicksalsjahre einer Familie« sowie ihre Schicksalsromane »Der Himmel über Tollet’s Ridge«, »Das Erbe von Brampton Hill«, »Sturmwolken über dem River Tyne« und »Der Hutsalon am Willington Place«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1970 unter dem Originaltitel »The Invitation« bei Macdonald. Die deutsche Erstausgabe erschien 1975 unter dem Titel »Herz im Sturm« im Marion von Schröder Verlag
Copyright © der englischen Originalausgabe 1970 The Catherine Cookson Charitable Trust
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1975 Marion von Schröder Verlag GmbH, Düsseldorf
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von ShutterstockSergeyCo, Richard Semikolon, Flower Garden und AdobeStock/raquel.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98690-877-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sturm über Savile House« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Catherine Cookson
Ein Sturm über Savile House
Roman
Aus dem Englischen von Karl Berisch
dotbooks.
Erster Teil
Kapitel 1 ‒ Sam
Maggie Gallacher starrte mit großen Augen auf die Karte in ihrer Hand. Es war eine Karte mit Goldrand. Die ineinander verschlungenen Initialen in der rechten Ecke vermochte sie nicht zu entziffern, aber sie konnte die Schrift lesen ‒ die Worte leuchteten auf dem Papier, als seien sie mit reinstem Goldstaub gedruckt, und für sie bedeutete jedes Wort eine Stufe hinauf zu der gesellschaftlichen Anerkennung, die Rodney an ihrem Hochzeitstag vor neunundzwanzig Jahren zu erringen begonnen hatte. Diese Karte, dieses Stückchen Pappe, der letzte Schritt auf dem Weg nach oben, jetzt hatten sie es geschafft. Und sie waren nicht einmal außer Atem, bei Gott, nein, sondern saßen gemütlich in Savile House, in der besten Gegend von Fellburn; nicht mehr in Brampton Hill, sondern in dem feinen Viertel, das allgemein The Rise hieß. Saßen gemütlich in zwölf Zimmern mit einem Garten von zwanzig Morgen, in dem sogar ein Bach floß. Und ihr Haus war möbliert, wie es ihnen erst einmal einer nachmachen sollte. Aber das war nicht alles, nein ‒ der Name Gallacher hatte in der Stadt einen Klang wie eine Kirchenglocke. Hatten nicht Gallacher & Sons die neue Schule gebaut und die Siedlungen von Rollingdon und Morley? Und hatten es nicht ihre Kinder alle zu etwas gebracht? Wenigstens fünf. Und dem sechsten, das jetzt neben ihr saß, dem war ein Glorienschein sicher.
Maggie ergriff die Hand ihrer jüngsten Tochter, und Elizabeth stieß ihre Mutter mit dem Ellbogen in die Seite, und sie lachten beide, wie nur die Gallachers lachen konnten, gründlich, wie alles, was die Gallachers taten, aus Leibeskräften, markerschütternd und ansteckend. Alle Gallachers lachten so, ausgenommen Paul. Aber Paul, ihr jüngster Sohn, machte in allem eine Ausnahme, er ähnelte niemandem in der Familie. Doch Maggie liebte ihn, so wie er war.
»Soll ich sie anrufen?« Elizabeth wischte sich eine Lachträne von ihren langen schwarzen Wimpern. Maggie blinzelte sie an, als ob sie sagen wollte: Worauf wartest du noch? Und Elizabeth sprang von der Couch und lief zum Telefon, das auf der Marmorplatte einer nachgemachten Louis-quinze-Kommode stand, und setzte sich auf den vergoldeten Stuhl davor. Ehe sie den Hörer abnahm, fragte sie ihre Mutter: »Sam und Arlette zuerst?«
Maggie nickte.
Sam war ihr Ältester. Es war ganz selbstverständlich, daß er es als erster zu hören bekam. Doch Sams Reaktion auf die Neuigkeit interessierte sie weniger als die seiner Frau. Mütter sind im allgemeinen eifersüchtig auf die Frauen ihrer Söhne, besonders auf die Frau ihres Erstgeborenen, aber Maggie war nie auf Arlette eifersüchtig gewesen. Es war ihr immer sonderbar vorgekommen, daß sie für Sams Frau solche Sympathie empfand; denn sie und Arlette waren in Erziehung, Denken und Lebensauffassung gänzlich verschieden, doch auf eine merkwürdige Weise stand sie ihr nahe. Maggie fühlte, daß sie ihre Schwiegertochter verstand, während die Kinder geteilter Meinung über ihre Schwägerin waren und deren Zurückhaltung teils als Snobismus, teils als Herablassung kritisierten. Nur Elizabeth mit ihrer jugendlichen Begeisterungsfähigkeit fand Arlette »einfach Spitze« und damit stimmte Maggie überein. Sie hatte es nie laut gesagt, nicht einmal zu Rod, aber immer gedacht, daß ihr Sam verdammtes Glück gehabt hatte, so eine wie Arlette zu kriegen. Sicher war er groß, und gut sah er aus, und im Geschäft war er immer auf Draht. Aber er war patzig. Ja, das war das richtige Wort: patzig. Und dann gab es da noch etwas bei ihrem Sohn, etwas, wohinter sie noch nicht gekommen war … Doch jetzt sprach Lizzie mit ihm. »Hallo! Bist du’s, Sam?«
»Wen hast du denn erwartet? Natürlich bin ich es. Was ist los? Du bist ja ganz außer Puste.«
»Du wirst es nicht glauben, was ich dir jetzt sage … Es betrifft Mama und Papa.«
»Erzähl mir bloß nicht, daß sie heiraten wollen.«
»Ach, Sam! Das sag’ ich ihr, verlaß dich drauf.«
»Tu’s doch. Also, was ist passiert … Sie kriegt doch nicht etwa noch ein Kind?«
»Aber Sam!«
»Na dann … Jetzt weiß ich’s ‒ sie lernt Französisch, um Arlette einen Gefallen zu tun.«
»Sei nicht so sarkastisch, Sam Gallacher. Glaubst du etwa, sie könnte es nicht lernen?«
»Ich weiß, daß sie es könnte; sie könnte alles schaffen, was sie will, unsere dicke alte Mutti.«
»Also, jetzt hör zu. Spitz deine Ohren. Papa und Mama haben eine Einladung zu einer musikalischen Soiree. Rate, von wem.«
»Von der Königin natürlich.«
»Nein, aber du bist nahe dran. Kohle.«
Es entstand eine Pause, ehe Sam antwortete. »Was du nicht sagst! Nun befreie mich endlich aus meiner quälenden Ungewißheit.«
»Also, ich halte eine wunderschöne Karte in meiner Hand, auf der steht eine Einladung von … vom HERZOG VON MOORSHIRE!… Bist du noch da?… Bist du noch da, Sam?«
»Ja. Ja, ich bin noch da. Stimmt das wirklich, was du da sagst ‒ vom Herzog von Moorshire?«
»Ja, tatsächlich.« Wieder schien die Leitung tot. Dann kam Sams Stimme zurück, ziemlich tonlos, als er sagte: »Alle Achtung! Wir steigen auf, nicht wahr?«
Elizabeth blickte ihre Mutter an. Sie wollte zu Sam sagen: ›Du scheinst nicht besonders begeistert zu sein‹, doch sie sagte: »Ist Arlette da?«
»Sie badet gerade.«
»Glaubst du, daß ihr später herüberkommen könnt? Ich rufe alle an.«
»Ja, ja. Wir kommen vorbei. Das wird eine rührende Familienfeier geben.«
»Ach, Sam! Tschüs also.«
»Tschüs.«
Sam Gallacher legte den Hörer auf und starrte ihn an; dann verschob er den Unterkiefer und kaute an seinem Mundwinkel. Er ging durch die Diele und das große Wohnzimmer, um den L-förmigen Eßtisch herum und in einen kleineren Korridor, an dem Badezimmer, Toilette, Küche und Waschküche lagen. An der Tür des Badezimmers blieb er stehen, hörte das Wasser aus der Wanne laufen und drückte auf die Klinke. Die Tür war verschlossen wie immer. Er wartete und lauschte auf die Geräusche drinnen, stellte sich vor, wie sie vor dem Spiegel stand, das Gesicht kühl, ausdruckslos, bis sie merkte, daß er im Hause war. Sie würde ihren Morgenmantel anhaben. O ja, sie blieb niemals lange nackt, nicht einmal im Badezimmer. Er hatte ihr einmal vorgeschlagen, im Schlüpfer zu baden; ganz im Badezimmer zu wohnen und darin zu übernachten, weil sie so versessen aufs Baden war. Sie hatte es ihm damals zurückgegeben und ihm erklärt, warum sie soviel badete, und er hatte ihr auf den Mund geschlagen. Am selben Abend wurde plötzlich ihre Tante krank, und sie mußte nach Devonshire fahren. Es lag ihr fast ebenso daran wie ihm, den Schein zu wahren, und er wußte warum, und der Grund brachte ihn noch mehr in Rage. Und dieser Grund war nun beim Herzog eingeladen worden. Allmächtiger Gott! Seine Mutter beim Herzog! Die Badezimmertür ging auf. Er sah seine Frau herauskommen, beobachtete, wie ihre lange Hand den Morgenrock fester zusammenzog.
»Ich wußte nicht, daß du zu Hause warst.« Sie ging an ihm vorbei durch das Eßzimmer und eine der gegenüberliegenden Türen. Schweigend folgte er ihr ins Schlafzimmer und sah, wie sie sich an den Frisiertisch setzte und sich das Haar zu bürsten begann. Sie würde sich nicht anziehen, das wußte er, solange er im Zimmer war. Er stellte sich hinter sie und betrachtete ihr Gesicht im Spiegel; auch ohne Make-up und noch feuchtschimmernd vom Bade, das Haar glatt aus der Stirn gestrichen, war sie schön, eine ernste, starre, leblose Schönheit.
Als er ihr die Hand auf die Schulter legte und ihre Haut unter seinen Fingern zusammenzucken fühlte, bäumte sich etwas in ihm auf, doch er mahnte sich: »Vorsicht, Vorsicht«, und so sagte er lächelnd, während er ihr im Spiegel in die Augen blickte: »Ich habe eine Neuigkeit für dich.«
Ihre Augen blieben unbewegt, abwartend.
»Du wirst es nicht erraten, nicht in tausend Jahren. Hast du nicht das Telefon gehört?«
Sie wartete noch immer.
»Sie haben eine Einladung vom Herzog von Moorshire zu einer musikalischen Soiree. Ist es zu glauben? Rod und Maggie.«
Ihre Augen weiteten sich ein wenig, der Anflug eines Lächelns trat auf ihre Lippen, und ihre Stimme klang eine Spur bewegter, als sie sagte: »Das ist schön, wirklich wundervoll. Ich freue mich für sie.«
Er zog sich einen Stuhl heran, stellte ihn dicht an ihren Hocker, mit dem Rücken zum Frisiertisch, und als er sich darauf niederließ, sich zur Seite beugte und ihr Spiegelbild verdeckte, konnte er ihr beinahe ins Gesicht sehen. Er sagte, eifrig nickend: »Ja, wirklich, nicht wahr? Nun, ich kann verstehen, daß er die Einladung bekommen hat, und er wird sich der Lage gewachsen zeigen, daran ist kein Zweifel, aber Mama … sie und der Herzog ‒ kannst du dir das vorstellen?«
»Ja, ich kann es mir vorstellen. Du traust ihr nie etwas Richtiges zu, weil du …« Sie schluckte den Rest hinunter, schloß die Augen und wollte aufstehen. Doch er hielt sie fest und sagte: »Komisch, nicht wahr? Ich möchte wetten, es kommt in zehn Millionen Familien nur einmal vor, daß der Sohn gegen seine Mutter ist und die Schwiegertochter für sie. Und was für eine Schwiegertochter, wie? Und was für eine Mutter. Sieh einer an! Sag mir die Wahrheit: warum hast du sie gern?«
Sie schüttelte den Kopf, als wolle sie sich von einem bösen Traum befreien, und murmelte: »Hör auf. Hör damit auf. Ich dachte, damit sind wir längst fertig. Ich habe es dir doch gesagt.«
»Dann sag’s mir noch einmal; aber erzähl mir nur nicht, der Grund sei der, daß du mit sechs Jahren deine Mutter verlorst und Mama dich gleich mit offenen Armen aufnahm. Denn, wie ich dir schon ein paarmal gesagt habe, zwischen meiner Mutter und deiner ist soviel Ähnlichkeit wie zwischen Kitty Malone bei uns im Büro und Prinzessin Margaret ‒ wie Tag und Nacht. Nein, die Wahrheit ist, dir macht es Spaß, leutselig zu sein, und Mama gegenüber kannst du nach Herzenslust leutselig sein, nicht wahr? Die andern würden es sich nicht gefallen lassen. Nicht einmal Nancy, die noch weniger Verstand hat. Aber Mama frißt es mit Wonne, weil sie dumm ist.«
»Das ist nicht wahr! Deine Mutter ist nicht dumm.« Jetzt hatte er sie aufgerüttelt. Sie versuchte, die Hand wegzuziehen, mit der er sie festhielt, und stieß ihn dabei so heftig, daß er beinahe mit seinem Stuhl umstürzte. Der Überraschungsangriff reizte ihn. Er straffte sich und stand auf.
Sein Gesicht war verwandelt, der vollippige Mund geöffnet, und die dunkelbraunen Augen funkelten belustigt, als er zur Tür hinüberblickte, wohin sie geflüchtet war. Mit erhobener Stimme rief sie ihm zu: »Warum haßt du sie? Warum? Sag nicht, weil du sie für eine dumme Trine hältst, das glaube ich dir nicht. Wenn ich weiß, warum du sie haßt, werde ich die Antwort auf alles haben, auf alles. Niemand von den andern denkt so von ihr, nur du. Du bist …« Sie hielt inne, und als sie ihn langsam auf sich zuschreiten sah, erstarrte jeder Muskel in ihrem Körper.
Als er vor ihr stand, war sein Ton sanft, ja zerknirscht. »Es tut mir leid«, sagte er. »Es ist meine Schuld, ich weiß. Es ist immer meine Schuld, wenn wir uns streiten. Aber es könnte alles anders sein. Alles könnte gut sein, wenn du nur ein bißchen Verständnis hättest.« Er legte beide Hände auf ihre Schultern, und als seine Unterlippe zitterte, sagte sie schnell: »Nein! Nein!«
Die eine große Hand legte sich fest unter ihre Schulterblätter, die andere fuhr tiefer, und als er sie an sich drückte, murmelte er: »Nur ganz normal, ganz normal, nichts weiter, ich verspreche es dir …«
»Nein! NEIN! sage ich. Nein. Ich ertrage es nicht. Du kannst nicht, wir haben es versucht … Nein …!«
So wie sie ihn überrumpelt hatte, als sie vom Frisiertisch aufgesprungen war, so überraschte sie ihn jetzt wieder. Ihr Leib, aufs äußerste angespannt vor Angst, wand sich aus seinen Armen, und ihre Hände, fest wie Klauen auf seinem Gesicht, drückten seinen Kopf beiseite. Dann, als er sie aufs neue packte, kämpfte sie schweigend weiter, bis sie beide zu Boden fielen.
Kapitel 2 ‒ Willie
Nancy Gallacher blickte über ihre Schulter und rief, kaum daß sie den Telefonhörer aufgelegt hatte: »Bist du es, Willie?« Und ihr Mann steckte den Kopf durch die Tür zwischen Küche und Diele und antwortete grinsend: »Wen hast du denn erwartet? Der Milchmann ist mit seiner Runde um zwölf fertig, der Briefträger kommt zuletzt um vier, und der Junge vom Fleischer ist erst morgen früh wieder dran …«
Nancy schubste ihn in die Küche zurück und sagte lachend: »Du wirst mir noch einmal einen schönen Schreck einjagen. Einer von den Müllmännern sieht dir täuschend ähnlich …«
»Ja, und?«
»Hör zu. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Das war Liz am Telefon.«
»Nun sag bloß noch, sie ist Äbtissin geworden. Sie ist verrückt. Ich sollte so was nicht sagen, aber …«
»Es hat nichts mit Liz zu tun; es handelt sich um deine Eltern.«
»Sie lassen sich scheiden. Ich habe es gewußt.« Er streckte den Arm theatralisch aus. »Aber Papa weiß doch noch nichts davon. Ich habe ihn noch vor einer halben Stunde gesprochen.«
»Du hast heute anscheinend deinen humoristischen Tag. Also gut, wasch dir die Hände, trink deinen Tee, bring die Kinder ins Bett, und wenn du dann noch Interesse hast, werde ich es dir erzählen.«
»Ich habe mir die Hände gewaschen, meinen Tee getrunken und die Kinder ins Bett gebracht. Also schieß los!« Er zog ihren kleinen rundlichen Körper an sich, und sie sagte geheimnisvoll: »Du wirst es nie erraten, nicht in aller Ewigkeit. Sie haben eine Einladung erhalten.«
»Aha. Sie haben also eine Einladung erhalten?«
»Vom Herzog von Moorshire.« Sie grinste über das ganze Gesicht, als er sie losließ und Schultern und Kopf zurückbeugte, um sie besser ins Auge zu fassen. »Mama und Papa haben eine Einladung vom …?« »Da bleibt dir die Spucke weg, nicht wahr, Mr. Gallacher? … Deine Mama und dein Papa gehen nach Lea Hall.«
»Heilige Mutter Gottes!« Er setzte sich auf einen Küchenschemel. »Das ist wegen der neuen Schule.«
»Ja, denke ich auch. Und ich weiß auch wieder nicht ‒ dafür war doch schon die Eröffnungsfeier. Man hatte sie beide eingeladen, aber Mama war erkältet und konnte nicht mit.«
»Was soll geboten werden, weiß man das?«
»Irgendwas mit Musik, hat Liz gesagt. Auf der Karte steht ein weltbekannter Pianist, ein Geiger und eine Sängerin, alles große Kanonen. Wir werden mehr erfahren, wenn wir hinübergehen ‒ sie kommen alle heute abend ‒, das heißt, wenn ich Mrs. Price als Babysitter kriegen kann.«
»Weißt du was?« Willie Gallacher hob den Zeigefinger. »Ich kann mir denken, wieso sie eingeladen worden sind. Durch die de Ferriers. Papa hatte in letzter Zeit eine Menge mit ihm zu tun. Er war von Anfang an im Schulausschuß, und durch seinen Einfluß hat doch Vater den Auftrag bekommen … Bestimmt.«
»Ich dachte, er hat ihn bekommen, weil sein Kostenanschlag am niedrigsten war.«
»Ja, darum auch.« Willie stellte sich an den Herd und spielte mit dem Deckel des Wasserkessels, so daß der Dampf in kleinen Rauchsignalen hervorstieß. Das tat er immer dann, wenn er nachdachte und Sorgen hatte. Jetzt sagte er bitter: »Ein Wunder, daß uns die verdammte Schule nicht den Hals gebrochen hat. Wenn die Siedlung von Morley nicht gewesen wäre, hätten wir Wasser saufen gehen können. Ich hatte es ihm gesagt, aber du kennst ja Papa ‒ immer hoch hinaus.«
Sie stand dicht vor ihm, als sie fragte: »Stimmt jetzt etwas nicht?«
Er wandte den Kopf und sah sie ernst an. »Ach, nicht der Rede wert ‒ wenn es dabei bleibt. Aber es sind Klagen gekommen. Bei den Morley-Häusern haben zwei Wände Risse gekriegt. Vielleicht ist es nur eine kleine Senkung. Wir wollen’s hoffen, denn wenn’s mehr als das ist, dann ist der ganze Streifen zwischen Longside Drive und Waterford Way in Gefahr. Alles in allem achtzig Häuser. Ach, zum Teufel! Komm, wir gehen zu den Kindern, ich hab’ genug geredet. Ich hab’s ihm gesagt. Als wir dort anfingen, vor sechs Jahren, sagte ich ihm: ›Es bestehen Bedenken über den Streifen.‹ Ich hatte mit alten Bergleuten von Beular gesprochen; aber als ich ihm das erzählte, was hat er geantwortet? Die Beular-Grube sei acht Meilen entfernt, und die Stollen liefen nicht in der Richtung, und er hätte sich den besten Rat geholt. Den besten Rat ‒ von Bill Teddington! Immerhin, er war Markscheider, und was konnte ich gegen ihn ausrichten ‒ damals war ich ein Bürschchen von neunzehn. Aber, wie ich schon sagte, zum Teufel damit!« Er grinste und zog sie an sich. Dann zeigte er auf seinen Mantel, der auf einem Stuhl lag, und sagte: »Ich hab’ dir was mitgebracht ‒ Nylons, ein Dutzend Paar, und diesmal deine Größe.«
»Ein Dutzend? Billy Stoddard oder Frank Atkins?« »Frank. Sie sind von einem Laster gefallen.« Er gab ihr einen Puff und unterdrückte ein Grinsen; und sie kicherte, als sie sagte: »Sieh mal einer an! Unser Willie. Von einem Laster gefallen!«
Sie nahm das Päckchen, prüfte die Strümpfe, hob die Brauen und sagte: »Sehr schön, vielen Dank.« Sie beugte sich zu ihm und küßte ihn. »Ich will Mama ein Paar geben. Vielleicht bemerkt sie der Herzog.« Und er antwortete: »Bemüh dich nicht. Ich hab’ auch für sie ein Päckchen.«
Als sie beide zur Tür gingen, blieb er stehen und sagte kopfschüttelnd, wie zu sich selber: »Ich weiß nicht recht, ob sie’s durchstehen wird.«
»Warum nicht? Sie wird sich schon richtig herausstaffieren; natürlich muß sie ein neues Kleid haben. In letzter Zeit hat sie sich etwas gehenlassen. Als wir uns kennenlernten, kam sie mir sehr elegant vor.«
»Es geht nicht darum, wie sie aussieht …«, Willie verzog das Gesicht, »sondern wie sie spricht, wenn sie in Fahrt kommt. Ein paar Drinks, und ihr Lachen erschüttert ganz Newcastle.«
»Sie wird nur Wein bekommen. Bei solchen Partys gibt’s immer Wein, hab’ ich gehört.«
»Man kann vom Wein ganz schön einen sitzen haben. Aber es ist natürlich was anderes als das harte Zeug, das sie sonst trinkt. Ich bin neugierig, was Papa dazu sagt.«
Nancy antwortete nicht, und als sie durch die Halle gingen, erklärte sie: »Übrigens hat Schwester Martha heute wegen Moira angerufen; sie hat sie wieder geärgert. Schwester Martha meint, Moira ist wohl ihrer Klasse ein bißchen voran, das ist das Dumme, und sie findet die Kleineren langweilig. Immerhin will man sie nächstes Semester versetzen. Und sie sagt auch, Moira ist alt genug, um mit den Unterweisungen zu ihrer ersten Beichte anzufangen. Und weil ich gerade davon spreche: Vater Armstrong war da, um dich zu fragen, ob du beim Tanz der Kinder Marie ein bißchen helfen würdest. Er meint, du könntest die Jungens zusammentrommeln. Liz wird bei den Getränken helfen. Er hofft, es wird eine große Sache, und er möchte, daß so viele wie möglich kommen. Er hat noch nicht die Hälfte von dem Geld, das er für das neue Fenster braucht.«
»Ach …«, Willie schüttelte ungeduldig den Kopf. »Sie müssen immer was zu schnorren haben, die drei.« »Vater Armstrong nicht.«
»Doch, Vater Armstrong und die ganze Clique, die sind alle gleich. Übrigens …«, er grinste wieder und näherte sein Gesicht dicht dem ihren, als er fortfuhr: »Ich werde dir sagen, wie sie ihr Fenster ganz schnell kriegen könnten … Frank Atkins.«
Und sie fielen sich in die Arme und wollten sich ausschütten vor Lachen.
Kapitel 3 ‒ Paul
Paul Gallacher hörte das Telefon läuten, als er den Schlüssel in das Türschloß seiner Wohnung steckte, und in der Eile rutschten einige Hefte aus seiner bauchigen Aktentasche und fielen auf den Boden der Diele, und er murmelte »Verdammt!« und ließ sie liegen, stieß die Tür auf, legte die Mappe auf einen Stuhl und nahm den Hörer ab.
»Hallo, Paul!«
»Hallo, Kleines!«
»Ich rufe dich seit Stunden an, wo bist du denn gewesen?«
»In der Schule natürlich.«
»Aber es ist schon fast sechs.«
»Ich bin nun einmal so ein gewissenhafter Trottel. Du kennst mich doch, ich gehe nie mit dem Glockenschlag. Aber ich hatte auch noch eine Besorgung zu machen. Geht’s dir gut?«
»Ja, ja. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Kannst du heute abend herüberkommen?«
»Oh, das wird schwierig sein. Ich wollte eigentlich …«
»Du mußt, Paul, sie kommen alle, ich hoffe es wenigstens. Nie im Leben wirst du erraten, was los ist.« »Nach deiner Sprechweise zu urteilen, jedenfalls keine Katastrophe. Nun, sprich’s schon aus, ich schmachte nach einer Tasse Tee.«
»Also, bleib angeschnallt … Was sagst du dazu? Mama und Papa haben eine Einladung zu einer Party beim Herzog von Moorshire!«
»Tatsächlich?«
»Hm, hm.« »Nein, so was! Das ist wirklich eine großartige Nachricht. Der Herzog von Moorshire! Sieh einer an! Wir kommen voran in der Welt, nicht wahr? Dürfen sie Verwandte mitbringen?«
Elizabeth lachte, dann sagte sie mit gedämpfter Stimme: »Mama ist ganz weg.«
»Das kann ich mir denken. Wo ist sie denn jetzt? Leg sie doch mal auf.«
»Sie ist gerade in die Küche gegangen, Häppchen und Schnittchen für euch zurechtmachen, wenn ihr alle kommt. Und sie muß es heute allein machen, abgesehen von deiner ergebenen Dienerin hier.«
»Was ist los? Wieder Krach mit Annie?«
»Du sagst es.« Ihre Stimme wurde noch leiser. »Annie hat gedroht zu gehen, wenn Mama nicht Mrs. Slocombe feuert. Es ist wegen des Lohns, den Mrs. Slocombe kriegt. Und es ist auch ein bißchen happig, wenn man es sich überlegt, denn Annie ist Tag und Nacht auf den Beinen für ihre sechs Pfund. Ich glaube, ich würde es mir auch nicht gefallen lassen.«
»Annie wird nie gehen.«
»Ich weiß, und Mama weiß es, und Annie weiß es, aber trotzdem hört dieses Theater nicht auf.«
Sie tat einen tiefen Seufzer, und er sagte freundlich: »Das alles wird dir nächstes Jahr fehlen. Hast du es dir gut überlegt, Liz, denn es werden Zeiten kommen, da wirst du dir sagen, hätte ich doch auf sie gehört, statt mich Hals über Kopf davonzumachen.«
»Ja, darüber mache ich mir oft Gedanken, doch zugleich sehne ich mich danach, wegzugehen und endlich anzufangen … Ach, Paul, ich muß mich mal mit dir unterhalten!«
»Tu das. Meine Adresse ist Talford Road, Marsh House, Wohnung Nr. 4.« Sie lachten beide, und Elizabeth sagte: »Du kommst also nachher?«
»Ja, ja, ich werde es einrichten. Ich möchte es tatsächlich nicht versäumen, nicht für allen Tee in ganz China. Also, bis nachher.«
»Bis nachher, Paul. Bye-bye.«
Er legte den Hörer auf, ging in die Diele und sammelte die Hefte ein. Als er die Tür hinter sich geschlossen hatte, blieb er eine Weile dagegengelehnt stehen und starrte ins Zimmer. Eine Einladung zum Herzog von Moorshire. Schau, schau. Es ging unübersehbar aufwärts mit ihnen. Würde es Maggie Vergnügen machen? Sicherlich. Es wurde Zeit, daß sie einmal ausging und ein bißchen Spaß von ihrem Wohlstand hatte, statt immer bloß zu Hause zu hocken und sich um ihre Sippschaft zu sorgen. Sie war in den Hintergrund gedrängt worden, während sein Vater seine eigenen Wege ging. Das hatte sie als selbstverständlich hingenommen. Eigentlich seltsam, denn sie war anders geartet, war feurig, überschwenglich, warmherzig und liebenswert. Alle hatten sie verlassen, einer nach dem andern, außer Liz, und die strebte nun auch fort, nicht in die Welt hinein, sondern aus ihr hinaus. Einer nach dem andern hatten sie ihre Mutter ausgepreßt. Er selber fühlte sich nicht ohne Schuld. War er nicht sogar der Schlimmste gewesen?
Er ging in die Küche, setzte den Kessel auf den Gaskocher und stellte das Teegeschirr auf ein geblümtes Tablett. Dann schnitt er drei Scheiben Brot ab, nahm Butter und Marmelade, goß den Tee auf und trug das Ganze ins Zimmer.
Es war karg möbliert und enthielt nur eine Couch, auf der er nachts schlief, eine Kommode, einen Kleiderschrank, einen Sessel, zwei Stühle, ein Rollpult und den runden Tisch, an dem er aß. Der Fußboden war mit grau marmoriertem Linoleum ausgelegt, und ein einziger kleiner Teppich lag vor dem elektrischen Ofen. Das Zimmer war ungemütlich und hatte nicht einen einzigen reizvollen Gegenstand. Aber so wollte er es haben. Alle hatten sie die Nase hineingesteckt und versucht, ›etwas daraus zu machen‹, doch er war fest geblieben. Er wußte, sie dachten, seine asketische Lebensweise sei nur eine Beschwichtigung seines schlechten Gewissens: der Bruder, der Sohn, der ausgezogen war, seinem Ruf zu folgen, der jetzt ein geweihter Priester hätte sein sollen, von dem Glanz auf die ganze Familie strahlte, war weiter nichts als ein Englischlehrer an einer Grundschule in Bog’s End geworden, und tiefer als Bog’s End ging es nicht, in keiner Hinsicht.
Er lehnte sich zurück und ließ den Tee kalt werden. Sehr, sehr müde fühlte er sich. Nächsten Mittwoch wurde er fünfundzwanzig. War es wirklich erst sechs Jahre her, daß er den Entschluß gefaßt hatte, nicht sechs Monate, sechs Tage, gestern? Die Höllenqualen waren so stark gewesen, daß er manchmal dachte, es war erst gestern. Er wußte jetzt, daß es keine Hölle gab, wie die Kirche einen glauben machen wollte, wie Vater Stillwell und Vater Monaghan einem immer wieder einhämmerten; Vater Armstrong nicht, nein, der war zu vernünftig dafür. Die Hölle, das waren die Seelenqualen in der Nacht, ein tiefer, tiefer Brunnen der Verzweiflung, wo man im Dunkeln zappelte und kämpfte, wo man seine Schuld auskotzte und sie wieder vor sich aufsteigen sah wie einen schmierigen, stinkenden Dreckhaufen, der einen zu ersticken drohte. Und die Hölle am Tag war das freundliche Wohlwollen der Priester, das Wohlwollen, das einen Schleier über ihre Verdammung breitete; das Wohlwollen der Brüder in Gott, die dich mit Erbarmen anschauten, doch dies Erbarmen bemäntelte nur ihren Neid, den Neid auf deinen Willen, der die Kraft hatte, auf dem Pfade zu Gott kehrtzumachen. Gott, der nur eine Wahnvorstellung war, eine Hoffnung, die man der Verzweiflung einspritzte, ein Bild in deiner Seele, von andern Seelen eingesaugt, Seelen, die so sicher schienen, doch immer noch sangen: »Ich glaube! Hilf meinem Unglauben!«
Die Hölle war der Blick in den Augen seiner Mutter, der Blick, der schweigend fragte: »Ist es ein Mädchen?« Und wenn sie ihn laut gefragt hätte, was hätte er geantwortet? Er hätte gesagt: »Nein, es ist kein Mädchen, es ist eine Frau«, denn sogar damals, mit nur einem Jahr Unterschied, hatte er sie als Frau gesehen, reif, anders.
Wenn er sie nie gesehen, nie kennengelernt, sie nie gesprochen hätte ‒ wäre er auch dann umgekehrt? Ja, ja; früher oder später wäre es geschehen. Wenn er seine Jugend überblickte, sah er, daß jeder unschuldige Schritt, den er getan, in seinen Eltern falsche Vorstellungen erweckt hatte. Sein Dienst als Ministrant, seine Liebe zur Kirche überhaupt war mißdeutet worden. Das Zeremoniell hatte ihn verhext. Der lateinische Singsang bei der Messe (er lehnte sich heftig dagegen auf, daß die Mysterien auf englisch offenbart wurden), die scheinbare Kameraderie unter den Priestern, ihre gute Laune, stets zu einem Scherz bereit, und ihre durchaus menschliche Trinkfestigkeit zogen ihn mit der Kraft einer ersten Liebe an. Doch was seine Schritte am meisten bestimmt hatte, war die unverhohlene Verehrung gewesen, die seine Mutter ihm entgegenbrachte, ihrem Sohn, ihrem Sprößling, der dazu ausersehen war, der Familie Ruhm zu bringen.
Er war siebzehn, als er endlich nachgab, und an diesem Tag hatte sie ihn in die Arme genommen und geküßt und, während ihr die Tränen übers Gesicht liefen, geflüstert: »Du bist wie eine Buße für meine Sünden, denn ich bin mein Leben lang eine treue Katholikin gewesen.« Sie wußte nicht, und niemand hätte es ihr auch damals begreiflich machen können, daß sie Paul als Opfer darbrachte.
Er war neunzehn gewesen, als er seiner Mutter sagte, daß er entschlossen sei, das Seminar zu verlassen. Sechs Monate lang hatte er sich Tag und Nacht bemüht, die Sache vernünftig zu sehen, doch es war zwecklos gewesen. Von dem Tag an, da er zum ersten Mal das Mädchen ‒ oder die Frau ‒ zu Gesicht bekommen hatte, war es mit ihm aus gewesen. Und es war nicht einmal so, daß ihn die Liebe zum ersten Mal getroffen hätte; schon mit vierzehn und früher hatte er seine kleinen Versuche gemacht. Er war nicht gleich aufs Ganze gegangen, aber es hatte ihm vorerst genügt. Er war damals eingebildet genug zu glauben, er brauche nur den Finger zu heben, und sie kämen angelaufen, und es stimmte sogar. So daß sie ihm, als er sie zum ersten Mal sah, keineswegs als ein Wesen erschien, über deren Anatomie er nicht Bescheid wußte.
Ihr erster Anblick erfaßte nicht nur seinen Körper, sein Herz ‒ das hätte er überwinden können ‒, sie nahm seine Seele in Besitz. Endlose Wochen lang sprach er mit seinem Beichtvater darüber. Dann brachten sie ihm Vater Armstrong. Er hatte ihn, er hatte sie alle getauft, er hatte seine Eltern zusammengegeben; er gehörte gleichsam zur Familie. Vater Armstrong drang tiefer ein als sein Beichtvater im Seminar, und als er genug wußte, legte er ihm die Hände auf die Schultern und sagte: »Also, Paul, wenn es etwas gibt, worauf die katholische Kirche verzichten kann, dann ist es ein verwirrter und schwankender Priester.« Er lächelte sogar dabei.
Vater Armstrong schien der einzige zu sein, der nicht etwas sagte und dabei etwas anderes dachte, und der einzige, der den Namen der Frau wußte, die Paul verzaubert hatte.
Er nahm die Teetasse und verzog das Gesicht, als seine Lippen das kalte Getränk berührten. Auch die Teekanne war kalt geworden, und so stand er auf und ging in die Küche, um sich frischen Tee zu brühen.
Kapitel 4 ‒ Frances
»Bist du’s, Frances?«
»Ja. Ja, Liz. Einen Augenblick, ich will nur die Tür zumachen, sie spielen schon wieder verrückt … Hast du sie gehört? Ihre Oma Walton ist hier und badet sie. Ich weiß nicht, wer sich am meisten dabei amüsiert oder wer den größten Krach macht. Also, ich sitze bequem; wir können anfangen.« Sie lachte. »Schieß los.«
»Ich habe etwas, das dich überraschen wird, Frances.«
»Wirklich? Also, ich liebe Überraschungen. Ich habe ganz vergessen, was eine Überraschung ist, seitdem Pauline die Katze in die Waschmaschine gesteckt hat.«
»Hör auf zu flachsen, Frances, das kannst du noch den ganzen Abend. Hör zu. Du wirst nicht erraten, wohin Mama und Papa gehen werden.«
»Doch. Ich weiß zumindest, worauf es Papa abgesehen hat. Er möchte geadelt werden. Gestern hab’ ich ihn mit Mrs. de Ferrier sprechen sehen, er stand mit ihr gegenüber dem Klub. Sie muß zum Lunch dagewesen sein, bei Ransome’s, weißt du. Nur vornehme Damen sind bei Ransome’s zugelassen.«
»Du bist gar nicht so weit davon ab.«
»Was du nicht sagst!«
Elizabeth dämpfte ihre Stimme zu einem feierlichen Flüstern. »Sie sind vom Herzog von Moorshire nach Lea Hall eingeladen.«
»Mama und Papa?«
»Mama und Papa.«
»Das soll ein Witz sein.«
»Kein Witz, Frances, ich halte die Karte in der Hand.
Der Herzog von Moorshire gibt sich die Ehre, Mrs. und Mr. Gallacher am … ist es nicht wundervoll?«
»Ja, ich denke schon …« Eine Spur von Zweifel war in Frances’ Stimme; dann fragte sie: »Geht Mama?«
»Ob sie geht? Natürlich geht sie.«
»Wann ist es denn?«
»In vier Wochen. Zeit genug, daß sie sich was zum Anziehen kaufen kann.«
»Sie muß erst ihr Gewicht herunterkriegen, ehe sie an Kleider denkt; sie dürfte in letzter Zeit etliche Pfund zugenommen haben.«
»Nein, das hat sie nicht, durchaus nicht; sie ist überhaupt nicht dick.«
»Nicht dick!« Frances blickte verächtlich ins Telefon, als könne sie Elizabeth sehen; dann fragte sie: »Kommen sie alle heute abend?«, und Elizabeth antwortete: »Ja. Ich habe nur Helen noch nicht angerufen, aber sie schaut sowieso jeden Freitag abend herein. Ihr kommt doch, Dave und du, nicht wahr?«
»Eigentlich ist heute unser Klubabend, aber ich glaube, es läßt sich machen. Ja, wir kommen um acht herum auf einen Sprung.«
»Fein, Frances. Bye-bye.«
»Bye-bye.«
Frances Walton legte den Hörer auf und starrte eine Weile das Telefon an, bevor sie sich umdrehte und langsam ins Wohnzimmer ging, wo ihr Mann auf der Couch vor dem Kamin lag, die Füße auf eine Stuhlkante gestützt. Sie ging um die Couch herum, stellte sich vor ihn hin und fragte: »Weißt du das Neueste?« »Na, was denn?«
»Mama und Papa sind zu einer Party beim Herzog von Moorshire eingeladen.«
»Ih!« Dave Walton nahm die Füße vom Stuhl und richtete sich auf. »Sag das noch einmal.«
»Du hast es gehört. Meine Mama und mein Papa sind zu einer Party im Hause des Herzogs von Moorshire, in Lea House, eingeladen. Du weißt, das Schloß am Fluß, ungefähr sechs Meilen von …«
»Ich weiß, ich weiß.« Er machte eine ungeduldige Handbewegung. »Von ihm sind sie eingeladen worden?«
»Ja, das hat jedenfalls Liz gesagt. Also …« Sie zog den Atem tief ein und atmete langsam wieder aus, bevor sie sich neben ihren Mann auf die Couch setzte. »Papa will hoch hinaus.«
»Ja, ja, das will er.« Dave Walton nahm sich eine Zigarette von dem Seitentischchen, zündete sie nachdenklich an und sagte: »Es wird gut fürs Geschäft sein. Solche Kontakte sind wichtig.«
»Wirst du was davon haben?«
»Wird sich kaum vermeiden lassen, nicht wahr? Ich besorge das Material ‒ na ja, einen Teil davon.« Frances warf das blonde Haar ungeduldig zurück und sagte: »Ich finde es zu blöd von Papa, daß er sich den Auftrag mit Smith teilt, und ich möchte ihm am liebsten sagen …«
»Kümmere dich um deine Angelegenheiten.« Er streifte die Asche von seiner Zigarette und gestikulierte damit, während er weitersprach. »Wenn es da etwas zu sagen gibt, so bin ich ganz gut imstande, selber nach meinen Interessen zu sehen. Und ich glaube, ich weiß, warum er Smith von dem Auftrag etwas abgegeben hat.« »Warum denn?«
»Na ja, es ist eigentlich erst eine Vermutung, aber Smith ist doch ein Vetter von Redfern, Stadtrat Redfern. Kapierst du?«
»Nein.«
»Also, wenn es der Gemeinderat beschließt, das heißt, wenn die Steuerzahler dafür gradestehen, dann wird das Schwimmbad gebaut. Nun ist flußaufwärts, bevor man zu den Schieferbrüchen kommt, ein vier Meilen langer Streifen, aus dem könnte man einen Anlegeplatz für Boote machen.«
»Hinter all den Fabriken?«
»Ja, hinter all den Fabriken. Aber wir kommen von der Hauptsache ab. Der Schulbau ist ein Baukastenspiel, verglichen mit diesem Bootshafen ‒ mit Sonnenterrasse, Gartencafé, Tanzsaal und einem Motel obendrein. Dein Vater wirft mit der Wurst nach der Speckseite und schmiert Smith, damit er Redferns Zustimmung kriegt. Redfern ist der große Mann im Gemeinderat.« Seine Stimme wurde sarkastisch, als er hinzufügte: »Ich hoffe nur, er fängt sich nicht eines Tages in seinem eigenen Netz.«
Frances blickte ihren Mann an. Eigentlich hätte sie ihren Vater und seine Taktiken verteidigen sollen, denn ihm allein hatten sie ihren Wohlstand zu verdanken, wenn er es auch noch nicht mit dem ihrer Mutter, wie er sich in Savile House repräsentierte, aufnehmen konnte. Sie war ehrgeizig, das war sie, für sich und ihren kleinen, geriebenen Mann.
»Nun also …«, sie stand von der Couch auf, »ich denke, es ist besser, wir machen uns für die Freudenfeier fertig.« Als sie an ihm vorbeiging, ergriff er ihren Arm, sah zu ihr auf und sagte mit einem unterdrückten Lachen: »Na, dann mach ein vergnügtes Gesicht. Mit Neid kommst du nicht weit.«
»Ach, du!« Sie gab ihm einen Klaps, ging aus dem Zimmer und durch die schmale Diele die Treppe hinauf. Oben blieb sie stehen und blickte hinunter. Sie mochte das Haus nicht, es war eng und erstickend. Sie hatte nicht gewußt, wie sehr sie ihr Elternhaus liebte, bis sie vor dreieinhalb Jahren an ihrem Hochzeitstag hierher gekommen war. Nie würde sie sich zufriedengeben, bevor sie nicht ein Haus hatte wie das, in dem sie seit ihrem vierzehnten Jahr aufgewachsen war. Sie fühlte, daß sie für ein Haus wie Savile House geschaffen war.
Sie würde es zu führen verstehen, wissen, wie man Gäste empfängt. So wie es jetzt war, hatte es wenig Sinn: Ihr Vater war kaum zu Hause, Elizabeth würde es nächstes Jahr verlassen, um ins Kloster zu gehen, und dann würde es fast nur noch von ihrer Mutter bewohnt sein, von gelegentlichen Familienzusammenkünften abgesehen. Ihre Mutter würde bestimmt in einem Haus wie diesem glücklicher sein, sich weitaus mehr zu Hause fühlen. Ach, es ging gar nicht gerecht zu in der Welt.
Kapitel 5 ‒ Helen
»Trevor! Mach doch bloß das Ding leiser!« Helen Gillespie kam ins Zimmer gelaufen, stürzte zum Fernseher und drehte ihn nicht nur leiser, sondern stellte ihn ganz ab. Dann ließ sie sich mit einem Plumps in den Sessel fallen, so daß sie beinahe den niedrigen Tisch umgeworfen hätte, auf dem ihr Abendessen stand, Rührei auf Toast und, ein Wohlstandssymbol, eine Flasche Sauternes aus dem Getränkediscount.
»Hel-en. Hel-en!« Ihr Mann trennte ihren Namen immer auf diese Weise, wenn er verärgert oder gereizt war. »Du hast mir beinahe den Teller auf den Anzug geworfen.« Er schob seinen Stuhl zurück, untersuchte seine Hose und wischte mit der orangefarbenen Papierserviette darüber.
»Ach, ich bin so aufgeregt. Was, glaubst du, hat Liz mir eben erzählt?«
»Ich weiß es nicht.« Steif und mit einem Gesichtsausdruck, der besagte, daß es ihn auch nicht interessierte, nahm er wieder Messer und Gabel zur Hand und setzte seine Mahlzeit fort. Seine Art zu essen paßte zu seiner pedantischen Sprechweise und zu seinem schmalen, sauber rasierten Gesicht und seiner grämlichen Miene.
Helen streckte die Hand aus, um ihn beim Arm zu packen, hielt jedoch rechtzeitig inne. Wenn sie ihm den Anzug bekleckerte, würde es den Abend verderben. Aber ihr Gesicht blieb gereizt, und sie sagte: »Zum Donnerwetter, was tut schon ein Fleck auf deinem Anzug, du kannst ihn zehnmal am Tag reinigen lassen. Anzüge, Anzüge, das ist alles, woran du denkst.« »Schließlich leben wir ja davon.« Er balancierte einen Bissen Ei auf der Gabelspitze.
»Wirklich? Tun wir das? Und was ist mit mir ‒ mein Anteil zählt gar nicht? Hör mal zu!« Sie beugte sich über den Tisch. »Ich wollte es dir schon lange sagen. Ich arbeitete, bevor ich dich geheiratet habe, und ich arbeite noch immer. Mein Gehalt ist nur drei Pfund die Woche niedriger als deins. Ich habe zwei Gehaltserhöhungen in zwei Jahren gehabt und du nicht eine, seit wir verheiratet sind, und das ist jetzt drei Jahre her. Also überlege dir bitte in Zukunft, was du sagst.«
Als seine Frau sich in die Küche verzogen hatte, legte Trevor Gillespie langsam Messer und Gabel auf den Teller und starrte durch das schmale Zimmer auf den Gummibaum, der vor dem Gestell stand, das die Eßecke von dem übrigen Zimmer trennte und es schon fast verdeckte. Wieder überkam ihn dieses abscheuliche Gefühl der Demütigung, so daß er am liebsten den Kopf auf die Arme gelegt und wie ein Kind geweint, sich seinen Kummer von der Seele geheult hätte über seine Unzulänglichkeit, seine Unfähigkeit ‒ nicht bei Helen, da war alles in Ordnung, nein, im Geschäft, da war er ein Versager. Aber warum war er da ein Versager? Nur weil Pattenden ihn nicht leiden konnte, nicht wegen seiner Arbeit. Pattenden hatte ihn nie leiden können, und er zeigte es, indem er andere über seinen Kopf hinweg beförderte … Und was hatte er dagegen unternommen? Was konnte er tun? Nichts, denn er konnte Pattenden nicht entgegentreten, Pattenden, der groß und breit und gewaltig war und recht, immer recht hatte. Aber jetzt würde er es sich nicht länger gefallen lassen, auf keinen Fall, er würde zum Hauptbüro gehen … Er hatte nicht gemerkt, daß Helen zurückgekommen war und neben ihm stand, bis sie ihm den Arm um die Schultern legte, sich zu ihm beugte und flüsterte: »Es tut mir leid.«
Er lächelte zu ihr hinauf, hob das Gesicht und küßte sie und nahm ihre Hand, zog sie zu sich auf den Sessel und fragte sanft: »Was wolltest du mir denn erzählen?«
Sie sagte, aber ihre Begeisterung war verflogen: »Mama und Papa haben eine Einladung vom Herzog von Moorshire nach Lea Hall.«
Sie sah, wie er den Mund aufriß, wie seine Augen größer wurden und seine Brauen in die Höhe gingen, und mußte lachen.
»Wie wunderbar … Der Herzog von Moorshire!« Er dachte an den morgigen Tag und hörte Pattenden, wie er sagte: »Gillespie, einen Augenblick ‒ nehmen Sie bitte diesem Herrn Maß.«
»Ja, Mr. Pattenden. Sofort, Mr. Pattenden.«
»Was ist mit Ihnen los, Mr. Gillespie, träumen Sie schon wieder?«
»Nein, Mr. Pattenden. Ich habe nur heute nacht wenig geschlafen. Wir waren lange bei meinen Schwiegereltern; es wurde über die Einladung zu einem Empfang des Herzogs von Moorshire gesprochen, und wir überlegten, wie sich meine Schwiegereltern revanchieren könnten, eine kleine Dinnerparty oder etwas Ähnliches. Sie wissen doch, wie das so ist ‒ es wird eine Gegeneinladung erwartet …«
»Liz sagt, wir sollen hinüberkommen.«
»Ja, ja.« Er blinzelte und lächelte sie an. »Natürlich. Deine Mama ist sicher sehr aufgeregt.«
Sie blickte ihn leicht verwundert an. Er nannte ihre Mutter nur selten Mama, fast immer ›deine Mutter‹, manchmal auch nur ›sie‹. Sie hatte schon oft gedacht, er rümpfe die Nase über ihre Mutter, und das gefiel ihr gar nicht, denn er war schließlich selber nicht weit her. Sie waren ganz anständig, seine Leute, aber das war auch alles, was man von ihnen sagen konnte, denn sie hatten ihr Leben lang gekratzt und geknausert.
Helen stand auf und räumte den Tisch ab. »Mama muß etwas mit ihrer Figur machen. In letzter Zeit hat sie sich gehenlassen, und sie ist ja noch nicht so alt, erst vierundvierzig.« Sie blieb mit den Tellern in der Hand stehen und sagte: »Morgen werde ich ein Wort mit den Ärzten reden. Paß auf, wie ihnen das imponieren wird, besonders Doktor Blake, denn der ist ein Snob, wie er im Buch steht. Und seine Frau ist ihm eine Länge voraus, die hat Ellbogen.«
Trevor lachte, während er die Tischmatten zusammenlegte. Auch er wünschte, es wäre schon morgen. Und wie er es sich wünschte!
›Ja, Mr. Pattenden; ja, Mr. Pattenden; ja, Mr. Pattenden. NEIN, Mr. Pattenden!‹
Kapitel 6 ‒ Der starke Mann
Man sagte, mehr noch als der Fluß selbst bilde die Collingwood Road eine Grenze zwischen dem oberen und dem unteren Teil von Fellburn, denn an der einen Seite begann der Stadtteil Bog’s End, während hinter dem anderen der Markt lag, die öffentlichen Gebäude, die alte und die neue High Street, die beide in den Park mündeten; und der Park führte nach Brampton Hill und natürlich zu dem neuen Wohnviertel der oberen Zehntausend, The Rise.
An der Collingwood Road standen hauptsächlich Lager- und Bürohäuser, und zwischen der Straße und den Collingwood Mews lagen die Büroräume der Baufirma Gallacher & Sons.
Die vorderen Büros gingen zur Straße hinaus. Dahinter kam Rodney Gallachers Privatkontor, mit einem Fenster und einer Tür auf die Mews, den früheren Marstall. Der Hof konnte zwei Laster und zwei Pkw aufnehmen, und zuerst taten sie es auch, weil man sich keine Garage leisten konnte. Doch jetzt parkten dort nur noch Privatautos, meistens drei, Rodney Gallachers, Sam Gallachers und der Wagen der Wohnungsmieterin. Die Wohnung gehörte Rodney Gallacher und war für acht Pfund die Woche an eine Mrs. Morland vermietet. Wenigstens stand es so in den Büchern, und zur Bestätigung kam allmonatlich Mrs. Morlands Scheck. Sie selber jedoch verließ ihre Wohnung jeden Freitag abend und blieb über das Wochenende fort; doch dies wußte niemand außer Rodney Gallacher und Mrs. Morlands bester Freundin, Rosamund de Ferner.
Mary Whitaker, Rodney Gallachers Sekretärin, und seine Stenotypistin, Kitty Malone, sahen gelegentlich Mrs. de Ferrier aus ihrem Wagen steigen und in die Wohnung gehen, um Mrs. Morland zu besuchen, und machten jedesmal Bemerkungen über ihre Garderobe, »so ganz einfach, aber irgendwie Klasse.« »Wenn du ihre Kleider in irgendeinem Laden hängen sähst, würdest du keine drei Groschen dafür geben. Aber wie sie die Sachen trägt, darauf kommt’s an«, stellte Mary Whitaker fest, und Kitty Malone sagte: »Ja, man ist damit geboren oder nicht, und alle Piepen auf Barclay’s Bank« ‒ es war die Bank der Firma ‒ »würden dir nichts nutzen, wenn du’s nicht hast; du verstehst, was ich meine.«
Sie wußten, daß ihr Chef Mr. de Ferrier kannte, denn er kam manchmal ins Büro, ohne daß sie sich viel um ihn kümmerten, affektiert und hochnäsig wie er war, mit einem Gesicht wie ein gepuderter Arsch, wie Kitty Malone bemerkte, und obwohl Miß Whitaker ihr diesen Ausdruck streng verwies, mußte sie selber darüber lachen. Seine Frau, meinten sie, war ein ganzes Stück jünger als er. Er war über fünfzig, und sie, nun, wie alt konnte sie sein? Sie sah aus wie drei- oder fünfunddreißig, aber sie mußte älter sein, denn sie hatte einen neunzehnjährigen Sohn, der sich irgendwo herumtrieb, oder sie mußte mit sechzehn angefangen haben, und das paßte nicht zu diesem Typ. Vielleicht war sie neunzehn oder zwanzig, als sie heiratete; dann wäre sie jetzt vierzig. Wenn es so war, dann alle Achtung.
Als sie vorige Woche einmal aus ihrem Wagen stieg, war der Chef gerade im Büro und hatte ihr zugesehen, wie sie übern Bürgersteig ging, und sie hatten den Chef angesehen und hätten gern gewußt, was er von ihr dachte und ob er überhaupt an sie dachte, denn sie wußten alle beide, daß der Chef eine Frau ansehen konnte, ohne sie überhaupt anzusehen. Das einzige, was er richtig ansah, waren Ziegelsteine, Zement, Fensterrahmen, Dielenbretter und dergleichen. Ja, wenn es Mr. Sam gewesen wäre, mit Mr. Sam hätten sie was zu lachen gehabt, aber bei seinem Vater kam das nicht in Frage. Wie Mary Whitaker sagte, und sie mußte es wissen, denn sie war von Anfang an bei der Firma, dachte der Chef an nichts als an sein Geschäft, und er war so oft unterwegs, um nach diesem und jenem zu sehen, daß sie sich fragte, wie seine Frau sich damit abfand. Aber er schien Glück zu haben, denn Mrs. Gallacher, soweit sie sie kannte, sah aus, als ließe sie gern fünfe gerade sein. Dicke Leute waren immer so.
Das Schlafzimmer war in Französischgrau und Mattrosa gehalten. Die Fenstervorhänge waren rosa mit einem grauen Fischgrätmuster, und die schwere Bettdecke hatte den gleichen Bezug.
Jetzt war die Decke am Fußende des Bettes aufgerollt, und Rodney Gallacher drückte die nackten Füße dagegen, streckte seine langen Beine aus, zog den in letzter Zeit stärker gewordenen Bauch ein und weitete die Brust mit einem langen, tiefen Atemzug, während er die Arme seitwärts bog.
Als er ein leichtes Rascheln hörte, wandte er den Kopf zur Tür und blickte die Frau an, die ihn behext hatte und sein Leben seit achtzehn Monaten beherrschte. Er wußte, wenn er sie verlöre, würde nichts in seinem Leben auch nur einen Pfifferling mehr wert sein.
Er drehte sich, auf den Ellbogen gestützt, zu ihr und sah sie auf sich zukommen. Sie trug einen spinnwebdünnen Morgenrock, der ihren Körper verführerischer erscheinen ließ, als wenn er nackt gewesen wäre. Als sie bei ihm stand, ließ er sich wieder auf den Rücken fallen, streckte die Hände aus und zog sie brüsk an sich, so daß ihr Gesicht über seinem schwebte, lang und blaß, die grünen Augen spöttisch wie immer.
Hätte Maggie ihn so angesehen, hätte er gesagt, sie mache sich über ihn lustig oder wolle einen Streit anfangen. Manchmal mußte er sich selber darüber wundern, wie weit es mit ihm gekommen war, daß er sich von dieser Frau solche Dinge gefallen ließ. Wäre Maggie so unverschämt gewesen, hätte sie gleich eins aufs Maul gekriegt.
Sein ganzes Leben hatte Rodney Gallacher einen heimlichen Respekt für das gehabt, was er »Klasse« nannte. Hinter seinen bombastischen Reden und seinem politischen Linksdrall war er immer voller Bewunderung für den Ton und das Aussehen der »Klasse«, ja sogar für ihre Überheblichkeit. Wenn man »Klasse« hatte, wurde man leichter mit allem fertig, mit Demütigungen wie mit gelegentlichen Seitensprüngen. Wenn man »Klasse« hatte, besaß man den Zauberschlüssel für Sprache, Aussehen und Benehmen. Dieses Gefühl für »Klasse« mußte ihn bewegt haben, als er mit neunzehn Jahren der Armitage-Tochter von der Klosterschule bis zum Brampton Hill hinauf nachgeschlichen war, bis er an einem glorreichen Tag endlich ihre Mappe tragen durfte. Und das ging einen Monat so, bis ihr Vater dahinterkam und ihn nicht nur beinahe verdroschen hätte, sondern auch dafür sorgte, daß er aus Stevensons Ziegelei hinausflog.