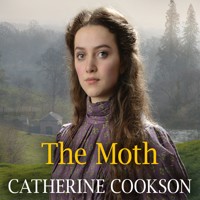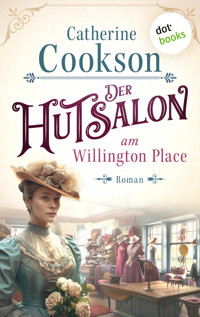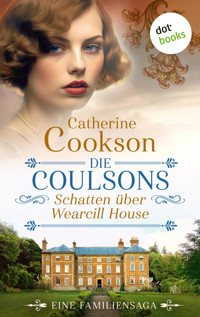5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Vermächtnis einer Familie: Der Roman »Die Thorntons – Sturm über Elmholm House« von Bestsellerautorin Catherine Cookson als eBook bei dotbooks. Ein nordenglisches Dorf um die Jahrhundertwende: Von Kindesbeinen an ist Hanna es gewohnt, dass die Dorfbewohner sie nur abfällig »das Mädchen« nennen. Als Bastardtochter von Matthew Thornton, dem das vornehme Elmhouse House gehört, ist sie der Schandfleck der angesehenen Familie. Das lässt auch Thorntons Ehefrau die junge Hanna voller Abscheu spüren – umso mehr, als diese zu einer Schönheit heranwächst, die bald die Aufmerksamkeit wohlhabender Männer erregt. Eine Heirat könnte für Hannah endlich einen Neuanfang bedeuten – doch ihr Herz hat sie schon vor Langem dem Minenarbeiter Ned geschenkt, der in den dunklen Bergwerken, die den Thorntons gehören, Tag für Tag sein Leben riskiert … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die englische Familiensaga »Die Thorntons – Sturm über Elmholm House« von Weltbestsellerautorin Catherine Cookson wird auch Fans von »Lady Chatterley’s Lover« sowie der »Poldark«-Serie begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein nordenglisches Dorf um die Jahrhundertwende: Von Kindesbeinen an ist Hanna es gewohnt, dass die Dorfbewohner sie nur abfällig »das Mädchen« nennen. Als Bastardtochter von Matthew Thornton, dem das vornehme Elmhouse House gehört, ist sie der Schandfleck der angesehenen Familie. Das lässt auch Thorntons Ehefrau die junge Hanna voller Abscheu spüren – umso mehr, als diese zu einer Schönheit heranwächst, die bald die Aufmerksamkeit wohlhabender Männer erregt. Eine Heirat könnte für Hannah endlich einen Neuanfang bedeuten – doch ihr Herz hat sie schon vor Langem dem Minenarbeiter Ned geschenkt, der in den dunklen Bergwerken, die den Thorntons gehören, Tag für Tag sein Leben riskiert …
Über die Autorin:
Dame Catherine Ann Cookson (1906–1998) war eine britische Schriftstellerin. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern gehörte sie zu den meistgelesenen und beliebtesten Romanautorinnen ihrer Zeit; viele ihrer Werke wurden für Theater und Film inszeniert. In ihren kraftvollen, fesselnden Schicksalsgeschichten schrieb sie vor allem über die nordenglische Arbeiterklasse, inspiriert von ihrer eigenen Jugend. Als uneheliches Kind wurde sie von ihren Großeltern aufgezogen, in dem Glauben, ihre Mutter sei ihre Schwester. Mit 13 Jahren verließ sie die Schule ohne Abschluss und arbeitete als Hausmädchen für wohlhabende Bürger sowie als Angestellte in einer Wäscherei. 1940 heiratete sie den Gymnasiallehrer Tom Cookson, mit dem sie zeitlebens zurückgezogen und bescheiden lebte. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1950; 43 Jahre später wurde sie von der Königin zur Dame of the British Empire ernannt und die Grafschaft South Tyneside nennt sich bis heute »Catherine Cookson Country«. Wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag starb sie als eine der wohlhabendsten Frauen Großbritanniens.
Catherine Cookson veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre englischen Familiensagas »Die Lawsons – Anbruch einer neuen Zeit«, »Die Emmersons – Tage der Entscheidung«, »Die Coulsons – Schatten über Wearcill House« und »Die Masons – Schicksalsjahre einer Familie«.
Auch bei dotbooks erscheinen ihre Schicksalsromane »Der Himmel über Tollet’s Ridge«, »Sturmwolken über dem River Tyne«, »Sturm über Savile House«, »Das Erbe von Brampton Hill« und »Der Hutsalon am Willington Place«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1972 unter dem Originaltitel »The Girl«. Die deutsche Erstausgabe erschien 1981 unter dem Titel »Es ist nie zu spät« bei Franz Schneekluth, München. Der Roman erschien ebenfalls 1995 im Heyne Verlag.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1972 The Catherine Cookson Charitable Trust
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1981 by Franz Schneekluth Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz unter Verwendung von Shutterstock/HiSunnySky, Oaurea und AdobeStock/Colin, Cary Peterson
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-028-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Thorntons« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Catherine Cookson
Die Thorntons – Sturm über Elmholm House
Eine Familiensaga
Aus dem Englischen von Erni Friedman
dotbooks.
ERSTER TEIL
Die unwillkommene Tochter
Kapitel 1
Sie hatten zwei Tage gebraucht, um die dreiundzwanzig Meilen von Newcastle nach Hexham zurückzulegen, und hatten hierzu fast nur Feldwege oder die zu beiden Seiten der Hauptstraßen sich hinziehenden Grasstreifen benützt, um nicht von Kutschen und Karren überfahren oder von rücksichtslos daherstürmenden Reitern niedergerannt zu werden. Wäre Hanna alleine gewesen, so wäre sie mit der Leichtfüßigkeit eines Rehs dahingeeilt. Aber sie mußte sich nach ihrer Mutter richten, die sich, noch ehe sie Newcastle verlassen hatten, nur mühsam auf den Beinen halten konnte.
An diesem Morgen hatten sie sich aus einem dumpfriechenden Strohhaufen in einer mitten auf dem Feld stehenden verfallenen Scheune erhoben, noch ehe die Sonne aufgegangen war, und es hatte gut vier Meilen gedauert, ehe ihnen ein wenig warm geworden war. Das heiße Wasser, das Hanna sich von einem Bauern erbettelt und in das Nancy eine Handvoll Hafermehl getan hatte, wärmte sie ein wenig auf. Aber nun, um drei Uhr nachmittags, als sie endlich in Hexham anlangten, waren sie verschwitzt, hungrig und durstig.
Hanna Boyle war an das Stadtleben gewöhnt. Sie war in Newcastle zur Welt gekommen, und wann immer ihre Mutter sie zum Spielen nach draußen geschickt hatte, weil sie Besuch zu empfangen hatte, war sie am liebsten mitten in die Stadt gelaufen, um sich all die großen, prächtigen Gebäude und Plätze anzusehen.
Diese Stadt war jedoch anders. Obwohl Hanna hundemüde war, blickte sie sich interessiert um, denn was sie da zu sehen bekam, gefiel ihr. Der Marktplatz war anheimelnd, die Läden bunt, und die Straßen waren breit und sauber.
Ihre Mutter riß sie aus ihren Betrachtungen, als sie ihr zwei Pennys in die Hand drückte und sagte: »Geh hinüber in den Bäckerladen und sieh zu, daß du soviel wie möglich dafür bekommst.«
»Ja, Ma. Kann ich dich auch wirklich allein lassen?«
»Freilich. Mach dir keine Sorgen. Geh nur.«
Während das Kind über den Marktplatz lief, lehnte sich Nancy Boyle an die nächste Hausmauer und murmelte vor sich hin: »Mein Gott, gib, daß ich es schaffe!«
Als sie plötzlich von einem heftigen Hustenanfall gepackt wurde, zog sie ein Tuch aus der Tasche und preßte es vor den Mund. Nachdem sie mehrmals hineingespuckt hatte, drückte sie es fest zusammen, steckte es wieder ein und lehnte sich abermals gegen die Mauer, wobei sie vor Schmerzen krampfhaft keuchte.
Da sah sie ihre achtjährige Tochter zwischen Kutschen, Karren und Reitern hindurchschlüpfen und bemühte sich, das Keuchen zu unterdrücken. Als die Kleine vor ihr stand, blickte sie sie vorwurfsvoll an, ehe sie mühsam hervorbrachte: »Ich hätte gute Lust, dich an den Ohren zu… ziehen. Hab ich dir… nicht gesagt, daß du niemals zwischen den Wagen durchlaufen sollst? Verstehst du denn nicht, wie gefährlich das ist?«
»Ich paß schon auf, Ma.«
»Das sagt sich so leicht. Eines Tages wirst du noch überfahren werden… Was hast du bekommen?«
»Ich hab die Bäckersfrau um altes Brot gebeten. Sieh nur« ‒ sie öffnete ihre Tasche ‒, »was sie mir alles gegeben hat: Gebäck, sogar mit Zucker drauf, und ein großes Stück Teekuchen. Sie war richtig nett. Wollen wir hier essen?«
»Nein, nein. Du kannst meinetwegen ein Stück nehmen. Aber dann wollen wir uns nach einer Viehtränke Umsehen und einen tüchtigen Schluck Wasser trinken.« Nachdem sie den Platz hinter sich gelassen hatten, fragte Hanna, die genußvoll an dem Zuckergebäck kaute: »Wie weit haben wir denn noch, Ma?«
»Ein paar Meilen ‒ wenn das, was die Frau in der Hütte gesagt hat, stimmt.«
»Wie viele?«
»Woher soll ich das wissen? Weshalb fragst du ständig, zum Teufel! Ach, tut mir leid.« Die Frau schüttelte den Kopf und fuhr sich hilflos über das schmutzverkrustete Gesicht.
»Ist schon gut, ist ja schon gut, Ma«, sagte die Kleine hastig. Und dann stellte sie, als hätte ihre Mutter sie nicht eben gehörig angefahren, schon die nächste Frage. »Wird der Mann … wird er nett zu uns sein, Ma?«
»Das möchte ich ihm geraten haben«, erwiderte die Mutter kaum hörbar.
Als sie an mehreren feinen Läden vorbeigekommen waren und endlich ein Gasthaus erblickten, vor dem zwei Kutscher Bierfässer abluden, blieb die Frau stehen und fragte einen der Männer: »Können Sie mir sagen, wie weit es noch bis Elmholm ist?«
Der Angesprochene richtete sich auf, blickte sie und das Kind von oben bis unten an und erwiderte: »Elmholm? Nun, liegt ganz schön außerhalb von Allendale.«
»Wie weit außerhalb?«
»Alles in allem neun Meilen, würd ich sagen. Aber wenn Sie über den Hügel gehen, können Sie abkürzen.«
»Und wie kommen wir da hin?«
»Immer die Straße entlang, ungefähr vier Meilen, bis zu einem Dörfchen am Fluß, dort geht’s hügelan. Ein kleines Stück muß man da zwar klettern, aber man kommt eben viel rascher nach Elmholm hinüber als auf der Straße. Wenn Sie auf dem Hügel angelangt sind, können Sie Elmholm gar nicht mehr übersehen. Es ist ein ganz ansehnlicher Marktflecken.«
»Danke«, sagte die Frau und nickte dem Mann zu, der zurücknickte und den beiden nachsah, wie sie mit ihren Rocksäumen den Staub aufwirbelten. Als sein Arbeitskollege ihm zurief: »Was haben die zwei denn gewollt?«, meinte er: »Sie hat nach dem Weg nach Elmholm gefragt. Aber wetten möcht ich nicht darauf, daß sie’s schafft ‒ nein, das möcht ich nicht …«
Wie lange sie für die vier Meilen bis zur angegebenen Stelle am Fluß brauchten und wie lange sie dann am Fluß entlanggingen, um den hügelaufwärts führenden Weg zu finden, wußten sie nicht. Sie legten oben wieder einmal eine kurze Rast ein, als ein Wagen vorbeikam. Dessen Kutscher erwiderte ihnen auf ihre Frage: »Elmholm? O ja, da seid ihr auf dem richtigen Weg. Am besten, ihr schlagt da drüben den Feldweg ein«, er zeigte auf die andere Straßenseite, »und fangt an, raufzuklettern.« Gegen fünf erreichten sie nach zahlreichen Pausen endlich den Scheitelpunkt des ihrer Meinung nach letzten Hügels. Nun fragte das vor seiner Mutter stehende Kind die Niedergesunkene ängstlich, wobei es ins Tal deutete: »Soll ich nicht vorauslaufen, Ma, und versuchen, einen Unterschlupf für uns zu finden, und dich dann holen?«
»Nein, bleib hier. Ich… werde gleich wieder in Ordnung sein. Der Mann hat ja gesagt, daß … es auf der anderen Seite des Hügels sei.«
»Aber du siehst ganz erschöpft aus, Ma.«
»Sorg dich nicht«, sagte die Frau in einem für sie ungewohnt sanften Ton und streckte ihrer Tochter die Hand entgegen. »Es ist mir schon schlechter gegangen, und ich hab’s überlebt. Unkraut vergeht eben nicht.« Sie lächelte mühsam.
Hanna blieb ernst, ergriff den Arm ihrer Mutter und sagte: »Dann komm, Ma, steh lieber auf und halt dich an mir fest. Dieser Hügel sieht ganz schön steil aus.«
Der Hügel war tatsächlich steil. Nancy Boyle kroch auf allen vieren weiter, und dennoch mußte sie plötzlich lang ausgestreckt liegen bleiben, als ein neuerlicher Hustenanfall sie schüttelte. Nun unternahm sie auch keinen Versuch mehr, das Taschentuch vor den Mund zu pressen, aus dem Blut quoll.
Als sie sich schließlich mühsam hochrappelte, wischte Hanna ihrer Mutter mit einem Lappen, den sie ihrem Bündel entnommen hatte, das Gesicht ab, dann redete sie ihr zu: »Bleib liegen, Ma, wir müssen bald da sein. Ich kann dort unten schon die ersten Häuser sehen. Wie heißt denn der Mann, zu dem wir wollen, Ma?«
Nancy Boyle antwortete nicht, sondern richtete sich halb auf und drehte sich so zur Seite, daß sie sich an ein Felsstück anlehnen konnte.
»Hanna … ich kann im Moment nicht weitergehen«, sagte sie. »Wir werden eine Zeitlang warten müssen, bis ich wieder zu Atem komme.«
»Ja, Ma, ist gut. Weißt du, was? Iß doch was von dem gezuckerten Gebäck. Zucker ist bestimmt gut für dich.« Die Frau nahm stumm das angebotene Stück, brach dieses und den Teekuchen in zwei Teile und kaute dann langsam an dem ihren. Hanna machte sich hungrig über ihren Anteil und sagte munter: »Jetzt wirst du dich gleich besser fühlen, Ma, wo du was im Magen hast.«
»Ja, ich werde mich bald besser fühlen, Kind, aber sitzen bleiben muß ich doch noch eine Weile.«
Und so saßen sie eine Weile da. Hanna kam es lang vor, und immer wieder warf sie einen besorgten Blick auf ihre Mutter. Nicht, daß sie Blut gespuckt hatte, beunruhigte sie, denn das hatte sie schon immer getan ‒ in letzter Zeit jedenfalls. Was ihr Angst einjagte, war, daß ihre Mutter immer blasser wurde und ihre Augen immer glanzloser zu werden schienen.
Es fröstelte sie, sie blickte zum Himmel auf. Die Dämmerung hatte eingesetzt, und es würde nicht mehr lange dauern, bis es ganz dunkel war, höchstens noch eine Stunde ungefähr. Sie würde nun doch zu den Häusern hinunterlaufen müssen, denn hier oben konnte sie weit und breit keine Scheune oder dergleichen erblicken. Ihr war, als befänden sie sich mitten in der Wildnis. Alles sah völlig überwuchert, fern jeder Zivilisation und verlassen aus. Der Himmel schien um vieles höher als in Newcastle, es gab so schrecklich viel Platz hier. Hanna hatte es bedeutend lieber, wenn es eng war, wenn sie von Mauern umgeben war.
Sie kniete sich neben die Mutter und sagte sanft: »Kannst du es jetzt schaffen, Ma?«
»Was?« Es war, als hätte sie ihre Mutter aus tiefem Schlaf gerissen, denn ihre Lider flatterten, ehe sie sich umblickte und sagte: »Ja … ja, ich glaube schon.«
Sie hatten kaum die Hälfte des steil nach unten führenden Weges zurückgelegt, als die Mutter von neuem zu Boden sank und sich auf Händen und Füßen weiterschleppte, bis sie einen niedrigen Felsriegel erreichten: Sie ließ sich auf einem der Steine nieder, betrachtete die kahle Landschaft und stieß keuchend hervor: »Ist es noch weit?«
Hanna blickte über die Hügel und Täler, deren Farben von schieferfarbenem Grau bis zu stumpfem Grün reichten, es schien ihr, als wolle die Hügellandschaft kein Ende nehmen, als ginge sie direkt in den Himmel über. Panik ergriff wie ein böser Traum Besitz von ihr, sie fühlte, daß sie allein war, und sie fürchtete sich, als gäbe es kein Entrinnen.
Langsam drehte sie sich um und blickte auf ihre Mutter nieder ‒ dann ließ sie sich neben ihr zu Boden fallen, ergriff ihre Hand, zog sie an die Brust und ließ sie dort. »Was ist? Was ist denn?« Nancy Boyle schrak aus ihrer Lethargie auf. »Hast du was gesehen? Hast du da unten was entdeckt?«
»Nichts, Ma, nichts.«
»Was soll das heißen ‒ nichts?«
»Nun, das Dorf muß dort sein, das hab ich von droben gesehen. Aber es ist noch immer ein gutes Stück bis dahin.«
»Es … es wird nicht kürzer werden, wenn wir hier bleiben. Hilf mir auf.«
Nachdem Hanna ihrer Mutter auf die Beine geholfen hatte, stolperten und glitten sie abermals hügelabwärts. Endlich hatten sie die letzte Böschung erreicht, die von einem dichten Waldstreifen eingefaßt war, der kohlrabenschwarz aussah. Nun war Hanna diejenige, die stehenblieb und fragte: »Müssen wir da durch, Ma?«
»Entweder wir gehen durch, oder wir müssen drumherum. Und das kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Ich bin zu Tode erschöpft.«
Sie streckte dem Kind die Hand hin und redete ihm zu: »Komm ‒ von dort oben hat es gar nicht so weit ausgesehen. Wir werden bald durch sein.«
Aber als sie dann ohne Weg den Wald zu durchqueren suchten und das Laub der Bäume auch den letzten Schimmer des entschwindenden Tageslichts verschluckte, merkten sie nicht, daß sie statt der Breit- der Längsseite des Waldes gefolgt waren.
»Mein Gott!«
»Was ist denn, Ma?« Hanna klammerte sich fest an den Arm der Mutter.
»Nichts, nichts.«
Während sie sich von Baum zu Baum weitertasteten, flüsterte Hanna: »Haben wir uns verirrt, Ma?«
Als sie darauf keine Antwort erhielt, preßte sie sich dicht an die Mutter, blickte ringsum und rief schließlich aufgeregt aus: »Da ist ein Haus, Ma ‒ sieh nur!«
Hanna ließ den Arm der Mutter los und lief auf ein hölzernes Gebäude zu, das sich als ein nach der Seite offener, rohgezimmerter Holzschuppen erwies, der dazu bestimmt war, Werkzeug, Geräte und Säcke vor dem Wetter zu schützen.
»Sieh nur, Ma! Hier können wir bis morgen früh bleiben. Da sind Säcke und alles. Und sogar trockene.«
»Du lieber Himmel, so etwas!« Nancy Boyle schüttelte ungläubig den Kopf und wankte in den Schuppen, wo sie unter einem neuen Hustenanfall zusammenbrach.
»Leg dich schön hin, Ma. Weißt du, was? Ich werde dir drei Säcke aufeinanderlegen, dann ist es gleich weniger hart für dich.«
»Nein, laß, der Boden ist trocken, da wollen wir uns lieber nebeneinanderlegen und uns mit den Säcken zudecken. Ist noch etwas von dem Gebäck übrig?«
»Ja, zwei Stücke, Ma.«
»Dann wollen wir sie aufessen. Aber legen wir uns erst mal hin. Und iß langsam, so hält es länger vor. Es macht einen satter, wenn man langsam ißt, Kind.«
Eng nebeneinander liegend deckten sie sich mit den Säcken zu und kauten konzentriert an dem Gebäck. Kaum hatten sie den letzten Bissen hinuntergeschluckt, sanken sie beide erschöpft in Schlaf.
Es war der Nebel, der sie weckte. Hanna kam es vor, als wäre der Schuppen von grauem Licht erfüllt. Sie setzte sich auf und hustete. Wo waren sie? Was war geschehen? Wozu diente das Werkzeug ringsum? Als sie mit den Zähnen zu klappern begann, nahm sie den Nebel wahr, der dick und feucht in ihren Schuppen eingedrungen war und alles zu durchnässen schien, so daß sie von Kopf bis Fuß fröstelte. Sie blinzelte. Der neue Tag dämmerte herauf. Sie konnten aufstehen, weitergehen und vielleicht eine Hütte finden, wo sie eine Kanne heißen Wassers bekamen. Sie war durstig, nicht mehr hungrig, nur durstig. Und kalt war ihr, so kalt.
Sie drehte sich um, schüttelte die Mutter an der Schulter und sagte: »Ma! Es ist Tag.« Dreimal schüttelte sie sie, und dann schrie sie beinahe: »Hörst du mich, Ma? Ma! Wach auf, wach auf!«
Als ihre Mutter zu stöhnen begann, fiel ihr ein Stein vom Herzen. Ruhiger sagte sie: »Ma, es ist Tag, wir können weitergehen.«
»Hanna!«
»Ja, Ma?«
»Ich kann nicht weiter. Geh … und hol jemanden.«
»Aber woher denn, Ma? Woher soll ich denn jemanden holen?«
»Aus … aus dem Dorf. Geh!«
Hanna erhob sich mühsam. Ihre Beine waren so steif, daß sie beinahe hingefallen wäre. Dichte Nebelfetzen schoben sich vor ihr Gesicht, und sie rief ängstlich: »Ich werde aber nichts sehen, Ma.«
»Geh nur.«
Als sie aus dem Schuppen in den Wald hinaustrat, biß sie sich auf die Unterlippe, blieb sekundenlang ratlos stehen und wußte nicht, welche Richtung sie einschlagen sollte. Da hob sich plötzlich der Nebel, und keine zehn Schritte vor ihr lag offenes Land.
Sie schürzte ihren Rock und eilte auf die Lichtung zu. Nach einer Weile erblickte sie direkt vor sich auf einer abschüssigen Stelle ein altes Haus.
Während sie mit raschen Schritten darauf zuging, wurde es von einer neuerlichen Nebelwolke eingehüllt, aber mm wußte sie, wo es lag. So sprang und hüpfte sie durch den Nebelvorhang, ohne stehenzubleiben, bis sie spürte, daß der Boden unter ihr weder Gras noch Moos, sondern ein gepflasterter Hof war.
Das Stampfen von Hufen und die Stimme eines Mannes ließen sie einen Augenblick innehalten, dann lief sie in die Richtung, aus der die Geräusche gekommen waren. Als sie aus dem Nebel trat, erblickte sie am Ende des gepflasterten Hofes, der dieses merkwürdige Haus umgab, einen jungen Mann. Er war damit beschäftigt, einige Pferde aneinanderzubinden, hielt jedoch plötzlich in seiner Arbeit inne, wandte erstaunt den Kopf und spähte mit vorgerecktem Kopf der kleinen Gestalt entgegen. Er verharrte regungslos und schweigend, bis Hanna vor ihm stand und ihm mit einer eindringlichen Geste beide Hände auf den Arm legte. Da holte er tief Atem, befeuchtete sich die vollen Lippen, kniff die Augen zusammen und sagte: »Allmächtiger! Wer bist denn du?«
»Ich bin Hanna Boyle. Kommen Sie mit und helfen Sie mir, bitte, Mister! Sonst stirbt meine Mutter.«
»Deine Mutter?« Er beugte sich zu ihr hinunter, bis sein Gesicht auf gleicher Höhe mit dem ihren war, und fragte ruhig: »Wo ist sie denn?«
»Dort drüben im Wald.« Hanna deutete über ihre Schulter. »In einem Schuppen. Wir haben uns gestern abend verirrt und dort übernachtet.«
»Und sie ist krank?«
»Ja, sehr sogar.«
Er richtete sich auf, strich sich mit der Hand über sein unrasiertes Kinn, ergriff das Seil, das vorhin seinen Händen entglitten war, ging auf die den Hof einfassende Mauer zu, befestigte es an einem Ring und sagte: »Wartet hier schön, alle miteinander.« Dann wandte er sich an das Galloway-Pony, das bereits gesattelt war, und sprach zu ihm wie zu einem Menschen: »Paß auf sie auf, Racker, und keine Tricks, verstanden?« Mit großen Schritten überquerte er nun den Hof, während Hanna sich alle Mühe gab, nicht hinter ihm zurückzubleiben.
»Woher stammst du?«
»Aus Newcastle.«
»Aus Newcastle? Das ist aber weit. Weshalb kommt ihr von so weit her? Sucht ihr Arbeit?«
»Nein.«
Er sah sie an. »Was denn?«
»Ich … ich weiß es nicht.«
Er blieb stehen und verzog das Gesicht. »Du weißt es nicht?« fragte er und schüttelte bedächtig den Kopf. Dabei sah die Kleine alles andere als dumm aus!
Sie waren beinahe am Waldrand angelangt, ehe er die nächste Frage stellte: »Was hat denn deine Mutter?«
»Die Schwindsucht.« Sie traf diese Feststellung in der gleichen Art, in der ein anderer ›eine leichte Erkältung‹ gesagt hätte.
Er blieb wie angewurzelt stehen. Die Schwindsucht! Das war ja ansteckend. Ach was, er steckte sich schon nicht an … Aber was sollte er mit der Kranken anfangen? Schwindsüchtige waren zum Tod verurteilt. Er blickte das Kind von der Seite an und ging rasch weiter.
Als sie den Schuppen erreicht hatten und er sich über die Frau beugte, die unter den Säcken lag, fand er seine Meinung nur bestätigt: Sie war zum Tod verurteilt. Und wenn er auch nur das mindeste davon verstand, würde es nicht mehr lange dauern.
»Hallo, Missis«, sagte er so laut, als spräche er mit einer Schwerhörigen.
»Ich bin … krank.«
»Das sehe ich. Können Sie stehen?«
»Ich weiß nicht recht.«
»Wir wollen es versuchen.« Er bückte sich, legte den Arm um ihre Schulter, wandte aber gleichzeitig das Gesicht ab. Zwar war er nicht abergläubisch, aber er hütete sich auch davor, sein Schicksal herauszufordern. Und den Hauch einer Schwindsüchtigen einzuatmen, wäre gleichbedeutend damit gewesen.
»Ist schon besser … nur ein kleines Stück bis zum Haus. Wohin wollen Sie denn?«
»Ins Dorf. Nach Elmholm.«
»Ach so. Nun, da haben Sie nicht mehr weit. Kennen Sie dort jemanden?«
Er trug sie beinahe, während er auf ihre Antwort wartete. Als sie schwieg, blieb er stehen und wiederholte seine Frage. »Ich sagte, ob Sie dort jemanden kennen?«
»Ja.«
»Nun, ich kenne so ziemlich alle Dorfbewohner, vielleicht kann ich Ihnen den Betreffenden heraufholen.« Als sie wieder nicht antwortete, wandte er den Kopf und sah sie eindringlich an. Und dann sagte sie, als spürte sie seinen prüfenden Blick, obwohl sie die Augen beinahe geschlossen hielt: »Ich möchte erst sein Haus sehen.« Er runzelte die Stirn und erkundigte sich: »Wie ist denn sein Name?«
Es dauerte sekundenlang, ehe sie erwiderte: »Thornton.« Und dann fügte sie hinzu: »Ich glaube es jedenfalls.« Da sagte er nichts mehr, sondern zog sie mit sich fort. Thornton ‒ er hatte sich keineswegs verhört! Nun, was sollte eine wie sie von Matthew Thornton wollen? Es war zwar kein Geheimnis, daß er aus mehr als einfachen Kreisen stammte, aber daß er derart arme Verwandte wie diese beiden hatte… Was seine hochnoble Gattin wohl sagen würde, wenn ihr solche Gäste ins Haus schneiten? Sie würde sicher in Ohnmacht fallen! Das gönnte er ihr von Herzen… Wirklich merkwürdig, was einem der Nebel so bescherte.
»So ist’s recht, nur noch ein paar Schritte, dann sind wir da.«
Als sie den Hof überquerten, meinte er: »Sie werden sich ins Stroh legen müssen, denn die Leiter nach oben schaffen Sie nie im Leben.«
Hanna folgte ihrer Mutter und dem jungen Mann durch eine Doppeltür in einen großen, rechteckigen Raum, der aussah und roch wie ein Stall. An zwei Seiten befanden sich Pferdeboxen, vor der dritten Wand türmten sich Heuballen, und über gefüllten Säcken war an Nägeln eine Ansammlung von Werkzeugen und Sattelzeug aufgereiht. Am anderen Ende des Raums führte eine Leiter beinahe senkrecht zu einer darüber befindlichen Falltür.
Hanna sah zu, wie der junge Mann ihre Mutter auf ein mit Stroh bedecktes, erhöhtes Holzpodest sinken ließ, von einer Trennwand zwei braune Pferdedecken herunterzog, sie damit zudeckte, sich zu ihr niederbeugte und sie fragte: »Ist es so besser, Missis?«
Nancy Boyle machte eine kaum wahrnehmbare zustimmende Kopfbewegung.
»Ich muß mich jetzt auf die Beine machen, Pferde abliefern gehen«, sagte er gleichsam entschuldigend. »Bin nämlich Pferdehändler, wissen Sie. Sie bleiben jetzt jedenfalls so lange hier liegen, bis Sie ihre Beine wieder gebrauchen können. Ich werde rauf in die Küche gehen«, er deutete zur Leiter hinüber, »und den Alten herunterholen. Das ist mein Großvater. Er wird sich um Sie kümmern und euch etwas zu essen richten. Er ist zwar beinahe taub, aber hier«, er tippte sich an die Stirn, »ist er noch völlig in Ordnung. Obwohl er fast neunzig ist.« Damit nickte er ihr zu und stieg die Leiter hinauf. Hanna kniete sich neben ihrer Mutter hin, lächelte ihr beruhigend zu und flüsterte: »Jetzt wirst du dich sicher bald erholen, Ma. Wie nett und freundlich er ist, nicht? Wird der andere Mann auch so sein?«
»Nein.«
»Oh!«
»Weshalb, zum Teufel, treibst du dich noch hier rum? Du solltest längst fort sein! Was sagst du ‒ krank? Wo?« Hanna warf einen Blick auf die beiden Männer, die nun die Leiter herabkamen, der Junge glitt behende von Sprosse zu Sprosse, der alte hingegen setzte langsam Fuß um Fuß auf und hielt sich an beiden Seiten an.
Unten angekommen, blieb er mit einem Ruck stehen und starrte sie verblüfft an. Als Hanna ihn ebenfalls neugierig musterte, hätte sie um ein Haar gelacht, weil sie denken mußte: Sieht ja wie ein Matrose aus, wie ein richtiger Seebär…
Der Alte war bis auf zwei hinter den Ohren hervorstehende weiße Haarbüschel völlig kahl. Doch was ihm auf dem Kopf fehlte, schienen seine dichten weißen Bartstoppeln wettmachen zu wollen. Er mußte einmal ein wahrer Riese gewesen sein, selbst jetzt, wo er stark gebückt ging, war er noch eine respektable Erscheinung. Nun stand er neben dem Podest und blickte erst Hanna und danach deren Mutter an. Er schien sich leicht unbehaglich zu fühlen, und auch seine Stimme klang ängstlich, als er laut ausrief: »Das ist ein schöner Schlamassel! Was ist los mit Ihnen?«
Dann drehte er sich um und starrte seinen Enkel an, der ihm durch Gesten etwas klarzumachen versuchte. Endlich begriff er. »Die Schwindsucht?« sagte er, drehte sich auf dem Absatz um und eilte mit langen Schritten in den Hof hinaus. Aber auch von dort war klar und deutlich zu hören, was der Alte, nach Art aller Schwerhörigen überlaut sprechend, zu bedenken gab. »Und was ist, wenn sie abkratzt?«
Die Antwort war zwar weniger laut, aber immer noch vernehmbar. »Zerbrich dir nicht den Kopf, Großvater«, sagte der Junge. »Du brauchst sie nicht einzubuddeln. Sie hat Verwandte im Dorf: die Thorntons.«
»Wen?«
»Die Thorntons.«
»Die beiden sind mit den Thorntons verwandt? Das soll wohl ein Scherz sein, wie?«
»Das dachte ich erst auch. Aber sie wollen zu den Thorntons.«
»Sieh mal an!« Es folgte lebhaftes Kichern.
»Ich geh jetzt.«
Hanna schrak zusammen und schaute zu dem jungen Mann auf, der nun vor dem Podest stand. Sie hatte ihn gar nicht eintreten hören.
»Ich werde nicht vor dem späten Nachmittag zurück sein. Bleibt, solange ihr wollt. Bis sie wieder auf den Beinen stehen kann.«
»Danke.«
»Und iß tüchtig, wenn dir mein Großvater was bringt.«
»Ja, danke«, wiederholte sie.
Er betrachtete sie nachdenklich, lächelte aufmunternd und eilte hinaus in den Hof. Hanna sah ihm nach, bis er verschwunden war. Dann richtete sie aufseufzend den Blick auf ihre Mutter. Deren Gesicht war nun nicht mehr grau, sondern von rosiger Farbe. Es mußte ihr jetzt bedeutend wärmer sein, ja es sah so aus, als schwitze sie. Hanna, die noch immer fröstelte, hätte gewünscht, daß auch ihr wärmer sei. Sie war völlig durchgefroren und so müde, als hätte sie in der Nacht kein Auge zugetan. »Da! Iß das schön auf.«
Hanna fuhr auf, blinzelte und streckte die Hände gehorsam nach der dampfenden Schüssel voll Haferbrei aus. Offenbar war sie eingedöst.
»Kann deine Mutter allein essen?«
»Ich werde ihr dabei helfen.«
»Du mußt sie stützen. Warte, ich werde ihr einen Sack unterschieben.« Der Alte holte einen Getreidesack herbei und hob ihn keuchend auf das Podest, wo er ihn zur Seite drehte, so daß die Kranke sich daran anlehnen konnte. Dann schrie er Hanna geradezu an, als er fragte: »Magst du Tee?«
»O ja, gerne.« Hanna nickte eifrig.
»Das möcht ich dir auch geraten haben«, polterte er. »Tee darf man niemals ausschlagen. Obwohl ich bezweifle, daß du jemals richtigen Tee bekommen hast.«
Damit drehte er sich um und eilte hinaus. »Du mußt ihn dir holen kommen, wenn ihr mit dem Essen fertig seid«, brüllte er Hanna von der Tür aus zu.
Hanna schob abwechselnd der Mutter, dann wieder sich selbst einen Löffel Haferbrei in den Mund ‒ der alte Mann hatte nur einen Löffel in die Schüssel gelegt ‒, aber noch ehe sie die Hälfte gegessen hatte, wehrte Nancy die Hand des Kindes ab und sagte: »Iß es auf.«
»Fühlst du dich jetzt besser, Ma?«
»Ja, gewiß.«
»Möchtest du Tee? Der alte Mann hat gesagt, daß wir welchen haben können.«
Nancy schien zu überlegen, dann schüttelte sie langsam den Kopf und erwiderte: »Ich lege mich jetzt ein bißchen aufs Ohr. Hinterher werde ich mich sicher besser fühlen.«
»Gut, Ma.«
Hanna aß den restlichen Haferbrei heißhungrig auf. Danach erhob sie sich aus dem Stroh und durchquerte den Stall. Sie suchte und fand die Küche, wo sie den Alten vor dem Herd sitzen sah, ganz dicht davor, obwohl es hier drinnen mehr als warm war. Er kaute an einem dicken Schmalzbrot, und als er den Mund öffnete, sah Hanna, daß er nur mehr drei Backenzähne und einen Schneidezahn hatte.
»Möchtest du Tee?«
»Ja, bitte.«
»Wie geht es ihr?«
»Sie ist eingeschlafen.«
Er hatte sich von ihr abgewandt, während er redete, und nun drehte er sich wieder zu ihr um und brüllte: »Ich fragte, wie es ihr geht?«
»Sie ist eingeschlafen«, wiederholte Hanna, jedes einzelne Wort mit dem Mund formend, da sie sich daran erinnerte, daß der junge Mann es vorhin genauso getan hatte. Als auch dies nichts zu nützen schien, schloß sie einfach die Augen und stützte mit einer beredten Geste den Kopf in die Hand.
Nun verstand er. »Das ist das Allerbeste, schlafen… Wie alt bist du?«
»Acht.«
»Wie alt?«
Da sie bereits bis zehn zählen konnte, zeigte sie ihm acht Finger, und er wiederholte: »Oh, acht.«
Er lächelte ihr anerkennend zu, und Hanna erwiderte sein Lächeln. Während sie den Tee trank, den er ihr eingegossen hatte, kaute der Alte genüßlich an seinem Brot weiter.
Sie sah sich nun eingehender in der geräumigen Küche um. Über einem breiten niederen Geschirrschrank hingen verschieden große Bratpfannen an der Wand. Die Holzbank war mit Roßhaarkissen gepolstert, die einige schadhafte Stellen aufwiesen. Um den Küchentisch standen drei Stühle mit hohen, geraden Lehnen. Alles andere erinnerte eher an eine Werkzeugkammer: Hufeisen hingen an den Wänden, Bügel und Gurte lagen auf Stellagen, Messingbeschläge und Schachteln mit Nägeln verschiedenster Größe standen herum. Die Wände der Küche bestanden aus mächtigen Quadern. Nie vorher hatte sie derlei gesehen: in Newcastle gab es nur Ziegelsteine.
Hanna fuhr zusammen, als der Alte sie plötzlich anschrie: »Gefällt dir das Pele-Haus? So heißt meine Zwingburg, weißt du? Zwingburg ist gut, nicht?« Er kicherte.
Sie nickte.
»Ein schönes Haus, was?«
Wieder nickte sie.
»Hat gegen Wind und Wetter ebenso standgehalten wie gegen Krieg und Weiber.«
Er warf den Kopf in den Nacken und lachte aus vollem Hals. Dann wurde seine Miene ernst, er beugte sich zu ihr hinunter und sagte bedeutend leiser: »Ich bin hier geboren und aufgewachsen, weißt du? Drei Frauen hab ich hierhergebracht, zwei Söhne in die Welt gesetzt. Sie sind beide in dem verdammten Bergwerk geblieben. Nun habe ich bloß noch Ned. Er ist ein guter Junge, o ja!« Er beugte sich noch weiter zu ihr. »Genau wie ich, aus dem gleichen harten Holz geschnitzt, verstehst du? Geht seinen eigenen Weg, wird niemals einen Herrn und Gebieter anerkennen, läßt sich nicht herumkommandieren, der nicht! Nun, ich war genauso. Komisch, daß meine Jungs so ganz und gar ihrer Mutter nachgeraten sind. Keinen Mumm, weißt du! Das Bergwerk ist ihnen zu Kopf gestiegen. Ich hab es ihnen vorhergesagt. Wehe, wenn einer einmal mit dem Bergwerk in Berührung kommt, der wird davon aufgefressen. Aber was hilft’s? Sie wollten schnell Geld verdienen. Und für wen haben sie gearbeitet? Für den verdammten Blutsauger Beaumont. Bleibt beim Pferdehandel, hab ich gesagt. Solange es Bergwerke gibt, werden die Leute Maultiere und Pferde brauchen. Aber nein, sie waren ja richtig darauf versessen, am Schmelzofen zu arbeiten. Dabei ist das das reinste Gift. Blei ist Gift, weiß du das? Gift!«
Er lehnte sich zurück, griff zum Herd hinüber, schenkte sich aus der mächtigen braunen Teekanne tüchtig ein und goß die siedendheiße Flüssigkeit in sich hinein, als wäre der Tee nicht mehr als lauwarm.
Danach leckte er sich die Lippen, beugte sich abermals zu Hanna hinüber, die ihn mit großen Augen anstarrte, und fuhr fort: »Mein Vater war der größte Pferdehändler im ganzen Land. Der hat die Galloways, die Ponys, weißt du, dutzendweise in die Bergwerke verkauft. Früher einmal haben die Leute das ganze Erz auf Pferderücken herausgebracht. Aber was hat der ganze herrliche Fortschritt bewirkt? Straßen hat man gebaut, innen und außen, und Wagen verwendet. Da wurden auf einmal nicht mehr so viele Galloways benötigt. Nun ja, es reicht immer noch.«
Er streckte seine schmierig aussehende Hand aus und klopfte ihr aufs Knie, als er lachend sagte: »Ein Wagen ohne Pferd ist nicht viel wert, stimmt’s?«
Sie lächelte ihn an und nickte bestätigend. Gern hätte sie etwas zu dem Gespräch beigetragen und erzählt, daß die Pferde in Newcastle aber dreimal so groß seien wie die hier und kräftige, zottige Beine hätten, vor allem diejenigen, die die Bierwagen zogen… Aber da sie nicht wußte, wie sie ihm das durch Gesten hätte verdeutlichen sollen, lächelte sie ihn weiter an.
Der Alte spann seinen Faden weiter: »Weißt du, daß ich in meiner Jugend an einem einzigen Tag mehr Geld ausgeben konnte, als meine beiden Söhne in einem Monat im Bergwerk verdient haben? Ein Pfund hat man jedem von ihnen monatlich in der Zeche ausgezahlt, der Rest wurde für irgendwelche Verpflichtungen zurückbehalten. Du glaubst mir nicht? Es ist genauso wahr, wie ich hier sitze. ›Lebenshaltungskosten‹ nannten sie es, und bei Gott, ihr Lebensunterhalt war armselig. Jeder, der im Bleibergwerk arbeitet, ist ein Narr, der seine Seele verkauft. Man braucht ja nur daran zu denken, was im vergangenen Jahr passierte, als sie streikten. Achtzehn Monate setzten sie mit der Arbeit aus, und was war dann? Hinausgeworfen hat man sie, jawohl! Über hundert von ihnen hat man gefeuert, und mehr als die Hälfte davon hat damit das Dach überm Kopf verloren. Was wird mm aus ihnen, frag ich dich? Nach Amerika können sie auswandern, das ist alles, was ihnen übrigbleibt. Und was sie dort erwartet, weiß keiner. So geht’s zu in den Gruben. Die einzigen, die davon profitieren, sind die Besitzer und die Verwalter. Und Thornton ist einer davon. Weshalb wollt ihr zu dem hinunter?« Die letzte Frage stellte er beinahe in normaler Lautstärke.
»Ich weiß es nicht.« Da Hanna ihre Antwort mit einem Kopfschütteln begleitete, verstand er sie und wiederholte: »Du weißt es nicht?«
»Nein.«
Er lachte kurz auf. »So etwas! Ned hat mir gesagt, daß du mit deiner Ma von Newcastle zu Fuß heraufgekommen bist und du weißt nicht, weshalb ihr es getan habt? Da kann ich nur eines darauf sagen: Entweder bist du strohdumm, oder du bist ein durchtriebenes kleines Biest. Und dumm siehst du nicht gerade aus, keineswegs. Also, dann schweig dich ruhig aus, Kindchen, ich nehm es dir nicht übel. Schweig dich ruhig aus! Aber wenn du dort hinuntergehst« ‒ er deutete mit dem Daumen zur Tür ‒, »dann wird es dir bald dämmern, worauf du dich einläßt. Und das Dorf wird es auch im Handumdrehen wissen, das sag ich dir.«
Kapitel 2
Das Dorf Elmholm war ungefähr zweieinhalb Meilen von Allendale entfernt. Es bestand aus fünfundvierzig Häusern, wozu auch die Arbeitersiedlung gehörte, die rechts vom Dorfanger lag. Diese Siedlung war vor gut fünfzig Jahren errichtet worden, um die Arbeiter aus dem Bleibergwerk und den Schmelzhütten unterzubringen. Sie bestand aus niedrigen Steinhäusern mit zwei Räumen, deren Böden erst im Lauf der Zeit mit Steinfliesen ausgelegt worden waren. Die sanitären Einrichtungen hatten sich anfangs auf Abflußgräben vor den Häusern beschränkt. Mit den Jahren entschlossen sich die Leute, Senkgruben auszuheben, und zwar größtenteils hinter den Häusern oder gar erst am Gartenende. Die Dorfbewohner lebten im allgemeinen friedlich miteinander, abgesehen vom turbulenten Markttag oder freitags, wenn der Lohn ausgezahlt wurde. Dann schlugen sich die Raufbolde unter den Bergarbeitern oft die Köpfe blutig oder prügelten ihre Frauen. Aber wenn am Montagmorgen die Arbeit begann, verlief das Leben wieder in seinen gewohnten Bahnen.
Der Umriß des Dorfes ähnelte einer Birne. Die Straße von Allendale gab ihm diese Form, da sie sich zwischen der Schmiedewerkstatt von Ralph Buckman, dem Haus von Will Rickson und dem Bauhof teilte und beiderseits des Angers hinzog, um sich dahinter zwischen der Friedhofsmauer und ›Haus Elmholm‹ wieder zu vereinigen, was sozusagen den Stiel der Birne darstellte.
Die Dorfhäuser und -hütten waren von verschiedener Form und Größe. Fred Loams Haus zum Beispiel war zweistöckig, und zu ebener Erde befand sich der Metzgerladen. Die Nachbarhäuser gehörten Walter Bynge, dem Steinmetz, und Thomas Wheatley, dem Getreidehändler, der sich, obwohl er seine Hauptgeschäfte in Allendale abzuwickeln pflegte, gleichfalls im Erdgeschoß einen kleinen Laden eingerichtet hatte, wo er Mehl und Hülsenfrüchte verkaufte.
Die beiden größten Gebäude im Dorf waren die Methodistenkirche und das Gasthaus. Beide übten offenbar die gleiche Anziehungskraft auf die Einheimischen aus, denn sie pflegten nach dem Besuch der Kirche häufig auf dem kürzesten Wege in die Schenke überzuwechseln. Gleich hinter der Friedhofsmauer lag ›Elmholm House‹, Matthew Thorntons Besitz. Man konnte zwar sagen, daß jedermann im Dorf Matthew Thornton mochte, aber eines stand fest: auf seine Frau traf das keineswegs zu. Alle wußten, daß Matthew Thornton aus äußerst bescheidenen Verhältnissen stammte und es zu etwas gebracht hatte. Er hatte niemals einen Hehl daraus gemacht, daß seine Familie nur einen armseligen Kramladen in Haydon Bridge besessen hatte und daß er alles, was er an Wissen und Erziehung vorweisen konnte, einem pensionierten Lehrer verdankte, der ein paar Häuser weiter gewohnt und den aufgeweckten Jungen unter seine Fittiche genommen hatte. So hatte er ihm nicht nur das Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht, sondern sogar etwas Latein. Das ließ Matthew die Nase manchmal ein wenig hoch tragen, auch wenn ihm die Kenntnisse dieser toten Sprache kaum etwas nützten, als er die technische Laufbahn einschlug. Jedenfalls mußte diese Form von Bildung der »Gnädigen«, wie die Dörfler seine Frau in ihren Wirtshausgesprächen nannten, imponiert haben ‒ genauso wie die Tatsache, daß er sich gewählter ausdrückte als die anderen und eine gute Singstimme hatte. Anne Thornton stammte durchaus aus gutem Hause, sie war die Tochter eines Anwalts aus Newcastle. Über ihre Base Marion war sie zudem mit dem alten Beaumont selbst verwandt. Hätte man ihren Stammbaum weiter zurückverfolgt, so wäre man vielleicht noch direkt zu Adam und Eva gelangt. Jedenfalls erhob sie allen Ernstes Anspruch darauf, zum Adel gerechnet zu werden. Den Männern des Dorfes war dies immer wieder ein Anlaß zu lauter Heiterkeit. Die Frauen verhielten sich zurückhaltender, denn sie mußten sich der Tatsache fügen, daß Mrs. Thornton die ›First Lady‹ der Dorfgemeinschaft war.
Anne Thornton war eine große Blondine, deren blasser Teint die Klarheit ihrer großen, stahlblauen Augen nur noch unterstrich. Ihre Nase war klein, ihre Lippen waren voll, beinahe zu voll, aber wohlgeformt. Zwar verfügte sie weder über Busen noch Hüften, doch ersetzte sie das, was ihrer Anatomie diesbezüglich mangelte, durch geschickte Auspolsterung. Sie war eine tüchtige Hausfrau und ihren Kindern eine gute Mutter. Ob sie auch eine gute Ehefrau war, hätte nur Matthew Thornton beantworten können.
Hätte man ihre beiden Mägde ‒ Bella Monkton, die in der Küche das Regiment führte, und Tessie Skipton, das Haus- und Kindermädchen in einer Person ‒ nach ihrer Meinung über ihre Herrin gefragt, hätten die beiden einander nur angesehen, die Lippen zusammengepreßt und geschwiegen. Da Bella Monkton genau wußte, daß sie mit ihren vierzig Jahren keine Heiratsaussichten mehr hatte und Stellen schwer zu bekommen waren, hielt sie es für klug, keine riskanten Kommentare abzugeben. Und was die elfjährige Tessie Skipton betraf, so wußte sie aus eigener leidvoller Erfahrung, daß jeder Arbeitsplatz dem Armenhaus vorzuziehen war, aus dem Mr. Thornton sie vor vier Jahren befreit hatte. Deshalb würde sie sich für ihn, wie sie täglich beteuerte, mit Begeisterung die Finger wundarbeiten. Leider bot sich ihr nur die Gelegenheit, dies für ihre Herrin zu tun. Was dachte sie wohl über sie? Tessie sagte es nicht. Nur Bella gegenüber sprach sie sich hier und da aus, aber auch das nur unter vier Augen im Flüsterton, wenn sie in dem Dachstübchen, das sie miteinander teilten, ihre müden Glieder auf einem Strohlager ausstreckten.
Sie kamen gut miteinander aus, Bella und Tessie. Jede war für die andere der Ersatz für etwas, was sie vermißte: die eine eine Tochter, die andere eine Mutter. Ihr gutes Einvernehmen trug übrigens viel dazu bei, daß der Haushalt reibungslos lief, denn die beiden leisteten gut und gern die Arbeit von vieren.
Außer ihnen gab es im Haushalt der Thorntons noch den gleichfalls aus dem Armenhaus stammenden vierzehnjährigen Dandy Smollett, der Garten und Pferd zu versorgen hatte und im Stall schlief.
John, der älteste Sohn des Hauses, war zwölf und für sein Alter ziemlich groß. Obgleich er seiner Mutter äußerlich sehr ähnlich sah, schien er nichts von ihren Eigenschaften geerbt zu haben.
Margaret, die älteste Tochter, schlug äußerlich ihrem Vater nach, denn sie hatte das gleiche quadratische Gesicht, die gleichen lichtbraunen Haare, ebenso graue Augen und seinen großen Mund. Sie war ein sehr sensibles Wesen, das mit allen Lebewesen Mitleid hatte und oft weinte.
Der zehnjährige Robert glich äußerlich gleichfalls seinem Vater und war bereits bedeutend größer als Margaret. Er war eine Abenteurernatur und ungemein eigensinnig ‒ Eigenschaften, die er, wie man ihm erzählt hatte, seinem Großvater väterlicherseits verdankte.
Beatrice, die als jüngstes Kind meist Betsy genannt wurde, war das genaue Ebenbild ihrer Mutter ‒ nicht nur, was Gesicht und Gestalt anlangte, sondern vor allem in ihrem Wesen. Da sie noch keine neun Jahre alt und noch dazu recht klein war, wurde sie von sämtlichen Familienmitgliedern als Nesthäkchen verhätschelt und tüchtig verzogen.
Im Moment befanden sich alle Kinder daheim. John, der in Hexham ins Internat ging, hatte ebenso Ferien wie Margaret und Robert, die die Tagesschule in Allendale besuchten. Betsy ging überhaupt noch nicht zur Schule, da man sie daheim als zu zart dafür hielt, was jedoch nicht bedeutete, daß sie noch keinen Unterricht erhielt. Täglich las ihr die Mutter eine Stunde am Vormittag und eineinhalb Stunden am Nachmittag aus der Bibel vor, übte mit ihr Lesen, Schreiben und Rechnen und brachte ihr das Sticken und Spinettspielen bei.
Auch jetzt saß Anne Thornton am Spinett, die Hände auf den Tasten und den Blick auf die Noten gerichtet. John, Margaret und Betsy umstanden sie. Ohne den Blick vom Notenblatt zu wenden, rief Anne plötzlich: »Robert!« Die Kinder wurden unruhig. Margaret versetzte John einen leichten Rippenstoß, worauf der Bruder unverschämt grinste, während die kleine Betsy sich auf die Zehenspitzen stellte und sich fast den Hals verrenkte, nur um aus dem Wohnzimmerfenster hinaussehen zu können.
»Er ist aus dem Haus gegangen, Mama ‒ den Weg hinunter!« piepste sie plötzlich.
Anne Thornton erhob sich mit einem Ruck von ihrem Drehstuhl. Ihr umfangreicher Rock streifte ihre Jüngste so heftig, daß das Kind beinahe hingefallen wäre. Am Fenster angelangt, klopfte sie energisch an die Scheiben, stieß dann die beiden Flügel auf und rief in unüberhörbarem Befehlston: »Robert!«
Der Junge drehte sich um und sah seine Mutter einen Augenblick an. Dann zuckte er die Achseln und trat widerstrebend den Rückweg an.
Er hatte die lange, schmale Halle noch nicht durchquert, als seine Mutter bereits aus dem Wohnzimmer eilte. Ehe sie jedoch noch Zeit fand, ihn zu tadeln, sagte er energisch: »Wir haben Ferien, Mama. Es ist ein schöner Tag, also möchte ich auf die Hügel gehen.«
»Zwischen ›mögen‹ und ›dürfen‹ besteht ein gewaltiger Unterschied. Das habe ich dir schon gesagt. Wenn du noch ein einziges Mal ungehorsam bist, werde ich mit deinem Vater darüber sprechen!«
Diese Drohung schien keinen besonders großen Eindruck auf Robert zu machen. Er schob die Hände in die Taschen seiner Kniehose, warf den Kopf zurück und marschierte unwillig durch das Wohnzimmer, bis er bei seinen Geschwistern, die ihn verstohlen ansahen, angelangt war.
Kaum hatte Anne Thornton wieder auf dem Drehstuhl Platz genommen, ihre Röcke zurechtgeschoben und die Hände zum Spiel erhoben, als ihr schwieriger Sohn heftig protestierte: »O nein, nicht das ‒ wir sind doch keine Klageweiber!«
Anne Thornton zwang sich, ihre Ungeduld nicht zu zeigen. Sie verharrte bewegungslos und erwiderte so ruhig wie möglich: »Das ist eines von Thomas Moores schönsten Liedern. Außerdem ist es das einzige in dem Buch, das für vier Stimmen arrangiert ist, und ich möchte, daß die Überraschung für euren Vater tadellos ausfällt.«
»Als ob der sich schon was draus machte!«
Diesmal war es John, der damit herausplatzte, worauf Margaret zu kichern begann, aus Angst vor dem Zorn der Mutter jedoch gleich wieder verstummte.
Nach kurzem Zögern sagte Arme Thornton: »Ich werde die erste Strophe singen, und jeder von euch weiß, wann er einzusetzen hat. Erst du, Margaret, dann du, Robert, und dann du, John.« Nun drehte sie sich halb um, blickte ihren Zweitältesten Sohn fest an und fuhr fort: »Und denkt gefälligst daran, daß dies Lied genau wie vorgeschrieben gesungen wird: langsam und mit feierlichem Ernst.«
Nachdem sie ›Wie oft hat das Käuzchen geschrien‹ intoniert und den Kindern der Reihe nach Einsatzzeichen gegeben hatte, schwoll der Trauergesang auf und ab, bis sie gemeinsam in die Schlußworte »Seufzt über das Heldengrab« einstimmten. Da Betsy es aber nicht lassen konnte, besagtes ›Heldengrab‹ grell hervorzupiepsen, war es mit der erzwungenen Feierlichkeit auch schon zu Ende. Die Kinder lachten einfach drauflos, bis die Mutter den Anführer der Schar, ihren ungeratenen Sohn, bei den Ohren packte und aus dem Wohnzimmer bis zur Treppe zog, wo sie ihn noch einmal kräftig durchbeutelte und ihn anschrie: »Geh sofort auf dein Zimmer! Ich werde mit Vater reden, wenn er heimkommt.«
Die Hände auf die brennenden Ohrmuscheln gedrückt, stapfte der Junge hochrot die Treppe hinauf, blieb aber mit einem Ruck stehen, als ihm die Mutter zur Strafverschärfung nachrief: »Und ich werde dafür sorgen, daß er dir verbietet, zu Mr. Beaumonts Feier zu gehen, verlaß dich drauf!«
Johns Lippen begannen zu zittern, und einen Moment lang sah es aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen. Statt dessen hob er den Kopf, wandte der Mutter ostentativ den Rücken und eilte in sein Schlafzimmer.
Mrs. Thornton drehte sich um, musterte kurz ihre andern drei Kinder, die in der Wohnzimmertür standen, und sagte in bewundernswert beherrschtem Ton zu Margaret: »Hol das ›Buch des Wissens für junge Damen‹. Wir wollen uns das Kapitel ›Erze‹ vornehmen. Euer Vater wird begeistert sein, wenn ihr Interesse dafür zeigt.« Den Kindern in den Wintergarten vorangehend, nahm sie das von Margaret eilends herbeigebrachte umfangreiche Buch in Empfang. Als sie sah, wie ihr jüngster Sohn unwillig die Stirn runzelte, erkundigte sie sich barsch: »Was hattest du vor, wenn ich fragen darf?«
»Nichts, Mama«, kam es gedehnt zurück. Robert konnte jetzt schwerlich eingestehen, er hätte einen Spaziergang über die Hügel machen wollen, so sehr ihm auch danach zumute war.
»Nun, dann komm gefälligst mit in den Wintergarten.« Nachdem alle Platz genommen hatten, schlug Anne Thornton das Buch an der durch ein Lesezeichen gekennzeichneten Stelle auf, blickte lächelnd in die Runde und sagte: »Jedesmal, wenn ich dies Buch zur Hand nehme, erinnere ich mich an meinen vierzehnten Geburtstag, zu dem ich es von meiner lieben Mutter geschenkt bekommen habe.«
Die beiden Mädchen schauten sie an, sagten jedoch nichts. Betsy wußte zwar, daß ihre Mutter nur auf die Aufforderung wartete, über die großartige Feier ihres vierzehnten Geburtstags zu berichten, aber sie hatte sie schon zu oft gehört, um sie nicht tödlich langweilig zu finden, während Margaret sich fragte, weshalb Märchen einen immer wieder zu fesseln vermochten, wohingegen Geschichten über Erwachsene es nicht einmal beim ersten Mal vermochten.
Aufseufzend begann Margaret nun das Kapitel über die Erze vorzulesen. Matt und langsam buchstabierte sie ihr schwierig erscheinende Worte, die keinen Sinn für sie ergaben: »Ist es nicht sonderbar, daß Erze manchmal so ganz anders sind als Metalle? Viele Minerale bekommen wir in ihrem natürlichen Zustand zu Gesicht, aber nur wenige Menschen sind mit den Metallen vertraut, die ganz allgemein in Gebrauch sind, oder denken auch nur im entferntesten an die vielen Arbeitsgänge, die nötig sind, um daraus Gebrauchsgegenstände herzustellen, die wir Tag für Tag zur Hand nehmen. Was sieht wohl weniger wie Kupfer aus als der wunderbar wirkende Malachit, nicht wahr? Und nehmen wir einmal …«
An dieser Stelle wurde der schwerfällige Monolog glücklicherweise dadurch unterbrochen, daß die Tür zum Wintergarten ohne vorheriges Anklopfen aufgerissen wurde und Tessie in höchst ungebührlicher Form hereingestürzt kam. »Missis, Ned Ridley steht mit zwei Leuten vor der Haustür!« stieß sie hervor.
»Ned Ridley?«
»Ja, Missis, mit zwei Leuten.«
Anne Thornton erhob sich, ging langsam auf Tessie zu, baute sich vor ihr auf und fragte: »Was soll das heißen: zwei Leute? Drück dich gefälligst deutlicher aus, Mädchen.«
»Nun, Missis, die beiden sehen wie richtige Landstreicher aus, schlimmer sogar, schmutzig und… Also, es ist eine Frau und ein Kind.«
Anne Thornton stützte die Hände in die Hüften und wies Tessie an: »Sag allen dreien, daß sie zur Hintertür gehen sollen, und bitte die Köchin, sie zu fragen, was sie wollen.«
»Ja, Missis.«
»Setz dich, John!«
Der Junge hatte versucht, vom Ende des Wintergartens aus einen Blick auf die zur Haustür führenden Stufen zu werfen. Auch Anne Thornton nahm wieder ihren Platz ein, forderte ihre Tochter jedoch nicht dazu auf, mit dem Lesen fortzufahren. Statt dessen saß sie, wie ihre Kinder, abwartend da.
Tessie kehrte derart rasch zurück, daß keiner der Anwesenden sich vorstellen konnte, daß sie in der kurzen Zeit tatsächlich an der Haustür gewesen war. Sie bewies es jedoch dadurch, daß sie gleich nach dem Eintreten herausplatzte: »Er will sich nicht von der Stelle rühren, Missis! Ned… Ned Ridley. Er sagt, die beiden seien von weit her gekommen, um mit dem Master zu sprechen.« Abermals erhob sich Anne Thornton langsam, legte die Fingerspitzen aufeinander, rückte sich die Gürtelschnalle zurecht, ebenso Spitzenkragen und Leinenhäubchen, dann durchquerte sie wortlos den Wintergarten und ging durch die Halle zur Haustür.
Tessie, die die Tür kurz zuvor geschlossen und die Besucher draußen stehengelassen hatte, war ihr vorausgelaufen. Nun öffnete sie wieder, trat zurück und sah ihre Herrin neugierig an.
Als Anne die drei Leute auf den Stufen erblickte, wurde ihre Miene eisig. Sie konnte sich nicht denken, was die zwei schmutzigen Fremden wünschten, aber daß Ned Ridley es wagte, einfach mir nichts, dir nichts am Haupteingang aufzutauchen, war in ihren Augen eine glatte Unverschämtheit. Es hatte sie damals schon genug gedemütigt, ihre Hilfsmaßnahmen dem kleinen Ned gegenüber scheitern zu sehen. Noch erniedrigender war der Spott gewesen, den sie später von dem Heranwachsenden geerntet hatte. Die Erinnerung an ihr letztes Zusammentreffen war ihr nach wie vor gegenwärtig. Da war sie zur Weihnachtszeit mit John und Robert den Hügel hinaufgegangen. Sie wollten Neds Großvater, obwohl dieser als ausgemachter Grobian galt, ein Geschenk bringen. Aber sie hatten kein Wort des Dankes zu hören bekommen, sondern waren von den beiden nur verhöhnt worden.
»Was soll ich wohl Ihrer Meinung nach dafür tun, Missis?« hatte der Alte zu ihr gesagt, nachdem er das Stück Bauchfleisch ausgewickelt hatte. »Erwarten Sie nun etwa, daß wir Ihnen für dieses Almosen auf den Knien danken? Da hat die Frau des Pastors schon mehr Großzügigkeit bewiesen, die hat uns nämlich eine dicke Fleischpastete und Zuckerzeug gebracht, müssen Sie wissen. Und trotzdem werden wir deswegen keine eifrigen Kirchgänger, jawohl!«
Die ärgste Beleidigung hatte ihr jedoch der Junge zugefügt, als er ihr, nachdem er sie bis ans Ende des Hofes begleitet hatte, grinsend zugeflüstert hatte: »Wenn Sie ihm statt dessen eine Flasche Schnaps mitgebracht hätten, Madam, dann wäre er am Ende wirklich hinuntergekommen und hätte vor Ihrer Haustür gesungen ‒ wenn auch nicht gerade Kirchenlieder. Aber so…« Oh, diese Ridleys!
»Was willst du?« fragte sie barsch.
»Guten Tag, Madam.« Der junge Bursche zog mit einer schwungvollen Geste seine Mütze und sagte: »Ich hab die beiden Leute hierhergeführt, die in aller Frühe bei uns droben aus dem Nebel aufgetaucht sind. Sie haben auf dem Weg zu Ihnen die ganze Nacht im Freien verbracht.«
Ein Ausdruck äußersten Staunens lag nun auf Anne Thorntons Gesicht, als sie von der Frau zu dem kleinen Mädchen blickte. Dann wandte sie sich an die Frau. »Weshalb wollt ihr mich sprechen?«
Nancy Boyle hustete zweimal kurz, schluckte und antwortete schleppend: »Ich komme nicht zu Ihnen, sondern zu Ihrem Mann.«
»Mein Mann ist nicht daheim. Sagen Sie also mir, was Sie von ihm wünschen.«
Wiederum mußte Nancy husten, diesmal heftiger. Aber sie hielt dem durchdringenden Blick der stahlblauen Augen stand. »Das ist meine und seine Angelegenheit«, erwiderte sie stolz.
Einen Moment lang verschlug es Anne Thornton die Sprache. Dann schaute sie jedoch in das Gesicht Ned Ridleys, dessen ernsthafter und feierlicher Ausdruck von dem Lachen in seinen Augen Lügen gestraft wurde. Das war zuviel!
»Was diese Leute meinem Mann auch zu sagen haben mögen ‒ ich bin sicher, daß sie es sehr gut ohne deine Hilfe zustande bringen werden!« fuhr sie ihn an. »Also sei so freundlich und verschwinde. Und vergiß in Zukunft nicht, daß wir einen Hintereingang haben.«
»O ja, Madam, natürlich, Madam!« Der junge Mann setzte seine Mütze mit einer heftigen Bewegung wieder auf, trat feixend zwei Schritte zurück und sagte dann zu Nancy: »Viel Glück, Missis, viel Glück, was Sie auch Vorhaben mögen.«
Anne Thornton sah ihm nach, als er die Auffahrt hinunterlief, das Gittertor aufriß, es hinter sich zuschlug und abermals spöttisch an den Mützenrand tippte.
Was für ein Flegel! Wenn irgend jemand auf der Welt imstande war, sie zu ärgern, dann war es dieser Bursche. Seit sie ihn als kleinen Jungen zum ersten Mal gesehen hatte, hatte er sie gereizt und verärgert, und auch die folgenden Begegnungen hatten sie stets mit Zorn und Abscheu erfüllt…
»Ich möchte Ihren Mann sprechen«, brachte sich die Fremde wieder in Erinnerung.
Mrs. Thornton wurde dadurch jäh in die Gegenwart zurückgeholt. Hochmütig wandte sie sich der noch immer auf der untersten Stufe stehenden Frau zu und fragte verächtlich: »Was haben Sie mit meinem Mann zu schaffen?«
»Das ist meine Angelegenheit.«
»Wer sind Sie überhaupt?«
»Ich heiße Nancy Boyle, und das hier ist meine Tochter Hanna.« Die Frau legte die Fingerspitzen auf die Schulter des Kindes.
Anne Thornton starrte die Kleine an, ehe sie sagte: »Falls Sie Vorhaben zu betteln, ist es nicht mein Mann, an den Sie sich zu wenden haben. Diese Angelegenheiten erledige ich. Wir geben Almosen zugunsten der Kirche und …«
»Ich will kein Almosen, Missis ‒ ich möchte Ihren Mann sprechen.«
»Mein Mann befindet sich in seinem Büro. Wenn Sie etwas mit ihm zu besprechen haben, können Sie das getrost mir sagen.«
Nancy Boyle blickte unerschrocken in das abweisende Gesicht der Hausherrin, ehe sie ruhig erwiderte: »Sie werden es früh genug erfahren. Ich kann warten, bis er zu Hause ist. Komm!« Sie drehte die Kleine um und schob sie zum Eisentor.
Anne Thornton sah den beiden vom Treppenabsatz aus nach. Sie kniff die Augen zusammen, kaute auf der Unterlippe und überlegte ziemlich beunruhigt, welche Verbindung es zwischen diesen abgerissenen Geschöpfen und ihrem Mann geben konnte. Es waren doch hoffentlich keine Verwandten von ihm? Natürlich wußte sie, daß er einfacher Herkunft war. Hatte sie nicht seit Jahren versucht, diesen Umstand durch tadelloses Verhalten in Vergessenheit geraten zu lassen? Aber wie ärmlich die Verhältnisse auch sein mochten, aus denen ihr Mann stammte ‒ seine Verwandten hätten sich gewiß dagegen gewehrt, mit dieser Person und ihrem Kind in Verbindung gebracht zu werden.
Als die Standuhr in der Halle rasselnd die vierte Stunde schlug, überlegte sie, daß bis zu seiner Heimkunft noch zwei Stunden vergehen würden. Was war, wenn dieses Weib sich währenddessen auf die Bank am Dorfanger setzte, sich mit Vorbeikommenden auf ein Gespräch einließ und ihnen erzählte, daß sie hier sei, um Matthew Thornton aufzusuchen? Sie hätte die beiden im Hof warten lassen sollen. Wie hatte sie nur so unvorsichtig sein können!
Aufgeregt drehte sie sich um, hob die Rockschöße hoch und eilte durch die Halle, vorbei an Tessie, deren Miene deutlich zum Ausdruck brachte, wie erstaunt sie darüber war, ihre sich stets so würdevoll gebende Missis laufen zu sehen. Noch erstaunter sah sie drein, als Anne Thornton, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, nach oben hastete. Sie erriet sogleich, daß ihre Herrin ins Schlafzimmer der Knaben wollte, und konnte sich gut vorstellen, weshalb sie dies tat.
Auch Robert war verblüfft, mit welcher Heftigkeit seine Mutter das Schlafzimmer betrat. Sie stieß ihn beinahe von der breiten Fensterbank, kauerte sich nun selbst darauf und drückte ihr Gesicht an die Fensterscheibe. Von hier aus hatte man nämlich einen ungehinderten Blick auf die zur Dorfmitte führende Straße. Alles, was Anne im Moment von ihrer Warte aus sehen konnte, waren die beiden Bynge-Mädchen Alice und Mary, die mit Bill Buckman plauderten, übertrieben lachend die Köpfe zurückwarfen und sich überhaupt recht unziemlich benahmen. Wo nur die Mutter der beiden war? Jeder wußte, daß Bill Buckman verheiratet war, angeblich lebte seine Frau in Hexham. Und nicht nur seine Frau, auch seine Freundin… Ach, was zerbrach sie sich über derlei Dinge eigentlich den Kopf? Von ihren beiden »Besucherinnen« war jedenfalls weit und breit nichts zu sehen!
»Nach wem hältst du Ausschau, Mama?« Die Stimme des Jungen verriet keinerlei Groll darüber, daß sie ihm erst vor kurzem eine Strafe verpaßt hatte.
»Nach niemandem.«
»Handelt es sich um die Leute, die vorhin an der Haustür waren?«
Sie fuhr herum und sah ihren Sohn an. Natürlich hatte er die beiden gesehen!
»Sie sind nicht ins Dorf gegangen, Mama«, erklärte Robert, »sondern in die entgegengesetzte Richtung, die Kirchhofmauer entlang hügelan. Sieh nur« ‒ er trat neben sie und deutete hinunter ‒, »dort sitzen sie.«
Anne schaute in die angegebene Richtung. Tatsächlich, dort saß die Frau. Und das Kind stand neben ihr. Von diesem kleinen Hügel neben dem Friedhof konnte man die Straße sehr gut überblicken, auf der ihr Mann heimzureiten pflegte, wenn er aus dem Bergwerk kam. Wußte das Weib das? Es war möglich, daß Ned Ridley es ihr gesagt hatte. Was wollte sie? Was wollte sie nur?
»Behalt die beiden weiter im Auge, Robert«, befahl sie ihrem Sohn. »Wenn sie den Hügel verlassen, gibst du mir Bescheid, verstanden?«
»Ja, Mama. Weshalb wollen die beiden mit Papa sprechen?«
Anne Thornton blieb auf dem Weg zur Tür unvermittelt stehen, drehte sich jedoch nicht um, als sie antwortete: »Ich weiß es nicht.«
Dieser Junge! Er mußte vorhin das Fenster geöffnet und ihr Gespräch mitangehört haben. Aber dann hatte auch Tessie heimlich gelauscht, und das bedeutete, daß Bella gleichfalls bereits Bescheid wußte. Und was Bella wußte, würde in Kürze das ganze Dorf erfahren.
Was war nur plötzlich los hier? O wäre es doch nur schon sechs Uhr…
Matthew Thornton, der sich gerade auf den Heimweg machen wollte, warf einen Blick auf das scheinbare Durcheinander, das Joe Robson, ein erfahrener Bergmann, seinem Sohn Peter soeben erklärte: Es handelte sich um die beste Art des Erzwaschens. Die Kunst bestand darin, den Rechen so hin- und herzuschieben, daß das Gestein auf einem von einem Holzrahmen umgebenen großen Sieb von allen Seiten einem kräftigen Wasserstrom ausgesetzt wurde.