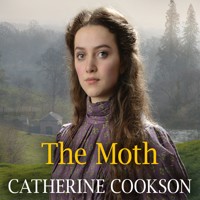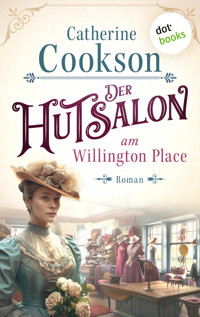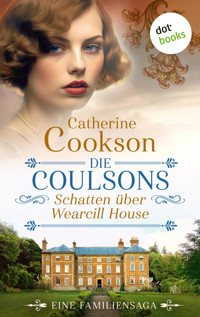
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Liebe und Intrigen: Die Schicksalssaga »Die Coulsons – Schatten über Wearcill House« der Bestsellerautorin Catherine Cookson als eBook bei dotbooks. Ein altehrwürdiges Anwesen in den 60er Jahren: Winifred und Daniel Coulson haben viele Opfer gebracht, um ein angesehenes Leben im englischen Tyneside führen zu können. Dass ihre Ehe über die Jahre immer mehr Risse bekommen hat, wissen sie gekonnt zu verbergen – und ebenso, dass Winifred von ihren drei Söhnen nur einen einzigen lieben kann. Doch welches Geheimnis verbirgt sich dahinter? Donald ist derjenige, der als perfekter Sohn das Erbe der Familie weiterführen muss – aber als er sich ausgerechnet in Annette, ein einfaches Mädchen aus dem nahen Dorf verliebt, braut sich ein Sturm über Wearcill House zusammen. Werden nun lang vergrabene Skandale ans Licht drängen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der mitreißende Englandroman »Die Coulsons – Schatten über Wearcill House« von Catherine Cookson wird Fans von Judith Lennox begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein altehrwürdiges Anwesen in den 60er Jahren: Winifred und Daniel Coulson haben viele Opfer gebracht, um ein angesehenes Leben im englischen Tyneside führen zu können. Dass ihre Ehe über die Jahre immer mehr Risse bekommen hat, wissen sie gekonnt zu verbergen – und ebenso, dass Winifred von ihren drei Söhnen nur einen einzigen lieben kann. Doch welches Geheimnis verbirgt sich dahinter? Donald ist derjenige, der als perfekter Sohn das Erbe der Familie weiterführen muss – aber als er sich ausgerechnet in Annette, ein einfaches Mädchen aus dem nahen Dorf verliebt, braut sich ein Sturm über Wearcill House zusammen. Werden nun lang vergrabene Skandale ans Licht drängen?
Über die Autorin:
Dame Catherine Ann Cookson (1906–1998) war eine britische Schriftstellerin. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern gehörte sie zu den meistgelesenen und beliebtesten Romanautorinnen ihrer Zeit; viele ihrer Werke wurden für Theater und Film inszeniert. In ihren kraftvollen, fesselnden Schicksalsgeschichten schrieb sie vor allem über die nordenglische Arbeiterklasse, inspiriert von ihrer eigenen Jugend. Als uneheliches Kind wurde sie von ihren Großeltern aufgezogen, in dem Glauben, ihre Mutter sei ihre Schwester. Mit 13 Jahren verließ sie die Schule ohne Abschluss und arbeitete als Hausmädchen für wohlhabende Bürger sowie als Angestellte in einer Wäscherei. 1940 heiratete sie den Gymnasiallehrer Tom Cookson, mit dem sie zeitlebens zurückgezogen und bescheiden lebte. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1950; 43 Jahre später wurde sie von der Königin zur Dame of the British Empire ernannt und die Grafschaft South Tyneside nennt sich bis heute »Catherine Cookson Country«. Wenige Tage vor ihrem 92. Geburtstag starb sie als eine der wohlhabendsten Frauen Großbritanniens.
Catherine Cookson veröffentlichte bei dotbooks auch ihre englischen Familiensagas »Die Thorntons – Sturm über Elmholm House«, »Die Lawsons – Anbruch einer neuen Zeit«, »Die Emmersons – Tage der Entscheidung« und »Die Masons – Schicksalsjahre einer Familie«.
Bei dotbooks erscheinen außerdem ihre Schicksalsromane »Der Himmel über Tollet’s Ridge«, »Das Erbe von Brampton Hill«, »Sturmwolken über dem River Tyne«, »Sturm über Savile House« und »Der Hutsalon am Willington Place«.
***
eBook-Neuausgabe November 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »The Year of the Virgins« bei Simon & Schuster, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Das Glück zeigt Risse« im Heyne Verlag.
Copyright © The Catherine Cookson Charitable Trust 1993
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/HiSunnySky, naskopi und AdobeStock/Felix
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-876-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Coulsons« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Catherine Cookson
Die Coulsons – Schatten über Wearcill House
Eine Familiensaga
Aus dem Englischen von Peter Pfaffinger
dotbooks.
Erster Teil
Kapitel 1
»Was soll ich? Das kann doch nicht dein Ernst sein!«
»Es wird von einem Vater wohl nicht zuviel verlangt sein, seinem Sohn eine so simple Frage zu stellen.«
»Wie bitte?«
Daniel Coulson beugte sich über die Frisierkommode; im Spiegel sah er das feiste Gesicht seiner Frau. Ihre Haut war noch so glatt wie vor einunddreißig Jahren, als sie ihm vor dem Traualtar das Ja-Wort gegeben hatte. Das war aber auch schon alles, was von dem Mädchen übriggeblieben war, das ihn sich als Neunzehnjährigen geangelt hatte. Das blonde Haar hatte seinen Glanz verloren, und die einstmals leicht mollige, aber durchaus attraktive Frau war auseinandergegangen wie ein Pfannkuchen. Ihr hochgeschlossenes Taftkleid unterstrich noch die unförmige Figur. So etwas wie ein Dekolletee gab es bei ihr nicht. Sie hielt es wohl für obszön, die Brüste auch nur ansatzweise zu entblößen. Freilich war jede Leidenschaft, die ihr Busen in Daniel hätte wecken können – oder sollen –, längst erloschen. Er richtete den Blick auf ihre Augen. Normalerweise waren sie blaßgrau, ja fast farblos, doch nicht in Momenten wie diesem, wenn sie vor Wut kochte.
»Und du erwartest von mir, daß ich so einfach zu ihm gehe und ihn so etwas frage?« stieß er hervor.
»Jeder normale Vater würde das tun. Andererseits warst du natürlich nie ein normaler Vater.«
»Das war ich gottlob wirklich nie. Ich war immer auf seiner Seite und habe alles getan, um ihm zu helfen, von dir loszukommen. Wenn es nach dir ginge, würde er ja noch heute in Windeln rumlaufen. Was war das damals für eine Blamage! Du hast ihm solange die Brust gegeben, bis die Leute mit dem Finger auf dich zeigten. Sonst hättest du nie damit aufgehört.«
Ihr Ellbogen schoß jäh nach hinten und traf ihn mit solcher Wut in den Nabel, daß er sich vor Schmerzen krümmte. Geistesgegenwärtig riß er die Arme hoch, denn sie hatte den schweren Glasdeckel ihrer Puderdose gepackt und zielte damit auf seinen Kopf. »Wirf nur«, knurrte er, »aber dann zerschlage ich dir das Gesicht, und zwar so gründlich, daß seine Hochzeit ohne dich stattfindet!«
Ganz langsam lockerte sich ihr Griff, und der Deckel fiel auf den Tisch. Ihren Mann ließ sie dabei nicht eine Sekunde lang aus den Augen. »Du kannst den Gedanken wohl nicht ertragen, ihn an eine andere Frau zu verlieren, selbst wenn es die Tochter deiner besten Freundin ist. Du wolltest sie doch mit Joe verkuppeln. Na schön, als Schulmädchen mag sie ja vielleicht mal mit ihm geflirtet haben, aber jetzt ist sie erwachsen und will Don. Und ich habe dafür gesorgt, daß sie sich kriegen. Allerdings muß ich zugeben: Nach Don hätte ich unbedingt Joe für sie ausgewählt.«
»O ja! Dann hättest du Joe für sie ausgewählt. Das entscheidest immer allein du. Erst hast du mir einen zurückgebliebenen Sohn angehängt, und dann hast du mir ein fremdes Kind aufgezwungen. Freiwillig hätte ich ihn nie adoptiert …«
»Gott im Himmel!« Er wandte sich kopfschüttelnd ab und ging zur Tür. Vor ihrem Himmelbett blieb Daniel stehen. Seit mehr als fünfzehn Jahren hatte er nicht mehr darin geschlafen. Resigniert lehnte er den Kopf an einen der vier kunstvoll gedrechselten Pfosten. Dann drehte er sich erneut zu ihr um und fixierte sie lange mit einem kalten Blick. Kein Laut war zu hören, bis er doch noch einmal nachsetzte: »Ich soll dir ein fremdes Kind aufgezwungen haben? Du hast wohl vergessen, daß es nicht mein Vater war, der in der Irrenanstalt gestorben ist.«
Ihre Gesichtsmuskeln zuckten. Schlagartig wurde ihm klar, daß er zu weit gegangen war. Diese Bemerkung war grausam. Doch wie verhielt es sich mit ihrer Grausamkeit ihm gegenüber? Wenn sie eine normale Ehefrau gewesen wäre und nicht eine von ihrer Religion besessene Fanatikerin und eine fast schon krankhafte Glucke, dann hätte er bestimmte Bedürfnisse nicht anderswo befriedigen müssen. Natürlich schämte er sich deswegen, aber wer hätte es ihm verdenken können? Wie erniedrigend allein schon die ständige Heimlichtuerei für ihn war! Freilich durften die Gemeindemitglieder, Priester und Nonnen nichts davon erfahren. Der Schein mußte immer gewahrt bleiben…
Daniel hielt es in ihrem Schlafzimmer nicht länger aus. Er mußte raus, etwas trinken. Aber nein, er wartete wohl besser auf die Gäste. Wenn er jetzt schon anfing, konnte er später die Zunge bestimmt nicht mehr im Zaum halten.
Daniel hatte die Tür erreicht und wollte gerade auf den Flur treten, als sie ihm eine letzte Verwünschung nachsandte. »Du bist der letzte Abschaum und gleichst deinem Vater und der ganzen übrigen Verwandtschaft!«
Ohne sich umzudrehen, zog er stumm die Tür hinter sich zu und blieb erst wieder unten auf dem Treppenabsatz stehen. Er schloß die Augen. War das nicht absurd? Ausgerechnet sie bezeichnete ihn als Abschaum. Dabei war sie doch im ärmsten Viertel der Stadt aufgewachsen. Nur zu gut erinnerte er sich noch an den Tag, an dem sie ins Büro der Firma seines Vaters gekommen war und sich um die Stelle einer Sekretärin beworben hatte. Sie war damals fünfzehn gewesen, und Jane Broderick hatte sie eingestellt. Dieselbe Jane Broderick, die drei Monate später erklärt hatte: »Es ist schrecklich mit ihr. Sie wird nie tippen lernen. Als Empfangsdame würde sie sich bestimmt ganz gut machen, aber wir brauchen keine.« Sein Vater hatte sie jedoch nicht rauswerfen wollen. »Geben wir dem Mädchen noch eine Chance. Sie haben gesagt, sie könne ganz schön schreiben. Soll sie sich doch um die Ablage und die Registratur kümmern.«
Später hatte sein Vater sich fast totgelacht, als er von ihren Rhetorikstunden bei einem pensionierten Lehrer erfuhr. Von da an hatte Daniel sie mit ganz anderen Augen gesehen. Er hatte wirklich geglaubt, sie sei etwas Besonderes. Nun, im Laufe der Zeit hatte er ihre Besonderheiten zur Genüge kennengelernt. Aber eins mußte er ihr lassen: Die Rhetorikstunden waren keine Zeitverschwendung gewesen, denn seitdem konnte sie sich in jeder Umgebung ins rechte Licht rücken. Gleichwohl wählte sie sich ihre Gesellschaft seit dem Tag ihrer Hochzeit stets selber aus. Mit so etwas wie Arbeitern gab sie sich nicht ab. Um so erstaunlicher war es, daß sie sich mit Janet Allison angefreundet hatte, obwohl die Allisons nicht in einem so prächtigen Herrenhaus lebten wie sie und nicht zu den alteingesessenen Familien zählten. Dafür waren sie vom Scheitel bis zur Sohle Katholiken. Protestanten hätte Winnie nie in ihrer Nähe geduldet, und wenn sie mit zehn Adelstiteln auf die Welt gekommen wären. Sie ließ keinerlei Zweifel an ihrer Treue zur katholischen Kirche.
Daniel stieg mit nachdenklicher Miene weiter die Treppe hinunter. Er hatte gerade den Korridor erreicht, da öffnete sich am anderen Ende eine Tür, und sein Adoptivsohn Joe kam ihm entgegen.
Joe war genauso groß wie er und glich ihm auch ansonsten in vielerlei Hinsicht. Wer es nicht gewußt hätte, wäre versucht gewesen, die beiden für Vater und Sohn zu halten. Nur war sein Haar schwarz und nicht braun wie das seines Adoptivvaters, und im Gegensatz zu Daniel hatte er keine blauen, sondern warm leuchtende braune Augen. Daniel war stolz darauf, daß Joe ihm so ähnelte. Auch behandelte er ihn genauso wie seine leiblichen Söhne, ja fast war er ihm noch lieber als Stephen und sogar Don.
Während er sich näherte, bemerkte er zwei Bücher in Joes Hand. »Nanu? Legst du heute eine Nachtschicht ein?«
»Eigentlich nicht. Ich wollte nur etwas nachschlagen.« Sie blickten einander in die Augen. Unvermittelt fragte Joe: »Ärger gehabt?«
»Was meinst du damit?«
»Na ja, ihr Schlafzimmer liegt direkt über der Bibliothek. Die Decke ist zwar recht hoch, aber schalldicht ist sie nicht gerade.«
Daniel ging weiter zur Bibliothek. »Hast du mal eine Minute Zeit?« fragte er seinen Adoptivsohn mit einem Blick über die Schulter.
»Klar, für dich nehme ich mir einfach Zeit.«
Joe zog die Tür hinter sich zu und folgte Daniel zum Fenster, das den Blick auf einen herrlichen Garten freigab. An der Wand gegenüber stand ein bequemes Ledersofa, aber der Mann der für Joe wie ein Vater war setzte sich nicht, sondern stellte sich ans Fenster. Seufzend drückte er die Stirn gegen den Holzrahmen.
»Was war denn los?« fragte Joe besorgt.
»Es ist nicht zu fassen«, stöhnte Daniel. »Du wirst nicht glauben, was sie jetzt von mir verlangt.«
»Sag’s mir einfach.«
Daniel ließ sich nun doch auf das Sofa sinken. Er verbarg den Kopf in den Handflächen. »Ich soll Don fragen, ob er noch jungfräulich ist«, murmelte er.
Da Joe nicht reagierte, sah er schließlich auf. »Was sagst du dazu?«
»Was kann man da noch sagen?« brummte Joe kopfschüttelnd. »Kann man in solchen Dingen überhaupt einen Rat geben? Aber wie, glaubst du, würde sie reagieren, wenn du ihr sagtest, er sei es nicht mehr?«
»Wie sie reagieren würde? Keine Ahnung; ich bin schon ganz durcheinander. Sie würde garantiert durchdrehen. Vielleicht würde sie sogar versuchen, die Hochzeit im letzten Moment zu verhindern, und in der Kirche schreien, er dürfe ein unbeflecktes Mädchen wie Annie – oder Annette, weil ihre Mutter ja keine Kosenamen duldet – nicht heiraten. Vielleicht würde deine Mutter ihn auch zu Father Cody schleifen. Um Father Ramshaw würde sie ja einen großen Bogen machen, weil sie genau weiß, daß er ihr nur ins Gesicht lachen würde. Aber mit Cody wäre das etwas anderes. Er liegt ganz auf ihrer Linie, würde Don in eine Reihe mit den Frevlem von Babel bis Sodom stellen und zum Schluß Johannes den Täufer anrufen, weil sonst keiner mehr ihren Sohn von seinen Sünden reinwaschen könnte.«
Joe verkniff sich mühsam das Lachen. »O Dad, du hättest wirklich das Zeug zum Komiker.«
»In den letzten Tagen war mir bestimmt nicht zum Lachen zumute, mein Junge. Außer dir gibt es nur noch einen Menschen, mit dem ich über das alles sprechen kann. Ich sag’s dir ganz ehrlich: Ich bin verzweifelt. Du weißt ja, ich habe sie schon zweimal verlassen, aber jedesmal hat sie mich wieder rumgekriegt, und ich bin zurückgekommen. Doch wenn ich jetzt gehe, helfen ihr all die Tränen und Selbstmorddrohungen und das Gerede von den hilflosen Kindern nichts mehr… Kinder! Du warst zwanzig Jahre alt, als sie zuletzt mit dieser Leier anfing, und das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Na ja, ein Kleinkind hat sie ja lange genug mit sich herumgeschleppt – selbst als es schon sechzehn war. Zumindest sah sie Don immer noch als ihr Baby an. Es ist ein Wunder, daß trotz allem so ein prächtiger Kerl aus ihm geworden ist, findest du nicht auch?«
»Ja, ja, da hast du schon recht, Dad, er ist schwer in Ordnung. Aber hast du auch an Stephen gedacht? Was soll aus ihm werden, wenn du wirklich ernst machst und nicht mehr zurückkommst? Er wird zeitlebens ein Kind bleiben. Bislang hast immer du dich um ihn gekümmert, aber wer würde es dann tun? Maggie kann man es nicht zumuten, ihn allein zu versorgen. Und was Mam mit ihm anstellen würde, weißt du nur zu gut. Sie hat ja oft genug damit gedroht.«
Daniel sprang plötzlich auf. »Hör auf, Joe, bitte hör auf! Solange ich lebe, kommt Stephen in kein Heim. Aber ich halte es in diesem Haus nicht mehr aus. Sieh dich doch nur um! Was soll denn nur dieser riesige Raum hier – er ist von oben bis unten vollgestellt mit Büchern, die außer dir kein Mensch auch nur ansieht. Der reine Prunk, und nichts dahinter! Achtundzwanzig Zimmer und dazu noch dein altes Häuschen. Ställe für acht Pferde, aber wir haben nicht einmal einen Hund, weil sie Hunde nicht ausstehen kann. Ein Wunder, daß ihr Katzen nicht zuviel sind. Sechs Morgen Land und das Haus für Lily und Bill. Und wozu das alles? Damit wir fünf Leute für uns arbeiten lassen können? Damit jeder von uns seinen Diener hat? Ich lebe seit fünfzehn Jahren in diesem Haus. Gekauft habe ich es vor siebzehn Jahren, weil es spottbillig war. Eine Bombe war in der Nähe explodiert, und eine Zeitlang hatten Soldaten darin gehaust. Die Eigentümer waren froh, als sie es los waren. Merkwürdig ist es trotzdem. Die konnten ihre Ahnen bis ins siebzehnte Jahrhundert zurückverfolgen, doch sie waren bereit, ihr Anwesen an einen Emporkömmling zu verramschen, der Dinge produziert, mit denen man Menschen umbringen kann.« Er hatte sich nun in Fahrt geredet. »Ganz richtig, so habe ich es immer gesehen. Als Dad und Jane Broderick kurz vor Kriegsende bei der Explosion in der Fabrik ums Leben kamen, hielt ich das für eine Art Vergeltungsschlag des Schicksals. Irgendwie habe ich das immer als eine verdiente Strafe angesehen. Genauso hatte ich bei diesem Haus kein gutes Gefühl, von Anfang an nicht. Aber damals sagte ich mir: Das mußt du kaufen! Darum kann ich auch deiner Mutter keinen Vorwurf machen. Sie war genauso scharf auf das Haus. Und als wir einzogen, steckte sie ein ganzes Vermögen in die Einrichtung. Eins muß man ihr ja lassen, Geschmack hat sie. Trotzdem habe ich das Gefühl, daß es ein verwunschenes Haus ist. Komisch, nicht wahr? Aber es hat was gegen mich.«
»Das bildest du dir jetzt nur ein!« protestierte Joe.
»Es mag mich wirklich nicht. Für solche Dinge habe ich einen siebten Sinn, ich spüre sie einfach. Ich bin hier eingedrungen, obwohl ich kein Recht dazu hatte. Wir alle sind im Grunde Störenfriede. Na ja, seit dem Krieg ist es vorbei mit den alten Traditionen. Keiner ist besser, nur weil er aus einer Adelsfamilie stammt. Andererseits gibt es nun einmal Orte wie eben diese alten Herrenhäuser, die einen ständig darin erinnern, daß man seinen Platz anderswo hat. Ich gehöre nicht hierher, Joe.«
Zum erstenmal huschte ein Lächeln über Daniels Gesicht. Er sah wieder zum Fenster hinaus. »Erinnerst du dich noch an unser erstes eigenes Häuschen am Fuß des Brampton Hill? Es war so richtig gemütlich. Der Garten war nicht weniger schön als der hier, und er hatte den Vorteil, daß man sich darin nicht verlief.«
Sein Adoptivsohn nickte. »O ja, ich erinnere mich noch genau.«
»Und trotzdem gefällt dir dieser Palast?«
»Doch, ja. Ich habe mich hier immer wohlgefühlt. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. In einem täuschst du dich aber: Denn Dad, im Grunde hast du doch Glück. Um das alles hier in Schuß zu halten, kommst du mit fünf Angestellten aus. Die Blackburns dagegen brauchten damals allein schon zwölf Leute für das Haus, und sie hatten auch nur drei Söhne und eine Tochter.«
»Ja, ja, richtig, drei Söhne. Sie sind alle im Krieg gefallen.«
»Ach, Dad, schau doch wieder ein bißchen fröhlicher drein.« Joe boxte ihm kameradschaftlich in die Rippen. »Soll ich dir was sagen? Du gehst jetzt zu Don rüber und fragst ihn ganz einfach, ob er noch ›unbefleckt‹ ist. Was meinst du, wie entgeistert er dich anglotzen wird?«
Weil Joe sich vor Lachen bog, fing nun auch Daniel an zu schmunzeln. »Die Frau hat nicht alle Tassen im Schrank, sag’ ich dir. Was die sich alles einbildet… Aber sag mal, glaubst du, daß er noch eine Jungfrau ist?«
»Keine Ahnung. Andererseits könnte ich es mir ganz gut vorstellen.«
»Dann weißt du mehr als ich. Wo steckt er überhaupt?«
»Zuletzt habe ich ihn im Billardzimmer gesehen. Er versucht mal wieder sein Glück und spielt gegen Stephen. Soweit ich das mitgekriegt habe, war er auf der Verliererstraße, wie immer. Aber er versteht sich prächtig mit dem Kerl.«
»Das stimmt. Das ist ja auch so ein wunder Punkt, über den sie einfach nicht hinwegkommt: daß ihr kleines Lamm immer Zeit für ihren zurückgebliebenen Erstgeborenen findet und nicht rund um die Uhr um sie herumtanzt. Kommt, gehen wir gemeinsam rüber.«
Stephen und Daniel spielten noch immer eifrig Billard, als die zwei eintraten.
»Dachte ich mir doch, daß ich euch hier antreffen würde!« rief Joe schon in der Tür. »Was seid ihr nur für Kindskopfe! Ihr verschmiert euch über und über mit Kreide und habt wohl ganz vergessen, daß wir in einer halben Stunde Besuch erwarten.«
»Joe! Joe! Ich hab’ ihn geschlagen! Ganz ehrlich!«
Joe ging auf einen etwa dreißigjährigen Mann zu, der fast so groß und gut gewachsen war, wie er; doch das Gesicht unter dem buschigen schwarzen Haar hätte einem kleinen Jungen gehören können, einem hübschen kleinen Jungen. Daß etwas mit ihm nicht in Ordnung war, verrieten seine Augen. Sie waren blau wie die seines Vaters, doch war sein Blick verschwommen und unstet. Kurzfristig konnte er etwas Fixieren, und in solchen Momenten suchte sein Verstand wohl nach etwas, bekam es aber nur für einen Augenblick zu fassen, ehe es sich wieder verflüchtigte.
»Ich… ich hab’ sieben Punkte nacheinander gemacht und er keinen einzigen! Stimmt doch, oder, Don?«
»Ja, ja, das stimmt schon. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance.«
»Keinen einzigen Punkt, Don?« rief Daniel. »Dann bist du ja schlechter geworden!«
»Na ja, er ist halt zu gut für mich. Das ist einfach nicht fair.«
»Ich… ich laß dich das nächste Mal gewinnen, Don. O ja! Du darfst das nächste Mal gewinnen, das versprech’ ich dir.«
»Ich werde dich daran erinnern.«
»O ja! Tu das, Don!«
Stephen fuhr sich unvermittelt mit der Hand zum Hals und zerrte dort an seiner Fliege herum. »Die tut mir weh, Dad.«
»Unsinn.« Daniel ging zu ihm hinüber und rückte sie wieder zurecht.
»Dad?«
»Ja, Stephen.«
»Darf ich zu Maggie in die Küche?«
»Du weißt doch, daß Maggie das Essen kochen muß.«
»Na gut, dann geh’ ich eben zu Uly.«
»Aber doch nicht jetzt, Stephen. Muß ich dir das jedesmal aufs neue sagen? Ist doch gar nicht so schwer: Du begrüßt Mr. und Mrs. Preston sowie Mrs. Bowbent und natürlich auch Tante und Onkel Allison und Annie… Annette. Wenn das vorbei ist und du dich ein bißchen mit Annette unterhalten hast, darfst du in dein Zimmer. Uly bringt dir dann bald dein Essen.«
Daniel wandte sich ab und ging zum Kamin, um das Feuer nachzuschüren. Von hinten trat Don an ihn heran.
»Dad? Laß ihn gleich nach oben gehen. Ihm ist vorhin wieder ein Mißgeschick passiert.«
»Schlimm?«
»Nur ein bißchen naß. Aber er ist völlig durcheinander. Du weißt doch selbst, daß er mit so vielen Menschen überfordert ist. Ich verstehe nicht, warum du ihm das nicht ersparst.«
»Den Grund kennst du sehr wohl, Don«, erwiderte Daniel und schob ein Scheit in die Flammen. »Ich werde meinen Sohn nicht wie einen Idioten verstecken – ganz einfach, weil er kein Idiot ist, Punkt.«
»Aber für ihn ist es doch eine Qual. Erspar es ihm wenigstens dieses Mal. Mam würde sich nur wieder aufregen, wenn er ausgerechnet heute mit nassen Hosen daherkäme. Es ist ja schon einmal geschehen.«
»Das ist aber schon lange her. Seitdem hat er viel dazugelernt.«
»Dad, bitte.«
Vater und Sohn sahen einander vorwurfsvoll an. Eine Weile fiel kein Wort mehr. Nur im Hintergrund war Joes Stimme zu hören. Er lenkte Stephen mit einer Erzählung ab, so daß sie auf den Behinderten keine Rücksicht zu nehmen brauchten.
»Betrachte es als eine Art Hochzeitsgeschenk für mich«, brummte Don schließlich.
»Ach, reicht dir nicht, was du bekommen hast?«
»Ob es mir nicht ›reicht‹? Du weißt doch, wie ich mich freue. Ich kann’s nur noch nicht fassen. Ein ganzes Haus für uns zwei allein, und noch dazu…« Er hielt inne, um mit gesenkter Stimme fortzufahren: »… eins, das so weit weg ist.«
»Richtig, mein Junge, ihr werdet dort eure Ruhe haben. Aber eines darfst du bitte nie vergessen. Ich mahne nicht gern, aber es muß doch gesagt werden. Brech’ nicht alle Brücken hinter dir ab. Lade sie öfter zu euch ein und komm sie besuchen, so oft du kannst.«
»Versprochen, Dad. Aber da wäre noch etwas, das ich dir ganz allein sagen möchte. Danke für alles, Dad. Danke, daß du mich da durchgebracht hast.«
Er mußte ihm nicht erklären, was er damit meinte. Daniel verstand die Andeutung auf Anhieb. Er wandte sich um und ging mit schnellen Schritten zu Stephen hinüber. »Also gut. Du hast wieder mal gewonnen. Du bist nicht nur der beste Billardspieler weit und breit, du schaffst es immer wieder auch, mich um den kleinen Finger zu wickeln. Wenn du willst, kannst du in dein Zimmer gehen. Ich sage nur noch Lily Bescheid, dann kommt sie zu dir nach oben.«
»Das kann warten, Dad.« Joe legte einen Arm um Stephens Schulter. »Erst müssen wir zwei was klarstellen. Der Kerl will doch glatt Sunderland gegen Newcastle unterstützen. Habt ihr so was schon mal gehört? Beim Fußball hört der Spaß auf! Los, Stephen, sei ein Mann und stell dich!«
Die beiden Männer verließen den Raum. Im Gehen legte Stephen einen Arm um Joes Hüfte und versuchte, seinem Adoptivbruder ein Bein zu stellen. Aus seiner Kehle kam ein glückliches Gurgeln.
Obwohl Daniel und Don nun endlich allein waren und ungestört sprechen konnten, schienen sich Vater und Sohn auf einmal nichts mehr zu sagen zu haben. »Hast du Lust auf eine Partie Billard, Dad?« schlug Don vor. »Wir haben ja noch eine Viertelstunde Zeit.«
»Nein, danke, Don. Ich schaue lieber kurz in der Küche vorbei. Maggie soll ein paar Bissen für Stephen abzweigen und nach oben schicken.« Daniel wandte sich hastig ab und ließ seinen Sohn allein.
Eine mit grünem Filz bespannte Tür führte in den weitläufigen Küchentrakt. Dort hatte Daniel die modernsten Geräte einbauen lassen, ansonsten aber alles beim Alten gelassen. So stand ein moderner Herd einem offenen Kamin und einem alten Steinbackofen gegenüber, in dem nach wie vor ein hervorragendes Brot gebacken wurde. Für eine behagliche Atmosphäre sorgten ein langer Holztisch in der Mitte des Raumes, ein mit Steingut beladenes Regal sowie das Fenster mit Blick auf die Stallungen. Zudem gab es eine geräumige, mit Marmor gekachelte Speisekammer und einen Raum, in dem das Brennholz gelagert wurde. Von dort gelangte man in einen vor nicht allzu langer Zeit fertiggestellten Anbau mit großen Glasfenstern.
In der Küche wurde heute Schwerstarbeit geleistet. Maggie Doherty, die siebenunddreißigjährige Köchin, belegte einen selbstgebackenen Tortenboden mit halbierten Kirschen und Erdbeeren. Die Sahne hatte sie schon vorher mit einer Spritzdüse kunstvoll verteilt. Bei Daniels Eintreten sah sie kurz auf. »Sie werden bald kommen.«
»Ja, ja richtig. Die kommen immer so pünktlich, daß man die Uhr danach stellen kann… Das sieht aber hübsch aus! Wenn es auch noch genauso gut schmeckt, kann nichts mehr schiefgehen.«
»Da bin ich ganz sicher. Ich habe eine halbe Flasche Sherry hineingegeben. Der Boden dürfte schön damit getränkt sein.«
»Wirklich? Nun, das braucht Madge Preston ja nicht zu wissen, oder? Du kennst sie ja!«
»Sag ihr einfach, das sei eine Gewürzmischung. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel besser so ein Kuchen schmeckt, wenn guter Sherry drin ist.«
. »Doch, kann ich schon. Hmm, wie das riecht! Gibt es Ente?«
»Ja, mit der üblichen Füllung und ein paar kleinen Geheimnissen von mir.«
»Ich freue mich schon drauf. Und als Vorspeise?«
»Soupe Vichissoise.«
»Lecker!«
»Oder wahlweise Krabbencocktail.«
»Darauf wird sich Betty Broadbent stürzen, jede Wette.«
Unter seinen bewundernden Blicken arrangierte Maggie die letzten Kirschen. Als sie fertig war, erklärte er: »Ich habe Stephen auf sein Zimmer geschickt. Ihm ist heute wieder etwas danebengegangen, wie ich mir sagen lassen mußte. Könntest du ihm später ein bißchen von allem raufschicken?«
Maggie sah ihn mißbilligend an. »Warum du nur immer darauf bestehst, daß der Schein gewahrt bleibt, das weiß Gott allein. Fremde sind für ihn eine Belastung. Warum kannst du ihn dann nicht einfach in Frieden lassen?«
»Wie oft muß ich das denn noch sagen, Maggie? Es ist nur zu seinem Guten.«
Maggie stellte den Kuchen wortlos beiseite. Während sie sich die Hände wusch, taten ihm seine barschen Worte schon wieder leid. »Mein Gott, daß ich mich auch immer gleich so aufrege! Es ist auch so schon schwer genug für euch. Aber sei mir bitte nicht böse, Maggie. Vorhin hat sie mir wieder eine gräßliche Szene gemacht.«
Erneut sah sie zu ihm auf, doch diesmal war ihr Blick freundlich, verständnisvoll. »Ich weiß, daß du deinen Kindern ein guter Vater bist.« Sie wollte noch mehr sagen, doch in diesem Augenblick trat eine junge Frau in die Küche. Sofort änderte Maggie die Tonlage. »Peggie! Mach Master Stephen ein Tablett zurecht und bring es ihm rauf. Du weißt ja, was er am liebsten ißt. Und noch was… Habt ihr den Tisch richtig gedeckt?«
»Jawohl, Miß Doherty«, lispelte das Mädchen. »Lily ist gerade fertig geworden. Sieht aus wie ein richtiges Kunstwerk.«
»Na, wir werden ja gleich feststellen, ob ich derselben Meinung bin«, erwiderte Maggie, doch lächelte sie das Mädchen dabei an. Dann legte sie ihre weiße Schürze ab, strich sich das Haar glatt und verließ die Küche.
Daniel folgte ihr. Im Flur blieben sie stehen. Er drehte sie zu sich herum und beugte sich über sie. Ihr Gesicht war ansehnlich, wenn auch nicht aufregend schön. Die regelmäßigen Züge verrieten ein aufrichtiges, gütiges Wesen.
»Es tut mir leid, Maggie«, murmelte er. »Wie konnte ich mich nur so gehenlassen?«
»Sei doch nicht dumm. Nun warte ich schon so lange auf diesen Moment. Endlich ist es soweit, und ich komme mir überhaupt nicht unverschämt dabei vor, wenn ich so mit dir spreche.«
»Och, Maggie, du bist jetzt zwanzig Jahre bei uns. Ich war wie ein Vater zu dir …«
»Wie? Ich habe dich nie als Vater gesehen, Dan. Komisch« – sie lachte leise –, »daß ich dich ›Dan‹ nenne.«
»Du verläßt uns also nicht?«
»Nein.« Sie sah sich nervös um. Da niemand kam, fuhr sie fort: »Ich habe darüber nachgedacht, aber dann wurde mir klar, daß ich es nicht kann. Natürlich muß ich mich am Riemen reißen und darf mir nichts anmerken lassen, auch wenn es mir noch so schwerfällt. Oft genug wollte ich mich ja auf der Stelle umdrehen und für immer gehen, wenn sie mich so von oben herab abkanzelte. Am Anfang wußte ich gar nicht, warum ich es aushielt. Aber dann begriff ich es: Hier ist mein Platz. Aber daß ich zwanzig Jahre lang bleiben würde, hätte ich mir nie vorstellen können. Weißt du, zuerst dachte ich ja, Stephen sei der Grund – er, war doch so hilflos und auf Liebe angewiesen. Na ja, das ist er immer noch, er braucht viel Zuwendung …«
»Das sehe ich nicht ganz so, Maggie.«
Sie wandte sich abrupt ab, doch er packte sie am Arm und wollte noch etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor. »Morgen ist mein freier Tag. Wie Sie wissen, gehe ich da immer zu meiner Kusine Helen. Die Adresse kennen Sie ja: Bowick Road 42.« Sie zwinkerte ihm kurz zu, dann ließ sie ihn stehen.
Kapitel 2
Das Essen war ein voller Erfolg. Die Gäste bedankten sich überschwenglich bei Winifred und beglückwünschten sie zu ihrer Köchin.
Anschließend zogen die Frauen sich wie nach jedem Dinner in den Salon zurück, während die Männer im Eßzimmer bei einem Glas Portwein ihre Zigarren rauchten. Winifred hatte diese Sitte, die ja sonst nur in Adelskreisen üblich war, bei ihrem Einzug eingeführt. Am Anfang hatte Daniel darüber gespottet, es dann später aber unterlassen.
Annette Allison saß auf einem unbequemen Stuhl neben dem Flügel und beobachtete ihre Mutter, ihre zukünftige Schwiegermutter, Madge Preston, und Betty Bowbent. Unwillkürlich schickte sie ein stummes Stoßgebet zum Himmel: Bitte lieber Gott, laß nicht zu, daß ich so werde wie sie. Gewissensbisse verspürte sie wegen dieser Gedanken nicht, auch wenn es in der Bibel hieß, man solle Vater und Mutter ehren. Merkwürdig, sinnierte sie, seit dem fünften Lebensjahr hatte sie bei Klosterschwestern im Internat gelebt und war also mit derlei Predigten aufgewachsen. Dennoch hatte sie stets ihre eigenen Vorstellungen entwickelt.
Ihre Gedanken wanderten weiter zu Don. Ihr war klar, daß ihr heute keine fünf Minuten Alleinsein mit ihm vergönnt sein würden, denn nicht nur ihre Mutter, sondern auch Mrs. Coulson wachten mit Argusaugen über sie. Es war wie im Gefängnis. Beim Gedanken an Dons Mutter beschlich sie Angst vor der Zukunft. Als seine Ehefrau würde es ihr wohl schwerer fallen, ihre wahren Gefühle zu verbergen und bei den unvermeidbaren Meinungsverschiedenheiten zu schweigen.
Mittlerweile war Mrs. Bowbent auf Maria zu sprechen gekommen. Worauf ihre Mutter schnell das Thema wechselte und laut darüber nachdachte, ob man nicht auch gleich das Wetter für den nächsten Sonntag bestellen könnte. Das war die Gelegenheit, den Damen wenigstens für eine Weile zu entkommen. Annette stand hastig auf. »Ist es dir recht, wenn ich mal nach oben gehe und ein bißchen mit Stephen plaudere?« fragte sie ihre zukünftige Schwiegermutter.
Nach kurzem Zögern antwortete Winifred lächelnd: »Aber natürlich, Annette. Er wird sich bestimmt über deinen Besuch freuen.«
Die vier Frauen blickten Annette nach. Kaum hatte sich die Tür hinter ihr geschlossen, nahm Madge Preston einen neuerlichen Anlauf. »Warum sollen wir das Thema totschweigen, Janet? Sie weiß doch Bescheid. Im Grunde weiß jeder, was los ist.«
Janet Allison war entrüstet. »Das stimmt doch überhaupt nicht! Und was gehen diese Leute uns noch an. Sie sind ja weggezogen.«
»Richtig, aber erst als Marias dicker Bauch auch dem letzten ins Gesicht gesprungen war.«
»Pfui, Madge! Wie ordinär du bist!«
»Sei doch nicht so prüde, Janet. Was würdest du denn sagen, wenn Annette das gleiche passierte?«
Janet Allison sprang empört auf. »Diesmal bist du zu weit gegangen, Madge!«
»Bitte setz dich wieder, Janet, es tut mir leid.«
Winifred, die ihnen schweigend zugehört hatte, legte begütigend eine Hand auf Janets Arm. »Setz dich doch wieder, Janet, bitte. Wir wollen über etwas anderes sprechen. Es gibt weiß Gott erbaulichere Themen.« Sie bedachte Madge mit einem tadelnden Blick. In diesem Moment ging die Tür auf. »Ah, da kommen die Männer.« Sie ließ sich erleichtert zurücksinken. Mit mehr oder weniger sanfter Gewalt brachte sie Janet dazu, es ihr gleichzutun.
Im Gänsemarsch kamen die Ehemänner herein: Daniel, der rundliche John Preston, der hagere, immer ein bißchen blutarm wirkende Harry Bowbent und James Allison, der einen gewaltigen Schmerbauch vor sich herschob. Joe folgte ihnen mit etwas Verspätung.
Winifred winkte ihn zu sich. »Wo ist Don?« Im allgemeinen Stimmengewirr hörte niemand außer Joe die Frage.
»Don? Ach, er ist nur kurz zu Stephen gegangen, ihm eine gute Nacht wünschen.«
Sie mußte sich förmlich zwingen, nicht auf der Stelle nach dem Rechten zu sehen. Und als sie Janet Allisons zusammengekniffenen Augen bemerkte, wußte sie, daß ihre zukünftige Schwägerin dasselbe dachte wie sie.
Im zweiten Stock standen Don und Annette eng umschlungen in Stephens Spielzimmer und küßten sich. Als ihre Lippen sich trennten, raunte Don ihr ins Ohr: »Ohne dich kann ich keine Minute länger leben.«
»Mir geht es nicht anders«, erwiderte sie schlicht. »Vor allem jetzt nicht mehr, seit ich Gewißheit habe.«
»Ja, vor allem jetzt.« Er nahm ihren Kopf zärtlich zwischen beide Hände. »Kannst du dir vorstellen, daß es auf der ganzen Welt noch so ein Paar gibt mit Müttern, wie es unsere sind?«
»Nein. Aber manchmal plagen mich schreckliche Schuldgefühle. Du hast ja noch Glück, hinter dir steht wenigstens dein Vater. Ich dagegen muß gegen alle beide ankämpfen. Soll ich dir sagen, warum sie mich heute ausnahmsweise gehen ließ? Weil die Damen wieder mal über Maria Tollett diskutierten. Und das Thema ist natürlich viel zu schmutzig für ein unschuldiges Mädchen wie mich. Die arme Maria! Mein Gott, wie war sie früher doch schüchtern! Einigen Mädchen hätte ich so etwas zugetraut, aber nie und nimmer Maria. Aber dann ist es ihr passiert, und ihre Familie mußte sie in eine andere Stadt schicken – wegen der Schande. Ich glaubte immer, jetzt, wo wir die fünfziger Jahre endlich hinter uns haben, wäre so etwas nicht mehr möglich. Aber wenn das so weitergeht, und Leute wie deine oder meine werte Frau Mama nicht dazulernen, werden diese alten Zöpfe auch zur Jahrtausendwende nicht abgeschnitten sein.«
Sie drückte sich mit aller Kraft an ihn: »O Gott, wenn doch schon Samstag wäre!«
»Es wird ja alles gut, Liebes. Denk nur an die drei Wochen in Italien! Nur du und ich! Na gut, wir müssen natürlich zum Papst gehen, aber das ist ja nur ein Tag.«
Er spürte, wie ihr Körper zu zittern anfing, hörte sie an seiner Schulter kichern. Auch er konnte ein Lachen nur mit Mühe unterdrücken. »Pssst! Pssst. Wenn unsere Mütter das hören, kommen sie die Treppe raufgesprintet.«
Sie sah zu ihm auf. Tränen standen in ihren Augen. Sie biß sich auf die Lippen, um nicht loszuplatzen. Schließlich brachte sie hervor: »Ich habe ihnen hoch und heilig versprechen müssen, daß wir jeden Morgen zur Messe in den Vatikan gehen… du und ich gemeinsam.«
»Nein!«
»Doch!«
»Hast du ihnen nicht gesagt, daß der Papst uns gern haben kann und wir lieber bis Mittag im Bett bleiben und uns aneinander kuscheln?«
»O Don!« kicherte sie.
»Hör doch!« Er löste sich sanft von ihr. »Da kommt jemand. Ich verschwinde lieber in Stephens Zimmer und sehe nach, ob er schon schläft, und du gehst schon mal die Treppe runter.« Doch unvermittelt überlegte er es sich anders und legte einen Arm um ihre Hüfte. »O nein! Nein! Wir spielen keine Komödie mehr. Irgendwann muß Schluß sein. Wenn ich einen Funken Verstand gehabt hätte, hätte ich ihnen viel früher gesagt, was los ist.«
Sie setzten sich mit trotziger Miene in Bewegung, als Joe ihnen entgegenkam. »Gleich schicken sie einen Suchtrupp. Beeilt euch mal lieber. Unten herrscht Aufbruchsstimmung. Sie begutachten noch die Geschenke, aber die Stimmung ist auf den Nullpunkt gesunken. Sag mal, Annette, hat es einen Streit gegeben?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es ging nur um Maria Tollett. Und da habe ich die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und bin gegangen. Ich nehme an, daß sie während meiner Abwesenheit kein Blatt mehr vor den Mund genommen und kein gutes Haar an ihr gelassen haben. Das dürfte allerdings Mrs. Preston gegen den Strich gegangen sein, weil sie doch mit den Tolletts eng befreundet ist.«
»Ach so… Hört trotzdem lieber auf meinen Rat und schaut ein bißchen ernster drein. Unten herrscht dicke Luft. Wenn ihr so Arm in Arm daherkommt, ist der Ofen endgültig aus.«
Lachend ließen sie sich von ihm die Treppe hinunter scheuchen. »Bald ist Samstag«, raunte Don Annette ins Ohr, und sie flüsterte: »Amen! Amen!« Keiner ahnte, daß Joe, ihr Freund und Verbündeter, den Samstag mindestens ebenso inbrünstig herbeisehnte wie sie.
Es war kurz vor elf. Im ganzen Haus herrschte Stille. Winifred hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen, und auch Joe und Stephen lagen bereits im Bett. Nachdem Lily und Peggie ihm eine gute Nacht gewünscht hatten, rumorte nur noch Maggie in der Küche herum. Daniel wußte, daß er bei ihr jederzeit willkommen war. Und diese Stunden des Alleinseins mit ihr taten ihm so unendlich wohl. Doch heute verzichtete er darauf, denn er war zu aufgewühlt. Er wußte genau, wohin es geführt hätte, wenn er sich jetzt hätte gehen lassen – das Klima im Haus wäre vollends unerträglich geworden, weil er seine Gefühle einfach nicht verbergen konnte.
Müde war Daniel noch nicht. Er war ein Nachtmensch, der erst so richtig aufdrehte, wenn die anderen ins Bett gingen. Schwierigkeiten hatte er dagegen regelmäßig am Morgen. Da kam er nur schwer aus den Federn.
Er zog sich einen Mantel an und ging leise aus dem Haus. Es war kühl geworden. Der Herbst und mit ihm die langen, kalten Nächte standen bevor. Daniel hing seinen Gedanken nach. War sein bisheriges Leben nicht auch eine lange, kalte Nacht gewesen? Doch jetzt sah er in der Ferne ein Licht flackern. Wie er sich danach sehnte, sich an diesem Feuer zu wärmen! Gleichzeitig schämte er sich deswegen.
Langsam ging er die Auffahrt hinunter. Unten beim Tor brannten noch die Lampen. Das bedeutete, daß Lily und Bill, ihr Mann, noch auf waren.
Als er an ihrem Häuschen vorbeikam, stürzte plötzlich Bill zur Tür heraus. »Ach, Sie sind’s, Sir. Sie haben mir ja einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte schon, es wäre ein Einbrecher.«
»Ich wollte nur ein bißchen frische Luft schnappen, Bill.«
»Ihre Gäste sind früh gegangen, nicht wahr?«
»Stimmt, sie hatten heute wohl nicht soviel Sitzfleisch. Es ist kühl geworden, finden Sie nicht auch? Wir müssen uns auf einen frühen Winter einstellen.«
»Sieht ganz danach aus, Sir. Ich selbst mag den Winter ja ganz gern. Für mich gibt es nichts Schöneres, als die Füße auf den Ofen zu legen, eine Pfeife anzuzünden und ein gutes Buch zu lesen. Im Sommer finde ich irgendwie nie die nötige Ruhe.«
»Stimmt, da haben Sie recht. Jede Jahreszeit hat wohl ihre Vorzüge.«
Schweigend gingen sie gemeinsam zum Eisentor, um es für die Nacht zu verriegeln. Es wirkte recht imposant mit seinen zwei Flügeln und den massiven elektrischen Laternen oben auf den Steinsäulen zu beiden Seiten. Kurz davor blieb Bill stehen. »Ich muß Ihnen etwas sagen, Sir…« Er druckste herum. »Heute mußte ich wieder in die Dale Street fahren.«
Daniel musterte sein Gegenüber mit regungsloser Miene. »Fahren Sie oft dorthin?« fragte er schließlich ganz leise.
»Dreimal bisher. Aber erst heute habe ich kapiert, warum sie mich dorthinschickt. Ich sollte rausfinden, ob Sie dort sind.«
»Wann sind Sie denn die anderen zwei Male hingefahren.«
»Letzte Woche.«
»War das alles? Oder mußten Sie noch… woandershin fahren?«
»Das war alles, aber sie hat mich dann ausgefragt.«
Daniel starrte auf die Felder hinaus, auf die der Lichtschein der Laternen fiel. Würde sie denn nie Ruhe geben? Wie unwohl sich doch dieser Mann in seiner Haut fühlen mußte. Da saß er zwischen zwei Stühlen, hatte einerseits die Launen seiner Herrin über sich ergehen zu lassen, und hielt doch stets seinem Brötchengeber treu die Stange.
»Danke, Bill«, murmelte Daniel mit belegter Stimme.
»Keine Ursache, Sir.«
Daniel wollte gerade umkehren und zum Haus zurückgehen, da hörte er einen Wagen heranrattern. Die Klapperkiste hätte er unter Hunderten erkannt, und als sie vor dem Tor anhielt, trat er sogleich darauf zu. »So spät am Abend noch unterwegs, Herr Pfarrer?«
»Ach, die üblichen Geschäfte«, brummelte Father Ramshaw. »Hatten Sie Gäste?« Er deutete auf die Laternen.
»Sind schon alle weg. Wollen Sie auf einen Drink reinkommen?«
»Jetzt, wo Sie’s sagen, bekomme ich richtig Durst. Dabei habe ich mich vor ein paar Minuten nur noch auf mein Bett gefreut.«
»Bill!« rief Daniel seinem Angestellten zu. »Sie brauchen unsertwegen nicht aufzubleiben. Ich lösche die Lichter später selbst. Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Sir!« rief Bill seinem Arbeitgeber nach, der nun zu Father Ramshaw in den Wagen stieg.
»Wen haben Sie denn heute besucht, Father? Ein dringender Fall?«
»Tommy Killbride.«
»Nicht schon wieder! Der Kerl ist doch ein Hypochonder!«
»Das war er mal, aber diesmal bildet er sich nichts ein. Auch wenn er es noch nicht ahnt, in spätestens zwei Tagen ist es vorbei mit ihm. Und ob Sie’s mir glauben oder nicht – keiner wird so überrascht sein wie er selbst. Ich sehe ihn schon an der Himmelspforte reklamieren: ›Da muß ein Irrtum vorliegen! Ich habe nichts als eine übersteigerte Phantasie. Vierzig Jahre lang haben sie mir das immer vorgehalten. So viele Menschen können sich doch nicht getäuscht haben. Laßt mich wieder zurückgehen! ‹ Wissen Sie, Daniel, das Leben spielt einem schon die eigenartigsten Streiche. Er hat sich so ziemlich jede Krankheit dieser Welt eingebildet, nur diese eine nicht, die so unvermutet dahergeschlichen kam. Er tut mir aufrichtig leid. Aber daß der Tod ihn so überrumpeln wird, das hat er sich selbst zuzuschreiben!«
»Ach, Father!« lachte Daniel. »Wetten, daß Sie am liebsten dabei sein würden, wenn er da oben ankommt, nur um sein Gesicht zu sehen…? Was anderes: Geht noch immer dieses unsägliche Klappergestell von Rosie bei Ihnen ein und aus? Wenn Sie die nicht bald rauswerfen, sind Sie der nächste, der vor dem Jüngsten Gericht landet.«
»Ich habe nicht vor, Rosie rauszuwerfen. Sie ist eine Freundin, und ich will nicht, daß Sie über sie herziehen. Oder sollen wir Menschen links liegenlassen, nur weil ihre Knochen nicht mehr mitmachen und sie verbittert sind? Unterhalten wir uns lieber über die schönen Dinge. Sie hatten doch eine Party heute Abend. Wie ist sie gelaufen?«
»Wie immer.«
»Na, Sie werden froh sein, wenn es am Samstag endlich ausgestanden ist.«
»Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, Father. Nichts wünsche ich mir sehnlicher.«
Wenige Minuten später saßen sie in der Bibliothek. Im Kamin prasselte ein Feuer, und auf dem Tisch zwischen ihnen standen eine Karaffe mit Whisky, eine Flasche Brandy, ein Krug Wasser und zwei Gläser.
Daniel deutete auf die Flasche. »Ich könnte mir vorstellen, daß Sie vielleicht mal was Neues ausprobieren wollen. Ich weiß schon, Sie stehen nicht auf Brandy, aber der hier ist etwas Besonderes; ein Geschenk von einem guten Kunden. Er ist über vierzig Jahre alt und zergeht einem richtig auf der Zunge. Der Geschmack ist unvergleichlich.«
Er schenkte ein und reichte dem Pfarrer ein Glas. Der nippte daran und zog beim Herunterschlucken die Augenbrauen anerkennend hoch.