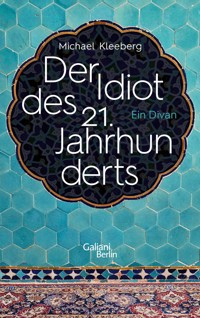
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein überwältigender Roman, eine Anleitung für eine humane Gesellschaft." Björn Hayer, Spiegel Online Orient und Okzident, Einwanderer, Auswanderer, Aussteiger, Islam, Christentum, Kapitalismus und die Suche nach dem Glück: Michael Kleeberg erzählt Geschichten und Schicksale in einer globalisierten Welt. In diesem großen Wurf gelingt es ihm, die wichtigen Fragen unserer Zeit in packende Literatur zu verwandeln. Mühlheim bei Frankfurt. Ein Kreis von Freunden trifft sich und versucht, über Freundschaft und Gesellschaft nicht nur nachzudenken, sondern auch Utopien eines anderen Zusammenlebens zu verwirklichen. Dabei: Hermann, einst Doktorand der Philosophie, dann Aussteiger, jetzt Lehrer in Frankfurt. Maryam, eine iranische Sängerin, die auswandern musste, weil ihr das Singen verboten wurde. Dabei auch: Younes, ein libanesischer Pastor, Zygmunt, ein polnischer Handwerker, Bernhard, ein Ex-Sponti, der lange einen Verein für Jugendsozialarbeit leitete, Ulla, seine Frau, Kadmos, ein arabischer Lyriker. In einem kaleidoskopischen Roman in zwölf Büchern (angelehnt an Goethes West-Östlichen Divan und Nezamis Leila und Madschnun) erzählt Michael Kleeberg ihre Geschichten und Geschichten um sie herum und begibt sich zu den Wurzeln ihrer Kulturen. Sein Buch spielt in Deutschland, Iran, im Libanon und im Reich der Mythen; Kleeberg verarbeitet Motive östlicher und westlicher Kultur – von der persischen Erzählung bis zu den Blogs deutscher Islamistinnen im "Islamischen Staat"; er mischt verschiedene Erzählperspektiven und Genres, Erzählung, Dialog, Essay und Parabel zu einem großen multiperspektivischen Ganzen, das den Suchbewegungen und Unsicherheiten der Gegenwart gerecht wird. Kein Buch der Gewissheiten, ein Buch der Suche. Ein literarisches Wagnis. Ein großes Buch. "Ein ost-westlicher Divan des 21. Jahrhunderts – auf den Spuren Goethes versammelt Michael Kleeberg zwölf Geschichten mit allen Problemen und Konflikten unserer Zeit: Terrorismus, Fundamentalismus, Kampf der Kulturen. Vom Libanon und Iran bis in die hessische Provinz - am Ende steht die Vision einer humanistischen Utopie, wo Menschen trotz aller Unterschiede einander Freund sein können. Ein großer, anspruchsvoller, weltliterarischer Wurf – und er gelingt!" Joachim Scholl, Deutschlandradio Kultur "Michael Kleeberg ist ein unendlich begabter, unverschämt maliziöser Schriftsteller, der souverän über alle Register der großen Romanorgel verfügt." Ijoma Mangold, Die Zeit "Michael Kleeberg hat diese Bereitschaft, seine Identität zu vergessen (nicht seine Existenz oder seine Kultur). Er ist bereit, sich dem anderen anzunähern ohne fertige Kategorien." Abbas Beydoun
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Idiot des 21. Jahrhunderts
Ein Divan
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Michael Kleeberg
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Michael Kleeberg
Michael Kleeberg, geboren 1959 in Stuttgart, lebt als Schriftsteller und Übersetzer (u.a. Marcel Proust, John Dos Passos, Graham Greene, Paul Bowles) in Berlin. Sein Werk (u.a. Ein Garten im Norden, Vaterjahre) wurde in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt. Zuletzt erhielt er den Friedrich-Hölderlin-Preis (2015), den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (2016) und hatte die Frankfurter Poetikdozentur 2017 inne.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Orient und Okzident, Einwanderer, Auswanderer, Aussteiger, Islam, Christentum, Kapitalismus und die Suche nach dem Glück: Michael Kleeberg erzählt Geschichten und Schicksale in einer globalisierten Welt. In diesem großen Wurf gelingt es ihm, die wichtigen Fragen unserer Zeit in packende Literatur zu verwandeln.
Mühlheim bei Frankfurt. Ein Kreis von Freunden trifft sich und versucht, über Freundschaft und Gesellschaft nicht nur nachzudenken, sondern auch Utopien eines anderen Zusammenlebens zu verwirklichen. Dabei: Hermann, einst Doktorand der Philosophie, dann Aussteiger, jetzt Lehrer in Frankfurt. Maryam, eine iranische Sängerin, die auswandern musste, weil ihr das Singen verboten wurde. Dabei auch: Younes, ein libanesischer Pastor, Zygmunt, ein polnischer Handwerker, Bernhard, ein Ex-Sponti, der lange einen Verein für Jugendsozialarbeit leitete, Ulla, seine Frau, Kadmos, ein arabischer Lyriker.
In einem kaleidoskopischen Roman in zwölf Büchern (angelehnt an Goethes West-Östlichen Divan und Nezamis Leila und Madschnun) erzählt Michael Kleeberg ihre Geschichten und Geschichten um sie herum und begibt sich zu den Wurzeln ihrer Kulturen. Sein Buch spielt in Deutschland, Iran, im Libanon und im Reich der Mythen; Kleeberg verarbeitet Motive östlicher und westlicher Kultur – von der persischen Erzählung bis zu den Blogs deutscher Islamistinnen im »Islamischen Staat«; er mischt verschiedene Erzählperspektiven und Genres, Erzählung, Dialog, Essay und Parabel zu einem großen multiperspektivischen Ganzen, das den Suchbewegungen und Unsicherheiten der Gegenwart gerecht wird. Kein Buch der Gewissheiten, ein Buch der Suche. Ein literarisches Wagnis. Ein großes Buch.
»Michael Kleeberg ist ein unendlich begabter, unverschämt maliziöser Schriftsteller, der souverän über alle Register der großen Romanorgel verfügt.« Ijoma Mangold, Die Zeit
»Michael Kleeberg hat diese Bereitschaft, seine Identität zu vergessen (nicht seine Existenz oder seine Kultur). Er ist bereit, sich dem anderen anzunähern ohne fertige Kategorien.« Abbas Beydoun
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Lisa Neuhalfen und Manja Hellpap, Berlin
Covermotiv: Plainpicture/Stephanie Uhlenbrock
ISBN978-3-462-31878-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Dank
Widmung
Motto
Moghanni Nameh – Buch des Sängers
Saghi Nameh – Buch des Schenken
Se Eschgh Nameh – Buch der drei Lieben
Das vierte Paar
Der Urmord
Die Götter
Aknun Nameh – Buch des Augenblicks
Madjnun Nameh – Buch des Idioten
Hääschde
Der Jasmin des Minnedieners
Die Spiritualität des Widerstands
In der Wüste
Dadjjal Nameh – Buch Daddschal
Einen habe ich verloren
Die Sirenen
Eine Merkwürdigkeit
Hermann: Das richtige Leben im falschen
Fünf Grabsteine
Georges Wolinski
Yohan Cohen
Krystle Campbell
Ein anonymes weibliches Opfer
Xulhaz Mannan
Kadmos: die Zurücknahme
Ehre und Schande
Leyla Nameh – Buch Leilah
Die Musik der Anfänge
Die Musik der Befreiung
Die Musik der Klage
Maschregh Nameh – Buch des Orients
Vormittag
Nachmittag
Abend
Taadib Nameh – Buch der Erziehung
Der Lehrer
Das Wiedersehen
Ghorbat dar Gharb Nameh – Buch des westlichen Exils
Die Frauen unter sich
Gottfried und Amir
Die Frauen unter sich (Fortsetzung)
Die Männer kommen dazu
Coda
Khandeh Nameh – Buch des Lachens
Der Arabische Mantel
Amal Nameh – Buch der Utopie
Die Anfechtungen Daddschals
Die Drei Prinz*essinnen von Serendip
Dank
Der Autor dankt der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und der Stiftung Preußische Seehandlung für die Unterstützung bei der Arbeit an diesem Werk
Den Freunden auf ihren Divanen
in Ost und West
Fried’ und Freude allen Wohlwollenden,
besonders den Nahen Verbundenen!
Und so fortan!
»Ist es wahr, Fürst, dass Sie einmal gesagt haben, die Welt werde durch die Schönheit gerettet?«
Dostojewski, Der Idiot
»Wie sich in der politischen Welt irgend ein ungeheures Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigensinnig auf das Entfernteste.«
Goethe, Tag- und Jahreshefte 1813
Moghanni Nameh – Buch des Sängers
Buch des Sängers
Dass wir solche Dinge lehren
Möge man uns nicht bestrafen:
Wie das alles zu erklären
Dürft ihr euer Tiefstes fragen.
Goethe
Allerliebste Marianne, erwache!
Ei! Wach’ uff und guck!
Die Welt ist aus den Fugen! Blutrot geht die Sonne im Abend auf. Der Orient zersplittert. Gog und Magog, die Bastarde unserer Berührung, hausen in unserer alten Karawanserei, wüten in der geliebten Stadt. Sie schießen Pfeile gen Himmel, die blutbefleckt wieder zur Erde fallen. Sie zertrümmern den Sarkophag des Ahiram von Byblos, und mit jedem Hieb geht uns ein Wort verloren. Die phönizische Prinzessin, unsere Urahnin, klammert sich verzweifelt an die Hörner des Stiers, aber der versinkt im winterlichen Meer, und ihr Bruder, ausgeschickt, sie zu suchen, sitzt in Abschiebehaft, und so haben wir denn keine Heimat mehr? Die Nachtigall schweigt im Zerplatzen der Bomben, im gelben Nebel welken Rose und Jasmin dahin. Hudhud hüpft an den Zäunen und Stacheldrahtrollen entlang und kann seine Liebesbotschaft nicht mehr überbringen. Daddschal, der Lügner und Täuscher, der Missgebildete mit dem blinden Auge, schwindelt die Hölle zum Paradies um und das Paradies zur Hölle, und unsere Brüder und Schwestern folgen ihm, dem Messias der Abwege, und besorgen sein schmutziges Geschäft, gleich ob er sich Schellenberg oder Kalif nennt. Die Wasserräder der Gerbermühle von Hama jammerten, kreischten und polterten schon in den Ohren Trajans und Mohammeds und Saladins, aber heute mahlt nur noch der tote Gang, und der Gevatter kommt bei Neumond das Mehl holen. Der Schrecken ist ein Engel auf dem Potsdamer Platz, die Piraten der Zukunft setzen zum Entern an.
Und wohin lenke ich in all diesem Wirrsal deinen erwachenden Blick?
Auf die Frau, die hier gegenüber von uns am Tisch sitzt und mit geschlossenen Augen der Musik lauscht. Warum auf sie? Wegen dieses Ausdrucks völliger Hingabe auf ihrem Gesicht. Lass uns ganz leise ein wenig näher treten, die anderen rund um den Tisch bemerken uns gar nicht in ihrer versunkenen Konzentration. Komm in den Kreis hinein, den die lebendige Musik um uns alle schlägt, hinein in die Fruchtblase, die sich um jede Gruppe von Menschen bildet, die gemeinsam musizieren.
Wir könnten, wären wir selbst taub, auf diesem Gesicht die Klänge und Worte lesen. Wie anmutig die Mondsicheln der Brauen mithorchen! Und wie zart und verletzlich die geschlossenen Lider sind, aber durchflossen von Leben wie Magnolienblüten. Und wie anrührend die Falten und dunklen Vertiefungen unter den Augen und die tief eingeprägten Krähenfüße. Wenn sie lacht, kräuselt sich der Nasenrücken so liebenswert, du wirst es gewiss gleich noch sehen. Nein, es ist nicht das Gesicht eines Mädchens oder einer jungen Frau, ihre schwarzen Locken sind am Schläfenansatz ergraut, ob sie sich wohl das Haar färbt, was meinst du? Schau, die Lippen sind nicht fest geschlossen, sie bewegen sich kaum merklich, als murmelten, als flüsterten sie den Text mit, den sie auswendig zu kennen scheint. Es sind rote und volle Lippen, trocken und fein gemasert. Lass uns einen Schritt zurücktreten, nicht dass unser Atem sie aufstört.
So ganz bei sich, durchdrungen von Melodie und Rhythmus und Worten, aber nicht in sich verschlossen, ihr Gesicht, ihr Körper sind dem Augenblick geöffnet wie eine Blume der Sonne. Was meinst du, kann man sagen, sie liefert sich dieser Sekunde aus, und die ist Klang? Sie schwimmt im Fluss des Liedes mit wie ein Fisch, der sich von der Strömung treiben lässt?
Innig konzentriert, als lausche sie auf ein Echo der Vergangenheit im Gegenwärtigen. Was sagst du? Sie sieht aus, diese lauschende Frau mit den geschlossenen Augen, als durchlebe sie die Sekunde vor oder die nach dem Glück.
Ihre geöffneten Handflächen ruhen auf dem Schoß, die türkise Bluse lässt das Haar leuchten und den schwarzen Spitzenbesatz des BHs flimmern, der unter den beiden geöffneten obersten Knöpfen zu sehen ist. Der lange schwarze Rock fällt seitlich über den Stuhl. Gesammelt sitzt sie da von den Fingerkuppen bis in die Zehenspitzen, die im Takt des Liedes mitwippen. Sogar durch die geblähten Nasenflügel scheint die Musik einzuströmen, sie füllt sich mit ihr und entlässt sie wieder aus sich im synkopierten Rhythmus des Blues.
Das Bild dieser Berührten zu enträtseln, liebe Freundin, deswegen sind wir hier. Ich gestehe dir, ich hab’ dich in ihr wiedererkannt, du wirst verstehen warum, wenn du sie erst selbst singen hörst. Und ganz ungeachtet solcher Nebensächlichkeiten wie Familienstand, Alter, Haarfarbe oder ihrer aparten persischen Schafsnase.
Sie heißt übrigens Maryam.
Du fragst dich: Wo sind wir hier? Nun, an einem Ort, wo nicht nur gesungen wird, sondern auch vernünftig gesprochen. Der Abend ist angebrochen, ein warmer Sommerabend, dessen schwere gelbe Düfte ab und zu ein Windhauch durchs offene Fenster weht. Aber bevor wir uns umsehen und orientieren, überquert unser Blick die feingesponnene, schwingende Brücke vom Ohr der Zuhörenden zum Mund des Sängers. Wer ist er, der die Musik macht, die die Anwesenden in Bann schlägt, die um den Tisch sitzen und lauschen? Selbst Mimi, die schwarzweiße Katze auf der Fensterbank, hört zu, genau wie Kitmir, der dreibeinige Hund aus dem Tierheim, der unterm Tisch liegt. Sogar die letzten abendlichen Amseln draußen in den Baumkronen haben respektvoll den eigenen Gesang eingestellt.
Auch die Augen des Sängers sind geschlossen. Sein Kopf ist über die Gitarre geneigt, im Kerzenschein schimmert seine Glatze, die von einem Saum grauer Haarbinsen umwuchert ist, wie ein mondbeschienener See. Die Brille ist auf der fleischigen Nase ein Stückchen hinabgerutscht. Er trägt über einem weißen T-Shirt ein lachsfarbenes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, dessen Knopfleiste über dem Bauch ein wenig spannt.
Findest du nicht? Man hat hier, wie beim Anblick aller Menschen, die ganz durchdrungen von ihrer Tätigkeit, konzentriert einem komplizierten Handwerk nachgehen, das Bedürfnis, seine Versunkenheit zu beschützen wie die Unversehrtheit eines Säuglings.
Die Hände auf den Saiten sind zwei muskulöse Spinnen, die einen Balztanz vollführen. Die linke streckt und dehnt die Beine, kommt ihrem Partner entgegengelaufen und gesprungen, zuckt dann wieder zurück, dehnt sich, zieht sich zusammen. Die rechte bleibt in sich gekehrt auf gleicher Höhe und pflückt die Töne wie Kirschen.
D-Moll, B-Dur, zwei Bünde tiefer nach C und wieder zurück nach D. Dreimal hintereinander dasselbe wohlbekannte Riff. Dann beginnt er zu singen, Hermann ist sein Name, mit einem leisen, aber sicheren Bariton. Seine Augen sind noch immer geschlossen. Er scheint tief in sich hineinzublicken oder zu horchen, wie in einen Brunnenschacht, aus dem die Wörter gefördert und geschöpft werden müssen:
»What will you do when you get lonely and nobody’s waiting by your side? You’ve been running and hiding much too long. You know, it’s just your foolish pride.«
Und dann der Refrain, und drei Stimmen fallen in die Harmonie ein, die Maryams, deren Mund sich dabei zu einem Lächeln weitet, die eines jungen Mannes von Anfang zwanzig mit schwarzem Haar, und die des neben ihm sitzenden, an ihn gelehnten dunkelblonden Mädchens mit den langen, gefilzten Dreadlocks: »Layla!«
Vier Stimmen, der Bariton Hermanns, der Celloton Maryams ganz dicht darüber, auf den sich der Tenor des Jungen und heller, aber nicht höher, die Stimme des Mädchens schichten wie Schmirgelpapiere, die sich aneinander reiben und Fünkchen schlagen der Spannung, die den Zuhörern eine Gänsehaut den Nacken hinaufjagt:
»Layla! You got me on my knees, Layla. I’m begging darlin’ please, Layla. Darling, won’t you ease my worried mind?«
Nur hört es sich so nicht an.
Denn Hermann, der ohnehin, wenn er an den Wochenenden aus Frankfurt hierheraufkommt, um seinen Freund TK zu besuchen, gerne ins Hääschdener Platt ihrer Kindheit und Jugend verfällt, versucht gar nicht erst, die englische Aussprache korrekt klingen zu lassen.
»Letz meek se best of se sidjuehschn, biefohr ei fainelie goh insehn. Blies dohnd seh, wiel newwer faindeweh ent tell mie ohl mei laffs inwehn!«
Und vor allem singt er dann im Refrain: »Lehla! Ju gatt mie on mei Knies!«
Knies! Mit K!
Aber sieh dich um! Grinst deswegen irgendwer hinter vorgehaltener Hand? Muss einer lachen? Und die drei jungen Leute, die gewiss fließend Englisch sprechen, ziehen sie höhnische Grimassen? Verliert das Lied dadurch irgendetwas von seiner schmerzlichen Besessenheit, angesichts der man einen knieenden Einsiedler in der Wüste vor sich sieht, der, die Hände zum Himmel gehoben, die Steine und den Sternenhimmel anfleht?
Keine Spur. Niemand merkt auf, niemand fällt aus dem sanften Bann. Niemand zuckt mit der Wimper, ganz so als sei es völlig nebensächlich und spiele überhaupt keine Rolle, wie englisch das Englisch nun klingt. Und sag selbst: Findest du irgendein Moment der Lächerlichkeit in dieser Szene?
Nein, das tun wir beide nicht, denn auch wir sind drinnen, auch wir sind in der Fruchtblase des Einvernehmens und der Zuneigung dieses Hauses, wo man frei wird und mutig und über sich hinauswächst, du erinnerst dich? Und dieses Déjà-vu ist der andere Grund, warum ich dich bitte, diese Tage bei mir zu sein.
Etwas lächerlich zu finden und lächerlich zu machen, ist zunächst einmal nichts als der Beweis, draußen zu stehen und sich damit nicht wohlzufühlen. Das tut hier niemand, im Gegenteil, der Humus, aus dem die Blüten der Musik wachsen, ist Zuneigung, ein Wissen um die Gebrechlichkeit unserer Würde und Autonomie, um die Kostbarkeit unserer gemeinsamen Augenblicke.
»Leike fuhl, ei fell in laff wiss ju«, singt Hermann und hebt kurz den Kopf, um verlegen in die Runde zu lächeln angesichts des Gefälles zwischen der Leidenschaft des Liedes und seiner Gestalt, und hier und da wird das Lächeln erwidert, voller Respekt und Schalk, und Maryam öffnet wie auf Verabredung die Augen, blickt über den Tisch und schließt sie wieder. Dafür ergreift sie das Tamburin, das am Stuhl lehnt, und klopft jetzt als Antwort mit den Fingerkuppen den Rhythmus mit. »Layla, you got me on my knees … Layla … Darling won’t you ease my worried mind?«
Die Finger streichen zärtlich über das Fell der Daf, ganz beiläufig übernehmen sie den Rhythmus, und im Refrain schichten sich die zweite und dritte Stimme über die erste wie Blätterteig.
Ob der Sänger und die Zuhörer die Geschichte dieses Songs kennen? Die Geschichte von Eric Clapton, der sich unsterblich in die Frau seines engen Freundes George verliebte, ihr dieses Lied seiner unerfüllten Sehnsucht schenkte und dann, als sie ihn, hin- und hergerissen zwischen Verliebtheit und schlechtem Gewissen, nicht erhörte, drei Jahre lang in den Abgrund von Heroin und Alkohol flüchtete? Aber warum nannte Clapton sein Lied nicht Pattie, sondern Layla? Das lag an einem schottischen Drehbuchautor, der im Swinging London zu seinen Freunden gehörte, einem gewissen Ian Dallas, der dem liebeskranken Gitarristen ein Exemplar von Leilah und Madschnun schenkte, jener altpersischen unsterblichen Geschichte einer unsterblichen hoffnungslosen Liebe. Da war Dallas allerdings bereits zum Islam konvertiert und nannte sich Abdalqadir as-Sufi. Seither hat er sich allerdings weniger als Mystiker hervorgetan, sondern sich mit einer Fatwa gegen den Papst und Hasstiraden gegen die Juden in eine ganz eigene Richtung entwickelt, aber das ist eine Geschichte, die nicht direkt hierhergehört.
Was hierhergehört ist, dass an diesem privatesten aller Orte, so weitab von irgendwelchem Rockstar-Glamour wie von jeder Frömmelei, Hermann, dieser nicht mehr junge Mann mit dem runden Gelehrtenbäuchlein, dessen äußere Erscheinung eines Aufbegehrens oder Auftrumpfens nicht fähig scheint, den Schmerz und die Sehnsucht und die Hoffnung von Claptons Lied mit virtuosen Fingern interpretiert und den anderen darreicht in einer demütigen Würde, die man nur dann ausstrahlt, wenn man weiß, wovon man redet.
Und auch Maryam, die so hingegeben zuhört und deren Fingerkuppen die Daf streicheln, lauscht wie jemand, der persönlich gemeint ist. Was ist das? Erinnerung an verlorene Jugend und der bittersüße Schmerz darüber?
»Hör uff!« winkt TK lachend ab, nachdem wir uns zwischen die anderen an den großen Esstisch gequetscht haben.
Nun gut, ich gebe zu, das ist eine unbeholfene Art, mich auszudrücken.
»Mir scheint«, sagt Hermann, »was uns irgend Großes, Schönes, Bedeutendes begegnet im Leben, daran darf man sich nicht von außen her erinnern, das darf man später nicht gleichsam erjagen müssen, es sollte sich vielmehr gleich vom Anfang her, wenn es geschieht, in unser Inneres verweben und mit ihm eins werden. Es muss sozusagen die vorhandene Substanz vergrößern und verdichten und beständig produktiv in uns wirken.«
Maryam blickt auf: »Es gibt überhaupt kein Vergangenes, das man zurücksehnen durfte, es gibt nur ein ewig Neues, das sich aus den erweiterten Elementen des Vergangenen gestaltet, und die echte Sehnsucht muss stets nach vorn gerichtet sein und etwas Neues, Besseres erschaffen.«
Ich könnte es selbst nicht besser sagen.
Deshalb sind wir hier, liebe Freundin, um vorauszublicken, indem wir zurückblicken, um, verfügend über unsere Vergangenheit, von diesem Balkon der Gegenwart in die Ebene der Zukunft hinunterzusehen, die unserer Kultivierung harrt.
Lass mich dir also von dem Elfer einschenken, der mineralischen Mäushöhle, dem Papillenschmeichler aus Buntsandstein und Keuper, dem Goldmundwässerchen, dem Gaumenbalsam und Zungenlockerer aus den Deidesheimer Hügeln, den unser Schenke und Magier TK so freigiebig kredenzt, während unser Blick die ganze Tafelrunde erfasst an diesem sich dem Ende zuneigenden Wochenende des 24. bis 28. Augusts 2015, meinem Geburtstag, hier an der Peripherie.
Denn wie sang Maryam vorhin, als die Reihe an ihr war:
»Den bitteren Wein wünsche ich, den berauschenden, der männerfällende Kraft hat, um einen Augenblick vor der Bosheit und Wirrnis der Welt auszuruhen.
Bring Wein, gibt es doch vor den Ränken des Himmels keine Sicherheit, wenn Sohre die Laute schlägt und Mehrih die Waffen klirren lässt.«
In solchen klirrenden Zeiten aber braucht es noch mehr als den bitteren Wein, es braucht auch Küssen in der Öffentlichkeit, Schinkenbrote, Meinungsverschiedenheiten, neueste Mode, Literatur, Großzügigkeit, Filme, Gedankenfreiheit, Jazz, Schönheit, Liebe, denn keine lasttragende Seele ist dazu verdammt, die Last einer anderen auf sich zu nehmen …
»Und Frauenfußball!« ruft Ulla dazwischen.
Das Lied Maryams ging denn auch noch weiter:
»Auf die Armen zu achten, steht der Größe nicht entgegen.
Salomo, bei all seinem Pomp, beachtete die Ameisen.
Komm, dass ich dir im reinen Wein das Geheimnis der Zeit aufzeige, unter der Bedingung, dass du es keiner schiefen Seele und keinem Herzensblinden verrätst.
Den Brauenbogen hält die Liebste unverwandt auf den Idioten gerichtet, doch er muss lachen über seinen schwachen Arm.«
Schiefe Seelen und Herzensblinde sitzen hier heute Abend keine, dafür will ich mich verbürgen. Aber lass mich dir die Runde der aufrechten Seelen und Herzensäugigen vorstellen, die sich hier versammelt hat, um gemeinsam mit mir meinen Geburtstag zu begehen und mit der wir das Wochenende verbringen wollen.
Ehre, wem Ehre gebührt. Zunächst also TK, der Schenke und Herr des Magierhauses, und Ulla, seine Frau, das Herz und die Seele der Runde. TK heißt eigentlich Bernhard, aber außer Hermann und Ulla und Udo, die ältere Rechte haben, nennt ihn keiner so. Der Spitzname, eine Abkürzung für Tante Käthe, verdankt sich einer gewissen, aus den grauen Locken herrührenden Ähnlichkeit mit Rudi Völler und der Tatsache, dass Bernhard selbst in seiner Jugend ein vielversprechender Athlet und Fußballer war.
Ulla, die jahrelang hier oben in Mühlheim Jugendwohngruppen leitete, hat eine Weile in dem alten Pfarrhaus oben hinter dem Stadttor gelebt, das jetzt von Younes und Karoline bewohnt wird, und dann dieses Haus entdeckt, das zum Verkauf stand, und TK an langen Abenden überredet, seine geliebte Bornheimer WG ganz nahe seiner Arbeitsstätte zu verlassen und sich hier an der Peripherie anzusiedeln, wie er das nennt. TKs Reich ist eigentlich die Bergerstraße, dort hat er im Anschluss an seine Spontizeit und sein Studium einen Verein für Jugendsozialarbeit aufgebaut, in dem er aufgeht – oder aufgegangen ist bis vor kurzem, aber das ist eine schmerzhafte Geschichte, die er selbst erzählen soll.
Zu den Sängern: Hermann arbeitet jetzt wieder – oder soll ich sagen: jetzt erstmals – als Lehrer in Frankfurt, aber er ist fast jedes Wochenende als Hausgast hier. Maryam dagegen lebt seit einigen Jahren hier oben, gar nicht weit weg, in dem Eckhaus beim Bettelweib, als professionelle Musikerin hat sie dort auch einen Probenraum und ein kleines Studio. Seitdem begleiten die Frauen, die im Chor singen, also von den hier Anwesenden Ulla und Martha, sie häufig, zuletzt erst gestern bei Younes’ Gartenoper, die passenderweise die Geschichte von Leilah und Madschnun zum Thema hatte. Da musste Hermann übrigens auch sein Clapton-Lied spielen, denn es ist ja quasi Gesetz beim Alten: Wer im Ort ist, macht mit. Der Einzige, der sich entzieht, ist TK, aber wir arbeiten daran.
Martha, die alte Dame in der lila Tunika (von Ulla geschneidert) mit dieser unglaublichen zarten Haut, die hier rechts sitzt und auch eine Gitarre neben sich stehen hat, ist unsere Doyenne. Sie hat vorhin gespielt (ihr Lieblingslied, Ännchen von Tharau), bevor wir dazugekommen sind. Was kann man über Martha sagen? Sie ist hier geboren, aber seit dem Tod ihres Mannes und vor allem seit dem tragischen Selbstmord ihres ältesten Sohns letztes Jahr fühlt sie sich in ihrem Häuschen sehr einsam und ist häufig hier, um nicht alleine zu sein. Ja, du wirst es noch sehen, dieses Haus ist ein Taubenschlag. Andauernd schaut jemand herein, und TK und Ulla haben für jeden einen Stuhl, der irgendwie noch an den Tisch passt, und je nach Tageszeit eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein.
»Martha und wir, wir führen hier so eine Art WG«, scherzt TK, und das macht Martha verlegen, deren größte Furcht es ist, jemandem auf die Nerven zu fallen. Maryam hat sie vorhin mit dem Auto hochgefahren und bringt sie nachher auch wieder nach Hause, denn nach ihrer Hüft-OP kann Martha die steile Straße von ihrem Haus bis hierher noch nicht ohne Schmerzen zurücklegen.
Am anderen Ende der Altersskala unsere Zweitstimmen von eben: die philosophischen Zwillinge Ernst und Navid und dazu Giselle. Wobei Ernst zwar Gitarre spielt, aber nicht singt, und Giselles französischer Name eine merkwürdige Laune von Hermanns Schwester war; sie ist dessen Nichte, die Navid bei einem Besuch hier kennen- und lieben gelernt hat. Weder hat die Schwester, so weit ich weiß, jemals in Frankreich gelebt noch ein besonderes Verhältnis zum Ballett, und auch der Erzeuger ist ein Deutscher. Wie auch immer, Giselle und nicht Gisela. Jedenfalls studiert Giselle Design an der Armgartstraße in Hamburg und unterhält seither eine Fernbeziehung mit Navid, der seinerseits Informatik in Marburg studiert und als ›ethischer Hacker‹, wie er sich selbst bezeichnet, Geld damit verdient, Sicherheitslücken in Computersystemen aufzuspüren, wogegen sein Busenfreund Ernst, nachdem er an der Humboldt-Uni in Berlin seinen Bachelor in Politik und Philosophie gemacht hat, ein Erasmusjahr in Bristol verbringt. Dass sie alle hier sind, liegt daran, dass Ernst, der Sohn von TK und Ulla, und Navid, der von Maryam, einige prägende Jahre hier in Mühlheim verbracht haben und wann immer es geht, ein paar Tage zu Hause verbringen wollen.
Zwischen Hermann und TK sitzt der lange, grauhaarige Udo, der aus demselben Ort stammt wie die beiden und in Frankfurt als Anwalt arbeitet. Der Große, Stille da hinten ist Zygmunt, den sie hier im Dorf alle peinlicherweise Siggi nennen, er kommt jedes zweite Jahr aus seinem Dorf hinter Stettin, um aus alter Verbundenheit die Überdachung des Pfarrgartens für die Aufführung der Gartenoper aufzubauen, aber mittlerweile hat er auch jedes zweite Haus der Umgebung renoviert. Er soll später selbst noch erzählen, und hier neben ihm, das ist mein Freund.
Kadmos, der Sänger von Tyrus, der Erneuerer des lyrischen Alphabets. Er hat auch einen bürgerlichen arabischen Namen, aber als Dichter trägt er den Namen des legendären Königssohns seiner Heimat, die er mit seinen Gedichten mindestens ebenso unsterblich gemacht hat wie sein Namenspatron. Kadmos ist öfter in Europa, nicht nur auf Lesereisen, seine beiden Kinder studieren hier, der Sohn Islamwissenschaften, Arabistik und Philosophie an der Sorbonne und die Tochter Film in Babelsberg, und da er beide finanziert, gestattet er es sich, ab und zu als Paterfamilias nach dem Rechten zu sehen. Als er irgendwann in Frankfurt las, nahm ich ihn mit hierher, vielleicht nur, um ihm zu beweisen, dass Gastfreundschaft nicht bloß in Beirut zelebriert wird.
Wir können übrigens von Glück sagen, dass vorhin während der Musik sein Handy nicht klingelte, denn das tut es normalerweise ständig, woraufhin er auch nicht zögert, den Anruf anzunehmen, ganz gleich, was er gerade tut. Zum Beispiel erlebte ich ihn vor einiger Zeit auf dem Podium einer Diskussion zum Bürgerkrieg in Syrien (allerdings zum Glück nicht in Deutschland, denn was dann geschah, hätte man hier in den falschen Hals bekommen). Er saß dort mit mehreren anderen Personen und erklärte gerade etwas mit seiner Kieselsteinstimme, als sein Telefon klingelte und er, sich entschuldigend, abnahm. Man sah ihn nicken und »mhm, mhm, mhm« murmeln, dann legte er auf und brach in schallendes Gelächter aus, das gar nicht mehr aufhören wollte. Der Moderator, angesteckt von diesem Heiterkeitsausbuch, fragte nach, und Kadmos zog ein weißes Stofftaschentuch aus seinem Jackett, nahm die Brille ab, tupfte sich die Augen und erklärte: »Entschuldigung, aber das war meine geschiedene Frau. Sie wollte wissen, ob unsere Tochter die Nacht zu Hause verbracht hat. Ich meine, die ist vierundzwanzig und lebt in Berlin. Ich nehme doch einmal stark an, dass nein.«
Sieh ihn dir an: Das Erste, was an ihm auffällt, sind seine Augen. Es kommt ein Augenpaar ins Zimmer, das von einem Menschen umgeben ist, nicht ein Fremder mit einem Gesicht, das irgendwelche Merkmale hat. Zwei dunkle Brunnen, Zisternen, in denen es aber auch maliziös funkeln kann. Wenn du weißt, was er erlebt hat, fragst du dich, wo seine fatalistische Heiterkeit herkommt, er ist jedenfalls nicht der Typ, der panisch nach Samara reitet, wenn er dem Tod auf dem Marktplatz von Bagdad begegnet. Und er ist ihm schon zwei-, dreimal begegnet.
Und er ist nicht der einzige Libanese hier. Wir wollen schließlich auch mit den Abwesenden und den Toten feiern, die selbst nur momentan Abwesende sind. Es fehlt nicht viel in diesem Haus, und TK würde auch ihnen ein Glas von dem Elfer hinstellen, falls sie sich kurzfristig entscheiden sollten, doch noch vorbeizuschauen.
Es ist letztlich nichts als eine Frage nach der Sensibilität für das Feinstofflichere.
Den ›Patriarchen‹, wie TK ihn nennt, wirst du noch kennenlernen, er hat sich heute Abend bereits zurückgezogen. Die Frage nach Abwesenheit oder Tod ist, was ihn betrifft, ein wenig ambivalent. Sagen wir so, wenn es dich nicht befremdet, dass jemand ein zweites Leben geschenkt bekommt unter der Maßgabe, sich abends in eine Eiche zurückzuverwandeln, von denen einige besonders schöne Exemplare im Pfarrgarten wachsen, dann ist Khalil Jean Younes lebendiger als die meisten von uns. Er und Kadmos kannten sich in den Jahren im Libanon zwar vom Sehen, aber ihr Leben und Denken verlief in zu unterschiedlichen Bahnen, als dass sie je eine engere Beziehung miteinander gepflogen hätten. Hier, auf exterritorialem Gebiet, ist das anders, und Kadmos hat den Alten herzlich begrüßt, besonders aber Karoline, seine Frau, die er schon immer geliebt und bewundert hat, und die, obschon kinderlos, einen jeden so in den Arm nimmt wie eine Mutter und Freundin.
Und last not least lass uns Mahmouds gedenken, des Löwen von Tripoli, und Beates, Hand in Hand im Leben wie im Tode. Auf sie erhebe ich mein Glas jedesmal, wenn ich es hebe, mit.
Du siehst, wir müssen heute den fliegenden Teppich nicht in die Lüfte entführen, um über Wüsten und Karawansereien, über Oasen und vieltürmige Städte hinweg in unseren Rosengarten nach Shiraz zu fliehen. Der Orient ist längst hier bei uns, er fliegt mit MEA und Lufthansa und Turkish, er studiert Hegel in Heidelberg, Strömungsmechanik an der TU und Heidegger in Paris, und die Gäste, die hier sitzen und dem Madschnun lauschen, wie er voll inniger Trauer und Glück von Claptons Layla singt, sie kommen aus den salzigen und sandigen winddurchfegten Gassen von Tyrus und dem kalten Zimmer mit dem Kohleofen im sechsten Stock einer Mietskaserne von Offenbach. Kommen aus den von tausend kleinen Sonnen strahlenden und duftenden Orangenhainen von Tripoli und den grauen Sechziger-Jahre-Türmen der Diezenhalde wie denen der Jordan Street in Teheran, dort wo der Afrika-Boulevard in die Nelson-Mandela-Straße übergeht, und kommen aus der Jordanstraße in Bockenheim zwischen Karl-Marx-Buchhandlung und Senckenberg-Museum. Aus den katholischen Hügeln des Pfälzer Waldes und den katholischen Wäldern Pommerns, den heidnischen Ebenen der Mark, den pietistischen Fildern, den schiitischen Geröllfeldern von Sur und den maronitischen Steilhängen von Yahchouche.
Kinder- und Jugendheimaten, Ausbrüche, Fluchten, Wanderschaften, Entdeckungen und Eroberungen. Zweitheimaten, Drittheimaten, schmerzliche Heimaten, Fremde und Exil. Aus irgendeiner Heimat sind wir alle hierher gekommen, und Heimat ist’s immer, wonach wir suchen.
Und was nehmen wir mit? Unsere Identität? Ich weiß nicht, denn mit ihr reisen immer auch auch Mord, Tod und Elend, mehr oder weniger subtil, mehr oder weniger gedanklich verbrämt, aber immer gerechtfertigt durch sie, durch Identität.
»Darf ich dich unterbrechen?« fragt Kadmos. »Ich glaube, dass jemand, der mit seiner Identität in ein Land kommt, nur dem begegnen wird, was er dort auch auf die eine oder andere Weise erwartet. Ein Besuch in einer anderen Welt sollte ohne eine Identität erfolgen. Es wäre doch Unsinn, dass man sich plagt und reist, nur um sich seines Fremdseins, seines Europäer- oder Arabertums zu versichern, obwohl das so manche Reise oder Auswanderung tut. Ich wünsche uns diese Bereitschaft, unsere Identität zu vergessen (nicht unsere Existenz oder unsere Kultur), damit wir uns einander annähern ohne fertige Kategorien. Es ist auch ein Abenteuer, die Identität des Anderen zu vergessen (nicht seine Existenz oder seine Kultur), das Abenteuer eines Individuums, das anderen Individuen begegnet. Das Andere als Ziel ist zunächst eine Reise weg vom Selbst.«
»Es ist auch ein moralischer Akt«, fügt Hermann hinzu, »seine Identität zu vergessen. Es handelt sich darum zu lernen, nicht zu lehren. Unsere Gespräche hier, wenn ich dich recht verstehe (dabei wendet er sich an mich), können vielleicht eine Botschaft aus einem gänzlich anderen Land sein, nicht irgendeinem bestimmten, sondern einem womöglich noch unbekannten. Verweisen wir immer wieder auf diesen Ort, der weder im Osten noch im Westen liegt, es ist ein verschollener Ort, den wir aber hier und da werden zu erblicken glauben auf unserer gemeinsamen Reise. Er taucht auf, doch er kommt nicht, existiert nicht, kein utopischer Ort und auch nicht der ideale Staat, ein verlorener Ort, genauer gesagt ein Ort, der nie Wirklichkeit geworden ist. Dennoch ist es manchmal genau der Ort, auf den wir warten, dem wir lauschen, auf den wir verweisen.«
Ja, lass uns Identitäten zertrümmern. Wir wollen, solange wir hier zusammen sind, die Sünde der Liebe begehen, der Anverwandlung, auch wenn wir so nicht zu irgendwelchen Schlüssen gelangen werden. Dieser Preis ist zu entrichten, diese Schuld zu begleichen, der Lohn ist das Geheimnis. In seltenen Momenten wird es sich offenbaren, das Geheimnis unserer Reise, doch nie ganz, denn die Reise geht weiter. Das Land, zu dem es uns zieht, ist immer ein anderes.
Würdest du jetzt aus der niedrigen Wohnküche hinaustreten, über den gepflasterten Hof die Gasse hoch, oben bei der Skulptur des Bettelweibs hinter Maryams Haus nach rechts abbiegen, durchs mauerseglerdurchpfeilte Stadttor treten, die 50 Meter am Grundstück des alten Pfarrhauses vorbei, in dem der Patriarch und seine Karoline leben, und dann die Staffeln hinauf zum Bergfried, würdest du die 42 Stufen der äußeren Wendeltreppe und die 84 Stufen der inneren Steintreppe hinaufsteigen, dann könntest du bei Tag und gutem Wetter, am Altkönig vorbei hinunter in die Ebene blicken, am Fernsehturm und der vertrauten City-Skyline mit dem Messeturm Maß nehmen, die Augen am schwarzen Kristall der Geld-Kaaba der EZB vorübergleiten lassen, und dann würdest du sie sehen, dort am Silberband des Euphrat, der Völkermühle und Blutkelter, hinter dem Osthafen, zwischen dem Rudererdorf und dem Kaiserleikreisel, die kurze, ewige Heimat unseres Gedichts.
Nicht mehr wiederzuerkennen, aber wie die Fliege im Bernstein, sitzt im Herzen der Zeitform ihre unwandelbare Gestalt. So dort wie hier. So damals wie heute. Ganz nah sind wir, denn wie unser Schenke stolz sagt: »Auch hier an der Peripherie wird gelebt und geliebt.«
Morgen beim langen, dem ewigen Bewegungsdrang TKs geschuldeten Spaziergang werden wir wieder darauf zu sprechen kommen, wenn wir anhalten müssen, weil Hermann und Kadmos außer Puste sind. Wir werden ins Tal von Oberlauken hinunterblicken über die Streuobstwiesen hin, und Hermann wird den Satz zitieren vom Ort, der uns allen in die Kindheit schien und worin noch niemand war.
»Die Fundamentalisten wie die Materialisten sind sich ja darin einig, dass wir an gar nichts glauben, was nicht stimmt, wie wir wissen. Aber die Rückbindung ist das eine, wie jedoch steht es mit der Zukunft? Wollen wir etwas bewahren, oder wollen wir etwas schaffen?«
Eine Utopie? Muss es dann nicht, wie alle Utopien, eine mosaische sein? Ein Ausblick? Eine Hoffnungskarotte? Ein Vorgefühl von höchstem Glück?
Wir blicken darauf wie Mose hinunter ins Gelobte Land, wie wir jetzt hinunter nach Oberlauken. Betreten kann man sie immer nur kurzfristig, denn alle Utopien verwandeln sich zu totalitärem Irrsinn, wenn sie sich konsolidieren.
Ein Blick also nur, ein Wochenende im Rosengarten von Taunus-Shiraz, ein Moment des anderen Lebens hier an der Peripherie der Welt, zum Erinnern, zum Bewahren, zum Weiterreichen, bevor die Woche wieder beginnt.
Sehen wir also zu, liebste Marianne, mischen wir uns unter die Hausgäste, trinken, diskutieren, lachen und weinen wir mit ihnen, lösen wir uns in ihnen auf und inkarnieren wir uns in ihnen, und ihr anderen vernehmt, was wir zwei Taucher im Seelenmeer euch von diesen Stunden im August 2015 und in den Zeiten davor und danach zu berichten wissen.
Springt munter herum auf diesen Seiten. Gleich wo ihr anfangt, kommt ihr doch immer automatisch zurück in die Mitte. Und was die bringt, ist offenbar: das, was zum Ende bleibt und anfangs war.
Saghi Nameh – Buch des Schenken
Buch des Schenken
Seele und Herz verlangen nach Freundeswort.
Hafis
Als Ernst in seinem Zimmer erwacht, ist das Haus still. Nur die Morgensonne erwärmt die alten Knochen des Fachwerks und entlockt ihnen ein wohliges Knarren und Seufzen. Entweder ist er der Erste, der aufwacht, oder es sind schon alle ausgeflogen. Es ist halb neun, und aus dem Zimmer von TK und Ulla ist kein Laut zu hören, eben sowenig aus dem von Navid und Giselle. Aber die beiden schlafen gewiss noch. Vor halb elf wird mit ihnen nicht zu rechnen sein.
Auf bloßen Füßen steigt Ernst die steile Treppe hinunter in die leere Küche, nimmt zwei Tassen aus dem Schrank und stellt sie vor die Kaffeemaschine. Während sie heiser summend ihren Dienst verrichtet, tritt er hinaus auf den Hof. Auf dem Pflaster unter dem großen Vordach perlen Sonnenflecke. Hummeln steuern in zielstrebiger Unordnung die Blüten der Stockrosen an der Hauswand an. Es sieht aus wie eine bukolische, florale und friedlich-leise Version der Szenen in Star Wars, wenn die kleinen Kampfflieger in die Landeluken des Mutterraumschiffs gleiten. Der Duft des Geißblattbuschs hinter dem Außentisch fließt über die Ränder des Morgens wie Honig von einem Honigbrötchen. TKs Rennrad und der Fiesta fehlen. Die beiden sind also schon unterwegs. Aber gegenüber im oberen Gästezimmer sind die Vorhänge noch zugezogen. Ernst nickt. Das Summen hat aufgehört, der Kaffee ist fertig. In seine Tasse gießt er einen Schuss Milch, in die andere füllt er zwei Löffel Zucker. Dann nimmt er den ersten Schluck und geht mit beiden Tassen wieder nach draußen, steigt die äußere Wendeltreppe hoch und klopft an der Tür.
Es dauert einen Moment, bis Hermanns Stimme zu hören ist: »Ja?«
»Guten Morgen. Darf ich reinkommen? Ich bring’ dir einen Kaffee.«
»Herrlich!« ruft Hermanns Stimme, und Ernst drückt mit dem Ellbogen die Türklinke runter und tritt ein. In dem Zimmer befinden sich nur ein großes Bett und ein ausgelagertes Bücherregal TKs.
»Ich danke dir! Du bist ein Schatz. Auf gesticktem Polsterkissen, gelehnt darauf, sich gegenübersitzend, umkreist von Jünglingen, ewigen; Mit Bechern, Näpfen, Schalen des Klarflüssigen, das nicht berauscht und nicht verdüstert, und Früchten, wonach sie gelüsten …«
»Die Früchte gibt’s später beim Frühstück«, sagt Ernst. »Und was das Klarflüssige betrifft …«
»Gott bewahre!« Hermann setzt sich im Bett auf, angelt nach der Brille auf dem Nachttisch, setzt sie auf, fährt sich mit beiden Händen durchs kaum vorhandene Haar und streckt dann lächelnd eine Hand nach der Kaffeetasse aus.
Ernst setzt sich ans Fußende.
»Bist du der Erste?« fragt Hermann.
Ernst schüttelt den Kopf. »Nein, TK und Ulla scheinen schon unterwegs zu sein. Gut geschlafen? Kein dicker Kopf?«
»Wunderbar geschlafen. Und du?« Er trinkt den ersten Schluck. »Aah, das tut gut!«
Ernst wirft einen Blick auf das aufgeschlagene, umgedrehte Buch auf dem Nachttisch neben der Lampe und deutet darauf:
»Liest du was Neues? Oder ist das hier aus dem Bestand?«
»Was Neues. Judith Shklar. Der Liberalismus der Furcht. Kennst du sie?«
Ernst nickt. »Sie ja. Das Buch noch nicht. Aber den Übersetzer. Er hat an der Humboldt Examen gemacht, als ich anfing. Ziemlicher Überflieger. Aber warum Furcht?«
»Es geht um die Sicherheit vor Grausamkeit als Grundbedingung für die individuelle Freiheit. Die Grausamkeit jeglicher Machtausübung. Ihr großes Thema. Und woran arbeitest du?«
»Ich habe mich für den Bachelor gerade an einer Analyse der Spontibewegung versucht.«
Hermann lacht. »Eine geistige Herleitung deines Vaters. Hast du ihn gelöchert?«
»Ja, aber da kriege ich nur Anekdoten über Fußball und Äppelwoi zu hören.«
»Dabei gehört Bernhard zu den wenigen, die sich ihre Ideale nie haben korrumpieren lassen«, sagt Hermann.
»Ja, leider«, erwidert Ernst. »Sonst könnte er vielleicht heute auch von seinem Management 50000 pro Vortrag verlangen lassen wie Joschka Fischer.«
»Na komm, es reicht doch auch so. Wobei, du hast insofern recht, als wenn wir alle auf Hartz IV wären und nur unsere Armut zu teilen hätten, auch dieser Ort hier nicht existieren würde. Die innere Freiheit ist und bleibt bis zu einem gewissen Punkt eine Funktion der Mittel, die du dir erwirtschaftet hast.«
»Notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung«, sagt Ernst.
»Ja, und da wären wir bei dem ›überschüssigen Bewusstsein‹ von Marcuse oder Bahro oder beiden. Den humanen Kapazitäten, die übrigbleiben, nachdem du für dein materielles Überleben geschuftet hast. Die beiden haben zwar geglaubt, dass nur im Sozialismus so ein geistiger Mehrwert herauskommt, aber das wissen wir ja nun besser.«
»Wie war das nochmal?« fragt Ernst. »Es werden Bedürfnisse freigesetzt, und zwar entweder kompensatorische oder emanzipatorische?«
»Genau. Willst du Erstere befriedigen, um dich für die Arbeiterei zu entschädigen, kaufst du Autos, machst Kreuzfahrten und spielst Golf. Die emanzipatorischen dagegen fließen in die Bildung, die Kultur, die Schönheit, die Menschlichkeit und die Gemeinschaft. Und genau darin, lieber Ernst, bist du groß geworden. Wenn Ulla und Bernhard ihr Geld lieber für sich ausgeben würden, dann gäbe es diesen Ort nicht, wo wir leben, lieben, denken und trinken können, und ich würde in irgendeinem Loch hocken …«
»Apropos trinken. Soll ich dir noch einen Kaffee holen?«
»Nein, danke dir. Wir können ja beide gleich runtergehen und den Frühstückstisch decken.«
»Weißt du, was ich dich nie gefragt habe?«
»Nein, was denn?«
»Wie das eigentlich für dich war, als TK dich damals gefragt hat, ob du hier hochkommen und es mit uns versuchen wolltest.«
Hermann ist mittlerweile aufgestanden und hat das Bett aufgeschüttelt. Er trägt einen rot-blau gestreiften Schlafanzug und hält die leere Tasse in der Hand.
»Ich sagte zu ihm, wie soll das denn gehen? Ich kann sowas doch nicht! und er: Improvisieren wir halt. Das war nicht nur Großherzigkeit, es zeigt dir Bernhards Gabe, dem anderen Peinlichkeiten zu ersparen und ihn auf Augenhöhe zu ziehen. ›Wir improvisieren.‹ Mein Gott, man muss sagen, wir haben gar nicht so schlecht improvisiert.«
Ernst lächelt.
»Weißt du, dein Vater vermittelt immer den Eindruck, als sei er es, der den anderen zu Dank verpflichtet sei. Weil sie zu ihm kommen, die er einlädt. Weil sie mit ihm sprechen, der das Beste aus ihnen herausholt. Seine Großzügigkeit erweckt nie den Anschein, als gebe sie etwas. Sie befreit vielmehr. Und so hat sie mich damals auch befreit aus meiner Wüste.
Weißt du, ich glaube, diese Gabe der Großzügigkeit ist ein Erbe oder ein gelebtes Beispiel, eine Verpflichtung von klein auf, weil er es einfach von seiner Mama her so gewohnt war, die immer kommentarlos einen weiteren Teller auf den Tisch stellte, wenn jemand zur Tür reinkam. Es spielt auch Taktgefühl mit hinein, jedenfalls vermittelt er dir nie den Eindruck, jetzt zu einer Gegenleistung verpflichtet zu sein. Verstehst du, das ist das Schöne an ihm: Er macht dich größer als du bist. Seine Großzügigkeit wirkt, als käme sie dir einfach zu und sei nicht mehr, als was du verdient hast. Und so befreit er seine Freunde und alle anderen von jedem Schuldgefühl. Das ist seine Kunst. Und nur so können an diesem Ort hier so viele schöne Momente stattfinden, Momente der Erkenntnis, Vertiefung von Zuneigung, Denkaufschwünge, Gefühlsehrlichkeit. Dank dieses Spinnennetzes der Freundschaft, das die beiden hier gesponnen haben. Denn natürlich gibt es keinen Bernhard ohne Ulla. Ich habe nie jemanden getroffen, der so viel für andere tut, ohne dass du dabei jemals das Gefühl hast, sie würde zu kurz kommen oder sich selbst hintanstellen. Guck, jetzt ist sie wahrscheinlich schon oben im Pfarrhaus und hilft den beiden beim Aufräumen.«
Die zwei klettern die enge Wendeltreppe hinunter, überqueren den gepflasterten Hof und fangen an, den Tisch draußen fürs Frühstück zu decken.
»Wie viele sind wir denn?« fragt Hermann.
Ernst zählt mit den Fingern nach. »Wir vier. Die beiden Langschläfer. Maryam kommt vielleicht. Martha bestimmt. Lass uns mal für acht decken. Wenn noch irgendein unerwarteter Gast dazukommt, stellen wir halt noch was raus.«
In diesem Augenblick bremst quietschend TKs Rennrad im Hof. Er steigt aus den Klicks und lehnt es gegen die Mauer, wischt sich den Schweiß von der Stirn und legt den Rucksack ab, aus dem er eine große Papiertüte mit Brötchen zieht sowie die FAZ und die Lokalzeitung.
»Guten Morgen, habt ihr gut geschlafen? Ich hab’ auf meiner Runde beim Bäcker haltgemacht. Ich geh’ schnell duschen, dann können wir frühstücken. Die Frauen kommen auch bestimmt gleich. Sie sind oben beim Patriarchen und helfen aufräumen und die Reste zusammenpacken.«
Die Erste, die erscheint, ist Maryam, die einen Korb mit übriggebliebenem Essen von der Nachfeier der Oper mitbringt.
»Ulla und Martha kommen gleich mit dem Auto nach«, sagt sie. »Aber Ulla kann nicht weg, bevor sie nicht alles wieder picobello aufgeräumt hat.«
Ernst steht an der Tür, und Maryam deutet mit dem Kopf lächelnd auf Hermann, der im Schlafanzug hinter seiner Zeitung sitzt. Dann sagt sie zu dem Jungen gewandt:
»Gib zum Morgentrunk, o Schenke
ihm das Weinglas in die Hand,
da das Leben wie im Schlafe
dem ergrauten Träumer schwand.«
»Bloß nicht«, grantelt Hermann, ohne den Blick zu heben. »Ernst wollte mir auch schon Wein geben am frühen Morgen. Was habt ihr bloß alle für ein Bild von mir?«
Maryam und Ernst grinsen sich an, und Maryam fährt fort:
»Doch von jenem Weine gib ihm,
der, wenn er das Aug’ erhellt,
Ihm als Wasserspieg’lung zeige –«
»Was sie wirklich ist, die Welt«, schließt Hermann hinter seiner Zeitung den Vers ab. »Das versuche ich ja gerade herauszufinden, wenn man mich nur lesen lässt.«
Maryam zwinkert Ernst zu und hebt wieder an:
»Doch von jenem Weine gib ihm,
der, sobald er schäumend gärt –«
»Den erhab’nen Dom des Himmels«, respondiert Hermann hinter der FAZ, »einem Bläschen gleich verzehrt.«
»Hey!« sagt Ernst und klatscht in die Hände.
Ohne hinter seiner Zeitung hervorzusehen, sagt Hermann:
»Doch von jenem Weine gib mir,
der durch seine frohe Kraft –«
»Trunkne zu verrückten Männern,
Weiber zu Verliebten schafft«, ergänzt Maryam.
Jetzt lässt Hermann die Zeitung sinken, prostet Maryam mit der Kaffeetasse zu und sagt:
»Du schummelst! Das war der falsche Reim.«
»Na gut: Weise zu Verliebten schafft also.«
Hermann nickt und fährt fort:
»Da ich nun zum Greis geworden,
geht dies Einz’ge nur mir nah: Na, was?«
»Dass du, diesen Wein entbehrend,
deine Jugend schwinden sahst«, ergänzt Maryam. »Meine Rede!« Und beide lachen.
»Hey!« sagt Ernst nochmal. »Habt ihr das eingeübt?«
»Keine Spur«, sagt Maryam zwinkernd. »Wir funktionieren wie Behram und Dilaram, die im Zwiegespräch ihrer Zuneigung ganz unversehens die Dichtkunst und das Reimen erfunden haben.«
»Geh«, sagt Hermann, »das kannst du auch. Pass auf:
Wein zu trinken und im Rausche
aufzugeben deinen Geist … na?«
»Ew’ges Glück ist dies zu nennen«, sekundiert Maryam. »Na …?«
»Ja, wartet«, meint Ernst. »Geist, Geist … Ja!
Prost, und ich genieß es dreist!«
»Bravo! Komm, noch einen. Maryam?«
Die überlegt kurz, dann:
»Wie schön ist, was zum Harfenklang
beim Morgenwein der Sänger sang.«
Hermann hilft: »Erwach, o Mensch, dein kurzes Sein …«
»Schließt Schätze langen Schlafes ein!« ertönt es von oben, und alle blicken hinauf, wo Giselle und Navid sich aus dem Fenster lehnen. »Die ihr einem aber raubt mit eurem Dichten am frühen Morgen! Gibt es Frühstück?«
»Für den, der mithilft, es zu machen«, sagt Ernst.
Als der Tisch gedeckt und TK geduscht ist und den Usinger Anzeiger durchblättert, fährt auch der Fiesta vor, und Ulla und Martha steigen aus. Beide tragen ein Tablett mit übriggebliebenen Salaten von gestern Abend.
»Karoline wollte uns noch mehr geben«, erklärt Ulla, während sie die Sachen auf den Tisch stellt und prüfend mustert, was die Männer und jungen Leute geleistet haben. Dann packt sie wortlos Wurst und Käse aus den Tupperdosen, in denen die Tischdecker sie gelassen haben, und legt alles auf das Silbertablett aus dem Pfarrhaus, holt aus der Küche Löffel für die Marmeladengläser und schneidet zwei überreife Rosenblüten vom Strauch und stellt sie in die flachen, runden Tonvasen auf dem Tisch. Währenddessen ist TK aufgestanden, um seiner Frau und Martha Kaffee zu machen.
»Karoline kommt nachher auch noch kurz runter, aber der Patriarch muss sich von der gestrigen Anstrengung erholen. Bernhard, wann musst du in Homburg am Bahnhof sein, um Kadmos abzuholen?«
Der winkt ab. »Erst um vier. Noch viel Zeit.«
Nach dem Frühstück ist der Moment, scheint mir, um TK einmal beiseitezunehmen und ihn nach den Entwicklungen bei seiner Arbeit zu fragen, die ihm auf der Seele lasten. Aber Bernhard kann, wie er selbst sagt, nur richtig denken und dementsprechend auch Gedanken formulieren, wenn er sich bewegt. Man muss auch keine Angst haben, ihn überzubeanspruchen, nachdem er heute früh schon 40 Kilometer radgefahren ist. »Ich brauche das«, sagt er. »Und momentan mehr denn je. Es nagt doch mehr an mir, als ich gedacht hätte.«
Es passt mir gut in den Kram, dass wir unseren Spaziergang in den Friedwald machen wollen. Denn dort kann ich vermutlich ganz leicht Krüger auftauchen lassen, der in diesem Falle der geeignetere Gesprächspartner ist. Seinen Vornamen kenne ich nicht und weiß auch nicht, ob überhaupt jemand hier ihn kennt. Er stellt sich immer nur mit »Krüger« vor und redet von sich auch in der dritten Person: »Der Krüger sagt jetzt Gute Nacht«, wobei er mit den Knöcheln auf den Tisch klopft, um sich zu verabschieden. Man redet ihn eben mit »Du, Krüger« an. Seit seiner Pensionierung, Krüger war Personalchef bei einer Frankfurter Bank, hat er hier in Mühlheim das Geburtshaus seines Vaters bezogen und arbeitet ehrenamtlich für den örtlichen Friedwald, der gleich hinter dem Sportplatz am oberen Ende des Dorfes beginnt. Merkwürdig genug, dass Krüger diese Seite des Dorfausgangs bevorzugt, den stillen Hochwald, unter dessen Buchenstämmen er den Leuten mögliche Grabstätten zeigt, und nicht die gegenüberliegende, wo der Golfplatz beginnt, den man einem Exbanker eigentlich eher als Aufenthaltsort für seine hart erarbeiteten Mußestunden zutrauen würde. Politisch steht er natürlich dennoch am anderen Ende der Skala als TK, und wenn die beiden ins Diskutieren kommen, fliegen die Fetzen. Was nichts an der gegenseitigen persönlichen Wertschätzung ändert. Denn Krüger ist ebenfalls Mitglied in der Triathlon-Abteilung des TUS Mühlheim (ja hat sie zusammen mit TK, Marthas verstorbenem Sohn und einem weiteren Sportfex überhaupt erst gegründet), und Erfahrungen wie den Sportplatz winterfest zu machen, sich mit dem Rad von Schmitten zum Sandplacken hochzukämpfen oder anderthalb Kilometer durch die Lahn zu schwimmen verbinden mehr, als irgendwelche Meinungen entzweien können.
Es ist vielleicht feige, aber es ist mir lieber, dass Krüger TK der Naivität zeiht, als dass ich es mir anmaße. Denn dass sein Partner und Freund und Spontigenosse A.S. Bernhard nach dreißig gemeinsamen Jahren, seit sie den Verein für Jugendarbeit in Bornheim gegründet haben, ausgebootet und aufs Abstellgleis geschoben hat, ist natürlich viel mehr als eine berufliche Niederlage und eine menschliche Enttäuschung. Der Skeptiker und Misanthrop würde es ein Lehrstück nennen.
Und da kommt er uns auch schon entgegen, aufrecht, das Haar in einer grauen Bürste, im kurzärmligen, karierten Funktionshemd, Shorts und Laufschuhen. Eine eckige Brille mit Goldrand. Krüger hebt die Hand zum Gruß:
»Ei, Bernhard. Des is awwer kaa Training!«
»Bin heute schon Rad gefahren, Krüger«, entgegnet TK.
Dass ich mir um unseren Schenken im Magierhaus Gedanken und ein paar Sorgen mache, versteht sich von selbst: Um ein offenes Haus führen zu können, braucht man ein Haus. Das Essen, das jeder, der hereinschneit, vorgesetzt bekommt, muss eingekauft werden, desgleichen der Elfer. Großzügigkeit braucht Mittel, und Großherzigkeit kommt aus der Selbstachtung, die wiederum daher rührt, dass man Arbeit hat und angemessen dafür bezahlt wird.
Die Gefahr ist immer, dass man solch einen Ort für selbstverständlich nimmt, für gegeben und unveränderlich, und ausschließlich am Wesen der Gastgeber festmacht anstatt an den komplizierten und unsichtbaren Mechaniken des Lebens, die die Existenz auch dieser Gastgeber bedingen. Denn ein solches Wesen ist eben nicht unveränderlich, und die wichtigsten Veränderungen kommen meist nicht aus ihm selbst, sondern von außen, über eine Veränderung der materiellen Basis, die alles ins Wanken bringen kann, was eben noch festgefügt schien.
»Wie is’ die Situation bei deiner Arbeit?« fragt Krüger. TK hat die Geschichte nicht für sich behalten, und im Bekanntenkreis wird eifrig und offen darüber diskutiert, was zwar nicht immer hilfreich ist, aber wenigstens nicht die Stickluft geheimgehaltener Bedrängnisse aufkommen lässt, und das ist an sich schon eine Erleichterung.
»Die Anwälte unterhalten sich«, sagt Bernhard.
»Da wer’n wenigstens zwei bei der Sach’ froh. Aber wie hats denn so weit komme’ könne’?«
Bernhard seufzt.
»Ei, lauf mer e bissi«, sagt Krüger. Das ist bei ihm als Einladung zum Gespräch zu verstehen. Ich hasse es, durch den Wald zu rennen. Ich brauche meine Luft zum Laufen, deswegen beteilige ich mich nicht an der Konversation im Rhythmus des gleichschrittigen Trabens über den weichen Waldboden.
»Mit einem Wort«, sagt Krüger nach einer Weile, »du hast nie die Machtfrage gestellt.«
»Nein, warum hätte ich auch sollen. Der ganze Verein war doch über all die Jahre auf flache Hierarchien und den Gedanken kollektiver Gemeinschaftsentscheidungen ausgerichtet. Macht hat da nie eine Rolle gespielt und sollte das auch nicht.«
»Und das ist genau der Punkt, wo du dich täuschst!« sagt Krüger schnaufend. »Wenn nicht explizit in festen Hierarchien, dann implizit in Form von individueller Exzellenz.«
»Exzellenz, hör uff!« lacht TK.
»Und vor allem füllt sich ein Machtvakuum immer sofort. Wenn einer die Macht abgibt oder ausschlägt, ist ein anderer da, der sie übernimmt. Aber denk doch mal nach: Wessen Idee war dieser Verein?«
»Meine.«
»Und wer hat ihn aufgebaut und ausgeweitet?«
»Ich. Aber nicht nur.«
»Und wer hatte die Ideen dazu?«
»Die kamen aus gemeinsamen Diskussionen.«
»Schon. Aber wer hat solche Diskussion eingefordert, angeregt und ihnen eine Richtung gegeben? Sei ehrlich!«
»Ich«, sagt Bernhard schweratmend und sein Lacher gleicht einem Husten.
»Und wer hat die Richtungsentscheidungen gefällt?«
»Immer gemeinsam im Kollektiv. Aber stimmt schon, ich habe die anderen schon meist in die Richtung gelenkt, die mir am besten vorkam.«
»Und deshalb bist du ja auch der Vorsitzende des Vereins gewesen.«
»Nie. War ich nie.«
»TK! Isch glaub’s net!«
»War mir nie wichtig.«
»Aber was für eine Position hast du denn dann innegehabt?«
»Gar keine. Mitarbeiter.«
»Aber du hast den Verein doch nach außen repräsentiert. Gegenüber der Stadt, dem Sozialamt, dem Jugendamt, was weiß ich?«
»Naja sicher, ich kenne die ja alle.«
»Bernhard, du bist naiv!«
»Mag schon sein. Aber warum ist es naiv, sich nicht in den Vordergrund zu drängen, wenn sowieso alle wissen, dass man den Laden schmeißt?«
»Genau deshalb, mein Lieber. Weil sich sonst jemand dahin drängt, der ihn eben nicht schmeißen kann, oder der ihn auch schmeißen kann, aber anders als du. Ich nehme doch an, dass dein Freund und Mitgründer, der dich jetzt rausgeekelt hat, der Vorsitzende des Vereins ist.«
»Ja, für den war das wichtig.«
Die Probleme hatten ganz unscheinbar begonnen. Vielleicht damit, dass A.S. vor einigen Jahren neben dem Verein eine eigene Entrümpelungs- und Umzugsfirma gegründet hat, die jugendliche Alkoholiker und Straftäter resozialisierte. Eigentlich ein tolles Projekt. Nur dass er, als im ersten Jahr die Liquidität fehlte, in die Vereinskasse griff, um das auszugleichen. Sie hatten das durchdiskutiert und die Summe dann in ein offizielles Darlehen umgewandelt.
»Kein Wunder, dass er einen Rochus auf dich hat!« sagt Krüger.
»Wieso denn er auf mich?«
»Weil er in deiner Schuld steht. Und weil du seine Schwäche und sein Fehlverhalten kennst und gerade nicht öffentlich gemacht hast. Und natürlich, weil er die Gelder hätte ganz bequem und legal verschieben können, wenn es alles sein Laden gewesen wäre.«
»Es war aber so lange alles gut, bis er mit der Überwachung anfing. Effizienzsteigerung. Monitoring! Wo dann kein Platz für Vertrauen und Selbstverantwortung bleibt.«
»Die gewiss jeder bis ins letzte Glied in jeder Minute geübt hat …«
»Krüger, jetzt wirst du zynisch. Wir sind alle Menschen und machen Fehler. Und das muss auch erlaubt sein. Jedenfalls fing A.S. dann mit Stichprobenkontrollen an, und es gab die ersten Abmahnungen statt eines Gesprächs. Und dann kam er mit der Idee, den Verein in eine GmbH umzuwandeln. Und erst dagegen habe ich offen opponiert.«
»Ohne dir die Machtmittel gesichert zu haben«, sagt Krüger. »Ich nehme mal an, da hast du dann auch deine erste Abmahnung bekommen. Aber weißt du, wenn du von der Wut und der Enttäuschung abstrahieren kannst, wird dir Folgendes auffallen: Dass die entscheidende Rolle bei alledem nicht der gewiss schäbige Charakter deines früheren Freundes spielt, den schenk’ ich dir. Sondern der Zeitpunkt und das Alter.«
»Wie das?« fragt TK und bleibt vor Verblüffung kurz stehen. Aber Krüger joggt im Stand und wartet, bis der andere sich wieder in Bewegung gesetzt hat, bevor er fortfährt.
»Hast du noch nie bemerkt, dass das der natürliche Weg aller jugendlichen, idealistischen Gründungen und Unternehmen ist? Sie fangen alle mit der alleinigen Konzentration auf die Sache an, das Ziel, den Stern am Horizont. Einigkeit herrscht, Jugend herrscht, da können die Hierarchien flach bleiben, die Einkünfte symbolisch, und die Diskussionen finden schnell zu einem gemeinsamen Ergebnis, und Macht ist ein Zwangsmittel, das nur Alte und Analneurotiker brauchen, und gleich sind wir sowieso und können im Kollektiv entscheiden, denn alle leitet uns die Vernunft.
Aber irgendwann merkt der Klügste oder Arbeitssamste oder Ehrgeizigste, dass es immer schon er war, der die Sache entscheidend vorangebracht hat, und jetzt wird er älter und will endlich auch persönlich etwas von dem Ganzen haben. Dass die Gleichheit aller Beteiligten eine fromme Illusion und Lüge ist und immer war, das fällt ihm jetzt langsam wie Schuppen von den Augen. Das machen das Alter und die Erfahrung und der Blick nach rechts und links. Irgendwann stellst du fest, du bist ein Individuum geworden, das ganz anders ist als die anderen, und du sagst dir: Jetzt muss es aber auch endlich mal um mich und meine Meriten gehen. Und mit Alter und Erfahrung steigt auch die Verachtung für die Mitläufer und Profiteure und die Nichtskönner und Faulenzer und Durchmogler. Oder wenn dir Verachtung ein zu scharfes Wort ist, dann die Unduldsamkeit für Schlamperei und Dummheit. Es wächst einem ein Bewusstsein für Rangunterschiede zu. Wir reden nicht von Menschenrechten, Achtung! Es geht nicht darum, einen netten Versager auszupeitschen, aber muss er unbedingt das Gleiche verdienen wie ich? Du bekommst ein Gefühl dafür, dass Gerechtigkeit, von der immer so viel die Rede ist, eigentlich das wäre, wenn der Bessere und Klügere und Fleißigere, derjenige, der die Verantwortung trägt und auf sich nimmt, auch den größeren Teil des Kuchens für sich beanspruchen dürfte. Nochmal: Nicht dass die anderen darben sollen. Nie und nimmer. Aber mitreden sollen sie nicht, wenn sie nichts verstehen und sich im Grunde ihrer Seele auch nicht dafür interessieren, gottverdammt!«
»Ja, so ungefähr hat A.S. wohl gedacht«, sagt Bernhard.
»Und zweifellos hättet ihr die GmbH zusammen gründen können, euch zu Geschäftsführern machen, die Gewinne teilen und der Realität endlich eine adäquate Struktur geben. Teilen und herrschen.«
»Ja«, sagt TK schweratmend. »Ja, aber das wollte ich nicht. Das kam mir wie Verrat vor an dem Grundgedanken der Unternehmung. Außerdem haben wir alle sehr ordentliche Gehälter bekommen, und ich hab’ auch beizeiten für eine erstklassige betriebliche Altersvorsorge gesorgt. Mehr brauche ich nicht.«
»Klassischer Denkfehler aller Utopisten der Machtlosigkeit. Zu glauben, es gebe einen endlichen Bestand an Bedürfnissen und alles, was darüber hinausgeht, sei Gier.«
Sie fallen beide endlich zurück in Schritt, denn wir sind wieder im Dorf und auf dem Weg hinunter zu TKs Haus.
»Ich will gar nicht mit dir darüber streiten, dass die Dinge die Tendenz haben, größer werden zu wollen, und dass nichts schwieriger ist, als sich mit einem Status quo zu begnügen. Worum’s mir geht, sind die menschlichen Schäden dieser Vergrößerungs- und Optimierungs- und Effizienz- und Kontrollwut. Weil sie so zutiefst unnötig sind. Weil wir fast dreißig Jahre bewiesen haben, dass man gute und sinnvolle Arbeit eben auch ohne Macht leisten kann.«
»Was du sagst«, meint Krüger, »erinnert mich an Utopia von Thomas Morus. Aber der logische Fehlschluss daran lässt sich in einen Satz fassen: There is no free lunch. Sowas wie kostenloses Mittagessen gibt es nicht.«
»Ich kann dir gleich das Gegenteil beweisen«, erwidert Bernhard.
»Ja, aber warte ab, wie du reagierst, wenn ich Geschmack daran finde und jeden Mittag bei euch vor der Tür stehe und es einfordere. Es gibt ein Grundprinzip, das überall wirkt, wo der Versuch gemacht wird, die Macht auszublenden. Es mag gelingen, Hierarchien, Eigentum und Geld abzuschaffen. Aber in dem Maße, in dem die Macht aus den hierarchischen Ungleichheitsverhältnissen verschwindet, kehrt sie durch die Hintertür zurück als strukturelle Gewalt. Es braucht ein rigides System der Überwachung, um sicherzustellen, dass alle sich an die Regeln der Gleichheit, Besitzlosigkeit und Brüderlichkeit halten. Das utopische System kommt nicht ohne drakonischen Strafenkatalog aus. Strafen zu können ist aber einer der Grundpfeiler von Macht. Und eine Quelle permanenter Gewalt. Deshalb lieber eine GmbH mit einem Chef als ein Kollektiv mit einem Revolutionstribunal, das den Eierdieb dann irgendwann einen Kopf kürzer macht, um ein Exempel zu statuieren. Der vermeintliche Verzicht auf Macht kann eine perverse Sache sein.«
Diese letzten Sätze hat Krüger auf dem Hof gesagt, wo er sich jetzt an den Tisch setzt, um ein Glas Wasser zu trinken. Hermann, der sich noch immer nicht von dort wegbewegt hat, hört sie und legt die Zeitung beiseite.
»Ich verstehe, was du meinst«, sagt er, »aber auf Bernhard bezogen, also auf den Einzelnen bezogen, will das nicht viel heißen. Gewiss, er hätte der Umwandlung des Vereins in eine GmbH zustimmen können, er hätte der Hierarchisierung des Betriebs zustimmen können, aber dazu hätte er ein anderer Typus sein müssen als er ist. Der Bernhard, der diese Dinge aus betriebswirtschaftlicher Logik und Eigeninteresse getan hätte, wäre eben ein anderer Mensch, eine andere Wesenseinheit als die, die hier sitzt. Oder besser: bei der wir sitzen. Und jener Bernhard wäre eben vielleicht gerade niemand, dem andere Werte durch den Kopf gehen als Macht und Effizienz. Mit der Konsequenz, dass beispielsweise ich hier nicht sitzen würde bei jenem Bernhard. Ich habe keinerlei Nutz- oder Tauschwert. Ebenso wenig Martha. Und noch ein paar andere. Die richtige Frage ist also nicht die, ob unser Bernhard naiv gehandelt hat und letztlich selbst schuld an seinem Schicksal ist, sondern die, welche sonstigen Auswirkungen auf das Leben anderer jener Bernhard hätte. Und da scheint die Waage doch sehr zugunsten des Unsrigen auszuschlagen.«
»Und ich wollte doch auch nichts anderes sagen«, wiegelt Krüger ab, »als dass er sich nicht grämen soll, weil er eben nicht Opfer menschlicher Niedrigkeit, sondern einer Strukturlogik geworden ist. Danke fürs Wasser, der Krüger muss los. TK





























