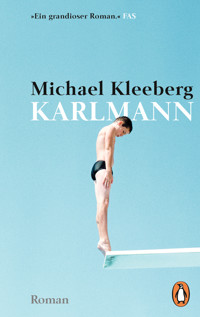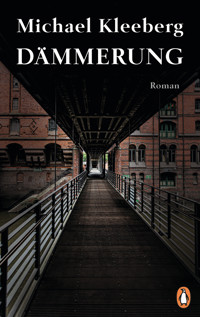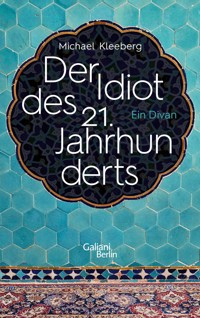16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Herkunft kann man verlassen – aber kann man der eigenen Zeit entkommen? Der Erzähler und seine Familie sind verreist – und der achtzigjährige Vater hütet das Haus. Nach der Rückkehr finden die Heimkehrer einen beunruhigenden Mailwechsel des Vaters, in dem es um ein Millionenvermögen geht, das nach Deutschland transferiert werden soll. Eine kurze Recherche macht klar: er ist einem Trickbetrüger aufgesessen, der ihn um seine letzten Groschen brachte. Nach dem Tod des Vaters wird das Ereignis zum Ausgangspunkt für Kleebergs Nachdenken und schließlich eine regelrechten Recherche über ihn. Einen, der in fast asozialen Verhältnissen in den Gassen Frankfurts aufwächst, sich als Vierzehnjähriger alleine durch das zerstörte Land schlagen muss; der sich nach dem Krieg ohne höheren Schulabschluss hocharbeitet, ein Einzelkämpfer, der sich jeder sozialen Zugehörigkeit verweigert. Ein Mann, der sich zeitlebens nicht von den politischen und gesellschaftlichen Prägungen seiner unter dem Nationalsozialismus verbrachten Kindheit zu lösen vermag. Ein Mann zwischen Vorurteilen, Anstand und Fluchtdrang. Idealistisch, naiv, selbstgenügsam, jähzornig. Einer, dem Geld und Status immens wichtig sind, der aber einmal Erreichtes auch immer wieder zerstört. Einer, der den Sohn zu etwas Besserem machen will, und zu dem der Sohn in ein Hassliebeverhältnis gerät, das von Rivalität, Rachegelüsten, aber auch tiefster Zärtlichkeit geprägt ist – und der im Lauf des Buches merkt, wie gespenstisch viele seiner Verhaltensweisen und Einstellungen denen des Vaters gleichen. Kleebergs Recherche ist ebenso schonungslose Analyse wie zärtliche Annäherung. Eine Reise durch die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Und eine schmerzhafte Selbstbefragung: Wieviel des Vaters steckt in mir, wieviel der Einstellungen seiner Generation prägten die Republik?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michael Kleeberg
Glücksritter
Recherche über meinen Vater
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Michael Kleeberg
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Michael Kleeberg
Michael Kleeberg, geboren 1959 in Stuttgart, lebt als Schriftsteller und Übersetzer (u.a. Marcel Proust, John Dos Passos, Graham Greene, Paul Bowles) in Berlin. Sein Werk (u.a. Ein Garten im Norden, Karlmann, Vaterjahre, Der Idiot des 21. Jahrhunderts) wurde in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt. Zuletzt erhielt er den Friedrich-Hölderlin-Preis (2015) und den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (2016).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Herkunft kann man verlassen – aber kann man der eigenen Zeit entkommen?
Nach dem Tod des Vaters wird das Ereignis zum Ausgangspunkt für Kleebergs Nachdenken und schließlich eine regelrechten Recherche über ihn. Einen, der in fast asozialen Verhältnissen in den Gassen Frankfurts aufwächst, sich als Vierzehnjähriger alleine durch das zerstörte Land schlagen muss; der sich nach dem Krieg ohne höheren Schulabschluss hocharbeitet, ein Einzelkämpfer, der sich jeder sozialen Zugehörigkeit verweigert.
Ein Mann, der sich zeitlebens nicht von den politischen und gesellschaftlichen Prägungen seiner unter dem Nationalsozialismus verbrachten Kindheit zu lösen vermag. Ein Mann zwischen Vorurteilen, Anstand und Fluchtdrang. Idealistisch, naiv, selbstgenügsam, jähzornig. Einer, dem Geld und Status immens wichtig sind, der aber einmal Erreichtes auch immer wieder zerstört. Einer, der den Sohn zu etwas Besserem machen will, und zu dem der Sohn in ein Hassliebeverhältnis gerät, das von Rivalität, Rachegelüsten, aber auch tiefster Zärtlichkeit geprägt ist – und der im Lauf des Buches merkt, wie gespenstisch viele seiner Verhaltensweisen und Einstellungen denen des Vaters gleichen.
Kleebergs Recherche ist ebenso schonungslose Analyse wie zärtliche Annäherung. Eine Reise durch die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Und eine schmerzhafte Selbstbefragung: Wieviel des Vaters steckt in mir, wieviel der Einstellungen seiner Generation prägten die Republik?
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: © photothek/FlorianGaertner
Lektorat: Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-30230-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motti
1. Kapitel Das Hans-im-Glück-Syndrom
2. Kapitel Ein Laokoon des Geldes
3. Kapitel Familienaufstellung
4. Kapitel Das Herz ist ein einsamer Jäger
5. Kapitel Rosebud
Bild des Vaters
»Hans, als er sie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freuden auf, kniete dann nieder und dankte Gott mit Thränen in den Augen, dass er ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihn auf eine so gute Art und ohne dass er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, von den schweren Steinen befreit hätte, die ihm allein noch hinderlich gewesen wären. ›So glücklich wie ich‹, rief er aus, ›gibt es keinen Menschen unter der Sonne.‹ Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war.«
Brüder Grimm, Hans im Glück, 1857
»Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben – und sie sind glücklich dabei.«
Adolf Hitler, Reichenberger Rede, 1938
1. KapitelDas Hans-im-Glück-Syndrom
In den Osterferien 2011 verbrachte ich mit meiner Familie zwei Wochen in Irland. Wie jedes Mal, wenn wir verreisten, hütete in dieser Zeit mein Vater bei uns ein, um sich um Hund und Katzen zu kümmern.
Obwohl es reiner Urlaub sein sollte, hatte meine Frau ihren Mailverkehr auf ihr Mobiltelefon umgeleitet, um auch auf Achill Island zumindest abends oder morgens einen kurzen Blick auf ihre Korrespondenz werfen und eventuelle dringende Schreiben beantworten zu können. Zu ihrem großen Verdruss funktionierte das aber nicht – ich weiß nicht mehr, ob es an fehlendem Netz lag oder irgendwelchen anderen Gründen. Nach einigen Tagen hatte sich meine Frau ins unabänderliche Offline-Dasein gefügt, es gab genug zu tun und zu sehen.
Kaum aber war unser Rückflug in Tegel gelandet, und 150 Menschen starteten im Gang stehend und auf den Ausstieg wartend ihre Telefone, ratterte – bildlich gesprochen – der Ertrag von 15 Tagen in ihre Eingangsbox. Dutzende und Aberdutzende in diesen zwei Wochen auf ihrem Computer empfangene Mails – jetzt wo der wieder in Reichweite war, standen sie alle auch zusätzlich im Telefon und waren, ihrer Aktualität verlustig, nur noch eine Plage.
Sehr bald jedoch sollten sich diese aufs Handy meiner Frau kopierten Mails als von entscheidender Wichtigkeit erweisen.
Wir waren am Dienstag nach Dublin geflogen, also war mein Vater am Montag nach dem Frühstück in sein Auto gestiegen und vor dem Mittagessen bei uns angekommen. Die knapp 300 Kilometer von Hamburg nach Berlin schaffte er, wie er sagte, locker in zweieinhalb Stunden. Er fuhr immer noch gerne schnell. Er verschwand mit seiner kleinen Reisetasche im Gästezimmer, zog sich bequeme Kleidung an, packte seinen Kulturbeutel im Badezimmer aus und setzte sich dann mit unserer Tochter, während ich den Tisch deckte, ins Wohnzimmer, um ihr rasch noch eine Geschichte zu erzählen. Im Januar war er 80 geworden, und er war, abgesehen von ein paar alterstypischen Zipperlein wie einer vergrößerten Prostata, bei guter Gesundheit.
Da der Teddy meiner Tochter auf dem Sofa lag, improvisierte mein Vater eine Geschichte über einen Teddybären. Das Mädchen wird erwachsen, und der Bär, der ihre Kindheit und Jugend miterlebt und behütet hat, wandert in den Wandschrank, wo er zehn entsetzlich einsame Jahre verbringt, bis eines Tages die Tür aufgeht, und ein neues kleines Mädchen, die Tochter seiner vormaligen Gefährtin, mit strahlenden Augen dem Teddy zu einem späten Glück verhilft.
Als ich rief: »Essen steht auf dem Tisch«, konstatierte ich lächelnd, dass mein Vater, wie früher, die Erzählung mit perfektem Timing zu Ende brachte.
Er erhob sich und sagte händereibend den Satz, den ich in meinem Leben vielleicht tausendmal von ihm gehört habe, wenn meine Mutter zu Tisch rief: »Doch wenn’s zum Esse’ gegange’ is, dann hat’s ihn gar grausam geeilt.« Das hörte sich komisch an, wenn man ihn sah, denn er hatte seit der Fresswelle in den frühen Sechzigern einen dicken Bauch, wenn ›dick‹ auch kein Wort war, das er benutzte, weder für sich noch für andere. Noch weniger das Wort ›fett‹. Mein Vater sagte ›proper‹ oder ›rundlich‹, selbst seine Schwägerin, meine adipöse Tante, die bei 1,63 Körpergröße zuletzt weit über 100 Kilo wog, nannte er liebevoll ›moppelig‹.
Sooft ich meinen Vater sein geflügeltes Wort zu den Mahlzeiten hatte sagen hören, hatte ich mir doch nie Gedanken gemacht, woher es eigentlich kam. Andere seiner Schablonen waren als Schiller- oder Goethe-Zitate zu erkennen oder hatten Frankfurter Lokalbezüge. Aber über dieses ging ich immer hinweg. Erst jetzt habe ich nachgeforscht und herausgefunden, dass es sich dabei um ein Lied des 1736 geborenen fränkischen Mundartdichters Johann Konrad Grübel handelt, Der Schlossergesell.
Ein Schlosser hat einen Gesellen gehabt, der hat zwar langsam gefeilt, doch wenns zum Essen gegangen ist, dann hats ihn gar grausam geeilt.
»Früher hast du nicht so traurige Geschichten erzählt«, sagte ich, als wir alle saßen, denn die Verbannung im Wandschrank ging mir nach.
»Das war eine schöne Geschichte!«, protestierte meine Tochter.
»Ich will ein paar davon aufschreiben und dachte, ich gebe sie dem Rydlewski. Vielleicht macht er was draus.«
»Darauf hat der gerade gewartet«, sagte ich. »Früher hast du auch nicht daran gedacht, etwas aus deinen Geschichten ›zu machen‹ oder sie zu verkaufen. Schon gar nicht ans Fernsehen.«
»Früher kannte ich auch niemanden, der beim Fernsehen ist.«
Rydlewski, einer seiner Versicherungskunden, von denen er auch mit 80 noch mehrere betreute, war Schauspieler und Drehbuchautor und gut im Geschäft.
»Du verkaufst deine Geschichten doch auch«, sagte meine Tochter zu mir.
Meine Frau grinste.
Den ganzen Tag lang ging mir nicht aus dem Kopf, dass der Bär trotz der zehn Jahre, die das Mädchen ihn weggesperrt hat, nicht verbittert ist, nur traurig, und am Ende keine Genugtuung empfindet, nur Freude.
Erst am Tag nach unserer Rückkehr – mein Vater war nach dem Frühstück abgereist, da er es ohne konkrete Aufgabe nie lange ohne meine Mutter aushielt und hatte angerufen, dass er gut zu Hause angekommen sei, die Wäsche war gewaschen, der letzte Koffer verstaut und die Computer gecheckt – ging meine Frau daran, die nun nutzlosen Mail-Doppels von ihrem Mobiltelefon zu löschen.
Kurz darauf kam sie aus ihrem Arbeitszimmer zu mir und sagte: »Deine Eltern haben ja merkwürdige E-Mail-Wechsel.«
Meine Mutter hatte vor ihrem 40. Lebensjahr angefangen schwerhörig zu werden. Spätestens seit ihrem 70. Geburtstag war sie de facto taub. Es war eine Form der Taubheit, eine Atrophie des Hörnervs, gegen die Hörgeräte nur wenig oder nichts ausrichteten. Ich hatte mir angewöhnt, in ihrer Gegenwart sehr laut zu sprechen, aber sie verstand mich trotzdem nur, wenn es ansonsten keine Nebengeräusche im Raum gab.
Nach 57 Ehejahren hatten meine Eltern natürlich Formen der Kommunikation und des gegenseitigen Verstehens gefunden, bei denen es auf das genaue Hören nicht mehr so ankam, aber gegenüber anderen Menschen isolierte der Zustand sie sehr, umso mehr, als sie nie in ihrem Leben auch nur einmal gesagt hätte: »Entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie nicht verstanden, ich bin etwas schwerhörig.« Stattdessen lächelte sie den Menschen verständnissinnig zu und antwortete gar nichts oder sagte etwas völlig Unpassendes oder behalf sich mit einer Höflichkeitsfloskel. Ich hatte in meiner Kindheit und Jugend darunter gelitten, dass die Menschen sie deswegen für arrogant oder hochnäsig hielten.
Was ich sagen will, ist, dass meine Mutter seit Langem nicht mehr telefonieren konnte, seit es aber E-Mails gab (zuvor hatten sie sich, waren sie getrennt, Faxe geschrieben, davor Briefe), tauschten die beiden Mails, um sich zu erzählen, wie der Tag gewesen war. Und während mein Vater bei uns wohnte, benutzten sie dazu den Account meiner Frau.
»Wieso merkwürdig?«, fragte ich.
»Da war die ganze Zeit die Rede von einem Captain Brooks oder so. Kennst du einen Captain Brooks? Und deine Mutter hat insistiert, dass dein Vater vor seiner Abreise ihren gesamten Mailverkehr löscht, weswegen er auf meinem Computer auch nicht mehr ist; aber alle Mails, die deine Mutter ihm geschrieben hat, sind auf meinem Handy.«
»Ihre typische Geheimnistuerei.«
»Sieh sie dir mal an. Ich hab nur kurz draufgeschaut, aber es klingt seltsam.«
Sechzig Jahre zuvor, als meine Mutter bei den Amerikanern gearbeitet hatte, kannte sie mehrere Captains, aber keiner von denen hatte Brooks geheißen. Ein Mann dieses Namens war ihnen nie begegnet, darauf konnte ich schwören, ich kannte den sehr überschaubaren Bekanntenkreis meiner Eltern durch die Zeiten. Blieb ein Versicherungskunde meines Vaters.
Neugierig geworden, ließ ich mir diese Mails meiner Mutter, die er alle säuberlich vom Computer meiner Frau gelöscht hatte, von ihrem Mobiltelefon auf meinen Mailaccount schicken und überflog sie von der neuesten bis hinunter zur ersten, am Tag unserer Abreise geschickten.
Der erste kryptische – oder zumindest merkwürdige – Satz meiner Mutter vom Tag vor unserer Rückkehr lautete: »Es ist 12 Uhr 14, gerade habe ich deine Mail gefunden, ich hatte schon ein paarmal nachgesehen. Ich wollte warten, bis etwas von unserem Freund kommt, aber bisher nichts. Bei der Gelegenheit: Lösche bitte alle unsere persönlichen Mails.«
Merkwürdig war nicht die Geheimnistuerei – meine Mutter hat selbst heute noch, tief in der Demenz versunken, die Angewohnheit, Zwei-gegen-eins-Konstellationen zu bilden: In ihrer Senioren-WG hebt sie mir gegenüber die Augen zum Himmel, um zu signalisieren, dass wir nichts mit den ›Leuten‹ zu tun haben, die sonst noch am Tisch des Gemeinschaftsraumes sitzen, sobald ich aber aufstehe und sie glaubt, ich sehe nicht mehr hin, hebt sie ihrem Nachbarn gegenüber ebenso die Augen und sagt, in ihrer Taubheit glaubend, ich könne sie nicht hören: »Das war mein Sohn, der Besserwisser.«
Als ich noch ein Kind war, war das dramatischer, denn sie verbrüderte sich immer einmal wieder mit mir gegen meinen Vater, und wenn ich ihn dann beleidigte, indem ich ihm die Schwächen vorhielt, über die sie sich mokiert oder beklagt hatte, wechselte sie sofort auf seine Seite und machte mir, zusätzlich zu den Ohrfeigen meines Vaters, auch noch Vorwürfe für meine Frechheit. Als ich mit siebzehn oder achtzehn zum ersten Mal das Wort ›double-bind‹ hörte, glaubte ich plötzlich einiges über unser Familienleben zu verstehen.
Diese harmlose Form der Abgrenzung, ihren Mailverkehr privat zu halten, war also nichts Besonderes, nein, merkwürdig war die Formulierung ›unser Freund‹. Sie konnte nur ironisch gemeint sein, denn meine Eltern hatten keine Freunde in dem Sinne, wie andere Menschen Freunde haben. Sie hatten auch niemanden in ihrem Bekanntenkreis, den meine Mutter jemals meinem Vater gegenüber einen Freund genannt hätte, ohne die Anführungszeichen gleich mitzusprechen.
Aus dem nächsten Brief ging klar hervor, dass etwas nicht stimmte. Und das Entscheidende und letztlich auch der Grund dafür, dass ich diese Geschichte aufschreibe und zum Ausgangspunkt weiterreichender Überlegungen nehme: Dass etwas nicht stimmte, war nicht nur mir nach einmaligem Lesen klar, es hätte eigentlich jedermann klar sein müssen, der bei Verstand war und nicht in einem absoluten Informations- und Kommunikationsvakuum lebte.
Die Betreffzeile über dem Brief meiner Mutter lautete: »Neue Mail von Brooks«
Im Brief selbst stand Folgendes:
»Lieber Werner,
eben habe ich die Mail gefunden. Ich versuche, sie zu übersetzen:
›Bitte wie ist die aktuelle Situation im Augenblick? Ich verliere die Geduld mit deiner gleichgültigen Haltung, die Sache zu einem Ende zu bringen. Dr. Morgan sagte mir, er könnte nichts tun, um das Geld zu beschaffen. Und die Box bleibt inUK, wenn du kein Geld schickst. Du kennst meine Situation jetzt. Wir sind einen langen Weg gegangen und haben so viel investiert. Ich sehe nicht ein, dass diese kleine Gebühr im Weg stehen soll, die Angelegenheit abzuschließen.
Bitte, du solltest dein Bestes tun und ihm das Geld schicken, sodass die Sendung sofort an dich ausgeliefert wird. (…)
Denke daran, du hast anfangs zugestimmt, diesen Deal mit mir zu machen, ich glaubte und vertraute dir, aber was ich jetzt von dir bekomme, ist nicht ermutigend. Lass mich nicht im Stich, sieh was du tun kannst, die Box vor Freitag nach Deutschland zu bringen.
Ich zähle wirklich auf dich, bin auch bereit, deinen Anteil zu erhöhen, sobald du das erledigt hast. (…)
Komm auf mich zu.
Roger‹
Sag mir, was du antworten willst (fuhr meine Mutter fort), ich übersetze es und maile es dir.
Gruß und Kuss, Ingrid«
Wie gesagt, nach der Lektüre dieses Briefes war mir klar, dass meine Eltern es mit einem Betrüger zu tun hatten, einer Betrugsmasche aufsaßen, weder einer neuen noch einer unerhörten, noch auch einer besonders cleveren. Es war eine Spielart des Vorschussbetrugs, auf Englisch scam, und seit Jahren unter dem Namen Nigeria-Connection bekannt. Eigentlich, hatte ich gedacht, wusste das jedermann. Meine Eltern aber offenbar nicht.
Was ging in diesem Moment der Lektüre in mir vor?
Der erste innerliche Ausruf war: Gottverdammt, wie kann man bloß so bescheuert sein?! Und sofort schämte ich mich wieder meiner Eltern, ihrer mangelnden gesellschaftlichen Geschmeidigkeit, ihrer kleinbürgerlichen Beschränktheit, ihrer sozialen Einsamkeit – all dessen, wofür ich mich mit sechzehn angefangen hatte zu schämen, als wir aus Böblingen in den gutbürgerlichen Hamburger Vorort umzogen und ich all die parkettsicheren Kinder erfolgreicher, kommunikativer Eltern kennenlernte.
Ich hatte mich ihrer 20 Jahre lang geschämt, im Grunde bis ich selbst eine Familie gründete und gar nicht so viel anders lebte als sie, nämlich im kleinbürgerlichen Kleinfamilienglück (recht genau nach dem Muster meiner eigenen Kindheit), da begann ich mich vielmehr meiner Attitüde zu schämen, auf die mich mein bester Freund sogar einmal ansprach, sodass ich aus allen Wolken fiel: »Es war peinlich damals, Michael, wie du deine Eltern behandelt hast. Schließlich waren es sehr sympathische Menschen, die alles für dich getan haben.«
Ich hatte jedenfalls angefangen, mich ihrer zu schämen und zugleich begonnen zu glauben, ich werde und könne alles anders und besser machen als sie: erfolgreich sein, smart sein, mich nicht für dumm verkaufen lassen, mich nicht unterbuttern lassen. Und genau dieses Gefühl: ›Das könnte mir nicht passieren‹ war jetzt wieder da.
Es war aber nicht das Einzige. Noch bevor ich anfing, mir Sorgen zu machen, kam zugleich mit der Verächtlichkeit auch die Schadenfreude. Das ist die Quittung, dachte ich. Das konnte ja nicht anders kommen, dachte ich. Recht geschieht es euch, dachte ich, und als ich das dachte, fragte ich mich, was ich eigentlich von ihnen erwartete, wenn ich ihnen das tatsächlich sagte.
Vermutlich erwartete ich, dass sie dann meine Überlegenheit anerkannten. Und diese Überlegung erkannte ich nur zu gut als die Rückseite meines lebenslangen Apportiertriebes, der am Anfang natürlich exklusiv auf meine Eltern gerichtet war: Ich liebte es, Exzellenz abzuliefern und dafür von ihnen bewundert zu werden, und als gute Herrchen (aber das war mir als Kind nicht klar) verlangten sie nichts von mir, bei dem es mit der Exzellenz schlecht ausgesehen hätte. Diese Lehre war dem Leben vorbehalten, das mir dann auch eine narzisstische Kränkung nach der anderen zufügte.
Wenn ich nicht zum Apportierhund geboren bin, dann wurde ich zu einem gemacht, und im Grunde habe ich diesen Drang nie verloren: Das meiste, was ich je getan habe, tat ich, um von einem unsichtbaren Publikum oder einem konkreten Gegenüber Lob zu bekommen: ›Feiner Hund!‹
Zugleich mit der Verächtlichkeit und der Schadenfreude, deren ich mich schämte, während ich sie empfand, war natürlich sofort auch die Sorge darüber da, wie tief sie bereits in diesem Betrugsmahlstrom versunken waren, und ein tiefes, trauriges Mitleid mit diesem isolierten, arglosen, gutgläubigen und naiven alten Paar, zugleich aber auch wiederum Ärger über ihre Motive. Wärt ihr weniger geldgierig und geldfixiert, wäre euch das nicht passiert. Andererseits hatten sie tatsächlich wenig Geld. Seit mein Vater in Rente war, stand ihnen das Wasser bis zum Hals wegen des noch immer nicht abgezahlten Hauses, an das meine Mutter sich klammerte wie an die Elendshaut der früheren Hoffnung auf gutbürgerliches Renommee.
Und weil ihre Dummheit eben nicht nur Dummheit war, sondern auch Lebenskampf, empfand ich noch etwas anderes, worüber ich mir aber erst sehr viel später klar wurde: eine tiefinnere Solidarität. Die Familiensolidarität der aufstiegsfixierten, haltlosen Kleinbürger, deren einziges Ziel, deren wichtigster Wert, deren Leitbild und Götze in dieser Gesellschaft das Geld ist, Gott Mammon. Wozu? Was damit tun? Zu welchem Ende? Ganz gleich.
Wie gesagt, mein Vater hatte viele geflügelte Worte parat, die er über die Jahrzehnte hin immer wieder verlässlich in gewissen Momenten zitierte. So wie den Spruch vom Schlossergesellen vor dem Essen, brachte er, wann immer es um Geld ging, den Anfang von Goethes Schatzgräber an, den er bezeichnenderweise an zwei Stellen falsch zitierte:
»Arm am Beutel, krank am Magen, schleppt’ ich meine alten Tage, Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut.«
Mein Vater, denke ich mir, ersetzte das Herz durch den Magen, weil er, als er das Gedicht kennenlernte, keine Liebessehnsucht litt, sondern Hunger. Und die langen Tage wurden vielleicht deswegen zu alten, weil er als jemand, der immer gerne arbeitete, keine Langweile empfand, dafür sehr wohl das Gefühl, über das Warten auf den Schatz alt geworden zu sein.
Ich höre noch den Klang seiner Worte, wenn er wie einen Stoßseufzer die Erkenntnis aussprach: Reichtum ist das höchste Gut! Es waren immer mindestens zwei Ausrufezeichen dabei.
Interessanterweise wurde das Gedicht nie bis zu seinem wie ich bis heute finde etwas heuchlerischen, pietistischen und biederen Schluss zitiert, der eigentlich eher zu Schiller gepasst hätte als zum Freigeist Goethe. Womöglich hatte mein Vater ab und zu auch die ›sauren Wochen‹ auf der Zunge, aber die ›frohen Feste‹ und ›abends Gäste‹ waren bei uns Mangelware gewesen.
Ich weiß nicht, ob mein Vater je so weit gegangen wäre, sich für einen Schatz mit dem Widersacher zu verbünden, hätte die Gelegenheit sich geboten – wobei – konstatierte ich mit schiefem Grinsen im Weiterlesen, im kleinen Maßstab hatte er ja genau das jetzt getan.
»Lieber Werner,
die Sonne scheint, in London ist es neblig und trüb, sicher wird der ›hochgeschätzte Diplomat‹ Morgan in die Westminster Abbey eingeladen sein zur Hochzeit. (…)
Mir fällt bei den Briefen von Morgan immer wieder auf, dass er Fehler macht und die Sprache primitiv ist. Ein hochgeachteter Diplomat? Na, ich weiß nicht … (…)
Hast du etwas von der englischen Hochzeit gesehen? Ich fand den Vater der Braut am sympathischsten, als er seine Tochter zum Altar führte, der Gesichtsausdruck: eine Mischung aus Stolz und Verlegenheit. Er hielt sich ausgezeichnet. (…)
Lieber Werner,
hier mein zweiter Versuch für den Brief an Brooks:
I have no indifferent attitude. Is it so difficult to understand that I have used all my possibilities? I will not get money from the bank or from relatives whom I owe 7500. I don’t have the money!
(Ich schlug die Hände überm Kopf zusammen. Das war die erste konkret genannte Summe. Und es war für meine Eltern, die seit Jahren nicht mehr in Urlaub fahren konnten, ein Riesenbatzen Geld. Der flehende Ton gegenüber jemandem, der in Wirklichkeit gar nicht existierte, zerriss mir das Herz. Ich musste die beiden einzigen relatives sofort anrufen. Hatte mein Vater sich das Geld von seinem Bruder gepumpt oder von der kleinen Schwester, was reichlich ironisch gewesen wäre, weil Elfriede immer das ärmliche Sorgenkind der Familie gewesen war, auf das die beiden erfolgreicheren Brüder naserümpfend und verächtlich herabsahen?)
The ›little sum‹ of 3200 was due after a delay for which Dr. Morgan was responsible. How much has accumulated in the meantime? Dr. Morgan should get a written insurance that after that payment the consignment will be handed to him without further delay and costs. You and Dr. Morgan know that there is money in the box – I don’t! It should not be a problem to raise the necessary sum from friends if they know they get a good interest (I am a pensioner and I don’t have the income which a ›highly esteemed diplomat‹ should have).
Den letzten Satz kannst du weglassen. Alles andere ist so wie du willst.
Gute Nacht, Ingrid«.
Darunter stand ein Originalbrief von Brooks:
Hello Werner,
Please what is really going on? Have you sent the money to Dr. Morgan? According to him you are responsible for his inability to deliver you the consignment. I am losing patience with this whole situation. I must tell you that I am totally unhappy, this is so unbearable.
I want to hear from you as soon as possible. You seem to have forgotten what is involved here. Please that money is my life so you dare not joke about it. Very soon I’ll be leaving here for Europe without getting my dream realized. Please be reasonable and bring this matter to this long awaited successful end.
Regards,
Roger.
Ich sah meine Mutter vor mir, konzentriert auf ihren Anteil an der gemeinsamen Mission Geld, an die sie gewiss nur halb glaubte – ich weiß nicht genau, wie lange das Vertrauen in die Fähigkeiten meines Vaters in ihr schon erschüttert war –, jedenfalls zog sie ihre einzige Befriedigung aus der Tatsache, ein besseres Englisch zu schreiben als der hochgeschätzte Diplomat Morgan und dieser vermeintliche Roger Brooks, vor denen mein Vater sich erniedrigte, ohne es zu bemerken oder ohne dass es ihm etwas ausmachte, oder die Erniedrigung still herunterschluckend. Warum zählte sie nicht eins und eins zusammen? Warum schloss sie aus dem offenbaren Pidginenglisch des Betrügers nur auf ihre eigene Überlegenheit ihm und meinem Vater gegenüber und schöpfte keinen Verdacht? Und wenn sie Verdacht schöpfte, warum versuchte sie nicht, meinen Vater von seiner fixen Idee abzubringen, er könne mit ein, zwei kleinen Zahlungen auf seine alten Tage endlich zum Multimillionär werden?
O die unschönen Erinnerungen, die diese Lektüre wachrief! Meine Mutter, die mir kopfschüttelnd und seufzend, zwinkernd, augenrollend und verschwörerisch die Schwächen und Fehler meines Vaters aufzählte und woher sie rührten, sodass ich, als ihr Echo und vermeintlicher galanter Verteidiger – ich mochte zehn Jahre alt sein oder zwölf – bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit meinen Vater provozierte: »Du hast ja nur Volksschule« oder »Du kannst ja noch nicht mal Englisch«. Und wie seine Augen dann basedowartig anschwollen, während er zwischen den Schlägen keuchte: »Und du bild dir mal nichts auf dein Gymnasium ein. Du kannst gar nichts. Du weißt gar nichts. Du bist gar nichts.«
Und wie meine Mutter dann bleich und erschüttert in meinem Zimmer erschien, wo ich vor Wut und Schmerz und Hass weinte und mir vorwurfsvoll sagte: »Dein Vater musste wieder eine Bellergal nehmen, weil er sich so aufgeregt hat, wie böse du warst. Du solltest dich bei ihm entschuldigen.«
Meine ganze Kindheit über lag (ich forschte heimlich nach) permanent eine angebrochene Schachtel Bellergal in seiner nach Holz und Aftershave duftenden Nachttischschublade neben einer Packung London-Gefühlsecht-Kondome … Genug davon!
Wobei: Herrschten Frieden und Eintracht im Haus, konnte mein Vater diese Dinge selbst ironisieren und zitierte dann gerne aus dem Zigeunerbaron: »Ja das Schreiben und das Lesen sind nie mein Fall gewesen …«
»Lieber Werner,
ich bin mir nicht sicher, was zu tun ist. Ich trau’ der Sache einfach nicht. Es ist ja immer wieder dasselbe. Selbst wenn du das Geld hättest, gäbe es wieder Probleme mit dem Transfer, und schon wäre die Frist wieder verstrichen, und er hätte eine neue Ausrede und Forderung. Hat er überhaupt mit Brooks gesprochen, von dem hört man ja auch nichts nach unserer letzten Mail. Wenn du diesen Vorschlag machst, weißt du ja immer noch nicht, ob die Kiste dann wirklich geliefert wird, und du bist wieder einen Tausender los. Weder Morgan noch Brooks reagieren je auf irgendwelche Vorschläge, die du machst oder jemals gemacht hast. Die ganze Sache fängt immer wieder von vorne an. Man kann ihnen ja vielleicht Geld versprechen (nach deinem Vorschlag) und gleichzeitig sagen, wenn es nicht akzeptiert wird und die Box nicht umgehend ausgeliefert wird, übergibst du die Sache dem Anwalt, der sich darum kümmern wird. (Du musst das ja nicht tun, nur sagen, überlege mal, was der Schuft dir schon an Drohungen an den Kopf geworfen hat.) Durchdenke die Sache nochmal, ich überwache den Computer.
Gruß«
Dazwischen hatte sie immer wieder genug von dem Thema und schrieb über anderes:
»Lieber Werner,
gerade habe ich deine Mail gefunden, vielen Dank. Hier ist es sonnig, aber windig und kühl. Du könntest zu deinem Kotelett ein paar Bratkartoffeln machen, wenn du keinen Salat oder Gemüsekonserven hast. Heute Abend gibt es im Fernsehen einen Münsteraner Tatort. Gestern wollte ich im Südwestfunk eine Sendung über die besten Grand-Prix-Lieder aller Zeiten ansehen, habe aber bald aufgehört, denn wie gewöhnlich haben viele Leute ihren Mist dazu erzählt, was keinen interessiert, von den Liedern kaum etwas, immerhin – wenn auch kurz – Domenico Modugno mit Volare. Ich habe dann noch kurz Wetten dass angesehen, dort war ein Auftritt der (ostdeutschen) Band Silly, deren Sängerin Anna Loos ist. Sie sang mit ihrem Mann, der auch sehr gut ist (Liefers), da fragt man sich, warum solche Leute nicht zu dem Grand Prix geschickt werden anstatt die dümmliche Lena.
Viele Grüße und Küsse,
Ingrid.«
Irgendwann verlor ich den Überblick über die Reihenfolge der Briefe, da es mehrere Dopplungen gab, aber dann entdeckte ich noch ein Schreiben, das von Dr. Morgan kam:
»Lieber Werner,
gerade habe ich eine Mail gefunden, sie war von 22.20 Uhr, ganz versteckt, weil die Mails alle nicht sortiert sind, obwohl ich die ganze Liste durchgesehen hatte.
Text: Sie und Capt. Brooks müssen das ausmachen, weil ich schon so viel in der Vergangenheit investiert habe und nicht noch mehr will. Sie müssen das mit Capt. Brooks teilen und bis spätestens Dienstag mit der Zahlung kommen. Ich werde Ihnen morgen die Details für die Zahlung senden.
Dr. Morgan.
Ich finde das unverschämt wie immer, er hat doch Kontakt zu Brooks. Also, was ist jetzt?
Gruß und Kuss Ingrid«
Den Rest überflog ich nur noch. Ich hatte auch genug gesehen. Aber anders als in den ersten Momenten, in denen der Briefwechsel mich elektrisiert hatte, als wäre ich ein Detektiv und kurz davor, einen Fall zu lösen, war ich jetzt wie gelähmt. Der Gedanke, meinen Vater sofort anzurufen, war unerträglich. Ich war völlig hilflos. Ich wusste nicht, wie ich vorgehen sollte. Ich rief meine Frau um Hilfe und erklärte ihr alles beim Wein. Das half, denn im Erzählen wurde es schon wieder komisch.
»Was soll ich ihm um Himmels willen sagen?«
»Du sagsts ihm wie es ist. Dass er einer Betrugsmasche aufgesessen ist. Und dass es keinen Captain Brooks und keinen Dr. Morgan gibt.«
»Wahrscheinlich spreche ich zuerst mal mit Friedrich und Elfriede, um herauszufinden, wer ihm das Geld geliehen hat«, sagte ich kopfschüttelnd. »Ich meine, er hat schließlich keins. Er muss, seit er das Lebensversicherungsgeld in der 2001er-Krise mit irgendwelchen Risikoanlagen bis auf den letzten Pfennig verloren hat, jeden Monat einen Tausender zu seiner Rente dazuverdienen, um das Haus abzahlen und dürftig leben zu können. Was glaubst du, warum er mit 80 immer noch arbeitet?«
»Klar braucht er das Geld, aber er arbeitet auch, weil es ihm Spaß macht, und weil er es gut macht. Es macht ihm ja sogar Spaß, meine Steuerunterlagen zu machen. Er hilft und er berät eben einfach gerne.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Deutschlands einziger ehrlicher Versicherungsvertreter. Zumindest der einzige, dessen Kunden im Schadensfall wirklich manchmal etwas von ihrer Versicherung kriegen.«
»Da würde er wieder aufbrausen, wenn du so übertreibst. Aber wenn du mit ihm sprichst, mach es freundlich und einfühlsam. Nicht so von oben herab wie sonst und ohne Vorwürfe. Die wird er sich dann schon selbst machen.«
»Warum sagst du mir das. Ich bin immer freundlich und einfühlsam.«
Meine Frau verzog das Gesicht.
»Schmiers ihm nicht so rein mit so einer besserwisserischen Attitüde.«
»Ich glaub, ich geb ihm noch eine ruhige Nacht.«
»Du meinst dir. Aber es hat keinen Sinn, davor wegzulaufen. Du hast schon die Pflicht, ihnen zu helfen, bevor noch mehr passiert.«
»Ja, sicher«, sagte ich halb ärgerlich, seufzte und fragte dann:
»Was sind das für Leute, die auf so eine Masche reinfallen?«
»Es müssen zum einen Menschen sein, die um jeden Preis zu Geld kommen wollen –«
»Ja«, unterbrach ich sie, »und denen das auf dem üblichen Weg über eine Arbeit nicht oder nur unzureichend gelingt, sodass sie auf die verzweifeltsten Ideen kommen …«
Und vor meinem inneren Ohr hörte ich die Zeilen:
Und zu enden meine Schmerzen,
Ging ich einen Schatz zu graben.
Meine Seele sollst du haben,
Schrieb ich hin mit eignem Blut.
»Und zum anderen«, fuhr meine Frau fort, »sehr isolierte, sehr einsame Leute. Ich meine, wie du schon sagtest: Hätten sie irgendwen gefragt, deine Eltern, hätte man ihnen sofort gesteckt, dass es sich um ein Betrugssystem handelt.«
Ich nickte und überlegte.
»Geldfixiert und sozial autistisch. Typisch, dass er offenbar weder Elfriede noch Friedrich gesagt hat, wofür ers will, wenn er einen von ihnen um Geld bat. Aber eben auch schicksalsgläubig. Es sind Menschen, die im Guten wie im Schlechten überzeugt sind, dass das Leben gerade für sie das Außergewöhnliche bereitstellt, das es anderen vorenthält. Wenn ihn ein vermeintlicher englischer Diplomat anschreibt und ihm ein paar Millionen in Aussicht stellt, würde ein normaler Mensch schon allein deswegen misstrauisch werden, weil er sich sagt: Solche Glücksfälle passieren Menschen wie mir nicht. Bei meinem Vater ist es genau umgekehrt. Es hat ihn vermutlich keine Sekunde lang wirklich gewundert, dass man ihm fünf oder zehn Millionen anbietet. Er hat sich höchstens gefragt, warum es so lange gedauert hat.«
»Du sagst das mit einer Gewissheit, als würdest du von dir sprechen«, sagte meine Frau.
Ich starrte sie an. Dann nickte ich. »Das tue ich vielleicht auch.«