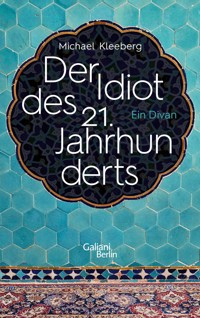Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorspiel
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Copyright
Geheimagent, Liebhaber, hochstapelnder Alchimist und schließlich kaiserlicher Gesandter - Theodor Neuhoff läßt sich von den Wellen des Geschicks durch ganz Europa tragen, weiß zu parlieren, zu brillieren und zu blenden. Und wird am Ende Opfer der eigenen Selbstüberschätzung. Als er sich - überzeugt, die Politik sei ein Spiel - im April 1736 von korsischen Aufständischen zum König ausrufen läßt, ist sein Untergang besiegelt. Als »König eines Sommers« geht er in die Geschichte ein und stirbt schließlich völlig verarmt in England.
MICHAEL KLEEBERG, 1959 geboren, wuchs in Böblingen und Hamburg auf, zog nach Rom und Amsterdam, ging 1986 nach Paris und lebte dann als Autor und Übersetzer in Burgund. 1996 erhielt er den Anna-Seghers-Preis, 2000 den Lion-Feuchtwanger-Preis. Er wurde zum Mainzer Stadtschreiber 2008 ernannt, im selben Jahr wurde er mit dem Irmgard-Heilmann-Preis ausgezeichnet. Der Autor lebt heute in Berlin.
MICHAEL KLEEBERG BEI BTB: Karlmann. Roman (73923)
»Flüchte du, im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten.«
Johann Wolfgang von Goethe, Westöstlicher Diwan
Für P.
Vorspiel
Die Bühne ist dunkel und leer.
Schließe ich die Augen, dehnt sie sich zu einem Universum. Die feuchte, von winzigen Moosen rauhe Fläche unter meiner Hand wird zur Reliefkarte meiner Freiheit, und mit den Fingerkuppen taste ich, blinder Odysseus, die Kontinente ab, die Isthmen und Flußdeltas, die Inseln und Ebenen und Hochplateaus, zu denen die Reise meiner unschuldigen Träume führt.
Mein Gedächtnis gleitet, ein kreisender Adler, so weit oben durch den Äther, daß es nur die Verwerfungen des Zeitalters wahrnimmt, nicht die Beute meines eigenen Lebens. Oder gleicht es eher einer Fledermaus, die torkelnd durchs Gewölbe meiner Vergangenheit flattert und gierig und erfolglos nach den wenigen reuelosen Erinnerungen schnappt?
Licht!
Majestät wünscht Licht!
Licht kommt!
Ein heller Schimmer läßt Stalagmiten und Stalaktiten aus der schwarzen Unendlichkeit wachsen. Schritte schrammen über Stein. Wo das Kerzengeflacker hinfällt, schichtet die Leere Mauern auf. Wogende Schatten auf den immer näher rückenden Wänden künden die herbeigetragenen Leuchter an.
Ich habe mich immer zuviel für mich interessiert, aber bei Gott, ich bin ein Thema, das mehr Interesse verdient als andere.
Jetzt sind sie aufgestellt, der lichtgeborene Stein wuchert als enges Gewölbe bis unter meine Hand. Die moosige Landkarte der Phantasie unter meinen Fingern erlischt.
Ich habe alles verloren bis auf die Hoffnung, die ist so hartnäckig wie die Läuse, und ich werde mir den Schädel der Illusionen rasieren müssen, um sie endlich loszuwerden.
Musik!
Majestät wünscht Musik!
Eine schwere Holztür fällt ins Schloß. Die hundert Flämmchen zittern und rußen. Eisenbeschläge oder ein Schlüsselbund klappern.
Die Musiker sind bereit!
Ein tief gestrichener Summton löst sich aus der Mauer, strömt durch meine Hirnschale, bricht sich an der Rückwand und flutet zurück. Eine Sirenenstimme geistert unter der Gewölbedecke entlang, sinkt herab und schmiegt sich um das Baßgebrumm, dann wird beides von schrillem Lärm verschluckt, der sich wie auf geheimen Befehl zu einem einzigen Ton verengt und wieder auseinanderplatzt in Celloschnurren und hysterische Geigentriller, Trompetenfanfaren, Flötengesirr und den Brunftruf des Fagotts. Ein im Gewölbe gefangener Wirbelsturm braust auf und legt sich wieder.
Gestühl für den Gast!
Majestät wünscht einen Sessel für den Gast!
Ich hatte immer Angst. Angst vor der Welt. Angst vor dem Tod. Angst vor dem Stillstand und der Veränderung. Angst vor den Menschen und vor allem vor ihrer Abwesenheit.
Sessel kommt!
Das Möbel wird herbeigeschleppt und abgeklopft, daß der Staub im Kerzenlicht tanzt und die Troddeln flattern. Im Gegenlicht wirft das Ding einen Schatten wie ein Schafott.
Mein Thron!
Majestät wünscht ihren Thron!
Der Thron kommt!
Wieder die schlagenden Türen und über den Steinboden scharrenden Füße. Ein Bärtiger mit fleckigem Wams und strähnigem Haar trägt den zerkratzten hohen Stuhl über dem Kopf, so daß die gedrechselten Füße, von denen das Blattgold blättert, wie ein Geweih in die Luft ragen.
Mein lieber William, stell ihn hier auf.
Der Gehörnte holt auch das Essen aus der Küche, ein bißchen Freundlichkeit ist also gewinnbringend angelegt. Die Kissen aus Samtbrokat sind zerschlissen, die Farben verschossen, zwischen den Bronzenieten sieht es verdächtig nach hervorquellender Holzwolle aus. Aber sobald ich darauf sitze, ist auch dieses Wrack ein Thron.
Spielt!
Vier Stakkatoakkorde, und schreitend und trabend setzt die Tafelmusik sich in Bewegung. Ich spähe ins Vorgewölbe, wo mein Schreibtisch vor der vergitterten Luke steht, dem engen Sonnentrichter. Die Musiker stehen so dicht, daß sie im Gegenlicht eine dunkle Welle bilden, auf der wie Schaumkrönchen die gepuderten Perücken nicken und stäuben. Jetzt fängt ein weit ausgreifender Bogen das Kerzenlicht auf und schimmert wie eine Angelrute in frühester Morgensonne.
So hell ist es hier selten. Unglücklicherweise kann ich mich genauer sehen, als mir lieb wäre. Die dicken, knorpligen Gelenke, die verkrümmten letzten Fingerglieder. Beinahe eine Klaue. Und die Gelenke schmerzen, als zöge man sie mit Zangen aus ihren Pfannen.
Dabei war ich einmal ein schöner Mann.
Eine Psyche!
Eine was?
Herr im Himmel, den hohen Spiegel, du Tropf!
Den Spiegel für Majestät!
Die Psyche, mannshoch, in einem doppelten Kirschbaumrahmen, der innere ist über die Querachse des äußeren schwenkbar, wird herbeigetragen. Die Kerzen verdoppeln sich, schwanken, gleiten vorüber, verschwinden, tauchen wieder auf und neigen sich, ohne zu tropfen.
Stellt sie so, daß man sich von beiden Sesseln aus darin sehen kann und verschwindet.
Der Kerl im Spiegel schaut mich an wie ein verwachsener, schwachsinniger Onkel, den man vor den Gästen verleugnet, aber nicht aus dem Haus gibt, weil man das Geheimnis gemeinsamer Untaten mit ihm teilt. Das Haar ist ergraut und nicht mehr sehr dicht, kurzgeschoren, um den Läusen keine Winterstatt zu gewähren. Ein hartes Gesicht, muß ich sagen, keine Spur von Altersweisheit (allerdings ist auch der Spiegel nicht von erster Qualität). Trotzdem liebe ich es mit zärtlichem Mitleid wie einen alten Schoßhund, der nur noch auf dem Schaffell liegt und das Wasser nicht mehr halten kann. Es ist ein Gesicht, das keine Hoffnung mehr zuläßt auf irgendeine Zukunft.
Dabei habe ich immer auf etwas gehofft, an etwas geglaubt, über uns, das die Geschicke lenkt. Wenn aber wir Menschen selbst alles bewegen müssen in diesem Leben und nicht der Allmächtige, dann kann einen keiner freisprechen als man selbst.
Die Verantwortung, die in dieser Leere aufschimmert, bis zum Grunde durchzudenken, wäre eine Aufgabe, für die ich jetzt zwar Zeit hätte, aber immer noch ebensowenig Lust wie je zuvor und auch nicht genügend analytischen Verstand. Da ist dieser blinde Fleck, dieses Flimmern und Verschwimmen, sobald ich mich der Haut eines Gedankens nähere, oder, nebenbei gesagt, der einer Frau.
Ich gestehe, ich habe nie über etwas anderes nachgedacht als über mich selbst. Ich bin geschwätzig, aber brillant.
Wichtiger als alles Nachdenken ist ohnehin das Geld, ich weiß, wovon ich rede. Ein gedeckter Kreditbrief gleicht einer eigenen Loge im Theater: Die Katharsis ist bezahlt, und man kann schon in der Pause gehen, um rechtzeitig beim Souper zu sein.
Ich blicke wieder auf die Psyche, aber jetzt sehe ich dort das Gemälde und kann die Augen schließen. Es soll das letzte sein, was ich sehe, und ganz zum Schluß werde ich es verstehen.
Da ist die gewitterverhangene, sonnige Landschaft, die ich zum ersten Mal in Venedig erblickte. Am rechten Flußufer die das Licht abstrahlenden Häusermauern, darüber der Himmel, grün vor Spannung und Ballung, und ein erster Blitz zuckt aus den Wolken. Im Vordergrund die junge Schönheit, nur ein Tuch um die Schultern, die ihr Kind säugt. Ihr leicht abgespreiztes linkes Bein ist im Knie gebeugt, und der Fuß streicht im Versuch, den Körper abzustützen, wie ein Perlmuttkamm durchs Gras. In heiterer Gleichmut blickt sie den Betrachter an, oder besser: durch ihn hindurch.
Wen sie nicht ansieht, das ist der Wanderer, der Stadt und Gewitter hinter sich läßt, im Gehen innehält, sich auf seinen übermannshohen Stab stützt und lächelnd zu ihr hinüberschaut. Er trägt ein weißes Hemd und eine offene, rote Schaube darüber. Seine kurzen Pluderhosen sind reich gemustert, seine rechte Hand streichelt sinnend den Wanderstab. Die Spannung, der Abstand zwischen den beiden, in die der Blitz leuchtend fährt, schreit nach einer Auflösung wie ein disharmonischer Akkord.
Erster Teil
»Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment.«
Pascal
Erstes Kapitel
Es herrschte Geselligkeit im Hause Pujol. Die Eichentür im Erdgeschoß, das die Kontorräume beherbergte, stand offen, gemietete Fackelträger leuchteten den Eintreffenden heim, als ob’s dessen bedurft hätte bei all dem Lärm und den Düften, die das spitzgieblige Haus verströmte. Die Glocke ging ohne Unterlaß, und das Mädchen oben auf dem Treppenabsatz hielt die Arme auf und nahm Mäntel, Umhänge und Hüte in Empfang.
Zwischen der Küche, wo Schweine und Fasane brieten und Pasteten garten, und dem Saal war ein stetes Kommen und Gehen der Aufwärter, deren schwankende Silbertabletts voller Hühnchen und Kuchen, Quiches, Weinkaraffen, Gläser und Bierhumpen spanischen Galeonen glichen, die von korsarischen Händen schon leergeplündert waren, bevor sie noch ihren Bestimmungsort erreichten.
Gelbgrüne Lichtsprenkel aus den Butzenscheiben scheckten den weiten, hohen Raum, Falbalas schabten übers geschrubbte Parkett, Rhingraves raschelten, wenn jemand sich verstohlen zwischen den Beinen kratzte, fächelnde Damen gluckten zusammen, pfeifeschmauchende Männer postierten sich vor dem Kamin. Wo stehen heut’ die Preise für Wolle aus Verviers? Ist die Belagerung Brüssels endlich aufgehoben? Habt ihr die Italiener schon gesehen? Zu teuer!
Ein spanischer Beamter brütete würdig und schwarz auf einem Stuhl, dessen hohe, mit Schnitzereien verzierte Rücken- und Armlehnen ihm die Flanken und den Nacken freihielten, zwei französische Obristen sowie eine Handvoll Großbauern aus dem Hennegau und dem Limburgischen repräsentierten das Geschäft, mehrere Prälaten und Theologieprofessoren aus der Stadt den Geist.
Pujol, der mit Tuch und Textilien handelte, aber auch für das französische Heer fouragierte und es mit Stiefeln, Mänteln, Musketen und Pulver versorgte, thronte am Kopfende des größten Tisches, sprach den vor ihm ausgebreiteten Speisen herzhaft zu und erklärte seinem Nachbarn mit einer Saal, Gemälde, Draperien, Möbel, Krüge, Schnitzfiguren umfassenden Geste, die über der Wachtel auf seinem Teller zum Stillstand kam, seine Liebe zu den Dingen, zu dem, was um ihn war, was man sehen, berühren, anfassen, riechen und schmecken konnte und was ihm gehörte.
Er war ein rotwangiger, grauhaariger Mann in den Fünfzigern, der einen nach oben gezwirbelten Schnurrbart, dessen Spitzen seine schweren Tränensäcke kitzelten, mit einem kleinen fussligen Ziegenbärtchen unter der fleischigen Unterlippe auspendelte, angetan mit einer schwarzen Prunkjacke, die mit farbigen, Blumenkörbe, Rankenwerk und überquellende Füllhörner darstellenden Stickereien verziert war. Über den Revers breiteten sich, als schliefen auf seinen Schultern zwei friedfertige weiße Tauben, die Spitzen des seinen Hals bis unters Kinn umschließenden Kragens, den, da der Hausherr zugleich aß und redete, mehrere Soßenspritzer verunzierten.
In der Mitte des Saals thronten auf der Querstange eines meterhohen Pfostens zwei große Papageien, ein roter und ein blaugelber Ara, deren Schwanzfedern bis zum Boden reichten, goldene Kettchen um ihren rechten Fuß, die sie am Aufflattern hinderten. Die schräggeneigten Köpfe ruckweise von links nach rechts und wieder zurückdrehend, beobachteten sie mit ihren regelmäßig blinzelnden Äuglein das seltsame Treiben.
Pujol hatte die beiden Vögel als Geschenk aus Übersee erhalten, bei Empfängen ließ er sie aus dem Bauer holen, in dem sie wochentags dahinvegetierten, und sie wurden begafft wie gefangene Negerhäuptlinge. Der Kaufmann betrachtete sie mit demselben etwas schmatzenden Genuß wie die anderen Einrichtungsgegenstände seines Heims und mit einer eigentümlichen Mischung aus Ehrfurcht und Verachtung.
Selbst nach Stunden noch glichen die Tiere sich nicht dem schwerblütigen Dekor an und blieben ein schriller Farbtupfer aus einer fremden Welt. Den Blick ihrer Knopfaugen überwachend, der leer war von der Schwermut der Gefangenschaft, empfand der Hausherr eine leise Abscheu wie gegenüber allem und jedem, das von ihm abhängig war und ungleich schwächer als er selbst, aber einer höheren Sphäre entstammte. Das bunte Kleid der Papageien wirkte wie ein hilfloser Protest, um so unleidlicher, je auftrumpfender er in seiner Sträflingsautonomie den Hausherrn provozierte.
Jetzt kniete ein junger Mann sich zu den Vögeln und geriet ins Blickfeld Pujols, dessen Augen und Mundwinkel sich nicht bewegten. Er hob den Zeigefinger, der rote Ara öffnete den Schnabel und sagte: Al-fons ist scheen! Und der blaugelbe fügte hinzu: Al-fons ist serr scheen!
Pujol nickte stumm. Man konnte den Viechern schwerlich widersprechen. Der braunhaarige, in moirierendes Schwarz Gekleidete wirkte inmitten der anderen Gäste wie ein Quecksilberkügelchen zwischen Bleimurmeln. Er war jünger als die meisten, sein anmutiges Gesicht eine Oase zwischen all den warzenübersäten, blatternarbigen Wüsteneien, zwischen den Kolbennasen und Kropfkinns, den Schwarten-Nacken und unreinen Augäpfeln. Auch sein Gelächter, seine graziösen Bewegungen schieden ihn von den Männern, deren Finger dazu dienten, Geld zu zählen oder Erde an den Mund zu heben, um ihre Fruchtbarkeit zu schmecken.
Alfons von Neuhoff stammte aus der westfälischen Grafschaft Mark unter dem Schutz des Kurfürsten und Markgrafen von Brandenburg. Dort, auf der Anhöhe von Pungelscheid, befand sich das Schloß von Donnersfurth-Bruchmühle - es wurde ein Schloß genannt, war aber wohl eher ein Haus mit Fenstern und Türen -, wo die Freiherren von Neuhoff seit Generationen residierten. Er wohnte seit sechs Monaten als Logiergast im Hause Pujol, um in Lüttich die Gottesgelehrsamkeit zu studieren. Er war sechsundzwanzig Jahre alt und Leutnant in der französischen Armee. Er war der Zankapfel seiner über die Maßen auf ihn stolzen Eltern.
Das Leben im Schloß von Donnersfurth-Bruchmühle verhielt sich zu dem im Hause des Kaufmanns Pujol in Lüttich wie die Fasten- zur Karnevalszeit. Was waren die Neuhoffs letztlich anderes als Großbauern und Waldbesitzer? Der Krieg hatte ihre Knechte getötet, das Dorf verwüstet und die tributpflichtigen Kleinsassen in alle Winde verstreut. Er hatte die Kühe geschlachtet und die Pferde requiriert. Den Wald abgeholzt und den Speicher in eine Kloake verwandelt. Er hatte Fensterläden, Fuhrwerke, Tische und Schränke mitgehen lassen. Im Gemüsegarten wucherten die Disteln. Es gab mehr Galgen als Bäume, die Gesichter der Gehängten waren flügelschlagende Krähennester, und noch immer marodierten Truppenteile und Freikorps durch die Gegend, erstachen Männer, schlitzten ungetauften Säuglingen die Bäuche auf, um ihrer Seele den Flug ins Fegefeuer zu erleichtern, und pfählten die Frauen - es war eine wilde, versteppte Ödnis, durch die der fanatische Singsang der wandernden Mönche und das Geklingel der Pestkranken hallte wie über eine leere Bühne.
Alfons’ Großvater hatte noch in der französischen Armee gedient und hielt aus jener Zeit ein Offizierspatent. Sein Vater, dessen Nase aus dem Golilla-Kragen ragte wie eine Muskete über die Brustwehr, kannte den Krieg zwar nur als Knabe, war aber, wie das häufig vorkommt, eher noch martialischer gestimmt als der aktive Militär. Seine soldatische Kleidung war vor fünfzig Jahren in Mode gewesen, aber wer kümmerte sich um Mode in Donnersfurth-Bruchmühle? Wer scherte sich dort um Manieren, Tischsitten, um alles, was die Friedenszeit, die Stadt und der Austausch mit anderen an Verfeinerung hervorbringen?
Um so erstaunlicher war es, daß Alfons in dem rußschwarzen, modrigen Haus zu einem hellen Glanz heranwuchs, der wie ein unerklärlicher Vor- oder Rückgriff in bessere Zeiten über mehrere Generationen hinweg erschien. Es mißfiel seinem Vater, daß sein Sohn gerne bei den Frauen saß, mit abgespreiztem kleinen Finger Schokolade trank und, seine Aufmerksamkeiten und seinen Charme salomonisch auf die jüngeren und die älteren verteilend, ein hauchzartes Spinnennetz aus Zuvorkommenheit und kleinen histoires wob, in dem die Weiber kleben blieben, so daß sie gar nicht mehr fortkamen von ihm.
Er lernte Französisch und Latein schneller als Reiten; Holzhacken und Biersaufen lernte er nie, und sein Vater kaufte ihn, um seine Männlichkeit zu stärken, als Leutnant in die Armee König Ludwigs ein. Seine Mutter dagegen, die ihren Sohn hielt wie eine Lichtmonstranz in einem Tabernakel, träumte davon, einen Kirchenmann aus ihm zu machen, wenn auch von anderer Art als die krähengleichen Kapuziner mit ihren Fanatikergesichtern, die durch das wüste Land zogen wie Sensenmänner, oder die Pastoren, die seit dem obrigkeitlich verfügten Konfessionswechsel mit ihren schwindsüchtigen Frauen und zwölf Kindern die Pfarrhäuser des Sprengels füllten.
Am Jesuitenkolleg in Lüttich verglich Alfons mit seinen Patres auf lateinisch die Meriten der Montespan mit denen der Maintenon und der Lavallière, die Abende bei Wein, Karten und Würfeln im Hinterzimmer des Ständesaals endeten im Morgengrauen, und im Hause Pujol ging er ein und aus, eine Mischung aus Sohn und älterem Bruder für die junge Amalia, Ehrengast und Zierde des bürgerlichen Heims und mit jovialer Miene ertragene Beschwernis.
Alfons war vor allem erleichtert, den Zwängen des Lebens von Donnersfurth-Bruchmühle entronnen zu sein. Die wohlhabende, hektische Stadt an der Maas mit ihren laut schreienden Händlern, leichten Mädchen, geistreichen Jesuiten und gediegen eingerichteten Bürgerhäusern war Alfons’ Bohème; der Leutnantstitel brachte außer einigen Pflichtaufenthalten bei der Garnison von Metz keinerlei Bürden mit sich, und nach einer steifen Jugend voller Erzählungen von Mord, Krieg, Not und Elend genoß er den Wartezustand, als den er sein Leben selbst empfand, hier in dieser komfortabel ausgestatteten Zwischenwelt in vollen Zügen. Er empfand ein Recht auf Sorglosigkeit und hatte, wie es vielen charmanten jungen Männern ergeht, die nur das Lächeln sehen, das sie auf die Gesichter in ihrer Umgebung zaubern, den Eindruck, die Welt gestehe es ihm gutwillig zu und empfinde nicht, daß er etwa von jemandes Langmut profitiere, sondern vielmehr, daß jeder Dienst zugunsten seines leichten Lebens auch den Geber leichter und fröhlicher stimmen müsse.
Alfons’ Hauptgläubiger war der alte Pujol, zu dem der junge Mann, die Zunge im Mundwinkel, das Verhältnis eines Sohnes zugleich kultivierte und spielte. Er bewunderte die finanzielle Bewegungsfreiheit, in der der Kaufmann lebte wie in einer bequemen Strickweste. Ein Ehrenmann war er selbst, das vermißte er nicht an seinem Wirt, aber dessen weltoffenes Parlando, seine Fähigkeit, zu jedem Thema etwas beizusteuern - nichts Weltbewegendes, aber einfach die Zähne auseinanderzubekommen - gestaltete das Leben soviel angenehmer. Pujol machte auf Alfons den Eindruck eines Mannes, der zu seiner Zeit gehörig über die Stränge geschlagen und Fünfe hatte gerade sein lassen und der ähnlichen Anwandlungen bei einem jungen Mann mit von selbstzufriedener Erinnerung getränktem Wohlwollen gegenüberstand.
Ging er ihn um Stundung des Mietzinses an oder erzählte beim Wein von seinen Spielschulden, reagierte Pujol mit abwinkender, komplizenhafter Selbstverständlichkeit - aber Baron, reden wir doch nicht von solchen Dingen. Ich weiß doch ganz genau, was solche momentanen Verlegenheiten sind, ein Wort mehr, und Sie beleidigen mich, junger Freund! -, daß das westfälische Prinzlein zu Zeiten überzeugt war, es tue dem Hausherrn einen Gefallen, indem es ihn an seiner Stelle bezahlen oder sich Geld vorstrecken ließ.
Auf eine kompliziertere Weise, als er dachte, hatte Alfons damit nicht unrecht. Pujol empfand eine ehrliche Zuneigung zu dem jungen galand. Bei einer Geselligkeit wie der heutigen war seine hübsche Larve, seine sorglose gute Laune ihr Geld wert. Auch war es dem verwitweten Kaufmann angenehm, abends nach Tisch einmal Männergespräche führen zu können. Die zutrauliche Vater-Sohn-Mystifikation, in der Alfons sich gefiel und die er durch einen feinen Abstand der Förmlichkeit davor bewahrte, mißverständlich zu werden, machte Pujol Spaß, aus demselben Grund wie dem Jüngeren: Es fehlte ihr das Element der Verantwortung.
Die unsichtbare Grenze überschritt der junge Neuhoff nur dann - und da er bei seinem Gegenüber keinen Widerstand sich regen spürte, immer öfter -, wenn er sich in finanzieller Verlegenheit befand. Das erste und vielleicht noch das zweite Mal hatte Pujol aus Höflichkeit vorgestreckt, das dritte und vierte Mal, weil die früheren Vorschüsse irgendwann zurückgezahlt worden waren. Das fünfte Mal, weil - nicht obwohl - Alfons säumig geblieben war und der Kaufmann feststellte, daß das Bilanzungleichgewicht ihn in diesem Fall nicht ärgerte, sondern ihn vielmehr mit einer bislang unbekannten Genugtuung erfüllte. Nicht, daß er sich mit den Fuggern oder Medici hätte vergleichen wollen, aber sich etwas leisten und halten zu können, was nichts einbrachte, war nicht jedermann möglich, und ohne daß Pujol seine Gedanken bis auf den Grund zu analysieren in der Lage gewesen wäre, schien ihm doch, der Zustand habe etwas mit Zeitenwende und Wertewandel zu tun. Manchmal kamen ihm sogar solche Spitzfindigkeiten in den Kopf, wie daß Alfons ihm durch sein taktloses Finanzgebaren womöglich freiwillig eine moralische Kompensation dafür zuschusterte, ihn als feilen Geldmenschen nicht so hoch achten zu können, wie er es vielleicht gewünscht hätte.
Noch immer verharrten Pujols Augen auf dem neben den Papageien knienden und sie neckenden Neuhoff.
Barroon, fragte der rote Ara krächzend, ist es richtig, daß alle Naturerscheinungen sich aus Bewegung und Ausdehnung erklären lassen?
Die Materie ist träge, behaupte ich als Gassendianer, rief der Blaugelbe.
Wovon reden diese Tiere? wurde Alfons gefragt.
Von der Leibniz’schen Monadenlehre, erklärte der Baron. Aber sie verstehen sie nicht richtig.
Monaden sind Seelen! quäkte der Gassendianer.
Darüber wandte die Aufmerksamkeit der Gäste sich einem eintretenden jungen Mädchen zu, das, eine Viola da Gamba im Arm, errötend den Raum durchquerte und das Musikzimmer betrat. Die Gäste, einschließlich Alfons, der sie begleiten sollte, folgten ihr, während Pujol am Tisch sitzen blieb. Er erwartete noch jemanden.
Das schwarzgelockte Mädchen war Amalia, die Tochter des Hauses. Sie trug ein bodenlanges, hochgeschlossenes Kleid und schlug vor den drängelnden, starrenden Freunden des Hauses auf entzückend keusche Weise die langbewimperten Augen nieder. Sie war hochgewachsen und schlank, und das Kleid, das sich nach unten hin weitete und bauschte, umschloß ihren Körper wie eine Metapher: alles ausdrückend, nichts preisgebend. Ihr Gang, ein wenig breitbeinig, fast seemännisch wiegend, widersprach dem Bild einer Dame, ohne dem Eindruck des Reizvollen Abbruch zu tun, genauso wie Amalias ungezupfte, von Natur aus kräftige Augenbrauen, die ihre ganze Mimik beherrschten, so daß der Betrachter sich zunächst nur auf sie konzentrierte, bevor er die Augen selbst und die rosigen Lippen wahrnahm. Dieser dichten und beweglichen Brauen wegen durfte man sie schwerlich eine Schönheit à la mode nennen, aber, sagte sich Alfons, was gibt es Langweiligeres als die Perfektion?
Die widersprüchlichen Eindrücke setzten sich fort, sobald Amalia auf ihrem Schemel saß und zu spielen begann.
Sie hockte da mit weit gespreizten Beinen, zwischen die sich der warme Holzleib des Instrumentes schmiegte, und strich den Bogen mit kräftiger Armbewegung. Der Anblick erinnerte Alfons an eine Bäuerin, die ein Lamm im Schwitzkasten hält und schert, aber die dabei produzierten Geräusche waren kein panisches Blöken, sondern eine heisere Melodie, die zusammen mit den geschlossenen, wie nach innen horchenden Augen, den gerunzelten Brauen und dem klaffenden Mund einen Anschein von Wissen hervorrief - von Erfahrung und Genuß -, auf den Alfons’ Schweißdrüsen mit alarmierter Tätigkeit reagierten.
Es ist ja nicht der Mensch als solcher, der unsere Lust entfacht, Alfons hatte Monate an Amalias Seite verbracht, ohne jemals andere als brüderliche Gefühle für sie zu empfinden, sondern ein plötzliches Aufbrechen in unserer Wahrnehmung, eine leichte Verschiebung der Perspektive. Mit einem Mal scheint die Schale, die wir bis dahin ausschließlich gesehen haben, sich zu öffnen, und der verborgene Kern, die Frucht offenbaren sich.
Jener Ausdruck angespannter Verzückung auf Amalias Gesicht, den wollte er wieder und wieder sehen, und vor allem wollte er ihn hervorrufen und selbst den Platz der Gambe zwischen ihren Beinen einnehmen. Mit steifen Fingern drückte Alfons seine Akkorde, bis Amalia ihm auf die Schulter klopfte und Aufhören, Alfons, rief, das Stück ist zuende.
Verliebt in Amalia auf eine brüderliche, unschuldige Weise war Alfons bereits gewesen. Diese Neigung war so sorglos, sie trug ihren Sinn und ihre Begrenzung ebenso in sich wie sein ganzes derzeitiges Leben, und es war Alfons bis zu diesem Abend nicht in den Sinn gekommen, mit ihr irgendwelche Pläne zu schmieden. Sie bestand aus Blicken, Scherzen, kurzen Berührungen der Hände, gegenseitigen Seelenergüssen und Anekdoten aus der Kinderzeit. Sie war wie ein Sommertag in den Dünen, wenn Wind und Meer rauschen und es keinerlei Notwendigkeit gibt, entdecken zu müssen, was jenseits der zwei, drei Sandhügel liegt, zwischen denen man spielt.
Aber an diesem Abend störte der plötzlich erweckte erotische Impuls Alfons’ Seelenfrieden auf und träufelte ein wenig Unerfüllbarkeit und Hoffnungslosigkeit ins klare Wasser seiner harmlosen Geschwisterverliebtheit, die das Getränk im Nu in einen ungleich attraktiveren Bitter verwandelten.
Zur selben Zeit, als im Nebenraum die Hausmusik erklang, der begleitende Alfons seine Lust auf Amalia entdeckte und das musizierende junge Mädchen ganz im säuberlich in Schwarz und Weiß geschiedenen Jansenismus der Saint-Colomb’schen Melodien aufging, ohne auch nur im entferntesten etwas von den Phantasien ihres Freundes zu ahnen oder selbst dergleichen zu empfinden, erschien endlich der von Pujol so dringlich erwartete Ehrengast des Abends, der Großbauer Xavier Hainaut.
Ohne Umschweife steuerte er auf Pujol zu und winkte ihn ins Arbeitskabinett. Die Türen schlossen sich, und nach einiger Zeit trat Hainaut heraus und kletterte ebenso eiligen Trippelschritts die Treppe hinab, wie er gekommen war. Die Festlichkeiten hatte er mit keinem Auge gewürdigt, auch die Tochter des Hauses nicht begrüßt. Der Gastgeber aber blieb verschwunden. All das erfuhr Alfons nach der musikalischen Darbietung, und da er von Natur aus kein Parzival war, klopfte er, nachdem die Gäste fort waren, bei Pujol an und fragte nach seinem Befinden.
Es war schlecht und Pujol viel zu aufgewühlt, um seinem jugendlichen Freund nicht gleich seine Misere zu offenbaren, oder jedenfalls einen Teil davon, denn indem er seine Sorgen laut aussprach, ordneten sie sich auch in dem Kaufmannskopf, der damit wieder unterscheiden konnte, was man einem Außenstehenden verrät und was nicht.
Lieber Meister Pujol, hat die Begegnung mit Ihrem Gast Sie in irgendeine Trauer oder Verlegenheit gestürzt, in der ich Ihnen hilfreich sein könnte, indem ich mich zu Ihrer Verfügung halte oder Ihnen einfach nur mein Ohr leihe, begann Alfons in seiner flamboyanten Art, die aus Höflichkeit und echter Großherzigkeit immer etwas mehr versprach, als sie hätte halten können und wollen.
Sie sind ein guter Junge, Baron, meinte Pujol und erzählte, daß er mit seinem alten Bekannten und Lieferanten Hainaut schon seit Jahr und Tag die Heirat ihrer Kinder ausgemacht habe und daß dieser Vertrag heute habe beurkundet werden sollen.
Es fehlte nicht viel, und er hätte sich von Alfons’ lauschenden Gesichtsausdruck hinreißen lassen, auch die finanzielle Notwendigkeit der Union zu erwähnen, den Schein des Wohlstands zu gestehen, den er mit Abenden wie dem heutigen aufrechterhalten mußte, um seinen Ruf zu wahren, aber in diesem Moment erschien ein Diener mit den Papageien und fragte, wohin er sie bringen solle, und Pujol entschied sich, von diesen Dingen zu schweigen.
Allerdings schockierte, was er statt dessen erzählte, den Zuhörer viel mehr als das Geständnis einer schwachen finanziellen Gesundheit, die der junge Mann nur allzugut hätte verstehen und billigen können. Georg nämlich, der Sohn Hainauts, sei nicht erschienen, weil er ein junges Mädchen aus den Hügeln von Herve geschwängert habe, dessen Familie ihm jetzt ans Leder wolle, woraufhin sein Vater ihn schnellstens nach Frankreich und in die Armee expediert, möglichst weit weg, Sie verstehen, bis die Situation zu einer gütlichen Eingung geführt sei. Die Heirat mit Amalia müsse daher noch mindestens ein Jahr warten. Pujol sah so verstört und betrübt aus, weil er beim Sprechen im Kopf mitrechnete, ob er dieses Jahr wohl überstehen werde.
Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte Alfons sich, nicht ohne Stolz, von der Fatalität des Lebens gestreift. Er sah die Kutsche seiner Existenz, von einem fremden Fuhrmann gesteuert, vor seiner Nase davonrollen und mußte nun diesem sich entfernenden Wagen, ohne zu zögern, hinterherstürzen, um zu retten, was zu retten war.
Mehr verwirrt als freundlich und höflich, gelang es ihm, die Form zu wahren und sich zurückzuziehen, aber an Schlaf war nicht zu denken. Er verließ das Haus und eilte in einem bedenklichen Zustand, alle Sinnesorgane nach innen gekehrt, um die Revolution zu begreifen, die dort brodelte, zu einem Wirtshaus unten am Fluß, wo er sich, ohne einen Blick auf die anderen späten Besucher zu werfen, auf eine Eckbank fallen ließ und Bier bestellte.
Erst jetzt fragte er sich, warum die Nachricht, Amalia sei einem anderen versprochen, ihn in derartige Panik versetzen konnte. Daß sie es kann, dachte er, heißt doch wohl, daß ich sie liebe, und indem er diesen Schluß zog, bemerkte er, daß er sie jetzt tatsächlich liebte. Aber selbst die Liebe rechtfertigte nicht das Entsetzen darüber, daß Pujol sie einem Bauernsohn vermählen wollte. Hatte er denn etwa vor, sie selbst zu heiraten? Nicht bis zu diesem Moment, nun aber stand die Frage groß und sperrig im Raum.
Er verstand vage, eigentlich spürte er es eher, daß er zu irgendeiner Form von Reaktion und Aktivität aufgefordert war, da die Welt über seine Zwischenexistenz, seinen fröhlichen Wartestand einfach hinwegschritt. Offenbar wurden seine Zustände erst in dem Moment, da er sie benennen konnte, virulent. Der laut ausgesprochene Tastgedanke »Ich liebe sie« schuf eine unumstürzliche Tatsache.
Ich habe Angst, um mein Glück gebracht zu werden, das ist es. Seltsam nur, daß erst diese Angst überhaupt das Bewußtsein von einem Glück erschaffen hat, an dem es mir nun plötzlich mangelt. Er war ein junger Adliger, der in den Brunnen der bürgerlichen Moral gefallen war. Und dann verstand er, was das eigentlich Neue und Verstörende an seiner Situation war: Sich seiner selbst bewußt geworden zu sein. Wer bin ich eigentlich? fragte er sich, als habe Pujols Erzählung den Schlußstein aus dem Gewölbe seines Lebens gerissen. Was will ich eigentlich in dieser Welt? Und antwortete sich: Glücklich sein! Dem entgegen stand im Moment die Erkenntnis, daß Dinge geschahen, die er nicht beherrschte, ja, von denen er nicht einmal wußte.
Glücklich sein, das hieß Amalia besitzen, und Amalia besitzen hieß sie heiraten, und das war in jeglicher Hinsicht ein so unerhörter Gedanke, daß der schiere Wahnsinn, ihn zu denken, ganz zu schweigen von dem Gebirge an Unmöglichkeit, ihn zu realisieren, ihn als einzig adäquate Reaktion auf die Scham erscheinen ließ, die Alfons verspürte.
Was soll aus mir werden, wenn ich jetzt dieses Glück verpasse, wenn ich Amalia nicht gewinne? fragte er sich und dachte an die Bogenstreicherin mit den geschlossenen Augen, das braunglänzende Tier zwischen ihren Schenkeln und dann an die trübe Heimat, wo all seine Bildung zu nichts nutze war, und diese Kaufmannswelt, in der man für das bißchen Wohlleben hart zu arbeiten und sich die Finger zu beschmutzen hatte.
Die Ehe mit Amalia gegen alle Widerstände durchzusetzen, war womöglich die einzige Großtat, die es für jemanden wie ihn zu begehen und bestehen gab. Ein Entschluß wie Kolumbus’ Einschiffung auf Entdeckungsfahrt. Aber das Glück, das er finden wollte, war ein Kontinent der Häresie, von allen Karten getilgt. Kein Gefühl und persönliches Gelüst, wie machtvoll auch immer, rechtfertigte eine Mesalliance. Die Ungeheuerlichkeit seiner Liebesrevolution nahm ihm den Atem, machte ihm aber dennoch keine angst. Bevor er nicht handelte, konnte nichts passieren, man konnte also auch nicht wissen, was passieren mochte. Das heißt, theoretisch konnte man es wohl wissen: Skandal und gesellschaftliche Ächtung drohten, aber es war wie beim Schach, wenn ein ungedeckter Läufer eine Dame herausfordert. Sie konnte ihn schlagen, es gab eigentlich gar keinen Grund, es nicht zu tun, aber sie hatte eben auch noch so und so viele andere Zugmöglichkeiten. Und zog er nicht selbst, würde er nie erfahren, wie die Welt darauf reagierte.
Pujol reagierte alles andere als erfreut, er mußte sich Mühe geben, nicht zu vergessen, sich als geehrt zu bezeichnen, bevor er Alfons von der Absurdität seines Begehrens zu überzeugen begann, wobei er die wirklichen Gründe seiner ablehnenden Haltung ja gar nicht erwähnen konnte. Je höher sich aber die Hindernisse vor dem nun einmal ausgesprochenen Entschluß türmten, desto hartnäckiger und eloquenter bestand Alfons auf ihm. Er ging sogar so weit, in wohltemperierte Tränen auszubrechen und den Kaufmann anzuklagen, selbst er, vor dem er den allergrößten Respekt hege, sei der Feind seines Glücks, wobei dieser Respekt und das Wissen, daß Amalia ihres Vaters Stütze und Stab, sein Augapfel sei, es ihm selbstverständlich verbiete, sie je gegen seinen Willen zu ehelichen.
Amalia selbst war beeindruckt von Alfons’ Willen und seinem Interesse für sie. Ohne zu wissen, ob sie ihn denn auch liebe, oder dieser Frage besondere Wichtigkeit beizumessen, fand sie es ganz in der Ordnung, dem Mann zu folgen, der sich nächst ihrem Vater am intensivsten um sie bemühte. Auch sie wußte nichts von der Vermögenslage Pujols, übrigens ebensowenig von der ihres Freiers.
Als Alfons’ hysterische Werbung das Zusammenleben unerträglich zu machen begann und er schließlich noch in eine Art psychosomatisches Fieber fiel, das auch durch mehrere Aderlässe nicht zu lindern war, als dann durch eine gewissermaßen seelisch-solidarische Ansteckung auch Amalia ernstlich erkrankte, blieb Pujol - um so weniger als Hainaut schlechte Nachrichten betreffs seines Sohnes schickte - keine andere Wahl, als dem delirierenden Alfons sozusagen in articulo mortis die Hand seiner Tochter zu gewähren, woraufhin es keine Woche dauerte, bis der junge Mann von den Toten erstanden war und die Heirat stattfinden konnte.
Der Rest von Alfons’ Geschichte und Leben ist schnell erzählt. Denn leider sollte seine heroische Entscheidung, gegen alle Konventionen seines Standes sein persönliches Glück zum Mittelpunkt und Ziel seines Lebens zu machen, sein größter Moment und einziger Triumph bleiben. Die Hochzeit fand im Oktober 1693 statt, der Bräutigam war siebenundzwanzig Jahre alt.
Zuallererst ging er daran, seine Eltern von seiner Ehe in Kenntnis zu setzen. Er brauchte mehrere Tage, den langen Brief fertigzustellen, denn nachdem er seinen Willen tatsächlich bekommen hatte, beschlich ihn eine Art innere Erschlaffung, und er erwartete unbewußt, da er nun schon soviel getan hatte, müßten auch die anderen mit gutem Willen folgen und das ihre zum Gelingen des Unternehmens beitragen.
Die Sätze gerieten ihm immer länger, apologetische Parenthesen umklammerten die einfachen Aussagen wie Riesenkraken, und unter der Hand formte sich sein Schreiben zu einem Hilferuf nach Verständnis und (finanzieller) Unterstützung.
Die Antwort von der Hand seiner Mutter ließ lange auf sich warten und war, als sie dann eintraf, ebenso kurz wie vernichtend. Die Baronin verbat sich weitere Belästigungen ihres zutiefst enttäuschten Gatten, untersagte Alfons, jemals wieder das elterliche Haus aufzusuchen, und teilte ihm bündig mit, er sei enterbt und beide Eltern hätten keinerlei Interesse zu erfahren, wie es fürderhin einem Sohn erginge, der gleich bei seinem ersten Eintreten in die Welt sich so erbärmlich kompromittiert habe.
Etwas in dieser Art war ja bei nüchterner Betrachtung vorauszusehen gewesen, und doch schockierte es Alfons tief, und es lähmte ihn, feststellen zu müssen, daß sein sonniges Wesen und sein argloses Vertrauen darauf, dank seines Charmes vom Leben begünstigt zu werden, mit einem Mal an schroffe Grenzen stießen und nichts mehr gelten sollten. Es wurde in der kurzen Frist, die ihm noch blieb, deutlich, daß er sich verausgabt hatte mit seiner Entscheidung, seinem Glück leben zu wollen, und daß er für die Bewältigung seines weiteren Lebens keine Reserven mehr besaß.
Der alte Pujol starb kein Jahr nach der Hochzeit und hinterließ seiner Tochter nach der Liquidierung seines Geschäfts bescheidene elftausend Gulden. Bezeichnenderweise hatte er seinem Schwiegersohn nie vorgeschlagen, es etwa selbst zu übernehmen, und wenn die Eroberung seines Glücks für den Baron eine kompromittierende Ehe rechtfertigte, so doch niemals eine kompromittierende Tätigkeit. Blieb nur mehr die soldatische Karriere. Alfons verwandte die Mitgift, um eine Kompanie aufzustellen, als deren Hauptmann er das Kommando eines Forts bei Metz übernahm, in einer der frisch eroberten Taschen oder réunions, die der pfälzische Krieg König Ludwigs nahe der umkämpften Frontlinie hatte entstehen lassen.
Das Fort war eine der genialen Konstruktionen Vaubans, das heißt, genial war es als Verteidigungsstellung, zum Leben, vor allem für eine schwangere Frau, war es ein Alptraum. Zugige Korridore, in denen die Nässe giftgelbe Pilze von den Decken wuchern ließ, der eisige lothringische Wind, der über die Hochebene brauste, sich im Innenhof verfing und durchs Logis zog, der Lärm der exerzierenden Soldaten, der durch die Privatzimmer des Hauptmanns hallte, der ewig verhangene Himmel, der blasse Gemüsegarten, den Amalia an der Innenhofmauer der Kommandantenwohnung hochpäppelte. Die in verschiedenen breiten Dialekten plärrenden Gesänge und das betrunkene Gegröle der Soldaten, ihre verstohlenen Tierblicke auf die junge Frau - das granitene Fort auf der Hochebene war ein kaltes Fegefeuer, und je mehr Zeit verging, desto wahrscheinlicher erschien es, daß die Strafe auf lebenslänglich lautete.
Jedes Gesuch Alfons’ nach Versetzung, jede Eingabe nach Beförderung blieb unbeantwortet, wurde abschlägig beschieden oder verschleppt. Bis auf wenige Scharmützel war das Leben im Fort ruhig, zu ruhig, die Soldaten langweilten sich, mußten diszipliniert, beschäftigt und besoldet werden, da keiner von ihnen fiel. Alfons, vom militärischen Leben und der feuchten Granitdüsternis des Gemäuers eher geschwächt als gestählt - er begann zu husten -, konstatierte melancholisch, daß seine heroische Tat gegen jede Würfelwahrscheinlichkeit ausschließlich zum Schlechten ausgeschlagen war, und fragte sich, wie lange das Schicksal ihn denn noch foppen wolle. Im Grunde erwartete er nach wie vor eine Art Belohnung für seinen damaligen Mut und letztlich auch für seine Person als solche, ganz unabhängig von ihren Taten.
Er mietete, als Amalia begann, sich täglich zu übergeben, die Tour aux Puces in Diedenhofen an, wo am vierundzwanzigsten August 1694 sein Sohn geboren und auf den Namen Theodorus Antonius Alfons getauft wurde. Das Wochenbett zog sich hin, denn die Blutungen nach der Entbindung des großen und kräftigen Knaben wollten nicht aufhören, und als Amalia schließlich mit dem Kind und einer Amme und Zugehfrau namens Minne, die wie die Neuhoffs aus Westfalen stammte, ins Fort zurückkehrte, schimmerte ihre Schläfenhaut durchsichtig und blaugeädert wie Chinaporzellan.
Im Frühjahr darauf war sie erneut in Hoffnung, und nichts hatte sich geändert. Latenter Kriegszustand, Regen, Wind, Kälte, die dunklen, klammen Räume des Logis, die die Kleider in den Schränken schimmeln ließ, der immer häufiger hustende und spuckende Alfons, dessen ergrauende Schläfen und abgezehrtes Gesicht ihn noch schöner erscheinen ließen; keine Versetzung, keine Beförderung, kein Geld, und daher auch nicht die Spur eines gesellschaftlichen Lebens.
Der Umgang zwischen den Eheleuten war noch immer von derselben exquisiten Höflichkeit und Liebenswürdigkeit wie in ihrer Brautzeit. Alfons blickte, wenn er seine Frau zu einem frugalen Abendessen in die zugige Halle führte, Amalia aus so brennend hypnotischen Augen an, als wolle er sie überzeugen, daß nur die Luftbrücke zwischen ihnen Realität sei, alles widrige Drumherum Trugbild und als müsse Amalia auch das ihre tun, diese Fiktion aufrechtzuerhalten, und dürfe auf keinen Fall durch ein Wort der Klage, einen Hinweis auf ihr aussichtslos erbärmliches Leben den Zauberbann brechen, durch den er sich eine Konfrontation mit den Realitäten vom Leibe hielt. Sie lernte, die stumme Verleugnung der Welt aufrechtzuerhalten; die Kraft, mit der seine Augen sie in eine Art Levitation versetzten, in der ihre Füße den schmuddeligen Boden der Tatsachen nicht mehr spürten, war ein letztes Echo der Kraft, die er gezeigt hatte, um sie zu erringen.
Amalia tat ihm den Gefallen, nie mit Worten an dieser Fiktion zu rühren. Was sie nicht hinderte, die verfahrene Situation in aller Deutlichkeit zu empfinden. Sie war Alfons gefolgt, weil sie einem Elan, der so ganz ihr galt, nicht hatte widerstehen wollen oder können. Freilich hatte sie erwartet, daß diesem Anfangsschwung irgend etwas folgen werde. Sie sah die Schwäche ihres Mannes, seine - sagen wir es deutlich - Unfähigkeit, den Alltag zu meistern, ganz ungeschminkt. Sie war ein anderes, ein komfortableres Leben gewohnt gewesen, aber während ihre Situation immer elender wurde, eignete Amalia sich den stoischen Hochmut ihres Gatten an, und ein Bewußtsein ihrer eigenen Kraft keimte in ihr und wuchs. Vorerst war es mehr ein schlummernder Schatz, ein unterirdisches Feuer, aber das wärmte sie in der klammen Kälte des Exils von innen heraus. Sie wußte, sie war ihrem Mann überlegen. Mit jedem Tag, den sie Alfons’ Verfall zusah, wuchs ihr Selbsterhaltungswille. Sie leugnete die Wirklichkeit auch tapfer weiter, als es kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes, einer auf den Namen Amélie Viktoria Elisabeth Charlotte getauften Tochter, nun nicht einmal mehr vor sich selbst zu verheimlichen war, daß Alfons an Schwindsucht litt und der Horizont seiner Zukunft sich zusammenzog. Es wurde kein Wort darüber verloren. Eigentlich, sagte der Baron, einen Wollschal um den Hals, zitternd beim Frühstück, während der Nordwind durch die Mauerritzen pfiff, eigentlich wäre nun eine Beförderung zum Obersten fällig und die Versetzung nach Paris. Meinst du nicht auch? Sie müßte eigentlich jeden Tag eintreffen. Was hältst du von Paris? Ich kann es kaum mehr erwarten. Aber es war ja auch hier ganz schön, nicht wahr?
Gewiß, sagte Amalia. So schlecht war es hier nicht. Sie sah ihren Gatten liebevoll an. Ja, sie liebte ihn. Sie verachtete seine Schwäche und war enttäuscht von seinem Mangel an Fortüne, sie verabscheute ihn um ihrer betrogenen Hoffnungen willen. Sie stellte fest, daß dies die ersten tiefen Gefühle waren, die sie für ihn empfand. Und man braucht konkrete Gefühle für den anderen, die man dann Liebe nennen kann, denn »Liebe« ist ein Sammelbegriff für eine Kombination exakterer Empfindungen, die ganz widersprüchlich sein können und die mit dem großen Wort, das wie ein Hut über sie geworfen wird, im allgemeinen nur mundtot gemacht werden.
Im Spätherbst 1697, der Friede von Rijswijk war soeben unterzeichnet worden und das Fort verlor seine strategische Position im umkämpften Kriegsgebiet, starb Alfons von Neuhoff, und seine Witwe zog mit ihren Kindern und der Amme Minne fort und kaufte vom Rest ihres Geldes ein Haus auf dem Land am Rande des Argonnerwaldes.
Zweites Kapitel
Die Gräfin von Mortagne, eine überzeugte Provinzlerin, der nichts entging, was sich bei ihr auf dem Lande zutrug, schrieb ihrem Gatten, dem Kämmerer Monsieurs, mit dem sie ein hauptsächlich epistoläres und daher offenes und harmonisches Eheleben führte: »... und übrigens spricht hier jeder von einer Dame aus offenbar deutschem Adel, die völlig verarmt in einer Strohhütte leben und, während sie kein Kleid zum Wechseln besitzt, doch all ihre Zeit und Energie außer der Erziehung ihrer zwei Kinder den Armen und Kranken des Kantons widmen und keine Messe versäumen soll. Die Bauern nennen sie die ›Schwarze Madonna‹, da sie nicht davon abzubringen ist, Trauer zu tragen, obwohl ihr Mann, ein Offizier der königlichen Armee, schon vor Jahren das Zeitliche segnete, wenn ich recht informiert bin. Wäre das nicht eine Herausforderung an Ihre berühmte générosité? Vor allem da die Dame angeblich unter ihren Lumpen eine Schönheit sein soll und Ihr idealistisches Streben nicht mit Ihrem Sinn für Ästhetik in Konflikt geraten müßte...«
Nicht alle Informationen in diesem Brief entsprachen den Tatsachen, so lebte Amalia keineswegs in einer Strohhütte, sondern in einem zweistöckigen Haus mit Fenstern, einem Paar Kaminen, einem gepflegten Garten und litt auch keinen Mangel an Toilette, aber vermutlich hätte es sie nicht gestört, so gesehen zu werden, denn ein derartiger Zustand würde zum schlechten Gewissen der Welt ihr gegenüber beigetragen haben, das sie beständig einforderte.
Zehn Jahre nach dem Tod Alfons’ war Amalia von Neuhoff eine schwarzgekleidete dreißigjährige Matrone, deren strenger Stolz ihr nicht gestattete, die Augen niederzuschlagen, um ihr den Anblick ihrer Holzschuhe im Kot der schlammigen Karrenwege zu ersparen, und deren Lippen so fest geschlossen waren wie die Tore einer belagerten Stadt, die geschworen hat, eher unterzugehen, als sich zu ergeben. Amalias Feind war das Leben, oder besser gesagt, die Umstände ihres Lebens. Die ignorierte sie verächtlich, und was sich nicht ignorieren ließ, dem gestand sie keine tiefere Wirklichkeit zu.
Ihr Leugnen ging Hand in Hand mit einem Trotz und einer höheren Art von Beleidigtsein, die sich in einem königlichen Gang ausdrückten und sie mit einer subtilen Form von Blindheit schlugen, denn auch noch nach zehn Jahren in dem erbärmlichen Dorf, an dessen Rand sie mit ihren halbwaisen Kindern lebte, erkannte sie, hocherhobenen Hauptes an ihnen vorüberschreitend, kaum einen ihrer Nachbarn wieder.
Zu dieser stolzen Leugnung der Welt gesellte sich der Wille, sie ihren Kindern untertan zu machen, wobei es nicht immer ganz klar war, ob sie mit der Welt, für die sie die zwei, vor allem aber ihren Sohn erzog, diejenige meinte, die hinter ihrem trotzigen Blick und ihrem vernähten Mund existieren mußte, oder die tatsächliche, durch die ihre schlammbespritzten Schuhe patschten.
Die Jahre seit dem traurigen Abschied von Lüttich waren ein schwarzer, morastiger Alptraum, durch den sie, das Herz voller Angst, ihre Kinder an der Hand, gewatet war, ständig sich umwendend, wenn Lärm ihr ins Ohr stach, unablässig auf der Hut, alle lauernden Gefahren rechtzeitig vorauszufühlen, die Augen mit Elend füllend, bis sie geschwollen und schwarz waren wie die aufgetriebenen Leichen im Straßengraben, um den Blick der Kinder zu schützen vor allem, was ihn vergiften konnte.
Die Wege waren nicht sicher. Räuber konnten den Sohn erschlagen, der Tochter und ihr selbst die Kleider vom Leib reißen und sie mißbrauchen. Marodierende Soldaten nahmen Frauen, wo sie sie fanden, bei der Einnahme von Städten, in requirierten Häusern, aus Spaß, aus Überdruß, sie kannte sie aus der Nähe. Ein Kapuzinerprediger mochte die Bauern aufhetzen, und schon liefen sie los in ihrer dumpf trunkenen, selbstgerechten Wut und verbrannten Juden und Sarazenen in ihren Häusern und Wagen.
All die Schreie, die man hörte in einem Leben! Schreie der Sterbenden am Tag, Schreie der armen Seelen in der Nacht, im Schlaf, davor bewahrte keine Beichte und Lossprechung. Das Kreischen der Verbrennenden, das erbarmungswürdige Quieken der Erstochenen, das entsetzliche Röcheln der Pest- und Aussatz- und Auszehrungskranken, das viehische Brüllen, wenn ein zerquetschter Arm oder ein Bein abgesägt wurde. Die schwärenden Wunden, die fetten grünen Fliegen überall, die ihre Eier in eiterndes Fleisch legten, die baumelnden Gehenkten an den Kreuzwegen, ihre schwarzrot gedunsenen Körper, die eine Meile weit stanken, so süßlich. Die niedrigen, von Unschlittkerzen erhellten Bauernkaten und das Geblök der Schafe hinter der Bretterwand, an der die Strohsäcke lagen, damit die Menschen noch aus der Wärme der Tiere ihren Nutzen zogen, und der Bocksgestank in den fettigen Wollwämsern der schmutzverkrusteten Bauern und deren Brut mit ihren grindigen Augen, dem gallertigen Weiß ihres Blicks und dem debilen Kopfwackeln. Und nie war sie sich sicher, das Rechte zu tun. Der Priester zieh sie des Hochmuts und hatte recht, und um zu sühnen, strich sie Salbe auf den Grind der stinkenden Bauernkinder und betete mit ihnen. Auch ihrem Sohn hatte sie die Sünde des Hochmuts ins Herz gepflanzt, aber wie sollte er denn überleben ohne sie? Mücken und Bremsen und Gestank überall, und der Morast, sobald es regnete, als wollte es nie mehr aufhören, und in der kahlen Kammer des Pfarrers das Menetekel des kohlkopfgroßen grünen Pilzes an der geweißten Decke, die Kuhlen im Holz des Betschemels und auf dem rohgezimmerten Bord die Gläser mit den Ratten und Lurchen in Alkohol. Und immer wieder die Angst vor Brandschatzung, vor einer Klinge, die ihr ins Fleisch fuhr, die tierische, zehrende Angst, den Kindern könne etwas zustoßen, eine Krankheit sie dahinraffen, man läßt sie zur Ader, ihr hellrotes Blut sprudelt, plötzlich sind sie weiß wie ein Laken und verenden ohne ein letztes Wort, ohne Sakrament, oder ein Geschwür wächst ihnen, und sie verfaulen von innen heraus bei lebendigem Leib, und ihre Augen rufen sie, ihre Mutter, um Hilfe an, und sie kann nichts tun.
Manchmal hielt sie wie eine Erstickende den Kopf ins Geißblattdickicht oder im Juni in den Blütenkelch einer Päonie, um einmal einen Duft wiederzufinden, so köstlich und sauber wie die frischgebleichten Laken ihrer Kindheit, oder der Spekulatius in der Eschenholztruhe oder das Lavendelsäckchen in ihrem Wäscheschrank daheim in Lüttich.
Nie verbrachte sie eine ruhige Nacht, weil sie dem kommenden Tag zuversichtlich entgegenblicken konnte. Kein Trost als der paradoxe der wieder und wieder gelesenen Seligpreisungen der Schrift, und keine Zuflucht als ihr verbarrikadiertes Herz. Niemand nahm ihr die Last der Verantwortung ab, ihr Vater hatte sie im Stich gelassen, dann ihr Mann, nur Gott nicht, aber Gott hilft denen, die sich selbst zu helfen wissen.
Schmallippig beichtete sie: Wenn die Welt mir die Mittel verweigert, das zu tun, was ich dennoch tue, um so schlimmer für die Welt. Schuldbewußt sah die Welt sie für die Ärmsten des Sprengels der eigenen Bedürftigkeit abgetrotzte Wunder an kühler Nächstenliebe und unpersönlicher Fürsorge tun, aber da es in Gelddingen keine Wunder gibt, war Amalia Neuhoff bis über den Kopf verschuldet,
1. Auflage
Genehmigte Taschenbuchausgabe Februar 2010, btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2001 by Deutsche Verlags-Anstalt in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
UB · Herstellung: SK
eISNB 978-3-641-05896-8
www.btb-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de