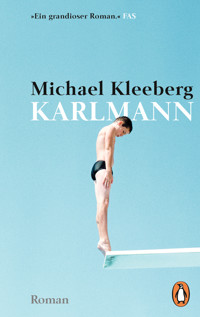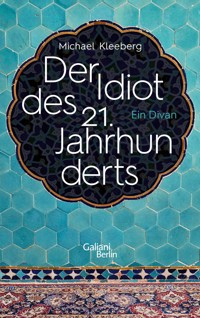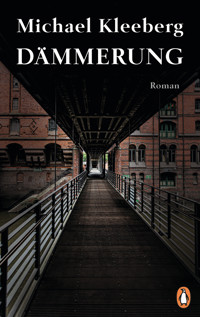
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Bilanz eines unverwechselbaren und doch eine ganze Epoche repräsentierenden Lebens
Nach »Karlmann« und »Vaterjahre« – der Höhepunkt von Michael Kleebergs Romankunst
Karlmann will’s noch mal wissen. Obwohl in die Jahre gekommen, zählt er sich) keineswegs zum alten Eisen. Jetzt, zu seinem 60sten, lädt er zur großen Sause. Und er zieht Zwischenbilanz, wie eh und je mit süffisantem Eigensinn, frei von Sentimentalität und nach wie vor nicht willens, klein beizugeben.
Das, was sich für ihn wie eine zweite Jugend anfühlt, ist vom Gedanken an Unwiederbringliches überschattet. Doch gegen die Übermacht der Gefühle hat Charly Renn sich schon immer zu wappnen gewusst. Das ist auch bitter nötig. Denn sein Selbstbild wird nicht nur in der Corona-Zeit auf eine harte Probe gestellt, sondern auch in der des Abschiednehmens vom sterbenden Vater und in der Konfrontation mit den eigenen Kindern, die längst ihre eigenen Wege gehen. So nimmt er ein letztes Projekt in Angriff, eins, das ihm noch einmal all seine Steherqualitäten abverlangt. In einer Hamburger Kultureinrichtung wird er zum Aktivisten wider Willen, nur um am Ende festzustellen, dass eine neue, eine völlig andere Zeit angebrochen ist, die nicht mehr viel mit ihm zu tun hat.
Im dritten und letzten Teil der »Karlmann«-Trilogie, die viele Jahrzehnte bundesrepublikanischer Gesellschaft erzählt, zeigt Michael Kleeberg seinen Protagonisten nun im reizvollen Licht der Dämmerung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nach »Karlmann« und »Vaterjahre« – der Höhepunkt von Michael Kleebergs Romankunst.
Karlmann will’s noch mal wissen. Obwohl in die Jahre gekommen, zählt er (sich) keineswegs zum alten Eisen. Jetzt, zu seinem Sechzigsten, lädt er zur großen Sause. Und er zieht Zwischenbilanz, wie eh und je mit süffisantem Eigensinn, frei von Sentimentalität und nach wie vor nicht willens, inmitten einer grassierenden geistigen Uniformität klein beizugeben.
Das, was sich für ihn wie eine zweite Jugend anfühlt, ist vom Gedanken an Unwiederbringliches überschattet. Doch gegen die Übermacht der Gefühle hat Charly Renn sich schon immer zu wappnen gewusst. Das ist auch bitter nötig. Denn sein Selbstbild wird nicht nur in der Coronazeit auf eine harte Probe gestellt, sondern auch in der des Abschiednehmens vom sterbenden Vater und in der Konfrontation mit den eigenen Kindern, die längst ihre eigenen Wege gehen. So nimmt er ein letztes Projekt in Angriff, eins, das ihm noch einmal all seine Steherqualitäten abverlangt. In einer Hamburger Kultureinrichtung wird er zum Aktivisten wider Willen, nur um am Ende festzustellen, dass eine neue, eine völlig andere Zeit angebrochen ist, die nicht mehr viel mit ihm zu tun hat.
Michael Kleeberg zeigt seinen Protagonisten im dritten Teil der Karlmann-Trilogie im reizvollen Licht der Dämmerung. Wie in den ersten beiden Teilen gelingt ihm ein Epochenroman, der am Beispiel seiner Figur Charly Renn viele Jahrzehnte bundesrepublikanischer Gesellschaft erzählt.
Michael Kleeberg, 1959 in Stuttgart geboren, studierte Politische Wissenschaften und Geschichte. Nach Aufenthalten in Rom und Amsterdam lebte er von 1986 bis 1999 in Paris. Heute arbeitet er als freier Schriftsteller und Übersetzer in Berlin. Für sein literarisches Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. 2008 als Mainzer Stadtschreiber. Zu seinen wichtigsten Büchern zählen: »Ein Garten im Norden« (1998), »Der König von Korsika« (2001) und »Karlmann« (2007). 2010 erschien der Roman »Das amerikanische Hospital«, der für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde und für den Michael Kleeberg 2011 den Evangelischen Buchpreis erhielt. Sein Roman »Vaterjahre« wurde u. a. mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg ausgezeichnet. 2016 erhielt Michael Kleeberg für sein Gesamtwerk den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung.
»Wenn es einen deutschen Schriftsteller der Gegenwart gibt, der die Erneuerung der deutschen Literatur aus dem Geist des Erzählens verkörpert, dann ist es Michael Kleeberg.« Tilman Krause, Die Welt über »Karlmann«
»Karlmann Renn ist endlich wieder da! Michael Kleebergs lebenskluger Roman weiß alles über den Mann in den besten Jahren und teilt es großzügig mit uns.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über »Vaterjahre«
»Seinen Bohrer setzt Kleeberg als Chronist des Tragikomischen dort an, wo es am meisten weh tut. In der Familie, im Alltag, im Mittelfeld der Gesellschaft.« Hamburger Abendblatt
Michael Kleeberg
Dämmerung
Roman
Der Autor dankt dem Deutschen Literaturfonds für die Unterstützung bei der Arbeit an diesem Werk.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2023 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Sabine Kwauka
Covermotiv: Lothar Köthe-Rehling
Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-15986-3V001
www.penguin-verlag.de
»Sei gefühllos!Ein leichtbewegtes HerzIst ein elend GutAuf der wankenden Erde.«
Drei Oden an meinen Freund Behrisch. Dritte Ode J. W. Goethe
»Dekadenz beginnt mit schlechtem Gewissen.«
Karlmann Renn
Karlmann Renn gewidmet
im Gedenken der gemeinsamen Jahre
I. Kapitel
Sechzig
Wäre die Zeit irgendwann stehen geblieben, sagen wir, vor zwanzig Jahren, dann würde links neben deinem Gedeck jetzt das Namenskärtchen von Heike stehen, deiner Frau. Aber sie ist nicht da. Sie ist auch nicht eingeladen. Und rechts von dir stünde, mit dieser kitschigen, verschnörkelten Schreibschrifttype bedruckt, die pH 5 ausgesucht hat, also Madleen, rechts von dir stünde das Kärtchen von Luisa, deiner Tochter. Auch nicht da. Auch nicht eingeladen. Und rechts neben Luisa wäre der Platz von Max. Eingeladen, aber entschuldigt. Es ist ein Achtertisch in der Mitte des Saals. Und wäre die Zeit irgendwann stehen geblieben, dann säße gegenüber von dir deine Mutter. Auch sie ist nicht da, weil tot. Und rechts neben ihr, dort, wo zwar das Tischkärtchen mit seinem Namen steht, aber kein Stuhl, stünde ein Stuhl, oder besser ein Sessel. Aber das, was einmal dein Vater war, wird im Rollstuhl an den Tisch gefahren.
Tja, so ist das, weil die Zeit eben nicht stehen bleibt.
Man könnte noch weitermachen mit denen, die fehlen, aber sie sind auf die eine oder andere Weise alle ersetzt. Achtzig Gedecke, kein Platz wird leer bleiben zur Feier des Sechzigsten von Karlmann Renn im festlich hergerichteten Clubhaus des Golfclubs von Beimoorsee bei Hamburg, am Rande der Stormarnschen Schweiz.
Grob geschätzt lassen sich die Geladenen auf etwa vier gleich große Gruppen verteilen: Familie. Freunde aus Schule und Studium. Golfer. Sonstige. Von der Arbeit niemand. Der alte Jessen, zu dem in seinen letzten Jahren ein fast Vater-Sohn-haftes Verhältnis gewachsen war und der dich zu seinem Testamentsvollstrecker bestimmt hatte, ist lange tot. Den Jüngeren einzuladen, war nie eine Option. pH 1 bis 4 natürlich auch nicht. Obwohl es eine vorzeigbare Strecke gewesen wäre.
Dafür wird die unverwüstliche Meret da sein, falls irgendwer zweifelt, dass du auch zu deinen Exen ein freundschaftliches Verhältnis haben kannst.
Sie kochen gut hier. Mit italienischer Küche ist immer noch jeder auf seine Kosten gekommen. pH 5 hat darauf bestanden, dass es auch ein veganes Menü gibt. Soll ihren Willen haben, auch wenn sie die Einzige wäre, die’s bestellt.
Der Aperitif wird draußen auf der Terrasse serviert, damit jeder sich bei seiner Ankunft erst einmal an einem Glas festhalten kann. Es ist ein wolkenloser Hochsommertag 2019, Klimawandel sei Dank.
Madleen hat sich wie gesagt um die Tischkarten gekümmert, mit Charlys Hilfe, was die Platzierung seiner Freunde und der weiteren Familie angeht, die und deren Wichtig- oder Unwichtigkeit sie noch nicht kennt. Sie sind erst seit einem knappen Jahr ein Paar, er hat sie auf einer dieser Golfreisen kennengelernt. Marbella, ein knappes Dutzend Paare, eine Handvoll Singles.
Er hat das irgendwann seinem Freund Thomas erklärt, einem hartnäckigen Monogamen: Wenn du eine gepflegte Erscheinung bist in unserem Alter (und sah ihn dabei spöttisch an) und nicht auf den Mund gefallen und Geld hast, dann gibt es überhaupt kein Problem, eine Sexualpartnerin zu finden, und bei Bedarf mehr. Die Welt da draußen ist voll von gut konservierten fünfzigjährigen Frauen, die auf sich halten und Sport machen und von den Arschlöchern getrennt sind, die sie mit fünfundzwanzig, dreißig geheiratet und deren Kinder sie großgezogen haben. Die Typen sind weg bzw. zahlen nur noch, die Kinder sind aus dem Haus, nun glaube doch nicht, dass solche Frauen jetzt meinen, das sei’s gewesen mit dem Leben. Die wissen, was sie wollen, haben etwas erreicht, kennen sich und ihren Körper und den Körper der Männer und haben ein gewaltiges brachliegendes erotisches Potenzial.
Und so ist das mit Madleen auch ganz schnell und reibungslos gegangen. Du wirst sie kennenlernen, aber du siehst ja schon auf den Fotos hier, dass sie mein Typ ist. Groß, schlank, gepflegte Hände und Nägel, das ist extrem wichtig. Und ihr eigenes Haus. Das ist ganz entscheidend. Ich denke gar nicht dran, aus meiner Wohnung rauszugehen. So ein Glacis ist Gold wert. Außerdem muss ich nicht noch mal Kinder erziehen. Auch keine fremden. Ihr jüngster Sohn wohnt noch bei ihr. Und in den Scheidungskrieg mische ich mich auch nicht ein, wenn ich nicht gefragt werde. Obwohl sie sich da extrem dumm anstellt. Insofern sollte ich vielleicht doch was sagen. Nicht dass sie dann hinterher, falls sie das Haus verliert, mit ihrem Gör bei mir vor der Türe steht.
Ist das schon der Moment, ein paar Worte über das zu verlieren, was man eine gewisse Schnödigkeit des Tons oder womöglich des Denkens nennen könnte, die uns hier an Charly auffällt?
Nein, vielleicht noch nicht. Kumulieren wir lieber noch ein wenig und warten die Ankunft der Gäste ab, die für 18 Uhr geladen sind und »smart casual« erscheinen sollen, wie es auf der Einladungskarte steht, die drei Charlys zeigt: als Kind mit Pony in der Stirn und Hasenzähnen aus der Münchner Zeit. Als glückselig lächelnden Mittzwanziger im Smoking (Foto von der ersten Hochzeit, aus dem Christine herausgeschnitten ist). Und als vielleicht fünfzigjährigen Golfer (also vor der Trennung von Heike, über den Daumen gepeilt in der Zeit von pH 1 oder 2).
Als Erste erscheint, eine Viertelstunde vor der verabredeten Zeit, Charlys Schwester, nach allem und allen doch seine älteste Vertraute. Seit vielleicht zehn Jahren haben sie ein Verhältnis zueinander wie alte Kriegskameraden, Veteranen, die an derselben Front gekämpft haben und viele Weggenossen haben verbluten sehen. Dabei spielt es gar keine Rolle oder verschwimmt mit der Zeit, ob man selbst ein Opfer war oder die casualties of war, oder besser of time, vielmehr seinerseits zu verantworten hat – es bleibt einfach, dass man einiges durchgemacht und durchgestanden hat und das Geschwister immer ein naher Zeuge gewesen ist. Man versteht einander mit wenigen Gesten und Augenaufschlägen, und man spricht eine private Sprache, deren Schwingungen bei Erika nur Charly und bei ihm nur seine Schwester wirklich versteht.
Sie lebt seit Jahren wieder in der Stadt, in einer großen Wohnung in Harvestehude, und sie hat ihren Freund im Schlepptau, den kahlköpfigen Rüdiger. Nun ja. Er ist Gestalttherapeut und ein sehr – wie soll man sagen – verkopfter Mensch. Aber offenbar tut er ihr gut, auch wenn er nicht mit ihr ausreitet und sich beim Segeln ziemlich tölpelhaft anstellt. (»Ich benutze ihn als Ballast«, dixit Erika.) Dafür hält er beim Laufen mit. Zumindest bis Kilometer zehn. Sie haben eine feste Beziehung, und nachdem Charly und seine Schwester sich darüber ausgesprochen haben, dass niemand verlangt, er müsse sich mit Rüdiger anfreunden, akzeptiert er ihn als Begleitung und Anhängsel, auch wenn er sich für nichts von dem begeistern kann oder eine Ahnung davon hat, was Charly interessiert. Umgekehrt verhält es sich ehrlicherweise genauso. Und auch Erika plant keinen gemeinsamen Hausstand mit ihrem Freund. Ganz blöd ist sie auch nicht, denkt Charly anerkennend.
pH 5, die, wenn sie nicht golft, als Fotografin arbeitet, hat sich vorgenommen, Charly ein Album seiner Feier zu schenken, und will daher jeden der eintreffenden Gäste dort am Tischchen fotografieren, wo sie ihren Aperol Spritz erhalten.
Und Erika in einem dunkelblauen Twinset, eine Perlenkette um den Hals und die Sonnenbrille auf die Stirn geschoben, ist das perfekte Beispiel für die vorhin erwähnte »gut konservierte Fünfzigjährige«, die auf sich hält und Sport treibt, und die mehr als zehn Jahre, die sie darüber hinaus ist, sieht man nur ihren Handrücken und ihrem Hals an. Madleen schiebt Rüdiger zur Seite – mit der Autorität des Fotografen (meine zweite Fotografin, denkt Charly) – und porträtiert Schwester und Bruder nebeneinander für das Veteranenfoto. Fast könnte man beide wieder, wie damals im Vorschulalter, als die Eltern sie identisch kleideten, für Zwillinge halten.
»Wann wird Papa gebracht?«, fragt Erika mit einem Blick auf ihre goldene Tissot Prestigious Lady (sie hat immerhin aus dem Krieg mit Kumpf vor zwanzig Jahren zusätzlich zu ihren Mädchen auch eine runde Million herausgeschlagen).
»Müsste schon da sein. Seine Polin bringt ihn und nimmt ihn nach ’ner guten Stunde auch wieder mit. Länger hat, glaube ich, keinen Sinn für niemand.«
Erika nickt. »Es geht im Grunde ja auch nur ums Symbolische. Er selbst wird nichts davon mitkriegen, und je länger er von zu Hause fort ist, desto unruhiger wird er.«
»Denke ich auch«, sagt Charly. Sie sehen einander an, und beide wissen, dass sie dasselbe Bild vor Augen haben: ihre Mutter.
»Weißt du eigentlich, wer Reden hält?«, fragt Erika. »Ich meine: Hast du jemanden bezahlt, damit er was Nettes über dich sagt?«
»Die sicherste Bank ist immer noch meine eigene Rede. Wolltest du was sagen?«
»Lass dich überraschen. Nein, wollte ich nicht. Wobei, die verjährten Verbrechen kenn mittlerweile nur noch ich.«
»Na ja, Kai und Thomas auch noch ein paar. Aber wie du schon sagst: verjährt. Ich nehme an, die beiden werden was zum Besten geben.«
»Schade, dass der alte Senftenberg nicht mehr lebt. Der war ein guter Redner …«
»Gott bewahre. Ich erinnere mich, wie er schon völlig dement zu deinem Fünfzigsten gequasselt hat. Der Wein war schal, die Blumen verwelkt, und von der Decke hingen die Spinnweben, als er endlich ein Ende gefunden hat. Und dabei hatte er nur einen Toast ausbringen wollen …«
»Na komm, wär dir Papa als Redner lieber gewesen?«
»So gesehen …«, lacht Charly, aber dann drängt Erika nach drinnen, weil sie wie alle als Erstes die Anordnung der Tischkarten sehen will. Da noch kein weiterer Gast in Sicht ist, kommt Charly mit.
»Eine ziemliche Hekatombe«, sagt seine Schwester kopfschüttelnd in der Mitte des Saals beim Rundgang um den zentralen Tisch. »Keine Mama, kein Franz – wann ist der noch mal gestorben?«
»2008 schon, wenn ich mich recht erinnere. Ein Jahr vor dem Selbstmord des armen Reiner. Also sitzt die Witwe Bolte bei uns. Ein wahrer Jungbrunnen, dieser Tisch.«
(»Witwe Bolte« nennen die Geschwister Henriette, Franzens Witwe, seit sie beim Leichenschmaus für ihren verstorbenen Mann Brathühner serviert hatte und Erika Wilhelm Busch eingefallen war: »Und mit stummem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück.«)
»Ich habe deine Töchter samt Männern und den Enkeln an den zweiten verfrachtet. Ist das o.k. für dich?«
Erika winkt ab. »Also keine Luisa. Charly, manchmal –«
Er sieht sie an.
»Du musst das wissen. Aber es ist hart.«
»Ich nehme an, sie wäre auch nicht gekommen, wenn ich sie eingeladen hätte. Aber warum sollte ich mir den Abend verderben?«
»Und Max wollte nicht rüberkommen aus Kanada?«
»Na komm, das kann man verstehen. Einmal Vancouver–Hamburg und zurück für einen Abend, an dem er sich doch nur langweilen würde. Nächste Generation ist doch durch deine Kinder und Kindeskinder vertreten.«
Einer der Kellner tritt zu ihnen heran und deutet auf die Tür. Da steht die Polin.
»Wie heißt sie noch mal?«, flüstert Charly. »Diese Namen sind immer so unaussprechlich.«
»Malgorzata. Nach fast zwei Jahren könntest du’s behalten.«
Nach dem Tod seiner Frau 2012 kam es für Charlys Vater, damals siebenundsiebzig, nicht in Frage, das Haus mit all den stummen Zeugen und Relikten des gemeinsamen Lebens zu verlassen. Sie halfen ihm, eine Haushälterin zu finden, denn sie hatten zu Recht Sorge, der Alte werde das große, vollgestopfte Haus nicht ordentlich und reinlich halten können. Nach der ersten Depression, die ein Vierteljahr dauerte, raffte er sich noch mal mit lebenslang geübter Disziplin auf, duschte sich morgens, zog Anzug und Krawatte an, ging an den Schreibtisch, telefonierte, kümmerte sich um sein Aktienportfolio, machte Anstandsbesuche in der Stadt, schrieb Leserbriefe und versuchte, was ja für alte Leute immer ein von vornherein verlorener Rückzugskampf ist, irgendwie im Sattel der dahingaloppierenden Zeit zu bleiben.
Es ist interessant – und erschreckend – zu beobachten, wie alte Menschen, die einen früher, die anderen erstaunlich spät, aber in jedem Falle irgendwann nach dem sechzigsten Lebensjahr (was es für Charly auch so unheimlich macht, diesen Prozess an seinem Vater zu beobachten), beginnen, sich von ihrer Zeit, also der Gegenwart der jeweiligen Epoche, abzukoppeln und ihr verloren zu gehen. Es ist ein beiderseitiger Ablösungsprozess, der häufig genug auch zunächst vom Individuum ausgeht. Zum Beispiel mit einem Beharren auf Gewohnheiten, die Jüngere nicht mehr haben und kennen (Höflichkeit, Tischsitten, Benehmen gegenüber Damen, korrekte Kleidung …). Mit einem Desinteresse an Moden und Trends, mit einer Missbilligung subjektiv empfundener Veränderungen in den Sitten und Gebräuchen. Vor allem mit einer aus jahrzehntelang geschultem Wissen um die geringe Halbwertszeit der meisten Vorgänge immer mehr nachlassenden Leidenschaftlichkeit gegenüber allem: Menschen, Politik, Neuigkeiten, Themen, Prinzipien, Ge- und Verboten. Um es kurz zu sagen: Der Drang, das eigene Wohl von der Zugehörigkeit zu einer aktiven Mehrheit abhängig zu machen, schwindet.
Und auf der anderen Seite macht die voranhetzende Gegenwart das alternde und dann alte Individuum sukzessive zu einer Kuriosität, einem Verkehrshindernis, einem Unikum, einem Stolperstein, zu Abfall.
Die Codes in Sprache und Gesten, der Zeitgeist, die Partizipationsblase oder -illusion – dieses System sortiert und scheidet diejenigen, die das Tempo nicht halten wollen oder können, hinten aus, während es zugleich permanent den Nachwuchs in die Maschine speist, der Schlange stehend darauf wartet, dazuzugehören. Ein wenig – könnte man sagen –, arbeitet die Zeit wie ein Mähdrescher, und die Spreu, die aus den seitlichen Rohren herausfliegt, sind die Alten.
Wir alle kennen Beispiele von alten Menschen, die sich mit Zähnen und Klauen gegen diesen Prozess wehren. Vor allem Menschen mit hohen Kompetenzen. Der alte Unternehmenspatriarch, der greise praktizierende Arzt und Jurist. Auch öffentliche Figuren. Gestern hat ihr Tun und Sprechen noch Ehrfurcht eingeflößt, heute klingt es irgendwie komisch. Aus einer anderen Zeit. Obsolet, lächerlich oder rührend, aber keinesfalls mehr ernst zu nehmen. Wie im Tierreich wird das alte Leittier, das den Ehrgeiz der Jungen nicht mehr bannt, in die Einsamkeit und den baldigen Tod verstoßen.
Dies alles – diese Entzweiung oder Entfremdung – muss noch keinesfalls auf ein Nachlassen des Individuums hindeuten. Womöglich hat es mit seinem Kopfschütteln, Abwinken und seinem Nicht-mit-mir gegenüber der Gegenwart sogar vollkommen recht. Aber es hat im Rauschen und Zwitschern des Jetzt irgendwann unbemerkt sein Stimmrecht verloren.
Auch bei Charlys Vater hatte dieser Prozess der Entfernung und Entfremdung von der Gegenwart bei unverminderten geistigen und (im Rahmen des Erwartbaren) körperlichen Fähigkeiten mehrere Jahre gedauert, in denen er vom respektierten Familienpatriarchen zur Witzfigur absank. Gut war das an seinen Leserbriefen zu studieren, die sich zunehmend mit Problemen und Entwicklungen auseinandersetzten, die für die Jüngeren (in diesem Fall die auswählenden Leserbriefredakteure) einfach keine Relevanz besaßen. Und je mehr sich Karl Renn akribisch formulierte und mit Quellenangaben untermauerte Gedanken um Dinge machte wie die historisch gewachsene soziale Verpflichtung des Hamburger Patriziats und ihre mangelnde Erfüllung in der Gegenwart oder die gemeinschaftsstiftende Wirkung des Mannschaftssports in Landschulheimen, die Vorteile eines Latinums in internationalen Geschäftsbeziehungen und daher seine verpflichtende Prüfung fürs Abitur, die gegenseitige geistige Befruchtung als Schlüssel langlebiger Ehen oder die Schuld der Hamburger KPD am Aufstieg der Nazis, desto klarer wurde, dass er irgendwie den Anschluss verpasst hatte. Entweder wollte niemand von diesen interessanten und kompetent analysierten Dingen wissen, oder niemand wollte darüber etwas von ihm wissen.
Und da solche Entwicklungen sich gegenseitig bedingen und steigern, winkte auch er immer öfter einfach ab. Lange leben heißt eben nicht nur, viele und vieles zu überleben, sondern auch die ewige Wiederkehr des Immergleichen mehrmals mitgemacht zu haben – beim zweiten oder dritten Mal verständlicherweise immer leidenschaftsloser.
Und so kam es, dass er, wie es den meisten Alten ergeht, irgendwann nur noch von seinen Enkeln im Kindesalter für voll genommen und in all seiner Würde und Besonderheit anerkannt wurde.
Bevor diese Erfahrungen zu bitter wurden – wer weiß, vielleicht auch, um ihnen zu entkommen –, setzte wahrscheinlich schon ab 2014, erstmals aber spürbar ab 2015, die Demenz ein.
Zu diesem Zeitpunkt lebte Charly schon seit zwei Jahren getrennt von seiner Frau, sodass nicht Heike seine Betreuung in die Hand nahm, wie es Charly aus mehreren Gründen recht gewesen wäre. Immerhin war es Heike, die den Geschwistern als Erste mitteilte, dass ihr Vater nachließ. Sie besuchte, weil es ihr lächerlich vorgekommen wäre, das Kind mit dem Bade auszuschütten und die ganze Familie mit einem Bann zu belegen, ihren Schwiegervater noch ab und zu, und nach einem dieser Besuche rief sie bei Erika an und sagte: »Ich glaube, ihr müsst etwas unternehmen. Er riecht.«
Erika, die das auch schon wahrgenommen, aber aus Scham, Bequemlichkeit und Respekt verdrängt hatte, erschrak, als wäre ein peinliches Familiengeheimnis plötzlich an die Öffentlichkeit geraten.
»O Gott, willst du sagen, er hat sich eingekackt?« (So redete man schon über Karl Renn.)
»Nein, danach riecht es nicht. Nur nach altem Mann. Nach altem Schweiß. Einfach nach Schmutz. Ich glaube, er wäscht sich nicht mehr regelmäßig.«
»Da sprichst du ihn drauf an«, sagte Erika dann am Telefon zu Charly. »Das regelt ihr bitte unter Männern.«
Und natürlich explodierte Charlys Vater, der in eine dunkelblaue Kaschmirstrickjacke, Hemd und Krawatte gekleidet war, als der Sohn mit viel Gedruckse und Um-den-heißen-Brei-Herumreden das Thema anschnitt.
»Heute Morgen habe ich mich geduscht! Ich dusche mich jeden Tag! Was nimmst du dir heraus, das anzuzweifeln. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit! Ich muss dich bitten zu gehen.«
Es stellte sich dann aber später anhand eines Zufalls heraus, dass er außer Katzenwäsche sich fast zwei Jahre nicht mehr gereinigt hatte.
Zunächst war es also, wie in der Sanduhr, langsam, langsam gegangen. Es dauerte fast zwei Jahre, bis Karl Renn an sich selbst zunehmend Vergesslichkeiten wahrnahm. Dann aber schritt der Verfall immer schneller voran, und immer mehr neben dem geistigen auch der körperliche. 2017 entschieden Charly und Erika, ihn nicht in ein Heim zu geben – so viel war dann in der Hülle des Menschen doch noch von seiner einstmaligen Autorität, und das Geld war ja da –, sondern eine Vierundzwanzig-Stunden-Pflegerin zu organisieren, Malgorzata, ein Engel von einem Menschen. Der musste sie in der ersten Zeit auch noch sein, bevor der Alte dann zu einem Gemüse wurde.
Jetzt jedenfalls sieht er aus, als befinde er sich im Wachkoma. Die halb geschlossenen Augen blicken ins Nichts und fokussieren sich auf nichts. Aus irgendeinem Grund sind seine ehemals blonden Wimpern ausgefallen, die schweren, nackten Lider sind rot, als sei der Wimpernansatz permanent entzündet, das restliche weiße Haar hat Malgorzata in Strähnen über den Schädel verteilt. Wie bei so vielen alten Männern sind die Ohren riesig geworden, was von dem dürr gewordenen Nacken unterstrichen wird, vor allem die Ohrläppchen sehen auf den ersten Blick aus, als trüge er Tunnel, und verleihen seinem Anblick von vorne etwas Dumbohaftes. Malgorzata hat sich die Mühe gemacht, ihm ein weißes Hemd und schwarze Hosen sowie ein schwarzes Jackett anzuziehen. Allerdings, was auch lächerlich wäre, keine Krawatte. Der sehnige Hals ragt aus dem Kragen wie der eines Geiers aus der Krause. Der Kopf hängt schief zur Seite, der ganze Mensch hängt schief im Rollstuhl, was keine Folge eines Schlaganfalls ist – er ist organisch überhaupt erstaunlich gesund –, sondern vermutlich von zunehmender Muskelschwäche herrührt. Malgorzata hat schon warnend gesagt, dass sie es kaum mehr schafft, ihn vom Rollstuhl aufs Klo oder ins Bett zu heben.
Sie schiebt ihn an seinen Ehrenplatz und entfernt sich dann diskret wieder nach draußen.
»Meinst du nicht, sie sollte bei ihm sitzen, solange er da ist?«, fragt Erika.
»Sieh ihn dir an. Meinst du, es macht noch einen Unterschied? Er kriegt sie so wenig mit wie uns. Hallo, Papa. Geht’s dir gut?«
»Hallo, Papa«, sagt auch Erika. Dann wischt sie ihm mit dieser typischen, von Peinlichkeit angesichts von Zärtlichkeiten gesteuerten Geste über die Schultern (die hervorstehenden Schulterblätter sind zu spüren), etwas, das ein Streicheln sein soll, aber eher wie ein Abwischen oder Abrubbeln wirkt.
Immerhin verzieht sich sein Mund zu einem Lächeln, und die trüben Augen blicken auf, um zu sehen, woher der angenehme Kontakt kommt.
»Meinst du, ich soll ihr ’n Fuffi zustecken für die Mühe?«, fragt Charly.
»Tu das, und ich leg noch einen drauf.«
»Ich muss wieder raus. Die ersten Gäste kommen.«
»Gut, ich bleib noch ’ne Minute bei ihm. Ach, und sag Malgorzata, sie soll reinkommen. Du kannst die doch nicht vor der Tür stehen lassen wie einen Chauffeur.«
pH 5 ist schon eifrig am Knipsen. Die ersten Paare und einzeln Gekommenen bilden eine kleine Schlange am Aperol-Tisch und werden von der Serviererin versorgt.
Es wird viel gewunken und gegrüßt, untereinander und zu Charly hin, was Madleens Arbeit erschwert, die jetzt schon feststellen muss, dass niemand die Disziplin aufbringt, am Eingang zu warten, bis sein Konterfei aufgenommen ist. Und auch Charly bleibt nicht brav stehen, sondern bewegt sich auf die Gäste zu, umarmt die Witwe Bolte, seine Stieftante Henriette, umarmt alte Schulfreunde, die gemeinsam und mit ihren Frauen und Männern erschienen sind, weil auch sie hier noch wohnen, vierzig Jahre nach dem gemeinsamen Abitur. Auch seine Nichten und (was für ein Wort!) Großneffen, zwei der mittlerweile insgesamt fünf Enkel Erikas treffen ein, samt zugehörigen Männern, alle sehr smart und nicht allzu casual.
Im Grunde ist Charly dankbar für die Anwesenheit der beiden die Familie auf vier präsente Generationen erweiternden Kinder, auch wenn sie’s vermutlich nicht lange aushalten werden, weil eine solche Feier nicht auf sie zugeschnitten ist. Das geht ja jetzt schon los mit dem Aperol Spritz, der weder für Claras neunjährigen Sebastian das richtige Getränk ist noch für den vierjährigen Alonzo, den Sohn Bettinas, der jüngsten und einzigen unverheirateten Tochter Erikas, die aber mit dem Kindsvater, ihrem ständigen Begleiter, gekommen ist, einem, ich glaube, kolumbianischen IT-Spezialisten. Ja, die drei Nichten, alle knapp über dreißig und adrett bis schön, und ihre Kinder verjüngen die Sache hier doch aufs Angenehmste. Anders als andere haben sie was aus sich gemacht und können jede Gesellschaft bereichern.
Sechzig ist eine Grenze, da sollen sie alle sagen, was sie wollen. Der letzte runde Geburtstag ohne Schnabeltasse, hat Charly im Vorfeld gescherzt, und wenn ich an den Fünfzigsten denke, den wir auch schon hier gefeiert haben – die Familie war noch intakt, und auch die Eltern lebten noch (bezeichnend, dass du vom Alten auch in der Vergangenheitsform sprichst) –, dann existieren doch ein paar subtile Unterschiede. Wir feiern ja mehr oder minder nach dem gleichen Schema, seit wir achtzehn sind. Aber zum ersten Mal gibt es angesichts der Kontinuitäten ein gewisses Innehalten und Zögern: Glaube ich mir das selbst noch, diese innere Unverändertheit? Glaube ich sie den andern? Ja, doch, aber erst, nachdem ich mir einen kleinen Schubs gegeben habe. Und im Vergleich zum fünfzigsten Geburtstag? Eines rechtfertigt alle Brüche: die Freiheit. Die Freiheit, zu sein und zu leben, wie du möchtest, die ist ungleich größer geworden. Und geht’s nicht genau darum im Voranleben: sukzessive zur Freiheit zu kommen, indem man eine Kette nach der anderen abwirft?
Aus den Augenwinkeln siehst du, dass pH 5 ihren Plan bereits aufgegeben hat und stattdessen Henriette nach drinnen scharwenzelt, ihre Charmeoffensive gegenüber seiner Familie, seinen Onkeln, Tanten, was nicht noch, fällt umso mehr auf, als ihr Interesse an seinen Freunden gleich null ist.
Mit der entspannten Kälte, die im Laufe der Jahre gekommen ist, siehst du auch das Ende dieser Beziehung schon am Horizont heraufziehen. Momentan wiegt die Schale mit den Vorteilen und Annehmlichkeiten allerdings noch schwerer.
Und heute geht’s um Harmonie und Perfektion. Also keine dunklen Wolken an den Horizont beschwören. Jetzt scheinen die Schleusen geöffnet, unten auf dem Parkplatz stauen sich die Autos, und es kommt dir, freudig und erwartungsvoll, gut gelaunt, gereift und unverändert unter der Maske der grauen Haare, Falten und dicken Bäuche die sich gleich gebliebene Essenz unserer zwanzig Jahre entgegen, der Mensch gewordene Ertrag deines Lebens.
Eine gute halbe Stunde später ist das Gros der Gäste eingetroffen und steht in zahlreichen Grüppchen – Inseln ohne verbindende Brücken – im späten Sonnenschein auf der Terrasse. Nur die kleine Schar der über fünfundsiebzigjährigen Verwandten hat sich bereits nach drinnen begeben, sei es, um der Form halber Karl Renn zu begrüßen, sei es aus halb bewusster Abgrenzung gegenüber den Jüngeren oder einfach um sich auf den vorgeschriebenen Plätzen niederzulassen im Gefühl, damit das Ihre getan zu haben, um die Veranstaltung voranzubringen, starten zu lassen, hinter sich zu bringen.
Dieser Drang, diese gewisse disziplinierte, freudlose Unrast des Alters, ist denn auch der Hauptunterschied zu denen draußen, die ja auch in ihrer übergroßen Mehrheit keine jungen Leute mehr sind. Und in vielerlei Hinsicht eben doch – das ist das Faszinierende.
Da ist die Gruppe von pH 5s Golffreunden, bei der sie steht. Die Gruppe von Charlys Golfkumpels aus dem Club hier. Erika und ihre Mädchen samt Anhang. Die Mitabiturienten. Die Studienfreunde. Die wenigen Einzelnen ohne Bezug zu anderen, die sich deshalb zusammenfinden, weil sie von jeder der anderen Gruppen abprallen. Insgesamt aber, lässt man den Blick schweifen, ein recht homogenes Bild. Das war im Sommer letztes Jahr anders, als auf einer gemieteten Barkasse im Hafen das vierzigjährige Abiturjubiläum gefeiert wurde. Ein knappes Dutzend der seinerzeit fünfzig Ehemaligen ist heute auch da, aber nicht die, die Charly schon vor fünfundvierzig Jahren ebenso wenig interessierten wie heute, und darunter befinden sich all jene, die mit ihren Neurosen und Ticks, mit ihren Unfähig- und Merkwürdigkeiten, ihrem cringy Auftreten, ihren Lebenszielen und ihrer sperrigen Inkompatibilität schon damals durchs Raster gefallen sind.
Was fehlt überhaupt?
Die Gescheiterten natürlich. Muss nicht sein. Dann Künstlervolk: keine Musiker hier, keine Maler, keine Tänzer, keine Schriftsteller, keine Schauspieler. Dann die Prominenz: keine Politiker, keine Fernsehnasen, kein Olympiasieger, kein Bundesligafußballer. Und natürlich fehlen die Fanatiker aller Couleur: kein in die Jahre gekommener KBWler. Auch kein Toskanafraktionär. Kein Morgenthau-Grüner (opportunistische SUV-Grüne dagegen zuhauf). Kein Drittwelt- oder Klimaaktivist. Kein Umverteiler (meines Wissens). Ebenso die Freaks: keine Tunte (nichts gegen normale Schwule), kein Geschlechtsumgewandelter, keine Schocklesbe. Interessanterweise sind auch die Graswurzel-Weltverbesserer abwesend (nicht aus Prinzip, du kennst nur keinen): kein Sozialpädagoge, keine Altenpflegerin, kein Feuerwehrmann.
Stattdessen Anwälte, Ärzte, Zahnärzte. Womöglich auch ein Tierarzt. Ein- und Verkäufer, teils mit eigener Firma. Immobilienverwalter. Techniker vom Agrar- bis zum Maschinenbauingenieur. Pharmazeuten. Verwaltungsjuristen. Banker, Trader. Paar Psychologen (die aber alle studierte Ärzte sind, also keine Quacksalber). Versicherungsmathematiker. Informatiker.
Was also an dieser bunten Gästeschar erweckt den Eindruck von Homogenität, und warum hat Charly den Eindruck, hier »den Ertrag« seines Lebens vor sich zu haben, womit er meint, dass seine Freunde einen Spiegel bilden, der vor allem ihn kenntlich macht?
Lass es mich an folgendem Beispiel erklären: Irgendwann im VWL-Studium hatte die Handvoll KPD-MLer, die immer erfolglos versuchte, Marx und Lenin und Mao zu diskutieren statt Adam Smith und Schumpeter, beim Professor durchgesetzt, sich wenigstens mit Bahros Alternative zu beschäftigen, die damals recht frisch erschienen und in aller Munde war. Der Professor drehte den Spieß allerdings um und vergab eine Hausarbeit: »Leiten Sie historisch her, inwieweit Bahro von falschen Prämissen ausgeht und zu falschen Schlüssen kommt«. Damals hat Charly sich mit einer Passage beschäftigt, die hier zupasskäme: Bahros Theorie vom »überschüssigen Bewusstsein«, das freigesetzt wird, der »nicht mehr vom Kampf um die Existenzmittel absorbierten psychischen Kapazität, die in Praxis umzusetzen ist«. Die moderne Produktionsweise, so Bahro, in der die intellektuelle Arbeit zum wesentlichen Faktor wird, erzeuge in den Arbeitenden Fähigkeiten und Wünsche, die in die Praxis umgesetzt werden wollten. So weit, so gut. Nur lief es bei Bahro darauf hinaus, dass dieses überschüssige Bewusstsein im Spätkapitalismus nur zu erhöhtem Konsumwunsch führe und erst im wahren Sozialismus »emanzipatorisch« werde und sich in idealeren, wertvolleren Sphären ergehe. Das Wort und der Gedanke, die Bahro gefehlt haben, um meine Gäste zu erfassen, denkt Charly, heißt Hobby.
Die Gemeinsamkeit der Anwesenden liegt genau darin, dass sie alle ihr überschüssiges Bewusstsein in ihre Hobbys stecken, für die sie das Geld, die Zeit, die Fähigkeiten und die Leidenschaft mitbringen. Und natürlich die Reife, die dazugehört, um zu wissen, womit man sein Leben bestreitet und womit man seine Freizeit erfüllt. Und da Bahro keinen Begriff von Hobbys hatte, konnte er auch nicht ahnen, dass sich in ihnen das kompensatorische mit dem emanzipatorischen Element aufs Verträglichste vereint. Die achtzehnjährigen Gitarren- und Klaviervirtuosen, die wussten, dass sie nicht Jimmy Page und Elton John werden würden, zelebrieren Hausmusik oder spielen in Garagenbands die alten Hits nach. Die Sportler, die ahnten, dass es bei ihnen weder zu Boris Becker (es gibt einen Gast, der mal die Nummer 1001 der deutschen Tennisrangliste war) noch zu Dieter Baumann reichen würde, helfen in ihren Tennisclubs mit, bei den Ü-50-Bezirksmeisterschaften die Konkurrenz aus Trittau oder Grande zu besiegen, oder bestreiten den Hamburg- oder Boston-Marathon oder irgendwelche Triathlons. Und auch wenn sich kein Franz von Assisi und keine Mutter Teresa unter ihnen befinden, dann doch viele, die im Ehrenamt sozialen Tätigkeiten nachgehen und sich um Kinder, Kranke und Ausländer kümmern – und reichlich spenden (gegen Quittung). Wahrscheinlich spielen sogar welche auf Amateurbühnen Agatha-Christie-Stücke nach oder tanzen argentinischen Tango – mit ihren Ehepartnern!
In den Gesprächen nachher wird jeder beim andern faszinierende Entdeckungen machen können in dieser Hinsicht. Charly zum Beispiel hat sich jetzt neben dem Motorradfahren aufs Restaurieren alter Autos geworfen. Er steckt endlos Zeit in die Suche nach Originalteilen seines wunderbaren Pagodendach-280-SL, einem W113 von 1970.
Ein Grund also für die Homogenität von Charlys Gästen und für den Eindruck, dass sie wie ein erweiterter Zeitkörper seiner selbst wirken, ist, dass sie alle Hobbyisten sind. Was aber eben auch bedeutet: temperierte Menschen, vernünftige Menschen, Protagonisten einer Konformität, gegen die nur diejenigen das Wort erheben, die nicht das Zeug haben, aus eigener Kraft den Normen zu genügen, die die Gesellschaft und das Leben, ja die ganze Existenz zusammenhalten.
Diese Konformität steht, wie Charly empfindet, nicht nur nicht im Gegensatz zur Individualität, sondern ist vielmehr die einzige Basis, auf der Individualismus sich entfalten kann, ohne abseitig, schädlich und parasitär zu werden.
Diese Konformität hat auch etwas zu tun mit einer gewissen Familienähnlichkeit aller Anwesenden – Ähnlichkeit bei größtmöglichen individuellen Unterschieden. Diese Ähnlichkeit beruht auf dem Alter. Gemeint im umfassendsten Sinne: dem physischen Alter eines jeden, dem Zeitalter und einer gemeinsamen Art, in diesem Zeitalter zu altern.
Das verlangt nach Erklärung. Nehmen wir so gänzlich verschiedene Physiognomien wie die von Meret, Charlys alter vormaliger Schul- und Bettfreundin, von Kai, seinem Studien- und Golffreund, und von Ines, der Lebenszeugin seit fast einem halben Jahrhundert. Jeder von ihnen hat sich, seit Charly sie kennenlernte, physisch gewaltig verändert, was aber dem, der sich zugleich mit ihnen verändert hat, genauso wenig auffällt oder ihn schockiert, wie ihnen selbst. Denn das Entscheidende hat sich nicht verändert: der Habitus, die Art zu sprechen, die Gestik, die sich so oder so äußernde Natur, der Blick, das Lächeln oder Lachen, die Art zu argumentieren oder sich zurückzunehmen. Vor allem anderen: die Stimme, ihr Klang, ihre Intonation. Man könnte, wollte man einen so veralteten wie vagen Begriff benutzen, sagen, dass in der Stimme die unveränderliche Seele aus einer veränderten Physiognomie herausschaut und sie so sehr überstrahlt, dass sie sie quasi unsichtbar macht.
Dabei ist Merets Gesicht verschrumpelt wie ein Apfel, der zu lange an der Luft gelegen hat und aus dessen Schale mit der Feuchtigkeit alle Spannung verschwunden ist. Als hätte jemand mit dem Kajalstift nachgeholfen, ziehen sich die tiefen Runzeln sternförmig vom Mund weg, dessen Lippen, was der fast orangerote Lippenstift noch unterstreicht, kaum dicker sind als sie. Diese Runzeln strahlen hinauf zu den Wangen, verlaufen entlang der Nase, über den Kiefer und multiplizieren sich über das gesamte Gesicht hin in einem feinen, aber keinen Flecken aussparenden Myzel von Linien und Falten, mit dem Ergebnis, dass Merets Gesicht erschreckend an einen an einer Hüttenwand aufgehängten Schrumpfkopf erinnert, einschließlich der pergamenten wirkenden Konsistenz der Gesichtshaut, die Charly aus Forscherdrang gerne einmal berühren würde, bestünde nicht die Gefahr, dass der Schrumpfkopf plötzlich zum Leben erwachte und sich das halb wissenschaftliche, halb angeekelte, in jedem Falle aber unzärtliche und unerotische Tasten und Tatschen verbäte – oder noch schlimmer: als Aufforderung zu weitergehenden Intimitäten verstünde und begrüßte.
Kai, der getreue Lebensbegleiter und Schatten und – in grauer Vorzeit – Konkurrent; dein Alter Ego also, nett gesagt, trug vor unvordenklicher Zeit das flaumige Blondhaar in einer Frisur, die um 1964 als gewagt gegolten hätte, hat nun aber auch schon, solange Charly denken kann, eine spiegelblanke Glatze, Konsequenz, zu der er sich, jeglicher Halbheiten abhold, irgendwann durchgerungen hat. Im Laufe der Jahre ist aber, trotz Radfahren und Golfspielen, nicht nur sein Körper, ohne geradezu fett genannt werden zu können, massiger geworden – er wiegt seine runden 110 Kilo –, auch der Schädel scheint zugenommen zu haben und beinahe – ohne dass sich die Züge darin ebenfalls vergrößert hätten – angeschwollen wie ein Blutmond, sodass jedermann, der den Film kennt, bei seinem Anblick unweigerlich Colonel Kurtz vor sich sieht oder besser den ungesund teigigen Mondschädel des alten und übergewichtigen Marlon Brando. Nur dass Kai dann nicht, wenn er von seiner Frau genug hat oder ihm ein Putt danebengeht, »The horror, the horror« murmelt, sondern, wenn Charly sich bei ihm für eine Gefälligkeit bedankt, mit derselben jungenhaften Stimme wie einst im WiWi-Bunker und in liebevollem Missingsch entgegnet: »Da nich’ für, mein Schietbüdel.«
Ines, auch schon mehrfache Großmutter, deren Sommersprossen rund um die Nase zu braunen Altersflecken verlaufen und verblasst sind, hat sich zu einer Matrone gewandelt, deren tonnenförmiger, von einem geblümten Sommerkleid umhängter Körper neben dem knochig und klapprig gewordenen ihres sehr alten Mannes zusätzlich an Imposanz und Verdrängung gewinnt. Nach einem Schlaganfall vor einigen Jahren, von dem er sich recht gut erholt hat – lediglich auf einen Stock ist er beim Gehen angewiesen – kommen Edschmidts Worte etwas verschliert und verschliffen heraus. Er stakst an ihrem Arm auf das Geburtstagskind zu, das er natürlich immer noch siezt, und sagt: »Meie allerhääsch Lüggwüüsch, Ha-Enn«, worauf Ines, die so stabil wirkt, als könne sie ihn auch wie einen Lumpensack über der Schulter tragen, erklärend hinzufügt: »Volker gratuliert dir herzlich.«
Offenbar ist sie es mittlerweile gewohnt, ihn zu übersetzen, selbst wenn es wirklich klar ist, was er sagen wollte. Danach bugsiert sie ihn nach drinnen zu den anderen Greisen und kommt dann, sich das Kleid glatt streichend, wieder heraus, wobei es ein wenig aussieht, als rolle sie auf Rädern und Schienen: Ihr Körper hat etwas entschieden Lokomotivenhaftes. Hals und Taille sind vollkommen verschwunden, der Hinterkopf liegt auf einem Wulst von Nackenspeck auf, und um diesen massiven Hals ist ein zu enges Platincollier geschnürt wie ein Kälberstrick. Ihr kehliges Lachen ist aber hell und blechern wie ehedem, und an ihm hört man, dass aus dem massigen Torso wie aus einer klobigen und unförmigen Pietà Rondanini die frühe, die eigentliche und ewige Ines herausgemeißelt werden könnte.
All diese Augeneindrücke, unbestreitbar, wie sie sind, übersetzen sich aber in der inneren Sprache nicht in das Wort alt, und um wirklich einen Schock zu empfinden angesichts ihrer aller Altern, braucht es gewissermaßen eine optische Täuschung – nur unter genau umgekehrten Vorzeichen wie üblich –, also vielleicht eher eine täuschende Optik. Und genau zu deren Opfer wird Charly jetzt für die Dauer von ein, zwei Sekunden, in denen er, eine Gesprächspause nutzend, mit schweifendem Blick seine Gäste gescannt hat und – abgekoppelt vom individuellen Auge-zu-Auge- und Ohr-zu-Ohr-Kontakt, der die Jahre unsichtbar werden lässt, die Körper und Gesichter sozusagen anonym wahrgenommen hat – mit einer gewissen Erschütterung. Und diese Erschütterung steigert sich jetzt, als er von schräg hinten einen wirklich alten Leib wahrnimmt, am Tisch eher kauernd als sitzend. Ein sehniger Hals, aus dem die am Ansatz schlohweißen Strähnen nach oben zu einem großmütterlichen Dutt verlaufen – wer um Himmels willen ist diese Scharteke, er kann sich nicht erinnern, sie eingeladen zu haben –, und dann macht der Kopf eine Vierteldrehung zu ihm hin, das Kinn hebt sich zu ihrem typischen perlenden Gelächter – es ist seine Schwester! Sie hat sich kurz das Haar hochgesteckt, jetzt löst sie die Kämme, schüttelt es aus, und der Hexenhals und die weißen Ansätze sind verschwunden wie ein böser Spuk.
Diese gemeinsame Art aller Gäste zu altern, ohne zu altern, die Tatsache, zwar fünfundfünfzig oder sechzig Jahre alt zu sein, ohne dass irgendwem der Gedanke an Alter käme, ohne dass der Gedanke an Alter aus irgendjemandem käme – diese bereits erwähnte Familienähnlichkeit – worin besteht sie? Woher kommt sie?
Nun, es braucht sozusagen zwei, um zu altern. Einen Körper, der das automatisch tut, und einen Geist, der sich dazu verhält, indem er sich seinerseits verändert. Noch die Generation von Charlys Eltern dachte, empfand und handelte kongruent zu diesem Prozess, und das nicht etwa, weil sie so viel schneller gealtert und gestorben wäre als die nachfolgende. Nein, der Unterschied in der statistischen Lebenserwartung beträgt zwischen Charly und seinem Vater keine drei Jahre. Das kann es nicht sein. Aber Karl Renn, um bei ihm zu bleiben, war noch ein Mann, der danach strebte, seine Jugend hinter sich zu lassen, die für ihn und seine Generation keinen Eigenwert besaß. Als er das Gefühl hatte, nun sei es so weit (sprich, als er Geld verdiente und auf Freiersfüßen ging), legte er sie ab wie einen zu eng gewordenen Konfirmandenanzug. Nunmehr ging es darum, Reife zu erwerben, und worin immer diese Reife genau bestehen mochte, war sie doch zu großen Teilen eine Absage an das Verhalten, die Überzeugungen und äußeren Merkmale der Jugend.
Und die klassischen Wegmarken – die Kinder sind aus dem Haus, haben ihre Berufsausbildung abgeschlossen und ihrerseits eine Familie gegründet, der eigene Berufsweg endet mit dem Beginn des Rentenalters – deuteten für jemanden wie Karl Renn an, dass die Zeit fürs Altenteil nahte – auch wieder nicht so wie für die vorangegangene Generation, in der Altenteil nur hieß: Muße und Vorbereitung auf den Tod, aber doch als ein gefühls- und wesensbewusstes Heraussteigen aus dem Hamsterrad und das Einnehmen einer Beobachter- und Erinnerungsposition.
Und dass er als Zwanzigjähriger mit Schmalztolle mit seiner Freundin, die Petticoat und weiße Söckchen trug, wie ein Verrückter Mambo getanzt hatte – Uncle Sambo, mad for Mambo –, das hatte er gründlich vergessen, ohne es auch nur verdrängen zu müssen. Es gehörte zu dem, sagen wir, sechzigjährigen Karl Renn so wenig wie die fünftletzte abgelegte Haut zu einer Schlange. Und die Idee, zu seinem runden Geburtstag wieder mit den Hüften zu wackeln und mit den Händen affige Gesten zu vollführen, wäre vollkommen absurd, unwürdig und geschmacklos gewesen.
Es stand, um noch ein altertümliches und kaum mehr verständliches Wort zu verwenden: der Ernst des Lebens dazwischen, den man erfahren und gelernt und verinnerlicht hatte, und der machte, dass ein Perpetuieren des jugendlichen Ichs einen zum Esel werden lassen würde.
Ist es denn aber so, dass keiner von Charlys Gästen diesen Ernst des Lebens empfinden würde? Doch, natürlich, sie empfinden ihn mit graduellen Unterschieden alle, doch hat sich das, was sie damit verbinden, gewandelt. Vielleicht hilft es, zunächst noch einen Blick auf die Physis zu werfen:
Wenn wir einen Querschnitt der Gäste nach ihren Operationen und Medikationen erstellen wollten (ausgenommen wiederum die drinnen sitzenden Greise), dann kämen wir auf zwei Männer, die sich Insulin spritzen, einen, der wegen Schilddrüsenüberfunktion behandelt wird, sechzehn, die Blutdrucksenker nehmen (darunter Charly), neunzehn, die einen zu hohen Cholesterinspiegel haben, neun, die unter Prostatavergrößerung und Beschwerden beim Urinieren leiden, und einundzwanzig, die regelmäßig Viagra nehmen (darunter Charly), davon fünf, die das vor dem Verkehr mit ihrer Frau tun.
Was den mechanischen Apparat betrifft, kommen fünf künstliche Hüftgelenke und drei künstliche Kniegelenke dazu. Ferner sitzen hier unter den Männern zwei, die eine Krebserkrankung (Leukämie, Prostata) überstanden haben, unter den Frauen fünf, die über keine Gebärmutter mehr verfügen, und zwei, deren Brüste plastisch wiederhergestellt sind, sowie ein COPD-Patient.
Das rein Kosmetische angehend, lächeln uns fünfundvierzig teil- oder ganz überkronte Gebisse an, zwei (weibliche) Nasen sind korrigiert, fünf Lippenpaare sind vergrößert, drei mal zwei Brüste, eine Vagina ist verkleinert, etwa zwanzig Hälse und Kieferpartien sind (nicht nur bei Frauen) per Spritzen von Falten befreit, und mehrere Bäuche und Schenkel tragen die kaum sichtbaren Narben von Fettabsaugungen.
Viel häufiger als in der Vätergeneration handelt es sich hier um Dorian-Gray-Interventionen, um Abwehrkämpfe gegen den als Störung, als Widernatürlichkeit empfundenen Prozess des Alterns. Charly und all seine Bekannten und Freunde hier sind eine der ersten Generationen, die die Jugend nicht mehr überwinden und hinter sich lassen wollten, sondern sie verewigen. Sie alle halten ihrer Jugend innerlich die Treue, weil sie wissen und spüren, dass sie im Zustand und Selbstgefühl der Jugend sie selbst sind. Und dieses Selbstgefühl weicht nicht. Ihr Reifeprozess, ihre Leistung ist die permanente Wiederholung. Sie perpetuieren diese Jugend, weil die keine Durchgangsstation mehr ist, sondern ihr Eigentlichstes, ihre Wirklichkeit und Wahrheit.
Vielleicht hilft uns, um das verständlich zu machen, ein kürzliches gesehenes – aber es gibt Hunderte der gleichen Art – Foto der Rolling Stones, aufgenommen knapp sechzig Jahre nach ihrer Gründung. (Drinnen läuft gerade, in dezenter Lautstärke, als Loungemusik You Can’t Always Get What You Want, davor Jumpin’ Jack Flash.) Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und der später dazugekommene Ron Wood: alte, faltige, runzlige, aufgespritzte, mit neuen Zähnen versehene Greise zwischen fünfundsiebzig und achtzig – und zugleich, blickt man nur lange genug auf das Bild: die Stones. Die ewigen Stones, die ewig jugendlichen Rebellen. Die Essenz der Stones: sehnige, grinsende, zur eigenen Verblüffung die Welt erobernde Schlakse. Naiv und frech, unbändig. Sie sind es noch stets, weil ihre Leistung die magische Wiederholung und Perpetuierung des Moments ist, in dem sie der Welt zum Urknall einer seither nie verlorenen Erkenntnis verhalfen: Die Jugend ist das Paradies. Und aus diesem Paradies hat uns nichts je wirklich vertreiben können, auch nicht das Alter.
Deswegen ähneln Charlys Gäste einander: weil sie alle wie verkleidete Jugendliche wirken. Die grauen Haare sind Perücken, die Falten sind aufgemalt, die Fettpolster sind Kissen, die Krankheiten sind reparierbare technische Defekte. Und alle hier haben die Mittel, obwohl die Garantiefrist lange abgelaufen ist, die Mechaniker und Ersatzteile zu bezahlen.
Bei Charly und bei allen anderen leuchtet die unveränderte Jugendlichkeit aus den Augen und Stimmen hervor, weil das Alter – diesmal das Zeitalter – nicht mit Krieg und Vertreibung, Mord und Tod, Armut und Entbehrung, Schuld und Verzweiflung diese Jugend ausgetrieben und durch bittere Reife ersetzt hat; das Altern ist lediglich ein physiologischer Prozess gewesen, kein existenzieller, keine Vergewaltigung. Die Falten und Runzeln sind keine geistigen, sie sind nur Physik und Chemie.
Man merkt das auch manchmal an der Sprache, die binnen zweier Generationen abgerüstet hat bis zum Kindisch-Diminutiven. Als pH 5 vorhin in ihrer ostentativ liebevollen und sich permanenter Zeugenschaft versichernden Art Karl Renn (der davon nichts mitkriegte) begrüßt hat, umarmte sie ihn von schräg hinten und schrie ihm dann ins Ohr: »Hallo Karl! Ich bin’s, Madleen! Bist du jetzt auch unter die Rollifahrer gegangen?«
Rollifahrer! Der Alte selbst hatte einen Menschen im Rollstuhl zu seiner Zeit noch schlicht einen Krüppel genannt. Und er hätte sich eine Bezeichnung wie Rollifahrer als eine den Ernst der Lage verspottende Beleidigung verbeten. Wie gut, dass das gewiss lieb und schonend gemeinte Wort nicht zu ihm durchdringt. Aber so etwas Krudes wie Krüppel ist schlicht nicht mehr zumutbar – vor allem für den, der es aussprechen soll.
Was Charly an einen Abend in den frühen Achtzigern erinnert, vielleicht war es der Fünfzigste des Alten gewesen, jedenfalls war er schon mit Christine zusammen, und er und Erika hatten die Eltern zu einem Abend im Circus Roncalli eingeladen. Und der Alte beugte sich mehrmals zu Charly rüber und fragte, mühsam seine Langeweile unterdrückend: »Und wann kommen die Löwen oder Tiger?« Erika hatte dann vermutlich etwas über den Tierschutz erzählt, worauf er höhnisch schnob: »Ein Zirkus ist doch kein Streichelzoo!« Und als sie ihn auf dem Nachhauseweg gefragt hatten, ob es ihm gefallen habe, sagte Karl Renn: »Es war nett. Es war so wie der Kinderzirkus in meiner Jugend.«
Siebzig ist das neue Sechzig, Sechzig das neue Fünfzig, Fünfzig das neue Vierzig und Vierzig das neue Dreißig. Und weil es in Wirklichkeit noch viel extremer ist, sitzen hier in den Larven der Sechzigjährigen lauter Fünfundzwanzigjährige. Dementsprechend erwartungsfroh sind sie eingetroffen. Zeit für Bilanzen? I wo, so weit sind wir noch nicht. Und wenn, dann nur launige.
Charly tritt zu einem Grüppchen Männer, das ebenfalls noch auf der Terrasse ausharrt – die meisten mittlerweile beim Weißwein – und in die schräge Sonne blickt, die das Green von Loch 18 in schimmerndes Licht taucht. Kai ist dabei und der Mann seiner mittleren Nichte Clara, ein Verwaltungsjurist, mit dem sie nach Berlin gezogen ist, Dr. Hubert Sprötten, für Charly wegen der Verwandtschaftsbeziehungen natürlich Hubert, obwohl er ihn erst das zweite Mal sieht. Die Runde öffnet sich dem Geburtstagskind bereitwillig, und Charly hört zu, um Anschluss an die Konversation zu finden. Offenbar geht es gerade um die Versorgungsmentalität der Parteien.
Holger, ein Mitabiturient Charlys, weiß ein Beispiel aus der Hamburger Gasversorgung. »Die Partei ruft beim Vertriebsvorstand an: Wir haben hier drei Leute, die müssen wir unterbringen. Verdiente Genossen.«
»Wollte gerade schon fragen: Welche Partei?«
»Ist wohl in Hamburg nicht nötig. Jedenfalls wurde dann rasch eine Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Energiewende aufgemacht, wo die Jungs Stabsstellen bekommen und Dünnschiss verzapfen dürfen. Wollt ihr hören?«
Die anderen nicken.
»›Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima kann die Energiewende nur gelingen, wenn alle Akteure in Politik, Energiewirtschaft und Bürger daran aktiv mitwirken.‹ Akteure in Bürger. Und dafür gibt’s dann B 9.«
»Akteure in Bürger hört sich nach ’nem typischen Copy-&-Paste-Fehler an«, sagt Charly. »Kriegen zwar B 9, aber haben dafür keine kompetenten Sekretärinnen mehr.«
»Na ja«, meint Hubert, »früher hat die SPD das noch diskreter gemacht, bei uns in Berlin macht sie’s heute in aller Öffentlichkeit. Da haben sie letztens per öffentlicher Ausschreibung einen Geschäftsführer für die Bauakademie gesucht, und wer ist als ›der ideale Kandidat‹ bezeichnet worden? Ein parlamentarischer Staatssekretär von der SPD, der einen neuen Job brauchte. Er hat zwar in seinem Leben noch keinen einzigen Bauantrag gesehen und ist auch nur ein abgebrochener Jurist, aber die Jury der Findungskommission ernennt ihn gegen alle Architekten und Baufachleute, die sich auch beworben hatten. Die dreisteste Selbstbedienung vor aller Augen!«
»Na ja, sie machen es alle«, sagt Kai. »Wer die Drecksarbeit für die Partei macht und nix kann und nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, der soll halt auch nicht darben.«
»Dafür ist die Staatsknete doch da!«
»Sehr richtig«, sagt Hubert, »aber keiner treibt es so schamlos wie die SPD.«
»Bloß drücken die andern Parteien alle Augen zu, damit sie’s genauso machen können. Fördermittel werden bereitgestellt. Irgendwelche Vereinigungen bieten was weiß ich an, zum Beispiel Weiterbildungsprogramme. Das wird immer gebraucht. Und da sind immer ein paar gute Stellen drin, vorausgesetzt, du hast das entsprechende Parteibuch.«
»Die öffentlich-rechtlichen Gesellschaften, über die du den Staat schröpfen kannst, sind ja auch nicht gerade Mangelware«, sagt ein anderer. »Wohnungsbaugesellschaft, Verkehrsbetriebe, Stadtreinigung, Energieversorgung, da kriegen die Vorstände überall sechsstellige Jahresgehälter!«
Kai blickt sich in der Runde um und meint: »Kinder, man muss auch gönnen können«, und alle lachen.
»Trotzdem«, legt der Mann von Charlys Nichte wieder los, »das sind schon echte Dekadenzphänomene. Seit das BMU –«
»Das was?«, fragt einer.
»Bundesumweltministerium.«
»Man merkt, dass du aus Berlin kommst.«
»Seit das also in SPD-Hand ist, haben sie dort wie eine Zwischendecke einen neuen Leitungsbereich eingezogen und Dutzende verdienter Genossen rübergeschafft und verbeamtet.«
»Wenn’s so weitergeht«, sagt Charly, »sind irgendwann alle übrig gebliebenen Beamten SPD-Funktionäre.«
»Und alle verbliebenen SPD-Mitglieder Beamte!«, fügt Kai hinzu.
»Und alle Aufsichtsräte von Unternehmen mit Staatsbeteiligung gescheiterte SPD-Politiker.«
»Jedenfalls«, sagt Hubert, »ist seit dem Umzug nach Berlin die Zahl der Beamten um 40 Prozent gestiegen.«
Die Frau von Holger kommt dazu, umarmt ihren Mann, flüstert ihm etwas ins Ohr, und er sagt: »Entschuldigt mich eben«, und geht mit ihr fort.
»Ich hab’s auch aus dem Kanzleramt gehört. Man gründet einen neuen Leitungsbereich und setzt dort Fake-Beamte rein, die nichts zu tun haben und die Fachreferenten in den Wahnsinn treiben, indem sie ständig irgendwelche Vermerke anfordern.«
Kais Frau, die sich mit Ines unterhalten hat, kommt herbei, lehnt ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes und sagt: »Schatzi, holst du uns bitte noch was zu trinken?«
Kai hebt entschuldigend die Augen zum Himmel (Charly weiß ja, wie es um die Ehe steht und wo Kai sich seit Jahren und für teures Geld seine kleinen Freuden holt), lässt sich dann von Sanni unterhaken, und sie verschwinden auf der Suche nach einer der Serviererinnen mit einem Tablett voll Wein, Wasser, Sekt und O-Saft.
»Du müsstest dich mal in den Landesmedienanstalten umschauen«, sagt Hubert. »Auch reine Versorgungsbetriebe für das SPD-Karrierenetzwerk. Und jemand, der da irgendwo wirtschaftliche Kriterien anlegt, ist sofort unter Diskriminierungsverdacht: ›Wie kann man so schnöde argumentieren, wenn’s um das Gute geht?‹«
Charly seufzt: »Es lebe die Privatwirtschaft.« Er steht hier mittlerweile fast alleine mit Hubert und würde jetzt lieber, anstatt über Politik zu reden, seine anderen Gäste treffen. Das ist immer das Problem bei so großen Feiern. Man redet mit einem und sieht aus den Augenwinkeln, mit wem man stattdessen alles reden könnte. Und die Gefahr ist, dass man schulterklopfend und »Warte eben, darüber reden wir gleich noch weiter« sagend, von einem Grüppchen zum nächsten flattert und am Ende des Tages keinen einzigen erinnerungswerten Austausch mit niemand hatte. Was aber vielleicht auch nicht der Zweck so einer Geburtstagsfeier ist.
»Ja«, rodomontiert Hubert weiter, »und das funktioniert durch semantische Dressur. Die Modellierung unserer Wahrnehmung, die Kanalisierung des Denkens, die Kriminalisierung von Wortfeldern –«
»’tschuldige«, unterbricht Charly ihn, denn er sieht Ines herankommen, die ihn mit aufgerissenen Augen anblickt. »Warte eben, darüber reden wir gleich noch weiter.« Und dann zu Ines gewandt, die sich zu einer allegorischen Skulptur der Dringlichkeit verformt: »Ja?«
»Charly, du musst mir bitte eben etwas erklären mit der Tischordnung …«
Er kennt ihre Stimme gut genug, um zu wissen, dass sie lügt, aber er nimmt die Gelegenheit trotzdem dankend an und folgt der alten Freundin nach drinnen.
»Bis gleich«, sagt er über die Schulter zu Hubert.
Ines führt ihn ans andere Ende des Saals.
»Was willst du denn wirklich?«, fragt Charly grinsend. »Knutschen?«
»Sag mal … du weißt schon? Der Typ …«
»Welcher Typ?«
»Mit dem du dich gerade unterhalten hast.«
»Das ist kein Typ, Ines, das ist Hubert, der Mann meiner Nichte.«
»Also weißt du’s nicht.«
»Weiß was nicht? Was soll ich wissen?«
Sie senkt die Stimme, als schäme sie sich, ein unflätiges Wort auszusprechen: »Dass der bei der AfD ist.«
»Oh«, erwidert ein verblüffter Charly unvermittelt. »Nein, wusste ich nicht.« Dann fasst er sich, von einem gewissen Etwas in Ines’ Ton, Blick und Haltung herausgefordert, und sagt: »Und?«
»Du weißt schon, dass das eigentlich nicht geht.«
»Was nicht geht?«
»So jemanden einzuladen. Ich meine, wenn wir gewusst hätten, dass hier ein Typ von der AfD …«
»Ich weiß nichts von AfD, ich lade die Leute doch nicht danach ein, ob sie mir ihren Ariernachweis präsentieren können«, sagt Charly, denkt aber zugleich, dass jemand, Erika oder Clara, ihn hätte aufklären können.
»Charly, ich sage das, um dich zu schützen. Ich will nicht, dass du den Eindruck erweckst, dich hier mit so einem Nazi wunderbar zu unterhalten. Die andern haben sich auch davongemacht, wie du siehst. Ich meine, von Rechts wegen …«
Charly sieht Ines an. Ihre Stimme klingt mütterlich oder soll so klingen, und auch ihr Blick versucht, besorgte Orientierung zu signalisieren. Zugleich ist aber auch eine kaum merkliche Nuance von Panik herauszuhören und eine gewisse Blässe um die einst sommersprossige, jetzt altersfleckige Nase zu erahnen, als habe Ines gerade erfahren, dass sie sich in einem Pandemiegebiet aufhalte, strebe zum nächsten rettenden Flugzeug, sei aber zugleich auch gelähmt von der Aussicht, auf dem Weg dahin mit irgendwelchen Infizierten in Berührung zu kommen. Aber in ihrem Ton versteckt sich noch ein Drittes außer mütterlicher Sorge und Seuchenangst: etwas Lauerndes, etwas vage Mahnendes und sogar Drohendes, das sich noch nicht zu einer Entscheidung durchgerungen hat, aber abwägt – sein Gewissen erforscht, seine Loyalitäten und Prioritäten bedenkt und sich fragt, ob da nicht Maßnahmen zu ergreifen wären und ob sie diejenige sein müsse, könne und wolle, die sich zu ihnen durchringt.
Es ist ein Überlegungs- und Entscheidungsprozess, der ein gewisses, wenn auch kaum sichtbares Beben verursacht.
Und dieses Beben, das ein moralisches Erbeben ist, provoziert Charly, der spürt, dass das allerdings nur einer von zwei Gründen ist, warum er gleich einen kleinen wütenden Ausbruch inszenieren wird; der andere ist der Ärger darüber, getäuscht worden zu sein. Erika hätte mich vorwarnen können, oder der Typ hätte sich auch outen können, damit man Bescheid weiß. Ich meine, es ist ja kein Verbrechen, aber …
Doch Ines, die aus einer Mischung von Mütterlichkeit und Denunziationseifer, von moralischer Empörung und dem erhebenden Gefühl, gut zu sein, bebt und ihn insistierend, fragend, Antwort heischend ansieht – nein, nicht nur Antwort heischend, sondern eine Gewissensentscheidung, einen entschlossenen Schritt auf die richtige Seite erwartend, geht ihm derart auf die Nerven (und das an meinem Geburtstag!), dass er nur sagt:
»Gleich ein Nazi! Sorry, ich habe die Hakenkreuzbinde übersehen. Aber vielleicht könnt ihr beide, du und dein Mann, Nazis ja riechen. Ich meine, alt genug ist er, um in seiner Jugend noch Sturmbannführer gewesen zu sein!«
Aber anstatt dass Ines nun, wie er es halb erwartet, empört davonstakst, nach Türen zum Schlagen sucht, ihren Mann unter den Arm nimmt und eine lautstarke Szene machend abrauscht, sieht sie ihn mit einem bittersüßen Lächeln an, einem Abbild oder einer Karikatur ihres offenen, unschuldigen Gesichts von ehedem, dann tropfen ein paar Tränen aus den Augenwinkeln, und sie sagt emphatisch und als könne und müsse das alles erklären: »Aber Charly, Volker hat zu den Initiatoren der Stolpersteine in Potsdam gehört! Er hat bei tausend davon die Vergoldung gezahlt.«
Aus irgendeinem Grund – Nervenüberreizung? – muss Charly an sich halten, um nicht laut loszulachen.
Dann sagt er: »Danke für den Hinweis, Ines«, umarmt sie und will wieder zu seiner Gesprächsgruppe zurück. Aus den Augenwinkeln sieht er aber Hubert alleine dastehen, in einer Art unsichtbaren Blase, wie er, um diesen Moment zu überspielen, angelegentlich in die untergehende Sonne über Grün 18 starrt, als gäbe es dort irgendetwas zu sehen.
Und obwohl Charly sein Gewicht bereits auf den linken Fuß verlagert hatte, um wieder hinaus zu Hubert zu gehen, wechselt er jetzt Stand- und Spielbein und entfernt sich, starr geradeaus blickend, in die andere Richtung, von wo ihm ein paar alte Freunde begeistert zuwinken.
Kumpf hätte ich einladen sollen, denkt Charly ein wenig nostalgisch an seinen Ex-Schwager zurück. Der war zwar ein Arschloch, aber er hätte sich nicht in die Hosen gemacht, sich mit einem AfD-Typen zu unterhalten. Hat doch was für sich, wenn man finanziell unabhängig ist und keinem Rechenschaft schuldet.
Mittlerweile ist übrigens Clara an Huberts Seite getreten, er lehnt den Kopf an ihren. Das Problem ist also auch erst mal gelöst. Sollen sich schließlich hier alle wohlfühlen!
Er behält den Berliner Juristen mit dem schütteren Haar und dem kantigen Kinn aber trotzdem im Auge, weil er nicht will, dass dessen Isolation zu einem verfrühten Abschied führt, der dann womöglich eine ganze Kettenreaktion in Gang setzen könnte via Clara, ihre Schwestern, bis hin zur sich zu Solidarität verpflichtet fühlenden Erika.
Aber entweder unterschätzt er die Dickfelligkeit Huberts oder die Auswirkungen von Ines’ Bannfluch, denn Hubert hat jetzt Johann-Albrecht entdeckt und offenbar sogleich wieder dort angesetzt, wo er zuvor aufgehört hatte. Jo, ein ehemaliger Kommilitone Charlys, ist wirtschaftspolitischer Sprecher des Verbandes Energiewirtschaft, und da sein markanter grauer Bürstenschnitt und seine schwarze Hornbrille schon in mehreren Interviews zu sehen waren, hat Hubert ihn offenbar wiedererkannt und als idealen Punchingball für seine Suaden auserkoren, die sonst keiner hören will.
Aber was das betrifft, ist Charly nicht bange. Jo weiß sich zu wehren, er monologisiert und doziert ebenso gerne wie Hubert und womöglich überzeugender. Und da er das einzig dezidiert liberal-konservative Mitglied des derzeitigen Vorstands ist (der ansonsten exklusiv aus recycelten Parteipolitikern besteht), steht auch kein ideologischer Mord und Totschlag zu befürchten. Charly hat seit den Studienzeiten (auch wenn sie sich danach über Jahre, fast Jahrzehnte aus den Augen verloren hatten) einen gewissen Respekt vor dem protestantischen Absolventen eines Stuttgarter humanistischen Gymnasiums, der in seiner Freizeit ein sehr ikonoklastisches VWL-Lehrbuch geschrieben hat, das er auch als kostenlosen Blog anbietet (»Was schon bei Adam Smith falsch war, aber nur ein Teilaspekt ist, wird bei Ricardo zur Kernaussage: die Akkumulation des Kapitals. Die Thesen von Ricardo beruhen auf vier Aussagen, die alle vier grottenfalsch sind.«), und der außer dem Wirtschafts- auch ein Theologiestudium abgeschlossen hat und als ausgebildeter Kantor Kirchenmusik spielt. Das war’s aber gewiss nicht, was die beiden einander nähergebracht hatte, sondern die Tatsache, dass Jo, um sein Studium zu finanzieren, für die Sportredaktion der BILD-Hamburg arbeitete und den ebenso motorsportbegeisterten Charly an vielen Wochenenden zu Rennen der Rallye-Cross-Europameisterschaft an den Estering mitnahm. An die Zeit des legendären Martin Schanche (Skanke ausgesprochen) erinnert sich Charly voller Nostalgie. Eine wunderbare Spielart des Schlammcatchens mit Autos.
Aus den Augenwinkeln sieht er und hört in Wortfetzen, wie Jo jeden Angriff Huberts gegen die Preisgabe nationaler Interessen mit sachlichen Beispielen internationaler Kooperation kontert und den AfD-Mann gerade dadurch auflaufen lässt, dass er seine Argumente nicht in Bausch und Bogen verdammt, sondern mit wirtschaftlicher Sachkenntnis ad absurdum führt.
Aber damit, denkt Charly besorgt, gräbt er sich zugleich sein eigenes Grab, denn weil Hubert sonst niemand zum Politisieren hat und Jo alleine hier ist, kann der sich in niemandes Arme flüchten und wird gnadenlos mit Beschlag belegt. Charly nimmt sich vor, ihn nachher irgendwann zu erlösen, sollte der andere ihm immer noch auf dem Buckel hängen, aber die Sache zieht sich bis zum Abendessen, bei dem Hubert sogar – allerdings erfolglos – versucht, die Tischordnung umzustoßen, um weiter auf Jo einreden zu können. Sodass der später frustriert als einer der Ersten aufbricht, ohne dass Charly noch mal Gelegenheit gehabt hätte, alte Gemeinsamkeiten aufzuwärmen. Ein Kollateralschaden, aber immerhin nur ein einzelner.
Auf seinem Weg von Grüppchen zu Grüppchen, um mit jedem der Gäste eine Begrüßung getauscht und ein paar Worte gewechselt zu haben, kommt Charly jetzt am Gabentisch vorbei, der sich erfreulich gefüllt hat.