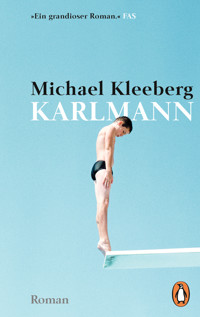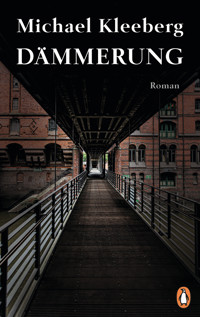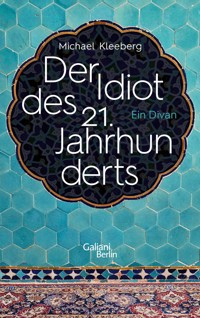10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Albert Klein ist gerade einmal zwanzig Jahre alt, als er Anfang der 1980er einer unerfüllten Liebe wegen aus Deutschland flieht. Doch als er gut ein Jahrzehnt später in seine wiedervereinigte Heimat zurückkehrt, erscheint ihm das Land allzu fremder, sodass er gleich weiter nach Prag flieht. Dort schenkt ihm ein Antiquar ein leeres Buch und verspricht: »Was immer Sie hineinschreiben, wird Wirklichkeit geworden sein, wenn Sie das Buch beendet haben.« Das lässt sich Klein nicht zweimal sagen, und so erschreibt er sich ein neues Deutschland des 20. Jahrhunderts ... Ein modernes Märchen, ein spannendes Stück Zeitgeschichte und ein fulminantes sprachliches Kunstwerk.
Dieser Titel, mit dem Michael Kleeberg seinen Durchbruch feierte, erschien zuerst 1998 bei Ullstein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 893
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Michael Kleeberg
EIN GARTEN IM NORDEN
Roman
MICHAEL KLEEBERG, 1959 in Stuttgart geboren, lebt in Berlin und zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellern der Gegenwart. Zu seinen wichtigsten Büchern zählen »Der König von Korsika« (2001), »Karlmann« (2007) und »Vaterjahre« (2014), für das er u. a. den Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg erhielt. 2016 wurde er für sein Gesamtwerk mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet. Im Penguin Verlag erschienen zuletzt »Vaterjahre« und »Das amerikanische Hospital«.
Ein Garten im Norden in der Presse:
»Ein ausgezeichnet geschriebener Roman.«der Freitag
»Ein sprachliches Kunstwerk.«Süddeutsche Zeitung
»Man müsste lange suchen, um ein gleichwertiges Prosastück in unserer Literatur zu finden … ein fabelhafter und fabulöser Spannungsroman.«Frankfurter Rundschau
»Der schönste deutsche Roman der letzten Jahre.«die tageszeitung
Außerdem von Michael Kleeberg lieferbar:
Vaterjahre Das amerikanische Hospital Karlmann Der König von Korsika Das Tier, das weint
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Die Originalausgabe erschien 1998 im Ullstein Verlag, Berlin.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2018 by Penguin Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Cover: Hafen Werbeagentur, Hamburg Covermotiv: François Guillot/AFP/Getty Images showing the Japanese Garden of the Albert Kahn Museum/Paris; Krzysztof Czerwinski/textures.com
ISBN 978-3-641-23736-3V003
www.penguin-verlag.de
Pascale und den über die Länder verstreuten Freunden
In Memoriam
Albert Kahn und Berthold Goldschmidt
Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft. Es war ein Traum.
Das küßte mich auf deutsch, und sprach auf deutsch (Man glaubt es kaum, Wie gut es klang) das Wort: »Ich liebe dich!« Es war ein Traum.
Heine, In der Fremde
Nein, Herr! Ich find es dort, wie immer, herzlich schlecht.
Goethe, Faust I
I
VON DER LIEBE UND DER HEIMAT
Manche Geschichten kann man ganz einfach erzählen, sie erzählen sich eigentlich selbst. Zum Beispiel eine, die so beginnen könnte: »Einst gab es, mitten in der Reichshauptstadt, einen seltsamen Park. Er war von hohen Mauern umgeben, über die im Frühjahr der Duft von Geißblatt, Flieder und Harz wehte, und Liebespaare verabredeten sich unter der Laterne im Schatten der Kastanien …«
Andere Geschichten erzählen sich nicht so leicht. Da muß man sich fragen: Warum erzähle gerade ich gerade diese hier? Bin ich auch der Richtige dafür? Ein weiteres Problem, an das man nur zu selten denkt, ist physikalischer Natur: Die Heisenbergsche Unschärferelation, die besagt, daß die Messung eines Phänomens das Phänomen selbst verändert.
Wenn man eine Geschichte von A bis Z erfindet, spielt das keine solch große Rolle, was aber, wenn man sich bemüht, Dinge nachzuerzählen, die sich tatsächlich ereignet haben, also die vergehende Zeit zu erzählen?
Die Geschichte dieses letzten Jahres, nicht die Geschichte an sich, sondern meine, ist eine sonderbare Mischung von leicht und schwer Erzählbarem. Was aber ist der Grund, sie erzählen zu wollen? Nicht der Anlaß, der läge auf der Hand, nein, der Urgrund, die Quelle, die diesen Fluß aus Erinnerung und Erfindung speist?
Vielleicht muß ich mit der Liebe anfangen, der Liebe, die mich fortgetrieben hat, ohne mich loszulassen, und die mich zurückgezogen hat, nach Hause in die Fremde. Vor langer Zeit gab es einmal ein wunderschönes Land, in dem ich glücklich war. Ich kannte kein anderes. Es hieß Deutschland, nein, nicht Deutschland, sondern BeErDe. Auch die Liebe hat einen Namen, Beate Wittstock, oder kurz: Bea. Ihretwegen war ich ins Ausland gegangen, ihretwegen kam ich zurück.
Nein, ganz so einfach ist es auch wieder nicht: Ich kam zurück, weil meine geschiedene Frau Selbstmord begangen und ich festgestellt hatte, daß außer ihr mich nichts und niemand mehr in Frankreich hielt und halten wollte, und weil ich irrsinnigerweise meine gutbezahlte Stelle bei ›Orion‹ hingeworfen hatte, um mich aufs Schreiben zu konzentrieren.
Auch als ich im Februar 1983, ziemlich genau zwölf Jahre zuvor, Hamburg verließ, tat ich das, um mich ›aufs Schreiben zu konzentrieren‹. Herausgekommen war dabei ein Job als Leiter der Abteilung zur Erstellung von Softwaremanuals der amerikanischen Firma ›Orion‹ mit europäischem Headquarter in Amsterdam.
Jetzt, an diesem 23. Februar 1995, fuhr ich in meinem marineblauen, in Paris gemieteten Renault Safrane V6 bei Saarbrücken über die Grenze, war fast 36 und kehrte aus einer Wahlheimat, die mich als Fremden ausspie, in eine Fremde zurück, die ich mir als meine Heimat einfach nicht mehr vorstellen konnte.
Als Volker mich 1983 fragte, warum ich mit einer Reisetasche und 400 DM ›für ein Jahr‹ nach Amsterdam emigrieren wolle, gab ich eine Antwort, die seinerzeit sehr glaubwürdig klang; ich selbst war vielleicht der einzige, der nicht an sie glaubte: Ich will der Volkszählung entgehen.
Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, welche Paranoia diese geplante und schon einmal vertagte Volkszählung damals bei den Jungen und Linken hervorrief, um so mehr, als das Regime gerade gewechselt und die gefürchteten Konservativen das Ruder übernommen hatten, mit ›Verrat‹ und allem Drum und Dran. Es war eine allseits akzeptierte Erklärung und natürlich eine Lüge. In Wirklichkeit ging ich fort, um nichts wie die anderen zu machen, weder die Liebe, noch die Karriere, und wenn doch, dann nicht von ihnen dabei beobachtet zu werden. Wenn Bea nicht mit mir leben mochte, sollte es daran liegen, daß ich nicht da war und nicht etwa, daß sie mir einen anderen vorzog. Und wenn ein anderer als ich ein erfolgreicher Schriftsteller würde, dann lag es ebenfalls daran, daß ich nicht da war und nicht, daß er etwa besser schrieb.
Als kleines Kind bin ich sonntagvormittags zu einer halben Stunde Spiel und Zärtlichkeit ins Bett meines Vaters gekrochen, während meine Mutter das Frühstück bereitete. Das Glück dieser Minuten war so selten und kostbar, daß nichts es trüben dürfte. Manchmal aber stritten wir uns, und mein Vater stand auf, und alles war vorbei und nicht mehr rückgängig zu machen. Um dem zuvorzukommen, sprang ich, kaum fühlte ich die Unschuld des Moments sich trüben, aus dem Bett, lief zurück in mein Zimmer, blieb dort zehn Minuten und kam ›zum ersten Mal‹ wieder zurück, hoffend, mein Vater werde das Spiel verstehen und noch einmal, zum ersten Mal, mit geschlossenen Augen dort liegen und ich könnte ihn wecken, und alles begänne wieder, aber schattenlos, denn es war nichts geschehen zuvor.
Deutschland zu verlassen war der Versuch, den gleichen Trick zu wiederholen. Verschwinden und neu geboren zurückkommen, mit einem erfolgreichen Buch und einer neuen ersten Begegnung mit Bea, die sich nicht verändert hätte, aber diesmal würde unsere Liebe gelingen und alles würde gut.
Aber so kam es natürlich nicht. Die ersten Jahre des Exils in Amsterdam waren vielleicht die besten meines Lebens, ich fand die Arbeit bei ›Orion‹ und verliebte mich in Pauline, und Deutschland und die Vergangenheit und Bea kamen mir mehr und mehr abhanden, trotz aller Briefwechsel, Geschäftsreisen und Besuche bei meinen Eltern. Nun hatte ich Pauline verloren, zwölf Jahre meines Lebens stellten sich als Parenthese heraus, und die einzige Zukunft, auf die ich hoffen, die einzige Klammer, die die plötzlich losen Enden meines Lebens zusammenhalten konnte, war eine Vergangenheit, Bea, die Einzige, die Lebensveränderin. Nur daß sie, soweit ich wußte, denn unser Briefwechsel, schon immer mit großen Unterbrechungen geführt, hatte 1990 abrupt geendet, heute verheiratet war. Ich hatte Angst vor dieser Rückkehr.
Ich näherte mich Deutschland wie ein feiger Boxer: ständig in der Defensive; wie ein griesgrämiger alter Wolf, der fast gierig darauf wartet, daß irgendeine Katastrophe hereinbricht und seine schlechte Meinung über Land und Leute bestätigt. Das war ein übles Vorzeichen für jemand, der in diesem Land wieder heimisch werden wollte. Ich hatte fünf Jahre in Amsterdam gelebt und sieben in Paris. Als ich immer häufiger auf Französisch träumte, sagte ich eines Tages einem Bekannten, ich würde gern versuchen, ein Buch in dieser Sprache zu schreiben. Laut ausgesprochen schockte die Idee mich selbst, sie hatte etwas von Hochverrat.
Der Bekannte aber wog ganz sachlich pro und contra ab und meinte schließlich: »Es kommt darauf an, in welcher Sprache deine Erinnerungen in dir reden, in welcher Sprache du deine Märchen gehört hast.«
Ja, dachte ich, und noch weiter, es sind Erinnerungsgene aus Generationen, die dich machen, die Geschichte der Familie, die Geschichte an sich, das Klima, die Farben. Und meine Erinnerungen und Märchen, woher kamen sie? Siegfried und Hagen von Tronje, Dietrich von Bern und Meister Hildebrand, Thor und Loki, Gudrun und Wate von Stürmen, Rübezahl und das Erzgebirge, die schöne Lau aus dem Blautopf, das Glasmännlein und der Holländer-Michel aus der schweigenden Tiefe des benachbarten Schwarzwalds, alles was ich war, bevor Hollywood über mich hereinbrach. Die Bücher kamen später.
Auf dieser Heimreise würde ich Dürers Nürnberg durchqueren (und das der Partei), würde den deutschesten aller deutschen Winkel streifen, Goethes, Nietzsches und Bachs Thüringen, aber all diese Vergangenheit war nicht mehr meine Gegenwart..
Ich sagte mir nur immer wieder: Du wirst in einem Land leben müssen, wo alle verstehen können, was du sagst, aber du verstehst ihre Wörter nicht mehr: Lebensversicherung, Karriereplan, Bausparvertrag, Emissionsschutz, Anti-AKW Bewegung, Feuchtbiotop, Shareholder Value, Spontiszene, Freizeitwert. Du wirst im Standort Deutschland hocken, dänische Butter, holländische Tomaten und spanische Erdbeeren essen müssen, die Geschäfte schlagen dir um sechs die Türe vor der Nase zu, die Filme sind alle synchronisiert, und ohnehin gibt es nur amerikanische, alle wollen sich gegenseitig aus dem Land werfen, die Rechten die Linken und umgekehrt, jedes Dorf von 500 Seelen hat seinen Autobahnzubringer, ein Land so reich, daß es nicht weiß wohin mit seinem Geld, wäre aber lieber arm und glücklich – ja, Geld war eben kein Kindheitswunsch! Ein Land, das niemanden nach seiner Façon selig werden lassen kann, das Land, aus dem ich aus guten Gründen verschwunden war. Ein häßliches Land! Mein Gott, wie häßlich in seinem Sauberkeits- und Perfektionswahn, und wie häßlich und blöde auch die provozierende Häßlichkeit, die die Systemgegner kultivierten. Was wollten sie denn bloß alle? Und wie sehr fehlte mir schon jetzt, da ich noch gar nichts gesehen hatte, das Hautfarben- und Sprachengemisch vom Leidseplein oder dem Boulevard Barbès. Ich kam aus Paris und fuhr nach Prag, als sei das einzig fremde Land, das man möglichst schnell hinter sich lassen mußte, Deutschland, mit dem nichts einen verband, das einen anzustecken drohte, und davor und dahinter lagen die Städte des Lichts, Blöcke kontinuierlicher menschlicher Geschichte, 1000 Jahre alte Inseln der Schönheit, des Widerstands, Zentren der Vermischung, ohne die es kein Leben gibt.
Das war mein Gefühlszustand, der natürlich ebenso typisch und ungerecht wie unhaltbar war.
Während ich zum hundertsten Mal staunend die Armeen großer, glänzender Mercedes-, BMW- und Audi-Limousinen betrachtete, deren Erfolg und Solidität so ungleich größer war als die aller ›Tiger‹ und ›Panther‹, die wir 50 Jahre zuvor ausgeschickt hatten, die Welt zu erobern, suchte ich nach einer Erinnerung, einem Anlaß, irgend etwas, das diesen Kriegszustand aus meinem Kopf vertriebe, dieses: Entweder ich oder Deutschland.
Februar. Beazeit. Das blieb der einzige Schlüssel. Trotz der Klimaanlage war mir, als rieche ich die ersten Zeichen von Frühling. Erster Frühling, 15 Jahre zuvor. Ich zwanzigeinhalb, sie gerade noch siebzehn. Die Reise, die mein Leben veränderte.
Drei Frühlinge hatten wir einander geliebt, aneinander gelitten. Jeden Sommer war Schluß. Kein Kontakt im Herbst und Winter. Und im folgenden Frühjahr überwältigt uns die Erinnerung an das ewig gegebene, nie zu haltende Versprechen des ersten Mals, und sie oder ich nehmen das Telefon oder das Briefpapier zur Hand. Wie hartnäckig das präsent blieb, noch heute, 15 Jahre nach der ersten Begegnung, fünf Jahre, nachdem ich sie zum letzten Mal gesehen hatte. Da kannte sie den Typen bereits, den sie dann offenbar geheiratet hatte. Unglaublich. Und ich glaubte auch nicht wirklich daran. Immer noch besser ein Fremder als jemand, den ich kenne. Aber das wäre wohl unmöglich gewesen. Meint er.
1990, als wir uns einen Nachmittag in Hamburg trafen, auch im Frühjahr, ein paar Wochen vor meiner Heirat mit Pauline, spielten wir die abgeklärten Erwachsenen, die sich, ohne bitter zu werden, über die Vergangenheit unterhalten können, ganz sachlich, objektiv, eifersuchtslos über ihre derzeitigen Liebhaber plaudern. Was alles nicht hinderte, daß wir nach einem Spaziergang um die Binnenalster und einem Kaffee am Gänsemarkt miteinander im Bett landeten. Eine Berührung ihrer kalten Fingerspitzen mit den Tabakkrümeln auf den Kuppen vom Selberdrehen hatte genügt, nein, es brauchte nicht einmal die Berührung, ihre Stimme hatte genügt, schon ihre Silhouette, als ich sie kommen sah. Wir waren verstört hinterher, daß alles kluge Gerede nichts half, etwas in uns, unsere Körper (unsere Seelen, hätte Bea gesagt), spielte sein eigenes Spiel oder spielte gar keines und beharrte auf dem Essentiellen. Als ich einige Monate später brieflich meine Heirat erwähnte, antwortete sie nicht mehr. Auch nicht im nächsten Frühling, auch nicht in dem darauf, überhaupt nicht mehr.
Hatte ich nicht seit über einem Jahr, noch bevor die Dinge mit Pauline in die Brüche gingen, Heimweh verspürt? Aber Heimweh wonach? Es war nicht Heimweh nach dem katholischen Süddeutschland, wo ich, das Protestantenkind, aufgewachsen war, noch die Lust, wieder in Hamburg zu leben. Es war Heimweh nach etwas, das es nicht gab, weil ich selbst nicht mehr der war, der vor zwölf Jahren fortgegangen war. Wie heißt es so wahr: Man steigt nicht zweimal in denselben Fluß. Die zwölf Jahre im Ausland hatten den Begriff Heimat ummodelliert, ins Allgemeine, Übergreifende verlagert, hatten mich mein eigenes Leben von außen sehen lassen. Heimat, das hatte eine andere Dimension bekommen, war ein idealer Raum geworden, durchkreuzt von Suchenden, von Fliehenden, Flickenteppich einer europäisch gewordenen Erinnerung, und ich mochte heulen und weinen, das Deutschland, durch das ich meine französische Luxuslimousine lenkte, war mir fremder als die backsteinroten Straßen der Pijp in Amsterdam, fremder als die Buttes Chaumont in Paris, und der Geist der Kritik, der Analyse, des Vergleichens, hatte all die selbstverständliche, unangestrengte Zuneigung ersetzt, die einst, als ich nichts anderes kannte, jeder Baum und Strauch hier in mir wachrief.
Wenigstens die Autobahn selbst machte mich nostalgisch. Sie erinnerte mich an Bea und die Zeit, als ich noch sicher gewesen war, mein Leben sei ein Zen-Pfeil, in höchster Konzentration, völliger Absichtslosigkeit von der Sehne geschnellt, um im schwarzen Punkt der Zielscheibe sicher zitternd einzuschlagen. Damals, als diese Hoffnung da war und Bea, als beides dasselbe war, was hatte mich da die dänische Butter geschert und die holländischen Tomaten, was die Höflichkeit und die republikanische Tradition, was die deutsche Vergangenheit und die synchronisierten Filme. Ich lebte, wo ich eben lebte, ich liebte Bea, und ich war der festen Überzeugung, daß es in meiner Macht stand, alles andere, alles Nebensächliche, zu verändern und zu bezwingen.
Heute war ich ein Schwamm geworden, vollgesogen mit anderer Leute Geschichten, fremden Bildern, die sich in meinem Kopf eingenistet hatten und meine geworden waren. Ich fragte mich, was passieren würde, wenn, was ich unterbewußt als die conditio sine qua non meiner Heimkehr ansah, nicht einträte: Daß ich nämlich mit Bea leben würde. Denn was mich von Pauline kurieren konnte, was mich von zwölf Jahren glücklichem Exil kurieren konnte, war nicht Geld, waren nicht meine Eltern, noch Volker, oder Rudolph, noch die Wiederbegegnung mit der Sprache – es war einzig sie.
II
SPEYER UND DIE EINREISE NACH DEUTSCHLAND
Mein Programm stand fest: Ich mußte am 27. Februar zum 60. Geburtstag meines Vaters in Hamburg sein. Am 25. hatte ich in Prag zwei Termine. Einen mit dem Vertriebsleiter von ›Orion‹, einen zweiten mit dem tschechischen Übersetzer der Manuals. Am 26. würde ich Rudolph abholen, das lag am Weg und mit ihm über Berlin fahren, wo er mit meinem Vater eine geschäftliche Verabredung hatte. Zum Geburtstag war er natürlich auch eingeladen. Und danach würde ich mir einige Tage Zeit nehmen, um zu entscheiden, wo und womit ich einen neuen Anfang wagen sollte.
Ich war spät fortgekommen und würde Nürnberg nicht mehr erreichen. An einer Tankstelle studierte ich den Atlas, und mein Blick fiel auf Speyer, das nicht zu weit von der Autobahn entfernt lag. Ich war noch nie in Speyer gewesen.
Es war dunkel, als ich das Ortsschild passierte. Die Stadt begann wie alle diese deutschen Städte, die weniger Vergangenheit zu haben scheinen als amerikanische. Es kam mir immer vor, als habe man, um vergessen zu machen, daß es zuvor ein Deutschland und Deutsche gegeben hatte, nach dem Krieg nicht mehr für Menschen, sondern für Autos gebaut. Das nationale Budget eines Landes wie Belgien kann nicht so hoch sein wie die Ausgaben, die hier zum Ausbau der Straßen, zu ihrer Beschilderung, zur Wahl ihres Materials oder ihrer Bordsteine, Bürgersteige und Ampeln verwendet werden – und, seit dieses Land, das immer einen Plan zur Verbesserung und Rettung der Welt braucht, die Ökologie entdeckt hat, zur Unbefahrbarmachung eben dieser wunderbaren Straßen: Die Holperstrecken, Engpässe und 30-Kilometer-Zonen machten mich verrückt.
Wie ein trotziges Kind, das Vernunftgründe nicht anerkennen will, weil es sich ärgert, nicht selbst und ohne Belehrung auf sie gekommen zu sein, drückte ich den Knopf des elektrischen Fensterhebers, die Scheibe glitt hinab, und ich kippte meinen halbvollen Aschenbecher auf die Straße. Im selben Augenblick erblindete ich im Jodstrahl der aufgeblendeten Fernlichter des Autos, das hinter mir an der Ampel wartete. Als ich wieder etwas erkennen konnte, sah ich im Rückspiegel ein Golf Cabrio mit geschlossenem Verdeck und Speyrer Kennzeichen.
Ich folgte den verkehrsberuhigten Straßen in Richtung Innenstadt, bis ich vor einem Haus ankam, das die Warsteiner-Leuchtschrift als Hotel ›Zum deutschen Kaiser‹ kenntlich machte. Vor dem Eingang war ein Parkplatz frei. Hinter mir ein Auto, also blinkte ich und steuerte zum Einparken an den Straßenrand. Obwohl die Straße breit genug war, blieb der nachfolgende Wagen, ein Golf Cabrio, auf meiner Höhe stehen, und der Fahrer blickte herüber. Da fiel mir auf, daß es sich um denselben Wagen handeln mußte wie vorhin an der Ampel. Ein blonder junger Mann mit dünnem Schnurrbärtchen sah mir aus dem offenen Fenster stumm beim Einparken zu.
Der Safrane ist groß und unübersichtlich, hat aber zum Glück Servolenkung. Die Parklücke war gerade ausreichend, und ich stieß zurück, bis meine Stoßstange das hinter mir stehende Auto berührte, legte dann den ersten Gang ein und parkte den Wagen. Als ich das Hotel betrat, spürte ich den Blick des jungen Mannes noch immer auf mir.
Ein türkisches Mädchen hockte am Empfang. Es war schüchtern und hübsch. Oben, im Geruch nach Raumspray und lackiertem Fichtenfurnier, ging ich direkt ins Bad, um zu duschen. Keine Seife, kein Gel, kein Shampoo. Ich setzte mich nackt aufs Bett, nahm den Hörer und wählte »0«. Das türkische Mädchen von der Rezeption antwortete unbeeindruckt:
»Ja dafür müssen runterkommen und hier bei mir abholen. Sowieso ist da ein Mann, der Sie will sprechen.«
»Ein Mann, der mich sprechen will?«
»Ja.«
Da sie nichts weiter sagte, zog ich mich wieder an und stieg die Treppe hinab. Das Mädchen händigte mir ein Paket Spikeseife und ein Tütchen Showergel aus, auch als Haarshampoo zu verwenden, und deutete mit den Augen zur Tür. Dort stand der blonde Fahrer des Golf Cabrio. Er war größer als ich, ca. einsneunzig, trug das Haar vorn kurz und hinten lang und war in eine halblange, gegürtete schwarze Lederjacke und graue Hosen mit Bügelfalten gekleidet. Seine kleinen Augen, die mich fixierten, waren hellblau.
Der Junge sah mich von der ganzen Höhe seiner vielleicht 22 Jahre an.
»Sie sind beim Einparken gegen die Stoßstange Ihres Hintermannes gefahren. Ich habe das gesehen. Und Sie haben nicht einmal nachgeschaut, ob Sie Schaden angerichtet haben«, sagte er drohend.
Kein Guten Abend, keine Entschuldigung, keine Frage. Ich holte Luft für meine Antwort, als mir aufging, daß er nur das französische Kennzeichen des Renault gesehen hatte und mich vermutlich für einen Ausländer hielt.
Was war da zu sagen? Daß der Wagen hinter mir ein Commodore Coupé von 1969 war, nur noch vom Rost zusammengehalten? Daß ich seine Stoßstange zwar berührt hatte, aber nicht vehementer, als mein Gegenüber vermutlich samstagabends die Brustwarzen seiner Freundin quetschte? Daß er gewiß weniger Umstände gemacht hätte, wäre irgendwo ein Asylantenheim angezündet worden?
In den Jahren des Exils findet und erfindet man gute Gründe, sein Heimatland zu verachten, hoffnungslos zu finden, vor allem, wenn es Deutschland heißt, und ich fand letztlich nur bestätigt, wovon ich ohnehin überzeugt war. Vielleicht spielte in meine krampfige Lust, Indizien gegen mein Herkunftsland zu sammeln, auch die eigenartige aggressive Unsicherheit des Soldaten hinein, der nie die Front gesehen, des Nachgeborenen, der es besser gemacht hätte als die Elterngeneration: Jedenfalls sah ich in diesem jungen Mann, der die deutschen Straßen und die deutschen Opels behütete, plötzlich das Inbild eines Nazis.
»Kümmern Sie sich gefälligst um Ihren eigenen Dreck, Sie KZ-Aufseher!«
Das türkische Mädchen und der Junge starrten mich entgeistert an.
»Sie wollen also nicht mit mir hinausgehen und den Schaden feststellen?«
Ich deutete mit dem Finger gegen die Stirn, drehte mich auf dem Absatz um und stieg die Treppe zu meinem Zimmer hinauf.
»Sie werden schon sehen!« hörte ich seine Stimme noch.
Ich duschte und ging resigniert in die Stadt, um vor dem Abendessen dem touristischen Bedürfnis Genüge zu tun und sagen zu können, ich hätte Speyer ›angesehen‹. Es war halb sieben, und entgegen meiner Erwartung, durch eine tote Stadt zu streifen, war die Straße, die zum Dom führte, hell und voller Menschen. Donnerstagabend! Verkaufsoffen! Ein Warenhaus, Apotheke, Dromarkt, Elektrogeschäft, Pennymarkt, Aldi, ein Tabak- und Zeitschriftenladen, Kebabstände und ein Chinarestaurant, eine Fußgängerzone. Der Dom war angestrahlt und verschlossen, ich umrundete ihn, ein großes Fragezeichen aus einer anderen Epoche.
Nach einer halben Stunde stieg ich die drei Marmorimitat-Stufen des ›Deutschen Kaisers‹ wieder hoch und trat ein. Die Polizei wartete bereits auf mich.
»Sind Sie der Halter des Wagens mit dem französischen Kennzeichen?«
»Das bin ich.«
»Sie sind Deutscher?«
»In der Tat.«
»Mit einem französischen Auto?«
»Das kann vorkommen.«
»Ihre Papiere bitte und die Wagenpapiere.«
»Darf ich vielleicht zunächst einmal fragen, was das Ganze soll?«
Während der eine schweigend und konzentriert meinen Reisepaß studierte und sich im Hintergrund die Hotelbesitzerin zu der Türkin gesellt hatte, sagte der zweite Polizist:
»Wir haben einen Anruf bekommen, daß Sie mutwillig ein Fahrzeug beschädigt haben …« (Aha, daher weht der Wind!)
»Und von wem war dieser Anruf?«
»Er kam aus einer Telefonzelle von einem Herrn.«
»Ein anonymer Anruf also.«
»Wir tun unsere Pflicht.«
»Gewiß«, sagte ich. »Wenn es weiter nichts ist, gehen wir doch hinaus und sehen uns die Autos an.«
Die Polizisten schienen erstaunt über meine Kooperationsbereitschaft. Aber ich bin über das Alter hinaus, in dem man mit Polizisten Streit anfängt.
Es ist erstaunlich, wie lange man zwei Autos studieren kann, die nichts, aber auch nichts Auffälliges besitzen. Die rostfleckige Stoßstange des Commodore wies nicht die geringste Spur einer Berührung auf. Auch an den Seiten und hinten war die Kiste unbeschädigt.
Schließlich legten sie die Hand an den Mützenschirm und fuhren wieder ab. Ich aß zu Abend und legte mich dann mit schwerem Magen auf mein Bett.
Selbstmitleid, Einsamkeit und eine vage Unzufriedenheit mit meiner Haltung flossen in dem Kinderwunsch zusammen: Ich will heim. Ich fühlte mich wie eine Schnittblume. Ich machte mich gut in der hübschen Vase, in die ich mich gestellt hatte, was nichts daran änderte, daß ich in zwei Tagen verwelkt wäre. Pauline war nicht mehr da, sag die Wahrheit: Sie war tot, dahin war kein Zurückkommen. Schon vor ihrem Tod hat sie dich verlassen. Doppelt war da kein Zurückkommen. Wie hatte sie ihr Leiden genannt: Die objektive Schwermut der Welt, die nur zu ertragen war, wenn man jeden Tag mit einem lebensspendenden Selbstbetrug begann. Meiner hatte lange Zeit gelautet: Ich bin anders als die andern. Dieser Orden, den ich mir selbst umgehängt hatte, begann schwer an meinem Hals zu ziehen. Jemand hatte einmal von sich gesagt: Seit ich ins Leben eintrat, habe ich mich in glücklichem Einvernehmen mit den geistigen Anlagen meiner Nation, in ihren geistigen Traditionen sicher geborgen gefühlt. Das galt nun schwerlich für mich.
Ich dachte an die erste Zeit des Exils, die herbe Erkenntnis, daß zu Hause alles weiterging. Nimm mich raus aus dem Bild, und früher oder später schließt das Loch sich wieder von selbst. Aber was hatte ich denn auch erwartet? Trauerzüge? Depeschen? Meine Welt kam ohne mich aus. Aber ich, ich existierte ebenfalls noch. Wie hart es war, tagsüber und an den Abenden, einsam zu sein, ohne daß irgend etwas anderes als mein dunkler Drang diese Einsamkeit notwendig gemacht hätte. Eine sehr seltsame Art von Glück auch, der Hoffnungslosigkeit verdächtig nahe, und doch eine Form von Wachheit, ein klarer Blick, als hätte man Adleraugen, wie an Herbsttagen, wenn die Sonne den regennassen Boden trocknet, eine leichte Brise die Wolken vertreibt und man kilometerweit alles exakt umrissen sieht.
Ich lebte im Jordaan, ich frühstückte im ›Dwaarse Egel‹, ich fuhr mit der Tram in den Overtoom und tippte die Softwaremanuals direkt in den Computer, ich träumte von Sex wie ein Verhungernder vom Essen. Bis ich Pauline kennenlernte. Sie holte eine Freundin von der Arbeit ab, die mit mir zusammen tippte. Der kurze Rock und diese langen, nicht endenden nackten Beine, die kräftigen Schenkel, die schönen Knie, die extrem schlanken Fesseln, die von den Riemen ihrer indischen Sandalen umgürtet waren. Die festen großen Brüste, die unter dem T-Shirt wippten, als wir zu dritt einen Kaffee trinken gingen. Die Brustwarzen, die sich, gegen die Baumwolle reibend, aufrichteten. Sie war Französin, sie war Tänzerin, sie hatte Alte Musik studiert, sie nahm an einem von der Stadt finanzierten Workshop für modernen Tanz teil. Wir kannten einander nicht, waren einander egal, suchten nicht große Liebe, wollten uns nicht intelligent unterhalten, nur unsere Körper bis zur Kante hochspiralen und dann auf der anderen Seite in die Tiefe fallen lassen.
Fremdheit und Abstinenz machten uns schamloser, als wir für möglich gehalten hätten. Keiner Kenntnis des anderen, keiner zärtlichen Rücksicht mußte da Tribut gezollt werden, unsere Worte waren von einer erhitzten Präzision und ausschließlichen Sachdienlichkeit.
So begann, was ich gar nicht gewollt hatte: Ein neues Leben. Der Sex wurde zu Liebe und zu Heirat, der Job zu einer Karriere. Das Provisorium wurde dauerhaft und ich ein Meister darin, die Tatsachen der Gegenwart gegenüber den Träumen der Jugend zu rechtfertigen. Und doch, so schien mir heute, war da immer ein heimlicher Vorbehalt geblieben. Eine Rechnung war noch offen, die früher oder später beglichen werden mußte. Und nun war Pauline tot, ich lag in einem Hotelbett in Speyer und war wieder genau am gleichen Nullpunkt angelangt wie zwölf Jahre zuvor. Plötzlich bekam ich Angst: War ich eigentlich identisch mit dem Menschen, den ich die ganze Zeit gespielt hatte? Aber irgend etwas mußte doch geblieben sein unterm Strich, und sei es nur die Leichtigkeit von Hans im Glück, der endlich die Hände frei hat und sie in die leeren Taschen stecken kann, während er beschwingten Schritts in ein nicht näher beschriebenes Happy End spaziert.
Das Einzelbett meines Speyrer Hotelzimmers schien immer schmäler zu werden, ich lag wie auf einem Schwebebalken, links und rechts gähnten Abgründe. Dann dachte ich noch an Bea, die ich vor meiner Abreise nach Amsterdam zuletzt im heißen August 1982 gesehen hatte, eine Stunde lang nur, gefüllt mit banalem und schmerzlichem Gerede, als sie in Travemünde als Zimmermädchen in einer Pension jobbte. Was war die Essenz unserer Reise gewesen: Die Liebe ist ein Geschenk, aber kein Privatbesitz. Mit diesem Satz auf den Lippen muß ich irgendwann eingeschlafen sein.
Gegen acht erwachte ich, frühstückte und trat aus dem Hotel. Der rote Commodore stand noch immer hinter meinem Auto. Ich öffnete die Zentralverriegelung und fuhr aus Speyer hinaus.
III
DAS WALDSTEIN-PALAIS
Man ißt früh zu Abend in Prag; zum Glück herrschen im Interconti westliche Sitten, so daß ich nicht zu spät dran war, um etwas in den Magen zu bekommen. Seit dem Frühstück hatte ich von deutschem Autobahnfraß gelebt: kalten Frikadellen und Kartoffelsalat.
Es gibt nichts Deprimierenderes als alleine in einem Restaurant zu sitzen, so hatte ich von der Bar aus Liehm angerufen, den tschechischen Vertriebsleiter von ›Orion‹, den ich am nächsten Vormittag treffen sollte, und ihn eingeladen, mit mir zu dinieren.
Liehm gehörte zu der neuen Generation, die nach 1989 ins Business eingestiegen ist, als hätte sie nie etwas anderes gekannt. Bei den Jahrestreffen hielt er seine Tischreden, innerhalb eines Satzes vom Tschechischen ins Deutsche, dann ins Englische und schließlich ins Französische wechselnd, alles fehlerlos und witzig obendrein. Aber es gab noch einen Unterschied zu den Westlern: Weder Liehm noch der ungarische ›Orion‹-Mann war der Typ des langweiligen Managers, der außer Banklehre, VWL-Studium und Karriere nichts erlebt hat und nur über Autos, Golf, Familiennachwuchs und Investitionen reden kann.
Liehm war Matrose gewesen (zweimal Kap Hoorn), hatte im Gefängnis gesessen, dann bei irgendeiner Behörde gearbeitet und als Restaurator Gemälde in der Loreto-Kirche erneuert. Gott allein weiß, wie er zu ›Orion‹ gestoßen war, aber er war erfolgreich. Rick van der Weyden, der europäische Chairman, besaß das Talent, Leute ausfindig zu machen, die menschliche und professionelle Qualitäten vereinten, die extrem hart arbeiteten und sich wunderbar zu amüsieren wußten.
Wenn die ›Orion‹-Leute aus zwölf europäischen Ländern sich trafen, wurde viel getrunken, gut gegessen, laut gelacht, es war das einzig funktionierende Stück Europa, das ich kannte, und manchmal bereute ich, mich nicht völlig in diese Arbeit zu investieren.
»Klein«, hatte van der Weyden mir einmal gesagt, »wenn du nur wolltest, dann könntest du irgendwann im Board sitzen. Wenn ich du wäre, dann würde ich folgendes tun: Wie alt bist du?« »33«, hatte ich gesagt. »33«, wiederholte er. »Du läßt das Schreiben für zehn Jahre, sagen wir, bis du 45 bist. Du stürzt dich Hals über Kopf in unsere Arbeit. In fünf Jahren leitest du ein Land, Deutschland logischerweise in deinem Fall, anstatt dein Leben im Ausland zu verbringen, und in weniger als zehn bist du im europäischen Board. Du verdienst mehr als das Doppelte. Gut, anstatt fünf Tage die Woche acht Stunden zu arbeiten, arbeitest du sieben Tage die Woche zwölf Stunden, aber mit dem Gehalt, mit den Vorzugsaktien (zwölf Prozent Dividende!) wirst du mit 45 genügend Kapital haben, um dich irgendwo zur Ruhe zu setzen und nichts mehr zu tun als zu schreiben. Und Themen wirst du dann auch genug haben. Was sagst du dazu? Oder besser, sag nichts, laß dirs durch den Kopf gehen, rechne dir das Pro und Contra aus. Und entscheide dich dann. Ich kann dir die Tür eine Weile offenhalten. Du hast als Jobber angefangen, jetzt bist du hier für die ganze Schreib-Abteilung verantwortlich, sitzt in Paris, und alles ohne Ehrgeiz. Überleg nur mal, wie weit du mit Ehrgeiz kommen könntest.«
Er hatte völlig recht gehabt, aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, zehn Jahre lang auf etwas warten zu sollen, was mir täglich so nötig wie die Atemluft war. Was er nicht ins Kalkül gezogen hatte, war, daß ich die Arbeit, die ich tat, nur ertrug, weil ich abends und an den Wochenenden schreiben und träumen konnte und mich aus der Welt stehlen in eine andere, wo ›Orion‹ nicht existierte.
So hatte ich Ricks Angebot nie angenommen, statt dessen ihn im letzten September, als die Scheidung mit Pauline durch war, gefragt, ob ich, ginge ich nach Deutschland zurück, weiter free lance für ›Orion‹ schreiben könne. Er sagte o.k., und ich kam mir sehr frei und intelligent vor, auch wenn es deutlich war, daß er mich für die Zukunft mittlerweile abgehakt hatte. Es gab genug Junge, die hungrig waren. Was ich ihm aber nie vergesse, ist, daß er im Dezember ins Flugzeug in Shiphol sprang und nach Paris zu Paulines Beerdigung kam und mir am Abend vorher nicht von der Seite wich, als ich mich um den Verstand trank.
Ja, ich hatte mich befreit gefühlt nach meiner Entscheidung, die fixe Arbeit an den Nagel zu hängen, jetzt, beim Abendessen, Liehm gegenüber, der enthusiastisch über die Geschäftsentwicklung sprach, relativierte sich das alles ein wenig. Liehm verdiente zum ersten Mal richtig Geld, und er brauchte es, er war Familienvater. Er war dankbar für die Verantwortung, die er trug, und festen Willens, das Vertrauen, das man ihm bezeugte, nicht zu enttäuschen. Er war glücklich, arbeiten zu dürfen. Das beschämte mich und brachte mich dazu, meine Schmetterlingshaftigkeit mit anderen Augen zu sehen. Es ist seltsam, wie das Privilegiertsein manchmal zu Stolz und manchmal zu Selbstverachtung führt.
Ich war erleichtert, als wir das Geschäftliche hinter uns hatten und er mir Anekdoten erzählte. Wir verabredeten uns für den nächsten Morgen an der U-Bahn-Haltestelle Jiřího z Poděbrad, um gemeinsam zu Novák zu gehen, der in seiner Wohnung nahe dem Fernsehturm arbeitete, dort, wo der Hügel von Vinohrady nach Žižkov abfällt und von einem Friedhof flankiert ist. Novák war der neue tschechische Übersetzer der Manuals, und es handelte sich mehr um einen Höflichkeitsbesuch. Der alte Übersetzer hatte noch aus dem Deutschen übersetzt, und die doppelte Übersetzung ging auf Kosten der Exaktheit. Novák war eine Entdeckung Liehms, und er arbeitete direkt mit dem englischen Original. Es drehte sich hauptsächlich darum, ihn einmal persönlich kennenzulernen. Er lebte in einer Stichstraße, die direkt auf den Friedhof ging, der Lucemburská, einer platanengesäumten Allee, und war ein 25-jähriger stiller Schwarzhaariger, der, wie sich dann herausstellte, den ›New Musical Express‹ abonnierte und alle House-Clubs Londons sowie die wenigen kannte, die es in Prag gab.
Hinterher fuhren wir in Nováks Škoda in die Innenstadt, aßen in der Zlatá Lyra Karpfen und Palatschinken, spülten alles mit einem ausgezeichneten österreichischen Wein hinunter, ich verabschiedete mich und war frei.
Da ich erst am nächsten Vormittag in Globau erwartet wurde, um dort Rudolph abzuholen, blieb mir noch der gesamte Nachmittag und Abend, um in Prag zu bummeln. Ich hatte Glück, die Sonne schien, keine Wolke stand am Himmel, es war frühlingshaft warm.
Ich schlenderte die endlose und unübersteigbare Mauer längs der Letenská entlang, bis zum Eingang des Waldstein-Palais. Als Kind hatte ich die sonntäglichen Spaziergänge in gepflegten Grünanlagen (Seepromenade, Mainau, Kur- oder Schloßpark) verabscheut, den Zauber von Parks und Gärten hatte ich im Exil erkannt und erlernt. Vielleicht weil ich fremd war und nostalgisch und jeder Park etwas Nostalgisches hat. Vielleicht erkennen wir hartnäckigen Städter nur in Parks, daß wir eine Grenze überschritten haben, die uns von unseren Vorfahren trennt, deren Leben mit dem Land verbunden war. In einem Park zu sitzen schafft eigentümliche Beziehungen zu den Menschen: eine Art stiller Komplizenschaft zwischen Leuten, die regelmäßig, ohne miteinander zu reden, sich auf Parkbänken begegnen. Sie sind noch nicht in jenes unerbittliche Zeitalter eingetreten, in dem Information, Datenaustausch alles ist. Sie brauchen nicht zu reden. Der Park ersetzt die Kommunikation. Er ist dem Einsamen am Tag, was ihm nachts die Kneipe ist.
Aber dieser Park erinnerte nicht an eine Kneipe. Er war kein Hort, sondern eine Vision. Die Fassaden des Palastes, wie so vieles in Prag in ihrer Stilvermischung den Lauf der Zeit demonstrierend. Die Türme, Schwünge und Kurven des Frühbarocks und die präzise, strenge, italienische Schönheit des Renaissancegebäudes dort drüben, ockerfarben leuchtend in der Februarsonne, so daß man sich in Ferrara glaubte, und widergespiegelt in dem großen Becken, gerahmt von der hohen Mauer mit den noch kahlen Fliederstauden. Das Immergrün des Labyrinths und die symbolischen Buchsbaumhecken des italienischen Gartens, die halbversteckten Nymphen, die Diana, die mit kräftiger Armbewegung den Faun, der ihr zu nahegetreten und von ihr bezwungen bereits am Boden liegt, mit dem Speer durchbohrt. Weiter hinten der englische Garten mit den mächtigen hundertjährigen Kastanien und der Voliere. Im Mantel war es warm, auf einer Bank zu sitzen und zu schauen. Lesende Mädchen, leise diskutierende Paare, Studenten vielleicht. Alte Männer allein, alte Frauen zu zweit und dritt. Früher dachte ich immer, Schönheit, unaffektierte Schönheit gebe es ausschließlich in der Natur. Heute meine ich – und vielleicht ist das auch nur ein Zeichen von Resignation und nachlassender Vitalität – daß die von Menschenhand geschaffene Schönheit, ob sie sich an der Natur inspiriert oder sie domestiziert, in ein Maß bringt, tiefer geht und uns gemäßer ist, eine Gnade. Eine Gnade, denn sie bringt uns nicht zum Erstarren oder Erschauern, sondern erinnert uns daran, daß wir nicht alleine sind, so oder so.
Herr Wallenstein selbst war vermutlich kein sehr angenehmer Zeitgenosse, 23 Häuser wurden abgerissen seinerzeit, um Platz zu machen für dieses Anwesen, und ganz Prag wurde ausgeplündert, um es zu bezahlen. Und um Vaux-le-Vicomte zu schaffen, wo ich so oft mit Pauline gewesen war, hatte Fouquet ganze Dörfer ausradiert. Ganz Frankreich hatte geblutet. Unmenschen, Egoisten, Herrenmenschen, Wallenstein und Fouquet? Mag sein, zu ihrer Zeit. Ein Söldner, ein Finanzminister, die beide Schönheit kreieren. Wer weiß, aus welchem Winkel ihrer machtbesessenen Gehirne dieser Drang kam? Zeichen der Neuzeit, die Größe, den Ruhm, die Intelligenz des Menschen zu verewigen, statt der Gottes und der Götter, indem man der Natur seinen Willen aufzwingt, Architektur, Geometrie und alle Dekorationskünste aufbietet, um das Chaotische, das Sinnlose in Form zu bringen. Die Zeit verzeiht alles. Wen interessiert heute noch, wer in den 23 abgerissenen Häusern, in den drei ausradierten Dörfern lebte? Mich nicht. Wer baute das siebentorige Theben? Eben doch ein großer Geist, ein großes Schwein vielleicht ebenfalls, dessen Phantasie es entsprang, dessen Traum Menschen und Natur zwang. Und das Leid? Wird zu all dem andern gelegt, ein Tropfen ins Meer. So viel Leid, aus dem keine Schönheit wuchs, als daß man nicht dankbar für die wenige Schönheit sein müßte.
Ja, früher bewunderte ich nur die Natur, heute ist mir das Maß, die Grazie der vom Menschen untergeordneten Natur mehr wert. Damals war Wallensteins Palast, war Fouquets Schloß nur wenigen zugänglich, heute uns allen. Ein Antidot gegen den Horror? Die Menschen, die hier sitzen und spazierengehen, müssen ganz einfach etwas behalten vom Eindruck der Schönheit. Etwas geht auf uns über. Etwas bessert uns. Was ich an Deutschland haßte, war die Häßlichkeit. Mehr als alle dunkle Vergangenheit, mehr als alle Fanatiker, was mich abschreckte, war die Häßlichkeit der Städte, des Landes. Die verquere Lust an der Häßlichkeit. Schönheit und Ratio, Schönheit und Maß gehören zusammen, aller Fanatismus, alle Extreme haben mit Häßlichkeit zu tun. Wenn wir seinerzeit gekonnt hätten, wie wir wollten, wäre diese Stadt zerstört, gäbe es diesen Park nicht mehr. Wenn man uns Deutsche gelassen hätte, hätten wir alle Erinnerung zerstört, alle Kontinuität kurzgeschlossen. Da man uns gestoppt hat, ist es letztlich nur unsere eigene Kontinuität, die gekappt ist und nie mehr existieren wird, unsere eigene Erinnerung, die nicht mehr richtig funktioniert. Schönheit hat auch mit Erinnerung zu tun, denn es ist der Vergleich, der Schönheit schafft. Und Erinnerung ist Kontinuität. Wie oft hatten sich mir in Amsterdam, in Paris im Anblick eines Hauses, eines Cafés, einer Straße die Zeiten ineinandergeschoben, Silhouetten aus vier, aus fünf oder sechs Generationen, die dieselben Stufen abschliffen, aus demselben Fenster geschaut hatten, über die nämlichen Straßen geschrieben. Und wir? Ein Loch. Ein Nichts. Und die Stimmen, wir müßten doch endlich vergessen. Was sind 50 Jahre? Viel für ein Volk, das glaubt, es bestehe erst seit 45 Jahren. Weniger als ein Augenzwinkern in der Seele eines Menschen. 1000 Jahre zu lieben, 1000 Jahre zu hassen, nichts zu vergessen in 1000 Jahren, alles sich zu merken, das wäre menschliches Maß. Bea mochte 50 Jahre verheiratet bleiben, was kümmerte das meine Liebe? Sie mochte 100 Jahre verschwunden bleiben, was konnte mich das stören? Ich hatte sie schon 1000 Jahre gekannt, 1000 Jahre begehrt, würde noch in 1000 Jahren voll frischer Ungeduld die Einlösung des Versprechens unseres ersten Moments erwarten, schien mir.
Und die schlechte, die kurze Erinnerung spielt Streiche. Nicht jeder vergißt so schnell wie unsereins und wie wir glauben, daß ein jeder vergessen müsse. Das Exil öffnet die Augen. Vor allem über die Illusion des kurzen Gedächtnisses unserer Nachbarn. Wenn wir wüßten, wie wenig Liebe, Vertrauen, Achtung und Freundschaft unser Wirtschaftswunder, unsere Demokratie, unsere Nationalelf und unsere Autos hervorgerufen haben! Zwei Namen nur. Zwei Namen, die mir immer wieder begegnet sind. Bei holländischen Kraakern, Kiffern und Geschäftsleuten, bei Franzosen meiner angeheirateten Familie aus drei Generationen. Zwei Namen nur in der Waagschale, zwei Tropfen deutscher Menschlichkeit auf den heißen Stein lebendiger Erinnerung: Böll und Brandt. Niemand anderes.
Und meine Mutter, die naiv erzählte bei jenem Weihnachtsfest, das ich mit Pauline in Hamburg verbrachte, wie ihr in Saintes stationierter Vater lebte wie Gott in Frankreich und Freßpakete nach Hause ins arme Frankfurt zu Frau und Tochter schickte. Ins arme Frankfurt, wo sie noch zweimal die Woche Fleisch aßen im Winter 43 auf 44, während Paulines Mutter und Großmutter ohne Strümpfe über die gefrorenen Stoppelfelder des ausgesaugten Frankreich 16 Kilometer marschierten, um ein Päckchen ins Stalag von Hanau aufzugeben, wo Paulines Großvater einsaß mit Skorbut und während seiner fünfjährigen Gefangenschaft 19 Kilo verlor. (»Der Deutsche hat seine Kriegsgefangenen immer tadellos behandelt«, sagte mein Vater dann.) Und wie Paulines Mutter mir erzählte, was für sie immer die erste Erinnerung bleiben werde, sobald das Wort Deutschland fällt: der Lärm der gewichsten schwarzen Schaftstiefel, trapp trapp trapp über das Pflaster ihres Dorfes in der Bretagne, der Marschtritt der schwarzen Stiefel, aus einer Kellerluke heraus beobachtet, wo man nichts sah als die Stiefel auf dem Pflaster. In einem Keller versteckt, weil damals, im Sommer 1944, die deutsche Wehrmacht, auf ihrem geordneten Rückzug aus der Bretagne, Frauen und Kinder einfing und sie vorne auf die Hauben und Kotflügel der LKWs schnürte, als Geiseln gegen eventuelle Anschläge der Resistance. (»Ich weiß nicht«, sagte mein Vater, »die Franzosen können sich doch nicht beschweren. Erstensmal war der deutsche Soldat immer korrekt zur Bevölkerung, und das halbe Land war doch freie Zone. Da konnten die doch ganz unbehelligt leben!«) Da lief Pauline türenschlagend aus dem weihnachtsgeschmückten Wohnzimmer, ich hinterher, und mein Vater bereute gewiß, daß ich keine Deutsche geheiratet hatte.
Was alles Paulines Mutter nicht davon abhielt, in den siebziger Jahren eine Pauschalreise nach Deutschland zu buchen, nach Bayern genauer gesagt: La fête de la bière, das Oktoberfest und Neuschwanstein; alles sehr sauber, war ihr Kommentar, und freundliche Menschen. Ohne Stiefel diesmal. »Ihr könnt doch gar nicht wissen, wie es damals war«, sagte mein Vater. »Heute kann man sich das doch alles gar nicht mehr vorstellen.« Oh doch, es genügte, im Garten von Wallensteins Prager Palast zu sitzen und die Zeiten durch sich strömen zu lassen, um sich all das und noch viel mehr vorstellen zu können.
Wie kann man in ein Land zurückwollen, in dem nur die Gegenwart existierte, in dem man nur die Gegenwart gelebt hatte? Die Jahre im Ausland hatten einen Menschen aus mir gemacht, der wie ein Geologe oder ein Maulwurf alle Erdschichten zugleich erblickt, wenn er nur auf die Oberfläche starrt. Wo war das Waldsteinpalais Hamburgs, in dem ich mit Bea gesessen hätte und wo unsere Liebe in die vielhundertjährige Kontinuität anderer Liebespaare getaucht wäre? Wie versöhnlich ist es zu wissen, daß man nicht der Erste noch der Letzte ist. Aber wir hatten keinen Park gekannt, in dem die Zeit geatmet hätte, nur den nackten Frühling, der immer wiederkehrt. Wir waren nie in eine Stadt gereist, vielleicht hatten wir die Konfrontation mit der steingewordenen Dauer gescheut.
IV
BEGEGNUNG IN DER PINCHAS-SYNAGOGE
Das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert war klein und niedrig und schien jedes Geräusch zu schlucken: Drinnen umgab mich absolute Stille. Es war nicht die Touristensaison, und es war kurz vor Schließung, so befanden sich außer mir nicht mehr als zehn Leute in der Synagoge. Paare meist, die sich an der Hand hielten und schräg nach oben starrten, vielleicht um die Schrift an den Wänden als Gesamtheit zu erfassen, anstatt die einzelnen Namen zu lesen. Die Namen der 77 000 in Terezín Ermordeten. Wie reagiert man auf diese in den Stein gravierten Namen? Wie reagiert man darauf als Deutscher? Hat man als Deutscher das Recht, diesen Raum zu betreten? Hat man die Pflicht? Was muß, was sollte, was darf man denken und fühlen? Ist es nicht pervers, sich das zu fragen, bevor man überhaupt irgend etwas denkt und fühlt?
Ist der Schauder, der mich überläuft, eine epiphanische Erschütterung oder ein deutscher pawlowscher Reflex? Nicht jeder darf auf die Knie sinken, und nicht jeder, den es auf die Knie zwingt, gibt dem Impuls nach. War ich ein Unmensch, weil ich aufrecht stehenzubleiben vermochte? Dickfelligkeit ist auch ein Schutz. Pauline war unfähig geworden, irgendeinen Schmerz, eine kleine Scheußlichkeit des täglichen Lebens, eine Ungerechtigkeit zu übersehen, zu verdrängen, zu vergessen, und das hatte sie zerrieben, bis ihr keine Wahl mehr blieb als der Tod. Und niemand hatte ihr helfen können. Nimm das doch nicht alles so ernst. Doch sie nahm es einfach ernst.
Aber wenn ich Pauline Dickfelligkeit und schlechtes Gedächtnis als Überlebenshilfen empfohlen hatte, was sollte ich dann hier und jetzt sagen? Vor diesen siebenundsiebzigtausend Namen, Geburts- und Sterbedaten.
Ja, ich verstehe dich, Pauline, ich verstehe dich zutiefst, und doch werde ich wieder hinaustreten aus diesem Saal und die Türen hinter mir schließen und weiterleben, ein wenig angeschlagen, ein wenig beschämt, mit dem eingewachsenen Stachel einer Erinnerung im Fleisch, einer lokalen, chronischen Entzündung.
Und dann, Pauline, erinnerst du dich nicht? Paris, die Gegenwart!
Wir haben doch den zehnjährigen orthodoxen Jungen mit seinem runden breitkrempigen Hut, seinen Schläfenlöckchen über den flaumigen Wangen und seinem Geigenkasten panisch dem Bus der Linie 91 hinterherlaufen sehen. Wir haben die blondierten schmuckbehängten Sephardinnen belauscht, wenn sie lautstark bei ihrem Kakao in einem Café der Rue Aboukir beisammensaßen und die Armreifen klimperten bei den großen Gesten. Wir haben auf einer Parkbank oben in den Buttes zwei alte, auf ihre Stöcke gestützte Männer Jiddisch reden hören. Wir haben mitgelacht, wenn die anderen ihre Witze rissen über die nordafrikanischen Juden. Wir haben die Polizisten mit den MPs vor dem Eingang der Synagoge in der Rue de la Roquette stehen sehen, in die die Hochzeitsgäste strömten, und die Range Rovers und Nissan Patrols waren kreuz und quer über die Gehsteige geparkt. Erinnerst du dich an den Graubart, der mich in der Metro schüchtern ansprach: »Ich habe gesehen, daß Sie die ›Equipe‹ lesen. Könnten Sie mich wohl eben nachsehen lassen, in welcher Qualifikationsgruppe Israel spielt?«
Wir wissen doch, daß die siebenundsiebzigtausend Namen nicht das Ende sind.
Aber ich war nicht unbeschwerter deswegen. Ich beobachtete die anderen Besucher, ich sah auf die gravierten Namen, ich setzte langsam einen Fuß vor den andern, da fiel mein Blick auf eine alte Dame, die schon seit einiger Zeit unbeweglich vor der Mauer stand und gegen sie starrte. Ich näherte mich ein wenig. Ihr Gesicht war gegen die Mauer gerichtet, ich konnte es nicht sehen. Aber ich hörte sie murmeln, den Blick unverwandt in die Mauer vertieft, so daß ich unweigerlich neugierig wurde, als könne dort anderes zu sehen sein als der Name eines Toten.
Die Frau war eher klein, vielleicht 1,60 m groß, sehr schlank, gut und teuer gekleidet. Sie trug einen schwarzen Kaschmirmantel, der die Knie bedeckte, aber die Waden und die jungmädchenhaft schmalen Fesseln sichtbar ließ. Die Schuhe, auch schwarz, hatten halbhohe Absätze, und es gefiel mir, eine alte Dame zu betrachten, die ein wenig kokett war. Sie trug eine schwarze samtene Baskenmütze, unter der das weiße Haar zu einem Zopf geflochten war. Der einzige Farbton im Schwarzweiß der Kleidung und des Haars waren fliederfarbene Lederhandschuhe und eine im selben Ton gehaltene Seidenstola über ihren Schultern. Die Hände waren lässig vor dem Körper gefaltet, über der rechten Schulter hing ein Täschchen; ein Kinderspiel für jeden Taschendieb, es ihr fortzureißen. Als hätte sie meine Gedanken gehört oder meine beobachtende Präsenz zwischen den Schulterblättern gespürt, drehte sie sich plötzlich um und blickte mich an.
Die grünen Augen! Die Katzenaugen! Die strahlenden funkelnden Augen einer 17-jährigen! Der Schock! Eine Sekunde lang war mir, als kenne ich sie, müßte ich sie gekannt haben, die Augen erinnerten mich an – weg war die Assoziation! Einen Augenblick lang flammte eine Epiphanie auf, aber ich wußte nicht, wo der Zusammenhang war. Dann drehte ich mich zur Seite, und sie blickte wieder zur Wand. Natürlich – wie hätte mir das trotz der Jungmädchenaugen entgehen sollen – hatte mich keine Siebzehnjährige angeblickt. Das Gesicht der Frau versuchte sein Alter nicht zu leugnen, zu vertuschen. Schwer zu sagen, wie alt sie sein mochte. 70, 75, 80, noch älter? Sie hielt sich sehr gerade, aber in ihrem faltigen Gesicht hatte das Leben offen Buch geführt. Doch besaß der Anblick nichts Erschreckendes. Jedes Jahr, jede Freude, jeder Schmerz hatte, ohne daß sie sie daran zu hindern versuchte, seine Spur eingegraben. Die früher vielleicht vollen Lippen waren schmal geworden, das einzige, dem die Zeit nichts angehabt hatte, war der Blick.
Wie sie mich angesehen hatte! Und wie sie jetzt wieder zur Wand starrte! Etwas zog mich, etwas drängte mich, und mit Herzklopfen, als sei ich selbst wieder zwanzig und wollte ein Mädchen ansprechen, trat ich Schritt für Schritt näher.
Aber, als würde ihr Blick gegen die Mauer auch mich lenken, sah ich nicht auf die Frau, sondern gegen die Mauer, um zu entdecken, was es war, oder besser, welcher Name es war, der sie so in Bann hielt. Sie mußte mich hören, aber sie sah sich nicht mehr um, blickte starr auf die Wand, bis ich neben ihr stand, die Mauer vor Augen, meine Sehschärfe regelte, und da traf mich der Schlag, meine Knie gaben nach, meine Hände griffen unwillkürlich nach Halt, fanden ihn, ich spürte nicht mal, wer oder was mich da stützte, sah nur den Namen! Las den Namen!
KLEIN!
Sah, daß der nachstehende Vorname mit einem ›A‹ begann! Mein Name! Albert Klein, auf der Liste von 77000 ermordeten Juden! Ich schloß die Augen, öffnete sie, alles verschwamm, KLEIN, A…war da in den 500 Jahre alten Stein gemeißelt, es mußte, es würde Klein, ALBERT dastehen.
Ich taumelte, als ich bemerkte, wie die Hand, die in meiner lag – denn eine Hand hielt meine Hand seit geraumer Zeit fest! – wie diese Frauenhand mich stützte, und ich öffnete die Augen, mein Blick wurde klar, und es waren die grünen Augen, die mich aufrechthielten – ich wußte nicht, wie mir geschah, die Hand, die Augen, ganz nah vor und unter mir, der Name und dann die Stimme, die tiefe und melodiöse Stimme, ein Celloton, die Stimme, die sagte – und sie sprach deutsch, wurde mir klar, denn ich verstand, was sie sagte: »Bist du gekommen für meinen Liebsten? Bist du der Sohn, der Nachfolger meines Liebsten? Du, der seinen Namen trägt? Bist du es? Bist dus?«
Ich starre sie an, ich glaube, den Verstand zu verlieren, ist nicht die Synagoge plötzlich hell wie am Tag, wessen grüne Augen sehe ich da, bin ich plötzlich auf die rollende Feuerkugel namens Zeit gespannt und taumle durch die Epochen, Schlieren und Schleier vor Augen, alles undeutlich, schon einmal gesehen, noch nicht gelebt, Erinnerung an die Zukunft? Ohne daß ich es bemerkt hätte, haben sich Tränen in meinen Augen gestaut, ein Meer von Tränen, und meine Brust hebt und senkt sich unter schweren Seufzern, als erwache ich aus einem Alptraum. Aber unter Tränen lese ich dann doch neben ihrem Kopf den ganzen Namen: KLEIN, ABRAHAM.
Ich starre sie an, weinend schüttle ich den Kopf, erleichtert, erlöst und zugleich auch untröstlich:
»Nein«, stammle ich, »nein, nein, nicht ich, ich bin’s nicht …«
Ihre Hand gibt mich frei, aus ihren Augen weicht die Frage, ihr Mund verzieht sich zu einem Lächeln, dem Schatten eines Lächelns. Ihre Hand berührt meine Stirn.
»Ganz heiß bist du«, sagt sie, die Cellostimme, die Stimme einer Mama (die Augen einer Geliebten). »Geh jetzt, du wirst schon verstehen, laß mich alleine.«
Sie gibt mir noch einen zärtlichen Stoß: »Geh.«
Ich torkelte aus der Synagoge, kam auf die Straße, zog die Luft in tiefen Zügen ein, die kalte abendliche Februarluft der uralten seltsamen Stadt, spürte etwas auf meinem Kopf, plötzlich machte alles mir Angst, als hocke mir eine riesige schwarze Spinne im Haar, ich schrie auf, fuhr mit der Hand drüber, aber es war nur die Kippa, die ich vergessen hatte, beim Herausgehen wieder an der Kasse abzugeben. Ich knautschte sie mit zitternden Fingern, ich sah nach links nach rechts, wußte nicht wohin, begann zu laufen, stieß mit Passanten zusammen, die mir nachfluchten, die Kälte trocknete meine Augen, die immer noch blind waren, nichts sahen in der Dunkelheit der Gassen des Josefov als meinen Namen an der Wand und die grünen Augen, dann leuchtete ein gutes warmes helles Schild aus der Nacht: ›Antiquariat‹. Und darauf hielt ich zu, die stumme Welt alter Bücher würde mich wieder zu mir selbst bringen, Atem schöpfen lassen, meine Gedanken in die Ordnung zurückführen. Ich war naß geschwitzt, mein ganzes Gesicht war naß, aber auch mein Haar, mein Hals, meine Hände, blutete denn mein Kopf? Nein, es regnete in Strömen, dann stieß ich die Tür auf, ein Glockenspiel ertönte, und ich war im Trocknen, Stillen, wo es lieblich und vertrauenerweckend nach Papier roch.
Es ging sechs Stufen hinab, an den Wänden hingen Stiche, und alte lederne Buchrücken standen dicht an dicht in den Regalen, alles warm und schwach erleuchtet von drei gelben Deckenlampen, und am Ende des Raums an einem Tisch saß der Antiquar und las. Ich war der einzige Besucher.
V
DAS ANTIQUARIAT
In Buchhandlungen und um so mehr in Antiquariaten gleiche ich einem Gourmand, der all die appetitlichen Speisen, die vor ihm aufgetischt sind, zunächst als Gesamteindruck mit den Augen verschlingt, abwägt, sich das Wasser im Mund zusammenlaufen läßt, die Arrangements, die Präsentation, den Augenschmaus als geistige Vorspeise goutiert, bevor er sich auf einen bestimmten Teller konzentriert und das Mahl beginnt.
So schritt ich zunächst die Wände ab, blickte auf die Reihen von Buchrücken, ließ den so verschiedenartigen Charme dünner broschierter Bändchen, die schön in Blei gesetzte Gedichte versprachen, und großformatiger dicker Folianten mit Goldschnitt, auf deren Seiten vermutlich an Kriege und Entdeckungen erinnert wurde, auf mich wirken. All das half, der Erschütterung Herr zu werden, die ich soeben durchlebt hatte, und zu versuchen, sie einzuordnen.
Seltsamerweise ist eine Buchhandlung für mich immer ein Ort der Rationalität, des klaren Gedankens, viel mehr als eine Schatzinsel mit Geistern und Phantomen. Erster Gedanke: Du hast dich getäuscht. Der Name war gar nicht Klein. Und ob. Zweiter Gedanke: Warum schließlich nicht? Warum sollte es nicht auch jüdische Kleins gegeben haben. Und überhaupt. Waren denn nur die Juden aufgeführt auf dieser Liste, oder alle Opfer? Das mußte doch herauszufinden sein. Dritter Gedanke: Kommen wir dem Problem doch einmal statistisch/stochastisch näher. Klein ist ein häufiger Name, und nicht nur im Deutschen. Elsässer, Franzosen, Österreicher hießen auch so. Hätte ich mir die Namen länger angeschaut, wäre ich garantiert auch auf zahlreiche Schmidts und Meiers getroffen. Das hätte zwar mich nicht berührt, aber man stelle sich die Touristenmassen vor und die Mengen von Meiers unter ihnen. Dann noch einen passenden Vornamen, und der Schreck, der mir in die Glieder gefahren war, mußte sich in der Hochsaison vermutlich täglich ereignen. Ein Zufall also.
Letzter Gedanke: Was mich so irr gemacht hatte, war ja der plötzliche Schock, vor meinem eigenen Grab zu stehen. Es hatte den ganzen Vornamen gar nicht gebraucht, damit ich mich angesprochen und gemeint fühlte. Nun gut: atavistische Furcht, das kam vor.
Jedenfalls war unsere protestantische, langweilige Klein-Familie mit ihren Bauern, Kleingewerbetreibenden, Mitläufern, ohne große Bösewichte oder Opfer, ohne große Ausbrüche, hier nicht vertreten. Wir waren nicht von der Art, die man irgendwo in Stein meißelt.
Blieb die alte Frau. Das war freilich seltsam. Vielleicht war sie einfach meschugge?
Jemand räusperte sich. Ich blickte auf. Der Antiquar sah mich an. Ich lächelte ihm kundenhaft zu und dachte weiter. Ja, die Frau. Das war sonderbar. Wie sie dich geduzt hat. Wie sie so sicher war. Aber die Zeiten gerieten ihr durcheinander. Ich, 1959 geboren, konnte schwerlich der Sohn von jemandem sein, der in Theresienstadt ermordet worden war. Und ihre grünen Augen! Und wie ich wußte, daß ich hatte nähertreten müssen! Auf einmal waren meine Augen wieder voll Tränen, und ich weinte. Worüber? Über die lange Zeit, über die Abwesenheit, über alles, was geschehen war und nicht mehr rückgängig zu machen und nicht zu wiederholen. Über uns alle, über –
Der Mann räusperte sich wieder und sah mich direkt an. Lächelte mich an. Ich wischte mir unwirsch über die Augen. Was würde er von mir denken! Er war ein schöner Mann, sah ich jetzt, von unbestimmbarem Alter, lockiges schwarzgraues Haar und ein grauer Vollbart. Ein großes Gesicht, hohe Stirn, leicht gewölbt, eine Adlernase, volle Lippen, aber stark geschwungen, klar gezeichnet, dunkle, ein wenig verhangene Augen. Krähenfüße; ja, die Augen und der lächelnde Mund ließen auf einen humorvollen Menschen schließen.
Er trug einen pistazienfarbenen Rollkragenpullover und schwarze Cordhosen. Wenn ich nur hätte sagen können, wie alt er etwa sein mochte, aber es ließ sich nicht festmachen. Irgend etwas entglitt einem. Er hatte das Buch, in dem er gelesen hatte, niedergelegt und sah mir in die Augen, prüfend, wollte mir scheinen. Auf dem kleinen Schreibtisch stand sonst nur noch eine bronzene Registrierkasse, auf deren Rücken die Schildchen American Express, Visa, Eurocard und Diners Club geklebt waren.
»Sie suchen ein Buch.«
Das war keine Frage. Aber schon wieder redete jemand, ohne daß ich einen Ton gesagt hätte, deutsch mit mir. Als ich mit Pauline nach Prag gefahren war, vor zwei Jahren, hatte sie mich gebeten: »Verbirg, daß du ein Deutscher bist, wenn wir dort sind. Rede französisch.« Es war allgemein bekannt, daß die Tschechen die Deutschen nicht liebten, und ich hätte bestimmt keine schwarzrotgoldene Fahne mitgenommen, aber sie hatte mich verletzt damals, Paulines Bitte. Ohnehin redeten wir nicht deutsch miteinander, und ich fand das ganze übertrieben, irgendwo war mein Rest von Nationalstolz, nein, nicht Stolz, damit hatte es nichts zu tun, meine Identität war verletzt, und ich war schweigend wütend auf Pauline, als hätte sie versucht, mir meine Seele oder meine Erinnerungen zu nehmen, obwohl – ich wiederhole es – ich nichts darauf gebe im allgemeinen, im Ausland den Deutschen zu markieren.
Im Gegenteil. Wie alle Deutschen.
Nun aber sprach der Antiquar mich auf deutsch an. Daß meine Nationalität mir offenbar so deutlich ins Gesicht geschrieben stand, gefiel mir auch wieder nicht. Die Deutschen seit 68! Eine Generation von Nemos. Vielleicht daher auch der Drang, sich in fremden, sprich amerikanischen Identitäten aufzulösen. Die Deutschen: ein Teil alte Nazis, ein Teil neue Amerikaner. In der Mitte ein Loch. Ich fing schon wieder an!
Der Antiquar schmunzelte, als habe ich laut gesprochen und stand auf und kam hinter seinem Schreibtisch vor. Er war fast einen Kopf größer als ich, das heißt, beinahe zwei Meter groß, schlank, aber gebaut wie ein Kleiderschrank. Der wohlwollende Blick aus seinen verschleierten Augen war wie der Blick eines Freundes, der meine Vorlieben und Schwächen kannte.
»Ich habe Ihr Buch«, sagte er.
»Mein Buch?«
»Ja. Warten Sie, ich finde es gleich.«
Er ging an mir vorbei, suchte mit den Augen in den deckenhohen Regalen und schien zu finden, was er suchte, denn er trat näher, schob die erste Reihe beiseite und zog ein Buch aus der zweiten hervor. Es hatte einen Ledereinband und goldgeprägte Mäander auf dem Deckel. Es war dick, aber nicht zu dick. Ich fragte mich, wofür er mich wohl hielt, und meine Neugierde wuchs.