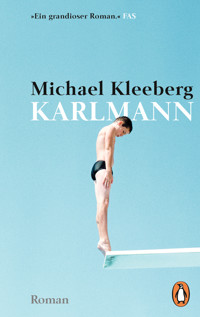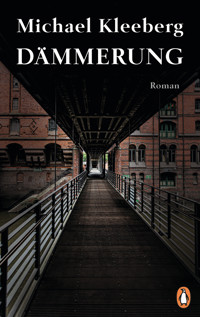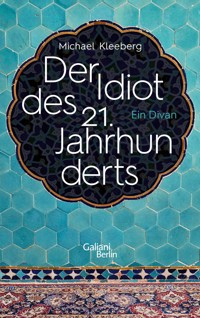Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
Copyright
Für P und P
Ich hab ein glühend Messer in meiner Brust.O weh! O weh! Das schneid‘t so tief.
GUSTAV MAHLER
You hear the bell, you come out fighting.
PHILIP ROTH
Dahin
dahin
Wann immer ich an meine Jahre in Paris zurückdenke, schiebt sich dieses janusköpfige Wort, das zugleich die Trauer um einen unwiederbringlichen Verlust und die Sehnsucht nach einer unerreichbaren Ferne bezeichnet, vor meine Erinnerungen und verhindert, dass ich in sie eintauchen, in ihnen umhergehen kann. Dieses Dahin umgibt sie wie ein feiner Schleier aus Melancholie, und versuche ich ihn zu lüften, versetzt er mir einen Schmerz, der mich loslassen lässt.
Dabei ist es kein stechender, kein bohrender, eher, wenn es so etwas gibt, ein sanfter Schmerz, und ich sage mir dann, das, was ich für einen Schleier halte, ist in Wahrheit ein Wundhäutchen, und risse ich es fort, begänne die Blutung wieder und wäre vielleicht nicht mehr zu stillen.
Will ich beschreiben, wie dieses Dahin für mich klingt in seinem Doppelklang, dann fallen mir ein Gedicht und ein Chanson ein. Das Gedicht Meeresbrise von Mallarmé ist ein einziger weher, sehnlicher Aufschrei, ins Weite hinauszugelangen, fortzukommen, davonzukommen: Fliehen! Dahin! Fliehen!
Und in Georges Brassens‘Lied von den Jungverliebten, deren Zuflucht vor der Welt und ihrer Moral die Parkbänke sind, auf denen sie sich küssen, muss das Paar nach dem Ende des Rausches, wenn der Alltag eingekehrt ist, voller Nostalgie erkennen, dass die Zeit, in der es träumend und voller Zukunftshoffnung auf seiner Parkbank allen bürgerlichen Konventionen eine Nase drehte, dass die Zeit, in der es ungeduldig glaubte, das Eigentliche komme erst noch, selbst das Eigentliche, das beste Teil, der schönste Augenblick seiner Liebe gewesen ist, und der ist dahin, und alles Weitere ist nur noch Abstieg.
Dem Neuankömmling scheint sich die Stadt zu öffnen - sie ist sein in all ihrer Faszination, er muss nur zugreifen. Aber um ein etwas abgegriffenes Bild zu gebrauchen: Sie öffnet sich ihm nur so, wie eine Frau auf dem gynäkologischen Stuhl sich dem Arzt öffnet; die Macht über ihren Körper ist rein funktional, bleibt äußerlich.
Geht man irgendwann wieder fort, schließt der Sesam sich nahtlos, als habe er sich nie aufgetan, und man hat das Recht verwirkt, ihn noch einmal zu finden. Aber wer es versucht hat, wird zweifelnd vor der geschlossenen Wand stehen: Ist er der Stadt entkommen, oder ist er ihrer verwiesen worden? Denn die Seele von Paris, um deren Aufmerksamkeit, um deren Gunst man gebuhlt hat, ist erbarmungslos. Diese Metropole ist zu groß und zu alt für einen einzelnen Menschen.
Das Leben in Paris ist ein Zeugen und Sterben unter dem saturnisch schweren, gleichmütigen Blick der alten Stadt. Man muss die Tragödie, die sie für einen bereithält, bis zur Neige durchleben. Wer sich ihr opfert, wer zum Humus wird, auf dem sie wächst, nur der darf sagen, sie gehöre ihm und er ihr. Wer ihr entkommt oder ihrer verwiesen wird wie ich, der nun schon lange wieder in Deutschland lebt, dem bleibt für den Rest seines Lebens nur das schwermütige Dahin.
Darum darf ich, will ich mich nach Paris zurückversetzen, nicht an mich denken, sondern muss mich an andere Menschen von damals erinnern. Zum Beispiel an Hélène.
Sie war dreißig, als sie den Amerikaner zum ersten Mal sah. Das war im Herbst 1991, und es geschah im amerikanischen Hospital von Paris, das in Neuilly am Boulevard Victor Hugo liegt.
Sie wartete in dem Raum gleich hinter der Rezeption, der wie die amerikanische Phantasie von einem Londoner Club in Holz und mit genoppten Ledersofas eingerichtet war. Davor, an den beigen, mit weißen Holzleisten in Rahmen und Kassetten unterteilten Wänden, hingen Ölgemälde der Gönner und Spender des Krankenhauses. Über der Tür war eine bronzene Dankestafel für die Starr Foundation mit eingearbeiteter Stutzuhr angebracht, daneben hing ein Foto aus den zwanziger Jahren, auf dem ein Automobil durch das schneebedeckte und von kahlen Bäumen gerahmte Portal des American Hospital rollt.
Sie war ein wenig zu früh dran. Aus der rückwärtigen Terrassentür konnte sie in den weitläufigen Garten hinausblicken, bis zu den hinter Platanen halb verborgenen Nebengebäuden, nach vorn durch die geöffnete Tür war das typische Klinikgewimmel zu sehen, das am Empfang des American Hospital of Paris eher an die Rezeption eines Grand Hotels erinnerte.
Schwarze Diplomaten im dreiteiligen Anzug eskortierten bunt gekleidete Frauen zum Empfangstresen, Golf-Araber in langen Gewändern und mit Aktenkoffern telefonierten oder rauchten draußen vor der Glastür, weißgekleidete Ärzte und Pfleger mit Stethoskop in der Brusttasche über dem Namensschild huschten vorüber, ihre gesenkten Augen verrieten die Furcht davor, angesprochen und aufgehalten zu werden. Junge weibliche Krankenhausangestellte, die wie Messe-Hostessen aussahen, stöckelten stakkato den Korridor entlang. Nasebohrende Kinder auf Besuch betrachteten die historischen Schwarzweißfotos aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, auf denen Rotkreuzschwestern mit Häubchen und Invaliden an Krücken zuversichtlich lächelnd vor Krankenwagen mit hölzernen Radspeichen posierten, im Hintergrund der zweiflüglige Bau, der heute noch das Zentrum des Krankenhauses bildet, damals aber das einzige Gebäude gewesen war.
Hélène muss im Türrahmen des Clubraums gestanden haben, als vor ihr im Korridor ein Mann zusammenbrach. Er stürzte zu Boden und zitterte unkontrolliert. Sie hatte ihn weder kommen sehen noch sonst wahrgenommen, aber nun lag er direkt vor ihren Füßen, auf der Seite, zusammengekrümmt, die Hände zu Fäusten geballt und krampfartig zuckend, als durchliefen ihn elektrische Schocks.
Die Vorübergehenden drehten den Kopf nach der Szene oder wandten ihn auch ab, aber Hélène kniete sich ohne zu zögern neben den Mann, umfasste seinen Oberkörper von hinten mit den Armen und versuchte ihn umzudrehen oder festzuhalten oder aufzurichten, sie wusste selbst nicht was. Das Ohr nah an seinem Kopf mit dem kurzen braunen Haar hörte sie ihn etwas murmeln. Horror, war das Einzige, was sie verstand. Sobald der Mann, dessen Gesicht sie noch immer nicht gesehen hatte, ihren Körper spürte, löste seine rechte Hand sich von dem Krawattenknoten, an dem sie gerissen hatte, griff nach hinten über die Schulter und klammerte sich an sie. Das heißt, er umfasste mit schmerzhaftem Griff ihren Oberarm, als halte er sich im Fallen an einem Ast oder Vorsprung fest oder wolle seine Hand mit Gewalt dazu bringen, mit dem unkontrollierten Zittern aufzuhören.
Mit aufsteigender Panik, denn sie vermutete einen Infarkt oder einen epileptischen Anfall und wusste nicht, was sie tun sollte, das Einzige, was ihr einfiel, war, dass man Epileptikern ein Stück Holz in den Mund steckt, damit sie sich nicht die Zunge durchbeißen, versuchte sie, den Oberkörper des Mannes ein wenig hochzuziehen. Der Mann war schwer, aber es gelang halbwegs, und als sein Hinterkopf an ihrer Brust ruhte, konnte sie auch sein Gesicht sehen und dass er keinen Schaum vor dem Mund hatte, das Gesicht war wächsern und schweißnass, aber nicht verzerrt, doch starrte der Mann so insistierend zu Boden, dass sie selbst unwillkürlich dort nach irgendetwas Schrecklichem Ausschau hielt, einem Blutfleck etwa. Aber da war nichts. Während die rechte Hand des Mannes noch immer schraubstockfest um ihren Oberarm geschlossen war, hatte die linke sich gelöst und zuckte unkontrolliert hin und her, und dann passierte es. Er bekam Hélènes Kleid zu fassen und klammerte sich so heftig daran, dass sie hören konnte, wie die Seitennaht riss in Höhe der Taille. Dann wurde sie erlöst.
Zwei Weißgekleidete, ein junger Pfleger und eine Schwester, knieten sich neben sie, der Mann griff dem Hilflosen unter die Achseln und hob ihn behutsam hoch, die Frau half ihm, indem sie die Hand des Mannes von Hélènes Oberarm löste und auf ihn einredete. Hélène, ein wenig unter Schock, verstand nichts von den Worten, richtete sich auf zittrigen Beinen auf und strich das Kleid glatt. Dann sah sie den Blick des Fremden, der auf sie gerichtet war. Er war von so bodenloser Traurigkeit, dass sich das aufmunternde Lächeln, das sich schon halb auf ihrem Gesicht gebildet hatte, wieder auflöste. Dieser Blick war so schwermütig, dass sie später nicht einmal hätte sagen können, ob er überhaupt etwas wahrnahm oder ins Leere ging, ob er ihr galt oder durch sie hindurchfiel wie durch ein Sieb. Dieser Blick verhinderte auch, dass Hélène, als sie kurz darauf den Aufzug betrat, um in den vierten Stock hinaufzufahren, einschätzen konnte, wie alt der Mensch gewesen sein mochte. Während sie die Seitennaht des geblümten Kleids inspizierte, die von der Höhe des Büstenhalters bis zum Gürtel aufgerissen war, sah sie die Augen vor sich und verspürte ein solches Mitleid, dass sie darüber völlig die üblichen Krankenhausüberlegungen vergaß, mit denen die Menschen, die hier einander im Vorübergehen mustern, versuchen, den anderen nach Gesichtsausdruck und Körperhaltung in Mitarbeiter, Besucher, leichte und schwere und unheilbare Fälle zu klassifizieren, in »Schlimmer dran als ich« oder »Weniger schlimm dran als ich«.
Es war die Art anonymen Mitleids, die einem den Magen verkrampft und uns im Anblick alter, zum Betteln verurteilter Menschen, weinender Kinder oder misshandelter Hunde anfällt. Der Blick des Mannes, nur der Blick, nicht das Gesicht, nicht der dazugehörige Körper, hatte sich in ihre Augen gebrannt, als hätte sie zu lange in die grelle Sonne gesehen. Sie hörte noch das tonlose I’m terribly sorry, das er in ihre Richtung gesprochen hatte, bevor man ihn den Korridor hinuntergeleitete, wobei der Pfleger - unnötigerweise, wie es schien - die Hand unter seinen Ellbogen schob. Er drehte sich noch zweimal nach ihr um, bevor er hinter einer Flügeltür verschwand.
Es war kurz nach Hélènes dreißigstem Geburtstag im Frühsommer des Jahres gewesen, dass sie und ihr Mann den Entschluss fassten, ärztliche Hilfe zur Herbeiführung einer Schwangerschaft in Anspruch zu nehmen.
Die Entscheidung für ein Kind war zugleich die Entscheidung für eine künstliche Befruchtung, denn Hélène wusste, dass sie infolge einer Salpingitis, die sie als Siebzehnjährige durchgemacht hatte, steril war. Sie hatte in den darauffolgenden Jahren, manchmal erleichtert, manchmal enttäuscht, festgestellt, dass sie nicht schwanger wurde, und dann die Diagnose gestellt bekommen, dass aufgrund von Komplikationen jener alten Entzündung ihre Eileiter verklebt waren.
Im Anfang ihrer Beziehung zu ihrem zukünftigen Ehemann, vor allem im ersten Jahr, in dem die Erregung proportional war zur Unsicherheit - darüber wie ernst man selbst, wie ernst der andere es meinte, wie weit man ihm, wie weit man sich vertrauen konnte -, war diese Sterilität eine willkommene Sache, denn sie machte (nach wenigen und inkonsequenten, der grassierenden Aids-Angst geschuldeten Versuchen mit Kondomen) jede Form lusthemmender oder beschwerlicher Verhütung unnötig.
Als sie sich einer des anderen sicher waren und, vorerst noch jeder für sich, gemeinsame Zukunftsbilder zu entwerfen begannen, glaubte ihr zukünftiger Ehemann insgeheim, den »Fluch«, das »Problem«, mit Willenskraft, mit Glück, mit wohlwollender Hilfe von oben auf dem natürlichen Weg bannen und überwinden zu können. Zu diesem Zeitpunkt planten sie zwar kein Kind, hätten eine Schwangerschaft aber, wäre es dazu gekommen, beide begrüßt. Doch die Natur ließ sich weder zwingen noch bestechen noch überlisten. Da heirateten sie.
Auf ihren sonntäglichen Spaziergängen in den Buttes-Chaumont brachte er das Thema auf. Meistens fuhren sie mit der Metro bis République, gingen den Uferweg am Canal Saint-Martin hinauf von Schleuse zu Schleuse, bogen an der futuristischen, weißen Suppenschüssel der KP-Zentrale in die Avenue Mathurin Moreau und erreichten von dort bergauf den Westeingang des Parks.
Sie schlenderten den Höhenweg entlang, vorüber an der halb von Rhododendron zugewucherten Bank der alten Armenier und der benachbarten der alten Aschkenasen. Sie überquerten die im Volksmund scherzhaft so genannte Selbstmörderbrücke, passierten den Vesta-Tempel und blickten von der Hängebrücke direkt auf den Guignol, das verwitterte Kasperletheater am Seeufer hinab. Die Töchter bürgerlicher Familien, hochaufgeschossene Elfjährige in marineblauen Kleidern, deren dünne Fohlenbeine in weißen Kniestrümpfen steckten, warteten geduldig und sittsam auf die nächste Vorstellung. Rannte eine von ihnen einem Ball nach, vollführte ihr Pferdeschwanz auf dem Rücken wilde Pendelschläge. Auf Bänken im Schatten der Trauerbuchen vor dem Sandkasten saßen junge Mütter, ihre altertümlichen, hochbauenden Kinderwagen mit Speichenrädern neben sich abgestellt, und lasen.
Am Spätnachmittag, zurück in ihrer Wohnung, liebten Hélène und ihr Mann sich nach diesen Spaziergängen oft, bereiteten dann in der Küche gemeinsam das Abendessen zu und hörten dabei Musik.
Hélènes Frauenärztin riet ihr, es entweder im Hôpital Antoine-Béclère in Clamart oder im Hôpital Américain in Neuilly zu versuchen. Die beiden französischen Pioniere der künstlichen Befruchtung, die vor einigen Jahren das erste französische Retortenbaby zur Welt gebracht hatten, arbeiteten der eine im einen, der andere im anderen dieser beiden Krankenhäuser.
Hélènes Mann war sofort für das amerikanische Hospital, aus einem Bauchgefühl heraus, wie er selbst zugab. Der Name flößte Vertrauen ein, stand für Effizienz und Selbstvertrauen und den letzten Stand der Technik. Die Klinik galt als Institution, zugleich war sie auch als Reiche-Leute-Krankenhaus bekannt, was Hélènes Mann eher als Vorteil auffasste, da bekanntermaßen wohlhabende Menschen in besseren Krankenhäusern eine bessere Behandlung bekommen als arme in schlechten. Er hatte eine private Zusatzversicherung, die dafür aufkommen würde.
Clamart kannte er nicht. Auch war Clamart mit der Metro von ihrer Wohnung im 11. Arrondissement aus schlecht zu erreichen. Also verabredeten sie einen Termin mit dem Chefarzt der Fivète des amerikanischen Hospitals, einem Doktor Le Goff. Der bretonische Name schien Hélène ein gutes Omen, ihre Familie mütterlicherseits stammte aus der Bretagne, wo sie in ihrer Kindheit im Haus ihrer Großmutter unbeschwerte Ferien verbracht hatte.
Doktor Aimé Le Goff war ein schlanker, fast hagerer Fünfziger mit einer spitz zulaufenden Adlernase, sanften Augen hinter einer goldgerahmten Brille, gescheiteltem, glattem grauem Haar und einer ruhigen, leisen, aber festen Stimme.
An der weißen Wand hinter seinem aufgeräumten Schreibtisch hingen mehrere vergrößerte und gerahmte Fotos, die ihn sowie eine Frau und zwei Mädchen in gelbem Ölzeug an Bord einer schräg im Wind liegenden Yacht auf einem stahlgrauen Ozean zeigten.
Er hörte ihnen zu, und die Augen hinter der Goldrandbrille und die Mundwinkel lächelten in einer Mischung aus seinen Erfahrungen geschuldeter Ironie und verständnisvollem Mitgefühl. Sie fanden ihn sympathisch und vertrauenerweckend. Er sei, sagte Hélènes Mann nach dem Gespräch, die Art von Arzt, dem man sich bedingungslos anvertraute. Er trug einen weißen Arztkittel, nicht zugeknöpft, sodass darunter Hemd und Krawatte zu sehen waren.
Auch die Räume der Fivète, wie die reproduktionsmedizinische Station im vierten Stock (dem dritten vom Eingang im Hochparterre aus gerechnet) hieß, waren vertrauenerweckend, hell und freundlich eingerichtet. Die Wände waren in einem weißen Holzrahmenwerk gehalten, in dessen Zwischenräume hellgrauer, von feinen, diagonalen rosa Streifen durchzogener Teppich geklebt war. Dieselbe Farbkombination von Hellgrau und Rosa fand sich in den umlaufenden Friesen wieder, die den Deckenabschluss bildeten. Es gab viele Grünpflanzen, die meisten in große Bottiche gepflanzt, einige als Hydrokulturen. Die wartenden Paare waren junge, wenn auch nicht mehr ganz junge Menschen wie sie auch, gesund und gepflegt aussehend, manche unterhielten sich dezent, andere hielten einander still die Hand. Sie bildeten eine bunte Mischung quer über die Kontinente hin, es waren erstaunlich viele Nichteuropäer dabei. Die Sekretärin Le Goffs, die sich als Anne-Laure vorstellte, ein blaues Kostüm und eine Perlenhalskette trug, war freundlich und heiter und schien administrative Probleme nicht zu kennen. Das Ganze machte einen ebenso unbürokratischen wie zuversichtlich stimmenden Eindruck.
Dennoch waren sie zunächst erschlagen von der Menge an Informationen, der Komplexität der Abläufe und den unüberschaubar zahlreichen medizinischen Untersuchungen, die ihnen bevorstanden. Eines war ihnen bald klar, und Hélènes Mann sprach es aus: Der Rhythmus der bevorstehenden Besuche im amerikanischen Hospital war mit einer Vollzeitbeschäftigung Hélènes kaum zu vereinbaren.
Hélène war gelernte Innenarchitektin. Sie hatte ein BTS in Innenarchitektur an einer Pariser Schule erworben und ein CAP als Polstermöbelrestauratorin an der dem Versailler Schloss angegliederten Fachschule. Sie arbeitete in einem Möbelgeschäft im Faubourg Saint-Antoine, der alten Möbeltischlerstraße, hundert Meter von der Bastille gelegen, als Beraterin, was eine euphemistische Bezeichnung für Verkäuferin war.
Es brauchte keine langen Gespräche, um zu dem Schluss zu kommen, den ungeliebten Job zu kündigen. Die Krise hatte es lange schon unmöglich gemacht, als freie Innenarchitektin Aufträge zu bekommen, im Grunde genommen hatte Hélène in ihrem eigentlichen Beruf immer nur schwarz arbeiten können. Die Jobs (der derzeitige war der dritte) in Möbelgeschäften waren notwendig gewesen, solange Hélène alleine gelebt hatte, sie waren es jetzt finanziell nicht mehr, und letztendlich, zu dieser Überzeugung kamen sie rasch, würde Hélène von zu Hause aus mehr Gelegenheit haben, eine für sie befriedigende Arbeit tun zu können, fürs eigene Heim oder für Bekannte und dann später auch für Fremde, die durchs Hörensagen auf sie aufmerksam geworden wären.
Auch würden Hélènes ewige Überstunden ein Ende haben, es war in diesen Möbelgeschäften aufgrund schlechter Arbeitsorganisation und moralischen Gruppendrucks unmöglich, pünktlich Feierabend zu machen, und fast ebenso unmöglich, hinterher die obligatorische Aufforderung zum Pot auszuschlagen, dem Umtrunk nach der Arbeit, zu dem die Belegschaft sich geschlossen in eines der nahegelegenen Cafés verfügte, sodass Hélène kaum einen Abend einmal vor zwanzig Uhr zu Hause war.
Der Geschäftsführer des Möbelhauses, ein Herr Bensoussan, tat, als Hélène ihm ihre Absicht bekanntgab, was er in anderthalb Jahren nie getan hatte: Er bot ihr eine Gehaltserhöhung an, da er, wie er sagte, auf ihren Geschmack bei der Auswahl und Zusammenstellung von Stoffen, Farben und Mustern für Polstermöbel und Accessoires nicht verzichten könne.
Die verblüffte und auch geschmeichelte Hélène erbat sich einen Tag Bedenkzeit, aber am Abend rechnete ihr Mann mit ihr noch einmal durch, wie oft sie das Krankenhaus würde aufsuchen müssen und wie sehr während der Behandlung ein gewisses ruhiges Gleichmaß der Lebensführung gefordert war, und so kündigte sie zum Jahresende.
Die drei Monate nach dem ersten Besuch bei Le Goff waren mit Tätigkeit gefüllt: Sie mussten beide diversen Beratungen zuhören und medizinische Untersuchungen über sich ergehen lassen, Aids- und Hepatitis-Tests, Blutbilder, Hormonanalysen, Spermiogramm, Immunobead-Test, Hysterosalpingographie, mussten Fragebögen ausfüllen, das Dossier für die Privatversicherung zusammenstellen und zur Genehmigung einreichen und sich anhand mehrerer Broschüren und Bücher in die technischen und ethischen Aspekte der medizinisch assistierten Prokreation und ihrer Alternativen einlesen.
Ein obligatorischer Termin im amerikanischen Hospital brachte sie mit einer Psychologin zusammen, der sie erzählten, warum sie diesen Weg beschreiten wollten, anstatt entweder auf Kinder zu verzichten oder es mit einer Adoption zu versuchen, wovon allerdings selbst ihre Gesprächspartnerin ihnen aufgrund der administrativen Schwierigkeiten, um nicht zu sagen Schikanen abriet.
Im November des Jahres war es so weit, dass Hélène zum ersten Mal mit der Stimulation beginnen konnte. Nach einer Woche hatte sie einen Kontrolltermin in der Fivète, und das war genau der Tag, an dem sie, weil sie etwas zu früh gekommen war, unten im Empfangsbereich wartete und jener Mann vor ihren Augen zusammenbrach.
Das zweite Mal, dass sie ihm begegnete, war etwa vier Wochen später, Anfang Dezember. Es war der Tag der Follikelpunktion. Am Vormittag hatte Le Goff ihr unter leichter Sedierung das Ultraschallgerät mit der Hohlnadel eingeführt und die Follikel abgesaugt. Der Arzt hatte dafür plädiert, dass Hélène, obwohl es medizinisch nicht unabdinglich war, den Rest des Tages sowie die Nacht im Krankenhaus verbrachte, natürlich ohne zu strikter Bettruhe verpflichtet zu sein, aber doch mit der Auflage, sich zu schonen und sich möglichst wenig zu bewegen.
Ihr Mann war in der Gewissheit, sie in guten Händen zurückzulassen, zur Arbeit gefahren, und Hélène, die keine Lust hatte, alleine im Zimmer zu hocken - schließlich bin ich ja nicht krank, im Gegenteil, sagte sie der Stationsschwester -, saß in der hellen, weiträumigen und zur Hälfte mit leise plaudernden Menschen gefüllten Cafeteria des Krankenhauses vor dem modernen Anbau und blickte ab und zu von ihrem Buch auf, hinaus in den winterlich kahlen Garten.
Er war es, der sie entdeckte. Er hatte ebenfalls in einem Buch gelesen oder besser: geblättert, es immer wieder aufgeschlagen, es umgedreht vor sich hingelegt, um sich geblickt, es wieder aufgenommen, es wieder hingelegt. Schließlich geriet sie in den Fokus seines irrenden Blicks, lesend, konzentriert, in sich ruhend. Eine Tasse Kaffee stand vor ihr auf dem Tisch, daneben eine Schachtel Zigaretten, ein Plastikfeuerzeug darauf. Von Zeit zu Zeit rutschte ihr eine Haarspitze in den Mundwinkel, und sie nahm sie gedankenverloren zwischen die Lippen wie einen Grashalm.
Er schlug sein Buch zu, nahm es in die linke Hand, stand auf, ging zu ihrem Tisch hinüber und machte eine Verbeugung. Sie blickte auf, zwischen ihre erstaunt hochgezogenen Brauen grub sich eine kleine fragende Längsfalte. Er trug einen blauen, einreihigen Anzug, ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte. Das braune Haar war kurz geschnitten.
Entschuldigen Sie, sagte er im Stehen. Sie werden sich nicht erinnern. Sie haben mir -, er stockte. Sie waren sehr freundlich. Er blickte zu Boden. Sie haben sich um mich gekümmert, als ich -.
Aber natürlich! Jetzt lächelte sie im Wiedererkennen das Lächeln, das sie sich seinerzeit versagt hatte. Setzen Sie sich doch. Geht es Ihnen wieder gut?
1. Auflage
Copyright © 2010 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten Gesetzt aus der Meridien
eISBN : 978-3-641-04879-2
www.dva.de
Leseprobe
www.randomhouse.de