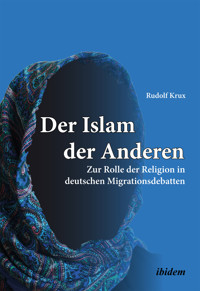
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Reine Glaubenssache, jenseits aller Politik? Für die meisten Deutschen bedeutet der Islam weit mehr als das. Vor allem weil die Religion als Teil einer ausländischen Kultur wahrgenommen wird, kann man Islam sagen und dabei vielmehr Außenpolitik, kulturelle Identität oder auch die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes meinen. Es entsteht eine Situation, die ein außergewöhnliches Maß an Missverständnissen provoziert und zugleich prägend für die gängigen Islambilder ist. Rudolf Krux bringt mit seinem vorliegenden Buch mehr Klarheit in die Debatten um den Islam, indem er eine der wichtigsten Bedingungen für den deutschen Islamdiskurs in den Blick nimmt, nämlich dessen Einbindung in den Migrationsdiskurs. Exemplarisch untersucht er diese in den Debatten zum seinerzeit hoch umstrittenen "Gesinnungstest" für Einbürgerungsgespräche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Für Fabi,
der hofft, dass auch sein schwedischer
Migrationshintergrund
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
„By tolerating any who enjoy the benefit of this indulgence, which at the same time they condemn as unlawful, he [the magistrate] only cherishes those who profess themselves obliged to disturb his government as soon as they shall be able.“[1]
John Locke schließt mit dieser Feststellung eine Gruppe von der von ihm geforderten Toleranz gegenüber anderen Religionen grundsätzlich aus. Angehörige der katholischen Kirche können, so der Wegbereiter des Liberalismus, keiner anderen Herrschaft hörig sein als der des Papstes. Sie stellen damit aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit generell eine politische Bedrohung dar. Die Verweigerung der Toleranz impliziert zwar eine Beschreibung der religiösen Gruppe (über Papsthörigkeit), erfolgt aber aufgrund eines politischen Kriteriums, nämlich der angenommenen Illoyalität ebendieser Gruppe.[2]
Auch heute wird Religion wieder zunehmend zum Anknüpfungspunkt einer letztlich politischen Unverträglichkeit genommen. Illustrieren lässt sich diese Feststellung für die Bundesrepublik z.B. an den (Bundes-) Verfassungsschutzberichten, die neben „Rechtsextremismus“ und „Linksextremismus“ mittlerweile auch „Islamismus/ Islamistischer Terrorismus“ als eigenständigen Gliederungspunkt aufführen und damit nicht mehr, wie noch bis 2004, unter „Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern“ abhandeln.[3]
Als Paradebeispiel für eine solche Fokussierung auf Religion kann der 2006 in Baden-Württemberg eingeführte Gesprächsleitfaden für Einbürgerungsgespräche betrachtet werden. In Zusammenhang mit der Einführung dieses Verfahrens ist vielfach eine besondere Unverträglichkeit einer als islamisch gekennzeichneten Gruppe mit der deutschen Verfassung behauptet worden. Zugleich wurde das Verfahren als diskriminierend gegenüber Muslim_innen[4]kritisiert.[5]
Dabei war die Zielgruppe des Verfahrens noch mehr als über Religionszugehörigkeit über das Kriterium der Staatsangehörigkeit definiert. Wer am Einbürgerungsverfahren teilnimmt ist (rechtlich gesehen) nicht deutsch, sondern will das gerade werden. Es geht also auch um eine Personengruppe mit Migrationserfahrung oder zumindest Migrationshintergrund – eine Definition, die etwa ein Fünftel der deutschen Gesamtbevölkerung (mit oder ohne Staatsangehörigkeit) einbezieht.[6]Entscheidend für die Debatten um den Leitfaden sind also sowohl ein Diskurs zum Islam als auch einer zu Migration.
Auch umgekehrt sind die Regelungen zur Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit von Bedeutung für den bundesdeutschen Migrationsdiskurs. So hat die Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 eine breite Debatte über die gesellschaftliche Integration der Eingewanderten ausgelöst. Diese haben infolge der Reform unter bestimmten Bedingungen (wie Aufenthaltsdauer, Straffreiheit, Familienstatus etc.) prinzipiell Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft.[7]
Neben der rechtlichen Lage verändern sich auch die Einstellungen der deutschen Bevölkerung zur Einbürgerung im Zeitraum um das Jahr 2000 erheblich. Kriterien wie die Geburt in Deutschland oder eine deutsche Abstammung werden für die Einbürgerung als zunehmend unwichtiger empfunden. Als deutlich relevanter dagegen gelten nun etwa Sprachkenntnisse, Anpassung an den Lebensstil oder auch das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung (fdGO).[8]
Rechtlich, diskursiv im Sinne der Integrationsdebatte und in der öffentlichen Meinung werden Kriterien der Abstammung durch Kriterien der Anpassung ersetzt. Bereits im Folgejahr der Reform verändern die Anschläge des 11. September 2001 den bundesdeutschen Migrationsdiskurs noch einmal erheblich. In der Bundespolitik wird über Zuwanderung zunehmend mit Blick auf Sicherheitsaspekte in Bezug auf islamistischen Terror diskutiert und der Islam wird zum entscheidenden Kriterium der Integrationsdebatte.[9]Die Verknüpfungen der Themen Islam und Integration vervielfachen sich im politischen, aber auch im medialen Diskurs.[10]Die Einbindung des Islam in den Migrationsdiskurs erscheint somit als ein relativ neues Phänomen.
Dagegen konstatiert die Religionswissenschaftlerin Tiesler für die akademische Debatte in Europa einen geradezu schlagartigen Perspektivenwechsel bereits für die neunziger Jahre. Der Islam, der im Blick auf Europa zuvor keine nennenswerte Rolle zu spielen schien, wurde nun breit thematisiert und dabei rückblickend von „Islamic Revival“, „Islamic Resurgence“ oder „Re-Islamisierung“ gesprochen. Zur gleichen Zeit verfestigt sich laut Tiesler die Vorstellung eines modernen aufgeklärten Westens, der in dichotomen Gegensatz zur vormodernen islamischen Welt steht. Auch in den medialen Öffentlichkeiten wird dieser Gegenpart zu den westlichen Gesellschaften demnach insbesondere in den immigrierten Muslim_innen personifiziert.[11]
In Anbetracht dieses kurzen Abrisses erscheint es naheliegend, dass die Miteinbeziehung der religiösen Kategorie Islam das Sprechen über Zuwanderung und Zugewanderte negativ zu färben vermag. Einen ganz anderen Schluss legt dagegen die ArbeitFeindbild Islam?der Religionswissenschaftlerin Petra Klug nah, welche im Folgenden noch näher thematisiert wird. Sie stellt in den Bundestagsdebatten eine negative Färbung des Islambildes gerade dort fest, wo er mit Migration assoziiert wird.[12]Womöglich kommt es in der Kopplung von Islam- und Migrationsdiskurs auch zu einer ganz eigenen, folgenschweren Konstellation, die letztlich beide Diskurse beeinflusst. Eine diskursive Kopplung zwischen Ethnizität, Kultur und letztlich Religion, wie sie hier im Besonderen passiert, stellt gleichsam ein Problem für die Analyse des Islamdiskurses dar. So beklagt Klug in ihrer Zusammenfassung des Forschungsstandes zum Islambild der Deutschen – neben einem Mangel an differenzierter empirischer Forschung – als grundsätzliches Problem in der Debatte:
„Sowohl bei der Propagierung eines 'Kampfes der Kulturen' als auch bei der Untersuchung eben solcher Diskurse hat sich die Verschränkung von Migration und Religion als zentrales Element herausgestellt. Zum einen ruft diese Kopplung das […] Dilemma in der politischen Diskussion hervor, indem sie den Blick auf die Motive der Kritik verstellt, und zum anderen reproduziert sie den ethnisierenden Kulturbegriff noch in seiner Verwerfung, indem Kultur und Religion aneinander gebunden bleiben.“[13]
Ebendiese problematische Konstellation soll mit der Konzentration auf den Islamdiskurs innerhalb des Diskurses über Migration zum Ausgangspunkt dieser Analysen gemacht werden. Ziel ist es, dem aktuelleren Islamdiskurs – im bundesdeutschen Kontext und primär auf der Ebene der Politik – innerhalb seiner spezifischen Einbettung in den Migrationsdiskurs nachzuspüren. Die Leitfrage lautet damit:Wiewird in Deutschland über Islam im Kontext eines Diskurses über Migration gesprochen? Oder noch etwas plakativer: Wie nehmen wir eine Religion wahr, die uns als Religion von Zugewanderten erscheint?
Methode
1Einordnung des Ansatzes und Forschungsinteresse
Die Religionswissenschaft hat im Laufe und in Konsequenz ihrer Geschichte davon Abstand genommen, an der Produktion eines abschließend definierten Religionsbegriffs mitwirken zu wollen. Stattdessen geht sie davon aus, dass die jeweils historisch aktuellen Begriffe von Religion sich nur in ihren spezifischen ideologischen und kulturellen Rahmen nachvollziehen lassen. Zu den wichtigsten Konsequenzen dieses Perspektivenwechsels gehören die „Diskursivierung des Gegenstandes“ sowie das Interesse an zentralen gesellschaftlichen Fragestellungen, die über den Religionsbegriff au
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























