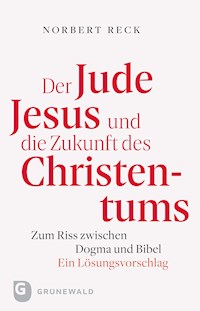
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthias Grünewald Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Während auf der Südhalbkugel die Zahl der Christen zunimmt, verlieren die Kirchen im Norden zu Hunderttausenden ihre Mitglieder. Norbert Reck geht davon aus, dass die Ursachen tiefer liegen, als verschiedene Reformversuche greifen. Seit der Aufklärung herrscht ein tiefer Riss zwischen kirchlicher Lehre (Dogma) und kritischer Beschäftigung mit der Bibel (Exegese), der zum tiefsitzenden Verlust an Glaubwürdigkeit des Christentums geführt hat. Dabei haben sowohl die liberale Bibelkritik als auch der dogmatische Antimodernismus das Jude-Sein Jesu entweder unsichtbar gemacht oder Jesus gar als Überwinder des Judentums gepriesen. Norbert Reck schlägt vor, wie die Entdeckung des Juden Jesus zu einer neuen Zukunft des Christentums führen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Reck
Der Jude Jesus und die Zukunft des Christentums
Zum Riss zwischen Dogma und Bibel
Ein Lösungsvorschlag
Matthias Grünewald Verlag
Inhalt
Widmung
Vorwort
1. Skizze einer Krise
2. Alles ist Geschichte
3. Ein Riss
4. Auf der Suche nach Bedeutung
5. Nur Diskurse. Nur?
6. Die Diskurse der Narrative
Der Gott des Exodus
Opfer
Messias
Der Gang über den See
7. Nicht aufhören zu erzählen
Zitierte und erwähnte Literatur
Über den Autor
Über das Buch
Bildnachweis
Impressum
Hinweise des Verlags
WIDMUNG
Gewidmet ist dieses Buch
dem Andenken meines Lehrers im Alten Testament,
Manfred Görg (1938–2012).
Seinem kritischen Blick
hätte ich es gerne ausgesetzt.
Vorwort
Der vorliegende Essay geht der Frage nach, warum der christliche Glaube in Westeuropa sich immer schwerer erzählen lässt und warum immer mehr Menschen dem Christentum den Rücken kehren. Ich vertrete darin die These, dass diese Krise nicht in der mangelnden Selbstdarstellung des Christentums wurzelt, sondern in der Theologie: in ihrem Zurückschrecken vor der jüdischen Identität Jesu seit dem Beginn der Moderne – mit weitreichenden Konsequenzen.
Wie die Dinge meiner Ansicht nach zusammenhängen, werde ich auf den folgenden Seiten Schritt für Schritt zeigen: von der Frage der Autonomie der Menschen in der Moderne (Kapitel 1) zu den Veränderungen seit der Zeit der Aufklärung (Kapitel 2), von ihren Auswirkungen auf die Theologie (Kapitel 3) bis zum Problem der christlichen Judenfeindschaft (Kapitel 4).
Helfen kann in dieser Situation das theologisch noch weithin unaufgearbeitete Denken von Michel Foucault, das die kritischen Impulse der Aufklärung aufgreift, aber weit über deren Grenzen und Schieflagen hinausgeht (Kapitel 5). Wie mithilfe von Foucaults Diskursanalyse biblische Texte und Grundbegriffe neu zum Sprechen gebracht werden können, versuche ich im Anschluss zu zeigen (Kapitel 6). Und zuletzt komme ich zurück auf die Ausgangsfrage nach der verlorenen Erzählbarkeit des christlichen Glaubens (Kapitel 7).
Statt einer weit ausgreifenden Untersuchung habe ich lieber einen Essay geschrieben, um meine These ohne große Umschweife auf den Punkt zu bringen und nicht in einer Vielzahl von Belegen zu vergraben. Die Darstellung beschränkt sich deshalb auf wenige sprechende Beispiele, »Probebohrungen« in verschiedenen Schichten der christlichen Geschichte. Die Versuchung war zwar immer wieder groß, noch weiteres interessantes und aufschlussreiches Material aufzunehmen, aber ich habe mich bemüht, ihr zu widerstehen und die Literatur auf ein Minimum zu beschränken.
Das Buch hat eindeutig eine katholische Schlagseite – aus dem einfachen Grund, dass sie meine Seite ist, die ich entsprechend besser kenne. Trotzdem habe ich nach Kräften auch Beispiele aus dem Protestantismus herangezogen, wo bekanntlich die Probleme nicht geringer sind.
Weiterdenken – zumal kritisches – ist ausdrücklich erwünscht. Ich bin nicht daran interessiert, Applaus zu ernten, sondern daran, dass die angesprochenen Probleme klar gesehen und diskutiert werden. Dazu will dieser Essay eine Anregung sein.
Vielen Freundinnen und Freunden, geschätzten Kollegen und Kolleginnen, verehrten Lehrern habe ich zu danken für Ermutigung und Kritik, beharrliches Nachfragen, was denn mit meinem Buch nun sei, für kritische Durchsicht einzelner Kapitel, Hinweise auf Literatur und intensive Diskussionen. Weil ich der Meinung bin, für meine Überlegungen selbst einstehen zu sollen, werde ich sie nicht namentlich aufzählen. Allzu leicht könnte der Eindruck entstehen, ich wollte mich mit ihren Namen schmücken und mit ihrer fachlichen Autorität dem Buch zusätzliches Gewicht geben. Das erschiene mir unpassend. Meine Dankbarkeit für ihre Unterstützung ist darum nicht geringer.
Kapitel 1
Skizze einer Krise
Zum Erstkommunionsunterricht bekamen wir vom Pfarrer ein Heft mit Bildern zum Ausmalen, mit kleinen Erzählungen über Jesus, über Brot und Wein sowie mit Lückentexten, in die wir die entscheidenden Begriffe eintragen sollten. Ich mochte das Heft; es war bunt und freundlich. Auf einer der ersten Seiten stand groß geschrieben »Zum Kommunionsunterricht kommen wir …«, und darunter waren drei Zeichnungen sowie jeweils ein Wort, das den angefangenen Satz zu Ende führte. Das erste Bildchen war ein Abreißkalender, und daneben stand »… regelmäßig«, das zweite zeigte eine Uhr (»pünktlich«), und als drittes war da ein lachendes Jungengesicht (»gerne«).
Ich sah mir diese Seite oft an, während der Pfarrer redete, und dachte verträumt über den Zusammenhang zwischen den Bildern und Wörtern nach. Den dritten Punkt fand ich am merkwürdigsten. Ich fragte mich, ob so ein breit lachendes Gesicht eine gute Illustration für »gerne« war, und fand es ein bisschen übertrieben. Und noch etwas stimmte nicht: Es schien mir zwar in Ordnung, dass man zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht und zum pünktlichen Erscheinen aufgefordert werden konnte. Aber ob ich gern oder ungern kam, war in meinen Augen nichts, was man mir vorschreiben konnte.
Es empörte mich nicht; ich nahm es einfach zur Kenntnis. Aber ich spürte, dass hier ein Bereich berührt wurde, der der Kontrolle durch andere entzogen war. Ich spürte einen Funken von Autonomie. Vielleicht sind mir deshalb meine Gefühle aus dieser Zeit so stark in Erinnerung geblieben.
Offenbar dachte die Religionspädagogik damals noch, dass man mit solchen Bildern und Worten auf Kinder einwirken könne. Es war die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil; ich erinnere mich daran als eine helle Zeit. In mein Gedächtnis kommen Bilder von Frühlingssonne und den weißen Kommunionkleidern der Mädchen, vom Rasen vor der Kirche, wo wir uns manchmal hinsetzten und unserem jungen, munteren Pfarrer zuhörten. Die Gemeinde war eine Neugründung; die Liturgiereform des Konzils galt in ihr von Anfang an. Aufbruchsstimmung lag in der Luft. Sonntags war die Kirche immer voll. Hinter den Bänken standen regelmäßig einige Spätergekommene, die keinen Sitzplatz mehr fanden. Der Pfarrer predigte vor Hunderten von Menschen, leidenschaftlich, eindringlich.
Wenn ich heute in meinen Heimatort komme, höre ich von meinen Tanten, die dort immer noch zur Kirche gehen, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher auf ein Grüppchen von zwanzig bis dreißig Leuten zusammengeschrumpft ist. Erstkommunionfeiern und Firmungen finden nur noch statt, wenn genügend Kinder zusammenkommen, damit der Aufwand sich lohnt.
Als ich später Theologie studierte, war es noch einmal ähnlich. Die Vorlesungen fanden zwar nicht in vollen, aber doch immer noch gut gefüllten Hörsälen statt. Heute treffen sich die wenigen Studenten in Seminarräumen, sitzen mit ihren Dozenten an einem Tischkreis. Priesteramtskandidaten gibt es nur wenige. Es lohnt sich nicht, jedes Jahr eine Priesterweihe anzusetzen.
Wie dramatisch sich die Lage verändert hat, ist sicher allen bewusst, die noch Kontakt zur Kirche haben. Im Jahr 2017 gehörten noch 58,3 Prozent der deutschen Bevölkerung einer christlichen Kirche an. Und von ihnen nimmt nur ein kleiner Teil aktiv am Gemeindeleben teil. In den meisten anderen westeuropäischen Ländern sieht es ähnlich aus.
Ganz anders ist es auf der Südhalbkugel der Erde. Dort wächst das Christentum und verändert sich dabei stark. Es ist – wie Felix Wilfred, einer der führenden Theologen Asiens, erzählt – jünger, pluralistischer, aufgeschlossener für die spirituellen Wege der Einzelnen, mehr am Hier und Jetzt interessiert als am Ewigen. Es hat eher Bewegungscharakter, tritt weniger als festgefügte Institution in Erscheinung. Wichtig sind nicht so sehr die Vorgaben des Katechismus, sondern die Erfahrungsaspekte des Glaubens und das dringende Anliegen, »das Christentum zu einer Praxis zu machen – zu einer Praxis des Gottesreichs« (6).
Auf der Nordhalbkugel herrscht in den betroffenen Gebieten dagegen zunehmend Ratlosigkeit angesichts des Massenexodus aus den Kirchen. Die großen Narrative von Europa als dem Kontinent der Christenheit sind zerbrochen wie die Christenheit selbst; das Ersatz-Narrativ von der »kleinen Herde«, die treu an der unverfälscht überlieferten Lehre festhält, ist kein Trost für diejenigen, die in den Kirchengemeinden mit dem alltäglichen Schwund zurechtkommen müssen.
Natürlich gibt es allerorten Debatten darüber, wie mit Priestermangel, versiegenden Finanzströmen und dem wachsenden Desinteresse am Christentum produktiv umgegangen werden kann, mit welchen Strategien der Mangel zu verwalten ist und mit welchen Botschaften, mit welchem Erscheinungsbild wieder mehr Menschen angesprochen werden könnten. Vieles wurde inzwischen versucht, auch Sinnvolles auf den Weg gebracht, aber letztlich konnte nichts davon die Situation grundlegend ändern.
Der liberale Reflex – Popmusik im Gottesdienst, jugendlichere Sprache, Lockerung der Regeln, Versuche der Annäherung an den Zeitgeschmack – hat ebenso wenig bewirkt wie der konservative Reflex: die entschiedene Rückkehr zu den klassischen kirchlichen Traditionen und Theologien. Was einmal abgestorben ist, kann nicht wiederbelebt werden. So wie man heute keine gotischen Kathedralen mehr bauen kann, kann man auch die – durchaus ehrfurchtgebietenden – theologischen Systeme des Hochmittelalters oder der Reformationszeit nicht einfach als Theologie für unsere Zeit restaurieren. Zudem findet sich im Christentum früherer Zeiten nicht nur Glanz und Herrlichkeit, sondern auch allzu viel Autoritäres, Judenfeindliches, Fetischistisches, als dass man sich wirklich dorthin zurücksehnen könnte.
Auch die Hoffnung auf eine »Trendumkehr«, nach der alles wieder »wie früher« werden könnte, oder die Erwartung, dass ein unbeeindruckt-tapferes »Weitermachen wie bisher« irgendwann mit neuer kirchlicher Stabilität belohnt würde, dürfte kaum realistisch sein. Denn der Mitgliederschwund, der massenhafte Auszug aus den verfassten Kirchen, ist kein oberflächlicher, momentaner Trend, sondern eine Tiefenströmung mit jahrhundertealten Wurzeln, die viel mit dem zu tun hat, wie wir selbst uns heute sehen, wie wir arbeiten, wie wir leben, welche Ziele wir haben.
Das Denken der Aufklärung, das Verblassen der Angst vor der Hölle, die Industrialisierung, Landflucht und Verstädterung, der Wandel von Groß- zu Kleinfamilien, die Flexibilisierung in der Arbeitswelt, die Etablierung von Demokratien, die Möglichkeit, das eigene Leben individuell entwerfen zu können – all das sind Stichworte, die andeuten, dass sich das Rad dieser Entwicklung nicht mehr zurückdrehen lässt. Man mag diese Veränderungen begrüßen oder beklagen, aber man wird mit ihnen leben müssen. Auch Sportvereine, Gewerkschaften oder Parteien müssen damit klarkommen, dass die Leute sich kaum noch auf feste Mitgliedschaften einlassen.
Andere sehen die Wurzel des Problems darin, dass viele heute kaum noch wissen, worum es im christlichen Glauben eigentlich geht. Deshalb setzen sie auf »Neuevangelisierung« und Bildungsarbeit, halten Glaubenskurse und schreiben Bücher. Auf dem Buchmarkt erscheinen in immer schnellerer Folge Darstellungen der christlichen Glaubensinhalte und kirchlichen Lehren, Reflexionen über die Bedeutung des Glaubens in der »heutigen Zeit«. Sie bieten »Argumente für die Torheit vom gekreuzigten Gott«, wollen erläutern, »Was wir glauben«, sprechen »Vom Sinn und Nutzen kirchlicher Lehre«, liefern »Grundwissen Christentum«, damit Interessierte »Den christlichen Glauben verstehen«. Und immer so weiter.
Die Autoren und Autorinnen dieser Werke haben verstanden, dass die Kommunikation zwischen dem Christentum und »der Welt« gestört ist; sie versuchen deshalb, in die Bresche zu springen und neue Zugänge anzubieten. Liegt aber die Ursache der Probleme tatsächlich im mangelnden Wissen? Oder ist nicht auch das eher ein Symptom? Nachgefragt werden diese Bücher und Kurse jedenfalls hauptsächlich von denen, die sich noch als kirchlich verstehen und gerne mehr wissen möchten – nicht aber von den Glaubensfernen. Auf die Absetzbewegung vom Christentum jedenfalls bleiben auch diese Bemühungen – so wertvoll sie für sich genommen sein mögen – ohne messbaren Effekt.
Indessen gibt es noch einen anderen Aspekt. Gelegentlich treffe ich mit Pastoralassistentinnen, Pfarrern, Religionslehrerinnen und Hauptamtlichen in der katholischen Bildungsarbeit zusammen, die sich auf Tagungen darüber austauschen, wie sie weiterhin eine Botschaft verkündigen können, die viele Menschen nicht mehr zu brauchen scheinen. Sie stellen fest, dass selbst viele treue Gemeindechristen mit dem traditionellen christlichen Vatergott nichts mehr anfangen können, dass ihnen Jesus als »Sohn Gottes« fremd ist und die sogenannte »Gottesfrage« keine Frage mehr ist, die diese Menschen tatsächlich haben. Angesichts dessen fällt es diesen kirchlichen Mitarbeitern und Bildungsverantwortlichen immer schwerer, die traditionelle Theologie den Menschen als Antwort auf ihre Fragen anzudienen. Sie fühlen sich zerrissen zwischen der Treue zur christlichen Tradition und der Treue zu den Menschen. Und es fällt ihnen oft selbst schwer, das zu glauben, was sie meinen, vertreten zu müssen.
Mir scheint, dass die Erfahrungen dieser engagierten Kirchenmitarbeiter den Nerv der Situation sehr viel genauer treffen als die Reformer aller Richtungen. Es geht nicht um eine bessere Verpackung – es geht um den Inhalt. Es geht nicht darum, hier und da etwas am kirchlichen Marketing zu verbessern, sondern um etwas Radikaleres, vor dem bislang noch viele zurückschrecken: nämlich zu fragen, ob die christliche Theologie noch »stimmt«, ob sie unter den veränderten Bedingungen unserer Zeit noch die richtigen Antworten auf die Fragen der Menschen hat – und zwar nicht im Sinne einer geschmeidigeren Anpassung an den Zeitgeschmack.
Um nicht missverstanden zu werden: Damit will ich keineswegs andeuten, dass die Botschaft des Jesus von Nazaret nicht mehr stimmt, nicht mehr in unsere Zeit passt. Ich denke sogar, dass das Gegenteil der Fall ist. Die radikale Frage betrifft vielmehr das, was aus dieser Botschaft im Rahmen des kirchlichen Lehrgebäudes geworden ist – also in unseren Interpretationen, in der Verkündigung, in der Theologie. Gibt die Theologie diese Botschaft noch treffend und lebensnah wieder?
Felix Wilfred denkt ebenfalls, dass die Krise der Kirche viel mit ihrer Theologie zu tun hat. Von Indien aus beobachtet er die Veränderungen des Christentums im Süden wie im Norden und meint, dass die »fruchtlosen und selbstverliebten Theologien des Nordens« (16) für die Krise des europäischen Christentums mitverantwortlich sind. Mit ihren anspruchsvollen Richtigkeiten tragen sie beständig zu einer »intellektualisierenden Bekenntnisidentität des Christentums« (6) bei, anstatt ein Christsein zu entwerfen, das nicht in erster Linie korrektes Denken ist, sondern ein Weg, in dieser Welt lebendig und solidarisch zu leben.
Dem will ich in den folgenden Kapiteln nachgehen und brauche dafür einen etwas weiter gesteckten historischen Rahmen: Was wurde aus der christlichen Theologie seit der Aufklärung? Wie hat sie sich verändert inmitten der Veränderungen des Denkens und der Lebensverhältnisse in Europa? Wie steht es um ihre Fähigkeit, die realen Sorgen ihrer Zeit zum Thema zu machen? Mir scheint, wir brauchen einen Blick auf die gesamte Moderne, wenn wir erkennen wollen, was in der Geschichte zu den heutigen Schwierigkeiten beigetragen hat, und wenn wir herausbekommen wollen, wie unsere »fruchtlose« Theologie wieder fruchtbar werden kann.
Das Paradigma, in dem sich die hier verhandelten Fragen ebenso wie unsere Zeit insgesamt bewegen, ist das der Transformation. Zwar beklagen sich viele Christinnen und Christen in Europa über den Stillstand in den Kirchen, doch tatsächlich befinden wir uns seit Längerem schon in einem tiefgreifenden Prozess der Veränderung. Kaum etwas, was heute das Bild des Christentums ausmacht, war vor hundert Jahren in den Kirchen bereits üblich, und kaum etwas davon wird am Ende dieses Jahrhunderts noch existieren. Manche denken dabei an Verfall und Niedergang, aber es ist durchaus möglich, darauf mit Hoffnung zu blicken. In jeder Transformation steckt beides.
Als ich nach einem Bild für diese Prozesse suchte, dachte ich daran, dass man die Kirche – zugegebenermaßen etwas naturalistisch – mit einer Raupe vergleichen könnte: Diese Raupe, imposant, schillernd und in bestimmtem Licht sehr schön, hat sich über viele Jahrhunderte bestens von dem ernährt, was die Menschen ihr als »Zehnt« abzugeben hatten. Im 19. Jahrhundert erschienen die Veränderungen der Umwelt so bedrohlich, dass die Raupe sich verpuppte, um sich zu schützen. Wie tot, unveränderlich, starr überdauerte die Puppe lange Zeit. Seit den 1960er-Jahren – genauer: seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil – bekommt der Kokon Risse (drinnen rumorte es schon länger). Viel ist noch nicht zu sehen, der Panzer ist noch nicht gesprengt. Es braucht Zeit. Wie der Schmetterling einmal aussehen wird, wenn er seine Flügel ausbreitet, um loszufliegen, ist noch nicht erkennbar. Die Kräfte der Beharrung, die die Kirche in der alten, ausgetrockneten Hülle zurückhalten möchten, sind weiterhin stark. Auch die Angst vorm Fliegen ist noch immer groß. Und es ist durchaus möglich, dass das neue, transformierte Christentum in seinem alten Panzer steckenbleibt und verendet, bevor es sich daraus befreien kann.
Auch Felix Wilfred sieht das Christentum in einem bedeutenden Prozess der Transformation. Für ihn stehen dabei ebenfalls hoffnungsvolle Aspekte im Vordergrund. So sieht er in den vielen Hundertausenden von Kirchenaustritten in Europa nicht unbedingt ein Zeichen des Verfalls, sondern hält es für möglich, dass sie bereits den Keim einer anderen Zukunft in sich tragen: »Was beispielsweise wie eine Abwanderung aus den Kirchen aussieht, könnte in Wirklichkeit eine Suche nach neuen Kirchen sein, die erst noch entstehen müssen und deren Beschaffenheit sich schwer voraussagen lässt« (17).
In jeder Transformation steckt beides: Ende und Neubeginn. Um das zu erkennen, muss man sehen lernen wie Felix Wilfred: Er erblickt in einem Kirchenaustritt nicht bloß einen Abfall vom rechten Glauben, sondern auch – möglicherweise – die Suche nach etwas Neuem, das besser zu den Betreffenden passt und ihnen ermöglicht, mehr mit sich selbst übereinzustimmen.
Um so sehen zu können und die Chancen, die in dieser Sichtweise liegen, zu entdecken, ist es allerdings unabdingbar, den persönlichen Entscheidungen der Menschen mit echtem Respekt zu begegnen. Es braucht ein Gespür für jenen Bereich in den Menschen, der absolut unverfügbar und jeder Kontrolle durch andere entzogen ist. Die Kirche hat sich oft über diesen Bereich hinweggesetzt, im Vertrauen darauf, das Wohlverhalten der Menschen auch ohne deren freie Zustimmung erzwingen zu können. Heute ist das nicht mehr möglich, denn die Kirche verfügt nicht mehr über die entsprechenden Machtmittel und wird sie auch nicht mehr wiedergewinnen.
Das war ja mein Erlebnis als Kommunionkind: dass man mich vielleicht zur Anwesenheit im Unterricht anhalten, dass aber keine Macht der Welt mich dazu bringen könne, »gerne« dabei zu sein. Ob ich etwas gerne tat oder nicht, war allein meine Sache. Zumindest in dieser Hinsicht war ich frei. Und ich denke, diese Erfahrung machen – mehr oder weniger deutlich – alle Menschen in der Moderne.
Ob das Christentum eine Zukunft hat, wird, so scheint mir, entscheidend davon abhängen, ob die Kirchen und christlichen Bewegungen begreifen, dass diese punktuelle Autonomie der Menschen nicht nur unhintergehbar, sondern vor allem auch etwas über alle Maßen Schätzenswertes ist – der Ort des Glaubens selbst. Wenn sie es nicht begreifen, werden sich die Menschen in der Zukunft anderen Gemeinschaften und Projekten zuwenden.
Kapitel 2
Alles ist Geschichte
Die Entdeckung der Autonomie der Einzelnen, die – wie begrenzt sie auch immer sein mag – übergangen, aber nicht beseitigt werden kann, die Entdeckung, sich des eigenen Verstandes bedienen zu können und sich von niemandem vorschreiben lassen zu müssen, was man zu denken und zu empfinden hat – all das gehörte zum innersten Kern der Aufklärung, zum großen Aufbruch des westlichen Selbstbewusstseins im 18. Jahrhundert.
Die Vernunft war dabei zwar bedeutsam, aber nicht unbedingt das wichtigste Stichwort. Die meisten Aufklärer hielten vom Rationalismus so wenig wie vom Irrationalismus. Sie sahen den Philosophen der Aufklärung vielmehr als Kritiker, als jemanden, »der Vorurteile, Überlieferung, generellen Konsens, Autorität, kurz: alles mit Füßen tritt, was die meisten Geister versklavt, der es wagt, selbst zu denken«, wie es in der berühmten Encyclopédie von Diderot und d’Alembert heißt. Darin drückte sich –noch lange vor der Französischen Revolution von 1789 – ein bürgerlicher Stolz aus, der sich allmählich auch auf das gesellschaftliche Klima vor allem in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und den USA auswirkte: Was nur autoritär verordnet, aber nicht mit Argumenten begründet wurde, fand keine bereitwillige Zustimmung mehr, sondern traf auf Skepsis.
Viele andere Themen hingen mit dieser Autoritätskritik zusammen und gruppierten sich darum herum: das Vertrauen auf Erfahrung und Experiment, die Abkehr von Magie und Wunderglauben, zunehmende Diesseitigkeit und Zweifel an der Totenauferstehung, die Überzeugung, dass sich alles entwickelt hatte und nicht einfach fertig vom Himmel fiel und also eine klar benennbare Ursache haben musste. (Und auch diese Punkte haben ihre eigenen Ursachen und Anfänge, etwa in den naturwissenschaftlichen Denkformen seit der Renaissance oder in dem aus England kommenden Deismus, der kein direktes Eingreifen Gottes in die Welt mehr für denkbar hielt.) Es fällt leicht, sich auszumalen, wie groß die Herausforderung für die Kirchen gewesen sein muss.
Besonders wichtig wurde das Stichwort der Geschichte. In der Aufklärung wurde es gewissermaßen neu formatiert: als säkulares Konzept, fern von allen heilsgeschichtlichen Anklängen. In dieser Form veränderte es nach und nach das gesamte westliche Denken.
Am Anfang stand Voltaire: Nach dem verheerenden Erdbeben, das 1755 die Stadt Lissabon fast völlig zerstörte und Zehntausende von Todesopfern forderte, protestierte der französische Aufklärer gegen die traditionellen Darstellungen der Geschichte, die noch fraglos davon ausgingen, dass alles in der Welt – auch Naturkatastrophen, Verfolgung, Krieg und Vergewaltigungen– im Grunde von Gott gewollt sei. Voltaire hielt es für empörend, das Weltgeschehen als Manifestation der göttlichen Vorsehung zu betrachten oder die Welt sogar, wie Leibniz, zur besten aller möglichen Welten zu erklären. In seiner Novelle Candide ließ Voltaire seinen Protagonisten in den Wirren nach dem Lissaboner Erdbeben seufzen: »Wenn dies die beste aller möglichen Welten ist, wie müssen erst die anderen sein!« (30).
Für Voltaire gab es keine überzeugende Antwort, wie man die Existenz Gottes, an die er anfangs noch glaubte, mit der Existenz des Leidens in Einklang bringen konnte – er ließ die Frage offen. Die Menschen hatten in seinen Augen nicht die Aufgabe, sich auf die Ewigkeit auszurichten, sondern die Welt zu einem Ort zu machen, an dem man gut leben konnte: »Il faut cultiver notre jardin« sind die abschließenden Worte Candides am Ende des Buchs: »Wir haben in unserem Garten zu arbeiten« (١٥٨). In seinerPhilosophie de l’Histoire (»Geschichtsphilosophie« – von ihm stammt dieser Ausdruck) hielt sich Voltaire dementsprechend konsequent an empirisch fassbare Geschichtsdaten und Ursachenzusammenhänge. (Seine Hoffnung auf eine »natürliche Religion« schien ihm zuletzt ebenso wenig haltbar wie das Christentum, das er ohnehin ablehnte. Voltaire, schreibt Roy Porter, »starb vermutlich als Atheist« [47].)
So wurde Voltaire zum Wegbereiter einer neuen, ganz und gar »weltlichen« Betrachtung der Geschichte – ohne jeden religiösen Überbau. Hinzu kam das Ursache-Wirkungs-Denken der Naturwissenschaften, das sich allmählich ins gesellschaftliche und geschichtliche Denken einfügte: Alles hatte eine »innerweltliche« Ursache, alles hatte eine Geschichte. Für die Theologie wurde das vor allem im Werk von Hermann Samuel Reimarus (1694–1768) sichtbar.
Reimarus, Professor für die Sprachen des Orients in Hamburg, hätte nach dem Wunsch seiner Eltern eigentlich ein angesehener lutherischer Pastor werden sollen, sah sich aber umso weniger dazu in der Lage, je mehr er seine philologischen und theologischen Studien miteinander und mit der Philosophie der frühen Aufklärung konfrontierte. Vieles am christlichen Glauben erschien ihm anstößig, unvernünftig, moralisch inakzeptabel; der Deismus überzeugte ihn mehr. Dennoch betrieb er über dreißig Jahre lang – bis zu seinem Lebensende – in seiner freien Zeit kritische Bibelstudien. Sein Ziel war es, denjenigen etwas an die Hand zu geben, die sich nicht mehr von den kirchlichen Glaubensvorgaben gängeln lassen wollten. Er hielt seine Aufzeichnungen aber unter Verschluss und bestimmte, dass sie nicht veröffentlicht werden dürften, »bevor sich die Zeiten mehr aufklären« (Apologie, 41).
Als Gotthold Ephraim Lessing in seiner Eigenschaft als Bibliothekar der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel in den 1770er-Jahren erstmals einige »Fragmente« aus Vorstufen von Reimarus’ Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes anonym veröffentlichte, rief er einen immensen Sturm der Entrüstung, aber auch viel Begeisterung hervor. Der sogenannte »Fragmentenstreit« wurde zur bedeutendsten theologischen Kontroverse im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Allein von 1777 bis 1780 entstanden mehr als fünfzig Gegenschriften. Und auch in den folgenden Jahrzehnten wurden immer wieder Auseinandersetzungen mit Reimarus veröffentlicht.
Was war so aufregend an seinen Studien? Ich erwähne nur zwei Aspekte, die in unserem Zusammenhang bedeutsam sind.
Vor allem – das ist der erste Aspekt – hatte Reimarus die Bibel mit »geschichtlichem Blick« gelesen. Das war neu und in der Tat bahnbrechend. So stellte er etwa fest, dass diejenigen, die nach der Hinrichtung des Jesus von Nazaret die christliche Gemeinde aufbauten, anderes vertraten als Jesus selbst, weswegen seine Botschaft nicht mit der der Apostel »vermischt« werden dürfe:
[…] ich finde große Ursache, dasjenige, was die Apostel in ihren eignen Schriften vorbringen, von dem, was Jesus in seinem Leben wirklich selbst ausgesprochen und gelehret hat, gänzlich abzusondern. Denn die Apostel sind selbst Lehrer gewesen, und tragen also das ihrige vor, haben auch nimmer behauptet, daß Jesus ihr Meister selbst in seinem Leben alles dasjenige gesagt und gelehret, was sie schreiben.
(Von dem Zwecke Jesu, 7 f)
Erstmals unterschied hier ein Bibelkenner verschiedene Zeitschichten mit unterschiedlichen Tendenzen in den biblischen Texten. Und darüber hinaus tat er es so, dass seine Leser und Leserinnen die Beobachtungen leicht selbst nachvollziehen konnten, wenn sie ihre Bibel zur Hand nahmen. Sie konnten feststellen, dass die Behauptung, die Bibel sei insgesamt das unveränderliche, eine, heilige Wort Gottes, zumindest auf der Ebene der Textoberfläche einfach nicht stimmte: Es ließen sich in den biblischen Büchern deutlich unterscheidbare und zum Teil einander widersprechende Auffassungen ausmachen; man konnte auch nachverfolgen, wie sich bestimmte Aussagen weiterentwickelt hatten, und es war zu erkennen, dass man den Texten Gewalt antäte, wollte man sie auf eine einheitliche Botschaft festlegen.
Was Jesus betraf, führte dies zu der Frage, was dieser denn von allem, was die Kirchen über ihn sagten, wirklich vertreten hatte. Für Reimarus war »wirklich«, was geschichtlich zuverlässig festzuhalten war. Er ging davon aus, dass die Evangelien, die von der Zeit Jesu erzählten, die unmittelbarsten Zeugnisse sein mussten, während die »Schriften der Apostel« bereits eine sekundäre, von anderen Interessen geleitete, quasi schon »kirchliche« Erweiterung darstellten:
Dagegen führen sich die vier Evangelisten blos als Geschichtschreiber auf, welche das hauptsächlichste, was Jesus sowol geredet als gethan, zur Nachricht aufgezeichnet haben. Wenn wir nun wissen wollen, was eigentlich Jesu Lehre gewesen, was er gesagt und geprediget habe, so ist das res facti, so frägt sichs nach etwas das geschehen ist; und daher ist dieses aus den Nachrichten der Geschichtschreiber zu holen. Da nun dieser Geschichtschreiber gar viere sind, und sie alle in der Haupt-Summe der Lehre Jesu übereinstimmen: so ist weder an der Aufrichtigkeit ihrer Nachrichten zu zweifeln, noch auch zu glauben, daß sie einen wichtigen Punkt oder wesentlich Stück der Lehre Jesu sollten verschwiegen oder vergessen haben.
(Von dem Zwecke Jesu, 8)
Hier müssen wir uns nicht damit aufhalten, dass Reimarus die Evangelisten noch umstandslos als Geschichtsschreiber (und nicht als Prediger oder Theologen) ansah – auch etliche andere seiner Hypothesen sind inzwischen offenkundig überholt. Der springende Punkt für unsere Überlegungen ist vielmehr, dass für Reimarus der Blick auf die geschichtlichen Fakten maßgeblich wurde.
Waren die Theologen in den Jahrzehnten vor Reimarus zuallermeist davon ausgegangen, dass alles, wovon die Bibel erzählt, geschichtliche Wahrheit sei, so befragte Reimarus nun die Texte anhand eines rein weltlichen Geschichtsverständnisses, wie es vor ihm schon Voltaire skizziert hatte. Er wollte wissen, ob die in der Bibel berichteten Geschehnisse historisch und logisch überhaupt denkbar seien, ob die Fakten stimmen konnten.
So rechnete er bei der Geschichte vom Durchzug der Israeliten durchs Rote Meer nach, wie groß das Volk während der Sklaverei in Ägypten geworden sein musste, und fragte süffisant, ob ein Exodus so vieler Menschen überhaupt möglich gewesen sein konnte. Und bei der Verkündigung der Auferstehung Jesu spekulierte er darüber, warum die Jünger erst an Pfingsten, fünfzig Tage nach der Kreuzigung, damit an die Öffentlichkeit gegangen seien. Hatten sie vielleicht doch den Leichnam Jesu beiseitegeschafft und gewartet, bis er nicht mehr identifizierbar war? So suchte Reimarus nach der Wirklichkeit hinter den Erzählungen.
Dass die Texte andere Absichten gehabt haben könnten, war ihm (und seiner Zeit) fern. Er nahm die »fünfzig Tage« zwischen Ostern und Pfingsten als Faktum, das sein kritischer Geist nicht – wie so vieles andere – infrage stellte. Dass die Zeitspanne zwischen den beiden christlichen Hochfesten genau der Spanne zwischen den jüdischen Festen Pessach und Schawuot entsprach und die neutestamentliche Darstellung offenbar eine christliche Interpretation dieser Feste sein wollte, entging seiner Faktenfixierung.
Reimarus zielte mitten ins Herz des christlichen Selbstverständnisses, wenn er fragte, »ob Jesus würklich nach seinem Tode auferstanden, und gen Himmel gefahren sey«, »ob die Facta wirklich geschehen, ob die Umstände dabei so beschaffen gewesen, wie erzählet wird, ob es auch natürlich, oder durch Kunstgriffe und Betrügerey, zugegangen, oder ob es so von ohngefähr zusammen getroffen« (Fragmente, 137). Was sich nicht geschichtlich und vernünftig plausibel erklären ließ, musste Lüge oder Fantasterei sein.
So zu fragen – es dachten und fragten ja immer mehr Menschen so – hat tiefe Spuren in unserem Denken hinterlassen. »Wirklich« ist dem allgemeinen Bewusstsein bis in unsere Tage vor allem das, was historisch belegbar ist. Wann fand der Exodus der Israeliten aus Ägypten statt? Auf welcher Route zogen sie durchs Rote Meer? Auf welchem Berg erhielt Mose von Gott die Tafeln mit den Zehn Geboten? Wo ging Jesus über den See Gennesaret? Wo war sein Grab? War es wirklich leer? »Wirklich« ist auch heute das zentrale Schlüsselwort. Fragen nach anderen Aspekten – etwa nach dem, was Menschen bezeugen, oder danach, was eine Metapher oder eine Legende ausdrücken will – stehen im Rang wesentlich tiefer, wenn sie überhaupt ernst genommen werden.





























