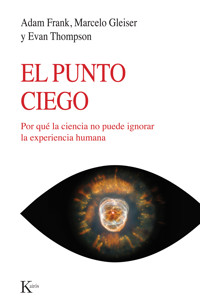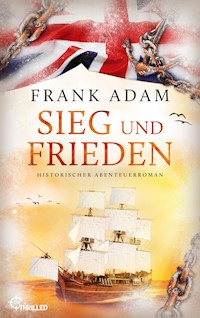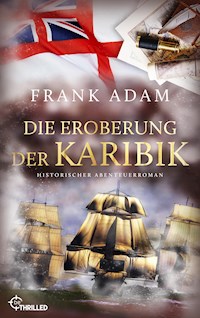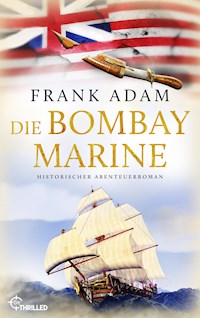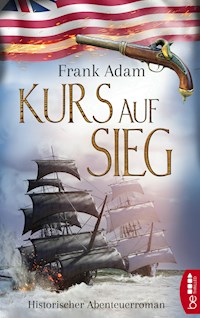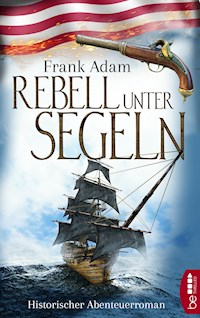6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Seefahrer-Abenteuer von David Winter
- Sprache: Deutsch
Rau und hart ist das Leben an Bord der Segelkriegsschiffe Seiner Majestät des Königs von England. Das bekommt auch der zwölfjährige David Winter zu spüren, als er 1774 in die Royal Navy eintritt. Sein Weg vom Captain’s Servant zum Midshipman auf einer Fregatte birgt tödliche Gefahren - im Sturm, im Kampf gegen Piraten und Rebellen oder auf der Jagd nach Schmugglern. Doch während die Breitseiten donnern und Befehle des Kommandanten übers Deck schallen, bleibt David standhaft und hält seinen Kurs ...
David Winters Abenteuer sind ein Spiegelbild seiner Zeit, des rauen Lebens in der Royal Navy, aber auch romantischer Gefühle, des heldenhaften Mutes und der Kameradschaft auf See. Vom Eintritt in die Royal Navy über die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges bis in die napoleonischen Kriege verfolgen wir David Winters Aufstieg vom Seekadetten bis zum Admiral.
Aufregende Abenteuer auf See, eingebettet in die faszinierende Geschichte der Marine.
Für alle Fans von C.S. Forester, Alexander Kent, Patrick O’Brian und Richard Woodman. Weitere Bücher von Frank Adam bei beTHRILLED: die Sven-Larsson-Reihe.
eBooks von beTHRILLED - spannungsgeladene Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Einleitung
Hinweise für den marinehistorisch interessierten Leser
Ankunft in England
Von London nach Portsmouth
Die letzten Wochen der Kindheit
Bitte an Bord kommen zu dürfen
Konvoi nach Gibraltar
Vor der afrikanischen Küste
Im Kampf gegen die Piraten
Die Befreiung der Gefangenen
Contredanse und Überfall
Sturmfahrt zur Neuen Welt
Rebellen und Königstreue
Die Blockade von Chesapeake und Delaware
Kurs auf Saint Augustine
Patrouillenfahrt in der Karibik
Der weite Weg zum Lake Champlain
Die Schlacht bei Valcour Island
Abenteuer in New York
Glossar
Über den Autor
Alle Titel des Autors bei beTHRILLED
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Über dieses Buch
Rau und hart ist das Leben an Bord der Segelkriegsschiffe Seiner Majestät des Königs von England. Das bekommt auch der zwölfjährige David Winter zu spüren, als er 1774 in die Royal Navy eintritt. Sein Weg vom Captain’s Servant zum Midshipman auf einer Fregatte birgt tödliche Gefahren – im Sturm, im Kampf gegen Piraten und Rebellen oder auf der Jagd nach Schmugglern. Doch während die Breitseiten donnern und Befehle des Kommandanten übers Deck schallen, bleibt David standhaft und hält seinen Kurs ...
Frank Adam
Der junge Seewolf
Historischer Abenteuerroman
Einleitung
Tagebücher haben oft ein seltsames Schicksal. Der bekannte Historiker und Soziologe C. Northcote Parkinson beschreibt, wie die Aufzeichnungen des britischen Leutnants Samuel Walters aus den Jahren 1805 – 1810 bei dem Abbruch alter Holzhäuser 1918 in New Orleans von einem farbigen Arbeiter gefunden wurden. Schiffszeichnungen in dem alten Heft weckten sein Interesse.
Sein Sohn, Butler eines Managers, wusste, dass sein Arbeitgeber mit einem englischen Seeoffizier befreundet war, und so wanderte das Heft in die Hände des Engländers, der nach seiner Pensionierung schließlich 1947 in Professor Parkinson den Mann fand, der die Erinnerungen des Samuel Walters fast anderthalb Jahrhunderte nach ihrer Niederschrift herausgab. (C. N. Parkinson (Hrsg.): Samuel Walters, Lieutenant, R. N. Liverpool: University Press 1949)
So weite und verschlungene Wege haben die Aufzeichnungen nicht zurückgelegt, die mir eines Tages angeboten wurden. Es waren Tagebücher und unregelmäßige Aufzeichnungen eines David Winter, der 1831 betagt auf seinem Landgut in der Nähe von Bremerhaven starb.
Wie das heute so ist, wurde das Gutshaus zum Landhaus reicher Städter umgebaut, das Ackerland bis auf einen kleinen Rest verkauft. Bei dieser Renovierung war hinter einer schwer zugänglichen Ecke des Speichers eine alte Kiste im Wege, die ein Teleskop, eine verrottete Uniformjacke und – eingehüllt in Ölpapier – einige steif eingebundene Hefte enthielt.
Dass sie an mich gelangten, mag an meinem bekannten marinehistorischen Interesse gelegen haben. Wer sie mir verkaufte, will ich lieber nicht preisgeben, denn ob die Eigentumsfrage überhaupt zu klären ist, erscheint mir fraglich, aber ich habe Zweifel, ob der Verkäufer sein Recht beweisen könnte. Wie dem auch sei: Meine Neugier siegte über Skrupel, und die Aufzeichnungen haben mich nicht enttäuscht.
Sir David Winter, Ritter des Bath-Ordens, hat eine faszinierende Laufbahn in der großen Zeit der englischen Flotte von 1774 bis 1819 erlebt und ist erst um 1824 in seine alte Heimat zurückgekehrt. Das Schicksal hatte ihn in etwa fünfzig Jahren voller Kämpfe und Abenteuer in fast alle Meere dieser Welt verschlagen. Was er mit wachen Sinnen, gesundem Menschenverstand und mitfühlendem Herzen erlebt hatte, erschien mir mitteilenswert.
Doch die Aufzeichnungen in der trockenen seemännischen ›Kurzsprache‹ dieser Zeit hätten nur den Marinehistoriker interessiert. So habe ich begonnen, die Erlebnisse des David Winter aus Stade auf meine Art nachzuerzählen. Viele historische Details, die Sir David nur andeutete, konnte ich aus zeitgenössischen Quellen ergänzen. Hier habe ich mich um größtmögliche Exaktheit bemüht, zum einen, weil die Erlebnisse dieses Mannes unter Wert verschleudert würden, reduzierte man sie auf Spannung und Action, zum anderen aber auch, weil der historisch interessierte Leser meinen eigenen Wünschen entspricht.
Spannende Erlebnisse brauchte ich nicht zu erfinden, denn die Zeit bot mehr an, als in Romanen unterzubringen sind. Aber in Handlungen und Charakteren der Personen habe ich mir jene Freiheiten genommen, die dem Erzähler zustehen.
Auf Fachausdrücke aus der Welt der Segelkriegsschiffe und dem Leben dieser Zeit konnte nicht ganz verzichtet werden. Ein Glossar am Ende des Buches kann das Verständnis erleichtern. Im Anschluss an die Einleitung findet der interessierte Leser auch Hinweise auf historische Literatur, falls er sich intensiver mit dieser Zeit beschäftigen möchte.
Ich hoffe, dass ich dem Leser etwas von dem Staunen und der Spannung vermitteln kann, die sich bei mir einstellten, als sich meine Fantasie durch die Aufzeichnungen des David Winter fesseln und anregen ließ.
Frank Adam
Hinweise für den marinehistorisch interessierten Leser
Wer sich über die geschichtlichen Hintergründe, die Schiffe dieser Zeit, das Leben der Besatzungen, die Waffen und vieles andere mehr orientieren will, kann das am einfachsten in dem Taschenbuch:
Adam, F.: Hornblower, Bolitho und Co.-Krieg unter Segeln in Roman und Geschichte. Frankfurt: Ullstein 1992
Ausführlicher und reichhaltiger illustriert ist das neue Standardwerk:
Lavery, B.: Nelson's Navy. The Ships, Men and Organisation 1793 – 1815. London: Conway 1989
Über die Seemannschaft dieser Zeit orientiert am besten:
Harland, J.: Seamanship in the Age of Sail. London: Conway 1984
Viele Informationen kann man auch alten nautischen Wörterbüchern entnehmen. Ich habe mich bei der Übersetzung nautischer Begriffe meist an folgendem Werk orientiert:
Bobrik, E.: Allgemeines nautisches Wörterbuch mit Sacherklärungen. Leipzig: Hoffmann 2. Aufl. 1858
Über das Leben in dieser Zeit berichten anschaulich viele Biografien. London und das Treiben der englischen Gesellschaft werden lebendig in:
Lichtenberg in England. Herausgegeben und erläutert von H. L. Gumbert. Wiesbaden: Harassowitz 1977
Von den Biografien der Seeleute habe ich besonders herangezogen:
Childers, Sp. (Hrsg.): A Mariner of England. London: Conway Nachdruck 1970
Choyce, J.: The Log of a Jack Tar. Maidstone: Mann Nachdruck 1973
Parkinson, C. N. (Hrsg.): Samuel Walters. Liverpool: University Press 1949
Parsons, G. S.: Nelsonian Reminiscences. Maidstone: Mann Nachdruck 1973
Ankunft in England
»Herr Kapitän! Herr Kapitän!«, klang näher kommend die helle Stimme vom mittleren Niedergang* her, begleitet vom Stapfen eiliger Schritte. »Herr Kapitän!«, schallte es lauter jetzt, und ein Jungenkopf tauchte aus der Luke auf. »Wir sind ja schon auf dem Fluss«, stieß der junge Bursche hastig und mit allen Anzeichen der Enttäuschung hervor.
Auf dem Achterdeck wandte sich eine hagere, graubärtige Gestalt im dunkelblauen Tuchmantel um. »Man sacht', jung' Heer! Du hast noch nix verpasst. Die Sonne ist gerade heraus. Vorher war es so diesig, dass wir alle Not hatten, unseren Weg zu finden. Steuerbord querab«, wies sein ausgestreckter Arm, »kannst du jetzt Tilbury Fort erkennen.« Der Kapitän legte seine Hand auf die Schulter des Jungen und führte ihn an die Backbordseite: »Und dort liegt Gravesend, auch nicht größer als Stade, wo du herstammst.«
Der Junge starrte mit seinen graubraunen Augen auf das kleine Nest am Themseufer, als wollte er Ähnlichkeiten mit seinem Heimatstädtchen beschwören. Aber die flache Hafenstadt bot ihm wenig Anhaltspunkte.
»Wann sind wir denn in London?«, wandte er sich dem Kapitän zu. »Das dauert noch manche Stunde, Herr Ungeduld«, erwiderte der Kapitän lächelnd. »Wir sind ja noch etwa fünfunddreißig Meilen vom Pool, also vom Hafen entfernt. Der Wind steht günstig, aber ich möchte nicht wetten, dass er sich hält. In zwei Stunden wird die Flut uns schieben. Wenn alles gut geht, sollten wir am Kai liegen, bevor sie kentert. Aber wenn du es eiliger hast, musst du auf den Kutter umsteigen, der aus Gravesend ausgelaufen ist. Er segelt schneller als wir und fährt im Liniendienst nach Billingsgate, ganz in der Nähe, wo wir auch anlegen.« Der Alte unterbrach sich: »Segg 'moal, hast du denn schon gefrühstückt?«
Der Junge schüttelte den Kopf.
»Dann aber runter zum Smutje und ordentlich eingefahren, ehe du wieder an Deck kommst, und eine warme Jacke solltest du auch anziehen.«
Der Protest folgte sofort: »Aber es ist doch so viel zu sehen, überall segeln Schiffe, sogar größere als unsres.«
»Nichts da«, brummte der Kapitän, »Schiffe wirst du bald mehr sehen als in deinem ganzen Leben zusammen, und was soll ich deinem Onkel sagen, wenn er dich abholt, und du kannst vor Hunger kaum stehen?«
Der Junge guckte prüfend an dem Graubart hoch, ob er es wirklich ernst meinte oder ob man ihn umstimmen konnte. Aber dann gab er auf und wandte sich mit einem »Jawohl, Herr Kapitän!«, zum Niedergang.
»Kannst dich schon an England gewöhnen!«, rief ihm der Kapitän nach: »Dort sagen sie: Aye, aye, Sir!«
Der Rudergänger deutete ein Grinsen an, das mit seinen Zahnstummeln eher erschrecken konnte: »Hei is 'n betten hitzig, disse junge Heer, wa Käpt'n?«
»Tja, wei woin mit twelf woll 'n ganz Deel ruhiger, aber hei is von Vadder her 'n Stadtmensch un 'n halben Studierter, dat mach woll wehn. – Pass up up dien Rudder, Döskopp!«, unterbrach er sich, »or wullt du uns up de Sandbank setten?«
Wieder auf dem richtigen Kurs glitt die Brigg Aurora mit vollen Segeln vor dem leichten Wind dahin. Sie fuhr im Postdienst zwischen Hamburg und London und führte auch immer Ladung mit, kein Massengut, aber kleineres, wertvolleres Stückgut, das eben schnell wie die Post eintreffen sollte. Und sie hatte auch fast immer Passagiere.
Auf dieser Fahrt waren es einige Woll- und Holzhändler, ein Finanzrat aus Hannover, der im Ministerium über Abgaben an George III., König von Britannien und Kurfürst von Hannover – neben allen anderen Titeln –, verhandeln sollte, ein Professor der Universität Göttingen mit seiner Frau und der junge Heißsporn.
Seine Eltern hatten ihn dem Kapitän für die Überfahrt besonders ans Herz gelegt. In London sollte ihn sein Onkel abholen, Stadtrat und Schiffsausrüster aus Portsmouth. Der Junge hieß David Winter, war der Sohn eines Arztes aus Stade und einer gebürtigen Engländerin, deren Schwester den Stadtrat aus Portsmouth geheiratet hatte.
David, einziger Sohn seiner Eltern, sollte ein halbes Jahr bei den englischen Verwandten leben, da sein Vater zu Vorträgen an die Universitäten in Prag und München eingeladen war und dort seinerseits neue Methoden bei der Heilung von Knochenbrüchen studieren wollte.
Davids Vater, Absolvent der medizinischen Fakultäten in Edinburgh und Göttingen, wollte diese für ihn so ehrenvolle Reise nicht ohne seine Frau antreten, und so war für David der Aufenthalt bei Onkel und Tante, Vetter und Base arrangiert worden, ein Abenteuer allzumal, aber er würde es sicherlich gut haben, Erfahrungen sammeln und seine englischen Sprachkenntnisse verbessern, wie sich seine anfangs doch recht besorgte Mutter getröstet hatte.
David wirkte auch nicht so, als ob ihn jeder Windhauch umblasen würde. Für sein Alter mittelgroß, war er gewandt und kräftig, hatte eine schnelle Auffassungsgabe und drückte mitunter seine Meinung etwas sehr direkt aus, was ihm nicht nur Freunde einbrachte.
Eben war seine helle Stimme schon wieder vom Niedergang her zu hören. Vor ihm tauchten jedoch der Professor und seine Frau auf und wurden vom Kapitän freundlich und respektvoll begrüßt.
»Wir haben Purfleet, ein kleines Fischerdorf, Steuerbord querab, Frau Professor, und laufen in den nördlichen Themsebogen ein«, erklärte der Kapitän. »Halfway Reach liegt Steuerbord voraus.«
»Sehr einladend bietet sich uns England aber nicht gerade dar«, sagte die Angesprochene gleichermaßen zu ihrem Mann und dem Kapitän. »Die Ufer sehen so eintönig aus. Wenn nicht die weißen und braunen Segel, die Möwen und Reiher den Fluss belebten, könnte man direkt melancholisch werden.«
»Das ist meist Marsch- und Sumpfland«, ließ sich von hinten der Bass des dicken Lübecker Wollhändlers vernehmen. »Das wird auch kaum besser bis London. Und von der Stadt ist über die Hälfte auch nicht des Hinsehens wert, wenn Sie mich fragen. Dreckige Gaunerviertel allzu meist.«
Andere Passagiere, eben hinzugetreten, widersprachen, und im Nu war eine lebhafte Unterhaltung über die Vor- und Nachteile dieser Riesenstadt im Gange.
»Herr Kapitän!«, übertönte alle wieder Davids helle Stimme. »Sehen Sie doch nur, da vorn die vielen Segel und ganz vorn, das sind ja Riesenschiffe.«
Alle schauten voraus, und einige beugten sich über die Reling, um besser zu sehen.
»Das sind die Schiffe, die mit Beginn der Ebbe aus dem Londoner Hafen ausgelaufen sind. Vorn sind zwei Ostindiensegler, die haben ihre 1200 bis 1300 Tonnen«, informierte der Kapitän und ließ sich das Fernrohr geben. »Hab' ich's mir doch gedacht! Voraus segelt die Northington, ein feines Schiff. Ich kenne ihren Kapitän aus der Zeit, als wir beide Maate waren. Er ist jetzt etwa sechs Monate unterwegs bis Bombay und sieht England frühestens in zwölf Monaten wieder, wenn überhaupt.«
Als einige fragten, was einen dazu bringen könne, so gefährliche und lange Reisen zu unternehmen, wies der Kapitän auf den Reiz der Fremde und vor allem auch auf die verführerischen Gewinnaussichten hin.
»Mein Freund kriegt nicht nur sein gutes Gehalt. Er ist auch nebenbei Kaufmann. Bis zu fünfundzwanzig Tonnen Frachtraum auf der Ausreise und fünfzehn Tonnen auf der Heimreise können Offiziere und Mannschaften der Ostindischen Gesellschaft an eigenen Waren frei transportieren und auf eigene Rechnung verkaufen. Und der Kapitän hat seinen guten Anteil. Manche haben ihr Vermögen gemacht und sind selbst Schiffseigner geworden.«
Erstauntes Gemurmel war zu hören. Vielleicht sah der eine oder andere Händler ein wenig neidischer zu den majestätischen Großseglern als zuvor.
Aber David sagte unberührt von Profitaussichten: »Ich würde gern mitsegeln. Es soll am anderen Ende der Welt ganz wunderbare Dinge zu sehen geben.«
»Ja, vor allem tolle Weiber«, brummelte der Rudergänger in sich hinein.
Der Wind stand jetzt querab, und die auslaufenden Schiffe hatten Mühe, gegen die Flut anzukreuzen. Sie würden spätestens in der Fiddler's Road, dem breiteren Flussabschnitt bei Greenhite, ankern und besseren Wind und die Ebbe abwarten, erklärte der Kapitän.
Hier und da wies er noch auf einige Schiffe hin: Kohlefrachter aus Newcastle, die eine oder andere Schnau aus der Ostsee, mehrere Themsebarken.
Viele liefen heute nicht aus, sagte er, die meisten würden wohl auf besseren Wind warten.
Der Professor wandte ein: »Mehr Schiffe können doch hier gar nicht fahren. Man müsste ja dauernd fürchten, gerammt zu werden.«
»Warten Sie nur ab, was sich im Pool drängt, Herr Professor. Da wissen auch alte Fahrensleute oft nicht mehr, wie sie durchschippern können.«
Inzwischen war das Königliche Hospital in Greenwich in Sicht. Der Professor bewunderte die klassische Weitläufigkeit des Gebäudes, und der Kapitän steuerte einige Bemerkungen über die Fürsorge für kranke und invalide Seeleute bei, von der andere Fürsten und Herren sich eine Scheibe abschneiden könnten.
Dann schlug er vor, die Passagiere möchten noch einen kleinen Imbiss nehmen und dann besser vom Vorschiff – »aber nicht in der Nähe der Ankermannschaft!« – das Einlaufen in den Hafen beobachten. Das Achterdeck brauche er dann ausschließlich zur Führung des Schilfes.
Davids fragenden, bittenden Blick beantwortete er nur mit einem Kopfschütteln und einer Handbewegung in Richtung des Niederganges. Dann wandte er seine ganze Aufmerksamkeit dem Strom, der Takelage und dem Ruder zu.
Lange hatte der Imbiss nicht gedauert. Die Passagiere, die London noch nicht oder lange nicht angelaufen hatten, kamen bald wieder an Deck. Andere, die die Route häufiger befuhren, ließen sich mehr Zeit. David war unter den ersten und sah noch die Königliche Werft von Deptford achteraus entschwinden. Zu seiner Enttäuschung lagen nur einige Fregatten und Sloops abgetakelt in der Werft. Kein Kriegsschiff setzte Segel.
Die Brigg folgte jetzt einer scharfen Flusskurve nach links, und als David den Blick nach vorn richtete, lag London vor ihm. Die Mittagssonne an diesem Märztag des Jahres 1774 schien wieder durch langsam südostwärts ziehende Wolken.
David legte die Hand über die Augen und starrte wortlos auf das Unvorstellbare. Der Fluss schien unter einer Fülle von kleinen und großen Schiffen zu verschwinden. Einige lagen am Ufer vertäut, andere ankerten im Fluss und Boote schwirrten zwischen ihnen in allen Richtungen umher.
In der Flussmitte drängelte sich gerade der Kutter aus Gravesend durch das Gewimmel. Am rechten Ufer begann ein unübersehbares Häusergewirr. Kleine, elende Katen waren es zumeist, aber weiter vorn erahnte man mehr, als man es sah: die dunkle Masse des Towers und die großen Steinbauten.
Nach Backbord hin, auf der südlichen Flussseite, standen nur hier und dort kleine Hütten, die sich erst in Höhe des Towers zu einer Siedlung verdichteten. Zum ersten Male nach dem Abschied von seinen Eltern wurde David ein wenig bange vor dem Neuen, das vor ihm lag.
Das also war London, Hauptstadt eines maritimen Weltreiches. Niemand wusste, wie viele Einwohner es jetzt hatte, siebenhundert- oder schon achthunderttausend? Für die einen war die Stadt Mittelpunkt des Handels und des kultivierten Lebens. Für die anderen war sie ein Sündenbabel mit ihren riesigen Elendsvierteln an den Peripherien, mit ihrem Dreck, ihren Dieben, Hehlern, Prostituierten, der unvorstellbaren Armut und den ständigen Seuchen.
Aber jene, die in den schönen Steinhäusern wohnten, in prachtvollen Bankgebäuden ihren Geschäften nachgingen, in sauberen, soliden Läden einkauften und in exklusiven Klubs speisten, sahen die anderen ja kaum durch die Fenster der Kutschen im Vorbeifahren, rochen den Mief nur durch den Filter des parfümierten Ziertuches. Eigentlich waren es zwei Städte, räumlich miteinander verwoben, aber im Leben durch Welten getrennt.
David erwachte langsam aus seiner Erstarrung. Vor Erregung stotternd wandte er sich dem Bootsmann zu, der die Aufsicht auf dem Vorschiff hatte. »Was ist denn jetzt hier los, Herr Jansen! Das sind doch Tausende von Schiffen, warum sind die gerade heute alle hergekommen?«
Lorenz Jansen, ein großer, strohblonder Friese, etwa fünfundzwanzig Jahre alt, lachte. »Aber, junger Herr, das ist der Pool, der Londoner Hafen. So sieht das hier immer aus. Der Hafen ist zu klein für die Schiffe aus aller Welt, die hier Ladung löschen und Passagiere anlanden wollen. Er bietet Anlegeplätze für rund sechshundert See- und Küstenschiffe. Da oft die doppelte oder gar dreifache Zahl laden oder löschen will, ankern die meisten im Fluss. Die vielen breiten und flachen Boote, die hin- und herrudern, das sind Leichter, die Ladung von den Schiffen im Fluss ans Ufer bringen oder umgekehrt.«
»Oft genug lassen sie die Ladung aber auch verschwinden«, mischte sich der Lübecker Wollhändler ein. »Viele Schiffe werden nachts überfallen und geplündert. Und mancher Passagier, der sich einem Boot anvertraute, erwachte ohne Börse und Kleidung in einer Abflussrinne am Ufer, wenn er überhaupt wieder aufwachte. In den Drecksläden von Southwark kann man jede Diebesbeute kaufen, die man nur will. Man kann sogar Diebstähle bestellen, wahrscheinlich auch Mord, wenn man nur genug Geld hat.«
»Sie mögen recht haben, mein Herr«, antwortete der Bootsmann. »Die Postboote haben ja ihren festen Ankerplatz bei Billingsgate, aber der Kapitän lässt keinen Passagier mit einem Träger von Bord, der nicht von einem bekannten Hotel kommt. Nachts müssen wir doppelte Wache mit Belegnägeln gehen, und an der Landseite patrouilliert ein Wächter mit einer großen Dogge.«
»Jagen Sie dem Jungen doch keine Angst ein«, erwiderte ein Holzhändler aus Surrey. »Er wird doch abgeholt.«
»Sieh lieber an Steuerbord dort den Turm mit seinen Mauern, das ist der Tower! Und dort weit voraus die große Kuppel ist St. Paul's, eine der größten Kirchen der Welt. Und dort die Brücke, das ist die London-Bridge, fest aus Steinen gebaut. Von dort aus zieht sich der Pool immer weiter stromabwärts.«
Nur noch langsam schob sich die Aurora durch das Gewimmel. Die Großsegel waren eingeholt, um die Fahrt zu vermindern. An Steuerbord glitt Katharinenkai vorbei, die dunkle Wolke vom Entladen der Kohlefrachter hatte die Umgebung eingefärbt. Das drohende Gemäuer des Tower war zum Greifen nahe.
Kommandos hallten über das Deck. Matrosen liefen mit Leinen, Stangen und Fendern herum. Dann steuerte die Brigg den Kai in der Nähe des Zollhauses an. Einige Seeleute holten die oberen Segel ein, andere warfen Leinen zum Kai. Festmacher zogen die Brigg an ihren Platz und belegten die Leinen an Ringen und Pollern.
Eine Gangway wurde zur Treppe an der Kaimauer geschoben, und ein mittelgroßer, rundlicher Mann mit navyblauem Jackett und Goldknöpfen betrat sie. »Der Beamte der Hafenmeisterei«, erklärte der Bootsmann den Umstehenden. »Er prüft die Papiere, kassiert die Gebühr und gibt das Schiff frei.«
Der Kapitän begrüßte den Ankömmling und führte ihn unter Deck in seine Kajüte. Als sie nach einer Viertelstunde wieder an Deck auftauchten, war das Rundgesicht des Hafenbeamten noch etwas rosiger, und er schien guter Laune.
»Mehr als zehn Schiffe kann der bei den Begrüßungsschnäpsen gar nicht am Tag abfertigen«, murmelte der Bootsmann vor sich hin.
In diesem Moment rumpelte eine Kutsche auf den Kai. Ein breitschultriger Mann mit rötlichem Haar, etwa vierzig Jahre alt, sorgfältig nach der Mode, aber konservativ gekleidet, stieg behände aus und ging mit energischen Schritten auf die Gangway zu.
»Ist es erlaubt, an Bord zu kommen, Sir?«, fragte er den Bootsmann.
»Selbstverständlich, mein Herr, ich führe Sie zum Kapitän.«
»Sir«, wandte sich der Fremde an den Kapitän, »ich bin William Daniel Barwell, Ratsherr aus Portsmouth. Ich möchte meinen Neffen David Winter abholen.«
Der Kapitän streckte seine Hand aus. »Guten Tag, mein Herr! Ich freue mich, dass alles so zeitgerecht geklappt hat. Ihr Neffe war ein angenehmer, munterer Reisegefährte.« Er wandte sich um: »David, komm her, dein Onkel ist da!«
David, der die Szene beobachtet hatte, trat zögernd näher. Wieder begann für ihn eine neue Etappe, und die bekannten Reisegefährten blieben zurück. Würde er es wieder gut treffen?
Eine energische und doch freundliche Stimme schnitt seine Gedanken ab: »Du bist also David, mein Neffe! Willkommen in England, mein Junge. Ich hoffe, du wirst dich bei uns wohlfühlen.«
Von London nach Portsmouth
Steif aufgerichtet, den Kopf zur Seite gewandt, den Augen vor Starren kaum einen Lidschlag erlaubend, saß David in der Kutsche, die über das Kopfsteinpflaster westwärts rollte. Die Welt um ihn herum schien in einen Tumult auszubrechen.
Kutscher brüllten sich an, um sich den Weg zu bahnen. Hafenarbeiter fluchten, wenn sie ihre Karren zur Seite rollen mussten. Fischweiber boten kreischend ihre Ware feil. Äpfelfrauen balancierten ihre Körbe auf der Schulter und riefen die Preise aus. Bäckerjungen priesen Pasteten an. Es schien nichts zu geben, für das man nicht schreiend Käufer suchte. Und die Räder der Wagen polterten und quietschten.
Nicht minder verwirrend waren die Attacken auf Nase und Auge. Der Geruch des Billingsgater Fischmarktes hatte kaum nachgelassen, da drängte sich der Gestank der Abfallhaufen, die überall auf den Straßen faulten, in die Nase. Gewürzballen und -fässer auf großen Pferdewagen lösten den Fäulnisgeruch ab, dann folgten wieder Schwaden von den Kochständen an der Uferstraße.
»David!«, riss ihn die Stimme des Onkels aus dem Starren. »Sieh dort, die London-Brücke! Breit für zwei Fuhrwerke nebeneinander und für die Verkaufsstände am Rand. Und alles aus Stein. So eine Brücke wirst du nicht oft sehen.«
David sah zur anderen Seite auf die Brücke, die in behäbigen Bogen den Fluss überspannte: »Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie eingeweiht wurde, als sie ein kleines Mädchen war.«
»Nein! Du verwechselst das mit der Westminster-Brücke. Die ist vor vierundzwanzig Jahren eingeweiht worden und führt weiter westlich über den Fluss. Die London-Brücke ist uralt, ganz früher soll sie aus Holz gewesen sein. Wo jetzt schon zwei Brücken über den Fluss führen, wird sich die Stadt wohl auch auf dem Südufer ausdehnen.«
»Wohnen Sie denn auf dem Nordufer, Sir?«
»Komm, David, wenn wir allein sind, brauchst du nicht so förmlich zu sprechen. Ich bin doch dein Onkel, hab' dich schon einmal gesehen, als du ein Baby warst. Und jetzt erinnerst du mich sehr an deine Mutter und an meine Frau. Sag einfach Onkel William!« Dann griff er die Frage auf: »Mein Hotel ist am Westende der Fleet Street, nicht weit vom Temple. Ich bin dann näher am Verpflegungs- und am Flottenamt, mit denen ich zu tun habe, und die Admiralität ist auch nicht weit. Wenn ich einen Rechtsanwalt brauche, was im Geschäft immer mal wieder vorkommt, finde ich sie dort im Dutzend.«
Und so erzählte der Onkel weiter, deutete auf dieses oder jenes Gebäude, bis die Kutsche am Temple nordwärts einbog, und David sog seine Umgebung überwältigt in sich hinein.
Die Kutsche hielt. Das Schild am Haus schien einen langhaarigen Dorfköter darzustellen, aber es sollte wohl ein Löwe sein, wie das vergoldete Geschnörkel »The Lion« andeutete. Ein Hausdiener öffnete den Schlag und lud sich die beiden Kisten auf, die Davids Habe enthielten.
Der Wirt tauchte im Eingang auf: »Das ist also der Neffe aus Hannover, Euer Ehren! Ein schmucker junger Herr, nur ein bisschen spack.«
»Es können nicht alle so rund sein wie Ihr, Rower, sonst müssten wir die Straßen verbreitern. Habt Ihr uns noch etwas zum Essen übrig gelassen?«
»Alles, was Ihr wollt, Euer Ehren, meine Frau steht schon bereit. Wir haben Stör und Schinken kalt, Lammkeule und Ochsenbrust warm, Kohl, Gurken, Kartoffeln, Salbei ...«
»Gut, gut«, wehrte der Onkel ab, »das wird schon für uns reichen. Aber erst gehen wir aufs Zimmer. Zeigt dem jungen Herrn seine Kammer, und wir spülen uns die Hände ab.«
Als David seine Mahlzeit gegessen hatte, mit einiger Vorsicht erst, dann trotz des ungewohnten Geschmacks einiger Zutaten mit jungem Heißhunger, antwortete er auf die Frage seines Onkels: »Danke, Sir, es hat mir sehr gut geschmeckt. Aber der Pudding war gar nicht so süß wie bei uns. Was war denn drin?« »Das darfst du mich nicht fragen. Ich bin nicht einer von den weibischen Fatzken, die sich über Rezepte unterhalten können. Aber Pudding ist bei uns kein Zucker- und Schokoladenzeug wie auf dem Kontinent, sondern Fleisch, Gemüse und so etwas. Deine Tante kann dir mehr darüber sagen. Aber nun will ich einiges von dir wissen!«
Und er fragte ihn mit der Bestimmtheit aus, die ihm nötig erschien, da er jetzt doch für einige Monate erzieherische Verantwortung zu tragen hatte. Und David erzählte von seiner Jugend im verträumten Stade, von dem großen Haus am Marktplatz, von den Kutschfahrten, wenn er seinen Vater bei Patientenbesuchen begleiten konnte, von den Bubenstreichen und den Bootsfahrten mit den Fischern auf der Elbe, von den zwei Besuchen in Hamburg.
»Aber du wirst dich ja nicht nur vergnügt haben«, unterbrach der Onkel den mit leichtem Heimweh gefärbten Bericht. »Was hast du denn gelernt? Englisch kannst du ja ganz passabel, kaum einen leichten Akzent hört man.«
»Meine Mutter hat immer mit mir geübt«, und David sprach schnell weiter, um die Tränen, die er fühlte, nicht in die Augen zu lassen. »Ich musste immer in Englisch erzählen, was ich getan hatte, und sie verbesserte mich, wenn ich etwas falsch sagte. Ich bin auch schon vier Jahre zur Lateinschule gegangen und habe dort etwas Französisch gelernt. Vater hat darauf bestanden, dass ich noch bei einer ehemaligen Gouvernante aus Rennes Stunden nahm, damit die Aussprache besser wurde.«
»Hm, so weit, so gut. Und wie steht es denn mit der Mathematik und den Realien? Kennst du den Pythagoras, und kannst du Prozente rechnen, was in meinem Beruf sehr wichtig ist?« »Wir haben wenig Mathematik, Physik und andere Realwissenschaften gelernt, weil der Direktor meinte, das gehöre nicht zur Klassik. Aber mein Vater hat mir etwas Chemie beigebracht, wenn er Medikamente zusammenstellte.«
»Was ich über euren Direktor denke, will ich lieber nicht sagen«, brummte der Onkel. »Wir sind hier auf der Insel etwas praktischer als ihr da drüben. Deine Mathematik kannst du in Portsmouth auffrischen. Das werden wir schon sehen. Aber jetzt kommt bald unsere Kutsche.«
»Fahren wir dann nach Portsmouth?«
»Nein«, wehrte der Onkel ab, »wir reisen erst morgen früh. Die Postkutsche fährt zwar spät am Abend nach Portsmouth, aber wir fahren am Tag mit einer Mietkutsche, die sich einige Reisende teilen. Da siehst du etwas vom Land, und wir müssen uns weniger vor Straßenräubern in Acht nehmen. Jetzt wollen wir noch etwas in London umherkutschieren, damit deine Mutter nicht sagen kann, ich hätte dir nichts von ihrer Heimat gezeigt.«
Die Kutsche fuhr vor, diesmal war es eine offene, und David genoss die Rundfahrt. Sie ratterten die breite Straße entlang, die »Strand« hieß und zum Themseufer hin große und teure Villen zeigte, bogen nach Whitehall ab, sahen die Admiralität, Horse Guards und Westminster mit der Brücke, alles mit den belehrenden Erklärungen des Onkels dargeboten.
Wie oft er später in wichtiger Mission zur Admiralität nach Whitehall kommen müsste, solche Vorahnung trübte Davids Schaulust nicht. Am beeindruckendsten aber war für ihn der Besuch in Mr. Cox' Museum. Für fünf Schilling drei Pence tat sich eine Zauberwelt der Mechanik auf.
Schmetterlinge aus dünnem Blech ließen durch winzige Mechanismen ihre mit Diamanten besetzten Flügel schlagen. Goldene Elefanten bewegten sich mit palastartigen Aufbauten auf den Tischen vorwärts. Mechanische Schlangen krochen Bäume hinauf, die aussahen, als seien sie echt. Bilder des Königspaares wurden illuminiert, und eine mechanische Kapelle spielte »God save the King«. Tulpen öffneten und schlossen sich und – für David der Höhepunkt – Drachen spien Perlen wie Feuer aus.
Während er von Tisch zu Tisch ging, fragte er sich immer wieder, ob das nun Traum oder Wirklichkeit sei. Der Onkel, der eine Zeitlang mehr auf eine junge Dame geachtet hatte, bei der er nicht sicher war, ob sie vom Stande oder vielleicht nicht so sehr standhaft war, brachte schließlich die Wirklichkeit zurück.
»So, David, bevor du dir die Augen ganz aus dem Kopf geguckt hast, sollten wir ins Gasthaus fahren. Der Tag war lang genug für dich.«
Das war er allerdings, dachte David, als er im ungewohnten Bett in der Kammer lag. Das war der ereignisreichste Tag in meinem Leben! Doch trotz aller Müdigkeit wollte der Schlaf nicht kommen. London ratterte, schrie und stöhnte wie am Tag. Bei dem Peitschenknall der Kutscher und den Rufen der Bettler wanderten die Gedanken zu seinen Eltern. Er kniff die Augen zu, und dennoch blieben die Bilder blass und undeutlich.
Dann war wieder der mechanische Drache vor seinen Augen, und schließlich erinnerte er sich an nichts mehr, als der Diener an die Tür klopfte: »Sechs Uhr morgens, junger Herr!« Also musste er doch geschlafen haben. Nun aber raus aus dem Bett. Der Onkel wartete sicher nicht gern.
Als die Kutsche vorfuhr, stand das Gepäck am Eingang, Onkel und Neffe waren bereit. Ein Dienern des Wirtes, Trinkgelder für die Knechte und hinein in die große Kutsche! Drinnen saßen Mr. Grey, ein Schiffsbauer aus der Königlichen Werft von Portsmouth, der mit der Admiralität und dem Flottenamt verhandelt hatte, und Mr. Foot, ein Reeder aus Portsmouth. Beide kannten Davids Onkel gut.
Es gab eine herzliche Begrüßung, gebührende Aufmerksamkeit für den Neffen und allgemeine Erleichterung, dass man aus dieser Riesenstadt, diesem lärmenden Sündenbabel, wieder ins heimatliche Portsmouth fuhr. Obwohl, wandte Mr. Grey mit flüchtigem Seitenblick zu David ein, obwohl es ja auch einiges gäbe, was man nicht verachten könne und was man in Portsmouth nur hausbackener erhalte, wenn man es sich überhaupt getraue. Aber nach einem bedeutungsvollen Blick von Davids Onkel spann er das Thema nicht weiter aus.
David beugte sich aus dem Fenster, als die Kutsche über die Westminster-Brücke polterte, und wich zurück, als sie durch die armen, schmutzigen Viertel am Südufer fuhr, wo Scharen zerlumpter Kinder neben der Kutsche herrannten und bettelten. Die Herren achteten wenig auf die ihnen bekannte Umgebung und erzählten von ihren Theaterbesuchen in London.
»Stellen Sie sich vor«, ereiferte sich Mr. Grey, »ich habe mir im Haymarket-Theater die Bettleroper angesehen. Ich mag Opern und musikalische Pantomimen, wie Sie wissen, und sehe auch Mrs. Thompson gern. Aber die Oper spielte unter Dieben, Gaunern und Dirnen. Sie ahmten die Gefühle nach, die anständige Bürger empfinden, und scheuten sich dann nicht, ihrem Milieu entsprechend auf der Bühne zu morden. Sollen wir diese Welt noch aufs Theater bringen.«
»Aber, aber, Mr. Grey«, unterbrach Mr. Foot, »wird denn bei Shakespeare nicht gemordet, stellt er nicht manchen abgefeimten Gauner auf die Bühne? Und Mr. Bannister soll in der Bettleroper doch vorzüglich singen, habe ich in der Gazette gelesen.«
Das müsse man zugeben, räumte Mr. Grey ein, aber bei Shakespeare werde doch der Pöbel nicht verherrlicht.
Davids Onkel wollte neutral bleiben: »Ich habe vorgestern Hamlet im Drury-Lane-Theater gesehen, und Mord und Schurkerei gab es genug, wie Sie wissen, aber bei Hofe. Und Mr. Garrick ist ein so hervorragender Schauspieler, dass mir fast das Herz aussetzte, als er mit dem Geist des Vaters sprach.«
»Ich habe davon gehört«, sagte Mr. Foot. »Wer spielte die Ophelia?«
»Das war Mrs. Smith, und sie war ebenso wie Mrs. Hopkins als Königin beeindruckend, aber Mr. Garrick kann auf der Bühne keiner das Wasser reichen. Meine Frau wird mich beneiden.«
Eine Weile schwieg das Trio. Die Kutsche hatte London hinter sich gelassen und fuhr über die Landstraßen in Sussex. Mr. Barwell wies seinen Neffen auf Dörfer und Viehherden hin. Einmal rumpelten sie an einer Picknickgesellschaft vorbei, die ihnen übermütig zuwinkte.
»Sagen Sie mal, meine Herren«, begann Mr. Foot wieder das Gespräch, »haben Sie die neuen Nachrichten aus Amerika gehört?«
»Meinen Sie die Aufrührer, die in Boston Tee in den Hafen geschüttet haben?«, fragte Davids Onkel.
»Viel schlimmer! Es steht in den Zeitungen, dass Hancock mit seinen als Indianer verkleideten Spießgesellen hinter der ›Teaparty‹ in Boston, wie es einige nennen, steckte. Aber auch in Charleston, Annapolis und New York haben Banditen jetzt Tee ins Wasser geschüttet oder ihn verbrannt. Wohin soll das führen? Das ist doch Aufruhr! Sie wissen, dass mein Vetter im Handelsministerium arbeitet. Von ihm weiß ich das Neueste: Lord North hat mit seinem Kabinett beschlossen, den Hafen von Boston für jeglichen Handel zu schließen, bis die Banditen der East India Company den Schaden ersetzt haben. Das wird ihnen zeigen, wohin Rebellion führt!«
»Wenn das nur gut geht«, seufzte Davids Onkel.
»Aber, Mr. Barwell«, griff der Schiffbaumeister ein, »wir können doch diese Radaubrüder nicht immer nur gewähren lassen. Als wir die Kolonien gegen die Franzosen und die mit ihnen verbündeten Rothäute verteidigen mussten, waren wir und unser Geld gut genug. Und jetzt müssen wir jedes Jahr, das der Herrgott werden lässt, vierhunderttausend Pfund für Verteidigung und Verwaltung der amerikanischen Kolonien zahlen, aus unseren Taschen, meine Herren, und die Schmuggler und Banditen steuern nicht einen Penny bei. Der Tee der Ostindischen Handelsgesellschaft, den sie jetzt in die Häfen werfen, ist mit der Steuer billiger als der holländische Tee, den sie mit Schmugglerschiffen ins Land bringen. Aber sie kaufen das holländische Schmuggelgut, diese Schurken, um bloß nicht zu den Steuern beizutragen.«
»Mr. Grey, ich lasse mich in der Treue zu unserem Land und unserem Herrscherhaus von niemandem übertreffen«, sagte Davids Onkel mit ruhiger Bestimmtheit. »Ich verurteile diese Gewalttaten nicht weniger als Sie. Aber ich glaube nicht, dass Lord North und seine Minister geschickt mit den Kolonisten umgegangen sind. Sie haben Gesetze erlassen, um Gelder einzutreiben, haben sie dann halb oder ganz zurückgenommen, wenn die Radaubrüder das Volk aufwiegelten. Dadurch haben sie nur das Selbstvertrauen des Pöbels gestärkt. Verständnis für die Bedürfnisse des Handels und für berechtigte Wünsche der Kolonien habe ich bei unserem jetzigen Premierminister nicht bemerkt. Sie wissen, dass das auch Lord Chatham in aller Öffentlichkeit gesagt hat.«
»Kein Wunder«, explodierte Mr. Grey, aber es blieb offen, was er damit meinte, denn die Bremsen der Kutsche quietschten, und die Insassen wurden nach vorn geschleudert.
Als sie wieder Halt gefunden hatten, die Türen aufrissen und nach dem Kutscher riefen, hörten sie, dass ein verdammter Dorftrottel mit seiner Karre in letzter Sekunde vor dem Wagen die Straße passieren wollte, dass man in Guilford sei und noch wenige Hundert Yards zum »Weißen Adler« zu fahren habe, wo die Pferde gewechselt würden.
David sprang mit einem Satz aus dem Wagen, die anderen kletterten etwas steifbeinig heraus und reckten sich.
»Eine Stunde, werte Herren, der Wirt soll sich mit dem Essen beeilen«, kündete der Kutscher an und fuhr die Kutsche in den Hof zum Pferdewechsel.
»Na, David, ob du hier Sauerkraut bekommen wirst, scheint mir zweifelhaft«, nahm Mr. Foot leutselig Kontakt auf. Davids Einwurf, dass er Sauerkraut nicht besonders möge, ließ seinen Onkel auflachen. »David, du bist ein Hannoveraner, unser König ist ein Hannoveraner und hält Sauerkraut für eine Delikatesse. Da kannst du doch nicht alles durcheinanderbringen. Für uns seid ihr Sauerkrautesser und die Franzosen Froschesser, so einfach ist das! Aber Spaß beiseite, ich habe in meinem Lager immer Fässer mit Sauerkraut. Einige Kapitäne schwören darauf zur Vorbeugung gegen den Skorbut. Die Dänen nehmen es vor allem.«
Im Gastzimmer servierte man einen köstlichen Lammbraten mit vielen Beilagen. Die Herren tranken Bier, ein Gläschen Port, und David konnte zwischen Milch und Sorbet wählen.
Sie hatten ihr Mahl kaum beendet, als Davids Onkel zu seinen Gefährten sagte: »Sie rauchen sicher noch ein Pfeifchen, meine Herren, und Sie wissen, wie ungern ich ruhig am Tisch sitze. Erlauben Sie bitte, dass ich mit meinem Neffen ein paar Schritte auf und ab gehe.«
Sie waren kaum aus dem Haus, als David sich dem Onkel zuwandte: »Onkel William, bitte, was ist das alles mit den amerikanischen Kolonien? Ich bin nicht richtig daraus schlau geworden.«
»Wer wird das schon, mein Junge. Deine Wissbegier in Ehren, aber um dir das alles zu erklären, brauchte ich viel Zeit. Zuerst muss ich dir sagen, dass ein älterer Vetter von mir in Massachusetts lebt und mir einiges geschrieben hat von der Arroganz und Anmaßung der Beamten, die ihnen London schickt, und von der Dummheit, mit der man vernünftige Vorschläge der gemäßigten Kolonisten ablehnt.«
Mr. Barwell gab seinem Neffen dann in seiner etwas belehrenden Art, die man bei einem Schiffsausrüster kaum erwarten würde, Auskunft über seine Ansicht von der Entwicklung des amerikanischen Problems. Er erzählte ihm, wie die dreizehn Kolonien in ihrem Handel durch Gesetze ganz auf das Mutterland orientiert seien, dass England an allem verdiene, was Amerika im- und exportiere.
Er erklärte ihm, dass sich Händler und Handwerker in ihren Entwicklungsmöglichkeiten durch die vielen Gesetze eingeengt sähen, die ihnen den Bau von Manufakturen und den selbstständigen Handel mit anderen Staaten verboten. Für die Opposition gegen die englische Verwaltung, die auch die Landnahme westlich der Alleghenies verhindern wollte – erfolglos bei dem Landhunger der Kolonisten –, zeigte er Verständnis.
Sehr viel weniger Verständnis ließ er für die Forderung der Kolonisten erkennen, dass eine Steuererhebung gesetzwidrig sei, solange sie nicht im Parlament vertreten seien. Seiner Meinung nach sei es völlig unmöglich, jeden Briten in jedem Teil der Welt eine direkte Repräsentanz im Unterhaus zuzugestehen.
»Wenn das Unterhaus aufgelöst wird, braucht man viele Monate, die Nachricht in alle Teile der Welt zu bringen und noch einmal Monate, um die Ergebnisse der Neuwahlen oder die neuen Abgeordneten ins Mutterland zu senden. Das Land ist dann öfter ohne Parlament als mit.«
Solche unsinnigen Forderungen müssten die Rechte der Bürger gefährden, statt sie zu fördern. Auch im Mutterland sei die Repräsentanz mehr ein Prinzip. Jeder wisse, dass in einigen Wahlkreisen wenige Stimmen zur Wahl eines Abgeordneten genügten, während in manchen Städten viele tausend Menschen auch nur einen Repräsentanten hatten. Aber wer könne die Menschen denn dauernd zählen und die Wahlkreise neu einteilen?
»Du wirst es im Leben noch erfahren, David. Wir müssen alle mit Unvollkommenheiten leben. Hauptsache, der Weg geht in die richtige Richtung. Umwege und Schlaglöcher kann man schon ertragen. Ich halte nichts von denen, die alles perfekt regeln wollen. Da das gar nicht geht, schaffen sie nur neue Willkür. Und am schlimmsten ist eine Regierung, die aus Dummheit und Unkenntnis ein falsches Gesetz durch das andere falsche ablöst, weil sie nach dem Pöbel schielt. Und Lord North versteht anscheinend genauso wenig von den amerikanischen Kolonien wie vom Handel. Glaub mir, es wird noch sehr viel Ärger geben. Aber ihr in Hannover werdet wohl weniger davon merken.«
Wenn er die Erläuterungen noch fortsetzen wollte, wenn David hätte nachfragen wollen, es war zu spät! Die Kutsche stand bereit. Der Kutscher knallte mit der Peitsche. Sie setzten sich eilends zu den anderen, und ab polterte der Wagen über das Pflaster. Dann mahlten die Räder wieder durch den Sand der Landstraße, und das Gefährt schlingerte in den ausgefahrenen Spuren. Die Reisenden waren satt und dösten vor sich hin.
Erst am späten Nachmittag, nach einer Pause und einem Topf Tee, kam wieder ein Gespräch auf. Die Gedanken waren in die Heimatstadt vorangeeilt. Und man tauschte Klatsch über diesen und jenen aus, diskutierte über Entscheidungen des Magistrats und sprach über die Aussichten von Handel und Wandel.
David war nur hin und wieder an dem Gespräch interessiert. Es strengte ihn auch an, der ungewohnten Sprache, dem ungewohnten Dialekt konzentriert zu folgen. So wanderten seine Gedanken zurück in die Heimat, zur Mutter, die sich voller Liebe und Wehmut von ihm verabschiedet hatte, zum Vater, der nie mit der Arbeit fertig wurde, mit den hilfesuchenden Patienten und den Schreiben, die ihn mit der gelehrten Welt verbanden. Und doch hatte David seine Liebe gespürt, wenn er ihn ansah, ihm die Hand auf die Schulter legte.
Aber die Hand auf seiner Schulter, die ihn jetzt leicht schüttelte, war die von Onkel William: »Aufgewacht, mein Junge! Willst du nicht sehen, wie wir in Portsmouth eintreffen?«
Im letzten Tageslicht, das vom Grau des Meeres getönt wurde, sah er die Stadtwälle, einen Meeresarm, Masten und Gebäude.
»Wir fahren am Mill Pond entlang«, wies der Onkel auf das Wasser. »Rechts liegt Portsea, daneben die königliche Werft und vor uns die Brücke zur Stadt.«
Große Gebäude blieben rechts liegen, David glaubte Kanonen zu sehen, die Räder gaben ein anderes Geräusch, dann hatten sie die Brücke passiert und waren in der Stadt. Enge Straßen, ein kleiner Platz. Die Kutsche hielt vor einem Gasthof.
»Gott sei Dank«, seufzte Mr. Foot. »Na endlich«, klang es aus Mr. Greys Ecke.
Die Tür wurde aufgerissen.
Mr. Grey beugte sich zu David vor: »Besuch mich mal in der Werft. Da gibt es viel zu sehen. Und nun gehab dich wohl, mein Junge.« Schwer stieg er auf die Klapptreppe, stand noch einen Augenblick auf dem Steinpflaster und wartete auf sein Gepäck. »Es war angenehm, mit Ihnen zu fahren, meine Herren. Grüßen Sie bitte Ihre Gattinnen. Ich hoffe, Sie finden alle Ihre Lieben gesund vor.«
Davids Onkel hatte mit dem Gastwirt vereinbart, dass ein Gehilfe das Gepäck mit der Karre in sein Haus brachte. Dann verabschiedete er sich von seinen Mitreisenden. »Komm, David, wir gehen das kurze Stück zu Fuß. Es lohnt nicht, eine Kutsche zu rufen, und wir haben den ganzen Tag gesessen.«
Die Straße war noch belebt wie am hellen Tag. Marineblau war die vorherrschende Farbe bei den Männern. Meist waren es Maate und Kapitäne der Handelsschiffe. Hin und wieder brachten die Manschetten und Revers der Offiziere der Royal Navy weiße Tupfer in das Blau. Einfache Matrosen waren seltener zu sehen.
»Die sitzen jetzt in den Tavernen unten am Point«, erklärte Onkel William.
Zivilisten in grauen und braunen Röcken tauschten mit dem Onkel Grüße aus, und er verbeugte sich artig vor dieser oder jener Dame.
Dann zeigte er auf ein breites zweistöckiges Haus, in Ufernähe gelegen: »Dort sind wir daheim, David! Links schließen sich die Warenräume an, unten sind Kontor und Empfangszimmer, und oben und zur See hin wohnen wir.«
Der kupferne Türklopfer hatte kaum die Tür berührt, als sie auch schon aufflog.
»Willkommen daheim, Sir, und willkommen auch der junge Herr«, begrüßte sie John, Hausdiener, Hausmeister und erprobte Stütze vieler Jahre. »Bringt der Diener vom Hotel zur Post das Gepäck, Sir? Ah, ich seh' ihn schon mit der Karre.«
Sie stiegen eine breite Treppe hinauf und hatten kaum den ersten Absatz erreicht, als oben in der Wohnungstür eine Frau erschien und ihnen die Arme entgegenstreckte. Sie trug das Haar anders als seine Mutter und sah jünger aus, aber die Ähnlichkeit war so groß, dass David schlucken musste, um nicht in Tränen auszubrechen.
»David, mein lieber Neffe, herzlich willkommen in Portsmouth. Wie freue ich mich, dass du uns endlich einmal besuchst. Wie geht es deiner Mutter? Du musst mir viel erzählen«, sprudelte sie hervor.
»Und der Hausherr ist wohl ganz Nebensache! Was sind das nur für Sitten heutzutage?«, meldete sich schmunzelnd der Onkel.
»Ach, William«, legte sie den Arm um ihn, »du weißt doch, wie ich mich über deine gesunde Heimkehr freue. Aber David sehe ich doch zum ersten Mal nach elf Jahren wieder.«
Sie zog die beiden in die Diele, wo ihnen ein Mädchen die Mäntel abnahm. »Julie ist schon im Bett und Henry natürlich erst recht, aber morgen werden sie ihren Cousin kaum lange schlafen lassen.«
Sie gelangten in ein geräumiges Wohnzimmer mit Ledersesseln um einen nussbraunen Tisch. Von der nächsten Tür war ein Winseln zu hören.
»Lass ihn schon herein, Sally, bitte«, sagte der Onkel mit einem Seitenblick zu David.
Die Tante öffnete die Tür, und jaulend vor Freude stürzte ein großer Schäferhund auf Onkel William zu, drehte sich vor ihm, wedelte und winselte.
»Rex«, rief David im Ton höchster Überraschung, »Rex, wie kommst du hierher?«
Der Hund ging abwartend, aber schweifwedelnd auf David zu.
»Das ist nicht Rex, das ist Ajax, ein Bruder Eures Rex', den uns dein Vater bei seinem letzten Besuch vor acht Jahren als jungen Welpen gebracht hat.«
David kniete vor dem Hund, legte seinen Kopf an den Kopf des Hundes mit dem weichen Fell und den großen Ohren und umfasste seinen Hals. Mit dem Instinkt des geliebten Haushundes spürte das Tier die Zuneigung und ließ ihn gewähren.
»Das ist ja wie Nach-Hause-Kommen«, schluchzte David. »Mögest du es immer so empfinden, wenn du zu uns kommst«, sagte die Tante, und auch sie konnte ihre Rührung nicht verbergen.
Die letzten Wochen der Kindheit
Wenn David sich in späteren Jahren an die ersten Wochen in Portsmouth zu erinnern versuchte, so war es immer, als ob ein Sturzbach von Bildern an ihm vorbeirauschte, aus dem er nur mühsam einzelne Szenen anhalten konnte.
Zuneigung und Freude erfüllten ihn, wenn er an seine Cousine Julie und seinen Cousin Henry dachte, die am ersten Morgen schon in aller Frühe mit einem hechelnden und schweifwedelnden Ajax in seine Kammer gestürmt waren.
Julie mit ihren acht Jahren sah ihn recht kritisch und distanziert aus blaugrauen Augen an. Sie hatte eher die untersetzte Figur ihres Vaters, aschblonde Haare, eine hohe Stirn über einem relativ breiten Gesicht.
Später glaubte sich David zu erinnern, dass sie ihm nicht eigentlich als hübsches Mädchen erschienen war, obwohl sie recht niedlich aussah, besonders wenn sie lächelte. Aber ihre Willenskraft, ihre Intelligenz und ihre unbeirrbare Freundschaft, wenn sie jemanden ins Herz geschlossen hatte, mussten wohl schon früh auch Davids Sympathie geweckt haben.
Der fünfjährige Henry hatte den Charme, die Zutraulichkeit und die Ausstrahlung, die ein Fremder vielleicht bei der Schwester vermisste. Er war der Liebling seiner Umgebung, zierlicher als seine Schwester, mit strohblondem, etwas gelocktem Haar, zu dem braune Augen einen reizvollen Kontrast bildeten.
In ihm steckte viel Übermut, und seine Umgebung wartete fast darauf, dass er wieder eine Redensart, einen Scherz, eine Bemerkung anbringen würde, die er irgendwo aufgeschnappt hatte. Meist passten diese Äußerungen weder zu seinem Alter noch zur Situation, aber gerade das schien die Zuhörer zu amüsieren.
In späteren Jahren wurde David klar, dass Henry nicht die zupackende Intelligenz seiner Schwester besaß, aber in der Zeit der ersten Bekanntschaft blieb ihm das verborgen, und auch den Eltern konnte er solche Beobachtungen nicht anmerken, sofern, dachte er später, sofern ich damals überhaupt so etwas bemerkt hätte.
Henry sprang am ersten Morgen auch geradewegs mit den Knien auf Davids Bett und fragte ihn nach Herzenslust aus, während die Schwester etwas abwartend beobachtete und nur hin und wieder eine Zwischenfrage einstreute oder eine Feststellung ihres Bruders ergänzte. Wer weiß, wie lange die beiden David ausgequetscht hätten, wenn nicht die Tante die Belagerung unterbrochen und ihm eine Pause zum Ankleiden und Frühstücken verschafft hätte.
Mit Julie, Henry und Ajax war die Erinnerung an ausgelassene Spiele im Garten der Barwells verbunden, der sich vom Haus bis fast zum Ufer erstreckte, und an viele Spaziergänge in der Stadt und am Ufer. Manchmal, oft sonntags nach dem Kirchgang, waren Mr. und Mrs. Barwell dabei, aber öfter begleiteten das Mädchen oder John die Kinder, der Sicherheit und auch wohl der Schicklichkeit wegen.
Portsmouth Point war ein Erlebnis, erstmals mit Johns sachkundiger Begleitung genossen. Sie wanderten am Appellplatz vorbei, sahen den Landeplatz von Sally Port, wo ständig kleinere Boote an- und ablegten und Scharen von Seeleuten entließen, die in den engen Gassen des Hafenviertels untertauchten.
David war kaum von den Läden wegzulotsen, die alles anboten, was Schiffe und Seeleute nur gebrauchen konnten, aber auch das, was aus fernen Ländern herbeigeschafft war. Immer kamen dann die Bilder der Papageien in sein Gedächtnis, die in einigen Läden auf Stangen hockten, unvorstellbar bunt, und misstönend krächzten oder heiser Namen und kleine Sätze – meist Flüche – hervorpressten.
John zeigte ihnen die in der Seefahrt weltbekannten Gasthäuser, das »George«, das »Star and Garter« und das von Midshipmen – viele unnütze Burschen darunter, wie John knurrte – bevorzugte »Blue Posts«.
Vorn am Kai schoben Hafenarbeiter die Schubkarren, rollten Fässer, die mit Taljen in Boote gehievt wurden, bahnten sich Fuhrwerke mühsam den Weg. David wurde an London erinnert, wenn auch das Menschengewirr mit seinen exotischen Tupfern von Laskaren und Schwarzen und das Geschrei der Verkäufer nicht mehr so ungewohnt für ihn waren.
Zwei Erlebnisse würde David in Verbindung mit Portsmouth Point nie vergessen. An einem Apriltag, sie hatten mit dem Mädchen gerade Zuflucht vor einem Regenschauer gesucht, trotteten zerlumpte, durchnässte und schmutzige Elendsgestalten um die Ecke. Sie waren mit Ketten aneinandergefesselt, und Soldaten trieben sie mit Kolbenstößen voran.
David, der seine Kraft brauchte, um den bellenden Ajax zurückzuhalten, bekam auf seinen fragenden Blick vom Mädchen Auskunft: »Deportierte, Diebe, vielleicht Mörder, die in die Kolonien nach Amerika verbannt worden sind.«
Dann am Ende des Elendszuges, David erstarrte vor Mitleid und Grauen, schleppte sich etwa ein Dutzend Kinder dahin, manche jünger als er. Auch sie waren angekettet, die Arme zum Teil wundgescheuert von den Eisengliedern. Einige schauten trotzig geradeaus, andere schlurften mit gesenktem Blick dahin. Aber an der Seite des Zuges gingen eng umschlungen zwei Mädchen, acht oder neun Jahre alt, blond, vielleicht hübsch, wie man unter dem Schmutz ahnen konnte, und weinten lautlos.
»Müsst ihr Kinder schinden und verbannen, ihr aufgeblasenen Bastarde?«, rief ein dickes Fischweib einem Soldaten zu.
Sie solle ihr ungewaschenes Maul halten, wurde geantwortet. Wenn ihr ein solches verdorbenes Gör den Rock klaue, schreie sie auch Zeter und Mordio. »Das Diebsgesindel ist dem Galgen entgangen, können noch froh sein! Sollen in der Wildnis arbeiten oder verhungern, was kümmert's mich«, schloss er seine Erklärung.
Julie, David und Henry waren heimgerannt, verstört von dem Elend, das ihnen so nah gewesen war.
»Onkel«, stieß David hervor, »sie haben Kinder aneinander gekettet und treiben sie zum Hafen. Jungen und auch Mädchen, manche nicht älter als Julie.«
»Ich weiß, mein Junge«, sagte Mr. Barwell, »bei uns ist ein solcher Transport selten, aber in London kann man es öfter sehen. Wer älter als sieben Jahre ist, wird vom Gericht wie ein Erwachsener verurteilt. Auf Diebstahl steht oft die Todesstrafe. Sie haben in Nortwich vor Kurzem ein siebenjähriges Mädchen gehenkt, das einen Unterrock gestohlen hatte. Dies ist nicht die Liebe und Güte, die unser Herrgott uns gebietet. Die Kinder wachsen in Hunger und Elend auf, sie werden zum Stehlen angeleitet, um Essen zu bekommen. Viele sind Waisen. Gott bewahre euch vor diesem Schicksal! Dankt Gott für jeden Tag, den ihr Nahrung und Wohnung habt, und betet für die Elenden.«
»Aber, Onkel William, bei uns in Stade gibt es ein Waisen- und Erziehungsheim für solche Kinder. Warum tut man in England nichts für sie?«
»Was verstehst du davon?«, polterte der Onkel. »Stade ist ein kleines Städtchen, und unsere Hafenstädte sind groß. In London weiß niemand, wie viele Tausend Menschen in den Hütten im Osten und in Southwark hausen. Wer gibt das Geld, an jeder Ecke ein Waisenhaus zu unterhalten? Wir haben in Portsmouth auch ein Waisenhaus, und ich weiß, wie schwer es ist, das Geld immer heranzuschaffen.«
»David meint es doch nicht böse, William!«, fiel Tante Sally ein, die sich hinzugesellt hatte. »Erzähl ihm von der Marinevereinigung, die viel Gutes für die Jungen tut.«
»Ja, die Marinevereinigung soll das Elend dieser Kinder lindern. Die verwahrlosten Jungen werden eingekleidet, ernährt, und man verschafft ihnen einen Arbeitsplatz in der Handelsmarine oder der Royal Navy. Es gibt die Marinevereinigung seit 1756. Sie hat sich allmählich in allen großen Hafenstädten ausgebreitet, und ich bin stolz darauf, in Portsmouth ihr Vorsitzender zu sein.«
»Könntest du nicht den Jungen helfen, Onkel William, die wir heute gesehen haben?«, beharrte David.
»Ich fürchte, nein. Wenn der Richter sie zur Deportation verurteilt hat, kann ihnen in Friedenszeiten nur die Gnade des Königs helfen. Die Marinevereinigung kann nur Jungen aufnehmen, denen der Richter es bei kleineren Vergehen empfiehlt und die zu uns wollen, natürlich vor allem jene, die nicht mit dem Gericht zu tun hatten. Wir geben ihnen Kleidung, Nahrung und eine erste Ausbildung in Seemannschaft. In Portsmouth besorgt das Bill Crowden, ein früherer Bootsmannsmaat. Dann suchen wir ein gutes Schiff mit einem verständnisvollen Kapitän. Die Jungen fangen meist als Kapitäns- oder Offiziersdiener an. Aber wer tüchtig ist und etwas Glück hat, dem steht in unserer Flotte die Welt offen. Ich sag' es immer, David, Britanniens Zukunft liegt auf dem Meer, nicht in den Elendsvierteln der Städte.«
Das Meer war allgegenwärtig in Portsmouth. Als David an einem Sonntag mit Onkel und Tante einen Spaziergang unternahm und sie am Runden Turm standen, brachte ihm das Meer den anderen nachwirkenden Eindruck, den er immer mit dem Point verband.
Von der See glitt majestätisch wie ein Schwan ein großes Segelschiff auf den Hafen zu. Über schwerem, dunklem Rumpf leuchtete zunächst ein Riesenberg heller Segel. Dann waren immer mehr Einzelheiten zu erkennen. Drohend nach vorn reckte sich der riesige Bugspriet mit den viereckigen Blindesegeln darunter. Hinter den Klüvern waren die Focksegel zu erkennen, welche die Segel der anderen Masten fast verdeckten.
Später holten wimmelnde Figuren Blindesegel, Fock und Großsegel ein. Als das riesige Schiff fast querab von ihnen war, kaum einhundertfünfzig Meter entfernt, enterten die Matrosen die Wanten hinauf und verteilten sich an den Rahen, die Füße fest auf die Fußpferde gestemmt, bereit für die weiteren Segelmanöver.
Die Galionsfigur leuchtete blau und golden zu ihnen herüber. Der untere Rumpf war schwarz angestrichen, darüber folgte ein breites gelbes Band, in dem die Reihen der Geschützpforten zu sehen waren. In dunklem Blau bildeten Vorder-, Achter- und Poopdeck den Übergang zu den dunklen Masten und den hellen Segeln.
»Das ist die Sandwich, ein Linienschiff der zweiten Klasse mit 90 Geschützen«, sagte Onkel William. »Sie wird zur Überholung in der Werft erwartet.«
Er wies seine Begleitung noch auf viele Einzelheiten hin, als das Schiff vorbeiglitt, auf die schwarzen Rohre der Kanonen auf dem Oberdeck, auf die Marse, Gefechtsstation der Seesoldaten, von denen einige schon mit ihren roten Röcken für die beim Anlegen erforderlichen Zeremonien bereitstanden, auf die riesigen Anker, die bereitgemacht wurden, auf die Stage, gewaltige Taue, die die Masten nach vorn sicherten.
David schien tief beeindruckt. Er fragte kaum nach, sondern starrte nur gebannt auf dieses riesige, von Menschenhand geschaffene Gebilde, das so leicht und wie von einem unsichtbaren Mechanismus gelenkt die Meerenge durchquerte. Es erinnerte ihn an die Maschinerie in Mr. Cox' Museum, war aber so unendlich viel größer.
»Woher kommt das Schiff?«, fragte er, aber der Onkel wusste es nicht und verwies ihn an Mr. Grey. Mit leichtem Schmunzeln erinnerte sich David viele Jahre später, dass ihm damals der Gedanke durch den Kopf ging, es müsse ein übermenschliches Wesen sein, das so ein Riesenschiff kommandiere und lenke.
Mr. Grey und die Königliche Werft waren ein anderer Höhepunkt in Davids ersten Erinnerungen an Portsmouth. Dem Tag, an dem Mr. Grey ihn gemäß einer Verabredung mit dem Onkel abholen sollte, fieberte David entgegen. Mr. Grey war pünktlich, und sie rollten wieder über die Brücke über den Mill Pond, diesmal in nördlicher Richtung. Die Straße bog nach links ab und wich einem Gebäude und einem eingezäunten Areal aus.
»Das ist das Kanonenarsenal«, erklärte Mr. Grey, »dort lagern vom 32-Pfünder bis zum Einpfünder alle Arten von Schiffsgeschützen und auch die Munition, aber kein Pulver. Wir sagen auch ›Kanonen-Kai‹, weil das Arsenal durch einen kleinen Kanal mit der See verbunden ist.«
Sie passierten eine kleine Brücke, ein riesiges Tor stand offen.
»Der Haupteingang«, erklärte Mr. Grey, »links das Lager für Maste und Sparren, rechts die Königliche Marineakademie, wo junge Herren vom Stande zu Fähnrichen ausgebildet werden sollen. Aber nur eine Handvoll Nichtsnutze verbummeln und vertrinken dort ihre Zeit. Im letzten Jahr hat man die Schulordnung verschärft. Aber ob es hilft? Seefahrt lernt man auf See, nicht auf der Schulbank!«
Sie fuhren über einen weiten Platz und sahen vor sich einige kleinere und eine große, gut vierhundert Yard lange, überdachte Reeperbahn, in der die Reepschläger den Hanf spannen, die gesponnenen Garne zu Duchten drehten und aus diesen dicke und dünne Taue schlugen.
»Und immer wird ein roter Faden hineingeflochten, damit des Königs Eigentum erkennbar ist«, schloss Mr. Grey seine Erklärung. »Und nun kommen wir zu meinem Reich, den Docks. Du hörst schon den Unterschied. Die Reepschläger spinnen die Garne und drehen die Duchten leise, aber die Zimmerleute hämmern, sägen und pochen, dass es nur so schallt.«
Die Kutsche hielt, sie stiegen aus und betraten ein zweistöckiges Gebäude, in dessen Zimmern Zeichnungen hingen und Schiffsmodelle standen. Auch in Mr. Greys Büro stand ein zierliches Modell einer Zweiunddreißig-Kanonen-Fregatte.
»Die wird gerade bei uns gebaut«, sagte Mr. Grey, »jedes Viertel Inch im Modell wird ein Fuß beim Schiff, das heißt, die Fregatte ist achtundvierzigmal so groß wie das Modell.«
Ein jüngerer Mann trat ein und grüßte.
»Ah, guten Tag!«, sagte der Schiffsbaumeister, »das ist Mr. Bentley, einer meiner Assistenten. Und das ist der junge Herr David Winter, unser Besuch aus Hannover«, stellte er vor.
»Mr. Bentley wird dich durch die Werft führen und aufpassen, dass dir keine Planke auf den Kopf fällt. Wenn der Rundgang beendet ist, meldet ihr euch wieder bei mir, und ich kann dir noch Fragen beantworten, falls ich Zeit habe.«
Mr. Bentley war ein freundlicher, geduldiger Führer, der langsam sprach, damit der »Hannoveraner« ihn auch verstehen konnte. Dies sei eine mittlere Werft, erklärte er, Chatham und Plymouth seien größer. 1770 habe ein furchtbares Feuer die Werft fast völlig zerstört. Dabei seien Planken, Rundhölzer, Taue und Segel für etwa fünfundzwanzig Kriegsschiffe verbrannt. Nein, man habe nie klären können, wie das Feuer entstanden sei. Wahrscheinlich habe ein Kalfaterer das Feuer unter einem Pechkessel nicht richtig gelöscht. Darum gäbe es jetzt überall zusätzlich kleine Löschteiche und Wassereimer.
Inzwischen waren sie an einer Helling angelangt, wo die Zimmerleute wie Ameisen um eine Holzkonstruktion herumliefen, die nach Davids Meinung wie die Gräten eines auf dem Rücken liegenden Fisches aussah.
»Da ist etwas dran«, gab Mr. Bentley zu. »Dann ist die Hauptgräte der Kiel, der aus verschiedenen Teilen fest mit hölzernen Bolzen verdübelt wird. Die nach oben gebogenen Gräten sind die Spanten, und der dort vorn aufragende große Balken ist der Vordersteven. Die wie eine zweiteilige Forke dort hinten aufragenden Balken halten später das breite Heck des Schiffes.«
Während sie an den Drillern vorbeischritten, die die Löcher für die Bolzen bohrten, erklärte Mr. Bentley, wie quer zu den Spanten dann die Planken befestigt würden, wie im Innern des Rumpfes die Kniestücke Spanten und Deckhölzer verbinden würden.
David war bei dem Hämmern und Sägen dankbar für die langsame, eindringliche Sprache seines Führers. Er sah das Skelett des Schiffes und ahnte, wie viel Planung, Arbeit und Material erforderlich waren, um ein großes Schiff zu bauen.
»Wie können die Zimmerleute die Maße so einhalten, dass alles ineinanderpasst, und wie kann man die Hölzer so formen, dass sie gebogen oder fast rechteckig aussehen?« Mr. Bentley erklärte ihm, dass man der Natur nachhelfe und den wachsenden Baum in bestimmte Formen presse. Das Holz, gute Eiche, müsse über Jahre lagern, sonst verrotte es im Wasser. Mitunter wachse der Baum auch von selbst in den gewünschten Krümmungen, so sei man dazu übergegangen, italienische Eiche zu importieren, die in den Bergen oft gekrümmt gewachsen sei. Und die Maße, die zeichneten Mr. Grey und seine Assistenten vorher auf dem Schnürboden auf, wo das Holz zugeschnitten werde.
Als David ihn nach den Masten fragte, belehrte ihn sein Führer, dass erst der Rumpf, das Heck voran, ins Wasser gelassen werde, also vom Stapel laufe. Dann lege er längsseits an der Masthulk an, wo man mit einem großen Gerüst, mit Bäumen oder Querbalken und Seilzügen die großen Maststücke in den Neubau einsetze.
»Vorher«, erläuterte Mr. Bentley, »muss der Rumpf des Schiffes aber noch gekupfert werden. Viele dünne Kupferplatten werden dabei überlappend mit Kupfernägeln auf die Planken genagelt. Das hält den Teredo-Wurm ab, der sich in warmen Gewässern sonst in den Schiffsrumpf bohrt und ihn mit der Zeit völlig durchlöchert.«