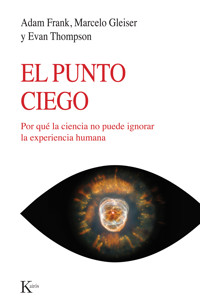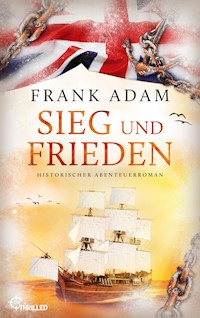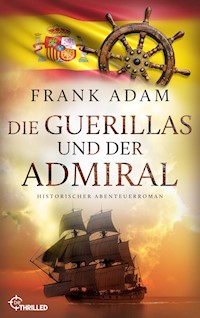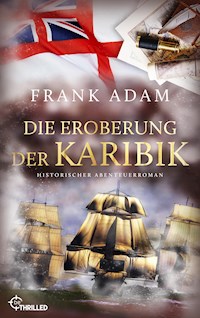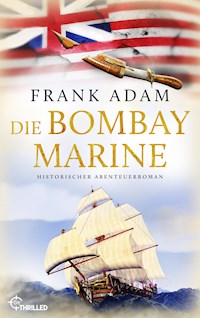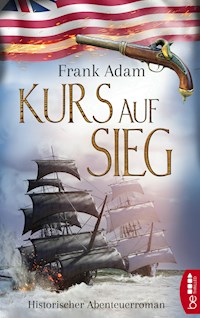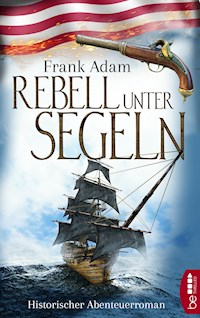6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Seefahrer-Abenteuer von David Winter
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1778 steht England im harten Kampf gegen amerikanische Kaperschiffe und Frankreichs Kriegsflotte. David Winter erlebt den Seekrieg dort, wo er am härtesten ist. Als Midshipman der Royal Navy steht er an vorderster Front des Kampfes um die amerikanische Unabhängigkeit. Zwischen Gefechten am Delaware River und in karibischen Gewässern erlebt David auch seine erste Liebe. Doch er muss feststellen: Sieg oder Niederlage, Gefangenschaft und Befreiung wechseln in raschem Tempo - und der ersten großen Liebe folgt tiefes Leid.
David Winters Abenteuer sind ein Spiegelbild seiner Zeit, des rauen Lebens in der Royal Navy, aber auch romantischer Gefühle, des heldenhaften Mutes und der Kameradschaft auf See. Vom Eintritt in die Royal Navy über die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges bis in die napoleonischen Kriege verfolgen wir David Winters Aufstieg vom Seekadetten bis zum Admiral.
Aufregende Abenteuer auf See, eingebettet in die faszinierende Geschichte der Marine.
Für alle Fans von C.S. Forester, Alexander Kent, Patrick O’Brian und Richard Woodman. Weitere Bücher von Frank Adam bei beTHRILLED: die Sven-Larsson-Reihe.
eBooks von beTHRILLED - spannungsgeladene Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 699
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Vorwort
Hinweise für den marinehistorisch interessierten Leser
Kurs Heimat
Erlebnisse mit Haddington
Die Tage des Artilleristen
Antigua
Schicksalsfahrt nach Virginia
Die Eroberung des Delaware
Die Inseln über dem Winde
Handstreich auf Martinique
Im Kampf gegen Frankreichs Flotte
Schlachtfeld Karibik
Das Netz des Midas
Das Schwert der Vergeltung
Die Bucht der sterbenden Schiffe
Glossar
Über den Autor
Alle Titel des Autors bei beTHRILLED
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Über dieses Buch
Im Jahr 1778 steht England im harten Kampf gegen amerikanische Kaperschiffe und Frankreichs Kriegsflotte. David Winter erlebt den Seekrieg dort, wo er am härtesten ist. Als Midshipman der Royal Navy steht er an vorderster Front des Kampfes um die amerikanische Unabhängigkeit. Zwischen Gefechten am Delaware River und in karibischen Gewässern erlebt David auch seine erste Liebe. Doch er muss feststellen: Sieg oder Niederlage, Gefangenschaft und Befreiung wechseln in raschem Tempo – und der ersten großen Liebe folgt tiefes Leid.
Frank Adam
Die Bucht der sterbenden Schiffe
Historischer Abenteuerroman
Vorwort
Wieder fährt David Winter zur See, erlebt Kämpfe und Abenteuer, Niederlagen und Erfolge, Liebe und Leid. Auch in diesem Band habe ich mich bemüht, die Erlebnisse meines Titelhelden historisch getreu nachzuerzählen. Der Leser soll David Winter unter den Verhältnissen erleben, die zu seiner Zeit existierten, und nicht in einer Welt, die der Erzähler nach seinem Gutdünken formte.
So hat es zum Beispiel Professor Hutton mit seinen ballistischen Untersuchungen an der Königlichen Militärakademie tatsächlich gegeben. Die beschriebenen Neuerungen im Geschützwesen, auf manchen Schiffen erprobt, fanden ihren Ausdruck schließlich im legendären Kampf von Brokes Fregatte Shannon im Jahr 1813. Auch die Untersuchungen des westindischen Rums auf Bleigehalt sind verbürgt. Ihre Ergebnisse wurden 1785 dem College of Physicians in London vorgetragen.
Und die aus Schafsdarm gewonnenen Kondome haben die Londoner Damen Phillips und Perkins seit 1750 mit großem Erfolg vertrieben. Der Gouverneur von Antigua ist zu dieser Zeit tatsächlich durch Wahnvorstellungen der geschilderten Art aufgefallen. So könnte ich noch viele Details hervorheben, die uns auf den ersten Blick kurios und unwahrscheinlich erscheinen mögen und die doch alle ihren Platz in der Welt David Winters hatten.
Selbstverständlich habe ich auch gestrafft und vereinfacht, um den Leser nicht im Wust der Fakten ersticken zu lassen. David Winter hat in Wirklichkeit öfter das Schiff gewechselt. Die Eroberung des Delaware erlebte er auf der Somerset (64er), und die Ereignisse um Martinique mit der Vernichtung der Fregatte Randolph fanden auf der Yarmouth (64er) statt. Aber es hätte den Fluss der Handlung gestört, neue Schiffe und Besatzungen einzuführen, und es hätte an den historischen Fakten nichts geändert.
Die Lebensumstände in der Flotte und in den Häfen sind in vielen anderen zeitgenössischen Berichten ebenfalls so geschildert worden, auch zum Beispiel die Verhältnisse am Drury Lane Theatre in London. Und die überwiegend konservative politische Einstellung der Flottenoffiziere ist aus vielen Tagebüchern belegt und konnte auch hier nicht verschwiegen werden.
Die seemännischen Fachausdrücke sind im Vergleich zu den Quellen sparsam benutzt worden. Sie werden außerdem im Glossar am Ende des Bandes erklärt. Die Ortsnamen habe ich in der heutigen Fassung wiedergegeben oder die heutige Fassung in Klammern hinzugefügt.
Ich hoffe, dass mein Streben nach historischer Genauigkeit dem Leser nicht die Freude und die Spannung beim Lesen der Abenteuer des David Winter beeinträchtigt.
Antigua, August 1993
Frank Adam
Hinweise für den marinehistorisch interessierten Leser
Wer sich über die geschichtlichen Hintergründe, die Schiffe dieser Zeit, das Leben der Besatzungen, die Waffen und vieles andere mehr orientieren will, kann das am einfachsten in dem Taschenbuch:
Adam, F.: Hornblower, Bolitho & Co. Krieg unter Segeln in Roman und Geschichte. Frankfurt: Ullstein 1992
Ausführlicher und reichhaltiger illustriert ist das Standardwerk:
Lavery, B.: Nelson’s Navy. The Ships, Men and Organisation 1793 – 1815. London: Conway 1989
Über die Seemannschaft dieser Zeit orientiert am besten:
Harland, J.: Seamanship in the Age of Sail. London: Conway 1984
Viel Informationen kann man auch alten nautischen Wörterbüchern entnehmen. Ich habe mich bei der Übersetzung nautischer Begriffe meist an folgendem Werk orientiert:
Bobrik, E.: Allgemeines nautisches Wörterbuch mit Sacherklärungen. Leipzig: Hoffmann, 2. Aufl. 1858
Über das Leben in dieser Zeit berichten anschaulich viele Biografien.
London und das Treiben der englischen Gesellschaft werden lebendig in:
Lichtenberg in England. Herausgegeben und erläutert von H.L. Gumbert. Wiesbaden: Harassowitz 1977. Schlüter, H.: Ladies, Lords und Liederjane. Dortmund: Harenberg 1982
Von den Biografien der Seeleute habe ich besonders herangezogen:
Childers, Sp. (Hrsg.): A Mariner of England. London:
Conway, Nachdruck 1970
Choyce, J.: The Log of a Jack Tar. Maidstone:
Mann, Nachdruck 1973
Dann, J. C.: The Nagle Journal. New York:
Weidenfeld & Nicolson 1988
Parkinson, C. N. (Hrsg.): Samuel Walters. Liverpool: University Press 1949
Parsons, G.S.: Nelsonian Reminiscences. Maidstone: Mann, Nachdruck 1973
Kurs Heimat
Januar bis Februar 1777
Nebelfetzen huschten über das Deck, zögerten an den Aufbauten, umklammerten Masten und Taue. Der Nebel sog die Gischt in sich auf, die am Bug mit jedem Wellenkamm zerstäubte. Schattenhaft erkennbare Körper duckten sich an Deck hinter jedem Aufbau, der Schutz versprach. Der Deckel einer Laterne ließ kurz einen Lichtschein entweichen.
»Vierzehn Grad, Sir!«, rief der Matrose, der die Wassertemperatur gemessen hatte.
»Deckthermometer?«, kam es fragend zurück.
»Unverändert, Sir!«
»Gut! Beobachte weiter.« Der wachhabende Offizier drehte sich ab und blickte backbords in den dunklen Nebel. Keine zwanzig Meter konnte man sehen. Ob es viel half, alle fünf Minuten die Temperatur zu messen? Wenn die Strömung ungünstig stand, könnte ein Eisberg unbemerkt herantreiben und dem Schiff den Rumpf aufreißen. Na ja, etwas beruhigte das Messen schon.
Der Wachhabende ließ den Blick nach vorn wandern, wo man den Bug nur ahnen konnte. Plötzlich erstarrte er in der Bewegung. War das nicht ein Laut backbord voraus gewesen, Metall an Metall?
»Gleich drei Glasen, Sir!«, rief der Melder, der am Ruderhaus stand.
»Ruhe! Nicht ausläuten, bring mir die Tüte!«
Der Melder hastete mit dem Sprachrohr heran.
»Dreh die Sanduhr und sag drei Glasen durch! Alle Wachen sollen auf Geräusche backbord voraus achten! Und: kein Laut!«
»Aye, aye, Sir«, murmelte der junge Bursche und lief davon.
Wieder ein Geräusch? Der Wachhabende hielt sich das Sprachrohr mit dem Mundstück ans Ohr und lauschte angestrengt. Das waren Stimmen, entfernt und undeutlich in der Nebelwatte. Was konnte das sein? Ein Schiff vom Konvoi, das in der Nacht vorbeigesegelt war? Unmöglich! Die waren langsamer und setzten nachts noch weniger Segel als die alte Exeter. Jetzt hörte es sich an, als ob Taue an Holz quietschten. Verdammt, was sollte er tun?
Der junge Wachhabende enterte die Wanten etwa zwei Meter empor und sah angespannt in die Richtung, wo er ein Schiff vermutete. Er war jung und kräftig, etwa einsfünfundsiebzig groß, breitschultrig, soweit man das unter dem Ölzeug ahnen konnte. David Winter, Steuermannsmaat und Midshipman in Seiner britischen Majestät Flotte, wurde fast übel, wenn er an die Verantwortung dachte, die ihn jetzt bedrückte. Einer der ständigen Befehle des Kapitäns besagte, dass der Wachhabende auf Nachtwache unverzüglich ›Klar Schiff zum Gefecht‹ befehlen müsse, wenn kein Vorgesetzter an Deck war und dem Schiff Gefahr drohe.
Verdammt! Drohte nun Gefahr? Sollte er zweihundertfünfzig Mann Besatzung aus dem Schlaf holen, eine Stunde bevor die Freiwache an Deck kam? Hörten denn die anderen nichts? Wieder presste er das Mundstück des Sprachrohrs ans Ohr und lauschte. Herrgott, was war das für ein Krach neben ihm? Der Melder hastete heran.
»Bugausguck glaubt Lichter gesehen zu haben, Sir!«
»Wo, verdammt?«
»Backbord voraus, Sir!«
Mr. Winter starrte angestrengt in den nächtlichen Nebel. »Ich sehe nichts. Du?«
»Nein, Sir.«
Wieder nahm David Winter die ›Flüstertüte‹ ans Ohr. Halt! Jetzt war es zu hören! Holz bummerte, Metall schlug an Metall! Stimmen fluchten unterdrückt.
»Sir, ich sehe zwei Lichter dicht beieinander!«, flüsterte der junge Melder an seiner Seite.
Da war eine Lücke im Nebel. David kniff die Augen zusammen. Ja, die Lichter zwischen den Nebelschatten waren kurz zu sehen, etwa achthundert Meter entfernt. Gott, rannten die etwa ihre Geschütze aus, und Licht drang durch die Geschützluken? Verdammt, was sollte er tun? Noch einmal Knarren, dumpfes Dröhnen, metallisches Klicken. Mr. Winter wandte sich zum Melder: »Klarschiff ohne Geräusche und ohne Licht! Renn zu den Mannschaften! Ich sag der Wache des Kapitäns Bescheid.«
Minuten später drangen Menschenscharen durch die Niedergänge an Deck. Dumpfes Klatschen ließ ahnen, dass Bootsmannsmaate mit dem Tauende zur Eile antrieben. Unterdrücktes Fluchen erstarb wieder. Befehle wurden gezischt. Hastig zerrten die Matrosen die Abdeckungen von den Kanonen.
»Was ist los, Mr. Winter?«, wollte die dunkle, große Gestalt wissen, die neben David auftauchte, der immer noch backbord voraus starrte.
»Sir, Lichter, Stimmen, metallische und andere Geräusche etwa siebenhundert Meter backbord voraus. Könnte sein, dass sie Geschütze ausrennen.«
»Bei der Dunkelheit? Die müssten ja Eulenaugen haben, um uns zu sehen. War bei uns alles abgedunkelt, Mr. Winter?«
»Jawohl, Sir!«
»Was sagen Sie dazu, Mr. Hope?«, wollte die große Gestalt von dem untersetzten Mann wissen, der an die Reling gegangen war.
»Das Nachtglas hilft bei dem Nebel gar nichts, Sir. Wir müssen abwarten. Wir sollten sie vor der Morgendämmerung eher wahrnehmen können als sie uns.«
»Gleich vier Glasen, Sir!«, schallte es vom Ruderhaus herüber.
»Nicht ausläuten!«
Schweigend starrten alle in den Nebel. Die Kälte kroch in die Glieder, Hände wurden gerieben.
»Ruhe!«, erscholl der unterdrückte Befehl.
»Ich höre auch Geräusche und Stimmen, Sir«, flüsterte Mr. Hope, »aber es hört sich nicht nach Englisch an.«
Vom Bug wurde flüsternd die Meldung weitergegeben: »Mehrere Lichter direkt voraus, etwa zweihundert Meter!«
Die Dämmerung kündigte sich mit ersten helleren Schattierungen an.
»Sir, das sind die Neufundlandbanker, die portugiesischen Fischer, die hier den Kabeljau für ihre Papisten daheim fischen«, erklärte Mr. Hope nun schon weniger flüsternd. Der Kapitän entgegnete: »Wir wollen noch etwas abwarten, ehe wir Klarschiff aufheben.«
Die aufhellende Dämmerung bestätigte es. Da lagen die Terranovas, die bunt angemalten portugiesischen Fischerboote. Zwischen ihnen tummelten sich Ruderboote mit den langen Dorschleinen. Holzfässer rumpelten. Winden quietschten, Metall hallte, Stimmen schallten herüber. Es waren dieselben Geräusche wie in der Dunkelheit. Aber in dem fahlen Nebelgrau wirkte es gar nicht mehr bedrohlich, eher friedlich. Menschen in dieser nördlichen Wasserwüste vor Neufundland!
»Lassen Sie die Gefechtsbereitschaft bitte aufheben, Mr. Morsey. Die Freiwache soll mit Deckreinigen beginnen«, befahl die große Gestalt, nun als Kapitän zur See in Alltagsuniform erkennbar. »Mr. Hope, legen Sie bitte einen Kurs fest, der uns von den Booten klar hält, und geben Sie entsprechende Signale an den Konvoi.«
David Winter starrte auf die Fischerboote, von denen jetzt einzelne Gestalten herüberwinkten. O Gott, dafür hatte er nun Alarm gegeben.
»Ich hätte es Ihnen sagen sollen, Mr. Winter, dass wir heute Morgen auf der Mittelbank mit portugiesischen Fischern rechnen könnten«, beruhigte ihn Mr. Hope, der Master.
Die Offiziere standen auf dem Achterdeck noch in einer Gruppe zusammen. Mr. Hope, der Master, gähnte verstohlen und schob sich den Südwester aus der Stirn, um sich am Kopf zu kratzen. Über dem rundlichen, etwas geröteten Gesicht wurde der weiße Haarkranz sichtbar. Mr. Brisbane, der Kapitän, überragte ihn um einen halben Kopf und schien mit leichter Belustigung zu ihm hinunterzuschauen. »Wir sollten ein Boot hinüberschicken und uns frischen Dorsch kaufen, was meinen Sie, meine Herren?«
Die Offiziere stimmten eher pflichtbewusst als begeistert zu. Fisch war nicht so beliebt in der Messe.
Mr. Barnes, der Erste Leutnant der Seesoldaten, grinste David an, als er zum Kapitän sagte: »Das ist ein umständlicher Fischkauf, Sir, wenn man über zweihundert Mann aus den Hängematten scheucht und mit Kanonen auf die Fischer zielt.«
Die anderen lachten schadenfroh. Wurde David nicht sogar rot unter der Bräune?
»Man sagt ja, dass fröhliche Offiziere die Moral der Mannschaft stärken«, warf der Kapitän ein. »Darf ich Sie aber darauf aufmerksam machen, meine Herren, dass Mr. Winter nur meinen Befehl befolgt hat. Hoffentlich haben Sie in einer ähnlichen Situation genauso wenig Angst vor dem Spott seiner Mitoffiziere wie er. Sonst wachen wir eines Nachts auf, wenn uns ein Gegner seine Breitseiten in den Rumpf jagt. Lieber hundertmal umsonst Alarm als einmal zu wenig, meine Herren.«
Langsam zerstreute sich die Gruppe. Der Erste Offizier und der Master blieben auf dem Achterdeck, und David war mit der Ausführung ihrer Befehle beschäftigt, um den Konvoi zu sammeln und auf den richtigen Kurs zu bringen. Die Jolle wurde gefiert, zum nächsten Fischerboot gepullt und kehrte bald darauf mit einem Korb zuckender Fische zurück.
Uninteressiert sah David zu und sehnte das Ende der Wache herbei. Endlich! Mr. Kelly, der Dritte Leutnant, erschien zur Ablösung.
»Na, David, wie viele Fischkutter haben Sie inzwischen versenkt?«
David zuckte mit den Schultern und brummte: »Darüber kann ich nicht mehr lachen, Sir.« Müde trottete er den Niedergang hinunter in das vordere Cockpit, das ›Heim‹ der älteren Midshipmen.
Die alte Exeter mit ihren fünfzig Kanonen segelte vor einem müden Nordostwind, einem ›Soldatenwind‹, stetig ihren Kurs. Nach ihrer Ankunft in England würde sie als Gefangenenulk dienen oder vollends abgewrackt werden. Sie war zu klein und schwach, um noch in der Schlachtlinie zu kämpfen. Das war jetzt Aufgabe der Vierundsiebziger oder der großen Dreidecker mit hundert und mehr Kanonen. Aber die Exeter war noch stark genug, den kleinen Konvoi, der in Lee von ihr segelte, gegen amerikanische Kaperschiffe zu schützen, die immer weiter und zahlreicher in den Atlantik vordrangen.
Leicht wäre der Kampf gegen ein starkes Kaperschiff aber auch nicht. Die Exeter hatte nicht genug Besatzung, um gleichzeitig die Segel zu bedienen und alle Geschütze zu besetzen. Kapitän Edward Brisbane, der in England die überholte Anson mit vierundsechzig Kanonen übernehmen sollte, hatte daher befohlen, alle Geschützbedienungen nur auf einer Seite zu konzentrieren und für die freie Schiffsseite nur einen Mann pro Geschütz abzustellen, der die Feuerbereitschaft sichern sollte.
Wenn nur die von der Exeter übernommenen Mannschaften tüchtiger und zuverlässiger gewesen wären! Aber der frühere Kapitän der Exeter hatte alle guten Leute mit zu seinem neuen Kommando genommen und Kapitän Brisbane nur den traurigen Rest überlassen. Der wiederum hatte von seiner Fregatte Shannon das beste Fünftel der Mannschaften, die Offiziere und Midshipmen auf die Exeter mitgebracht, wie es ihm traditionell zustand. Nun hatte er eine sonderbare Mischung von Versagern, Krakeelern und Schwachen einerseits und von guten Seeleuten andererseits. Wenn daraus je eine schlagkräftige Besatzung werden sollte, in den acht Tagen, die sie jetzt auf See waren, blieb der Erfolg noch verborgen.
Als es sieben Glasen der Vormittagswache läutete, also um elf Uhr dreißig, reckte sich David Winter in seiner Hängematte. Er war noch müde und fand an Bord eigentlich nie genug Schlaf. Vielleicht war das ein Tribut an sein Alter von fünfzehn Jahren und zwei Monaten. Aber was bedeutete eine Jahreszahl, wenn der junge Mann schon über zwei Jahre zur See fuhr, Stürme erlebt hatte, mehrfach Gefechte durchgestanden und gute Freunde sterben gesehen hatte. Seine Altersgefährten mochten noch die Schulbank drücken oder in der Lehre arbeiten. Sie konnten noch jungenhaft, manchmal etwas kindlich sein. David durfte es nicht mehr. Er musste den Dienst eines Mannes erfüllen, und er war ein Mann dabei geworden.
Sein braunes Haar war vom Schlaf verwuschelt. Als er es jetzt aus der Stirn schob, sah man von der Mitte der Stirn bis zum Haaransatz die etwas hellere Narbe, ein Andenken an das Gefecht in der Bucht bei Newport. Nachdem er sich die Augen gerieben hatte und sie öffnete, hätte man ihre braune Färbung mit grauen Einsprengseln erkennen können, wenn es heller gewesen wäre. Aber das Halbdunkel des Cockpits reichte aus, um die kräftige Nase in dem ovalen Gesicht wahrzunehmen. Die Schultern waren breit, die Arme muskulös, die Hände rissig vom Schiffsdienst. Mit seiner schlanken und doch kräftigen Figur schwang er sich aus der Hängematte. Er war auch vom Aussehen her ein Mann. Da gab es nichts Weiches, Kindhaftes mehr.
Er schob den Vorhang zur Seite, der die Hängematten vom Wohnteil abtrennte, und sah einige Midshipmen, zwei Maate und den Sekretär des Kapitäns in Erwartung des Mittagessens am Tisch plaudern. Einige schauten auf und lächelten ihm zu. Er wurde als guter Kamerad respektiert. Na ja, manchmal war er etwas rechthaberisch und aufbrausend, aber man konnte ihn auch leicht beruhigen, und er trug nichts nach.
David galt als guter Seemann. Der Master hatte eine Schwäche für ihn, weil ihn die Navigation mehr als nur beiläufig zu interessieren schien und er sich jetzt in einige Geheimnisse der Astronavigation einarbeitete.
Als Kämpfer war er respektiert. Von der Angst, die ihn vorher immer quälte, wussten die anderen nichts. Sie sahen nur, dass er auch im Getümmel die Übersicht behielt und den Gegner mit einer kontrollierten Wut angriff, die seinem heftigen Temperament entsprach. Das hatte ihm den Spitznamen ›Feuerfresser‹ eingebracht. Heftig war er auch in der Diskussion, scharfzüngig und manchmal verletzend. Aber wer hatte keine Schwächen?
David hatte sich gewaschen und ging zum Tisch. »Na, wartet ihr schon auf euren Erbsenbrei? Gibt es heute wenigstens noch etwas Leckeres dazu?«
Matthew Palmer, Midshipman wie David, aber ein Jahr älter und seit über zwei Jahren sein Schiffskamerad und Freund, neckte ihn: »Für dich ist heute das Mittagessen gestrichen, weil du über zweihundert ehrliche Seeleute aus dem schönsten Schlaf gerissen hast.«
»Matthew, du bist ein Aufschneider. In der ganzen britischen Flotte gibt es keine zweihundert ehrlichen Seeleute.«
Der Sekretär wandte ein: »Solange sie schlafen, würde ich sogar Seeleute für ehrlich halten.«
Protestgemurmel wurde laut, wie ein Schreiberling sich ein Urteil über Seeleute erlauben könne, er könne seinen Hintern ja schön in der Kajüte wärmen ...
»Schon gut«, wehrte der Sekretär ab. »Ich weiß, die Herren der Flotte dürfen sich nur untereinander verspotten. Ein Kapitänsschreiber darf ihnen nur helfen, wenn sie mit ihrem Papierkram nicht klarkommen.«
So ging das Geplänkel noch ein wenig hin und her, bis der Steward das Essen brachte. Es war Mittwoch, und da gab es nun einmal traditionell Erbsbrei, diesmal mit Sauerkraut und Mehlklößen angereichert. Sie murrten über das Essen und stopften es doch hinein, denn Seeluft, Kälte und Bewegung machten hungrig.
Die Bootsmannspfeifen schrillten und trieben die Mannschaften an die Geschütze. Davids Gefechtsposten war auf dem Achterdeck, wo er den Befehl über die drei Backbord-Sechspfünder hatte. Sofern der Master und der älteste Steuermannsmaat ausfielen, hatte er die Navigation zu übernehmen. In Davids Geschützgruppe bedienten Seesoldaten und Matrosen gemischt die Kanonen. Da die Sympathie zwischen den ›Hummern‹, wie die Seesoldaten wegen ihrer roten Uniformjacken genannt wurden, und den Teerjacken nicht sehr groß war, musste David immer darauf achten, dass die Reibereien nicht die Effektivität seiner Batterie störten.
Auch heute wieder stellte Jonathan, der alte, zahnlose Glatzkopf von der Besatzung der Exeter dem jungen rotblonden Seesoldaten von der Shannon ein Bein, als der zu seiner Gefechtsstation lief. Schon hob dieser die Faust, als David dazwischenbrüllte: »Keinen Streit da! Auf eure Posten, ihr Lahmärsche! Jonathan, dich lasse ich auspeitschen, wenn du dauernd stänkerst.« Der alte Matrose wollte aufbrausen, als ihn ein Kamerad herumriss und zur Ruhe brachte. Dem Kerl sollte David besser nicht den Rücken zuwenden, wenn sie nachts allein an Deck waren.
Kapitän Brisbane ließ den Ladedrill immer wieder durchexerzieren. Mit schmerzenden Händen mussten sie den Rücklauf der Geschütze imitieren, um sie wieder nach vorn zurren zu können. Als der Ausguck backbord voraus eine kleine Eisscholle sichtete, war die Gelegenheit gekommen, etwas von dem schwarzen Munitionsvorrat zu opfern. Die Pulverkartuschen wurden in die Rohre gestopft, die Kugeln festgerammt und mit alten Stoffpropfen gesichert. Batterieweise feuerten dann die Geschütze auf die dreihundert Yards entfernte Scholle. Erst dröhnten die Vierundzwanzigpfünder im Unterdeck, dann die Zwölfpfünder auf dem Oberdeck, und schließlich krachten Davids Sechspfünder nacheinander.
Der Erfolg war mäßig. Von allen fünfundzwanzig Geschützen der Backbordseite hatten nur sechs die Scholle getroffen. Fünf Kugeln waren so weit von der Eisscholle entfernt in die See gezischt, dass sie einen Feind höchstens zum Lachen gebracht hätten. Der Kapitän tobte. Die Geschützbedienungen, die getroffen hatten, durften wegtreten. Alle anderen mussten Geschützexerzieren, bis ihnen trotz der Kälte der Schweiß vom Körper rann. Bei der nächsten ruhigen See wurde Zielschießen angekündigt und wehe ...
Als David endlich das Cockpit betrat, blieb ihm gerade noch Zeit, sich umzuziehen und für seine Wache an Deck zu gehen. Er hatte jetzt nur die zwei Stunden der dog watch vor sich, jener verkürzten Wache, die man einschob, um den Rhythmus zu ändern. So blieb ihm am nächsten Tag die unangenehme Zeit der Morgenwache von vier bis acht Uhr erspart.
Nach dem Abendessen holte Harry Simmons seine Flöte hervor und spielte ihnen seit dem Auslaufen aus New York erstmals wieder etwas vor. Er variierte einige Themen, bis er die beliebte Weise von Admiral Hosiers Geist flötete. Sie sangen die Strophen begeistert mit. David war nicht sehr musikalisch, aber er strapazierte das Gehör seiner Nachbarn weniger als der Sekretär des Kapitäns, der immer zwischen Tenor und Bass schwankte. Der Rotwein, der sie wärmte, stammte von einem spanischen Blockadebrecher aus der Karibik. Bald würde der Vorrat erschöpft sein, und sie hätten dann nur noch ihren Grog zum Wärmen.
Davids Gedanken schweiften etwas ab, als ihn Barry McGaw, einer der jüngeren Midsphipmen, fragte, wann wohl Robert Bates, der Zweite Leutnant, wieder gesund wäre.
»Der Arzt meint, es könne noch zwei bis drei Tage dauern. Aber mir wäre heute lieber als morgen, damit er auf unserer Wache wieder die Verantwortung übernehmen kann.«
»Dir liegt wohl noch der Alarm von heute früh im Magen?«, fragte Jerry Desmond.
»Wärst du froh, wenn es dir passiert wäre?«, wollte David wissen.
»Natürlich nicht. Aber der Alte hat dir den Rücken gestärkt, und du hast ja auch richtig gehandelt. Komm, lass das Grübeln! Harry soll uns das Lied von Betty aus Jamaika spielen.«
Und Betty aus Jamaika war kein Thema, bei dem man noch länger über Fehlalarm nachdenken konnte. David sang und dachte an Denise, die zwar nicht aus Jamaika, aber auch sehr zärtlich gewesen war.
Als am nächsten Morgen die Pfeifen schrillten, merkte David, dass er wohl doch ein Glas zu viel getrunken hatte. Er fühlte sich so lahm und müde, dass es ihm schwerfiel, sich schnell zu bewegen. Nach der Morgenwäsche, bei der er so unvorsichtig war, dass ihm Salzwasser in die Augen geriet, wurde er etwas munterer. Aber erst das Frühstück mit dem Bohnenkaffee, den das Cockpit noch in New York gekauft hatte und der bei guter Reise fast bis England reichen sollte, ließ ihn richtig aufwachen.
An Deck läutete die Schiffsglocke sieben Glasen. In einer halben Stunde, um acht Uhr, begann die Vormittagswache. Gott sei Dank, der Master und der Erste Leutnant oder sogar der Kapitän würden an Deck sein, sodass er nicht allein die Verantwortung trug. Zum Glück schneite es auch nicht, sodass David auf die schwere Ölhaut verzichten konnte.
Als David den Kopf aus dem Niedergang steckte, sah er gewohnheitsmäßig erst zum Himmel empor. Hohe, aufgelockerte Bewölkung, kein Anzeichen von Schnee, Regen oder Sturm. Dann stieg er die letzten Stufen hinauf und schaute in die Runde. Mäßig bewegte See. Gute Sicht. Ziemlich kalt. Er grüßte den wachhabenden Offizier und ging zum Ruderhaus. Das Barometer zeigte ein leichtes Hoch an. Auf der Schiefertafel war vermerkt, dass sie während der Morgenwache vier bis sechs Knoten gesegelt waren.
Hugh Kelly, der wachhabende Offizier, bemerkte freundlich: »Sie sind früh dran, David. Es gibt nichts Besonderes. Ein Matrose aus Mr. Bates’ Division hat sich den Fuß verstaucht, als er von den unteren Wanten an Deck sprang. Aber das geht schnell vorbei. Ich musste nicht ›Klarschiff‹ ausrufen, um Fischerboote zu erschrecken.«
Gott, hört das gar nicht mehr auf, dachte David und griente säuerlich.
»Schon gut«, lenkte Mr. Kelly ein, »das war wohl für Sie nicht mehr lustig.«
Noch bevor die Wache übergeben war, erschien Mr. Hope an Deck. Nachdem er sich umgesehen hatte, erkundigte er sich nach den Schiffen des Konvois. Alle acht waren annähernd auf Position in Lee. Nur die Brigg Helena hatte während der Morgenwache zusätzlich Segel setzen müssen, um wieder auf Position zu gelangen.
Als Kapitän Brisbane das Deck betrat, nickte er nur zu ihrem Gruß, blickte kurz umher und begann dann seine Wanderung auf dem Achterdeck. Exakt eine Viertelstunde würde er nun hin und her gehen, ehe er zu ihnen trat, um sich nach irgendwelchen Ereignissen, dem Wetter und dem Zustand des Schiffes zu erkundigen. Die Pumpen klickten laut in der Morgendämmerung. Sechs Stunden mussten sie täglich pumpen, so morsch waren die Planken der alten Exeter. Mr. Lenthall, der Schiffsarzt, stieg etwas steif den Niedergang empor, um dem Kapitän über den Gesundheitszustand der Mannschaft zu berichten. Er lächelte Mr. Hope und David freundlich zu und setzte zum Sprechen an.
»Deck ho!«, rief der Ausguck. »Es bläst! Drei Meilen steuerbord voraus.«
David griff nach dem Teleskop und ging mit den anderen zur Steuerbordreling.
»Das sind ja viele Walfische, eine ganze Herde!«, rief der kleine Andrew Harland begeistert.
Der Schiffsarzt legte ihm die Hand auf die Schulter. »Mr. Harland, Wale sind keine Fische, sondern Säugetiere, die lebende Junge zur Welt bringen und säugen. Wenn sie in Gruppen auftreten, sagt man nicht Herde, sondern ›Schule‹.«
»Schule hören die jungen Herren nicht so gern«, gab der Master seinen Kommentar.
Mr. Lenthall hatte durch Davids Teleskop Einzelheiten erkannt. Da die Gruppe durch mehrere neugierige Midshipmen und Captain’s Servants verstärkt worden war, sprach er jetzt lauter. »Das sind Grönlandwale, Balaena mysticetus, die nach Süden ziehen, etwa vierzig große und kleine Tiere. Grönlandwale sind Bartenwale, die sich von Krill und anderen kleinen Tierchen ernähren. Sie werden bis zwanzig Meter groß.«
»Das merke ich mir doch nicht«, brummelte Andrew und fügte laut hinzu, als der Schiffsarzt zu ihm herübersah: »Und warum jagt man sie, Sir?«
Der Master und der Schiffsarzt erklärten, sich mitunter ins Wort fallend, dass vor allem die dicke Speckschicht, die die warmblütigen Säugetiere vor der Kälte des arktischen Wassers schütze, begehrt sei. Aus der Zunge und dem weichen Speck könne man den weißen Tran drücken, der ein schmackhaftes Speiseöl abgebe. Aus dem festen Speck koche man den braunen Tran heraus, und aus dem Bodensatz des Kessels könne man Schmierseife gewinnen. Die ausgesottenen Speckstücke, Schwanz und Flossen nehme man zum Leimsieden. Und aus dem Fischbein der Knochen könne man Schmuck und Modelle schnitzen oder die Stäbe für die Mieder der Damen.
»Kann man das Fleisch auch essen?«, wollte David wissen.
Der Master konnte Auskunft geben. »Ja, es schmeckt etwas modrig und ölig. Die Eskimos mögen es, sie schneiden auch die Haut in Stücke und lutschen sie aus.«
Inzwischen waren sie näher herangekommen und sahen, wie die grauschwarzen Kolosse mit ihrer riesigen Schwanzflosse, die in zwei Spitzen auslief, auf das Wasser schlugen, wegtauchten und unglaublich lange unter Wasser blieben, ehe sie mit lautem Platschen wieder auftauchten und große Wasserstrahlen in die Luft bliesen.
»Warum spritzen sie das Wasser hoch, Mr. Lenthall?«
»Mr. Harland, die Wale saugen unter der Oberfläche die kleinen Garnelen mit dem Wasser ein und drücken das Wasser durch die Barten wieder heraus. Die Barten sind eine Art sehr langer und dichter Zähne, wie unzählige Zinken eines riesigen Kammes. Sie halten den Krill zurück, wenn das Wasser rausgedrückt wird. Wenn die Wale wieder auftauchen, blasen sie die verbrauchte Luft aus, die dampft. Sind die Atemlöcher noch unter Wasser, dann stiebt eine Fontäne mit in die Luft. Sie verrät den Wal schon auf Meilen den Walfängern, die ihm nachstellen.«
David sah auf die vielen Wale, die keine Scheu vor der Exeter hatten. Die riesigen Tiere schienen mit ihrem gewölbten Oberkiefer die Zuschauer anzugrinsen. Die kleinen Jungwale spielten in der Nähe ihrer Muttertiere. Eines saugte an der Mutter, die sich auf die Seite gelegt hatte. Trotz ihrer Größe wirkten die Grönlandwale in ihren Bewegungen leicht und elegant.
Überall drängte sich die Mannschaft an die Reling und sah dem lebhaften Treiben zu. Die Offiziere duldeten die Unterbrechung der Tagesroutine. Bei über zweihundert Seeleuten war viel Erfahrung versammelt. Die einen erzählten von den Zahnwalen, die sich von anderen Fischen ernährten. Jemand wollte den Kampf eines Grindwales mit einem riesigen Tintenfisch beobachtet haben. Andere hatten Blauwale von über dreißig Meter Länge im nördlichen Pazifik gesichtet. Wieder andere waren auf Walfängern gefahren und berichteten von der gefährlichen Jagd. Als die Geschichten immer haarsträubender wurden und die Wale vorbeigezogen waren, meldete sich der Kapitän: »Mr. Morsey, lassen Sie bitte die Mannschaften wieder an ihre Arbeit gehen. Bitte signalisieren Sie dem Konvoi, er soll mehr Segel setzen. Wir wollen vorankommen.«
Die nächste Nacht war für David wieder kurz. Im Traum war er in Portsmouth bei Onkel und Tante. Sie saßen am Tisch, und die Tante legte ihm die Hand auf die Schulter. Warum drückte sie so stark und schüttelte ihn?
»Gleich acht Glasen der Hundewache, Sir«, flüsterte der Steward.
David fuhr mit dem Kopf hoch. »O Gott, wieder die Morgenwache ab vier Uhr!«
Er tastete sich im Halbdunkel zu Schuhen, Jacke und Mantel, spülte den Mund aus, wischte sich aus dem Holzzuber etwas kaltes Wasser ins Gesicht, griff sich einen Zwieback und trottete zum Niedergang.
An Deck war es noch stockdunkel. David konnte zunächst nicht einmal das kleine Kompasslicht erkennen. Als sich seine Augen etwas an die Dunkelheit gewöhnt hatten, ahnte er die schwarzen Schatten des Rudergängers und des Wachhabenden mehr, als dass er sie sah. Langsam tastete er sich zu ihnen. Es war wieder Leutnant Kelly, den er ablösen musste.
»Sie sind früh dran, David, da kriege ich vielleicht noch eine Mütze voll Schlaf. Keine besonderen Vorkommnisse, Wind Nordwest zu Nord, auffrischend in der letzten Stunde, Kurs Südost zu Süd, Fahrt vier Knoten, Barometer unverändert.«
An Deck war es unruhig geworden. Leises Trappeln, Schlurfen, Gemurmel, Gelächter hier und da verrieten, dass die Mannschaften ablösten. An Davids Seite tauchte eine kleine Gestalt auf.
»Gilbert, Sir, zur Stelle.«
»Ist gut, John, beobachte das Stundenglas, läute acht Glasen und dreh es um. Ich geh die Runde, ob alles auf Station ist.«
Vorsichtig stieg David vom Achterdeck hinunter und ging an der Backbordseite zum Vordeck, bemüht, aufgeschossenen Tauen, Geschützlafetten und ähnlichen Hindernissen auszuweichen. Hier und da hockten kleine Gruppen, duckten sich vor dem kalten Wind und warteten auf Befehle. Die Ausgucke meldeten alles klar. Auf dem Vordeck flüsterte einer leise auf Deutsch: »Guten Morgen, Sir. Wieder eine lausig kalte Nacht. In der Karibik war die Morgenwache angenehmer.« Das war Wilhelm Hansen aus Dithmarschen, Toppgast von der Shannon und treuer Gefährte seit Davids Dienstbeginn in der Flotte.
»Ja, William, da war es angenehmer und auch spannender. Gefechte, Prisen, Verfolgungsjagden.«
»Aber auch gefährlicher, Sir. Denken Sie an den kleinen John und die anderen, die wir mit den Füßen voran der See übergeben haben. Mir ist ein ruhiger Segeltörn lieber. Aber Offiziere denken da wohl anders.«
David war ein wenig irritiert. Sicher, Hansen war so vertraut mit ihm, dass er das sagen durfte. Stimmte es aber auch? Na ja, er hatte um John und Richard Baffin und all die anderen getrauert. Aber die Kämpfe hatten ihm auch irgendwie Erregung, Freude, Stolz, Genugtuung vermittelt. Wenn der Magen nicht mehr vor Angst verkrampfte, wenn dann der Gegner zu sehen war und bekämpft werden konnte, dann hatte ihn immer ein Rausch erfasst. Er hatte das Gefühl der eigenen Kraft, der Bewährung genossen. Und die Anerkennung der Kameraden und des Kapitäns hatte ihn beflügelt. War das bei den Seeleuten anders als bei Offizieren?
Die Schiffsglocke läutete ein Glasen. David schob die Gedanken beiseite. Sie waren ihm unbequem. Er plauderte mit William noch etwas über Ereignisse der vergangenen Tage und wandte sich zum Gehen. Vom Bug rief eine leise Stimme: »Licht steuerbord voraus, Sir!«
Nein, nicht schon wieder, schoss es David durch den Sinn, und er griff mit der Hand an ein Stag. Ihm war flau im Magen. »William, sieh nach, was da ist!« Er ging langsam hinterher. Wenn zwei etwas sahen, musste er sich darum kümmern. Aber hoffentlich ...
»Ein Licht, Sir! Zwei Strich steuerbord, Entfernung unsicher, vielleicht ein bis anderthalb Meilen.« Williams Stimme verriet keine Erregung. Dann war es wohl nicht zu ändern.
»Geh zum Ruder, William. Sag den Wachen, sie sollen den Ausguck verdoppeln und absolute Ruhe halten, nicht glasen. Bring mir das Nachtglas und die Flüstertüte mit. John soll auch herkommen.«
»Aye, aye, Sir!«
David stiefelte langsam zum Bug.
Da vorn war in der klaren Nacht tatsächlich ein winzig kleiner Lichtschein zu erkennen. Bewegte sich das Licht? Anderthalb Meilen konnten es sein, aber das war in der Nacht schwer zu schätzen.
»Hat sich die Entfernung verringert?«, fragte er den Ausguck.
»Nein, Sir.«
Also wahrscheinlich ein Schiff auf annähernd gleichem Kurs.
Zwei Gestalten huschten heran. William reichte ihm das Nachtglas. David richtete es auf den Lichtschein und justierte es vorsichtig. Eine nicht abgedeckte Laterne und – im Nachtglas auf dem Kopf stehend – die Silhouette eines Decks. Dichter über dem Wasser als ihr eigenes. Ein kleineres Schiff vermutlich.
»Sieh einmal durch«, sagte er zu William.
Der nahm sich Zeit. »Ich tippe auf einen Schoner, Sir, aber es ist noch nicht viel zu erkennen.«
David entschied, noch etwas zu warten, damit er beurteilen konnte, ob sie sich dem Licht näherten. »Behalt das Licht im Auge, William! John soll es mir melden, wenn zu erkennen ist, ob wir uns nähern. Ich gehe zum Ruder und komme dann wieder.« Im Umdrehen hörte er noch das stereotype »Aye, aye, Sir!«.
Die Segel standen gut. Die Wachen waren auf ihren Posten. Der Rudergänger hatte nichts zu melden. David ließ loggen. Viereinhalb Knoten bei reduzierter Besegelung. Ob der Konvoi wohl mithielt? Nun musste er wieder zum Bug, wo Entscheidungen warteten. Noch zögerte er, aber dann ging er nach vorn.
»Irgendwelche Veränderungen?«
»Wir nähern uns langsam, Sir. Im Nachtglas waren Gestalten zu erkennen, die sich vor dem Licht bewegten«, antwortete William.
Der Ausguck meldete ein zweites Licht. David ließ sich das Nachtfernglas geben. Tatsächlich. Neben der ersten Laterne war eine zweite entzündet worden, die langsam fortgetragen wurde. Bewegungen waren zu erkennen, wahrscheinlich Seeleute der Nachtwache.
»Sir, ich habe zwischendurch auch Geräusche gehört. Es klang wie Singen und Lachen«, meldete der Ausguck.
David nahm das Sprachrohr und hielt es mit dem Mundstück ans Ohr. Das andere Ohr stopfte er mit dem Finger zu.
Ja, das war Gesang, auch gepfiffen wurde die Melodie. Jetzt klang wieder Gelächter auf. Eine neue Melodie ertönte. Verdammt, die kenne ich doch, dachte David. Angespannt lauschte er. Ja, das hatte ihre Wache gesungen, als sie auf der Brigg aus Rhode Island mithilfe des Deserteurs überwältigt worden waren. Es war ein Spottlied auf König Georg.
»William, horch doch mal! Kennst du den Song?«
William nahm die Flüstertüte und schloss die Augen, während er horchte. »Auf der verdammten Brigg vor der Yukatanstraße, da haben sie uns die Ohren damit vollgegrölt. ›König Georg, deine Zeit ist vorbei. Wir zahlen keinen Zoll und sind frei ...‹, so ähnlich ging es weiter.«
»Du hast ein gutes Gedächtnis, William. An den Text konnte ich mich nicht mehr erinnern. Aber an Bord eines britischen Kriegs- oder Handelsschiffes wird man das Lied wohl kaum hören. Fragt sich bloß, ob es ein Kaper oder ein Blockadebrecher ist.«
Der Melder tauchte auf. »Gleich drei Glasen, Sir.«
»Ist gut. Nicht ausläuten.« David presste das Nachtglas wieder an das rechte Auge. Das Schiff war jetzt weniger als eine Meile entfernt. In einer knappen Stunde mussten sie gleichauf sein. Vor dem Lichtschein sah er zwei dunklere Schatten. Er justierte das Fernglas genauer und war jetzt sicher. »Das sind zwei Jagdgeschütze am Stern, abgedeckt mit Spritzplanen.« Er ließ William seine Beobachtung bestätigen. Dann war es also kein Handelsschiff, sondern wahrscheinlich ein Kaper.
»Wollen Sie ›Klarschiff‹ ausrufen, Sir?«
Dazu sei noch Zeit, antwortete David und rief leise nach dem Melder. »John, du gehst zur Kajütenwache und lässt den Kapitän wecken. Du sagst ihm, ich bitte um Erlaubnis, den Kurs vier Strich nach steuerbord zu ändern. Wir haben wahrscheinlich einen Kaper eine knappe Meile voraus, und ich möchte die Nachtseite gewinnen. Alles klar?«
Mr. Gilbert wiederholte, musste korrigiert werden und lief los. David ging zum Ruder, nachdem er William und dem Ausguck eingeschärft hatte, jede Änderung sofort zu melden.
David brauchte nicht lange zu warten. Der Kapitän kam bei dieser Meldung selbst an Deck. »Na, Mr. Winter«, fragte er schläfrig und mit skeptischem Unterton, »dann berichten Sie mal.«
David meldete alles der Reihe nach. Kapitän Brisbane brummte und murmelte dann: »Sie und Mr. Gilbert begleiten mich zum Bug.« Dort spähte er lange und wortlos durch das Nachtglas.
»Sie kannten das Rebellenlied?«
»Aye, Sir. Toppgast Hansen hat sich auch erinnert.«
»Ich halte das für einen großen Schoner mit zwei Heckgeschützen. Ihr Vorschlag, den Kurs vier Strich nach steuerbord zu ändern, ist richtig. Veranlassen Sie das. Die Segel sollen ohne laute Befehle nachgetrimmt werden. Mr. Gilbert, Sie bitten den Master und den Ersten Leutnant an Deck!« Wiederholungen, Bestätigungen, die beiden huschten los.
Der Master und Mr. Morsey erschienen. Der Abstand beider Schiffe betrug gut sechshundert Meter. »Es ist gleich vier Glasen. Lassen Sie Klarschiff ausführen, ohne Laut und ohne Licht. Beide Seiten doppelte Ladung mit Kugeln.« Wieder dauerte es nur wenige Minuten, bis die Mannschaften an Deck strömten. »Lassen Sie die Marssegel setzen und die Ausgucke besetzen, Mr. Morsey. Wir wollen jetzt heran, ehe sie uns sehen.«
»Mr. Hope, legen Sie bitte einen Kurs fest, der uns hundertfünfzig Meter längsseits bringt.«
David stand auf seinem Gefechtsposten an Achterdeck und beobachtete die lautlose Annäherung. Noch dreihundert Meter, die Dunkelheit lichtete sich etwas. Zweihundert Meter, man konnte den Schiffskörper schon als dunkleren Schatten erkennen. Hundertfünfzig Meter, schimmerten da nicht die Segel als hellere Flecke? Hundert Meter. Auf dem anderen Schiff erschallten Rufe. Kapitän Brisbane nahm das Sprachrohr: »Seiner Majestät Schiff Exeter, streichen Sie die Segel. Ich schicke ein Boot!«
Keine Antwort! Die Exeter schloss zum anderen Schiff auf.
»Sir, die streichen die Segel nicht, die zurren die Planen von den Geschützen. Acht Neunpfünder, schätze ich.« Zwei Raketen zischten von dem großen Toppsegelschoner nach oben. Weiß über blau. »Sir, das Signal wird erwidert, weiß über blau, drei Meilen backbord querab.«
Der Kapitän rief: »Fertig machen zur Breitseite. Feuer!«
Die alte Exeter bebte unter dem Rückstoß. Einige Geschosse zischten vor dem Schoner in die See. Andere fauchten durch die Takelage, aber die meisten krachten in den Rumpf und fetzten Holzsplitter in die Luft. Drüben blitzte es an einigen Stellen auf. Knall und Einschlag folgten dicht aufeinander. Die schlugen zurück! Schreie und Flüche.
»Unabhängig feuern! Oberdeckbatterie Traubengeschosse!«
Die Melder flitzten los.
Die zweite Salve stotterte heraus. Hurrageschrei! Der Vormast des Schoners neigte sich.
»Mr. Barnes, lassen Sie Ihre Scharfschützen auf die Rudergänger, Offiziere und Geschützbedienungen feuern!«
Fast gleichzeitig rief der Ausguck: »Toppsegelschoner drei Meilen backbord querab!«, und der Master schrie: »Achtung, die Marsstenge kommt runter!«
Sie sprangen zur Seite und brachten sich in Sicherheit. Dann liefen der Kapitän und Mr. Morsey an die Reling. Da, ein Toppsegelschoner, fast ein Schwesterschiff ihres Gegners, nahm Kurs auf den Konvoi.
Wieder Hurragebrüll.
»Sein Hauptmast fällt auch! Wir haben ihn!«
»Mr. Morsey, lassen Sie Feuer einstellen, Mr. Hope, legen Sie uns auf einen Kurs, der uns zwischen den Konvoi und den anderen Schoner bringt.«
Mr. Hope bestätigte und rief Befehle. Aber Mr. Morsey wandte ein: »Sir, noch fünf Minuten, und sie müssen die Flagge streichen.«
»Mr. Morsey, Sie wissen so gut wie ich, dass die Bark Niobe im Konvoi vollgestopft ist mit Kapitänen und Maaten von Kaperschiffen für die Gefangenenhulks und -lager in England. Was meinen Sie, was passiert, wenn der Schoner dort die Niobe kapert und die Gefangenen befreit? Dann sind es schon zwei Schiffe, die Jagd auf den Konvoi machen, und beide können wir mit der alten Exeter nicht in Schach halten. Also führen Sie den Befehl aus!« Die Schärfe im Tonfall war nicht zu überhören.
Mr. Morsey zuckte zusammen. »Aye, aye, Sir.«
Schwerfällig drehte die Exeter auf den neuen Kurs. Der Schoner lag tiefer im Wasser. Aber auch auf der Exeter mussten Taue gespleißt, Verwundete weggebracht und Trümmer über Bord geworfen werden.
»Der Schoner heißt Revenge, Sir«, meldete David.
Mr. Hope sagte dem Kapitän, dass sie den Schoner nicht mehr vor dem Konvoi abfangen könnten. »Er läuft besser mit dem Wind querab als wir, Sir. Wir müssen froh sein, wenn wir etwa zur selben Zeit beim Konvoi sind.«
»Mr. Winter, lassen Sie dem Konvoi signalisieren, dass er vier Strich nach steuerbord drehen und dichter zusammenrücken soll. Dass wir zu Hilfe kommen und sie selbst etwas zur Verteidigung tun müssen, werden sie ja wohl wissen«, setzte der Kapitän hinzu.
Der Schiffsarzt trat zu ihnen. »Sir, zwei Schwerverletzte, vier leichter Verwundete. Ich hoffe, dass ich alle durchbringen kann.«
»Danke, Mr. Lenthall, ich bin überzeugt, Sie tun Ihr Bestes.«
Der Konvoi segelte backbord voraus auf neuem Kurs. Das Kaperschiff lief steuerbord voraus in knapp zwei Meilen im Winkel von etwa fünfundvierzig Grad auf den Konvoi zu. Die Bark Niobe hielt noch Anschluss an den Geleitzug. Die Exeter hatte alle Segel gesetzt, aber der zweite Schoner war schneller. Er würde den Konvoi Minuten vor ihnen erreichen. Der Kapitän winkte den kleinen John heran: »Bestellen Sie Mr. Kelly, er soll mit den Buggeschützen Feuer eröffnen, sobald er in Reichweite ist.«
Als die Entfernung auf eine Meile geschrumpft war, donnerten die langen Zwölfpfünder am Bug los. Nicht schlecht! Die Einschläge waren nur etwas zu kurz. Vielleicht würde die nächste Salve schon treffen. »Sir, ich habe den Eindruck, er hält auf die Niobe zu.«
»Es sieht fast so aus, Mr. Hope«, stimmte der Kapitän zu.
Im Konvoi begannen einige Schiffe zu feuern.
»Viel werden sie mit ihren Böllern nicht ausrichten, aber es wird ihnen Mut machen und den Gegner hoffentlich irritieren«, murmelte der Master.
»Treffer achtern beobachtet«, meldete der Ausguck.
Kapitän und Master nahmen die Fernrohre an die Augen. »Das Feuer liegt nicht schlecht. Auch der Konvoi hat ihnen ein paar Löcher in die Segel verpasst.«
Das Kaperschiff stand jetzt vierhundert Meter querab vom Konvoi und etwa fünfhundert Meter drei Strich steuerbord vor ihnen.
»Mr. Hope, sobald sie das Feuer auf die Niobe eröffnen, möchte ich, dass Sie kurzzeitig acht Strich nach steuerbord abfallen, damit unsere Backbordbatterien feuern können. Mr. Morsey, sagen Sie den Batterieoffizieren Bescheid.«
Knapp fünf Minuten später wurden die Befehle ausgeführt. Die Salve lag gut. Holz splitterte an Deck des Kapers, am Vormast fiel eine Stenge. Aber der Schoner lief weiter in spitzem Winkel auf die Niobe zu und deckte ihr Deck mit Traubengeschossen ein.
»Noch einmal abfallen und eine Salve!«
Das reichte wohl. Der Schoner änderte den Kurs und hielt von ihnen ab, steuerte aber eine Position an, von der er das Heck der Niobe angreifen konnte.
Die Masse des Konvois war querab und segelte einen Kurs, der eine halbe Meile an der Revenge vorbeiführte, die noch immer entmastet gut zwei Meilen entfernt lag.
»Mr. Hope, wir müssen den Schoner vom Konvoi abdrängen. Legen Sie uns auf Backbordkurs. Mr. Morsey, die Geschütze sollen selbstständig feuern, sobald sie das Ziel auffassen können.«
»Deck ho, die Martha nimmt Kurs auf den ersten Schoner!«, rief laut der Ausguck.
»Sind die wahnsinnig?«, fluchte der Kapitän und lief zur Reling. »Mr. Winter, entern Sie auf und melden Sie, was da los ist.«
David hängte sich das Teleskop über die Schulter und hastete die Wanten empor. Der Ausguck rückte zur Seite, und David konnte im Fernrohr erkennen, dass die Brigg Martha auf den Schoner zusteuerte und nur eine halbe Meile entfernt war. Auf ihrem Deck machten sie ein Boot fertig, und jetzt feuerten sie auch eine Kanone auf die Revenge ab.
David meldete zum Deck. Der Kapitän ließ Signale setzen, dass Martha die Aktion sofort abbrechen solle, aber David konnte keine Wirkung erkennen. Die Brigg behielt ihren Kurs auf den Schoner bei, der ihr Feuer anscheinend nicht erwiderte. Jetzt setzten sie ein Boot aus.
»Sir, Mr. Blake, der Kapitän der Martha, ist ein unternehmenslustiger junger Mann. Er wird den Schoner entern wollen«, sagte der Master.
»Das fürchte ich auch. Er weiß nicht, was er riskiert, und wir können nicht helfen, sonst geht der andere Schoner gleich wieder auf die Niobe los.«
Aber die ständig wiederholten Weitschüsse der Exeter zeigten Wirkung. Auf dem Schoner waren jetzt mehrere Stengen heruntergekracht, und eine hing an seiner Steuerbordseite in der See und zog seinen Bug herum.
»Abfallen! Steuerbordbatterie eine Salve!«
Nun hatte der Schoner wohl genug. Er drehte ab und floh.
»Wir müssen ihm noch etwas folgen, bis er der Niobe nicht mehr gefährlich werden kann. Dann will ich einen Kurs, der uns schnellstens zum ersten Schoner zurückbringt, Mr. Hope.«
»Aye, Sir.«
»Mr. Winter!«, rief der Kapitän jetzt. »Was ist denn los? Sie sollen melden, was Sie sehen!«
»Boot der Martha hat am Schoner angelegt. Bootsbesatzung hat geentert. Mehr ist nicht zu erkennen, Sir. Entfernung jetzt drei Meilen.«
»Verdammt, dieser verrückte Mr. Blake wird was erleben, wenn ich ihn vor mir habe«, fluchte der Kapitän vor sich hin.
Nach zehn Minuten konnte die Exeter wenden und sich um die Revenge kümmern. »Lassen Sie auch die Royals setzen, Mr. Morsey. Wir brauchen ja fast eine halbe Stunde, bis wir eingreifen können.«
Während sie sich ihrem Ziel näherten, erhielten die Wachen nacheinander Frühstück. David hatte sich einen Becher Kaffee bringen lassen und kaute einen Zwieback. Seine Wache war noch nicht vorbei. Im Fernglas sah er, wie auf der Revenge fieberhaft gearbeitet wurde, um eine Notbesegelung zu errichten. Von der Bootsbesatzung der Martha war nichts zu entdecken.
Kapitän Brisbane marschierte ruhelos auf dem Achterdeck hin und her. Die Brigg Martha lag noch in der Nähe des Kapers.
»Sie signalisieren, Sir. Entermannschaft überwältigt.«
»Das musste ja so kommen«, schimpfte der Kapitän. »Alle Batterien feuerbereit mit Kugeln.«
Auf dem Deck des Kapers konnte man eine Gruppe abgetrennt auf dem Vordeck stehen sehen, etwa acht bis zehn Mann. Das war wohl die Entermannschaft.
Sie waren bis auf zweihundert Meter heran. Von der Revenge rief jemand mit dem Sprachrohr etwas zu ihnen herüber.
»Ruhe an Deck! Man versteht ja nichts«, befahl der Kapitän. Der Ruf wurde wiederholt.
»Sir, wir sollen abhalten, sonst hängen sie erst den Kapitän der Martha und dann seine Leute.«
Man sah, wie auf der Revenge ein Brett über die Reling geschoben wurde. An seinem Fuß stand ein Mann. Von seinem Hals führte ein Tau zur Rahnock.
»Sir, wir müssen abdrehen, sie haben uns in der Hand«, stammelte Mr. Morsey entsetzt.
Der Kapitän befahl: »Alle Geschütze tief auf den Rumpf zielen!« Erst dann wandte er sich dem Ersten Leutnant zu. »Mr. Morsey, ein Offizier Seiner Majestät darf nie einer Erpressung von Piraten nachgeben. Um keinen Preis! Sonst nimmt es kein Ende.« Er rief Mr. Barnes, den Leutnant der Seesoldaten, heran. »Mr. Barnes, haben Sie Scharfschützen, die die Qualen des Opfers abkürzen, wenn die Piraten ernst machen?«
»Jawohl, Sir!«
Sie waren fast querab, als der Mann vom Brett gestoßen wurde und am Tau zuckte. Musketen krachten.
»Feuer!«, brüllte Kapitän Brisbane. Der Schoner legte sich unter den Einschlägen über. An seinem Deck war ein Handgemenge zu erkennen. Dann wurde ein weißes Laken geschwenkt.
»Mr. Morsey, Sie und Mr. Barnes entern den Piraten. Gehen Sie ohne Nachsicht vor. Kapitän und Maate zuerst herüberbringen, dann die Mannschaft!«
Zwei Kutter legten ab und pullten zu der ihnen abgewandten Seite der Revenge. Die Enterer trieben die Besatzung des Schoners zusammen, sonderten einige Männer aus und stießen sie zum Kutter. Die Mannschaft der Martha bestieg ihr eigenes Boot und pullte zur Brigg zurück.
Als der Kutter die ersten Gefangenen der Revenge an Bord gebracht hatte, fragte Brisbane: »Wer ist der Kapitän?«
Ein hagerer, blonder Mann trat vor. »Ich bedauere, dass ich nicht das Recht habe, Sie zu hängen«, sagte Brisbane grimmig. »Aber hängen werden Sie für diesen abscheulichen Mord. Bootsmann, legen Sie den Kerl in Eisen!«
Der Kaperkapitän schrie voller Zorn: »Ich bin Kapitän eines legalen Kaperschiffes und verlange, als gefangener Offizier behandelt zu werden!«
»Sie sind ein Pirat und Mörder und können gar nichts verlangen. Schafft den Kerl weg!«, herrschte Brisbane den Bootsmann an.
»Ich verfluche Sie, Sie Scherge eines Tyrannen!«, rief der Kaperkapitän, als er abgeführt wurde.
Kapitän Brisbane ließ die Maate der Revenge von der Mannschaft absondern und alle nach gründlicher Durchsuchung in getrennte Räume unter Deck einsperren. »Doppelte Wachen vor jede Tür und an jeden Niedergang! Täglich werden die Räume und die Gefangenen genau durchsucht. Mr. Hope, sobald unser Enterkommando wieder an Bord ist, bringen Sie uns schnellstens zum Konvoi zurück. Ich gehe in meine Kabine.« Brüsk wandte er sich ab.
»Was hat der Käptn?«, fragte Mr. Morsey leise den Master.
»Er kannte den Kapitän der Martha, hatte ihn in New York zum Essen eingeladen. Daher wusste er, dass dieser jung verheiratet war und in New York die Nachricht von der Geburt des ersten Sohnes erhalten hatte. Nun grämt sich der Kapitän, dass er so handeln musste.«
Als David sich während der Freiwache etwas ausruhte, kam der Sekretär des Kapitäns zu ihm. »Mr. Winter, die Maate des Kapers sollen verhört werden. Der Kapitän bittet Mr. Bates und Sie, das mit mir durchzuführen.«
»Ist Mr. Bates wieder gesund?«
»Ja, ab heute kann er wieder Dienst aufnehmen. Er sieht gerade das Logbuch des Kaperers ein. Er wartet im Kartenraum des Kapitäns auf uns.«
Sie ließen sich die drei Maate einzeln vorführen. Einer war sehr feindselig und zu keiner Auskunft bereit. Die anderen hatten resigniert und waren mitteilsamer. Die Revenge war einen Tag vor der Exeter aus Salem ausgelaufen und hatte den anderen Schoner, der Freedom hieß und bereits drei Wochen in See war, vor zwei Tagen getroffen. Ja, sie hatten die Nachricht erhalten, dass der Konvoi nach England unterwegs sei und dass die Niobe gefangene Kapitäne und Maate an Bord habe. Sie wüssten immer, wer aus New York auslief. Die Patrioten dort gäben die Nachrichten weiter.
Ihr Kapitän hätte um keinen Preis aufgeben wollen. Er habe seine Frau und eine kleine Tochter verloren, als Falmouth im Oktober 1775 von den Briten beschossen worden war. Seine Frau war hochschwanger und muss ohnmächtig geworden sein, als sie vor der britischen Kanonade flüchten wollte. Seitdem halte den Kapitän nur noch sein Hass auf die Briten aufrecht.
Wie furchtbar, dachte David. Ausgerechnet Kapitän Brisbane, der den Angriff auf Falmouth als Barbarei verurteilt und sich deswegen fast in Saint Augustine duelliert hatte, musste nun die Folgen dieses Angriffs mittragen. Was würde er sagen, wenn er erführe, dass er einen Leidtragenden des Angriffes britischer Schiffe auf Zivilisten zum Gericht und damit zum Galgen bringen musste?
Zwei weitere Tage vergingen. Der gefangene Kapitän sei im Gegensatz zum ersten Tag jetzt beängstigend teilnahmslos, hieß es. Kapitän Brisbane befahl den Leutnant der Seesoldaten zu sich und ging mit ihm ins Vorschiff zu dem Gefangenen. Er sprach allein mit ihm. Der Seesoldat und der Leutnant warteten vor der geschlossenen Tür. Als Kapitän Brisbane heraustrat, zeigte sein Gesicht keine Regung. »Mr. Barnes, lassen Sie Kapitän Manson die Ketten abnehmen, und führen Sie ihn zum Quartier seiner Maate. Er hat sein Ehrenwort gegeben, dass er sich seinem Richter nicht entziehen wird.«
»Wohin sollte er auch fliehen, Sir?«, wandte Mr. Barnes ein.
»Er sagte wörtlich, er wolle sich seinem Richter nicht entziehen. Dabei wollen wir es belassen, Mr. Barnes.«
An den folgenden Tagen sah man den Kaperkapitän, wenn die Gefangenen an Deck gehen durften. Er hielt sich meist von allen fern, stand an der Reling und blickte in die Ferne. Als Mr. Bates mit David die Nachmittagswache hatte, überraschte sie ein heftiger Schneeschauer. Es gab viel Unruhe an Deck, als Segel geborgen und die Gefangenen unter Deck getrieben werden mussten. Eine halbe Stunde später war alles vorbei.
»Sir, die gefangenen Maate klopfen dauernd an ihre Tür«, berichtete der Melder.
»David, gehen Sie nach unten und fragen Sie, was los ist.«
Als David den Posten die Tür öffnen ließ und fragte, was denn sei, wurde ihm gesagt, dass Kapitän Manson vorhin bei dem Trubel nicht mit in ihren Raum gegangen sei. David fragte im Quartier der gefangenen Mannschaften nach, aber dort wusste man von nichts. Mr. Bates ließ das Deck und alle Räume unter Deck absuchen, aber ohne Ergebnis. Dann ging er zu Kapitän Brisbane.
Der schien nicht überrascht. »Lassen Sie mir bitte bringen, was Kapitän Manson an persönlicher Habe in der Gefangenenkammer zurückgelassen hat.«
Es war nur ein kleiner Beutel.
Als der Master zum Kapitän kam, um eine Kursänderung genehmigen zu lassen, hielt der ein Blatt Papier in der Hand.
»Kapitän Manson ist über Bord gesprungen. Er schreibt, dass er seine Handlung zutiefst bereue, nachdem er Gelegenheit hatte, darüber nachzudenken. Er hoffe, dass ihm seine Frau vergeben werde, die Quäkerin war und jede Gewalt verabscheut habe. Aber er wolle seinem Land, er schreibt wirklich ›seinem Land‹, die Schande ersparen, an einem britischen Galgen zu sterben. Er wolle sich dem Gericht Gottes stellen.«
»Möge seine Seele Frieden finden«, sagte Mr. Hope.
Erlebnisse mit Haddington
Februar bis April 1777
»Mr. Harland, signalisieren Sie dem Konvoi: Einlaufen in eigener Verantwortung!« Andrew Harland, Signal-Midshipman, bestätigte den Befehl und suchte die Flaggen heraus, die aufgesteckt werden mussten. Er schimpfte still vor sich hin, weil ihm die Offiziere der Freiwache im Weg standen, die an diesem mäßig kalten Vormittag auf die lang ersehnte Küste der Grafschaft Kent starrten. Aber die Themseufer sahen so reizlos aus wie fast immer.
»Ich hätte mir ein anderes Dock gewünscht als ausgerechnet Sheerness, Mr. Hope«, klagte Mr. Morsey, ohne den Blick von den Kriegsschiffen zu wenden, die auf dem Ankerplatz der Flotte an der Mündung des Medway lagen.
»Das kann ich mir denken«, antwortete der Master. »Sheerness ist ein lausiger Platz, wenn man den Landgang genießen will. Da wohnen ja kaum die Dockarbeiter, und die paar Kneipen sind dreckig und zapfen schlechtes Bier. Wenn man nicht den Ärger mit dem seichten Fluss hätte, würde ich der Niobe lieber nach Chatham folgen.«
»Warum segeln die weiter flussaufwärts und machen nicht mit uns in Sheerness fest?«
»Sheerness hat keine Kasernen für die Seesoldaten und keine Gefangenenhulks. Wo sollte die Niobe da ihre Gefangenen loswerden?«, gab der Master Auskunft. »Lausiges Dock«, murmelte der Erste Offizier dann noch einmal und wandte sich ab, um die Kursänderung nach Sheerness anzuordnen.
Eine Ozeanüberquerung lag hinter ihnen, die abgesehen vom Gefecht mit den Schonern so ereignislos war wie ihr Zielhafen reizlos. Einige raue Winde in der Irischen See, der obligatorische Nebel im Kanal und vorgestern noch eine Flaute, aber sonst nur Routine. »Wenigstens ausschlafen konnte ich in letzter Zeit«, tröstete sich David Winter, der zum Themseufer spähte, um Erinnerungen an sein erstes Einlaufen in die Themsemündung vor nun bald drei Jahren wachzurufen.
»David, fertig machen, unsere Wache ist gleich dran!«, rief ihm Mr. Bates zu. David lief schnell ins Cockpit, holte sich den warmen Mantel und trank noch einen Schluck aus der Kanne. Wache oder nicht, jetzt mussten doch alle an Deck für die Anlegemanöver. Und als er an Deck dann die Befehle brüllte, um die Segel einzuholen, die Trossen bereitlegen zu lassen und die Festmacher in Trab zu bringen, dachte er wieder daran, wie fremd ihm das alles erschienen war, als die Shannon auslief. Und nun waren Schiffe seine Heimat. Viel mehr als die paar schmutzigen Häuser, die sich um die Werftgebäude herumkauerten.
Als der Kapitän vom Hafenadmiral zurückkehrte, ließ er Offiziere und Deckoffiziere in seine Kajüte rufen.
»Meine Herren! Die Anson liegt in Chatham und ist erst in drei Wochen zur Übernahme bereit. Wenn wir in etwa sechs Tagen mit der Übergabe der Exeter fertig sind, kann für die Stammbesatzung Urlaub gewährt werden. Wir können aber nur die Leute in Urlaub schicken, bei denen wir sicher sind, dass sie zurückkommen. Der Hafenadmiral hat mir den Mangel an Seeleuten für die Flotte sehr eindringlich geschildert. Die Presskommandos der Rekrutierungsbehörde sind schon wieder unterwegs, und wer kann, versteckt sich vor ihnen. Von der alten Besatzung der Exeter lasse ich nur die Leute gehen, für die Sie mir garantieren können, meine Herren. Die anderen kommen auf die Hulk. Und jeder, der in Urlaub geht, soll Handzettel mitnehmen, mit denen wir Seeleute für die Anson anwerben. Für jeden Freiwilligen können wir sieben Pfund Handgeld zahlen. Zimmermanns- und Segelmachermaate können nur zwei Wochen in Urlaub gehen, dann brauche ich sie in Chatham wie die Herren Seeoffiziere.«
»Aye, aye, Sir!«, gab Mr. Morsey unbewegt von sich, aber sein enttäuschter Blick zu Mr. Bates verriet seine Gefühle.
Mr. Kelly wurde nachher an Deck noch deutlicher: »Verdammt! Zwei Wochen Urlaub. Davon sitze ich die Hälfte der Zeit in der Postkutsche. Und worauf habe ich mich die ganze Zeit in diesem lausigen Amerika gefreut?«
David fragte: »Wollten Sie nicht heiraten, Sir?«
»Ja, wollte ich eigentlich. Aber wie ich meine künftige Schwiegermutter kenne, braucht sie allein drei Wochen zur Vorbereitung einer Hochzeit. Verdammter Mist!«
»Seeoffiziere sollten erst heiraten, wenn sie einen Posten an Land in Aussicht haben, Hugh«, mischte sich Mr. Bates ein.
»Was soll der Quatsch, Robert? Dann kann man sich die Braut ja aus dem Altersheim holen. So lange will ich nicht warten!« Und er drehte sich um und ging zum Niedergang.
David musste an Susan denken, die große Liebe seiner ersten Jahre auf See. Jetzt war sie seit Weihnachten verlobt, und im Sommer wollte sie heiraten. Na ja, mit einem künftigen Lord bei den Horse Guards konnte ein kleiner Midshipman auch nicht konkurrieren. Er hätte am liebsten auch laut geflucht. Susans Vater war ein freundlicher, kluger Mann. Aber ihn jetzt noch in London besuchen, wie er es erbeten hatte, nein, das mochte er nicht. Lieber an die Stunden mit Denise denken! Es gab noch mehr Frauen, und er war noch jung.
»Mr. Winter, ich muss leider Ihre bedeutenden Gedankengänge stören.« Das war der Kapitän mit seinem ironischen Beiton. »Melden Sie sich bei meinem Sekretär. Er muss die Post fertig machen, die ich morgen zur Admiralität bringe, und er hat Ihre Hilfe bei der Formulierung der Handzettel erbeten, mit denen wir Seeleute anwerben wollen. Ich hoffe, Sie bringen auch den einen oder anderen Freiwilligen aus Portsmouth mit.«
»Ich werde mir Mühe geben, Sir.«
Auf dem Weg zur Kammer des Sekretärs lief ihm William über den Weg. »Na, William. Hast du gehört, dass es Landurlaub gibt? Wo wirst du hingehen?«
»Wo soll ich schon hin, Sir? Mit denen von der Exeter auf die Hulk. Da wird den ganzen Tag nur gesoffen. Und wenn ich nicht mehr zusehen kann, wie sie sich mit den Huren auf jedem freien Platz wälzen, dann werde ich mir auch eine greifen, ganz egal, was der Schiffsarzt nachher mit mir anstellt.«
Wie konnte ich bloß so blöd fragen?, dachte David. Nach Dithmarschen zu seiner Familie kann der William ja nicht. Und die Hulk war der Vorhof zur Hölle, wenn einer nicht völlig vertiert war.
»William, fahr mit mir nach Portsmouth. Im Lager meines Onkels ist für dich immer noch ein guter Schlafplatz frei. Meine Tante kann gut kochen. Und die Mägde werden dich verwöhnen. Abgemacht?«
»Sir, das wäre wunderbar. Aber ich bin doch ganz fremd für Ihre Leute. Das geht doch nicht.«
»Also, so fremd auch nicht. In meinen Briefen tauchst du schon auf. Red nicht länger. Du kommst mit! Ich weiß nur noch nicht, wann und wie wir von hier wegkönnen.« David sagte, er müsse zum Sekretär, und ging weiter. Williams dankbares Gestammel machte ihn verlegen. Und ganz sicher war er auch nicht, was Onkel und Tante zu seiner Einladung sagen würden.
Als der Kapitän am Abend des nächsten Tages aus London zurückkehrte, ließ er David rufen. »Man hat mich nach Ihnen gefragt, Mr. Winter. Können Sie sich denken, wer?«
»Nein, Sir.«
»Jemand, der sich gern an Sie erinnert und mit Freude hörte, wie Sie sich im Dienst bewährt haben. Ich traf den Herrn bei Mr. Stephens, dem Sekretär der Admiralität.«
»Mein Onkel, Sir?«
»Bei allem Respekt vor Mr. Barwick, in Portsmouth sicher ein angesehener Bürger, aber Mr. Stephens von der Admiralität würde mit ihm kaum Kaffee trinken und wohl auch nicht über Flottenangelegenheiten in seiner Gegenwart sprechen. Es war Mr. MacMillan, als Sekretär des Geheimen Beratungskomitees der Ostindischen Kompanie kaum weniger mächtig als Mr. Stephens, wie mir Admiral Brighton nachdrücklich versichert hat. Er gab mir einen Brief für Sie und erbat die Ehre Ihres Besuches morgen Nachmittag. Ich werde Sie mit Akten zur Admiralität schicken.«
»Muss ich zu Mr. MacMillan gehen, Sir?«
»Was Ihre Karriere angeht, wären Sie dumm, die Einladung abzulehnen. Was Sie als Mensch betrifft, so sollten Sie nicht leichtfertig eine uneigennützige Freundschaft zurückweisen.«
»Aye, aye, Sir.«