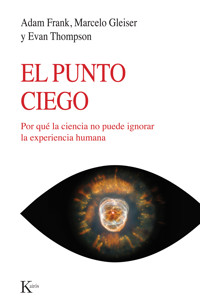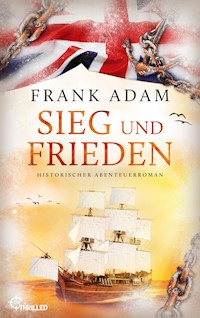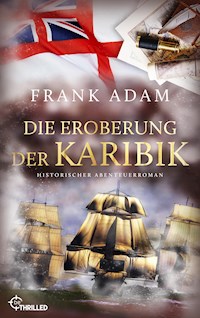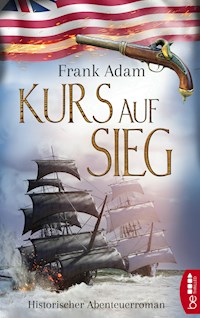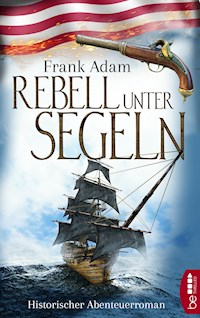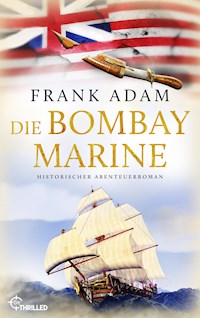
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Seefahrer-Abenteuer von David Winter
- Sprache: Deutsch
1783 herrscht ein Friedensvertrag zwischen England und Frankreich. Die britische Flotte wird drastisch reduziert und die meisten der königlichen Marineoffiziere damit zur Untätigkeit verdammt. Nicht so David Winter: Er erhält das Kommando auf einem neuen Schiff, das unter der Flagge der Ostindischen Kompanie segelt. Als Teil der sogenannten Bombay-Marine begibt sich David mit seiner Mannschaft auf Schatzsuche und jagt Piraten auf dem indischen Ozean. Er erlebt mörderische Kämpfe, leidenschaftliche Liebe und tödlichen Hass - während ihn dieses Kommando immer näher an seine Grenzen bringt ...
David Winters Abenteuer sind ein Spiegelbild seiner Zeit, des rauen Lebens in der Royal Navy, aber auch romantischer Gefühle, des heldenhaften Mutes und der Kameradschaft auf See. Vom Eintritt in die Royal Navy über die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges bis in die napoleonischen Kriege verfolgen wir David Winters Aufstieg vom Seekadetten bis zum Admiral.
Aufregende Abenteuer auf See, eingebettet in die faszinierende Geschichte der Marine.
Für alle Fans von C.S. Forester, Alexander Kent, Patrick O'Brian und Richard Woodman. Weitere Bücher von Frank Adam bei beTHRILLED: die Sven-Larsson-Reihe.
eBooks von beTHRILLED - spannungsgeladene Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Vorwort
Hinweise für den marinehistorisch interessierten Leser
Personenverzeichnis
Die Vorboten des Friedens
HEICS Guardian
Das Mädchen aus dem Totenreich
Der Enkel des Piratenkönigs
Im Schatten von Bombay Castle
Schatzsuche auf Balambangan
Entführung vor Arabiens Küsten
Der Generalgouverneur
Piraten vor Sumatra
Die Zeit des Kama
Nur ein Moment der Ewigkeit
Glossar
Über den Autor
Alle Titel des Autors bei beTHRILLED
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Über dieses Buch
1783 herrscht ein Friedensvertrag zwischen England und Frankreich. Die britische Flotte wird drastisch reduziert und die meisten der königlichen Marineoffiziere damit zur Untätigkeit verdammt. Nicht so David Winter: Er erhält das Kommando auf einem neuen Schiff, das unter der Flagge der Ostindischen Kompanie segelt. Als Teil der sogenannten Bombay-Marine begibt sich David mit seiner Mannschaft auf Schatzsuche und jagt Piraten auf dem indischen Ozean. Er erlebt mörderische Kämpfe, leidenschaftliche Liebe und tödlichen Hass – während ihn dieses Kommando immer näher an seine Grenzen bringt ...
Frank Adam
Die Bombay-Marine
Historischer Abenteuerroman
Vorwort
Für die meisten englischen Flottenoffiziere war die Friedenszeit nach 1783 eine Zeit erzwungener Untätigkeit an Land, die sie schwer ertrugen. Wir wissen das aus vielen Biographien, auch aus der Horatio Nelsons. Die Flotte war demobilisiert. Die Mannschaften mussten sich ohne Unterstützung durchschlagen. Die Offiziere erhielten Halbsold, der jenen ohne Vermögen nur ein karges Leben erlaubte.
Stellen in ausländischen Marinen wurden offeriert und oft akzeptiert, vor allem in der zaristischen Flotte. Aber mancher Offizier fand seinen Platz auch in der Handelsmarine, wobei die Schiffe der Ostindischen Handelskompanie besonders begehrt waren. Diese Kompanie verfügte auch über eine eigene Kriegsmarine, die Bombay-Marine, von der wir sehr wenig wissen. So schließt der Bericht über David Winters Erlebnisse in dieser größten privaten Kriegsmarine aller Zeiten auch in dieser Hinsicht eine Lücke.
Aber im Vordergrund stehen die persönlichen Erlebnisse dieses jungen Hannoveraners, der in der exotischen Welt des Indischen Ozeans und der angrenzenden Meere Abenteuer erlebt, die in Europa nicht mehr denkbar waren. Für uns sind diese Länder und Kulturen nur noch Stunden entfernt. Aber damals dauerte es viele Monate, sie zu erreichen, und die Kunde über sie war lückenhaft und oft irreführend.
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, David Winters Abenteuer in dieser fremden Welt angemessen wiederzugeben. Bei der Übertragung ins Deutsche waren Kompromisse unvermeidlich. So kennt der Engländer nicht den Unterschied von ›Du‹ und ›Sie‹ in der Anrede wie wir, aber er hat andere Möglichkeiten, zwischen dem ›Duzen‹ und dem ›Siezen‹ zu differenzieren. Hier habe ich einfach auf die deutschen Formen der Anrede zurückgegriffen.
Auf die politischen Hintergründe in Ostasien, auf die Geschichte der Ostindischen Handelskompanie konnte ich nur hier und da einen kleinen Hinweis geben. Auch die Befehlsstruktur der Bombay-Marine in Kalkutta habe ich etwas vereinfacht. Dennoch hoffe ich, dass ich dem Leser ein wenig von der Besonderheit europäischen Lebens, Handelns und Kämpfens in Ostasien vermitteln konnte.
In der Zeit, in der David Winter lebte, waren kriegerische Auseinandersetzungen nicht häufiger als in unserer, aber sie wurden eher als Mittel der Politik akzeptiert, zumindest in den führenden Gesellschaftsschichten. Tapferkeit und kriegerischer Erfolg hatten einen anderen Stellenwert. Das habe ich in der Nacherzählung nicht korrigiert.
Möge der Leser David Winter als Kind seiner Zeit akzeptieren und sich an seinen Abenteuern erfreuen!
Frank Adam
Hinweise für den marinehistorisch interessierten Leser
Für die allgemeine maritime Literatur verweise ich auf die Anmerkungen in den früheren Romanen und führe nur noch einmal das einzige deutschsprachige Taschenbuch an:
Adam, F.: Hornblower, Bolitho & Co. Krieg unter Segeln in Roman und Geschichte. Frankfurt: Ullstein 1992
Über die Bombay-Marine liegt sehr wenig Literatur vor. Alle Recherchen in neueren maritimen Bibliographien und in Datenbanken englischsprachiger Dissertationen erbrachten keine neuere Gesamtdarstellung. Alle Darstellungen basieren auf dem Standardwerk von Charles Rathborne Low, Leutnant in der Indian Navy, von 1877:
Low, Ch. R.: History of the Indian Navy (1613 – 1863). London: Bentley and Son 1877
Auch ein neueres Werk übernimmt für die frühe Zeit vor 1800 die Ergebnisse von Lows Forschung.
Hastings, D.J.: The Royal Indian Navy, 1612 – 1950.
Jefferson, N. C., und London: McFarland 1988.
Ohne andere Informationen, aber recht illustrativ in der Darstellung ist das entsprechende Kapitel in:
Sutton, J.: Lords of the East. The East India Company and its Ships. London: Conway Maritime Press
Interessante Details über das Leben im Indien dieser Zeit findet der Leser in:
Busteed, H. E.: Echos from old Calcutta... Shannon: Irish University Press 1972
Ohne Autor: The East Indian Chronologist... Calcutta: Hircarrah Press 1801
Angaben über das Fiasko der Ansiedlung auf Balambangan liefert:
Rutter, O.: The Pirate Wind. Oxford: Oxford University Press 1986
Personenverzeichnis
Offiziere und Deckoffiziere der Guardian:
David Winter
Kommandant
Robert Varlow
Erster Leutnant, später Kommandant der Grab ›Surat‹
William Hansen
Zweiter Leutnant, später Erster Leutnant
James Cotton
Schiffsarzt
Barry McGaw
Midshipman, später Zweiter Leutnant
Edmund Bennett
Midshipman
Conrad Mail
Midshipman
George Ferguson
Midshipman
Mark Rall
Bootsmann
Nadir Nawaz
Jemadar, Feldwebel der Sepoys
Henry Duff
Stückmeister
Isidor Latitre, der Kanadier
Bootsmannsmaat
Ricardo Lorenzo
Steuermannsmaat
Personen in Kalkutta:
Lord Cornwallis, Generalgouverneur
George Abercrombie, Oberstleutnant
Mr. Spencer, Chef des zivilen Stabes
Mr. Rustomjee, indischer Bankier
Kamala, seine Tochter, später Davids Frau
Sir Robert Chambers, Richter
Sir William Jones, Präsident der Asiatischen Gesellschaft
Mr. Jobert, betrügerischer Kaufmann
Die Vorboten des Friedens
August 1783 bis Oktober 1783)
Er krallte sich am Tau fest, das vom riesigen Bug des Linienschiffes herabhing. Jetzt fand ein Fuß in einem Schussloch Halt, und er konnte sich etwas emporziehen. Und dann rauschte wieder eine Salve heran und schlug über ihm in den Rumpf. Das Krachen und Bersten dröhnte in seinen Ohren. Noch ein Stück höher, aus dem Wasser heraus!
Aber da zerrte etwas an seinem linken Fuß, der noch im Wasser hing. Entsetzt blickte er nach unten und sah Bill Young, der sich an seinem Fuß festhielt. Das Gewicht war zu groß. Das Tau glitt durch seine Hände. »Pack das Tauende und zieh dich hoch!«, brüllte er. Aber Bill reagierte nicht.
Sein anderer Fuß wurde aus dem Schussloch gerissen, und dann sah er den Hai herangleiten, grau, spielerisch, tödlich. In panischer Angst trat er nach Bill, um freizukommen, um sich hochziehen zu können, in Sicherheit vor der Bestie.
Der Hai glitt nur Zentimeter an seinem Fuß vorbei, öffnete sein mörderisches Gebiss und packte Bill. Blut färbte das Wasser, und David hangelte, von Todesangst getrieben, am Tau empor. Wieder krachte und donnerte es. Dabei merkte er, dass er immer noch schrie. Schon wieder Krachen und Donnern!
Mühsam tauchte er aus den Tiefen des Traumes empor. Es war der Traum, der ihn immer wieder quälte, die Erinnerung an das furchtbare Geschehen in der Schlacht bei den Saints vor anderthalb Jahren.
Und das Krachen war das Pochen des Hoteldieners, der ihn wecken sollte, weil er zur Admiralität wollte.
»Ist gut, ich bin wach!«, rief er und schüttelte den Kopf, um die Erinnerung loszuwerden.
»Geht es Ihnen gut, Sir? Sie haben geschrien.«
David Winter antwortete: »Es war nur ein Traum. Bring das Frühstück in fünf Minuten!«
Die Sonne hatte den Staub längst getrocknet und dörrte ihn in diesen letzten Augusttagen des Jahres 1783 immer weiter aus. Auf die Straßen Londons konnte man sich kaum ohne ein Tuch vor Mund und Nase trauen, und wenn man nicht am Staub erstickte, den die Kutschen und Lastkarren aufwirbelten, so war man in kurzer Zeit von Kopf bis Fuß eingepudert wie ein Bäckergeselle.
Der junge Marineleutnant David Winter nahm das Tuch vom Gesicht, klopfte den Dreispitz auf dem Oberschenkel aus, schlug dann mit den Händen auf sein Jackett, schüttelte resignierend den Kopf und öffnete die Tür zu Lloyd’s Kaffeehaus, dem Treffpunkt der Reedereikaufleute und Flottenoffiziere. Feuchte Hitze, Rauch und eine Mixtur aus Schweiß und Alkoholgeruch schlugen ihm entgegen.
Da kommt man ja vom Regen in die Traufe, dachte David bei sich, aber der Durst überwog, und er sah sich nach einem Platz um. Der Tisch vor ihm war mit Flottenoffizieren besetzt. Er drehte sich und sah in die andere Richtung. Am Tisch verabschiedete sich gerade ein Offizier, und am Nebentisch sah ein korpulenter Kaufmann in diesem Moment einen Geschäftsfreund das Lokal betreten. Eilig richtete er sich auf, winkte und stieß den Marineoffizier fast um, der aufgestanden war.
»Passen Sie doch auf!«, rief der unwillig, als ihn der Dicke gegen Davids Rücken schob. Dieser wandte sich schnell um und wollte ärgerlich antworten, als er den Sprecher erkannte. Auch der hatte ihn erkannt und sagte mit schnellem Lachen: »Sie waren nicht gemeint, David, also erdolchen Sie mich nicht mit Ihren Blicken.«
»Martin«, antwortete der Leutnant, und ein Lächeln wischte den Ärger aus seinem Gesicht. Dann sah er die Uniform seines Bekannten und fügte hinzu: »Verzeihung, Sir, ich habe nicht gleich gesehen, dass Sie jetzt Kapitän sind.«
Der Kapitän fasste ihn am Arm und zog ihn mit zum Gang. »Bin ich deswegen ein anderer Mensch, David? Wir bleiben doch alte Freunde. Ich muss für ein kurzes Gespräch in die Admiralität, David, aber könnten wir uns in einer Stunde wieder hier treffen? Wir haben uns so lange nicht gesehen, und ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören, wie es Ihnen ergangen ist.«
»Gern«, antwortete David und vermied die Anrede, »ich freue mich auch.«
Er sah, wie der Kapitän einem Kellner winkte, ihm einige Worte sagte und dann entschwand. Kapitän ist er schon, dachte er. Wie das wohl geschehen sein mag. »Mr. Winter, Sir?« Der Kellner fragte es sehr respektvoll. »Der bin ich«, antwortete der Leutnant mit leichtem Lächeln. »Wenn Sie mir bitte folgen wollen.«
Der Kellner öffnete eine Tür und führte ihn in ein kleineres Gästezimmer, das geschmackvoll eingerichtet war und wohl für besondere Gelegenheiten reserviert wurde. »Wenn Sie mir bitte Ihre Wünsche für Speisen und Getränke mitteilen würden, Sir. Seine Lordschaft wird so schnell wie möglich wieder hier sein.«
»Seine Lordschaft?«, fragte David Winter erstaunt. Der Kellner stutzte. »Der Herzog von Chandos, Sir. Der Kapitän, der mit Ihnen sprach.«
»Ach so, ja.« David überwand seine Überraschung. »Bringen Sie mir bitte einen Gin mit Zitrone und ein Schinkenbrot nach der Art von Lord Sandwich.«
Sandwich, bis vor kurzem Erster Lord der Admiralität, wurde die Neuerung zugeschrieben, die Schnitte mit einer weiteren Brotscheibe zu belegen, weil man dann das Brot besser im Stehen und ohne Besteck essen konnte, und nun ahmte ihn ganz London nach.
Gin und ›Sandwich‹ wurden serviert, und David Winter trank einen Schluck, biss einen Happen ab. Aber er kaute den Bissen nicht auf, sondern starrte abwesend aus dem Fenster. Martin Balcor, mit ihm Leutnant auf der Surprise und sein Kammergefährte, war nun Kapitän und Herzog von Chandos. Ob sein Vater erst kürzlich gestorben war und ihm den Titel vererbt hatte?
Wie auch immer. Er war ein feiner Kerl gewesen und würde es sicher bleiben. Wie sie damals gemeinsam gegen die Intrigen des Lord Kinsale gekämpft hatten. David Winter musste lächeln. Aber jetzt war der Herzog Mitglied des Oberhauses, Träger eines der ältesten Adelstitel. Und er selbst war ein kleiner Leutnant, den sie im Wartezimmer der Admiralität schmoren ließen und für morgen wiederbestellten. Vorbei war die Zeit nach seiner Heldenbeförderung, als ihn der Erste Sekretär der Admiralität empfing und ihn Lord Sandwich vorstellte.
Leutnant Winter schüttelte den Kopf, kaute weiter, trank dann noch einen Schluck und biss wieder ab. Wenn er nur ein neues Kommando in Aussicht hätte. Aber der Krieg starb zusehends. Immer mehr Schiffe wurden außer Dienst gestellt und die Offiziere mit Halbsold an Land geschickt.
David Winter kam sich so überflüssig vor. Geld hatte er genug, und Onkel und Tante in Portsmouth nahmen ihn selbstverständlich kostenlos auf. Aber er konnte doch nicht immer nur mit der Tante spazieren gehen, dem Onkel bei seinen geschäftlichen Erörterungen zuhören, dem Cousin von der fernen Welt erzählen und Interesse für die Flirts seiner Cousine aufbringen.
Drei Monate hintereinander hatte er das jetzt ertragen und war fast nach London geflüchtet, um hier bei der Admiralität selbst seinen Bitten Nachdruck zu verleihen. Aber das wollten anscheinend Hunderte von Leutnants und Dutzende von Commandern und Kapitänen. Dieses Nichtstun und Herumhängen war furchtbar. Und der Dreck und Gestank in den Städten! Er sehnte sich so nach der Weite der See und der Frische ihrer Brisen.
Es polterte an der Tür, sie wurde aufgestoßen, und der Herzog von Chandos trat ein, Kapitän mit weniger als drei Dienstjahren, wie die Anordnung der Knöpfe in Zweiergruppen auf dem weißen Revers der Uniformjacke verriet. Er lächelte und streckte David die Hände entgegen. Der sprang auf. »Mylord«, begann er verlegen, aber der andere fiel ihm ins Wort.
»Bitte nicht so offiziell, David, wenn wir unter uns sind. Ich weiß doch, Sie waren nie ein großer Verehrer des britischen Adels. Darum ist es mir lieber, wenn ich für Sie Martin bleibe, und Sie bleiben mein Freund David für mich, nicht wahr?«
»Natürlich, Martin, aber ich möchte doch zu dieser ehrenvollen Würde gratulieren, wenn Ihre Übernahme auch mit dem Tod Ihres Vaters verbunden war, den ich bedauere. Und ich beglückwünsche Sie zur Ernennung zum Kapitän. Werden Sie im aktiven Flottendienst bleiben?«
Bevor der Herzog antworten konnte, klopfte der Diener, und der Herzog bestellte eine Flasche Champagner. »Auf unser Wiedersehen können wir nicht nur mit Gin anstoßen, David. Aber zunächst Dank für Ihre Glückwünsche. Mein Vater starb ziemlich überraschend, Gott sei Dank ohne Schmerz und in Frieden. Ich werde nicht im Flottendienst bleiben können, sondern ich muss auf Drängen meiner Verwandten und ihrer politischen Freunde in die Admiralität. Nun gucken Sie nicht so ungläubig und ablehnend, David. Kommen Sie, trinken Sie erst einen Schluck auf unser Wiedersehen.« Er reichte David das Glas, und sie tranken schweigend.
Dann erklärte er David in seiner ruhigen Art, dass er als Herzog von Chandos nun auch Pflichten und politische Verantwortung zu tragen habe. Seine Familie unterstütze die Whigs, die die Regierung übernommen hätten und nun zeigen müssten, dass sie das Land besser regieren könnten. Er würde als einer der Lords der Admiralität das Seine tun, das in der Flotte zu reformieren, was sie seinerzeit so beklagt hätten, die Intrigen, die Vetternwirtschaft und die unfähige Führung.
David hatte ihm aufmerksam zugehört. Er war nur ein oder zwei Jahre jünger als Martin, aber die Verantwortung, die jetzt auf diesen zukam, mochte er auch in zehn Jahren nicht übernehmen. Gewiss, Martin war immer ein kluger, kompetenter und nachdenklicher Offizier gewesen, aber ...? »Trauen Sie sich denn das zu, Martin?«, fragte er geradheraus.
»Ich kann mich nur nach Kräften bemühen, David. Und wenn ich Freunde habe, die mir gut raten, und mit Gottes Hilfe müsste ich es schaffen. Natürlich wird mir manchmal bange, wenn ich an die Zukunft denke. Aber was soll ich tun? Ich wäre der erste Herzog von Chandos, der sich einer Aufgabe verweigert, und was wir von unserer Flottenführung erlebt haben, schien uns beiden doch damals sehr verbesserungsfähig.«
»Weiß Gott«, bestätigte David, »und ich kenne keinen, der mit weniger Eitelkeit einen so hohen Adelstitel tragen kann, keinen, der mit mehr Verantwortungsbewusstsein an ein solches Amt herangeht als Sie, Martin. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Glück!« Er hob sein Glas.
Jeder Beobachter hätte gemerkt, wie viel Respekt und Sympathie die beiden verband. Der Herzog war etwas schmaler, blauäugig, dunkelblond, feingliedrig. David Winter hatte breitere Schultern, braune Haare, graubraune Augen, ein ovales Gesicht mit einer Narbe auf der Stirn. Jetzt fasste er sich an die kräftige Nase und lachte laut und ungekünstelt.
Sie waren bei dem Stadium ›Weißt du noch?‹, in dem sie Erinnerungen auffrischten und sich nach damaligen Bekannten erkundigten. »Admiral Brisbane hat übrigens die Herzogin von Dornoch geheiratet. Sie erinnern sich doch, David. Ich habe in keinem Adelsverzeichnis eine Herzogin von Dornoch gefunden, aber natürlich gehe ich der Sache nach der Heirat nicht weiter nach.«
»Brisbane ist ein tüchtiger und kompetenter Admiral, Martin. Hoffentlich können Sie ihm wichtige Aufgaben übertragen, wenn Sie in der Admiralität sind.«
»Das hoffe ich auch. Er ist übrigens gerade mit seiner Frau in London, im ›Royal Garden‹. Aber unsere Flotte wird radikal abgebaut. Der Friede steht vor der Tür, und der lange Krieg hat die Finanzen ausgeblutet. Wir werden kämpfen müssen, damit .uns das Parlament nicht völlig wehrlos macht wie anno fünfundsiebzig. Es wird eine harte Zeit kommen für Flottenoffiziere, David.«
»Ich spüre es schon, Martin. Die Ardent, auf der ich Zweiter war, wurde im Mai außer Dienst gestellt, und seitdem bin ich auf Halbsold. Ich bin nach London gereist, weil ich hoffte, dass mir die Admiralität eine neue Stelle zuweist, aber sie haben mich nicht einmal angehört.«
»Machen Sie sich keine Hoffnung, David. Der Friedensvertrag wird bald unterzeichnet werden, und dann kehren noch die vielen Schiffe von den auswärtigen Stationen zurück, und deren Besatzungen vergrößern die Zahl der Seeleute, die Arbeit suchen. Viele Offiziere werden sich bei fremden Flotten bewerben, die Russen suchen immer englische Offiziere, andere werden in der Handelsflotte oder bei der Ostindischen Kompanie unterkriechen. Aber Sie erwähnten eben die Ardent. Da gibt es ein Gerücht, dass ein Leutnant Winter sie ganz allein gekapert hat. Nun mal raus mit der Wahrheit, David!«
David nahm sein Glas, trank einen Schluck, sah Martin prüfend an und sagte schließlich: »Ich kann inzwischen darüber sprechen. Aber Sie müssen mir zusichern, dass es unter uns bleibt, Martin.«
»Selbstverständlich, David.«
Und David erzählte von der großen Schlacht bei den Saints, wie er sich vor den Haien am zerschossenen Bug der Ardent hochziehen konnte, wie der junge Midshipman Young in seiner Angst ihn beinahe wieder ins Meer gerissen hätte, wie er sich von ihm befreite und zusehen musste, dass ihn die Bestie zerfleischte.
David atmete tief, lehnte sich zurück und schloss die Augen. »Ich sehe es im Traum immer wieder vor mir und werde mich nie von der Schuld befreien können, was auch die anderen sagen.« Dann berichtete er, wie er die Posten getötet, die englischen Gefangenen an Bord der Ardent befreit und mit ihrer Hilfe das Schiff in seine Hand gebracht habe. Aber die Beförderung zum Commander, die die Kapitäne Grant und Haddington beantragen wollten, habe er verhindern müssen. »Das verstehen Sie doch, Martin?«
»Ja und nein, David.« Martin sprach langsam und bedrückt. »Was für eine Tat! Wer Sie kennt, David, weiß, dass Sie tapfer sind. Aber das hier war mehr, da müssen Sie wie im Rausch gehandelt haben. Und Ihren Wunsch, ein sauberes Gewissen zu behalten, den kenne ich aus der Affäre mit Lord Kinsale. Natürlich haben Sie keine Schuld, Sie konnten nicht anders. Aber das werden Sie mir auch nicht glauben und sich weiter quälen. Und dabei braucht die Flotte tüchtige Commander, und Sie fänden leichter ein Kommando als ein Leutnant. Aber erzählen Sie, was Ihnen danach widerfuhr, und ich berichte Ihnen, wie ich Kapitän wurde.«
Es wurde ein langer Abend und eine mühsame Heimkehr, bei der beide nach Kräften Kutscher und Diener hinderten, sie an der richtigen Stelle abzuliefern. Sie verabredeten ein weiteres Treffen, und David wurde von dem brabbelnden Wirt und dem Diener des Hotels ›The Lion‹, in dem er schon seit fast zehn Jahren übernachtete, wenn er in London war, in sein Zimmer und ins Bett gebracht.
Das Erwachen war furchtbar. Das Licht stach in die Augen. Das Gehirn schien sich an den Schädelknochen zu reiben. Es dauerte Minuten, bis David merkte, dass nicht sein Kopf so dröhnte, sondern dass jemand ausdauernd an die Tür pochte. Mühsam quälte er sich hoch, schlurfte zur Tür und schob den Riegel zurück.
Der Hausdiener stand mit kaum unterdrücktem Grienen vor ihm. »Ein Bote brachte das Couvert für Sie, Sir.«
David griff danach. Das war das Wappen der Bentrows! Er zwang seinen Verstand, in dem Alkoholnebel Halt zu finden. »Bring mir heißes Wasser und eine Tasse Kaffee«, krächzte er und schlug die Tür zu. Er lief zum Fenster und riss den Umschlag auf.
Der Bogen flatterte ihm aus den Händen, und er musste sich bücken. Der Schmerz schoss ihm in den Schädel, und er fluchte. Dann las er. Susan schrieb ihm, dass sie ihn heute zum Tee erwarte und warum er sich noch nicht gemeldet habe.
David ließ sich auf den Stuhl fallen. Susan! Damals war er gleich zu ihr geeilt, als die Ardent vor einem guten Jahr ins Dock kam. Sie hatte sich gefreut, ihm stolz seinen Sohn gezeigt, den kleinen John, der mit seinen anderthalb Jahren schon umherstakste und in seiner Kindersprache plapperte.
David lächelte in der Erinnerung und ließ den Briefbogen sinken. Es hatte ihn immer wieder bewegt, wenn er den Kleinen in den folgenden Wochen und Monaten sah und ihm »Onkel David« beibrachte, wo sein Sohn ihn doch nicht Vater nennen durfte.
Aber Susan hatte sich verändert. Sie war eine abgöttisch liebende Mutter, aber sie war nicht mehr seine Geliebte. Ihr Körper verlangte nicht mehr nach ihm. Sie ließ sich küssen, wenn sie einmal allein im Zimmer waren, sie lehnte ihre Stirn an seine Schulter und seufzte, aber Leidenschaft riss sie nicht mehr fort.
Als er nach Wochen beim dritten oder vierten Wiedersehen ungeduldig wurde, hatte sie ihm erklärt, dass sie nichts tun könne und werde, um die Position ihres Sohnes als künftiger Lord Bentrow zu gefährden. Nie und unter keinen Umständen! Es sei auch sein Sohn, hatte er aufbegehrt, und wieso ihre Liebe dessen Position gefährde.
Freundlich, aber entschlossen hatte sie ihn erinnert, dass er von Anfang an gewusst habe, dass er keine Rechte an dem Sohn geltend machen könne. Er habe doch gewusst, wieso ihr Mann nichts gegen die Zeugung eines Erben einwenden konnte, sie sogar dazu aufgefordert habe. Aber vor der Welt führe sie eine Ehe, und die könne sie nicht durch ein Verhältnis gefährden. Und ein weiteres Kind würde ihr Mann nicht anerkennen, sondern sie verstoßen.
Aber sie liebe ihn doch, hatte David eingewandt. Ja, als Vater ihres Sohnes werde sie ihn immer lieben. Aber die Liebe zu ihrem Sohn sei stärker als die Leidenschaft, in der sie sich einst vereint hatten.
David hatte lange gebraucht, um das zu akzeptieren. Als Liebhaber fühlte er sich in seinem Stolz verletzt. Er wollte sich auch als Vater eines so hübschen und gesunden Sohnes zeigen. Und er konnte mit niemandem über das Problem sprechen. Aber allmählich hatte er begriffen, dass die Mutterschaft Susan verändert hatte. Der Sohn füllte ihr Leben ganz aus, und die Liebe zu einem Mann musste zurücktreten, wenn sie nicht in das Leben des Sohnes passte.
Er fuhr auf, als es wieder an der Tür pochte. Ach ja, der Kaffee und das heiße Wasser. David fragte den Diener, wie spät es sei, und der antwortete Flottenoffizieren immer in der Schiffssprache: »Fünf Glasen der Vormittagswache, Sir.« Also zehn Uhr dreißig, dachte David, der sich an Land immer schnell umstellte, und musste lächeln. Der Bursche benutzte die Seemannssprache doch nur, um sein Trinkgeld zu fördern.
Er pustete in den Becher und schlürfte das heiße Getränk. Auch ein Zwieback lag dabei. Langsam kam er wieder zu Kräften.
Er seifte sich ein und rasierte sich, nicht ohne sich zweimal zu schneiden. Zur Admiralität musste er noch einmal, obwohl das zwecklos war, wenn er an Martins Informationen dachte. Und dann zu Susan. Liebte er sie eigentlich noch? Er war sich nicht sicher. Die Mutter seines Sohnes muss man doch lieben, dachte er. Und vor acht Jahren, sie waren noch Kinder, wie gern hatten sie sich damals, als sie mit ihren Eltern aus Piratenhand befreit wurde.
Er schüttelte den Kopf in Gedanken, und der Kopfschmerz brachte ihn in die Wirklichkeit zurück. Er musste etwas essen und noch mehr Kaffee trinken, sonst schaffte er es nicht zur Admiralität. David zog die Jacke über und stieg vorsichtig die Treppe hinab zur Küche.
Die Diener der Admiralität hockten in der Eingangshalle in ihren überdachten Ledersesseln und waren unhöflich wie immer. Nein, auch heute wäre wenig Hoffnung auf einen Termin beim Ersten oder Zweiten Sekretär. Aber er könne sich ja ins Wartezimmer setzen. David sah hinein und schrak zurück vor der Fülle erwartungsvoller und doch irgendwie resignierter Gesichter. In der Ecke stand jemand auf und winkte.
Als der Mann auf ihn zukam und den Lichterkorridor passierte, der vom Fenster einfiel, erkannte er ihn: Andrew Harland in der Uniform eines Leutnants. Er streckte ihm die Arme entgegen, und sie fassten sich um. Wie viel hatten Sie gemeinsam auf der Anson erlebt.
Sie gingen hinaus auf den Flur und fielen sich immer wieder gegenseitig ins Wort, weil sie wissen wollten, wie es dem anderen ergangen sei in den letzten dreieinhalb Jahren. Ja, vor vier Monaten sei er noch zum Leutnant ernannt worden, berichtete Andrew, so könne er wenigstens mit Halbsold rechnen, wenn er kein neues Kommando erhalte.
Andrew war jede Woche zwei Tage auf der Admiralität, seit sein Schiff außer Dienst gestellt worden war, aber es sei so gut wie aussichtslos. »Nächste Woche reise ich mit drei anderen Leutnants nach Margate. Wir haben uns für zwei Wochen eine Wohnung gemietet und wollen unser Leben genießen. Komm doch mit, David. Dort soll es hübsche Mädchen geben.«
»Das habe ich schon hinter mir, Andrew. Nach drei Wochen hielt ich es nicht mehr aus. Saufen, spielen und dauernd Frauen in der Wohnung. Die ersten beiden Wochen hat es wirklich Spaß gemacht, aber dann wurde es eintönig. Mir wird alles an Land mit der Zeit langweilig.«
»Das habe ich meinem Vater auch gesagt, David, und er hat mir den Kopf gewaschen. Das käme daher, dass wir an Land keine Aufgabe hätten. Aber uns zuliebe könne die Nation nicht dauernd Krieg führen. Er will, dass ich als Maat auf einem Schiff im Russlandhandel anheuere.«
»Oh Gott«, sagte David teilnahmsvoll. »Und dann immer dieselbe Route wie ein Postkutscher. Aber komm, Andrew, ich muss mich hinsetzen. Mir ist von der letzten Nacht noch wacklig.«
»Ja, blass siehst du aus, David, und eine Alkoholfahne hast du. Komm, ich kenne in der Nähe einen Gasthof, die haben Medizin dagegen.«
Als sie an die frische Luft traten, atmete David tief durch. Gott sei Dank war es heute nicht so heiß und staubig. Der Wirt in dem alten Pub empfing sie freundlich und brachte bald die ›Medizin‹. »Einen Löffel Magensalz, Sir, einen Mokka mit viel Zitrone und frisches Weißbrot, danach wird es Ihnen besser gehen.«
Und es wirkte! Zum Tee erschien David vor dem Haus der Bentrows und fühlte sich wieder besser. Susan schloss ihn freundschaftlich in die Arme, als die Zofe gegangen war, küsste ihn leicht auf den Mund und machte ihm Vorwürfe, dass er sich nicht gleich gemeldet hätte. »Aber ich war doch erst einen Tag in London, und wenn ich meinem Kameraden Martin, dem Herzog von Chandos, nicht in den Weg gelaufen wäre, hätte ich noch am Nachmittag hier vorbeigeschaut.«
»Du kennst den Herzog von Chandos? Alle Mütter heiratsfähiger Töchter sprechen von ihm. Erbe eines großen Titels und ein gut aussehender Mann dazu.«
»Ja, wir waren Leutnants auf Brisbanes Flaggschiff und bewohnten dieselbe Kammer, bevor er Herzog wurde.«
»Hatte er dann auch mit dem Kriegsgerichtsverfahren zu tun, um das sich mein Vater damals sorgte?«
»Ja, wir standen auf der gleichen Seite, und es ist gut, ihn auf seiner Seite zu haben. Aber genug davon. Wo ist mein Sohn?«
»Unser Sohn, David«, korrigierte ihn Susan liebevoll und nahm seinen Arm. »Er wird gleich gebracht. Er ist gesund und munter und sieht prächtig aus. Von dir kann man das nicht sagen, David. Du bist ein wenig blass.«
»Das hat man davon, wenn man sich mit dem britischen Hochadel einlässt.«
»Immer spottest du über den britischen Adel, du Rebell aus Hannover. Vergiss nicht, dein Sohn wird auch einmal dazugehören«, sagte Susan lächelnd.
»Mir wäre lieber, er könnte ›Vater‹ zu mir sagen, und du würdest mich lieben wie früher.«
»Ach, David, du quälst uns beide. Es geht doch nicht. Wir tragen doch Verantwortung für die Zukunft unseres Sohnes.«
Die Zukunft, die du für ihn ausgesucht hast, ist nicht die einzige Zukunft, wollte David ihr antworten, aber da wurde der kleine Kerl auch schon gebracht und lief jauchzend auf seine Mutter zu. Dann wandte er sich zu ihm: »Ontel Tavit«, begrüßte er ihn.
Und David nahm das große Paket vom Tisch, das er mitgebracht hatte, und stellte es vor ihm hin. Der Kleine riss das Papier ab und klatschte in die Hände, als er das bunte Schaukelpferd aus Holz sah, mit den vielen kleinen Glöckchen am Hals. David hob seinen Sohn auf das Pferdchen und bewegte ihn, so dass das Pferd schaukelte und die Glöckchen klingelten.
Der Kleine juchzte vor Vergnügen, und Susan blickte mit herzlicher Zuneigung zu ihnen hinüber. »Du wärst ein guter Vater, David. Du hast ein Herz für kleine Kinder.«
David traten die Tränen in die Augen, und er legte seinen Kopf an den Hals des Jungen und hätte fast laut gestöhnt, als er die zarte Haut und den Flaum der Haare spürte. Sein Sohn und doch nicht sein Kind.
Susan legte ihm den Arm auf die Schulter. »Er wird so erzogen, dass er dir immer in Liebe und Ehrfurcht begegnen wird, David.«
David seufzte: »Aber zu einem anderen Mann sagt er ›Vater‹.«
Susan nahm seinen Arm und zog ihn ein paar Schritte weg von John. »Es ist so hart für dich, David, weil du ein guter und liebevoller Mensch bist. Ich würde dir so gern helfen.«
»Dann liebe mich, gehöre mir wie damals«, stieß er hervor.
Susan löste sich von ihm: »Ich liebe dich, David, aber gehören kann ich dir nicht mehr. Wenn du ruhig nachdenkst, würdest du doch selbst nie die Zukunft deines Sohnes gefährden. Deine Leidenschaft für mich schmeichelt mir, aber wir beide wissen, dass die innige Verbindung unserer Seelen tiefer reicht als die Verbindung der Körper, die uns verwehrt ist.«
David schwieg und dachte, sie redet wie eine Betschwester. Susan zog ihn zu dem Jungen, der ihn ablenkte und aufheiterte. »Mein Vater hat gesagt, dass er dich auch gern sprechen würde, David. Schau doch mal bei ihm vorbei.«
David kitzelte den Kleinen und sagte ihm vor: »Morgen gehe ich zu Opa.«
»Oppa«, plapperte der Kleine stolz nach, und David drückte ihn an sich.
Sie spielten mit dem Kleinen noch ein Stündchen, David aß bei Susan Abendbrot, und dann war wieder der Augenblick des Abschieds da. »Kann ich John noch einmal sehen?«, fragte David.
»Aber David, er schläft, und das Kindermädchen würde sich Gedanken machen.«
»Bitte!«
Susan sah ihn an und sagte leise: »Komm!« Sie stieg die Treppe empor, ging vor ihm den Flur entlang und öffnete leise eine Tür. »Lassen Sie uns einen Augenblick allein«, flüsterte sie dem Kindermädchen zu, und David ging auf Zehenspitzen zu dem kleinen Himmelbett mit dem Wappen der Bentrows.
Dort lag sein Sohn, hatte die beiden kleinen Fäuste an den Kopf gedrückt und atmete leise vor sich hin. David legte die Hand vor die Augen. Da fasste ihn Susan an den Schultern, drehte ihn herum und küsste ihn so leidenschaftlich wie noch nie seit seiner Rückkehr.
»Du lieber dummer Kerl, du. Merkst du nicht, dass es mir auch so schwerfällt, mich dir nicht hinzugeben? Aber unser Sohn gibt mir die Kraft, mein Verlangen zu beherrschen. Kann er dir nicht auch die Kraft dazu geben?«
David wusste nicht, wie er aus dem Haus gekommen war. Die Erkenntnis, dass Susan auch mit ihrer Leidenschaft kämpfen musste, hatte ihn überrascht. Und alles bloß, weil der junge, schicke Lord Susan geblendet und ihr erst nach der Heirat gestanden hatte, dass er homosexuell sei und nie mit einer Frau schlafen könne.
Aber Seine Lordschaft brauchten eine schöne, junge Frau, und das mit dem Erben des Namens hatte sich auch diskret arrangieren lassen. David lachte, aber das Paar, das ihm gerade begegnete, schaute ängstlich fort. Eine junge Hure, ein Kind fast, drängte sich an ihn. »Na, Süßer?« Aber er stieß sie von sich und ging so schnell, als wollte er seine Gedanken zurücklassen.
Der nächste Morgen war wieder heiß und trocken. David nahm eine Kutsche zum Ostindienhaus und zog noch die Vorhänge vor, um den Staub abzuwehren. Der Portier hatte sich sein Gesicht gemerkt und schickte gleich einen Boten, ob Sir Abraham Zeit hätte.
Sir Abraham MacMillan, Sekretär des Geheimen Beratungskomitees der Ehrenwerten Ostindischen Handelsgesellschaft, begrüßte David herzlich wie immer. Während der indische Diener den gekühlten Tee holte, plauderten sie ein wenig über das Wetter.
Sir Abraham schimpfte über das Klima in London. Im Sommer sei es heiß und staubig und im Herbst und Winter trüb und die Luft voller Ruß von den vielen Öfen, die mit billiger Kohle geheizt würden. Fenster, Kleider, alles überziehe sich mit einer schwarzen, schleimigen Schicht.
»In der Hitze Indiens haben wir von der frischen Luft Englands geträumt. Aber die gibt es in London nicht mehr. Wenn ich zurücktrete, werden wir nach Kew ziehen, in die Nähe der königlichen Gärten. Dort kann man noch atmen, und wir sind mit der Kutsche nicht zu weit von der Londoner Gesellschaft, die meine Frau nicht ganz missen möchte.«
»Aber Sie werden doch noch lange Ihr Amt wahrnehmen, Sir Abraham. Was wäre die Kompanie ohne Ihren Rat?«
»Sie wird in spätestens einem Jahr ohne ihn auskommen müssen, David, und ich nehme an, manche werden sich darüber freuen. Die Kompanie ist nicht mehr, was sie in meiner Jugend war. Zu viele Angestellte haben sich in Indien skrupellos bereichert und führen nun hier in England ein Leben als reiche Nabobs.«
Er hob sein Teeglas an die Lippen, und auch David trank. »Die Nabobs haben mit ihrem Geld die Versammlung der vierundzwanzig Direktoren in ihre Abhängigkeit gebracht und rücksichtslos ihre Interessen in der Kompanie durchzusetzen versucht. Aber Eigennutz und Gewinnsucht sind selten gute Ratgeber. Die Kompanie geriet durch Korruption und Misswirtschaft in Verruf, und die Regierung hat sich vor zehn Jahren im Regulating Act Einfluss auf die private Handelsgesellschaft gesichert, um die schlimmsten Missstände etwas zu steuern. Und ich weiß, dass Pitt jetzt ein Indien-Gesetz vorbereitet, das die Kontrollrechte und den Einfluss der Regierung weiter stärken soll. Er kann gar nicht anders. Ein Untersuchungsausschuss deckt immer neue Missstände auf, die Burke im Parlament demagogisch vergröbert. Die Zeitungen schüren die Angst, dass uns in Indien eine neue Rebellion bevorstehe, bevor wir die amerikanische verdaut hätten. Wissen Sie, David, dass der Gouverneur von Madras das Wort geprägt hat: ›Wenn sich alle Inder verabreden würden, gleichzeitig zu pissen, würden alle Europäer ins Meer geschwemmt werden‹?«
David musste lachen. »Nein, Sir Abraham. Ich weiß natürlich, dass den vielen Millionen Indern nur ein paar tausend Engländer gegenüberstehen, aber so drastisch wurde es mir noch nicht gesagt.«
Sir Abraham schmunzelte. »Ja, David, es ist ein wunderbares Land, abstoßend und erhebend, schmutzig und sauber, bittere Armut und unvorstellbarer Reichtum. Sie können dort alles finden, auch Ihr Glück.«
Er lehnte sich zurück und trank wieder einen Schluck Tee. »Sie wissen, David, dass die Kompanie ihre eigene Kriegsmarine hat?«
»Ja, Sir, die Bombay-Marine.«
»Nun, die Navy gebraucht wohl häufiger den Spitznamen ›Bombay-Bukaniere‹, obwohl jeder weiß, dass die Bombay-Marine der Navy in nichts nachsteht, was Disziplin und Kampfkraft betrifft. Im Gegenteil! Wissen Sie auch, dass wir etwa vierzig Schiffe in dieser Marine haben?«
David war überrascht. »Nein, Sir Abraham, ich hätte auf ein Dutzend Schiffe getippt.«
»Wir haben ein knappes Dutzend größerer Schiffe von der Brigg bis zum 54-Kanonen-Schiff, aber außerdem viele kleine indische Segler, meist Grabs. Sie dürfen nicht vergessen, das Einsatzgebiet der Bombay-Marine reicht von Kanton bis zum Roten Meer, von Kalkutta bis St. Helena.«
David wunderte sich, warum Sir Abraham ihm das alles erzählte. Wollte er ihn anwerben?
Aber der schien Davids Gedanken zu ahnen. »Sie wundern sich, dass ich Ihnen das erzähle. Der Grund ist einfach. Man hat mir erlaubt, Ihnen das Kommando einer Sloop anzubieten, die wir als Neubau günstig von der Navy übernehmen. Sie wird in Portsmouth getakelt, und es sollte nicht schwer sein, sie zu bemannen, wo jetzt viele gute Seeleute entlassen werden.«
Die Großzügigkeit dieses Angebots überraschte David, und er stotterte etwas, als er sich bedankte. »Schon gut, David, Sie sind des Angebots würdig. Sie könnten Urlaub von der Admiralität erhalten, Sie haben ja jetzt einen hochgestellten Fürsprecher dort, und im Dienst der Bombay-Marine bleiben, so lange Sie wollen, aber mindestens vier Jahre. Sie haben eine Woche Zeit, sich zu entscheiden.«
»Ich werde mich schon früher entscheiden, Sir Abraham. Es gibt nur noch eine Reihe von Fragen nach der Bewaffnung, den Modalitäten der Anwerbung von Offizieren und Mannschaften, der Segelorder und noch einige Fragen dieser Art, die mir jetzt nicht einfallen.«
»Die Sloop hat achtzehn Geschütze, soweit ich weiß, davon sind sechs Karronaden. Ach ja, zwei Jagdgeschütze hat sie auch. Leider liegt Sir William James, der erste große Commodore der Bombay-Marine und danach einer unserer Direktoren, seit Monaten auf den Tod darnieder. Er hätte Sie gut in die Einzelheiten einführen können. Aber sein Nachfolger, einer unserer Kapitäne, kann das auch. Vereinbaren Sie doch für morgen einen Termin mit ihm.«
Sir Abraham läutete nach einem Diener. »Morgen Abend würden wir Sie gern zum Dinner einladen, David. Wir erwarten noch einen Gast, den Sie gut kennen. Und Susan wollte auch erscheinen. Ist sie nicht eine hingebungsvolle Mutter?«
David bestätigte das, und Sir Abraham fügte hinzu: »Ich glaube manchmal, dass sie übertreibt. So jung wie sie ist, sollte sie mehr an den gesellschaftlichen Veranstaltungen Anteil nehmen. Na ja, wer hört schon auf seine Eltern?«
Der Diener trat ein, erhielt den Auftrag, David zu Kapitän Leard zu bringen, und Sir Abraham verabschiedete sich herzlich von David.
Kapitän Leard war ein älterer Herr, hager und mit gelblich gefärbter Haut. »Kann Ihnen keinen Alkohol anbieten, Leutnant. Indien hat meine Leber zerstört. Soll Sie also über Ihren Auftrag informieren. Morgen um zehn Uhr, aber pünktlich bitte.«
David wunderte sich etwas über die brüske Art und sagte ebenso kurz: »Einverstanden. Adieu.«
Auf der Straße war es immer noch heiß und staubig. David war erregt von dem Angebot, aber auch von zwiespältigen Empfindungen hin und her gerissen. Verdammt, erst muss ich einen schattigen Platz finden und ein kühles Bier. Das war in London nicht schwer, und bald saß er in einem Gasthaus und kostete das Bier.
Ein eigenes Kommando, ein neues Schiff, eine Besatzung mit Freiwilligen, Dienst im fernen und rätselhaften Indien, das konnte man doch gar nicht ablehnen. Aber er war dann ja nicht länger Offizier des Königs, sondern Offizier einer Handelsgesellschaft. Würde die Navy seine Dienstzeit in der Bombay-Marine anrechnen? Und er würde seinen Sohn und Susan für lange Zeit nicht sehen können. Mein Gott, sagte er sich, jetzt denke ich auch schon in der Reihenfolge, erst der Sohn, dann die Geliebte.
David trank sein Bier aus und beschloss, sich morgen erst den Kapitän anzuhören, dann mit Martin zu sprechen und sich danach zu entscheiden. Jetzt wollte er erst einmal ins Hotel zurück, etwas essen und dann eine Nachricht an das Büro des Parlaments senden. Dort musste man doch wissen, wo Paul und Judith Foster, seine Freunde aus Barbados, wohnten, während Paul als Abgeordneter im Parlament wirkte. Und abends würde er ins Covent-Garden-Theater gehen und sich die Bettler-Oper ansehen.
Als David abends den Wirt bat, eine Kutsche zu rufen, blickte der anerkennend auf den jungen, gut aussehenden Offizier in der prächtigen Uniform, und sein Blick blieb an dem mit Gold und Edelsteinen verzierten Ehrendegen hängen, dem Geschenk des Gouverneurs und der Versammlung von Jamaika.
»Darf man fragen, Mr. Winter, wohin die Kutsche Sie fahren soll?«
»Ins Covent-Garden-Theater, warum fragen Sie?«
Der Wirt schien zunächst sprachlos. »Aber Sir, Sie wollen doch nicht mit diesem Schwert zu einer öffentlichen Veranstaltung. Sie würden beraubt, vielleicht getötet werden. Ihr Onkel würde mir das nie verzeihen.«
David war ärgerlich. »Ich bin doch wohl Manns genug, mich zu wehren. Was denken Sie, was ich in den letzten Jahren getan habe?«
Der Wirt beruhigte ihn: »Aber Sir, ich würde doch nie Ihre Tapferkeit und Ihre Erfahrung als Flottenoffizier in Zweifel ziehen. Aber das hier ist eine andere Welt, Sir. London ist ein Dschungel, Sir. Hier wird nicht offen gekämpft, sondern nur aus dem Hinterhalt. Hier schüttet man Ihnen ein paar Tropfen in Ihr Glas und Sie fallen ohnmächtig um. Hier sticht man Ihnen eine dünne Nadel ins Rückgrat, und Sie sind gelähmt. Nein, Sir, diese Welt kennen Sie nicht. Bitte, Sir, fordern Sie die Verbrecher nicht heraus. Lassen Sie diesen prächtigen Degen in unserem Safe und nehmen Sie einen anderen. Bitte, Sir.«
David war nicht überzeugt, hielt den Wirt für übertrieben ängstlich, gab aber nach, weil er die gute Absicht spürte und daran dachte, dass der Wirt ihn ja schon als Knaben gekannt hatte.
Die Kutsche setzte ihn einen Steinwurf vor dem Theater ab, weil die dichte Menschenmenge das Weiterfahren erschwerte. David drängte sich durch die Menge, die noch etwas die Abkühlung des Abends genoss, bevor sie in den Zuschauersaal ging.
Er wunderte sich wieder, wie bunt gemischt das Publikum war. Feine Herrschaften der Gesellschaft, aufgeputzte Huren jeder Preisklasse und am Rand der Menge überall die Bettler. David spürte eine Hand vorsichtig an seiner Jackentasche, packte kräftig zu und drehte sich zur Seite.
Ein junger Bursche, gut gekleidet, blickte ihn ohne Verlegenheit an. »Würden Sie mich bitte durchlassen und meine Hand nicht festhalten, mein Herr. Ich habe eine Karte reserviert.« David war klar, dass er nichts beweisen konnte. Er ließ die Hand los und sagte zu dem jungen Burschen: »Sie werden einmal in furchtbare Schwierigkeiten geraten, so, wie Sie an anderen vorbeigehen.« Der Bursche zuckte mit den Schultern und verschwand.
David fragte sich, ob sich das Publikum hier auch so skandalös verhalten würde wie damals im Drury-Lane-Theater, das er mit Charles Haddington besucht hatte. Aber er wurde angenehm überrascht. Die Zuschauer folgten mit Anteilnahme der Vorstellung und applaudierten besonders Mrs. Thompson und Mr. Bannister, die die Hauptrollen sangen.
Onkel William war seinerzeit empört, erinnerte sich David, wie das Halunkendasein in dieser Oper verherrlicht werde. Er selbst sah es nicht so, fand die Gestaltung der Charaktere interessant und die Musik beeindruckend.
Nach der Vorstellung ließ er sich von der Menge in Richtung des Neubaus vom Somerset House treiben, weil dort wohl eher eine Kutsche aufzutreiben war als in der Nähe des Theaters. Vielleicht fand er auch noch eine Wirtschaft für einen abendlichen Trunk. Aber auf seine Taschen passte er gut auf.
An der Einmündung einer Nebenstraße staute sich die Menge, und man hörte Rufe, die wie Anfeuerung klangen. David hielt es für aussichtslos, sich durchzudrängen, und trat ein paar Schritte zurück, wo ihm ein Geländer die Möglichkeit gab, einen Fuß hochzusteigen und über die Menge zu blicken.
Eine Straßenlampe erhellte einen freien Kreis, in dem zwei kräftige Burschen, Oberkörper nackt, mit bloßen Fäusten aufeinander einschlugen. Das war keine Keilerei, das war ein regelrechter Boxkampf, denn ein Mann amtierte als Schiedsrichter, ein anderer ging um den Kreis und sammelte in einem Hut Münzen ein.
Einer der Boxer war anscheinend Matrose. Tätowierungen zierten die muskulösen Oberarme, und die Haare trug er in einem kurzen Zopf geflochten. Und als er David den Rücken zudrehte, erkannte dieser die Narben von Auspeitschungen.
Beide Kämpfer trugen Blutspuren im Gesicht und auf der Brust. Die Menge johlte, und David sah mit Erstaunen, dass nicht nur die Huren kreischten, sondern auch Damen vom Stande die Kämpfer mit aufgerissenen Mündern anfeuerten. Er stieg hinab und ging weiter. Boxkämpfe und Schlägereien hatte er genug gesehen und auch miterlebt, um diesen übermäßig interessant zu finden.
Die Menge verlief sich, und die Bettler konnten sich an die einzelnen Passanten herandrängen. David fasste den Degen, achtete auf seine Taschen und schritt voran. Aber dann sah er die Elendsgestalten der kleinen Kinder am Straßenrand, hörte ihr Wimmern, sah ihre eiternden Glieder, ihre eingefallenen Gesichter mit den übergroßen Augen.
Ja, er wusste, dass Mütter ihre Kinder den Bettlerbanden ausliehen, damit sie Spenden anlockten, von denen die Elenden selbst nichts behalten durften. Aber was half das Wissen, wenn ihn dieses Elend ansprang. Er lief voran zum ›Strand‹, der breiten erleuchteten Straße, suchte die nächste Imbissstube und ließ sich einen Beutel mit Brot vollpacken.
Geld wollte er nicht geben, das nahmen ihnen nur die Bandenchefs ab. Aber in die hungrigen Mäuler sollten sie sich etwas stopfen können, solange er zusah.
Er ging zurück in den Dämmerschein der Gasse. Er brach das Brot und gab es den kleinen Elendsgestalten in die Hände. »Essen!«, sagte er, als sie zögerten, »jetzt sollt ihr essen, sonst gibt es nichts.« Sie stopften in sich hinein.
Er erregte Aufsehen. Bettler tauchten aus der Dunkelheit auf. Hände streckten sich ihm entgegen, aber er gab nur den Kindern und den Krüppeln.
Im Hintergrund winkte eine zerlumpte Gestalt eine andere heran. »Meggy soll ihn mit der Ladynummer in die Gasse locken, schnell!« Der Bote huschte davon. Andere wurden herangewunken. »Meggy kommt gleich, haltet euch hinten bereit.«
David achtete darauf, dass er im Dämmerlicht der Lampen blieb, die vom ›Strand‹ her leuchteten. Er verteilte die letzten Brotstücke, als eine gut gekleidete ältere Dame vorbeischritt. »Sie sind ein edler Mensch, Sir. Gott möge es Ihnen lohnen.«
»Es ist so wenig, was ich angesichts dieses Elends tun kann, Madame. Aber sie sollten hier nicht weitergehen. Es ist gefährlich.«
»Keine Sorge, mein Herr. Nur noch zwanzig Schritt. Dort liegt meine alte, kranke Zofe, sie braucht meine Hilfe, und das Pack hier kennt mich.« Und sie ging mit einem Kopfnicken weiter.
David wandte sich ab und wollte zurück zum ›Strand‹. Er war nur wenige Schritte gegangen, da schrie hinter ihm die alte Dame hoch und schrill. »Zu Hilfe! So helft doch!«
David wandte sich um, zog seinen Degen und rannte dorthin, wo die Stimme erloschen war. Er kam nicht weit. Mit einem starken Holz wurden ihm die Füße weggeschlagen, dass er platt auf den Bauch fiel. Der Degen entglitt seiner Hand, die er vor das Gesicht gerissen hatte, als der Aufprall drohte. Ein Schlag traf seinen Hinterkopf, und er spürte nichts mehr.
In einem Kellergewölbe, das durch Fackeln erleuchtet wurde, saß ein älterer Mann mit langem, grauem Haar. Um seine Schultern lag trotz der Hitze eine Pelzstola. Die Männer und Frauen im Raum behandelten ihn mit Respekt. Sie waren meist schmutzig und zerlumpt, aber einige trugen auch saubere und sorgfältige Kleidung.
Unter ihnen war die ältere Lady, die mit David gesprochen hatte, bevor sie ihn in die Dunkelheit lockte. Unbeteiligt sah sie zu, wie einige Ganoven David an Händen und Füßen in den Keller zerrten und vor den Sitz des Alten warfen.
Der starrte und blaffte sie an: »Warum schleppt ihr einen Flottenoffizier hierher, ihr Dummköpfe? Das bringt Ärger.«
»Er hat die Bettelbälger gefüttert, Chef, und als er das Brot gekauft hat, haben wir gesehen, dass er einige Guineen in der Tasche hat. Und mit dem Füttern macht er die lebenden Kadaver nur aufsässig. Meggy hat ihn angelockt.«
Meggy sah auf den ohnmächtigen David, und der Gedanke flog sie an, ob ihr kleines Kind vielleicht vor Jahren überlebt hätte, wenn ihm jemand Brot gegeben hätte. Sie schob den Gedanken von sich und wandte sich zur Treppe, die gerade zwei Burschen herabstiegen.
»Gebt mir seine Börse!«, befahl der Alte, und einer der zerlumpten Gestalten zog sie aus Davids Rocktasche und reichte sie ihm. »Wie viel habt ihr schon für euch abgezweigt, ihr Langfinger?«
»Aber, Chef«, begehrte der Ganove auf, doch der Alte sagte nur: »Leg es dazu!« Achselzuckend zog der Ganove einige kleine Münzen aus der Tasche und legte sie zur Börse.
Die zwei Burschen, die die Treppe herabgekommen waren, traten neugierig näher. Der eine zuckte zusammen und wollte etwas sagen, aber der andere riss ihn an der Schulter herum und zog ihn in einen Nebenraum.
»Na, habt ihr im Pool schön abräumen können?«, rief ihnen der Alte hinterher.
»Jaja, ich bin gleich wieder da, hol nur den Ricardo, der muss tragen helfen.«
Im Nebenraum lagen mehrere Männer schlafend auf Stroh. Die Ankömmlinge schlossen schnell die Tür hinter sich und rüttelten die Schlafenden wach. »Was soll das, Chris?«, maulte der eine.
»Steh auf, Kanadier, nebenan liegt Mr. Winter, sie haben ihn niedergeschlagen und beraubt.«
Der Schwarze, der daneben lag und seinen Kopf hob, fragte: »Welcher Massa Winter?«
»Na, unser Leutnant Winter, du schwarze Krake!« Ungläubige Rufe wurden im Keller laut. Die Männer rappelten sich auf und bestürmten Chris mit Fragen. Der gab Antwort, und einer flüsterte: »Los, wir befreien ihn!«
Aber der, den Chris Kanadier genannt hatte, packte den Ungeduldigen am Arm. »Halt, Ricardo! Ruhe, ihr andern! Meint ihr, die überlassen uns Mr. Winter einfach so? Wenn wir sie nicht zwingen können, läuft nichts. Und bei denen können wir dann nie mehr unterkriechen.«
»Na und?«, antwortete Ricardo. »Hat uns Mr. Winter je im Stich gelassen? Wir sagen ihm, warum wir hier gelandet sind, und er findet einen Ausweg.« Alle murmelten Zustimmung.
»Gut!«, flüsterte der Kanadier. »Ich lass ihn sowieso nicht allein. Und nun sagt mir, was wir an Waffen haben und wie es vorn aussieht.«
Chris berichtete, und sie zählten ihre Waffen. Jeder der sechs hatte sein Messer. Drei Säbel und eine Pistole waren noch im Gepäck, und große Knüppel gab es genug. Der Kanadier flüsterte, sie stimmten zu, und dann traten sie einzeln und langsam in den Vorraum.
Chris, der jüngste von ihnen, verließ den Vorraum über die Treppe. Ein anderer postierte sich dort, und der Kanadier trat mit den letzten drei zu dem am Boden liegenden David, als ob sie neugierig seien.
»Guckt euch nur an, wen wir da eingefangen haben«, forderte sie der Alte auf.
David hatte inzwischen das Bewusstsein wiedererlangt, sich aber nicht bewegt und nur durch die Lider geblinzelt. Doch jetzt riss er die Augen auf, als er den Kanadier sah. Der trat schnell auf ihn zu und durchtrennte im Nu die Stricke an Händen und Füßen.
»Was machst du da?«, brüllte der Alte los, und die anderen Ganoven wurden aufmerksam.
»Er ist unser Bruder. Ihr habt es nur nicht gewusst. Wir können ihn doch nicht gefesselt und beraubt lassen. Gib die Börse her, Chef.«
»Ich denke nicht daran, du Kakerlake«, schimpfte der Alte. »Ihr verschwindet, undankbares Gesindel, das wir in unsere Brüderschaft aufgenommen haben. Und er und seine Börse bleiben hier, oder ihr müsst alle krepieren.«
»Langsam, Chef. Seinem Bruder muss man helfen, das sagst du doch auch immer. Und er hat uns oft das Leben gerettet. Wir können nicht anders, das musst du einsehen.«
David hatte sich aufgerichtet und seine Arme und Beine so bewegt, dass das Blut wieder pulsierte. Von hinten wurde ihm ein Messer zugesteckt.
»Unser Bruder ist er nicht, und wir schulden ihm nichts. Verschwindet oder krepiert mit ihm!« Der Alte hatte mit drohendem Nachdruck gesprochen.
»Aber, Chef!« Der Kanadier blieb ganz ruhig, doch er hatte einen Lappen zurückgeschlagen, und der Alte konnte die Pistole sehen, die auf ihn gerichtet war. »Wir sind euch ja dankbar und werden euch nie verraten. Aber wenn wir in einer halben Stunde nicht alle unversehrt draußen auf dem ›Strand‹ sind, wird unser Freund Chris die Konstabler holen, und sie werden dieses Nest ausräumen. Überlegt es euch.«
Der Alte starrte auf die Pistole und sagte kein Wort. Der Kanadier fuhr fort: »Meine Freunde gehen jetzt zum Ausgang. Ich folge ihnen und schaue euch mit meinem Instrument hier die ganze Zeit an, Chef. Wenn wir draußen sind, sehen wir uns nie wieder. Sagt jetzt laut, dass ihr einverstanden seid und dass euer Gesindel uns ziehen lassen soll.«
Mit heiserer Stimme rief der Alte: »Lasst sie raus!«
Der Kanadier griff sich die Börse, verneigte sich, und sie zogen alle davon, die Fäuste um Messer und Säbel gekrampft. Als sie draußen waren, rannten sie wie auf Verabredung wortlos zur hellen Straße und verbargen ihre Waffen unter den Kleidern. Ricardo und der Kanadier zerrten David mit sich, der noch etwas taumelig war.
David lehnte sich an eine Straßenlampe und holte tief Luft. »Ich hätte meinen Arm verwettet, dass ihr ehrliche Seeleute seid, und nun treffe ich euch bei diesen Ganoven. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen?«
Der Kanadier war wieder ihr Wortführer. »Sir, wir sind ehrlich, aber wir hatten keine Wahl. Sie haben uns in Sheerness betrogen und um unsere Heuer und unser Prisengeld gebracht. Wir hatten keinen Penny, Sir, und sind nach London gelaufen, um uns bei der Admiralität zu beschweren. Die haben uns zum Navy Board geschickt, und dort haben sie uns mit Spott und Hohn davongejagt. Zwei Wochen haben wir gebettelt, dann waren wir fast verhungert, als uns der Alte angeboten hat, für seine Bruderschaft Waren aus dem Pool zu holen.«
»Dann habt ihr Schiffe beraubt, andere Seeleute?« David mochte es nicht glauben.
»Aber nein, Sir«, erklärte der Kanadier geduldig. »Das war doch alles mit den Maaten und Kapitänen abgesprochen. Die haben alles der Versicherung gemeldet, und von uns erhielten sie die Hälfte der Beute.«
»Guter Gott, in welchem Sumpf leben wir überhaupt? Wer von euch wieder ehrlich leben und ein gutes Schiff haben will, dem helfe ich. Wer nicht will, soll sich jetzt davonscheren.«
Der alte Greg trat einen Schritt vor und sagte in seiner bedächtigen Art: »Sir, meine Knochen sind nicht mehr die jüngsten. Wenn ich meine Heuer ausgezahlt krieg, Sir, dann ging ich gern auf meine alten Tage zu meinen Leuten nach Kent.«
David war gerührt. »Aber natürlich, Greg, das ist ja nichts Unehrliches, und du hast es verdient.«
»Und ich, Massa, Sir, wenn ich die Heuer hätt und das Prisengeld, Sie wissen, meinen Fischladen tät ich gern aufmachen.« Die anderen grinsten, und auch David musste lachen.
»Du hast so oft von deinem Fischladen geschwärmt, Isaak, dass die Fische bald vor Angst das Schwimmen vergessen. Ihr müsst nicht wieder anheuern. Ich wollte euch nur eine Chance geben. Aber nun will ich euch untergebracht und versorgt wissen und dann ins Bett gehen. Der Kanadier und Ricardo sind morgen früh um neun Uhr am Ostindienhaus, so sauber wie zur Sonntagsinspektion. Dort kenne ich Leute, die Gerichte tanzen lassen können, und denen erzählt ihr eure Geschichte.«
Sie sahen ihn bewundernd an und waren voller Vertrauen und Zuversicht. Jetzt gucken sie wieder wie treue Hunde, dachte David, und ich muss mich strecken, damit ich sie nicht enttäusche.
Sie fanden ein einfaches Gasthaus für Seeleute, und David zahlte für Unterkunft und Verpflegung. Dann drückte er ihnen noch die Hände und ließ sich von der Kutsche in sein Hotel bringen. War das ein Tag, sagte er sich, und fühlte nach der Beule an seinem Hinterkopf.
Als Davids Kutsche am nächsten Morgen am Ostindienhaus vorfuhr, standen Mr. Isidor Latitre, der Kanadier, und Mr. Ricardo Lorenzo in ihren Uniformen als Maate der königlichen Marine wie aus dem Ei gepellt wartend vor dem Tor.
Sie legten grüßend die Hände an ihre runden Hüte und sagten »Guten Morgen, Sir.« David dankte und sagte: »Nun sehen Sie doch wieder wie königliche Maate aus. Kommen Sie, wir trinken einen Pott Kaffee, und Sie erzählen mir Ihre Geschichte.«
Es war keine außergewöhnliche Geschichte. Als die Hector in Sheerness außer Dienst gestellt wurde, hatten ihnen der Zahlmeister und der Sekretär des Hafenadmirals Anrechtscheine auf die Heuer gegeben, die in Portsmouth auszuzahlen waren, weil die Anson, ihr Stammschiff, dort seinen Heimathafen hatte.
Ein anderer Zahlmeister, der den Schreiber des Hafenadmirals begleitet hatte, bot ihnen an, die Anrechtscheine gegen fünf Prozent Gebühr in Gutscheine für die Bank in Sheerness umzutauschen. Aber die Bank erklärte die Gutscheine für Fälschungen, und auf der Hafenadmiralität wollte der Schreiber den Zahlmeister nie gesehen haben.
»Sie Dummköpfe«, schimpfte David. »Dass die Anrechtscheine auf fremde Häfen in Geld umgetauscht werden, das kennt jeder, aber warum lassen Sie sich Gutscheine dafür andrehen?«
»Sir, beim Umtausch in Geld verlieren wir zehn bis dreißig Prozent, hier nur fünf, und der Mann kam doch mit dem Schreiber des Hafenadmirals.«
»Nun gut«, entschied David. »Ich frage jetzt, ob der Jurist helfen kann. Er wird Sie dann noch ausfragen. Ich bin beim Kapitän der Bombay-Marine, und Sie warten in Ihrem Quartier auf mich. Wie ist es übrigens?«
»Einfach, aber sauber, Sir. Nahrhaftes Essen.«
»Sehr gut. Und jetzt gehen wir.«
David fragte den Pförtner, ob Mr. Mail schon zu sprechen sei. Dieser bejahte, Mr. Mail sei immer sehr früh im Büro, und winkte einem Diener, um David anzumelden. Mr. Mail erkannte David sofort wieder, wollte wissen, wie es ihm ergangen sei, und hörte sich bei der unvermeidbaren Tasse Tee an, was Davids früheren Schiffskameraden widerfahren war.
»Das gibt es immer wieder, Mr. Winter. Wenn der Schreiber noch beim Hafenadmiral tätig ist, lassen wir ihn verhaften, dann wird er seinen Spießgesellen schon preisgeben. Aber ob die Heuer dann noch bei ihm zu finden ist, das ist die Frage. Das Prisengeld ist davon unberührt. Das zahlt der Zahlmeister nicht aus. Da haben Ihre Leute etwas missverstanden.«
Und Mr. Mail rief den Schreiber, diktierte die Anzeige und verabredete mit David, wie die Anklage in Sheerness vorzubringen sei. »Schicken Sie die Maate dann zu mir, ich höre mir die Einzelheiten an und besorge die Vollmachten. Sie sagten, die Leute würden sich für die Bombay-Marine verpflichten?«
»Ich muss jetzt erst mit Kapitän Leard sprechen, Sir, ehe ich das bestätigen kann.«
»Tun Sie das, Mr. Winter, ich würde mich freuen, wenn Sie unserem Klub beiträten. Alles Gute!«
David bedankte sich sehr herzlich bei Mr. Mail und schickte dann die beiden Maate zu ihm.
Der Empfang bei Kapitän Leard war nicht so freundlich. Brummig wies der ihm einen Sitz an. Ohne Vorrede begann er: »Wir haben günstig den Neubau einer Sloop gekauft, den die Navy nun nicht mehr braucht. Wir werden dagegen aufrüsten müssen, denn viele Schiffe, die bisher mit amtlichen Kaperbriefen Beute jagten, werden nicht aufgelegt, sondern kapern als Piraten weiter. Und da ihnen in der Karibik die Flotten zu sehr auf die Finger schauen, werden sie in den Indischen Ozean ausweichen.«
»Aber dort ist doch Admiral Hughes mit einer königlichen Flotte, Sir«, wandte David ein.
»Königliche Flotte«, wiederholte Kapitän Leard mit verächtlichem Unterton. »Sie hat sich mit den Franzosen bisher nur unentschiedene Schlachten geliefert und wird zurückbeordert werden, noch bevor die Tinte unter dem Friedensvertrag trocken ist. Und dann ist die Bombay-Marine wieder allein. Ist auch besser so, wenn Sie mich fragen.«
Aber David fragte ihn nicht, sondern sah ihn nur unbewegt an. Der Kapitän räusperte sich und fuhr fort: »Die Sloop hat 470 Tonnen, zwölf Sechspfünder-Kanonen, sechs Zwölfpfünder-Karronaden in den Breitseiten und vorn und achtern je einen Achtpfünder als Jagdgeschütz. Die Besatzung besteht aus hundertfünfzig Mann, die hier angeworben werden müssen. In Indien werden dreißig davon gegen Sepoys ausgetauscht, die eingeborenen Marineinfanteristen.«
David fragte: »Wo liegt die Sloop, Sir, und wann soll sie übernommen werden?«
»Sie liegt jetzt in der Werft in Portsmouth und erhält die Takelage. In drei Wochen soll sie übernommen werden. Die Ausrüstung überwacht Mr. Varlow, Erster Offizier und absolut fähig, sein eigenes Kommando zu übernehmen.«
Aha, dachte David, dem Herren passt es nicht, dass ein Außenseiter Kapitän wird. Kann ich verstehen. Und er fragte: »Sind noch weitere Stellen für Offiziere und Deckoffiziere vergeben, Sir?«
»Ein Midshipman ist abgeordnet, zwei weitere und den Zweiten Offizier können Sie vorschlagen, der Schiffsarzt ist bestellt sowie ein Steuermannsmaat, alles andere obliegt Ihnen.«
»Und der Master, Sir?«
Kapitän Leard lächelte erstmals, aber es war eher ein höhnisches Zähneblecken. »Von allen Offizieren der Bombay-Marine wird erwartet, dass sie selbst navigieren können. Mr. Varlow wird Sie sicher gern instruieren, Mr. Winter.«
David erwiderte sehr ruhig und frostig: »Nicht nötig, Sir, ich legte das Examen als Steuermannsmaat ab, habe auf jedem Schiff die Monddistanzen gemessen und besitze seit zweieinhalb Jahren eine eigene Kopie des Harrisonschen Chronometers, die mir die Bestimmung der Längengrade auch bei fehlender Sicht erlaubt. Gehören solche Chronometer zur Ausstattung der Schiffe in der Bombay-Marine, Sir?«
Kapitän Leard schien unsicher und beeindruckt. »Nein, wir haben diese Chronometer nicht.« Und er lenkte dann ab und sprach über Einzelheiten der Anwerbung. Die Sloop – er erwähnte zum ersten Mal den Namen, Guardian, (in Erinnerung an Commodore James’ erstes Schiff, mit dem er 1749 Angrias Flotte besiegte) – würde in London dann Verpflegung und sonstige Ausrüstung übernehmen. Die in London angeworbenen Seeleute würden so lange in Boarding-Häusern der Kompanie in Deptford untergebracht.
Als David Kapitän Leard verließ, war er so gut wie entschlossen, das Kommando anzunehmen, aber er wollte noch mit Martin sprechen und sehen, ob sein alter Freund William Hansen bereit war, die Stelle als Zweiter Leutnant anzunehmen.