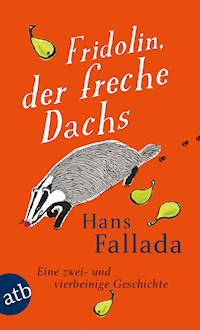7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Mitte Januar 1943 erhielt Hans Fallada vom Berliner Scherl-Verlag den Auftrag, einen Roman für die illustrierte Zeitschrift "Die Woche" zu schreiben. Er begann sofort mit der Arbeit, mußte jedoch nach zehn Tagen bereits wegen Krankheit und Sanatoriumsaufenthalt unterbrechen. Wieder zu Hause, in Carwitz, setzte er die Arbeit sogleich fort und beendete sie nach 25 Schreibtagen. "Es ist" schrieb er dem Verlag am 26. März, "ein Manuskript, das ich ohne alles schlechte Gewissen absende - wenn es auch nur ein Unterhaltungsroman ist -, und das sage ich nur selten." Vom 4. August bis zum 17. November 1943 brachte "Die Woche" den Roman in Fortsetzungen: eine gekürzte Fassung, die Fallada selbst redigiert und autorisiert hatte. Nach Falladas Tod erschien 1965 der Roman unter den Titel "Junger Herr - ganz groß" im Ullstein-Verlag, wobei jegliche Hinweise auf die Textgrundlage fehlten. Unsere Ausgabe ist die erste authentische Buchveröffentlichung nach der handschriftlichen Fassung und mit dem Titel, den Fallada gegenüber dem zunächst gewählten -"Die Weizenballade"- favorisierte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Ähnliche
Hans Fallada
Der Jungherr von Strammin
Roman
Impressum
Übertragung aus dem handschriftlichen Manuskript und Texteinrichtung: Barbara Thun
ISBN 978-3-8412-0075-4
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, BerlinBei Aufbau erstmals 1994 erschienen
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung U1 berlin unter Verwendung eines Bildes von © ullstein bild - mauritius
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
Zu dieser Ausgabe
ERSTES KAPITEL
Ich fahre mit vierhundert Zentnern Weizen nach Stralsund und komme ohne ein Pfund dort an
Es war ganz feierlich! Auf dem Hof hielten hintereinander die zwanzig vierzölligen Ackerwagen, jeder bis oben beladen mit prallen Weizensäcken und jeder bespannt mit vier Füchsen, mit jenen prachtvollen Füchsen, die unser Familiengut Strammin weit über Pommern hinaus berühmt gemacht haben. Auf der Freitreppe aber stand mein lieber Papa und hatte eben vor lauter Rührung und Aufgeregtheit zum dritten Mal sein Einglas verloren. Und hinter Papa stand Mama, rückte ihr Häubchen noch schiefer und murmelte immer wieder: »Oh, quel grand moment! Mademoiselle Thibaut, mon cachenez!«
Während Madeleine Thibaut der Mama das Taschentuch aus dem großen Pompadour reichte, warf sie, nämlich die kleine Thibaut, mir einen ihrer raschen verführerischen Blicke zu und feuchtete dabei schnell ihre Lippen mit der spitzesten Zunge an – als dürfe sie sich heute früh erlauben, was ich ihr schon zehnmal verboten hatte, nämlich das Poussieren mit mir, dem Jungherrn von Strammin!
Nein, es war wirklich schon gar zu albern und gar nicht mehr feierlich! Es stimmte wohl: auf den Wagen waren unsere letzten vierhundert Zentner Weizen, und wir brauchten den Erlös dafür recht nötig. Und es stimmte weiter, wir hatten 28 Kilometer bis zum Stralsunder Hafen zu fahren, und unser Käufer, der Käpten Ole Pedersen der kleinen schwedischen Brigg »Svionia« war trotz seiner silbernen Ohrringe ein höchst zweifelhafter Bursche und würde alles versuchen, mich um den Kaufpreis zu prellen. Und zum dritten war es richtig, daß ich zum ersten Mal in meinem Leben eine derartige Aufgabe zu erfüllen hatte, weil nämlich unser braver Inspektor Hoffmann mit einem gebrochenen Bein im Bett lag.
Aber dies war mir nun doch zuviel! Schließlich war ich kein barer Säugling mehr, sondern schier dreiundzwanzig Jahre alt, Erbjunker auf, zu und von Strammin, so gut wie verlobt und Besitzer eines vielversprechenden rotblonden Bärtchens (und verdammt vieler Sommersprossen). Außerdem war unser liebes Stralsund kein Ort, wo die Ottern und der Rost hausen, oder wie es sonst in der Schrift heißt, sondern eine gute alte ehrbare Hafenstadt, voll tugendsamer Bürger, die einem Strammin in jeder Not und Gefahr beistehen würden!
So rief ich denn mit gewaltiger Stimme über den Hof: »Junghanns, abfahren!«, und der Vorspänner Junghanns knallte mit der Peitsche, seine Füchse warfen die Köpfe und legten sich in die Sielen: knarrend setzte sich der Vierzöller in Bewegung. Und der nächste Knecht knallte mit seiner Peitsche und der dritte, der siebente, der zehnte, der fünfzehnte – donnernd fuhr ein Gespann nach dem anderen durch die gewölbte Torfahrt, vierzig Füchse, einer wie der andere, und alle Knechte fuhren vom Sattel aus und sahen genauso stattlich und zuverlässig aus wie ihre Gäule. Stolz erfüllte wieder einmal mein Herz auf unser Rittergut Strammin, und ich wußte, die Knechte waren ebenso stolz wie ich, und ich bin überzeugt, selbst die Füchse waren stolz darauf, die schweren Weizenwagen für ein solches Gut ziehen zu dürfen!
»Wenn es euch recht ist, Mama, Papa«, sagte ich und machte ihnen eine kleine scherzhafte Verbeugung, »so wird sich euer Aushilfsinspektor jetzt auch auf die Strümpfe machen.« Und ich winkte mit den Augen dem Stallburschen, der meinen Reitfuchs Alex am Fuß der Freitreppe auf und ab führte.
»Du hast völlig Zeit, noch eine Tasse Tee mit uns zu trinken, Lutz«, sagte Mama.
»Und noch mehr Ermahnungen anzuhören, nein, ich danke schön!« rief ich. Aber als ich ihr Gesicht sah, bereute ich, was ich eben gesagt. »Oh, verzeih mir, Mama«, sagte ich eilig, »das war eben sehr ungezogen von mir! Aber ich glaube, ich möchte jetzt wirklich auf meine Reise: Alex wird schon recht unruhig. Aber ich verspreche dir, ich werde nur im ›Halben Mond‹ am Markt logieren, ich werde mit keinem Unbekannten trinken, kein junges Mädchen anschauen. Ich werde das Geld keine Minute von mir lassen …«
»Ich weiß, ich weiß«, antwortete Mama, schon wieder ganz versöhnt. »Den besten Willen hast du! Wenn du nur nicht gar so sehr ein Strammin wärest!«
»Und was fehlt den Strammins?« fragte Papa kriegslustig. »Was hast du an den Strammins auszusetzen, Amélie?«
»Daß sie sich in jedes Abenteuer stürzen, daß sie den Morgen schon über dem Vormittag vergessen, das fehlt den Strammins, Herr von Strammin«, antwortete Mama mit einiger Strenge, »daß sie keinem Mädchengesicht und keiner Spielkarte widerstehen können. – Nun, nun, Benno«, meinte sie, als Papa sehr rot wurde und Blitze durch sein Einglas schoß, »du hast doch wohl kaum Ursache, dich über diese Anmerkungen zu erregen. Wer hat diesen Winter von Cannes abgeraten? Wer hat gesagt: Monte liegt gar zu nahe? Und wer hat geantwortet: keinen Fuß setze ich in diese Spielhölle, keine Karte rühre ich dort an? Und nun? Warum fahren wir denn unsern letzten Weizen vom Hof und verkaufen ihn an einen Schuft von Schiffskapitän statt an unsern ehrenerprobten Kalander?«
»Er zahlt dreißig Mark für die Tonne mehr!« murmelte Papa, nun doch sehr betreten.
»Er wird sie nie zahlen«, erklärte Mama mit Entschiedenheit. »Er wird überhaupt nicht zahlen! Er wird unsern Jungen begaunern und ihn in tausend Verlegenheiten stürzen! Aber, Lutz«, wandte sich Mama wieder an mich, der bei dieser Auseinandersetzung wie auf Kohlen gestanden hatte, denn diese Person, die Thibaut, hatte das alles mit der spitzbübischsten Miene angehört, ein wahrer Gamin … »Aber, Lutz«, sagte Mama zu mir, »ich weiß, du wirst lieber ohne einen Pfennig Geld zurückkehren als mit dem kleinsten Flecken auf deiner Ehre.«
»Liebste Mama«, sagte ich und bückte mich, ihr die Hand zu küssen.
Aber sie zog mich an sich und küßte mich feierlich auf die Stirn. »Was man auch gegen die Strammins einwenden kann«, sagte sie dann, »in schwierigen Lagen hat ein Strammin immer gewußt, was ihm seine Ehre gebot. – Und ein Lassenthin auch«, setzte sie hinzu, denn Mama ist eine geborene Lassenthin, woran ich in den nächsten Tagen noch mehrfach eindringlich erinnert werden sollte.
»Und nun«, fuhr Mama mit einem jener plötzlichen Übergänge fort, die sie so liebt, und zog mich direkt vor Fräulein Thibaut, »sehen sie nach, Mademoiselle Madeleine, ob Lutz auch völlig comme il faut ist! Ich will doch, daß er in Stralsund gute Figur macht.«
Ich fühlte, daß ich unter dem hellen musternden Blick der »Eidechse« rot wurde. Dieses Frauenzimmer hat lange geschlitzte Augen, und sie kann mich damit so schamlos ansehen, daß ich rot werden muß. Jetzt sah sie mich von unten bis oben an, als sei ich nur ein Haubenstock, kein junger Mann. Ich trug lacklederne Reitschuhe von Breitsprecher in Berlin, die wie angegossen saßen, eine schwarz-weiß karierte Reithose und eine Joppe aus blaugetupfter schottischer Wolle – ich sah wie ein Prinz aus!
»Gestatten Sie, junger Herr«, sagte die Thibaut, stellte sich auf die Zehen und fing an, meinen Schlips aufzubinden. »Ich würde binden die Scarf un peux plus légère.«
Ich bin überzeugt, die Schleife saß völlig richtig, sie wollte mir nur am Halse herumfummeln, so nahe an mir stehen, daß sie mich berührte. Und nun hatte sie noch die Frechheit, mir zwischen den Lippen geschwind ihre Eidechsenzunge zu zeigen – kein Mensch weiß, was ein junger Mann von Familie auch auf dem Lande für Nachstellungen zu erdulden hat. »Machen Sie endlich Schluß mit dem Gefummel!« rief ich zornig und machte mich los. »Meine Schleife saß ausgezeichnet!«
»Comme il est ravissant!« rief Madeleine und klatschte in die Hände. »Le vrai Parsival! Toutes les jeunes filles à Stralsund sick werden verlieben!«
»Jawohl, in meine Sommersprossen!« rief ich ärgerlich, und dann nahm ich endgültig Abschied von Mama. Sie küßte mich noch einmal, diesmal auf den Mund; ich weiß, Mama ist stolzer auf mich, als je ein Mensch auf der ganzen Welt es sein kann.
Papa brachte mich noch einige Schritte. Ich hatte die Zügel des Alex über meinen Arm gestreift und hörte mit einiger Ungeduld seine neuerlichen Ermahnungen an: ich solle keinesfalls den Weizen auf das Schiff lassen, ehe ich nicht das Geld dafür in der Tasche hätte. Ich solle nicht unter Deck gehen und mit dem Kapitän trinken. Ich solle, wenn mir irgend etwas zweifelhaft erschiene, lieber die dreißig Mark Mehrgewinn pro Tonne schießenlassen und zu unserem alten Getreidehändler Kalander gehen: »Trotzdem wir jede Mark so nötig wie das liebe Brot gebrauchen, nötiger, lieber Lutz, nötiger!«
»Lieber Papa«, sagte ich energisch und löste meinen Arm aus dem seinen und stieg auf den Alex, »seit ich lebe, höre ich dies Gerede von der unentbehrlichen Mark. Und dabei haben wir noch immer recht hübsch gelebt, wie unsere Leute auch. Ich werde die Sache so gut regeln, wie ich kann, und wird doch etwas falsch, so werden wir doch genauso weiterleben wie vorher, du wirst abends deinen Rotspon trinken und über die schlechten Zeiten stöhnen. Gott befohlen und grüß die Mama noch schönstens!«
Damit gab ich Alex den Kopf frei und ließ Papa stehen, wo er stand. Die Wahrheit zu sagen, ich hatte jetzt allmählich den Bauch voll Zorn von all diesem jämmerlichen Geschwätz! War der Handel mit dem schwedischen Käpten wirklich so gefährlich, so hätte Papa ihn nicht abschließen dürfen, jedenfalls hätte er selber mitreiten können. Aber so war Papa immer: am liebsten setzte er alles auf eine Karte, und ging es dann schief, weinte er allen Leuten die Ohren voll. Natürlich konnte nicht die Rede davon sein, daß ich ernstlich auf Papa böse war. In ganz Vorpommern einschließlich Insel Rügen gab es keinen besseren und großzügigeren Papa. Aber er hatte eben auch die Schattenseiten der Großzügigkeit, er war, was man so »leichtes Tuch« nennt, und da ich von Mama ziemlich viel von den Lassenthins abbekommen habe, die sehr genaue Leute sind (wie genau, sollte ich noch heute erfahren), ärgerte mich das manchmal.
Aber der schöne junge Junimorgen, die Vögel, die noch so eifrig in meines Vaters Park lärmten, der Himmel voller Sonne – all dies und am allermeisten meine frische Jugend vertrieben diesen kleinen Ärger sofort. Ich rückte mich behaglich im Sattel zurecht und wollte eben den Alex zu einem munteren Trabe ausgreifen lassen, als ganz überraschend aus dem Busch eine Gestalt mir in den Weg trat. Der Alex machte einen Satz. »Hoho, Alex!« rief ich und klopfte ihm beruhigend auf den Hals. Und zu der Madeleine Thibaut: »Schon wieder Sie! Ich begreife nicht, wie Sie so schnell hierhergelaufen sein können. Aber ganz egal – ich habe genug von Ihnen, von Ihrem Schleiferichten und Zungezüngeln, fort mit dir, Alex!« Und ich gab dem Gaul die Sporen, aber nur sachte.
»Jungherr«, rief da die Thibaut hinter mir. »Lutz, ich brauche Ihre Hilfe!«
Auf diesen in ganz richtigem Deutsch gerufenen Notschrei parierte ich den Alex noch einmal. Denn die Madeleine beherrscht die deutsche Sprache vollkommen, und nur in ihren übermütigen Stunden gefällt sie sich in einem Radebrechen, das Mama höchlich amüsiert, mich aber gar nicht.
»Meine Hilfe?« fragte ich erstaunt. »Worin kann ich Ihnen wohl helfen, Madeleine?«
»Indem Sie dieses Päckchen in die Hände von Professor Arland am Königlichen Gymnasium in Stralsund geben«, sagte Madeleine und gab mir ein weiß eingewickeltes Paketchen, das mit einem himmelblauen Band umschlungen war. Ich nahm es unwillkürlich. »Sie müssen es ihm aber selbst geben, keiner darf zugegen sein, und Sie müssen erreichen, daß er es noch in Ihrer Gegenwart öffnet.«
»Das ist ein seltsamer Auftrag, Madeleine«, sagte ich unschlüssig und befühlte das Paketchen. Es war leicht, es fühlte sich an, als seien Papiere darin, Briefe. »Ich kenne Professor Arland gar nicht.«
»Er aber kennt Sie, oder er glaubt Sie zu kennen!« rief Madeleine heftig. »Und er glaubt, ein Recht zu haben, eifersüchtig auf Sie zu sein. Sehen Sie, Lutz, in diesem Päckchen sind alle Briefe, die er mir geschrieben hat, und wenn ich sie ihm nun durch Sie zurückschicke, und er sieht Sie selbst, Sie verstehen mich, Lutz …?«
Ich dachte, das Päckchen noch immer in Händen, nach. »Wenn ich aber Ihren Boten in dieser seltsamen Sache abgebe, Madeleine«, sagte ich dann, »so stehe ich doch gewissermaßen für Sie ein. Und wenn Herr Professor Arland auch unrecht tut, mir zu mißtrauen, so werden Sie doch zugeben müssen, daß Sie manchmal etwas freigebig mit den Blicken Ihrer Augen, mit Ihrem Eidechsen-Zünglein und – vielleicht auch mit Ihren Küssen sind, Madeleine?«
»So, bin ich das?« rief Mademoiselle Thibaut, jetzt wirklich zornig. »Aber wir sind gottlob nicht alle trockene pedantische pommersche Jungherren mit Fischblut in den Adern! Wir freuen uns an der Welt und an jeder guten Stunde und sehen einen Kuß für keine Sünde an. Aber, Lutz«, fuhr sie ruhiger und doch viel ernsthafter fort, und das elfenbeinfarbene Gesicht mit den geschlitzten Augen sah jetzt beinahe schön aus, »ich bin gar nicht sicher, daß nicht auch einmal Ihre Stunde schlägt, und dann werden Sie froh sein, wenn es nur mit einem Augenblitz und einem Kuß abgegangen ist. Da werden Sie verstehen, daß ein Herz treu sein kann, auch wenn ein Mund einmal untreu ist.«
»Nun schön, Madeleine«, antwortete ich, so halb und halb überzeugt. »Ich kenne Sie nun fast drei Jahre, und ich weiß, Sie sind trotz allen welschen Firlefanzes ein gutes Mädchen.«
»Kommen Sie her, Lutz!« rief sie. »Bücken Sie sich ein wenig!« Und als ich ihr ganz überrascht den Willen tat, warf sie mir die Arme um den Nacken und küßte mich drei-, viermal herzhaft auf den Mund. »So, und nun reiten Sie los, Lutz, und erzählen Sie dies, wie es sich begeben hat, dem Marcelin Arland, und wenn ihn das nicht von Ihrer Harmlosigkeit überzeugt, so soll ihn der Teufel holen und in der hintersten und heißesten Hölle mit der ältesten Hexe verkuppeln!«
»Welch eine Sprache im Munde eines jungen Mädchens!« rief ich empört, kaum war ich wieder zu Atem gekommen. »Und welch unglaubliches Benehmen!«
»Und welch langweiliger steifsitzender Landjunker!« rief sie lachend zurück. »Welch tumber, sittenreiner Parsival! Was für einen trefflichen Schulmeister Sie abgegeben hätten, Lutz!«
Damit lief sie durch die Büsche zurück zum Schloß, ich aber hielt da mit meinem braven Alexius, das ominöse Päckchen mit dem noch viel ominöseren Auftrag noch immer in der Hand. Da ich aber unmöglich zurückreiten und es vor Papa oder Mama dem schlimmen Mädchen zurückgeben konnte, verwahrte ich es seufzend in der Satteltasche und überließ es dem Schicksal, wie es mich mit Professor Arland zusammenbringen würde.
Ich überholte meine Vierzöller kurz hinter Strietz, das denen von Belau gehörig ist, nicht sonderlich wegen seiner Wirtschaftsführung berühmt. Dort waren sie aber schon bei der Heuernte, und ich unterhielt mich eine Weile mit unserem Großspänner Junghanns über die Wetteraussichten und ob wohl die Belaus recht hätten, die jetzt schon mähten, oder wir, die erst nach unserer Rückkehr aus Stralsund anfangen wollten. Nach meiner Ansicht hatte das Wetter noch keinen rechten Bestand.
Junghanns war aber nicht recht bei der Sache, er wollte lieber erfahren, wohin sie den Weizen fahren sollten, doch sicher wieder zu Kalander? Gerade das aber sollte auf Vaters Wunsch nicht erzählt werden, Vater wollte, ich sollte erst noch einmal mit dem schwedischen Käpten reden. So sagte ich nur, ich würde sie unbedingt kurz vor Stralsund abfassen, dort sollten sie auf mich warten, aber ich würde bestimmt schon vor ihnen da sein. Und in Nipperow sollten sie zwei Stunden füttern, ich würde ein Fäßchen Bier für sie auflegen lassen.
Während sich Junghanns noch bedankte, ritt ich schon los, und ich ritt in einem schlanken Trab bis Nipperow durch, wo ich am Vormittag gegen elf Uhr im Kruge haltmachte. Hier beging ich den ersten schweren Fehler an diesem Tage: in meiner guten Stimmung bestellte ich nicht nur ein Fäßchen Bier für meine Leute, sondern auch fünf Flaschen Stralsunder Korn, immer für vier Mann eine. Das ist an sich nicht viel, aber ich hatte nicht bedacht, daß Korn Durst auf mehr Korn macht und daß die Leute bei solcher Fahrt alle eigen Geld bei sich in den Taschen führten. Die Folgen sollte ich noch erleben, vorläufig war ich noch in bester Stimmung. Warum aber das? Weil mich ein Mädel schon am frühen Morgen geküßt hatte! Ich war in dieser Hinsicht nicht verwöhnt worden, einmal, weil Mama, die das leichte Stramminer Blut fürchtete, immer ein Auge auf mich gehalten hatte, zum andern weil ich wirklich ein etwas schwerfälliger Junge bin. Die Wahrheit zu sagen, unter all meiner guten Kinderstube steckte ein gut Teil Schüchternheit: ich hatte ein bißchen Angst vor den jungen Mädchen. So sicher ich tat, ich wäre maßlos verlegen geworden, hätte eine in meinem Arm gelegen. Kurz und gut, ich war an diesem Morgen noch das, was ich schon durch dreiundzwanzig Jahre gewesen war: ein rechtes Muttersöhnchen!
Ich glaubte, Madeleines Küsse noch auf meinen Lippen zu spüren, und in dieser Stimmung behagte mir weder das Geschwätz des Gastwirts noch die vielen Fliegen seiner Gaststube. Ich stieg wieder auf meinen Alex und ritt von neuem los. Wohin aber? Für Stralsund war es noch viel zu früh, mein Gespräch mit dem schwedischen Käpten dort war in zehn Minuten abgetan, und im Hotel »Halber Mond« würde ich heute abend noch lange genug sitzen müssen. Eine Mittagspause aber würde auch ich machen müssen, schon des Alexius wegen. So ritt ich denn von der Landstraße ab und auf kleinen Nebenwegen und Feldrainen der See zu. Strammin ist ein herrliches Gut, ich wünsche mir keine schönere Heimat, aber wir liegen ein wenig fern von der See, mehr als zehn Kilometer. Wir haben die Wolken von der See und den Wind von der See und oft die Möwen und den Geruch der See, aber wir haben ihren Anblick nicht. Darum haben wir wohl immer Sehnsucht nach ihr.
Nun gibt es genug breite Wege zur See, aber eben die wollte ich vermeiden. Genau hier in der Gegend sind die Schalenbergs begütert, und Bessy ist auch eine Schalenberg. Ich habe es schon gesagt, ich bin so halb und halb verlobt – und zwar mit der Bessy. Wir haben nie ein Wort über die Sache gesprochen, aber wir wissen beide, es ist so zwischen unseren Eltern besprochen, und im Grunde haben wir auch gar nichts dagegen. Bessy ist ein ganz prachtvolles Mädel, groß, weizenblond, schön; wenn ich etwas gegen sie habe, ist es das, daß sie mich immer eine Spur aufzieht, sie kann mich einfach nicht ernst nehmen. Das ist für jemand, der einmal den Ehemann abgeben soll, nicht sehr angenehm.
Das ist aber auch das einzige, was ich an Bessy auszusetzen habe, wir kommen immer glänzend miteinander aus. Sie versteht enorm viel von Pferden, reitet fast so gut wie ich, ist Jägerin – da kann einem der Gesprächsstoff nie knapp werden. Von einer himmelstürmenden Verliebtheit kann natürlich zwischen uns keine Rede sein, wir kennen uns von Kindesbeinen, wie man so sagt. Damals haben wir uns gegenseitig an den Haaren gerissen, und einmal habe ich sie auch ins Wasser geschmissen, sie aber gleich wieder rausgeholt. Heute sind wir die besten Kameraden, alles andere würde sich in der Ehe schon finden – dachte ich damals. Wir haben uns so eine Art dalbrige Sprache miteinander zurechtgemacht, die uns über jede Verlegenheit forthilft: verlobt und doch nicht richtig verlobt und vor allen Dingen nicht verliebt, nichts von Händedrücken und Küssen – ihr versteht mich schon. Da hilft so ein bißchen Dalbrigkeit über die stillen Minuten fort.
Nun, über den Grund und Boden dieser Schalenbergs ritt ich jetzt seewärts und hatte nicht den geringsten Wunsch, meine sogenannte Braut Bessy zu sehen. Ich hatte nicht etwa ein schlechtes Gewissen wegen der drei oder vier Küsse von Madeleine, ganz im Gegenteil: mit diesen Küssen hatte sie mich eigentlich überzeugt, daß man küssen kann, ohne untreu zu sein. Sondern ich wollte einfach allein sein. Ich wollte allein sein und die See anschauen. Wenn man noch jung ist, hat man solche Wünsche, später ist man sich selbst meist zur Last. Später kennt man sich selbst nur zu gut. Aber damals hatte ich noch keine Ahnung von mir und fand mich hochinteressant …
Nun, ich kam an die See, die hier natürlich nur »Bodden« heißt, gute zwei Kilometer ab hatte ich vor der Nase die gelbgrüne Küste Rügens. Ich hing dem Alex den Futterbeutel um, machte ihn mit langem Trensenzügel an einem Birkenbäumchen fest und warf mich selbst ins Gras. Zu essen hatte ich keine Lust. Ich lauschte auf den Seewind, ich hörte auf das Plätschern der Wellen, manchmal schrien die Möwen, dann schnaubte wieder Alex. »Jawohl, Alexius«, antwortete ich ihm. »Hier sind wir in Sonne und Wind, haben nichts auszustehen. Ich finde, wir haben es verdammt gut auf dieser schönen Erde.« Aber das war nur so ein allgemeines Gerede, ich war eben einfach glücklich, an was Besonderes habe ich nicht gedacht, weder an Küsse, noch an Weizen, noch an sonstwas. Einfach animalisch glücklich …
Nach einer Weile hatte ich dann doch keine Ruhe mehr, so gedankenlos dazuliegen, ich kramte in meinen Taschen herum und suchte meine Mundharmonika hervor. Von Musik verstehe ich wohlgemerkt gar nichts, und was man nun gar klassische Musik nennt, die ödet mich zum Sterben an. Aber meine Mundharmonika liebe ich über alles, und ich exerziere immer auf ihr, wenn ich mich wohl fühle. Natürlich suche ich dazu die stillsten Plätze auf, denn es wäre wohl ein wenig lächerlich, wenn bekannt würde, daß der Jungherr von Strammin auf der Harmonika flötet wie der kleinste Pferdejunge. Aber hier war ich schön allein für mich, der Alex war solche Vorführungen schon gewöhnt, sie störten ihn nicht, er fraß ruhig weiter.
Ich geriet gleich in eines meiner damaligen Lieblingslieder, ich hatte es einem Leutnant abgelauscht, der es sehr virtuos zur Zupfgeige einem Kreis von jungen Damen vorgeträllert hatte: das Lied vom entlaufenen Hasen mit den vielen Laridah. Eigentlich ist es jammerschade, daß der Mundharmonikaspieler nicht auch zu seinem eigenen Spiel singen kann, aber ich hatte mich schon an diesen Nachteil meines Instrumentes gewöhnt und sang jeden Vers innerlich gefühlvoll mit. Ich war gerade bei jener Strophe, die da heißt:
»Also, Herze, sei zufrieden,
Laridah!
Viele Hasen gibt’s hienieden,
Laridah!
Ist der eine dir entlaufen,
Laridah!
Kannst du einen andern kaufen.
Laridah!«
Da raschelte es hinter mir im Grase, Alex tat einen Schnober, ich sprang auf, und Bessy stand vor mir. »Habe ich Euer Liebden in Dero Gefühlen gestört?« fragte sie lachend und amüsierte sich schon wieder über meine Verlegenheit und die Hast, mit der ich meine Harmonika zu verstecken suchte, wo doch jedes Verstecken längst unnütz geworden war. »Welcher Hase ist Euch denn entlaufen, Erbprinz? Oder waret Ihr schon wieder bei einem neuen Ankauf?« Und sie trällerte gefühlvoll:
»Einen schönen, weichen, weißen,
Laridah!
Mucki-Nucki soll er heißen,
Laridah!«
»O, hör auf, Bessy!« bat ich. »Wo in aller Welt kommst du überhaupt her? Ich finde es gemein von dir, mich so zu überraschen!«
Sie betrachtete meine Verwirrung mit etwas mehr Nachdenklichkeit. »Also hat der Erbprinz von Strammin wirklich an einen andern Hasen gedacht. Lutz, Lutz, du entwickelst dich! Aus Knaben werden Männer!« Und sie setzte sich ins Gras.
Ich setzte mich neben sie. »Reden Dero Liebden bloß keinen Unsinn!« sagte ich, noch immer ärgerlich. »Ich habe überhaupt an keinen Hasen gedacht. Weder an entlaufene noch an neue. Ich habe das Lied so vor mich hin gedudelt, einfach, weil es mir gerade einfiel.«
»Komisch!« sagte die Bessy. »Wirklich komisch! Da reitet der hohe Herr fünfzehn Kilometer über Land, setzt sich ausgerechnet auf den Grund und Boden einer gewissen Prinzessin hin, spielt ein gefühlvolles Lied und behauptet, weder an die Prinzessin noch an andere Häschen gedacht zu haben. Wenn das nicht komisch ist!«
»Und doch ist es die reine Wahrheit«, widersprach ich eifrig. »Ich bin nämlich nicht extra hierhergeritten, sondern ich begleite unsere Wagen, die mit Weizen nach Stralsund fahren.«
Bessy setzte sich auf. »Wollt Ihr etwa auch Euern Weizen an den alten Schweden Ole Pedersen verkaufen?« fragte sie gespannt.
»Es soll eigentlich ein Geheimnis sein«, antwortete ich, »aber Dero Liebden dürfen es schon wissen: wir sind dessen willens!«
»Dann paß auf, Lutz!« sagte sie gespannt. »Der Alte wird dich bestimmt begaunern.«
Ich warf mich verdrossen zurück ins Gras. »Hör auf, Bessy. Diese Litanei höre ich nun schon Tag für Tag. Und überhaupt, was weißt du davon?«
»Genug, Erbprinz, mehr als genug. Weil wir ihm nämlich vorgestern 600 Zentner geliefert haben und weil Dero ergebenste Dienerin mit dem alten Schweden in seiner Kajüte gesessen und süßen Schwedenpunsch gesüffelt hat.«
»Bessy!« rief ich, setzte mich auf und starrte sie an. »Es ist doch nicht die Möglichkeit! Und er hat dich begaunert?«
»I wo!« lachte sie. »Ich habe unser Geld auf Heller und Pfennig bekommen, wir waren aber auch die Leimrute, mit der er euch andere ködern will! Und, ganz unter uns gesagt, Lutz, der Alte mit seinen Silberohrringen in den mäßig gewaschenen Ohren ist recht empfänglich für ein Mädchenlachen oder einen weißen Mädchenarm, vielleicht zahlte er auch darum so willig.«
Ich fühlte, wie mir das Blut zu Kopfe stieg. »Bessy –!« rief ich. Aber dann lachte ich. »Auch du singst heute eine andere Weise als sonst, Schalenbergerin! Dein Vater oder dein Bruder würden es nie zugelassen haben …«
»Es gab aber keinen Vater oder Bruder, ich war ganz allein. Glaubst du nicht, daß man einer Bessy von Schalenberg nicht anvertrauen kann, was man einem Lutz von Strammin anvertraut? Oder hast du euern alten Hoffmann dabei?«
Ich fühlte, unsere Unterhaltung geriet stark auf ein gefährliches Gleis, aber nun gab es schon kein Zurück mehr. »Und wenn dies auch alles so ist, Bessy«, sagte ich hitzig, »so werde ich doch nie glauben, daß du mit einem alten schmierigen Segelschiffskapitän allein in seine Kajüte gestiegen bist, mit ihm getrunken hast und diesen Arm –« ich faßte ihn und empfand trotz meines Zornes flüchtig, wie schön kühl und lebendig er sich anfaßte, »und daß du diesen Arm um seinen Hals gelegt hast, bloß um ein paar Mark mehr herauszuschinden!«
»Und wenn ich es getan hätte,« sagte Bessy sanft (ich hielt noch immer ihren Arm), »würde es Euer Liebden Kummer machen, würde es Euer Liebden auch nur etwas angehen?«
Sie sah mich sehr ernst an, und ich hatte stärker denn je das Gefühl, daß sie mit mir Katz und Maus spielte. »Wegen Geld, Bessy!« rief ich mahnend. »Bedenke wohl, wegen ein paar schmieriger Taler!«
»Jawohl«, antwortete sie arglistig. »Wegen ein paar schmieriger Taler. Vielleicht aber auch darum, weil es mir Spaß machte, einen alten Gauner zu begaunern.«
»Und darum hast du deinen Arm um seinen Nacken gelegt, Bessy?«
»Darum! Und vielleicht habe ich darum sogar noch mehr getan, vielleicht habe ich ihm darum sogar noch einen Kuß gegeben! – Oh, nur einen Kuß auf die Backe!« rief sie eilig, als sie die Veränderung meines Gesichtes sah.
Aber ich hatte ihren Arm schon so hastig von mir gestoßen, als sei er eine giftige Schlange. »Ich danke Ihnen, mein Fräulein!« rief ich. »Sie brauchen mir nichts weiter zu erzählen. Dies ist genug!« Ich schüttelte die Hände und sah sie in ratloser Wut an. »Aber verstehen Sie gar nicht …?« rief ich wieder. »Nein, ich sehe, Sie verstehen nichts! Aber dies ist wahrhaftig genug!« Ein anderer Gedanke überkam mich. Ich mußte lachen. »Weiß Gott, es trifft sich ausgezeichnet, daß mich heute zum frühen Morgen schon ein schönes Mädchen abgeküßt, so bin ich doch wenigstens nicht der Betrogene!«
Damit ließ ich sie stehen, wo sie stand, und wandte mich meinem Alex zu. Aber ich war erst dabei, ihm seinen Futterbeutel abzunehmen, als sie mich an der Schulter berührte. »Höre, Lutz, was du eben gesagt hast, das war doch gelogen?«
»Es war so wenig gelogen wie deine Geschichte von dem Ole Pedersen«, antwortete ich und wechselte die Trense mit der Kandare aus.
Sie starrte mich nachdenklich an. »Ich glaube es nicht«, sagte sie. »Alle wissen, daß du mir bestimmt bist, und keine würde es wagen –«
»Wagen –« frage ich und drehte mich scharf nach ihr um. »Es ist also ein Wagnis, mich zu küssen? Für Fräulein Bessy aber ist es kein Wagnis, einen alten schmierigen Schiffskapitän abzuküssen?«
»Ach, hör auf mit dem Unsinn!« rief sie und stampfte zornig mit dem Fuße auf. »Ich will es wissen, wer dich geküßt hat!« Sie sah mich prüfend an, ich fühlte, wie ich rot wurde unter ihrem Blick, als könnte sie meine Gedanken erraten. Und wirklich, sie rief: »Die Thibaut! Die kleine Katze mit ihren Schlitzaugen und dem galligen Teint! Siehst du, jetzt habe ich dich erwischt! Ich habe es schon immer gesehen, wie sie um dich rumgetänzelt und geschwänzelt ist, aber ich dachte, du wärst zu dumm … Hast du es also endlich doch gemerkt?«
Meine Wangen brannten vor Scham. Ich richtete mich steif auf: »Erstens möchte ich dich darauf aufmerksam machen, daß man sehr wohl eine küssen, einer andern aber im Herzen treu sein kann …«
Sie rief spöttisch: »Oh, welch eine Weisheit aus dem Munde von Dero Liebden! Es ist mir genau, als hörte ich die kleine falsche Katze miauen …«
»Und dann«, fuhr ich unbeirrbar fort, »vergißt du ganz, daß du schon vorgestern wegen Geld, wohlgemerkt, wegen Geld einen alten Käpten abgeküßt hast und daß seitdem alles zwischen uns zu Ende ist, daß es dich seitdem nichts mehr angeht, wen ich küsse.«
Ich setzte einen Fuß in den Bügel und schwang mich in den Sattel.
»Wann es zwischen uns zu Ende ist, das werde ich dir schon rechtzeitig sagen«, rief Bessy und warf ihren Kopf zurück. »Das aber verspreche ich dir, ich werde heute nachmittag dein Fräulein Thibaut besuchen und werde ihr sehr gründlich beibringen, was ich über diese Küsserei denke!«
Ich hatte schon reiten wollen, aber nun hielt mich der Schreck an. »Bessy«, sagte ich, »das wirst du nicht tun. Ich schwöre dir, Madeleine – Fräulein Thibaut ist ganz unschuldig. Ich, ich habe ihr ein paar Küsse gestohlen – ganz gegen ihren Willen!«
Sie lachte. »Ich hoffe, diese Küsse sind etwas geschickter ausgefallen als deine Lügen, Lutz, sonst ist die Thibaut bestimmt nicht auf ihre Kosten gekommen. Und nun reite zu, mein Freund, und kümmere dich um deinen Weizen, ich werde mich schon um deine anderen Angelegenheiten kümmern!«
Sie hatte dem Alex einen Schlag versetzt, ich zügelte ihn aber noch einmal und sagte bittend: »Bessy, willst du diesen Besuch bei Fräulein Thibaut nicht noch um einen Tag verschieben? Laß uns morgen noch einmal hier an dieser Stelle sprechen – mit kälterem Blute!«
»Nichts da, mein Freund!« rief Bessy. »Ich will die Katze meine Maus fangen lehren! Ab mit euch, Jungherr!«
»Es ist also aus mit uns«, sagte ich und ritt ab, Wut und Verzweiflung im Herzen.
Am liebsten hätte ich kehrtgemacht und wäre in einem gestreckten Galopp heim nach Strammin geritten, die kleine Eidechse Madeleine auf diesen Besuch vorzubereiten, aber konnte ich meinen Weizen im Stich lassen? Und was hätte ich schließlich in Strammin ausrichten können? Die Madeleine konnte sich ein–, vielleicht sogar zweimal vor der Bessy verstecken, aber das würde die Bessy nie entmutigen. Und selbst wenn ich mir vorstellte, ich würde als getreuer Ritter die Unschuld Madeleines an ihrer Seite gegen Bessys Verdacht verteidigen – ich hatte eben schon eine recht traurige Figur abgegeben, ich war mir gar nicht sicher, daß ich bei einem zweiten Kampf besser abschneiden würde. Schließlich war die Madeleine auch kein heuriger Hase und würde sich ihrer Haut schon wehren, nicht umsonst hatte sie dies Zünglein!
Aber die Bessy, die Bessy war viel wichtiger, diese meine sogenannte Braut, mit der nun alles zu Ende sein sollte, was sie aber nicht wahrhaben wollte. Ich muß gestehen, die Schamlosigkeit, mit der sie ihr Vergehen mit dem alten Käpten als völlig nebensächlich behandelte, machte sie mir ganz abscheulich. Aber dabei gefiel sie mir in anderer Hinsicht eigentlich zehnmal besser als früher! In unsere kühlen Beziehungen war ein Wirbelwind hereingefahren, und ich hatte die vertraute Jugendgefährtin mit ganz anderen Augen als früher angesehen. Freilich, der Himmel sollte mich vor solch einem Eheweib bewahren, die mich schon jetzt so völlig als ihr Eigentum ansah! Zu Ende war es mit uns, und nachdem sich der Sturm in meinem Innern erst etwas gelegt hatte, kam ich ganz von selbst dazu, den Vers aus dem Hasenlied vor mich hinzusummen:
»Ach, mein Schatz ist durchgegangen,
Laridah!
Erst wollt’ ich ihn wiederfangen,
Laridah!
Doch dann hab’ ich mich besonnen,
Laridah!
Manch’ Verloren ist Gewonnen,
Laridah!«
Unter solchen Gedanken war ich längst wieder auf die große Landstraße nach Stralsund gelangt und hatte auch schon den und jenen am Wege Arbeitenden nach meinen Weizenfuhrwerken gefragt. Sie waren aber noch nicht vorbeigekommen. Eigentlich hätte mich das nachdenklich machen müssen, denn der Nachmittag war nun immerhin schon ziemlich weit vorgerückt, aber in meiner augenblicklichen Stimmung lag es mir nicht sehr, viel über Fuhrwerke nachzudenken: ich hatte mit mir selbst genug zu tun. Ich sagte mir, daß bei einer solchen weiten Überlandfuhre immer etwas vorkommt: eine Deichsel bricht, ein Reifen läuft vom Rade, oder sie hatten einfach zu lange Mittagspause gemacht. Damit war ich der Wahrheit ziemlich nahegekommen, und nun hätte ich eigentlich an den von mir gespendeten Stralsunder Korn denken müssen. Ich tat’s aber nicht, weil ich nämlich gerade an den Käpten Ole Pedersen dachte. Ich ließ den Alex rascher ausgreifen, ich war plötzlich ganz begierig darauf, dem Schiffer in seiner Kajüte gegenüberzusitzen und ihm meine Meinung über junge Mädchen, weiße Arme und alte Männer zu sagen.
Ich war schon gar nicht mehr weit ab von Stralsund, höchstens sechs, sieben Kilometer, und sah schon die Türme der ehrenfesten guten Stadt: Nikolai, Marien und Jakobi, da zügelte ich den Alex, denn mir entgegen kam am Straßenrand ein Männlein mit einer Aktentasche gewandelt oder richtiger gehumpelt, nämlich der Geheime Justizrat, Rechtsanwalt und Notar, Herr Gumpel. Der Herr Gumpel ist mir seit meinen Kindertagen eine wohlvertraute Figur, er ist nämlich der Berater aller Familien und Höfe um Stralsund herum weit und breit, der Schlichter aller Streitigkeiten, der verschwiegene Mitwisser der tiefsten Familiengeheimnisse. Darum erstaunte und bekümmerte es mich, den würdigen Mann hier mit wunden Füßen die Landstraße entlang wandeln zu sehen, denn jede Familie hätte es sich zur Ehre gerechnet, Herrn Gumpel beliebig viele Meilen im besten Kutschwagen spazierenzufahren.
Ich parierte darum meinen Alex und rief erstaunt: »Ja, Sie, Herr Geheimrat? Was machen Sie denn in aller Welt hier zu Fuß auf der Landstraße?«
Die finstere Miene des Geheimrates erhellte sich ein wenig bei meinem Anruf. Er setzte die Aktentasche umständlich ins Gras, zog ein Taschentuch hervor und trocknete sich die Stirn. »Sieh da! Sieh da!« sprach er dabei. »Der Jungherr von Strammin! Das erste freundliche Gesicht, das ich auf diesem unfreundlichen Wege sehe. Wir geht es der Frau Mama? Und dem Herrn Papa? Ich dachte eigentlich, er würde mich vor der Ernte noch einmal rufen!«
»Ach, denen geht es allen gut, Herr Geheimrat«, antwortete ich etwas ungeduldig, »und ich fahre heute vierhundert Zentner Weizen nach Stralsund, so daß Papa diesmal wohl ohne Ihre Hilfe bis zur neuen Ernte durchkommen wird! Aber was machen Sie hier so mutterseelenallein auf der Landstraße? Wer hat verbummelt, Ihnen den Wagen zu schicken?«
»Niemand hat es verbummelt, Lutz«, antwortete der Geheimrat mit ernster Miene. »Die Wahrheit ist: ich schleiche hier wie ein Indianer auf dem Kriegspfade. Ich will jemanden überraschen, der mich angemeldet nicht empfangen würde.«
»Aber wie ist das möglich?« rief ich und sah ratlos in die Runde über unser schönes vorpommersches Flachland, aus dem sich da und dort zwischen Baumgruppen oder Parks die Giebel der Gutshäuser erhoben. »Wen gibt es denn bei uns, der Sie nicht jederzeit gern empfangen würde, Herr Geheimrat?« Plötzlich aber schwieg ich stille, wie auf den Mund geschlagen, denn mein Auge war auf ein etwa zwei Kilometer entferntes grauschwarz verwittertes Haus gefallen, dessen oberste Fensterreihe gerade noch über dunkle Tannen zu uns hersah, fast drohend hersah, schien mir. »Ach so!« schloß ich ganz kleinlaut.
»Sehen Sie, Lutz!« sagte der Geheimrat. »Sie wissen es auch, und es ist sogar ein Onkel von Ihnen, oder genauer: ein Großonkel. Durch die Frau Mama nämlich …«
»Ich weiß schon«, antwortete ich etwas mürrisch, denn das klang fast wie ein Vorwurf, »der alte Herr von Lassenthin. Aber in unserm Hause wird sein Name nie genannt, wir legen keinen Wert auf diese Verwandtschaft, Mama schon gar nicht. Und wenn wir ihn unter uns nennen, unter uns jungen Leuten nämlich, so nennen wir ihn nur den Rauhbold.«
»Auch ich«, sagte der Geheimrat Gumpel wehmütig, »habe nie gedacht, daß ich dieses Haus wieder betreten würde. Aber, Lutz, mein Junge, wenn man um Hilfe gebeten wird, von einem Schwachen, der sich selbst nicht helfen kann …« Ich muß wohl den alten Herrn sehr gespannt angesehen haben, denn er brach seine Rede sofort ab, es deuchte ihn wohl, er habe schon zuviel verraten. »Aber das sind schlimme Geschichten, Lutz«, fuhr er fort, »von denen so ein junger Mensch wie du am besten nichts weiß, und so will ich denn weiterpilgern auf meinem Wege.«
»Nein, Herr Geheimrat«, rief ich entschlossen, »wenn Sie so ohne Zögern bereit sind, dem Schwachen zu helfen –«
»Nicht ohne Zögern, Lutz, sondern nur sehr, sehr zaghaft.«
»– so habe ich auch noch eine halbe Stunde Zeit, Sie bis an Ihr Ziel zu bringen. Meine Weizenfuhrwerke sind noch immer nicht in Sicht, und so steigen Sie auf meinen Alexius und schonen Ihre wunden Füße. Alex ist lammfromm, wenn ich ihn am Zügel führe.«
Eine Weile protestierte der alte Herr noch wegen der Ungelegenheiten, die er mir machte, aber wie bei vielen war sein Fleisch schwächer als sein Geist, der wahrhaftig völlig furchtlos war. So saß er denn bald mit baumelnden Beinen auf meinem Fuchsen, der sich ein paarmal verwundert nach dem seltsamen Reiterlein umsah, aber mir willig genug am Zügel ging.
Je näher wir kamen, um so mehr versank Ückelitz (so heißt der Besitz des alten Herrn von Lassenthin) zwischen den schwarzen Tannen, keine Fenster blickten mehr zu uns hinüber. Um so mehr aber dachte ich an den alten Herrn, den ich nur drei- oder viermal in meinem Leben gesehen hatte, den ich aber sehr gut in Erinnerung hatte als einen schweren, großen Mann mit einem rotbraunen Gesicht, einem weißzottigen wüsten Bart, ganz kahlem Schädel und scharfen, hellen, sehr kleinen Augen unter borstigen weißen Augenbrauen. Er war ein wirklicher Kinderschreck, ein wahrer »Rauhbold«, und so hatte er sich auch immer benommen. Mit allen Nachbarn hatte er Streit angefangen, immer hatte er Prozesse geführt, auf den eigenen Vorteil aufs kleinste bedacht. Nie aber hatte er an die Rechte der andern gedacht, mit wahrer Freude hatte er auf Feld und Flur der andern gejagt, gewildert muß man schon sagen, und traf ihn etwa der Jagdherr, so hatte es ihm nichts ausgemacht, den auch noch zu verprügeln. Das hatte viele schlimme Geschichten gegeben, die nicht alle hatten vertuscht werden können, so geschickt der Geheimrat Gumpel auch war.
In den letzten Jahren war es stiller geworden um den »Rauhbold«, kein Mensch hatte mehr etwas mit ihm zu tun haben wollen, er hatte einsam und schon halb vergessen, ein böser Menschenfeind, in seinem Ückelitz gehaust. Dann war noch einmal ein großes Gerede gekommen, aber diesmal nicht über den Vater, sondern über den Sohn, denn einen Sohn hatte der alte Herr von Lassenthin, wenn auch schon längst keine Frau mehr. Den Sohn, meinen Onkel also, aber keine zehn Jahre älter als ich, den Gregor von Lassenthin, kannte ich besser, und ich konnte ihn vielleicht noch weniger ausstehen als den Vater. Der Alte war doch wenigstens ein Kerl, wenn auch ein unangenehmer, der Sohn aber war so ein richtiger Schönling, ein Frauenmann, weibisch, künstlich. Er kam selten genug zu uns herauf nach Vorpommern, meist lebte er in Italien oder in München, und manche sagten, er sei ein richtiger Kunstmaler in Öl. Ich habe aber nie ein Bild von ihm zu sehen bekommen, und wenn er bei uns war, tat er nichts als zwischen Weiberröcken herumzuhocken und Lieder zur Laute zu singen und allen Mädchen die Köpfe zu verdrehen. Einfach ein Horror, dieser Kerl.
Daß es zwischen einem solchen Vater und einem solchen Sohn nie gut gehen konnte, war klar, und Gregor war im Jahr auch immer nur höchstens vier Wochen auf Ückelitz, wahrscheinlich gerade die Zeit, die not war, dem Alten das Geld für ein weiteres Jahr Lieder- und Luderleben abzujagen. In der letzten Zeit sollte es aber zu einem völligen Bruch zwischen den beiden gekommen sein, denn Gregor war, wie das Gerede erzählte, ehrlos mit der jungen Frau eines andern durchgegangen. Der hatte ihn gestellt, aber Gregor war feige gekniffen und hatte sich bei seinem Vater verstecken wollen. Ehrlos war der Alte nie gewesen, er hatte den Sohn vor die Pistole des andern zwingen wollen, war dann selbst für ihn eingetreten und hatte den Sohn für ewig verflucht …
Was an all diesen Geschichten wahr und was erfunden war, das wußte wohl außer den zunächst Beteiligten nur der alte Geheimrat da auf meinem Alex, und daß der mir nichts erzählen würde, das wußte ich. Im Grunde war es mir auch ganz egal, diese sogenannten Weibergeschichten sind mir immer ein Horror gewesen, und ich habe den Gregor schon deswegen nie ausstehen können, weil er, der mit den Frauen so schmeichelte und galant tat, in Herrengesellschaft beim Wein stets die schmutzigsten Geschichten erzählte. Rein um unsern stillen Weg etwas zu beleben, fragte ich aus meinen Gedanken heraus plötzlich den alten Geheimrat: »Was macht eigentlich der Gregor? Ist er jetzt auf Ückelitz oder treibt er sich wieder in der Welt herum?«
Meine unerwartete Frage warf den alten Rat beinahe aus dem Sattel. »Oh Gott!« rief er. »Lutz, nun fragst du mich auch noch nach dem Unglücksmenschen, und ich grübele die ganze Zeit darüber, wie ich zu ihm komme, ohne daß der Alte es merkt!«
»So ist der Gregor also auf Ückelitz?« fragte ich weiter. »Die Leute erzählen doch …«
»Glaube du den Leuten und ihren Erzählungen nie ein Wort«, sagte Herr Gumpel streng. »Es ist alles ganz, ganz anders.« Er schüttelte traurig den Kopf und sah mir prüfend von oben ins Gesicht. »Du hast so ein gutes offenes Gesicht, Lutz«, fuhr er fort, »und ich möchte dich um nichts in der Welt in diese schlimme Geschichte mengen, ich dürfte ja nie wieder deiner Frau Mama die Hand geben! Und doch grübele ich schon die ganze Zeit, ob ich dich nicht um einen kleinen Dienst bitten kann.«
»Und was wäre das für ein Dienst?« fragte ich, etwas neugierig und etwas ungeduldig.
»Sieh einmal, Lutz, mein Junge«, sagte der Geheimrat vorsichtig. »Ich habe es dir ja schon gesagt, ich muß den Sohn sprechen, ohne daß der Vater es merkt – in einer gerechten Sache wohlgemerkt! Würdest du es nun für möglich halten, daß du mir vorausrittest und dich bei dem alten Rauhbold – Gott sei’s geklagt – melden ließest und ihn nur etwa eine Viertelstunde im Gespräch festhieltest? Schließlich bist du doch sein Neffe, sein Großneffe, will ich sagen.«
»Ich kann verdammt schlecht lügen, Herr Geheimrat«, meinte ich bedenklich. »Was sollte ich denn für einen Vorwand haben?«
»Ach, irgendeinen. Daß dein Pferd lahmt oder daß dir schlecht geworden ist …«
»Das würde er mir beides nicht glauben. Aber ich könnte ihn wegen der Weizenlieferung an Ole Pedersen um Rat fragen. Nur, Herr Geheimrat, ich möchte wirklich nicht gern was für Gregor gegen den Alten tun. Ich kann den Gregor noch weniger ausstehen als den Alten.«
»Aber ich habe dir doch gesagt«, der Geheimrat war jetzt endgültig in dem gewohnten ›Du‹ angelangt, das er nur Mamas wegen immer wieder zu verbessern suchte, »ich habe dir doch gesagt, daß du für einen Schwachen kämpfen sollst.«
»Ach«, sagte ich in meinem Jugendtrotz, »für dieses weggelaufene Frauenzimmer …«
»Still! Still!« rief der Geheimrat fast, sah sich nach allen Seiten um und legte den Finger auf den Mund. »Du weißt nicht, was du redest, du hast auf Geschwätz gehört, und das sollte ein Ehrenmann nie tun. Also willst du mir helfen oder willst du nicht?«
Meine Heimat Vorpommern ist ein schönes Land, das ich über alles liebe. Aber es ist kein geheimnisvolles Land, so wie es offen und plan daliegt, entbehrt es der Überraschungen und Abenteuer. Ich war jung, hier winkte ein Abenteuer, eine verlästerte Frau, ein schwächlicher Verführer, ein kauziger Alter: ich überlegte keine Minute, da sagte ich schon: »Ich will, Herr Geheimrat!«
»Ich danke dir, Lutz, mein Junge«, sagte der alte Herr und schüttelte mir die Hand. »Und du sollst mir nur in dieser einen kleinen Sache helfen, denn der Himmel verhüte es, daß deine Mutter mir einmal Vorwürfe machen sollte.«
»Nun, Herr Geheimrat, eines müssen Sie mir schon außerdem noch erlauben, daß ich nämlich hinterher mit meinem Alex hier auf Sie warte und Sie heil nach Stralsund bringe.«
Man sieht, den Weizen und den Käpten Ole Pedersen, die Briefe der kleinen Madeleine und die zornige Bessy hatte ich schon vollkommen vergessen, so tief steckte ich bereits in meinem neuen Abenteuer. Ich war damals eben wirklich nicht mehr als dreiundzwanzig Jahre alt, nein, kaum soviel. Wir entwarfen nun noch unsern Schlachtplan, der einfach genug war: ich sollte offen auf den Hof reiten und mich beim Alten melden lassen, während der Geheimrat Gumpel indes von der Gartenseite ins Herrenhaus und beim Gregor eindringen sollte.
Ich saß wieder auf, und wir schüttelten uns noch einmal die Hände. »Hals- und Beinbruch, Lutz«, sagte der alte Herr fast gerührt. »Und wenn etwas schiefgeht, denke zuerst an deine Frau Mama und an dich. Ich bin ein alter juristischer Fuchs und solviere mich schon aus den schwierigsten Lagen.«
Ein wenig bänglich ritt ich nun doch auf den großen Hof, der selbst an diesem schönen Junitag finster und öde dalag. Die Hufe meines Alex klapperten über die Pflastersteine, zwischen denen Gras genug wuchs, aber kein Mensch ließ sich sehen, dem ich die Zügel des Gauls in die Hände geben könnte. Öde und grau blickten die Fenster des Herrenhauses auf mich herab, als lebte kein Mensch hinter ihnen. So mußte ich schon mein eigener Stallbursch und Anmelder sein, ich schlang des Alex Zügel um die gebrechlichen Reste eines Staketenzaunes und stieg die Stufen zur Haustür hinauf.
Ich war aber noch nicht auf der letzten, da flog die Tür auf, als hätte ein Fußtritt sie gesprengt, und in der Öffnung stand mein Großonkel in eigener Person und schrie mich an: »Mach, daß du von meinem Hof kommst, du Bengel! Ich bin für niemanden hier, hüt bün ick mißkumpabel!«
Dabei sah er mich unter seinen buschigen Brauen so zornig an, daß ich es ihm ohne weiteres glaubte, daß er »mißkumpabel« war, was wohl nach allgemeinem Sprachgebrauch »schlechter Laune« heißen sollte. Ich machte aber meine beste Verbeugung und sagte sehr höflich, wenn auch meine Stimme ein bißchen zitterte. »Ich bin der Ludwig von Strammin, Herr Großonkel, und hätte Sie gerne um eine Auskunft gebeten.«
»Strammin?« schrie er. »Strammin? Denkst du, Jüngling, das mußt du mir erst sagen? Ich kenne eure ekelhaften Visagen seit hundert Jahren, und sie waren mir schon verhaßt, ehe du noch geboren warst!«
»Nun, Herr Großonkel«, antwortete ich, und mein Herz pochte dabei wie ein Dampfhammer, denn der Herr von Lassenthin sah aus, als würde er mich jeden Augenblick die Treppe hinabwerfen, und das wäre ein unauslöschlicher Flecken auf meiner Ehre gewesen. »Wenn Ihnen der Name Strammin so gut bekannt ist, so werden Sie auch wissen, daß mein Vater fast der einzige Mann in Vorpommern ist, mit dem der Herr Großonkel noch keinen Streit gehabt haben!«
Der alte Herr lachte plötzlich auf, aber es war kein gutes Lachen. »Gut gekräht, junger Gockel!« rief er. »Und nun denkst du wohl, ich fange jetzt mit dem Sohn einen Streit an? Aber ich streite mich nicht mit Kindern und jungen Hunden, die verprügele ich nur!«
Die Röte stieg mir in die Wangen. »Es ist gut, Herr von Lassenthin«, sagte ich. »Ich bin in Ihren Augen nur ein dummer Junge, den Sie getrost beleidigen können. Aber es ist eines alten Mannes unwürdig, was Sie sagen, und Sie haben es fertiggebracht, daß ich mich zum ersten Mal in meinem Leben schäme, daß meine Mutter eine geborene Lassenthin ist.« Damit machte ich kurz kehrt und stieg die Treppe wieder hinunter.
»Halt!« rief der Rauhbold, und als ich ohne zu hören weiter hinabstieg, war er in einem Augenblick bei mir und legte seine Hand schwer, aber nicht unfreundlich auf meine Schulter. Er sah mich durchdringend an. »So scheint doch noch nicht alles alte gute Blut verplempert und versickert. Sieh mich an, Junge! Ich bitte dich um Verzeihung für das, was ich gesagt habe.«
Ich zögerte noch, seine Hand zu nehmen. »Was Sie gesagt haben, sollte nie unter Ehrenmännern gesagt werden«, beharrte ich.
»Ich bin doch nur der Rauhbold«, lachte er. »Wer wird ernst nehmen, was ich sage? Komm, mein Junge, sei kein empfindsames Weib, komm mit mir! Ich will ein Glas Wein mit dir trinken und sehen, was ich für dich tun kann. Und das ist mehr, als ich in zehn Jahren hundert Nachbarn angeboten habe.«
Damit hatte er seinen Arm in meinen geschoben und führte mich, ehe ich noch überlegen konnte, durch die Tür, durch eine große düstere Halle in ein großes Zimmer, das ganz dunkel gewesen wäre, hätte im Kamin nicht trotz des warmen Junitages ein gewaltiges Feuer aus Buchenkloben gebrannt. Das Zimmer aber sah so aus, als hätte seit Jahren keine Frauenhand dort saubergemacht. Durch die verschmutzten Scheiben drang kaum noch Licht, und die einst schönen Perser des Bodens waren kaum noch unter Staub und trocken gewordenem Dreck zu erkennen.
Der Alte warf sich ächzend in einen Sessel vor dem Feuer und sagte: »Ich bin ein Höhlenmensch geworden, hier hause ich jahraus, jahrein. Nicht nach deinem Geschmack, Jungchen? Mein geschniegelter Laffe von Sohn mißbilligt dies auch äußerst …« Er unterbrach sich und sah mich plötzlich wieder drohend an: »Hast du etwa was mit dem Gregor? Kommst du seinetwegen?«
Mit einiger Haltung antwortete ich: »Ich habe meinen Onkel Gregor seit rund zwei Jahren nicht gesehen, und ich habe nicht das geringste mit ihm!«
Mein Großonkel lachte: »Ich sehe schon, du kannst den Zieraffen ebensowenig wie ich ausstehen, und recht hast du! Ich finde ihn auch ekelhaft. Aber für einen Vater ist so etwas schwerer als für einen Neffen.« Er starrte mich unter seinen buschigen Brauen durchdringend an. »Es ist das Blut, Junge«, sagte er. »Achte immer auf das Blut! Guck nicht auf die Schönheit des Mädels, denk an das Blut! Sieh dir die Eltern an und die Großeltern, horche nach den Ahnen! Der einzelne ist nichts, das Blut ist alles. Ach, wie ich die Stunde schon tausendmal verflucht habe, wo diese hübsche Fratze mir in den Weg lief!« Er starrte durch mich hindurch. Er stöhnte fast: »Und jetzt wieder, jetzt schon wieder …«
Es war mir fast unheimlich vor diesem alten Mann in dieser finsteren Höhle. Das Feuer warf blutige Flecken über sein wildes, verwüstetes Gesicht, aber wie da ein Stück Stirn, der Mund, die scharfe Raubvogelnase aus dem Dunkel huschten, lag nichts Schlechtes im Licht, nur wilder Kummer, Trotz und Eigensinn. Mir fiel ein, daß dem Rauhbold vieles nachgesagt wurde, aber nichts Unehrenhaftes. Und mir fiel auch ein, daß ich mich unter einem lügenhaften Vorwand bei dem Alten eingeschlichen hatte und daß ich zu Unrecht hier als Gast an seinem Kamin saß. Es schien mir schon ganz unmöglich, meinen lächerlichen Vorwand anzubringen, ich würde ihn jetzt nicht mehr belügen können, nicht nach dem, was er eben gesagt hatte.
Nach seinen letzten finsteren Worten hatte der alte Herr von Lassenthin stumm in die Flammen des Kamins gestarrt, und nach seinem Gesichtsausdruck waren es keine fröhlichen Bilder, die er dort sah. Plötzlich aber schüttelte er das alles ab, so plötzlich wurde sein Gesicht freundlich, daß es mich rührte.
»Aber ich vergesse meinen Gast«, sagte der Rauhbold, »den ersten Gast, den ich seit manchem Jahr an meinem Feuer sitzen habe. Dort steht Wein, da sind Zigarren, greif zu, junger Strammin!« Ich dankte höflich, ich rauche weder, noch trinke ich um diese Stunde. »Möchtest du diese ekelhaften Dinger, die Papyrossen? Da müßten wir meinen Herrn Sohn, den Fatzken, bemühen, ich täte es nicht gern.« Ich dankte wieder, das Herz wurde mir immer schwerer, je freundlicher er wurde. »Und nun erzähle«, fuhr er fort, »welch Anliegen du hast! Bist du ein bißchen klamm –? Du verstehst mich, in deinen Jahren war dein Vater immer klamm. Oder hast du sonst Sorgen? Ein Mädchen –? Ich helfe dir schon, ich habe nie ein kleines Herz gehabt.« Der Rauhbold schlug sich gegen seinen Brustkasten, daß es dröhnte. »Nein, für all das Gesindel hier im Lande war mein Herz immer zu groß …«
Ich stand auf. »Herr von Lassenthin!« sagte ich und konnte es nicht hindern, daß meine Stimme zitterte. »Ich verdiene all Ihre Freundlichkeit nicht, diesmal nicht. Ich habe mich unter einem falschen Vorwand hier an Ihr Feuer geschlichen.«
Er sah mich mit schrecklicher Drohung an. Seine beiden Arme hielt er gestützt auf die Armsessel, wie zum Sprung geduckt belauerte er mich, aus seiner Brust kam ein Fauchen.
»Ich hatte von einem – ehrenwerten Mann, ich schwöre Ihnen, von einem ehrenwerten Mann den Auftrag, Sie eine Viertelstunde festzuhalten, unterdes sollte mit Ihrem Sohn geredet werden …«
Er brülle, er brüllte keine verständlichen Worte, er brüllte, wie ein Tiger brüllt im höchsten Zorn. Trotzdem ich ihn erwartet hatte, traf mich sein Schlag doch so unvermutet und stark, daß ich glatt zu Boden fiel und gegen den Kamin rollte. Die Flammen sengten mein Gesicht, ich war halb betäubt … Einen Augenblick stand er schrecklich drohend über mir, mit erhobenem Fuß, als wollte er mich in die Glut hineintreten. Wahrhaftig, kein Gedanke an Schonung für mich hat den Rauhbold von diesem Tritt zurückgehalten. Sondern plötzlich schrie er: »Habt ihr die Metze doch in mein Haus geschmuggelt!« und stürzte mit einer überraschenden Geschwindigkeit aus dem Zimmer …
Ich stand langsam auf. Halb taumelnd von dem Schlag tastete ich mich zur Tür, ich hatte das dunkle Gefühl, als sei mein Gesicht angebrannt, das Haar halb versengt … Dann traf mich die kühlere Luft der Halle, durch die noch immer offene Hallentür sah ich den späten Juninachmittag, golden und rein, ich hörte meinen Alex ungeduldig mit den Hufen scharren. ›Nur fort von hier‹, dachte ich, und tastete mich, noch immer nicht klar denkend, zur Tür.
Da erinnerte ich mich plötzlich des alten Geheimrats Gumpel, der wehrlos den wütenden Angriffen des alten Lassenthin ausgesetzt war. Gregor würde viel zu feige sein, auch nur ein Wort für seinen Sachwalter zu reden. Ich hatte Gumpel versprochen, ihn auf meinem Alex heimzuführen. Ich machte kehrt. Ich war noch betäubt von dem ersten Schlag und fürchtete einen neuen, aber ich machte kehrt. Noch erinnere ich mich, wie ich durch die öden verdreckten Gänge von Ückelitz irrte. Die Seidentapeten hingen in Fetzen von den Wänden, ich stolperte über eine Ritterrüstung, die zusammengefallen quer über dem Gang lag. Manchmal stand ich still und lauschte, aber es war alles totenstill, und doch meinte ich, ein ewiges Bröckeln, Nagen, Rascheln zu hören, als sinke Ückelitz unaufhaltsam in Staub. Aber das war wohl noch immer das Blut, das mir von dem Schlag in den Ohren summte …
Durch einen reinen Zufall stieß ich die Tür zu einem Gartenzimmer auf, Gregors Zimmer. Ich war so erstaunt, wie friedlich die drei dort beieinanderstanden, daß ich ohne ein Wort, mit offenem Munde in der Tür stehenblieb. Der schöne Gregor stand, seinen Backenbart streichelnd, an einem Fenster und sah wie gelangweilt in den Garten hinaus, bleich, aber widerlich hochmütig aussehend. Der alte Lassenthin war wie ein Koloß in der Mitte des Zimmers aufgebaut und sah finster auf den kleinen Gumpel, der sehr erhitzt war und in einigen Papieren wühlte. Beim Öffnen der Tür hatten alle drei die Köpfe gewendet und starrten mich wie einen Geist an.
Der alte Herr von Lassenthin war der erste, der sprach. »Da ist auch Ihr kleiner Spitzel, alter Fuchs; ich habe nie gewußt, daß ein Strammin ein Spion sein kann. Aber ich bin zum letzten Mal in meinem Leben hereingefallen, man kann dies Pack nicht genug verachten!«
Der Geheimrat sagte eilig: »Der Junge weiß von nichts, Herr von Lassenthin. Ich habe ihm nur versichert, daß es sich um eine ehrenhafte Sache handelt …«
Lassenthin unterbrach ihn: »Ihr seid alle schrecklich ehrenhafte Leute, tut nur ehrenhafte Dinge und begeht dabei die stinkendsten Unehrenhaftigkeiten. Genug geschwätzt! Ich habe euch alle satt bis hierher!«
Er ging schwer auf die Tür zu, ich trat zur Seite. Mein Großonkel blieb vor mir stehen. »Du hast noch Glück gehabt«, sagte er, »beinahe hätte ich dich ins Feuer gestoßen.«
Ich sagte: »Ich beklage mich nicht, Herr Großonkel, ich wollte Sie belügen. Aber ich habe Sie nicht belogen!«
Der Herr von Lassenthin sah mich mit einem grimmigen Lächeln an: »Wie ein junger Gockel! Genau wie ein junger Gockel! Muß krähen, steckt mal so in ihm.« Und plötzlich, mit erhobener Stimme: »Ihr habt alle Glück gehabt, alle! Hättet ihr das Frauenzimmer in mein Haus gebracht, hätte ich euch alle umgebracht, mit meinen Händen, euch alle!«
Er sah uns drei drohend an, dann seine ungeheuren Hände. Er nickte und war gegangen.
Ich stand noch immer unter der Tür. Weder der Geheimrat noch Gregor beachteten mich. Der Geheimrat sprach eindringlich auf meinen Onkel ein, der blasierter denn je aussah. Schon wegen seines Gesichtsausdrucks hätte ich ihn schlagen mögen, jedenfalls haßte ich ihn und war überzeugt, Gregor log, der Geheimrat vertrat die Wahrheit. Aber ich gab mir nicht die geringste Mühe zu lauschen, wie schon bemerkt, interessierten mich »Weibergeschichten« nicht. Einmal nur erhob sich des Onkels Stimme so laut, daß ich es hören mußte. »Sie kann es nicht beweisen, nie!« schrie er. Der Geheimrat murmelte etwas. Der Onkel rief: »Sie hat immer gelogen, sie ist die geborene Lügnerin! Sie fallen auf das glatte Gesicht rein, Gumpel!« Diesmal verstand ich auch den Geheimrat: »Ich habe die Dame nie gesehen, außerdem bin ich ein alter Mann.« Mein Onkel lachte, auf eine sehr häßliche Art, fand ich. »Um so schlimmer für Sie, sonst hätten Sie wenigstens ein Vergnügen an der Sache gehabt, Geheimrat.« Der Geheimrat flüsterte etwas sehr Scharfes, mein Onkel warf einen Blick auf mich. Er zuckte die Achseln, als wolle er sagen: ›Ach, der dumme Bengel versteht nichts!‹ Dann flüsterten sie wieder. Der Onkel rief: »Meinethalben soll sie Geld haben, nicht viel, aber etwas – wenn sie mich in Ruhe läßt.«
»Herr Geheimrat«, rief ich ungeduldig, »ich gehe jetzt.«
»Und du hast recht, Lutz, ich begleite dich«, rief er zurück. »Was hat Reden noch für einen Sinn?« Er hatte seine Papiere in die Tasche getan und kam zu mir. Mir fiel auf, daß er meinem Onkel nicht einmal Lebewohl gesagt hatte. Gregor schien es nicht zu stören. Er schlenderte die Gänge entlang neben uns her, sah mich spöttisch von der Seite an und sagte: »Papa hat dich ganz hübsch zugerichtet, halb gesengt und halb gebrüht, Bessy wird sich freuen.« Ich antwortete ihm nicht, er war mir zu schmählich. »Übrigens würdest du mich verbinden, Lutz«, fuhr mein Onkel fort, »wenn du niemandem hier in der Gegend von meiner Anwesenheit auf Ückelitz erzählen würdest, Gumpel muß schon von Berufs wegen schweigen, von dir habe ich dein Ehrenwort.«
»Du kannst dich darauf verlassen, Gregor«, antwortete ich – das »Onkel« wollte mir nicht über die Lippen, »daß ich jedem Menschen, den es interessiert, von deiner Anwesenheit erzählen werde.« Ich sah, wie er zusammenzuckte. Ich fuhr fort: »Allerdings kann ich mir kaum denken, daß du noch irgendeinen Menschen hier im Lande interessierst.«
Gregor lachte jetzt nur. »Du bist wirklich ein kleiner Gockel, genau wie mein Vater sagt. Nun, tu, was du willst, mir soll es gleich sein.«
Mit den Händen in der Tasche sah er zu, wie ich dem Geheimrat in den Sattel half. Erst als der alte Herr saß, rief er: »Aber ich hätte Ihnen auch gern einen Wagen zur Verfügung gestellt, Herr Gumpel.«
Weder der Geheimrat noch ich antworteten auf die letzte Frechheit. Ohne ein Abschiedswort ritten wir ab, ich schwor mir innerlich, dieses Ückelitz nie wieder zu betreten. Ich ahnte noch nicht, wie bald ich es wiedersehen würde.