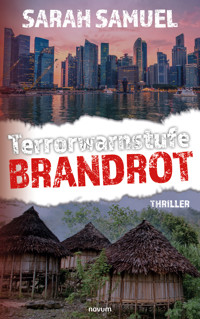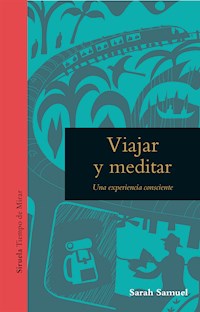Inhaltsverzeichnis
Impressum 2
Widmung 3
Die Woge 5
Mein vielgeliebter Freund 15
Der Katzenfänger 32
Die Co-Autoren 48
Das Konzert der Nächstenliebe 73
Die Künschtlerei 90
Abfahrt Seremban 9:31 111
Das wahre Leben 146
Das Geständnis 162
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2020 novum Verlag
ISBN Printausgabe: 978-3-99064-903-9
ISBN e-book: 978-3-99064-904-6
Lektorat: Mag. Eva Reisinger
Umschlagfoto: Sarah Samuel
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
Ich möchte diese Erzählungen den Menschen widmen, welche in die Hektik unseres heutigen Lebens voll eingebunden sind, sich aber gerade deshalb gerne ab und zu bei unterhaltsamer Lektüre entspannen wollen. Solche Leser können meist aus Zeitmangel keinen umfangreichen Roman in Angriff nehmen, und daher ist für sie das Genre der Kurzgeschichte hervorragend geeignet. Ich denke da speziell auch an Pendler in öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine originelle und packende Kurzgeschichte kann für jene die Wartezeiten und die Fahrt selbst durchaus angenehm gestalten. So gesehen mag dieser Band als Beitrag zur Literatur wie auch zum Einstieg in den Umstieg auf klimafreundlichere Fortbewegungsmittel gewertet werden!
I have not loved the world, nor the world me;
I have not flattered its rank breath, nor bowed
To its idolatries a patient knee,
Nor coined my cheeks to smiles, nor cried aloud
In worship of an echo; in the crowd
They could not deem me one of such;
I stood amongst them, but not of them.
Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage
Die Woge
Wellen … Wellen … Wellen. Verspielte Wellen. Tanzende Wellen. Schlagende Wellen. In gemessenem Takt rollen sie mit ihren vertändelnden weißen Gischtkronen auf den warmen Sand zu. Diese Rhapsodie des Meeres übt eine wahrhaft magische, eine unglaublich entspannende Wirkung aus, und eine heitere Gelassenheit umarmt uns. Der aufdringliche Lärm und das Geplärre von Bangalore sind in einer flirrenden Ferne verklungen.
Wohlig räkeln sich mein Mann Rainer und ich auf den Liegen unter den Sonnenschirmen des Luxushotels Sun Aqua Pasikudah. Wir fühlen uns absolut behaglich, erleichtert und sorglos. Eine kaum spürbare Brise kommt auf, und der frische, salzige Luftstrom streichelt die Wangen und liebkost die Ohren. Das Wispern der Palmwedel im Park der Hotelanlage hinter uns vermischt sich mit dem leisen Plätschern des Wassers zu einem einlullenden Raunen. Eine gedämpfte Betäubung erfasst uns, eine Befindlichkeit der sich selbst genügenden Untätigkeit.
Am frühen Vormittag herrscht hier noch jungfräuliche Stille, ja, man könnte geradezu meinen eine Bewegungslosigkeit. Nur ab und zu gleitet ein Seevogel mit kaum sichtbarem Flügelschlag über der Weite des Golfs von Bengalen, um dann plötzlich wie ein wildes Jagdtier aus dem Himmel in Richtung Meeresoberfläche zu schießen. Auf dem öffentlichen Strand gleich neben dem abgesonderten Gelände des Sun Aqua Pasikudah werden die überschwängliche Vitalität und die Begeisterung der Legionen von Besuchern für Sonne, Wasser und Sand erst später am Tag hereinbrechen. Dann werden auch die Strandverkäufer mit ihren T-Shirts, ihrem billigen Tand und den gekühlten Getränken sowie das Heer der Fotografen wieder samt ihrer zwanghaften Betriebsamkeit auftauchen. Da wir den damit einhergehenden Geräuschpegel als unerträglich empfinden, wird dies für uns das Signal für den Rückzug an den klaren, wohltemperierten und dennoch beinahe unbesuchten Swimmingpool des Hotels bedeuten.
All die Strapazen der letzten Monate scheinen sich allmählich zu lösen. Wir durchlebten ein intensives Wirken bis zur Erschöpfung, das nicht nur den Abschluss von Rainers Tätigkeit in der Firma, sondern auch die Auflösung unseres Haushaltes umfasste. Zehn lange Jahre im heiß umkämpften IT-Sektor in Bangalore haben ihre Spuren bei Rainer hinterlassen. Es waren aber nicht nur die andauernde unerbittliche Konkurrenz und die Bedrängnis durch die überall aus dem Boden schießenden Start-ups für Softwareentwicklung im aufstrebenden Schwellenland Indien, sondern auch die kontinuierlichen Forderungen der Zentrale in München, die meinen Mann zermürbten. Unter der Führung von Dr. Mayer wurden die Erfolgserwartungen immer höher geschraubt: Output, Qualität und Profit sollten ständig gesteigert werden. Doch die gewünschten IT-Spezialisten, meist mit Abschlüssen angesehener Universitäten und durchwegs äußerst kompetent, konnte man auch in Indien nicht um ein niedriges Salär anheuern. Sie waren ausnahmslos selbstbewusst und kannten ihren Marktwert. So erhöhten sich die Personalkosten von Jahr zu Jahr in einem für das Management besorgniserregenden Ausmaß und belasteten die Gewinnspannen. Zudem war mein Mann bei Geschäftsabschlüssen immer wieder dem Druck einer unbeschreiblichen Korruption ausgesetzt, wobei die Firmenleitung in München nicht die geringste Vorstellung von der Situation in Indien hatte und sich auch kaum darum kümmerte. In diesen Fällen verließ man sich ganz auf Rainers Einschätzung. München war nur daran interessiert, über die Niederlassung in Bangalore den stetig schrumpfenden Umsatz in Europa wettzumachen. Mit den lokalen Gegebenheiten hatte mein Mann alleine fertig zu werden.
Vierteljährlich erschien Herr Direktor Mayer mit einigen der Herren der Führungsetage, um, wie es im Firmenjargon hieß, beim indischen Ableger nach dem Rechten zu sehen. Es war meist eine aufwändige und frustrierende Prozedur, bei der alles durchleuchtet und hinterfragt wurde, obwohl ohnehin jede auch nur geringste Entscheidung stets im Voraus per Telefonkonferenz mit der Zentrale abgesprochen werden musste. In letzter Zeit landeten auch immer mehr Vorschriften aus München in Bangalore. Eine betraf das absurde Verbot von Lieferungen von Mittagsmenüs durch Lunch-Wallahs in die Firma, was von den Angestellten mit großem Unmut quittiert wurde. Rainer löste das Problem, indem er einen Raum direkt beim Eingang zum Firmengelände zur Verfügung stellte, wo die Essensboxen in Empfang genommen werden konnten. Das besänftigte die Beschäftigten, denn sie waren das von ihren Müttern oder Ehefrauen zubereitete Essen gewohnt und wollten trotz ihrer Aufgeschlossenheit dem modernen Leben gegenüber nichts von einer Betriebskantine wissen. Eher konsumierten sie da noch ein paar Happen bei den fahrenden Buden, die regelmäßig um die Mittagszeit in der Nähe des Firmentors aufkreuzten.
Wir genießen den Zauber der Passivität nach unserem tatenreichen Leben, das uns alles abverlangte und in dem wir alles gaben. Rainer wird in Kürze in den Ruhestand treten und wir werden in unser geliebtes Bayern zurückkehren, um dort unseren letzten Lebensabschnitt – den goldenen, wie man ihn gerne nennt – zu verbringen. Mit ein wenig Wehmut denke ich nun aber doch an unsere beiden Kinder, die es schon in verhältnismäßig jungen Jahren in die weite Welt verschlagen hat, und die sich Schritt für Schritt von uns abnabelten. Selbstredend gibt es nach wie vor die obligatorischen Telefonate zu Geburtstagen und hohen Feiertagen wie Weihnachten und Ostern, aber eigentlich sind wir emotional genauso weit von ihnen entfernt wie kilometermäßig. Sie bauten sich selbstständige Existenzen auf und folgen nun ihrem eigenen Stern – und wir dem unsrigen. Mit etwas Bitternis gesagt: Wir führen ein modernes Familienleben. Deshalb informierten wir unsere Kinder auch noch nicht über unser Vorhaben, in Kürze wieder nach Deutschland zurückzukehren und vorher noch zwei ergötzliche Urlaubswochen an einem paradiesischen Strand in Sri Lanka zu verbringen.
Im hellheiteren Ambiente an diesem Ort scheint nichts mehr so wichtig, weder die dereinst erlebten Enttäuschungen, als Rainer durch Intrigen und Machenschaften von Herrn Dr. Mayer bei der Nachfolge des damaligen Firmenchefs ausgebootet wurde, noch dass Rainers Versetzung in die Techcity Bangalore eigentlich einer Strafmaßnahme gleichkam. Mein Mann arbeitete sich vom einfachen Angestellten mit nur einem Diplom in Informatik empor und nahm an einigen wichtigen Entwicklungen teil. Herr Mayer trat ungefähr zum selben Zeitpunkt wie Rainer in das Unternehmen ein und fühlte sich naturgemäß mit seinem Doktorat der Betriebswirtschaftslehre sofort allen überlegen, obwohl er von der IT-Branche keine Ahnung hatte. Während Rainer durch Fleiß und Engagement zum Leiter der Entwicklungsabteilung für Software avancierte, auch fähig war, seine Mitarbeiter zu Höchstleistungen anzuspornen, verbrachte Dr. Mayer seine Zeit damit, immer neue Regeln auszuarbeiten und diese wortreich an das höhere Management als Effizienzsteigerungen zu verkaufen. Das imponierte dem Direktor, und so erachtete sich Dr. Mayer als dafür prädestiniert, in dessen Fußstapfen zu treten. Auch Rainer zeigte Interesse an diesem Führungsposten und plante Großes für die Firma.
Geschickt verstand es indes Dr. Mayer immer wieder, jedweden Vorschlag meines Mannes in der Softwareentwicklung als völlig unwirtschaftlich und auch als technologisch schlecht fundiert hinzustellen und ihn als Illusionisten abzustempeln. Dann gab es da auch noch die Affäre des Suizids der damaligen Abteilungsleiterin der Buchhaltung; eine Affäre, in welcher Mayer meinen Mann ganz dreist verleumdete und ihm praktisch die Schuld an diesem tragischen Vorfall in die Schuhe schob. Es wurde ja schon länger gemunkelt, dass die Frau an akuter Schizophrenie leide, und es war dann Rainer, der ihr riet, einen ihm bekannten Psychiater in der Universitätsklinik zu konsultieren. Diese Tatsache wurde hernach von Mayer in böswilliger Absicht so interpretiert, als hätte Rainer die Frau dazu genötigt, sich freiwillig in eine Anstalt einweisen zu lassen. Ihr Freitod erschütterte damals die ganze Belegschaft, und obwohl jeder wusste, dass mein Mann keinerlei Verantwortung dafür trug, wagte es niemand, Herrn Dr. Mayer ob seiner ungerechtfertigten Anschuldigung zurechtzuweisen. Rainer wurde bald danach zum Tochterbetrieb in Bangalore versetzt, wo ihm die Aufgabe zukam, die Fünf-Mann-Firma zu einem Vorzeigeunternehmen aufzubauen. Sollte ihm das nicht gelingen, würde sich die Zentrale gezwungen sehen, seine Stelle weg zu rationalisieren, wurde ihm unverblümt mitgeteilt.
Wellen folgen Wellen folgen Wellen. Der Anflug eines Hauches von Salz und Seetang weht vom Meer her. Die gleißende Sonnenscheibe schiebt sich langsam ihrem Zenit entgegen und eine angenehme Schlaffheit übermannt mich. Mit großem Behagen streckt sich Rainer faul auf seiner Liege aus, nachdenklich lässt er den rhythmischen Takt des Ozeans auf sich einwirken. Die tagtäglichen Ärgernisse, die Missgunst, der zerfleischende Wettbewerb, die Beschwerden von allen Seiten, die regelmäßig hereinflatternden Verordnungen der indischen Behörden und die zunehmenden Auseinandersetzungen mit dem Münchner Firmensitz erscheinen alle endlos weit zurück. Auch, dass der nachgerade sensationelle Bilanzabschluss des vergangenen Geschäftsjahres Herrn Dr. Mayer so beeindruckte, dass er sich sogar zu einem seltenen Lob herabließ, ist jetzt eigentlich irrelevant geworden.
Mein Leben verlief gleichfalls nicht in ungetrübter Beschaulichkeit. Meine schon in der Kindheit ausgeprägte musikalische Begabung führte mich nach dem Abitur zum Klavierstudium an das Mozarteum in Salzburg. Einmal war ich mit der Meisterklasse zu einem Konzert in München geladen, das zum Großteil von der IT-Firma meines zukünftigen Mannes gesponsert wurde. Rainer und ich lernten uns dann beim Büfett kennen, welches anlässlich eines geselligen Abends als Dank für die Einladung vom Mozarteum arrangiert worden war. Nach einem Jahr feierten Rainer und ich Verlobung und nach weiteren sechs Monaten heirateten wir. Ich zog nach München, wo wir zunächst in Rainers Junggesellenwohnung hausten. Mein ursprünglicher Plan, eine Karriere als Pianistin zu verfolgen, verflüchtigte sich binnen Kurzem, denn die intensiven Proben, die langen Abende im Konzertsaal und vor allem die wochenlangen Tourneen und die damit verbundenen Trennungen zermürbten unsere Ehe. Rainer war strikt gegen diesen Lebensstil, der unsere Beziehung schwer belastete, und als unsere Tochter geboren wurde, bedeutete dies automatisch das Ende meiner Laufbahn. Als nach weiteren zwei Jahren unser Sohn das Licht der Welt erblickte, gab ich auch die monotonen Klavierstunden für die meist ohnehin nur mittelmäßig begabten Schüler auf. Mein Mann erfreute sich danach eines wohlgeführten Haushaltes und seiner zwei Kinder. Ich war damit auch ganz zufrieden, denn Rainer verdiente angemessen und wir führten ein ausgeglichenes Leben. Rainer kam am Abend zwar oft ob der Querelen in der Firma entmutigt nach Hause zurück, war auch immer öfter desillusioniert, da man seinen Empfehlungen nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkte, aber ich konnte ihn jedes Mal beruhigen und davon überzeugen, dass solche Vorkommnisse nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im Kulturleben an der Tagesordnung seien. Nur die Stärksten überleben und von diesen auch nur zehn Prozent, so beschloss ich dann gerne meine Ermunterungsversuche.
Nach der Aufregung rund um die Chefbuchhalterin und Dr. Mayers Verwirrspiel mit der Machtübernahme in der Führungsetage blieb meinem Mann ohnedies keine andere Wahl als das sogenannte ultimative Angebot, den Firmensitz in Bangalore auf neue Beine zu stellen, widerspruchslos anzunehmen. Die dicke Luft im Münchner Hauptquartier schnüre ihm ohnedies den Hals zu, meinte Rainer. Mich begeisterte die Übersiedlung nach Indien nicht allzu sehr, besonders als ich mich über die dortigen Zustände klug gemacht hatte. Ich fügte mich jedoch und wollte meinen geliebten Mann mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln und auf allen Ebenen so gut es ging unterstützen. Immerhin schafften wir es irgendwie, mit viel Einsatzbereitschaft und Tatkraft unser Leben in Bangalore zu arrangieren, aber ohne Kinder. Diese genossen eine exzellente Ausbildung in einem Schweizer Internat, entfremdeten sich indes – zu unserem großen Bedauern – mehr und mehr von uns. Das Fehlen von aufrichtiger Kommunikation, nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit anderen nahen Angehörigen wie den alten Eltern von Rainer, meinem Bruder und meinen zwei Schwestern, schmerzte dann allerdings. Wir hatten uns auseinander gelebt. Vielleicht wird unsere Rückkehr nach Bayern die Familienbande wieder kitten, so hoffen wir jedenfalls.
Wellen über Wellen über Wellen. Es riecht jetzt ein wenig nach verwesendem Fleisch. Der Geruch lockt die Seevögel an und sie ziehen kreischend und aufgeregt ihre Runden. Mit der lodernden Mittagshitze und der dichten, mit Schwüle beladenen Luft, die mit den Händen greifbar scheint, finden sich auch andere Hotelgäste am prächtigen Kalkudah-Strand ein, wo sie sich unter Sonnenschirmen auf Liegen und flauschigen Frotteehandtüchern niederlassen. Durch die unerwartete Betriebsamkeit wird Rainer aus seinen Zukunftsträumen aufgeschreckt. Er hegt ja den biederen, beinahe langweiligen Wunsch, nach unserem abwechslungsreichen Leben nun ein Haus mit Garten im schönen Berchtesgadenerland zu erwerben. Dort lockt eine schier unerschöpfliche Auswahl an Spaziergängen und Wanderungen in der bayrischen Ramsau und besonders im nahen Salzburger Land. Wir würden uns an dem satten, kühlen Grün erfreuen, das wir im feuchtheißen Klima von Bangalore so vermissten, in die Berge wandern und uns auf den Gipfeln an der spektakulären Aussicht über die Seengebiete und ins Hochgebirge ergötzen. Dies sind banale, aber auch äußerst erquickliche Visionen, und vor allem solche in tatsächlicher Reichweite. Rainer weihte mich bereits vor einigen Monaten in diese seine Wunschvorstellung ein. Freilich ist es gerade hier in diesem exotischen Paradies, wo wir zum ersten Mal gemeinsam die Unbelastetheit des kommenden Lebens verspüren. Wir sind mit uns selbst und der Welt um uns im Einklang und im Frieden. In stummem Einverständnis lächeln wir uns zu und falten unsere Hände über die Liegen hinweg ineinander.
Eine nachdenkliche Stille gewinnt Raum, eine beinahe feierliche Lautlosigkeit. Die übrigen Hotelgäste dösen dumpf, nahezu bewusstlos, unter den Sonnenschirmen dahin, die Kinder planschen im Wasser oder graben bedächtig im Sand. Doch plötzlich beginnen die Seevögel schrill und schneidend zu krächzen. Etwas scheint sie zu verwirren, sie geraten in eine unerklärliche Erregung. Obzwar die Gäste noch liegen bleiben, macht sich nun eine kaum vernehmbare Unruhe, eine unbestimmte Sorge, am Strand breit. Diese Störung der gerade eben gelassenen Stimmung erweckt auch in Rainer und mir eine gewisse innere Anspannung – ohne einen wirklich triftigen Grund. Wir setzen uns auf und schauen auf das Meer, das noch immer unbewegt und besänftigend vor uns liegt. Aber hat sich nicht die Farbe des Wassers etwas geändert?
Der Himmel über dem Ozean verwandelt sich vor unseren Augen überraschend in ein bleifarbenes Tuch, das sich in Richtung Küste ausbreitet, ohne dass dabei aber irgendwelche bedrohlich wirkenden Wolken aufgezogen wären. Irritiert kämpfen einige Seevögel gegen den aufkommenden Luftstrom an, geben jedoch bald ihren Widerstand auf und lassen sich ins Landesinnere abtreiben. Mit einem Mal sehen wir, wie weit draußen am Horizont eine graugrüne Wand aufsteigt, die sich wogend in die Höhe erhebt, für einige Sekunden turmhoch aufragt, dabei fast stillsteht, bevor sie sich mit einer riesigen, mit Seetang und undefinierbarem Treibgut befrachteten Krone überschlägt. Gleichzeitig schwellen auch die auf das Ufer zustrebenden Wasserberge zu enormen Brechern an, schwappen immer zahlreicher und geradezu tobend auf die Urlauber zu. Diese versuchen jetzt hektisch verstört, ihre Sachen zusammenzuraffen, und schreien in panischer Angst nach ihren Kindern. Gehetzt flüchten die Strandbesucher in Richtung Hotel oder Straße, nur weg, rasch weg von den gigantischen Fluten, von den unter Tosen und mit rasender Geschwindigkeit daher stürzenden Wassermassen, die alles verschlingen.
Rainer und ich werden von einem noch nie gekannten Entsetzen, einem unvorstellbaren Grauen gepackt. Trotzdem können wir unsere Blicke kaum von diesem Schauer erregenden Schauspiel abwenden, das uns lähmt und versteinern lässt. Die unfassbare Rasanz, mit der die sich auftürmende Wassermyriade landwärts eilt, wälzt alles hinweg. Wie von einer mörderischen Lawine wird alles überrollt, die Liegen, die Sonnenschirme, die primitiv zusammengezimmerten Strandbuden. Die zerstörerische Gewalt macht aber auch vor der Natur nicht Halt und schleift gnadenlos Palmen, Sträucher, Büsche und die gesamte elegante Parkanlage des Hotels nieder. Die kontinuierlich anschwellenden, tödlichen Wasserfluten schwemmen gierig über alles hinweg, reißen alles mit. Am schlimmsten ist indessen das ungeheuerliche, ohrenbetäubende Dröhnen, das der Einsturz des Sun Aqua Pasikudah, das Bersten der riesigen Glasfront und das Zusammenkrachen der Pfeiler verursachen. Die verzweifelt fliehenden Menschen, die beim Hotel Schutz gesucht haben, werden unbarmherzig gepackt und so leicht, als würde die Natur mit einigen Federn spielen, hinweggespült. Es hat den Anschein, eine dämonische Macht lässt ihre unheimliche Kraft und Energie los, zeigt ihre unheilvolle Stärke, um sich an der Menschheit zu rächen.
In diesem Moment wird uns bewusst, dass auch für uns der Punkt gekommen ist, an dem es keine Rückkehr gibt. In stillschweigender Einigkeit umarmen wir uns – es bleibt keine Zeit mehr für Worte, aber es ist auch kein Bedarf mehr daran. Gegenüber der kolossalen Urkraft des Wassers haben wir keine Chance. Wir werden brutal erfasst und verstehen: Hier gibt es kein Entrinnen. Wir beugen uns der wilden Schöpfung. Eine neue, furchterregende Welle donnert auf den Strand und schlägt mit voller Wucht auf uns ein, umfängt uns und damit alle unsere vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Gerade wie in unserem Dasein mit all den Höhen und Tiefen reiten wir nun mit einer enormen Woge auf und nieder, wie in Erinnerung an unsere ereignisreiche Reise durch diese Welt. Die mühsamen Jahre des Aufbaus von Rainers Karriere, das Aufwachsen der Kinder und das Auseinanderbrechen der Familie, dann der alltägliche Kampf und Frust und schließlich der Erfolg in Bangalore, letztendlich die Planung unserer Rückkehr in die Heimat und die Vorfreude auf die Geruhsamkeit dort. Welch ein bewegtes Leben! Langsam entschwindet die Küste hinter uns und wir treiben dem grauen Horizont entgegen. Unsere Finger sind immer noch ineinander verschlungen.
Die im August 2005 erscheinende Bekanntmachung im Münchner Merkur betreffend Herrn Rainer Seyfried und seine Frau Erika, vermisst seit dem Tsunami am 26. Dezember 2004 in der Kalkudah Bay im Osten von Sri Lanka, erwähnt nur kurz einige nichtssagende Daten. Die Anzeige der Kinder des Ehepaares gleicht mehr einem Tatsachenbericht über die verschollenen Eltern denn einem Nachruf mit einem Rückblick auf ihr Leben und einer damit verbundenen Würdigung. Das Paar verschwand, ohne Spuren zu hinterlassen.
Mein vielgeliebter Freund
Es ist die Zeit, da der verscheidende Nachmittag seine letzte heiße Atemluft aushaucht, und ich lehne völlig erschöpft in einem Taxi von Al Manama nach Dhahran. Die kurze Dämmerung bricht schon über die Wüste herein, wenn auch die Sonne noch wie ein feuerroter Ballon just über dem Horizont schwebt. Bald wird die Gluthitze des Tages den viel erträglicheren Temperaturen der Nacht weichen.
War der Verkehr auf dem Causeway über den Golf von Bahrain schon unbeschreiblich zäh, so verdichtet er sich nun auf dem Highway auf der saudi-arabischen Seite noch um ein Vielfaches. Stoßstange reiht sich an Stoßstange, ein überdimensionales Gefährt klebt am nächsten Straßenmonster. Wohin treibt es bloß all die Leute in dieser fahlen, unwirtlichen Landschaft? Nach Al Khobar, Qatif, Al Hufuf oder gar nach Riad? Jeder Wagen ist mit mindestens vier Scheinwerfern ausgestattet, denn dass alle Straßen, auch die zwischen den Städten, durchgehend beleuchtet sind, genügt offenbar nicht. Es muss unbedingt gezeigt werden, dass man sich den Luxus der Energieverschwendung locker leisten kann; nicht umsonst lebt man in einem Land, in dem Kraftstoff billiger als Wasser ist.
Ein unüberschaubares Verkehrschaos. Einige Male verlässt das Taxi den mit leeren, verbeulten Öltonnen markierten Highway und jagt wie gehetzt – und eine riesige Sandwolke hinter sich lassend – auf einer imaginären Nebenfahrbahn in der Wüste, um einen auf der rechten Spur der Schnellstraße laut knatternden alten Lieferwagen zu überholen. Dann entscheidet sich der Lenker wieder für die linke Straßenseite und prescht einer gemächlich dahinkreuzenden Stretchlimousine vor. Straßenverkehrsregeln werden hierzulande nur als unverbindliche Empfehlungen betrachtet.
Zum Glück ist mein Wahrnehmungssinn noch immer vom Alkoholkonsum in meiner Stammbar in Al Manama getrübt, in der ich mehr oder weniger die gesamte Zeit seit gestern Abend verbrachte. Ich sage „zum Glück getrübt“, denn nüchtern hätte ich diese Höllenfahrt auf dem Highway nervlich nicht durchgehalten. Die Getränke in der Bar waren von bester Qualität, zumindest die ersten paar Gläser, die sich eingeprägt haben; die späteren ließ ich dann einfach routinemäßig in mich reinlaufen. Ich soff wie ein Kamel, das nach einem Tagesmarsch durch die Wüste zur Tränke in der Oase geführt wird.
Die übliche, scheinbar nie endende Wartezeit am Grenzübergang Umm Nasan nutzte ich für ein Nickerchen. Es gab zu viele Saudis, die für das Wochenende nach Bahrain gefahren waren, um sich dort mit südostasiatischen Schönheiten zu amüsieren, gut zu speisen und dem Alkohol zu frönen, und die noch heute in den züchtigen Alltag im Königreich der Beduinen zurückkehren mussten.
Als ich wieder zu Sinnen komme, befinden wir uns bereits auf dem achtspurigen Highway nach Dammam entlang dem Persischen Golf, oder eigentlich dem Arabischen Golf, wie er hier genannt wird. Mein Fahrer mit seinem fadenartig dünnen, graumelierten Bart, den Körper in eine lose, langärmelige und knöchellange Thobe gehüllt und auf dem Haupt eine weiße, gehäkelte Togiyah, begutachtet mich ab und zu im Innenspiegel. Ich spüre seine Blicke, seine Verachtung. Ich nenne so einen Taxifahrer nach seinem Aussehen einen Imam-Taxler. Ganz kann ich ihm seine Einstellung mir gegenüber ja nicht verübeln, denn wahrscheinlich dringt aus jeder Pore meines Leibes Alkoholdunst, eine Zumutung für den Moslem. Trotzdem braucht er bei dem geschmalzenen Tarif von 250 Rial für die Fahrt von insgesamt kaum 40 Kilometern – die Gebühr von 50 Rial für die Ein- und Ausreisevisa für Bahrain ist da noch gar nicht inkludiert – nicht so ein überhebliches Benehmen an den Tag zu legen. Schließlich kostet ihn das Benzin doch nur zwei Cent pro Liter, also eine Bagatelle – und das alles bei null Steuern! Außerdem ist er kaum der englischen Sprache mächtig, versteht nicht wirklich, wohin ich eigentlich möchte.
Beim Einsteigen in Al Manama habe ich zuerst nur den Wunsch geäußert, dass er mich nach Saudi-Arabien chauffieren soll, dann nach Al Khobar, der ersten größeren Stadt über der Grenze. Von dort soll er einfach weiter geradeaus nach Norden, in Richtung Dammam, lenken und dann bei Dhahran abfahren; eigentlich eine klare Sache. Diese Drillingsstädte sind ohnehin die einzigen nennenswerten Häuseransammlungen in dieser Wüstengegend. Ansonsten sieht man bloß versandete und staubige Lagerhallen aus Wellblech oder Sichtbeton sowie ebenso sandbedeckte und verloren wirkende Treibstoffdepots. Dass der Taxilenker von meiner genauen Destination, nämlich dem Campus der KFUPM, der King Fahd University of Petroleum and Minerals in Dhahran, überhaupt keine Ahnung hat, wird mir erst bewusst, als er mich zuerst einmal ins Spital in Al Khobar bringen will. Sehe ich tatsächlich schon so kaputt aus? Nun dämmert es mir aber, dass ich ihm auf alle Fälle akribische Anweisungen zu geben habe, damit ich es nach Hause schaffe.
Jetzt reicht er mir sogar sein Smartphone, aus dem sich eine freundliche weibliche Stimme in bestem Englisch erkundigt, wohin ich denn nun fahren möchte. Sie wird dann meine Antwort dem Chauffeur übersetzen, erklärt sie mir mit einem kaum unterdrückten Lachen in der Stimme. Da nähern wir uns gerade der abschüssigen Abfahrt nach Dhahran und ich schreie verzweifelt: „Hier, hier geht es ab!“ Das bringt aber nichts, denn der Mann versteht mich nicht. Verstört durch mein Geschrei blickt er sich zu mir um und verreißt dabei das Lenkrad, wobei nur durch das Geschick nachkommender Autofahrer ein katastrophaler Unfall vermieden wird. Obwohl in diesem Land kaum jemand einen offiziellen Führerschein besitzt – man kauft ihn einfach –, chauffiert man hier dennoch gewandt.
Völlig verschreckt durch den Zwischenfall bleibt mein Taxler zunächst stehen und will danach die steinige Böschung hinunterfahren, um doch noch die Abfahrt zu erreichen, was ich nur mit Mühe verhindern kann. Nun legt er den Rückgang ein, um im dichtesten Highway-Verkehr zurückzustoßen. Davon wird er aber glücklicherweise von wütend hupenden Autofahrern abgehalten. Jetzt scheint er von einem Geistesblitz getroffen zu sein, nickt sich selbstgefällig zu und fährt mit einem Lächeln um den Mund weiter, nimmt dann die nächste Abfahrt, wonach ich ihm bald die Himmelsrichtung anzeigen kann, in der sich der Campus befindet.
Auf dem Compound verständigen wir uns durch einfache Zeichensprache, ob es nun nach links oder rechts abzubiegen gilt. Vor dem Aussteigen muss ich noch eine Belehrung über mich ergehen lassen – so interpretiere ich seinen Redeschwall –, doch etwas Arabisch zu lernen, zumindest die Wörter für rechts und links sollte ich wissen. Insgeheim gebe ich ihm ja Recht, dass man wenigstens ein paar Brocken der Sprache des Landes, in dem man lebt, beherrschen sollte. Momentan bin ich aber derart heilfroh, es bis zu meinem Apartment geschafft zu haben, dass ich ihm trotz seiner mörderischen Fahrerei nicht nur ein unverhältnismäßig hohes Trinkgeld gebe, sondern mir vornehme, auch noch Arabisch zu lernen.
Da die Firma, bei der ich normalerweise das Taxi nach Bahrain hin und zurück buche, fast ausschließlich Inder als Chauffeure anstellt, diese auch ein recht ordentliches Englisch sprechen, erschien mir bislang der Aufwand zu groß, nur für den einen oder anderen Imam-Taxler die doch eher schwierige arabische Sprache zu erlernen. In den Supermärkten herrscht Selbstbedienung, und wo man noch bedient wird – zumindest was man ansatzweise als Bedienung bezeichnen könnte – sind meist Filipinos tätig, mit denen man sich so halbwegs auf Englisch verständigen kann. In anderen Geschäften kaufe ich ohnedies nicht ein, denn jedwede Erklärung, auch in einfachster Sprache wie auf Kindergartenniveau, geht ins Leere. So wollte ich einmal meine Französischkenntnisse aufmöbeln, als mir in der Buchhandlung zu diesem Zweck das beste Buch der Geschichte überhaupt, nämlich der Koran, in der Originalfassung angeboten wurde!
Warum hat es mich eigentlich hierher verschlagen? Ich schloss mein Studium der Anglistik an der Prestige-Universität Cambridge mit Erfolg ab. Da ich doch insgesamt 15 Jahre in England lebte, gelang es mir nach viel harter Arbeit, meinen koreanischen Akzent komplett abzulegen. An der nordenglischen University of Durham, wo ich nach meinem Studium eine Stelle als Lecturer erhielt, fühlte ich mich sehr wohl. Dort wurde, wie bereits in Cambridge, viel diskutiert und mindestens genauso viel getrunken, was ich als Asiate anfangs nicht besonders gut vertrug. Meine Freunde meinten, das sei eine Sache der Gewohnheit, der Übung, und da ich mich unbedingt auch in diesen Dingen integrieren wollte – schließlich sagte man mir ja perfekte Anpassungsfähigkeit nach –, vertrank ich ganze Nächte, um mich eben daran zu gewöhnen. Bald konnte ich mit jedem meiner Saufkumpane mithalten, ja, ich verkraftete oft sogar noch ein Glas mehr als er. Mein Ruf als trinkfester Geselle verbreitete sich rasch. Nach einigen Gläsern eines harten Getränks wurde ich auch recht kommunikationsfreudig. Ich erhielt mehr und mehr Einladungen zu Partys, die meist in einem Saufgelage endeten. Der Kreis meiner Bekannten vergrößerte sich fortlaufend. In gewissen Zirkeln wurde ich überdies als Stimmungskanone gehandelt, als jemand, den man gerne zu Gesellschaften einlädt. Der Alkohol löste meine Zunge, ich begann zu singen, gab gerne schnulzige koreanische Volkslieder zum Besten, obwohl ich absolut keine Singstimme habe, erzählte auch gerne schmutzige Witze und machte mich nebenbei oftmals über das universitäre Leben in England lustig.
Dann kam der Rat eines guten Freundes, mich gesellschaftlich doch etwas zurückzunehmen und meinen liederlichen Lebenswandel zu ändern. Gerüchte kursierten, dass der neue Rektor der Hochschule, ein trockener Physiker namens McPherson, es nämlich gar nicht so gerne sieht, wenn sich der Lehrkörper der Universität öffentlich übermäßig hedonistisch zeigt. Der neue Mann, der unlängst das Ruder dieser ehrwürdigen Institution übernommen hatte, stellte sich als puritanischer Schotte heraus, der gleich bei der ersten offiziellen Zusammenkunft mit der gesamten Universitätsgemeinschaft im Großen Auditorium seine Prioritäten bekannt gab, die da lauteten: Unbedingte Loyalität zur Universität, seriöses wissenschaftliches Arbeiten und Publizieren, ausgezeichnete Studentenbetreuung, Integrität jeder einzelnen Person, und hierbei erwähnte er speziell auch das Benehmen von Hochschulangehörigen in der Freizeit. Er schwafelte dann noch langmächtig über eine Reihe von Verpflichtungen, die jeder Einzelne der Institution schuldig war, hingen wir doch finanziell seit Maggie Thatcher sehr von wohlhabenden Sponsoren ab. Wir als Vertreter der Universität mussten da schon das Unsrige dazu tun, diesen Geldgebern mit gutem, ja, vorbildlichem Betragen unsere Dankbarkeit zu zeigen, hieß es plötzlich. Disziplin, Arbeitsmoral, Fleiß, Ehrgeiz gingen von diesem spindeldürren, älteren, etwas buckeligen Mann mit säuerlicher Miene aus, alles Tugenden, die mir im Laufe der Jahre abhandengekommen waren.
Ich wusste nicht genau, was meine Kollegen in diesem Moment empfanden. Viele von ihnen waren ja auch gleichzeitig meine Trinkgenossen, die mich eigentlich erst zu dem lasterhaften Leben verführt, mich überall hin mitgeschleppt hatten. Nun saßen sie wie brave Schüler auf ihren Sitzen und lauschten angespannt den Ausführungen des Herrn McPherson, so als würde er einen Vortrag über seine neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse halten. Sie nickten zu jedem Kommentar zustimmend, verhielten sich wie Unschuldslämmer, die nur darauf warteten, zur Schlachtbank geführt zu werden. Kein Muckser entkam der werten Gesellschaft, man hätte eine Stecknadel fallen hören, so viel fundamental Bedeutsames schien hier der Rektor von sich zu geben. Nach dem Ende seiner Predigt brauste tobender Applaus auf. Hatte ich bereits gespürt, dass meine Zeit an dieser Hochschule zur Neige geht, als der neue Leithammel der akademischen Herde dieser Stadt in seinem Talar das Podium betrat und ich seine ersten Worte vernahm, so war ich nach der Beobachtung der Versammlung dieser Komödianten und Heuchler dann ganz und gar davon überzeugt. Da ich nicht willens war, mich dem Diktat der neuen Führung zu beugen, fand man auch bald einen Grund für meinen Rausschmiss aus der Universität, gegen den ich keinen Einspruch erhob. Denn: Wie sollte ich plötzlich in solch einer sittenstreng gewordenen Umgebung weiterleben können?
Ich hatte bereits von Englischlehrern gehört, die von den überdurchschnittlich günstigen Arbeitsbedingungen im Morgenland schwärmten. Genaueres wusste man zwar nicht zu berichten, nur dass es finanziell wirklich attraktiv sein soll. Wissenschaftlich wurde nichts verlangt, keine Publikationen, man brauchte nur zu unterrichten. Ich begann im Internet zu stöbern und wurde bald auf der Webseite der KFUPM in Dhahran fündig, einer Institution mit Schwerpunkt Ingenieurwesen. Bei dieser hatten die Studenten vor Beginn ihres eigentlichen Studiums eine Englischprüfung abzulegen, wobei die Vorbereitung darauf je nach Hintergrund des Studenten ein bis zwei Jahre dauern konnte. Hier suchte man also English Lecturers und lockte mit einem äußerst interessanten Angebot von 60.000 Dollar pro Jahr steuerfrei für jedermann, der diese Sprache zu unterrichten imstande war. Ich hatte noch nie in meinem Leben von der KFUPM oder gar Dhahran gehört, einem Ort am Persischen Golf, der Teil einer urbanen Region mit der beachtlichen Einwohnerzahl von rund einer Million ist. Ich traf auch auf niemanden, der dieses Dhahran kannte, was natürlich insbesondere das allgemeine Unwissen über den Orient aufzeigt.
Nach meinem Ansuchen um eine Stelle bei der KFUPM wurde mir ein einjähriger Vertrag gewährt, ohne irgendein Vorstellungsgespräch und mit nur zwei Referenzschreiben. Ich nannte den Namen meines ehemaligen Diplombetreuers in Cambridge sowie den eines mir nach wie vor wohlgesinnten Kollegen in Durham. Etwas ungewöhnlich erschien mir diese Rekrutierung im Eilzugstempo schon. Offensichtlich war man desperat, Englischlehrer ins Land zu locken, was ich später beim Kennenlernen der dortigen Lebensumstände dann auch gut verstand. Die notwendigen medizinischen Zeugnisse wurden mir von der Universitätsklinik in Durham ohne weitere Umstände ausgestellt. Berichte über mein Alkoholproblem waren noch nicht bis zu dieser Institution gedrungen, und ich war auch bisher zu keiner Entziehungskur verdonnert worden. Die Klinik hatte mich also nicht als alkoholkrank registriert. Dass ich unverheiratet bin und deshalb keine Frau im Schlepptau hatte, half sehr bei der prompten Erledigung der Visumsformalitäten durch die Saudi-arabische Botschaft in London. Ehefrauen werden nämlich automatisch als Störenfriede eingestuft und haben monatelang auf ein Einreisevisum zu warten, so hörte ich.
Ich war frohen Mutes, als ich in London die Maschine der Saudi Arabian Airlines nach Riad bestieg und von dort weiter nach Dammam flog, dem Dhahran am nächsten gelegenen Flughafen. Es hieß, mein ausschweifendes Leben zurückzulassen, und ich hoffte inständig, im Land der totalen Abstinenz meine Sucht loszuwerden. Außerdem würde ich zukünftig ein gutes Salär einstreichen. Ich war völlig überzeugt, durch neue Aufgaben und Eindrücke eventuelle Entzugserscheinungen locker überwinden zu können. Als ich nach über neun Stunden endlich in Dammam angekommen war, fühlte ich mich dann doch etwas benommen. Die außerordentlich netten und auch sehr hübschen Flugbegleiterinnen animierten mich immer wieder, Süßigkeiten zu nehmen, servierten auch regelmäßig diverse Getränke, aber nur alkoholfreie … Nun tat es mir aufrichtig leid, nicht Lufthansa gewählt zu haben, denn da hätte man mich sicherlich mit Bier und Wein verwöhnt. Ich verspürte bereits erste Symptome des Alkoholentzugs, war aber fest entschlossen, diese tapfer zu bekämpfen. Ein neuer Lebensabschnitt hatte ja begonnen, dessen Herausforderungen ich meistern wollte.
Von der nahe gelegenen Moschee reißt mich das jammernde und gleichzeitig anklagend klingende Fajr des Muezzins im grauenden Morgen aus einem todesähnlichen Schlaf. Es ist erst 5 Uhr