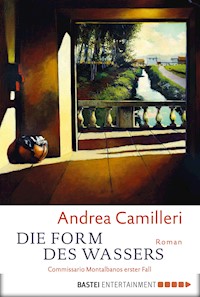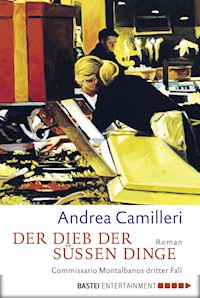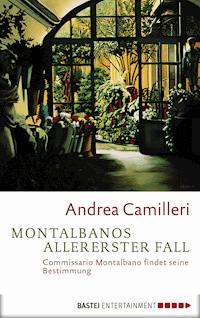9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Montalbano
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Aktien statt Arancini, Spekulationen statt Spaghetti, Börse statt Balsamico - schnelles Geld als Versprechen, dafür steht Emanuele Gargano, der sizilianische »Magier der Finanzen«. Gargano, Anfang vierzig, elegant und unverschämt gut aussehend, lebt von seinem Ruf als genialer Spekulant. Doch nachdem beinahe alle Bewohner der Provinz Montelusa ihm ihre Ersparnisse anvertraut haben, ist der vorher so Begehrte samt Geld spurlos verschwunden und nun der meistgehasste Mann südlich von Neapel. Während in Vigàta alle Jagd auf einen hinterhältigen Dieb machen, ahnt Commissario Montalbano schon bald, dass mehr als ein simpler Betrug hinter Garganos mysteriösem Verschwinden steckt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Anmerkung des Autors
Im Text erwähnte kulinarische Köstlichkeiten
Über den Autor
Andrea Camilleri ist der beliebteste zeitgenössische Autor Italiens und begeistert mit seinem vielfach ausgezeichneten Werk ein Millionenpublikum. Ob er seine Leser mit seinem unwiderstehlichen Helden Salvo Montalbano in den Bann zieht, ihnen mit kulinarischen Köstlichkeiten den Mund wässrig macht oder ihnen unvergessliche Einblicke in die mediterrane Seele gewährt: Dem Charme Camilleris vermag sich niemand zu entziehen.
Andrea Camilleri
Der Kavalierder späten Stunde
Ein Sizilien-Krimi
Aus dem Italienischen vonChristiane v. Bechtolsheim
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der italienischen Originalausgabe:
L’ODORE DELLA NOTTE,
erschienen bei Sellerio Editore, Via Siracusa 50, Palermo
© 2001 by Sellerio Editore
© für die deutschsprachige Ausgabe 2002/2023 by:
Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: © ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung von Motiven von © Iamkao99/shutterstock; Andrew Mayovsky/shutterstock; mjurik/shutterstock; Miloje/shutterstock
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7517-4293-1
luebbe.de
lesejury.de
Eins
Der Laden des weit geöffneten Fensters knallte mit solcher Wucht gegen die Hausmauer, dass es wie ein Pistolenschuss klang, und Montalbano, der just in diesem Augenblick träumte, er sei in eine Schießerei verwickelt, fuhr aus dem Schlaf hoch, verschwitzt und durchgefroren zugleich. Fluchend stand er auf und schloss das Fenster. Der eisige Nordwind blies so stark, dass er nicht wie sonst die morgendlichen Farben auffrischte; er trug sie mit sich fort, verwischte sie dabei und ließ nur den Entwurf von einem Fresko zurück oder vielmehr blasse Spuren wie bei einem Aquarell, das ein Dilettant beim Sonntagsausflug gemalt hat. Offensichtlich hatte der Sommer, der schon seit ein paar Tagen mit dem Tode kämpfte, in der Nacht beschlossen, sich endgültig geschlagen zu geben und der folgenden Jahreszeit Platz zu machen, die eigentlich der Herbst hätte sein müssen. Eigentlich, denn in Wirklichkeit war dieser Herbst, wie er sich ankündigte, schon Winter, und zwar tiefer Winter.
Montalbano kroch wieder ins Bett und trauerte den verschwundenen Übergangszeiten nach. Wo waren sie geblieben? Auch sie waren vom immer schnelleren Rhythmus des menschlichen Daseins überrollt worden und hatten sich angepasst: Sie hatten begriffen, dass sie eine Pause bedeuteten, und waren verschwunden, denn heutzutage darf es keine Pausen geben in diesem immer wahnsinnigeren Rennen, das von endlosen Aktivitäten bestimmt ist: auf die Welt kommen, essen, lernen, vögeln, produzieren, zappen, kaufen, verkaufen, kacken und sterben. Dieses ewige Tun, und dann ist doch alles in einer Nanosekunde, im Nu vorbei. Hatte es nicht eine Zeit gegeben, in der man sich auch mit etwas anderem beschäftigte? Mit Denken, Nachdenken, Zuhören und – warum nicht – Faulenzen, Dösen, Sich-Ablenken? Fast mit Tränen in den Augen erinnerte sich Montalbano an die Kleidung in der Übergangszeit und an den Staubmantel seines Vaters. Und dabei fiel ihm ein, dass er für die Fahrt ins Büro Winterklamotten anziehen musste. Er gab sich einen Ruck, stand auf und öffnete die Tür des Schranks, in dem die warmen Sachen hingen. Der Gestank von mindestens einem Zentner Mottenkugeln überfiel ihn ohne Vorwarnung. Zuerst blieb ihm die Luft weg, dann tränten seine Augen, und schließlich musste er niesen. Er nieste zwölfmal hintereinander, Rotz lief ihm aus der Nase, sein Kopf war betäubt, und der Brustkorb tat immer mehr weh. Er hatte vergessen, dass seine Haushälterin Adelina einen Privatkrieg gegen die Motten führte, in dem sie sämtliche Register zog und immer eine erbarmungslose Niederlage erlitt. Der Commissario verzichtete lieber. Er schloss den Schrank wieder und nahm einen dicken Pullover aus der Kommode. Auch hier hatte Adelina Giftgase eingesetzt, aber diesmal war Montalbano darauf gefasst und wappnete sich mit Luftanhalten. Er ging auf die Veranda und legte den Pullover auf den Tisch, damit sich der Gestank an der frischen Luft etwas verflüchtigen konnte. Nachdem er sich gewaschen, rasiert und angekleidet hatte, wollte Montalbano den Pullover von der Veranda holen, um ihn anzuziehen, aber er war nicht mehr da. Ausgerechnet der nagelneue Pullover, den Livia ihm aus London mitgebracht hatte! Wie sollte er ihr jetzt nur erklären, dass irgendein Scheißtyp, der vorbeigekommen war, der Versuchung nicht hatte widerstehen können und einfach hingelangt hatte? Er stellte sich wortwörtlich vor, wie das Gespräch zwischen ihm und seiner Freundin ablaufen würde.
»Na klar! Das war ja vorauszusehen!«
»Wie meinst du das?«
»Weil ich ihn dir geschenkt habe!«
»Was hat denn das damit zu tun?«
»Viel! Die Sachen, die ich dir schenke, sind dir völlig egal! Zum Beispiel das Hemd, das ich dir aus …«
»Das habe ich noch.«
»Kein Wunder, du hast es ja auch nie angezogen! Und dann: Der berühmte Commissario Montalbano lässt sich von einem kleinen Dieb beklauen! Schämen solltest du dich!« In diesem Augenblick sah er den Pullover. Vom Nordwind fortgerissen, wirbelte er über den Sand, er wirbelte weiter und weiter und kam immer näher an die Stelle heran, wo der Sand bei jeder größeren Welle überflutet wird.
Montalbano sprang über das Geländer und rannte los, sodass ihm der Sand in Socken und Schuhe drang; er kam gerade noch rechtzeitig, packte den Pullover und entriss ihn einer wütenden Welle, die es anscheinend auf dieses Kleidungsstück besonders abgesehen hatte.
Halb blind vom Sand, den ihm der Wind in die Augen blies, ging er zurück und musste sich damit abfinden, dass aus dem Pullover eine unförmige, nasse Wollmasse geworden war. Kaum war er im Haus, klingelte das Telefon.
»Ciao, Liebling. Wie geht’s? Ich wollte dir nur sagen, dass ich heute nicht zu Hause bin. Ich gehe mit einer Freundin an den Strand.«
»Musst du nicht ins Büro?«
»Bei uns ist Feiertag, der Tag des Stadtheiligen.«
»Ist das Wetter schön bei euch?«
»Herrlich.«
»Na dann, viel Spaß. Bis heute Abend.«
Das hatte gerade noch gefehlt, der Tag fing ja gut an. Er zitterte vor Kälte, und Livia lag genüsslich in der Sonne! Ein weiterer Beweis dafür, dass die Welt aus den Fugen geraten war. Im Norden verging man jetzt vor Hitze, und im Süden machten sich Frost, Bären und Pinguine breit.
Als er gerade mit angehaltenem Atem erneut den Schrank öffnen wollte, klingelte das Telefon wieder. Er zögerte kurz, dann nahm er beim Gedanken an die Übelkeit, die ihm der Gestank der Mottenkugeln beschert hätte, den Hörer ab. »Pronto?«
»Ah Dottori Dottori!«, keuchte Catarellas Stimme gequält. »Sind Sie das persönlich selber?«
»Nein.«
»Wer ist denn dran?«
»Arturo, der Zwillingsbruder des Commissario.«
Warum benahm er sich dem armen Kerl gegenüber so idiotisch? Wollte er etwa seine schlechte Laune an ihm auslassen?
»Echt?«, fragte Catarella bewundernd. »Entschuldigen Sie, Herr Zwilling Arturo, aber wenn der Dottori irgendwie im Haus ist, sagen Sie ihm dann, dass ich ihn sprechen muss?« Montalbano ließ ein paar Sekunden verstreichen. Vielleicht konnte er die Geschichte, die ihm spontan eingefallen war, bei Gelegenheit noch brauchen. Er schrieb »mein Zwillingsbruder heißt Arturo« auf einen Zettel und meldete sich wieder.
»Ja, was gibt’s?«
»Ah Dottori Dottori! Da geht’s drunter und drüber! Wissen Sie, wo dem Ragionieri Gragano sein Büro war?«
»Meinst du Gargano, diesen Buchhalter?«
»Ja. Warum, was hab ich denn gesagt? Gragano hab ich gesagt.«
»Schon gut, ich weiß, wo das ist. Und?«
»Weil da ist einer rein, der ist bewaffnet. Fazio hat’s zufällig gesehen, weil er zufällig da vorbeigegangen ist. Ich glaub, der will die Sekretärin erschießen. Er sagt, dass er das Geld zurückhaben will, was Gragano ihm geklaut hat, sonst bringt er die Frau um.«
Montalbano warf den Pullover auf den Boden, kickte ihn unter den Tisch, öffnete die Haustür. Bis der Commissario im Auto saß, hatte ihm der Nordwind fast die Besinnung geraubt.
Der Buchhalter Emanuele Gargano, vierzig Jahre alt, groß, elegant, gut aussehend wie der Held in einem amerikanischen Film und stets im richtigen Maß sonnengebräunt, litt an jener Sorte beruflicher Kurzlebigkeit, die man von aufstrebenden Managern kennt, kurzlebig insofern, als sie mit fünfzig schon so verschlissen sind, dass sie abgewickelt gehören, nur um eines ihrer Lieblingswörter zu benutzen. Ragioniere Gargano war, nach eigenen Worten, in Sizilien geboren, hatte aber lange in Mailand gearbeitet, wo er bald und ebenfalls nach eigenen Worten als eine Art Magier der Finanzspekulation galt. Als er dann fand, er habe sich den erforderlichen Ruf erworben, beschloss er, sich in Bologna selbständig zu machen, wo er – wir sind immer noch bei seinen eigenen Worten – Dutzende und Aberdutzende von Anlegern glücklich machte. Vor gut zwei Jahren war er in Vigàta aufgetaucht, um, wie er sagte, »das ökonomische Erwachen dieser unserer geliebten und leidgeprüften Insel« in die Wege zu leiten, und hatte innerhalb weniger Tage in vier Städten der Provinz Montelusa Agenturen eröffnet. Er war gewiss nicht auf den Mund gefallen und auch ausgesprochen begabt, mit seinem vertrauenerweckenden breiten Lächeln jeden zu überzeugen, der ihm über den Weg lief. Eine Woche brachte er damit zu, in einem auf Hochglanz polierten Luxusschlitten, einer Art Köder, von Dorf zu Dorf zu brausen; danach hatte er an die hundert Kunden gewonnen – Durchschnittsalter gute sechzig –, die ihm ihre Ersparnisse anvertrauten. Nach Ablauf von sechs Monaten wurden die Pensionäre einbestellt und erhielten, wobei sie fast der Schlag traf, zwanzig Prozent Rendite. Dann lud der Ragioniere alle Kunden aus der Provinz nach Vigàta zu einem großen Mittagessen, an dessen Ende er durchblicken ließ, dass die Rendite im folgenden Halbjahr vielleicht noch höher sein werde, wenn auch nicht viel. Das sprach sich herum, und die Leute standen Schlange vor den Schaltern der örtlichen Agenturen und flehten Gargano an, er möge ihr Geld an sich nehmen. Der Ragioniere willigte großherzig ein. Bei dieser zweiten Gruppe gesellten sich zu den Alten auch junge Leute, die scharf darauf waren, möglichst schnell Geld zu machen. Am Ende des zweiten Halbjahres kletterte die Rendite der ersten Kunden auf dreiundzwanzig Prozent. Die Geschichte bekam zusehends Rückenwind, doch am Ende des vierten Halbjahres erschien Emanuele Gargano nicht mehr. Die Angestellten der Agenturen und die Kunden warteten zwei Tage und beschlossen dann, in Bologna anzurufen; dort sollte sich die Generaldirektion der »König Midas« befinden, wie die Vermögensberatung des Ragioniere hieß. Am Telefon meldete sich niemand. Man forschte rasch nach und stellte fest, dass die gemieteten Geschäftsräume der »König Midas« dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben worden waren, und der wiederum war wütend, weil er schon monatelang keine Miete bekommen hatte. Nach einer Woche vergeblicher Suche, ohne dass in Vigàta und Umgebung auch nur der Schatten des Ragioniere gesichtet worden wäre, und nach zahlreichen turbulenten Übergriffen auf die Agenturen durch jene, die ihr Geld verloren hatten, entwickelten sich zwei Theorien über das mysteriöse Verschwinden des Buchhalters.
Die erste behauptete, Emanuele Gargano sei unter falschem Namen auf eine Südseeinsel gezogen, wo er sich mit halb nackten Schönheiten auf Kosten derer amüsiere, die ihm gutgläubig ihre Ersparnisse anvertraut hätten.
Die zweite Theorie besagte, Gargano habe sich unvorsichtigerweise das Geld irgendeines Mafioso unter den Nagel gerissen und produziere jetzt ein paar Meter unter der Erde Kompost oder diene als Fischfutter.
In ganz Montelusa und Provinz gab es nur eine Frau, die anderer Auffassung war. Eine einzige, und die hieß Mariastella Cosentino.
Mariastella, fünfzig Jahre alt, untersetzt und ohne Grazie, hatte sich bei der Agentur in Vigàta beworben und die Stelle nach einer ebenso kurzen wie intensiven Unterredung mit dem Ragioniere persönlich auch bekommen. So sagte man. Die Unterredung war kurz gewesen, aber für die Frau lang genug, um sich unsterblich in den Chef zu verlieben. Für Mariastella, die nach ihrer Buchhalterprüfung viele Jahre im Haushalt geholfen hatte, erst bei Vater und Mutter und dann bis zu seinem Tod bei dem immer anspruchsvolleren Vater, war dies zwar die zweite Stelle, aber bestimmt die erste Liebe. Mariastella war nämlich von Geburt an einem entfernten Cousin versprochen gewesen, den sie nur auf einer Fotografie gesehen und nie persönlich kennen gelernt hatte, weil er als Junge an einer unbekannten Krankheit gestorben war. Aber jetzt lagen die Dinge anders, denn diesmal sah Mariastella ihren Angebeteten mehrmals gesund und munter und eines Morgens aus so großer Nähe, dass sie sogar sein Rasierwasser riechen konnte. Da tat sie etwas sehr Verwegenes, was sie sich nie und nimmer zugetraut hätte: Sie fuhr mit dem Bus nach Fiacca zu einer Verwandten, die eine Parfümerie hatte, und fand, nacheinander an allen Fläschchen schnuppernd, bis sie Kopfschmerzen bekam, das Rasierwasser wieder, das ihr Schatz benutzte. Sie kaufte ein Fläschchen und bewahrte es in der Schublade ihres Nachtkästchens auf. Wenn sie nachts aufwachte, allein in ihrem Bett, allein in dem großen, menschenleeren Haus, und Traurigkeit sie beschlich, dann öffnete sie das Fläschchen, sog den Duft ein, flüsterte »Bonanotti, amuri mè, gute Nacht, Liebster«, und konnte dann wieder einschlafen.
Mariastella war überzeugt, dass Ragioniere Emanuele Gargano nicht mit den Geldeinlagen untergetaucht und erst recht nicht wegen irgendeiner nicht eingehaltenen Vereinbarung von der Mafia ermordet worden war. Bei der Befragung durch Mimì Augello (Montalbano hatte sich auf diesen Fall gar nicht einlassen wollen, weil er fand, er habe keinen blassen Schimmer von Geldangelegenheiten) hatte Signorina Cosentino ausgesagt, der Ragioniere leide ihres Erachtens unter einer momentanen Amnesie und werde früher oder später wieder auftauchen und dann die bösen Zungen zum Schweigen bringen. Sie hatte mit solch glühender Inbrunst gesprochen, dass Augello beinahe selbst daran glaubte.
In ihrem unerschütterlichen Glauben an die Ehrlichkeit des Ragioniere öffnete Mariastella jeden Morgen das Büro und wartete auf die Rückkehr ihres Liebsten. Alle in der Stadt lachten über sie. All jene, versteht sich, die mit dem Ragioniere nichts zu tun gehabt hatten, denn wer sein Geld verloren hatte, dem war das Lachen vergangen. Tags zuvor hatte Montalbano von Gallo erfahren, dass Signorina Cosentino auf der Bank gewesen war, um aus eigener Tasche die Miete fürs Büro zu zahlen. Warum also war der Kerl, der sie jetzt mit dem Revolver bedrohte, so sauer auf die Ärmste, obwohl sie mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun hatte? Und warum war der Gläubiger so spät auf diese tolle Idee gekommen – dreißig Tage nach dem Verschwinden, als alle anderen Opfer des Ragioniere Gargano sich mit ihrem Schicksal bereits abgefunden hatten? Montalbano, Anhänger der ersten Theorie, derzufolge der Ragioniere die Leute übers Ohr gehauen und sich dann abgesetzt hatte, empfand Mitleid mit Mariastella Cosentino. Jedes Mal, wenn er zufällig an der Agentur vorbeiging und sie aufrecht hinter der Trennscheibe am Schalter sitzen sah, bekam er Herzbeklemmungen, die er den ganzen Tag nicht mehr loswurde.
Vor dem Büro der »König Midas« waren an die dreißig Personen, die aufgeregt redeten, wild gestikulierten und von drei Polizisten auf Distanz gehalten wurden. Man erkannte den Commissario und umringte ihn.
»È veru che c’è unu armatu, ist da drin wirklich einer mit einer Waffe?«
»Cu è, cu è, wer denn?«
Laut rufend bahnte Montalbano sich mit Ellenbogen einen Weg und erreichte schließlich die Schwelle der Eingangstür. Hier blieb er, ziemlich erstaunt, stehen. Drinnen waren, er erkannte sie von hinten, Mimì Augello, Fazio und Galluzzo, und es sah aus, als tanzten sie ein seltsames Ballett: Mal neigten sie den Oberkörper nach rechts, mal neigten sie ihn nach links, mal machten sie einen Schritt nach vorn, mal einen nach hinten. Geräuschlos öffnete er die gläserne Innentür und besah sich die Szene genauer. Das Büro bestand aus einem einzigen großen Raum, zweigeteilt durch einen Tresen aus Holz, auf dem sich eine breite Glasscheibe mit dem Schalter befand. Jenseits der Trennwand standen vier unbesetzte Schreibtische. Mariastella Cosentino saß an ihrem gewohnten Platz hinter dem Schalter, sehr blass, aber gefasst und aufrecht. Die beiden Zonen des Büros waren durch eine schmale Holztür in der Trennwand miteinander verbunden.
Der Angreifer oder was er auch war, Montalbano wusste nicht, wie er ihn bezeichnen sollte, stand genau in dieser Tür, damit er die Sekretärin und die drei von der Polizei gleichzeitig im Visier hatte. Es war ein achtzigjähriger Mann, den der Commissario gleich erkannte, ein Vermessungsingenieur, der geachtete Geometra Salvatore Garzullo. Teils wegen der nervlichen Belastung, teils aufgrund des ziemlich weit fortgeschrittenen Parkinson zitterte der Revolver, der ganz offensichtlich aus den Zeiten Buffalo Bills und der Sioux stammte, heftig in der Hand des Geometra; deshalb wichen, wenn Garzullo auf einen der Polizisten zielte, alle aus, weil sie nicht wussten, wohin ein eventueller Schuss gehen würde.
»Ich will das Geld zurück, das mir dieser Dreckskerl gestohlen hat. Sonst erschieß ich die Sekretärin!«
Seit über einer Stunde schrie der Geometra den gleichen Satz, kein Wort mehr, kein Wort weniger, immer den gleichen Satz, und jetzt war er erschöpft und heiser, und seine Stimme klang, als ob er gurgelte.
Entschlossen trat Montalbano drei Schritte vor, ging an seinen Leuten vorbei und streckte, von einem Ohr zum anderen grinsend, dem Alten die Hand hin.
»Mein lieber Geometra! Das freut mich aber! Wie geht es Ihnen?«
»Ganz gut, danke«, sagte der Geometra verdutzt.
Aber er fing sich gleich wieder, als er sah, dass Montalbano noch einen Schritt auf ihn zugehen wollte.
»Bleiben Sie stehen, oder ich schieße!«
»Commissario, um Himmels willen, setzen Sie Ihr Leben nicht aufs Spiel«, schaltete Signorina Cosentino sich mit fester Stimme ein. »Wenn sich hier jemand für Ragioniere Gargano opfern muss, dann ich, ich bin bereit!«
Anstatt über den melodramatischen Einsatz zu lachen, fühlte Montalbano, wie ihn die Wut packte. Hätte er den Ragioniere in diesem Augenblick vor sich gehabt, er hätte ihm die Visage zermatscht.
»Das ist doch dummes Zeug! Hier opfert sich überhaupt niemand!«
Er wandte sich an den Geometra und begann mit seiner Improvisation.
»Sagen Sie, Signor Garzullo, wo waren Sie denn gestern Abend?«
»Das geht Sie einen Scheißdreck an«, gab der Alte kämpferisch zurück.
»Antworten Sie, in Ihrem eigenen Interesse.«
Der Geometra kniff die Lippen zusammen, dann rang er sich schließlich durch und machte den Mund auf.
»Ich war gerade wieder zu Hause. Ich war vier Monate im Krankenhaus in Palermo, dort hab ich erfahren, dass der Ragioniere mit meinem Geld abgehauen ist, mit allem, was ich hatte, nachdem ich ein Leben lang gearbeitet habe!«
»Sie haben gestern spät abends also nicht ferngesehen?« »Ich hatte keine Lust, mich mit Schwachsinn zulabern zu lassen.«
»Deswegen wissen Sie also nichts!«, rief Montalbano triumphierend.
»Was sollte ich denn wissen?«, fragte Garzullo verwirrt. »Dass Ragioniere Gargano festgenommen wurde.«
Aus dem Augenwinkel beobachtete der Commissario Mariastella. Er erwartete einen Aufschrei, irgendeine Reaktion, aber die Frau rührte sich nicht und wirkte eher verwirrt als überzeugt.
»Daveru? Wirklich?«, fragte der Geometra.
»Mein Ehrenwort«, sagte Montalbano, der große Schauspieler. »Er wurde festgenommen, und zwölf dicke Koffer wurden beschlagnahmt, randvoll mit Geld. In Montelusa wird noch heute Vormittag in der Präfektur mit der Rückgabe an die rechtmäßigen Besitzer begonnen. Haben Sie eine Empfangsbestätigung über das, was Sie Gargano gegeben haben?«
»Natürlich!«, antwortete der Alte und schlug sich mit der freien Hand auf die Jackett-Tasche, wo man den Geldbeutel hat.
»Dann ist ja alles klar, alles wieder in Ordnung«, sagte Montalbano.
Er trat zu dem Alten, nahm ihm die Waffe aus der Hand und legte sie auf den Tresen.
»Kann ich auch morgen in die Präfektur gehen?«, fragte Garzullo. »Ich fühl mich schlecht.«
Er wäre umgekippt, wenn der Commissario ihn nicht aufgefangen hätte.
»Fazio und Galluzzo, schnell, bringt ihn ins Krankenhaus.« Die beiden stützten den alten Mann. Als er an Montalbano vorbeiging, brachte er ein »Grazii di tuttu« heraus, danke für alles.
»Aber wofür denn«, sagte Montalbano und fühlte sich hundsmiserabel.
Zwei
Inzwischen war Mimì Signorina Mariastella, die zwar noch immer saß, aber wie ein Baum im Wind schwankte, zu Hilfe geeilt.
»Soll ich Ihnen etwas aus der Bar holen?«
»Ein Glas Wasser, danke.«
In diesem Augenblick hörten sie draußen einen Beifallssturm und lautes Geschrei: »Bravo! Es lebe Geometra Garzullo!« Anscheinend gab es in der Menge viele Leute, die von Gargano betrogen worden waren.
»Was haben die nur alle gegen ihn?«, fragte die Frau, als Mimì hinausging.
Sie rang in einem fort die Hände und war mittlerweile nicht mehr blass, sondern rot wie eine Tomate.
»Na ja, irgendeinen Grund werden sie schon haben«, antwortete der Commissario diplomatisch. »Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass der Ragioniere verschwunden ist.«
»Ja schon, aber warum muss man gleich an etwas Böses denken? Er kann doch sein Gedächtnis verloren haben, bei einem Autounfall oder einem Sturz oder so … Ich habe mir erlaubt, bei …«
Sie unterbrach sich und schüttelte betrübt den Kopf.
»Ach nichts«, sagte sie, einen Gedanken fallen lassend.
»Was haben Sie sich erlaubt?«
»Sehen Sie fern?«
»Manchmal. Wieso?«
»Ich hatte von einer Sendung mit dem Titel ›Bitte melde dich!‹ gehört, in der es um Vermisste geht. Ich ließ mir die Telefonnummer geben und …«
»Ich verstehe. Was hat man Ihnen geantwortet?«
»Dass sie nichts tun könnten, weil ich nicht in der Lage sei, die notwendigen Angaben zu liefern, Alter, Ort des Verschwindens, Foto, all so was.«
Schweigen trat ein. Mariastellas Hände waren inzwischen ein einziger unentwirrbarer Knoten. Montalbanos vor sich hin dösender verflixter Bulleninstinkt wurde, weiß der Himmel, warum, plötzlich für einen Moment wach.
»Signorina, Sie müssen schon auch die Geschichte mit dem Geld bedenken, das mit dem Ragioniere verschwunden ist. Es geht um viele Milliarden, wussten Sie das?«
»Ich weiß.«
»Haben Sie denn irgendeine Ahnung, wo …?«
»Ich weiß nur, dass er das Geld investierte. In was und wo, weiß ich nicht.«
»Und hat er mit Ihnen …?«
Mariastella schoss die Röte ins Gesicht.
»Was … was meinen Sie?«
»Hat er nach seinem Verschwinden auf irgendeine Weise Kontakt mit Ihnen aufgenommen?«
»Hätte er das getan, dann hätte ich es Dottor Augello berichtet. Er hat mich befragt. Ich kann Ihnen nur wiederholen, was ich Ihrem Vice schon gesagt habe: Emanuele Gargano ist ein Mann, der nur ein Ziel im Leben hat: andere glücklich zu machen.«
»Das glaube ich gern«, sagte Montalbano.
Und meinte es auch so. Denn er war überzeugt, dass Ragioniere Gargano auf irgendeiner einsamen Insel Polynesiens Edelnutten, Barkeeper, Geschäftsführer von Casinos und Verkäufer von Luxusautos permanent glücklich machte.
Mimì Augello kam mit einer Flasche Mineralwasser und ein paar Pappbechern zurück, sein Handy hatte er ans Ohr geklemmt.
»Sissignore, sissignore, Augenblick bitte.«
Er gab das Ding dem Commissario.
»Für dich. Der Polizeipräsident.«
Bih, che camurrìa, der nervte vielleicht! Man konnte nicht behaupten, dass die Beziehung zwischen Montalbano und Questore Bonetti-Alderighi von gegenseitiger Achtung und Sympathie getragen war.
Ein Anruf des Polizeipräsidenten bedeutete, dass es irgendeine unangenehme Angelegenheit zu besprechen gab. Und dazu hatte Montalbano im Augenblick keine Lust.
»Ja bitte, Signor Questore?«
»Kommen Sie sofort!«
»Spätestens in einem Stündchen bin ich …«
»Montalbano, Sie sind Sizilianer, aber wenigstens in der Schule werden Sie doch wohl Italienisch gelernt haben. Kennen Sie die Bedeutung des Adverbs ›immediatamente, sofort‹?«
»Warten Sie kurz, ich hab’s gleich. Ach ja. Es bedeutet ›ohne räumlichen und zeitlichen Verzug‹. C’inzertai, stimmt’s, Signor Questore?«
»Sehr witzig. In exakt einer Viertelstunde sind Sie hier in Montelusa.«
Der Questore legte auf.
»Mimì, ich muss gleich zum Questore. Nimm den Revolver des Geometra und bring ihn ins Kommissariat. Signorina Cosentino, ich will Ihnen einen Rat geben: Schließen Sie jetzt gleich das Büro, und gehen Sie nach Hause.«
»Warum?«
»Nun, bald wird die ganze Stadt über Signor Garzullos Anwandlungen Bescheid wissen. Und es ist nicht auszuschließen, dass es ihm irgendein Schwachkopf nachtun will, und dann haben wir es womöglich mit jemand zu tun, der jünger und gefährlicher ist.«
»Nein«, sagte Mariastella entschieden. »Ich verlasse diesen Platz nicht. Und gesetzt den Fall, dass der Ragioniere zurückkommt und niemand vorfindet?«
»Das wäre ein herber Schlag!«, sagte Montalbano finster. »Und noch was: Haben Sie vor, Anzeige gegen Signor Garzullo zu erstatten?«
»Keinesfalls.«
»Besser so.«
Auf der Straße nach Montelusa war viel Verkehr, folglich wurde Montalbanos schlechte Laune noch schlechter. Außerdem litt er, denn von dem ganzen Sand juckte es ihn zwischen Socken und Haut, zwischen Hemdkragen und Hals. Etwa hundert Meter weiter, auf der linken Seite und damit in entgegengesetzter Richtung, lag »Il Ristoro del Camionista«, wo es einen erstklassigen Espresso gab. Fast auf Höhe des Lokals angekommen, blendete er auf und bog ab. Ein Riesenspektakel brach los, es wurde gebremst, gehupt, geschrien, geschimpft, geflucht. Wie durch ein Wunder gelangte er heil auf den Platz vor dem Lokal, er stieg aus und trat ein. Als Erstes sah er zwei Personen, die er sofort erkannte, obwohl sie praktisch mit dem Rücken zu ihm standen. Es waren Fazio und Galluzzo, die jeder ein Gläschen Cognac tranken, zumindest sah es so aus. So früh am Morgen Cognac? Er stellte sich zwischen die beiden und bestellte bei dem Barmann einen Espresso. Als sie seine Stimme hörten, wandten sich Fazio und Galluzzo überrascht zu ihm hin.
»Prost«, sagte Montalbano.
»Äh … wir wollten nur …«, fing Galluzzo an, sich zu rechtfertigen.
»Wir waren ganz schön fertig«, sagte Fazio.
»Wir haben eine Stärkung gebraucht«, setzte Galluzzo noch hinzu.
»Fertig? Wieso das?«
»Der arme Geometra Garzullo ist tot. Er hatte einen Herzinfarkt«, sagte Fazio. »Als wir am Krankenhaus ankamen, war er bewusstlos. Wir haben die Sanitäter geholt, und sie haben ihn gleich reingebracht. Wir haben noch das Auto abgestellt, dann sind wir reingegangen, und da haben sie uns gesagt, dass …«
»Das war schlimm für uns«, sagte Galluzzo.
»Das ist allerdings schlimm«, sagte Montalbano dazu. »Wisst ihr was, seht mal nach, ob er Verwandte hatte, und wenn nicht, dann findet ihr vielleicht irgendeinen guten Freund. Gebt mir Bescheid, wenn ich aus Montelusa zurück bin.«
Fazio und Galluzzo verabschiedeten sich und gingen hinaus. Montalbano trank in aller Ruhe seinen Espresso, dann fiel ihm ein, dass der »Ristoro« auch für seinen tumazzo caprino bekannt war; man wusste zwar nicht, wer diesen Ziegenkäse herstellte, aber er war eine Delikatesse. Es gelüstete ihn spontan danach, und so stellte er sich an jenen Abschnitt der Theke, wo außer tumazzo auch Salami, capocotte und sosizze auslagen. Der Commissario war versucht, einen Großeinkauf zu machen, aber er riss sich zusammen und erstand nur einen kleinen Laib Ziegenkäse. Als er von dem Platz vor dem Lokal wieder in die Straße einbiegen wollte, stellte er fest, dass dies kein leichtes Unterfangen war, die Schlange der Lastwagen und Autos war dicht und bot keinen Durchschlupf. Nach fünf Minuten Warten erwischte er eine Lücke und reihte sich ein. Während der Fahrt hatte er ständig einen embryonalen Gedanken, der einfach keine Gestalt annahm, und das ärgerte ihn. So kam es, dass er sich unversehens in Vigàta wiederfand.
Und nun? Sollte er sich noch mal auf den Weg nach Montelusa machen und verspätet in der Questura erscheinen? Jetzt war sowieso schon alles egal, da konnte er auch nach Marinella heimfahren, sich duschen und in Schale werfen und sich dann, frisch, sauber und mit klarem Kopf, dem Questore stellen. Und während er unter der Dusche stand, kristallisierte sich ein Gedanke heraus. Eine halbe Stunde später hielt er vor dem Kommissariat, stieg aus und ging hinein. Kaum war er drin, betäubte ihn Catarellas Geschrei, aber es war weniger Geschrei als ein Mittelding zwischen Gekläff und Gewieher.
»Aaaaahhh Dottori Dottori! Ccà è? È ccà, Dottori?«
»Ja, Catarè, ich bin da. Was ist los?«
»Der Signori und Quistori plärrt wie ein Klageweib, Dottori! Fünfmal hat er schon angerufen! Der ist so was von stinksauer!«
»Sag ihm, er soll sich beruhigen.«
»Dottori, ich tät mich nie trauen, so mit dem Signori und Quistori zu reden! Das wär ganz furchtbar ungezogen! Was soll ich ihm sagen, wenn er noch mal anruft?«
»Dass ich nicht da bin.«
»Nzamà, Signuri, nie und nimmer! Ich kann doch den Signori und Quistori nicht einfach anlügen!«
»Dann stell ihn zu Dottor Augello durch.«
Er öffnete die Tür zu Mimìs Zimmer.
»Was wollte der Questore?«
»Ich weiß es nicht, ich war noch nicht dort.«
»Oh Madunnuzza santa! Und wer darf sich das jetzt anhören?«
»Du hörst dir das an. Du rufst ihn an und erzählst ihm, ich sei auf dem Weg zu ihm vor lauter Eile wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Nichts Schlimmes, eine kleine Platzwunde an der Stirn. Sag ihm, wenn es mir wieder besser geht, werde ich am Nachmittag meiner Pflicht nachkommen. Laber ihn zu. Und dann kommst du zu mir.«
Er ging in sein Büro, und sogleich kam Fazio hinter ihm hergelaufen.
»Ich wollte Ihnen sagen, dass wir eine Enkelin von Geometra Garzullo gefunden haben.«