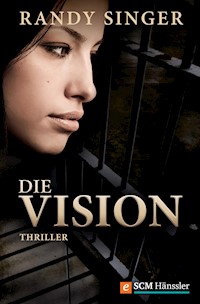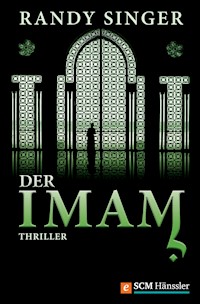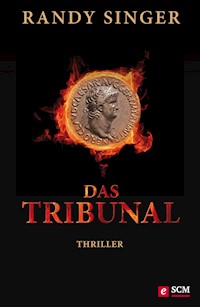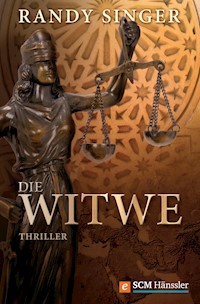Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Justizthriller
- Sprache: Deutsch
Cameron Brown ist ihre größte Sehnsucht bisher versagt geblieben. Nur durch eine Leihmutter kann Cameron Brown sich ihren sehnlichen Kinderwunsch erfüllen. Um die Chancen auf Erfolg zu erhöhen, werden die Embryos zuvor geklont. Als beim ungeborenen Baby Down-Syndrom diagnostiziert wird, will Cameron es abtreiben lassen. Der Anwalt Mitchell Taylor kämpft mit Leihmutter Marynagegen die Abtreibung. Doch kann er gleichzeitig einen bioethischen Albtraum für Millionen verhindern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Dieses E-Book darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer,E-Reader) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der dasE-Book selbst, im von uns autorisierten E-Book Shop, gekauft hat.Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der vonuns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor unddem Verlagswesen.
ISBN 978-3-7751-7201-1 (E-Book)ISBN 978-3-7751-5540-3 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book:Satz & Medien Wieser, Stolberg
© der deutschen Ausgabe 2014SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: info@scm-haenssler.deOriginally published in the U.S.A. under the title: Irreparable HarmCopyright © 2010 by Randy SingerGerman edition © 2013 by SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG with permission ofTyndale House Publishers, Inc. All rights reserved.
Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten.
Übersetzung: p.s. wordsUmschlaggestaltung: OHA Werbeagentur GmbH, Grabs, Schweiz; www.oha-werbeagentur.chTitelbild: 123rf.com; istockphoto.comSatz: Satz & Medien Wieser, Stolberg
Inhalt
Stimmen zu Der Klon
Stimmen zu Randy Singer
Vorwort
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Epilog
Danksagung
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Stimmen zu Der Klon
»Ein absolut gelungener Roman. Randy Singer verbindet eine spannende Handlung mit einer eindringlichen Botschaft. Sehr zu empfehlen.«
T. Davis Bunn, Autor
»Ein fesselnder Medizin-Justizthriller, unvergessliche Persönlichkeiten, ein ethisches Minenfeld und durchdachte Denkanstöße zu der zeitlosen Kernfrage ›Wer entscheidet über Leben und Tod?‹. Was kommt dabei heraus, wenn man diese Zutaten mit der Fähigkeit mischt, lebensnah und unterhaltsam Beobachtungen festzuhalten: über menschliche Leidenschaft, wirtschaftliche Macht und intellektuellen Ehrgeiz, die die biotechnologische Revolution vorantreiben? Dieses Buch liefert die Antwort. Ich kann Der Klon nur wärmstens empfehlen. Abgesehen davon, dass ich es nicht mehr aus der Hand legen konnte, kann ich noch immer nicht aufhören, darüber nachzudenken.«
Samuel B. Casey, Managing Director des Law of Life Project und ehemaliger Geschäftsführer der Christian Legal Society
»… viele Rätsel und Wendungen, mit denen Singer souverän spielt. … Singer liefert ein weiteres Mal einen starken Beitrag zu diesem … Genre.«
Publishers’ Weekly
»Hin und wieder erobert ein Autor die Bestsellerlisten mit der seltenen Gabe, ein tiefgründiges und gleichzeitig unterhaltsames Buch zu verfassen. Randy Singer gelingt genau dies. Mit erstaunlicher Tiefe und Kompetenz erzählt er eine Geschichte, die die Messlatte für Justizthriller höherlegt. … ein wichtiges Buch, das meiner Meinung nach kein Leser wieder aus der Hand legen kann.«
Carolyn Curtis, Autorin
»In Der Klon geht Randy Singer unverblümt die kompliziertesten und faszinierendsten bioethischen Fragen unserer Zeit an. Das Thema Klonen, Stammzellenforschung, raffgierige Geschäftsführer und Anwälte mit schillerndem Charakter lassen eine fesselnde Geschichte entstehen, welche die Schlagzeilen von morgen vorwegnimmt. Die Figuren werden nicht nur Ihr Herz erobern, sondern Ihre Denkweise zu den entscheidendsten Fragen auf den Prüfstand stellen, mit denen wir in unserer kühnen neuen Welt der Genforschung konfrontiert werden: Ab wann beginnt ein Leben, und wie können wir es schützen?«
Mark Early, ehemaliger Generalstaatsanwalt von Virginia und bis 2010 Präsident von Prison Fellowship
»… Ein Justizthriller, der es mühelos mit Grishams besten Werken aufnehmen kann. … Die Geschichte fesselt Sie, denn genau wie Mitchell werden Sie sich verzweifelt fragen, wie in aller Welt dieser knifflige Fall jemals zu einem guten Ende kommen kann. Noch beängstigender ist jedoch die Tatsache, dass so ein Fall wie dieser sehr, sehr bald Realität werden könnte. Empfehlenswert.«
Christian Fiction Review
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Stimmen zu Randy Singer
»Die Figuren sind so gut ausgearbeitet und die Dialoge so interessant, dass man diesen Thriller kaum aus der Hand legen kann.«
Bookreporter.com über Der Code des Richters
»Randy Singer verbindet traditionelle Justizthriller-Elemente mit christlichen Themen, doch vorrangig ist Die Staatsanwältin eine Kriminalgeschichte, und zwar eine abgründig gute.«
Booklist über Die Staatsanwältin
»Singers juristische Kenntnisse sind genauso überzeugend wie seine beeindruckende Erzählkunst. Erneut drängt er uns bis über den Abgrund hinaus und lässt uns dort zappeln, bevor er uns souverän zurückzieht.«
Romantic Times über Der Imam
Für Charlotte und Darrell, »Duck und Hip«, Mama und Papa.Ein Buch kann niemals die vielen Jahre Unfug ausgleichen,die ich als Teenager verschuldete.Aber es ist ein guter Anfang.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Vorwort
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches in den USA berichtete die Presse täglich über Stammzellenforschung. Ein paar radikale Gruppierungen behaupteten, sie hätten bereits den ersten Menschen geklont (obgleich dies angezweifelt wurde) und der Kongress zog ein vollständiges Klonverbot in Betracht. Die Herausforderung bei diesem Buch bestand somit darin, eine Geschichte zu erzählen, die nicht schon mit der nächsten Schlagzeile überholt sein würde.
Daher stellte ich die Prämisse auf, dass der Kongress ein Verbot sowohl gegen therapeutisches als auch reproduktives Klonen verhängen würde und nannte es das Bioethikgesetz. Die Geschichte ereignet sich ungefähr anderthalb Jahre nach Verabschiedung dieses hypothetischen Gesetzes, zu einer Zeit, in der bahnbrechende Fortschritte in der Wissenschaft erreicht wurden. Im Mittelpunkt steht eine spezielle Form des Klonens, die Blastomeren-Isolation, bei der ein sehr junger Embryo (mit weniger als acht Zellen) in zwei oder mehr Embryos geteilt wird. Im Grunde handelt es sich um eine künstliche Erschaffung von »Zwillingen« im Labor. Der Unterschied zu dem kontroverseren Verfahren des Zellkerntransfers somatischer Zellen – mit dem auch das Schaf Dolly erschaffen wurde – liegt in der Komplexität und der Art des Verfahrens.
Als ich diese Anmerkung schrieb, gab es keine dokumentierten Fälle, bei denen das Verfahren der Blastomeren-Isolation eingesetzt wurde, um geklonte menschliche Embryos zur Fortpflanzung zu erhalten. Wissenschaftler waren sich einig, dass man es nicht anwenden sollte, da genetische Defekte auftreten könnten und die Überlebenschancen der entstehenden Embryos ungewiss seien. Dennoch hatte eine Gruppe von Forschern aus Oregon durch dieses Verfahren bereits Affen geklont. Die vorliegende Geschichte setzt die medizinischen Fortschritte voraus, die notwendig wären, um dasselbe Verfahren bei Menschen anzuwenden.
Des Weiteren liegt der Geschichte die Vorstellung zugrunde, dass es irgendwo eine Kinderwunschklinik gibt, welche die vorherrschende Meinung in den Wind schlägt und von der beschriebenen Methode Gebrauch macht, um die ersten geklonten menschlichen Embryos zu erzeugen. Von deren Schicksal erzählt dieses Buch.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Prolog
Sie war sechzehn Jahre alt. Viel zu jung, um zu sterben, wie ihre Mutter ihr immer wieder versicherte.
Maryna Sareth lag zitternd im hinteren Laderaum des rostigen koreanischen Frachters. Tief im Innern des Schiffes war sie, dicht an ihre Mutter gedrängt, zwischen fast einhundert anderen kambodschanischen und chinesischen Flüchtlingen in einem entsetzlich stinkenden Container eingepfercht. Jede Nacht schlotterte sie sich in den Schlaf.
Um diese Reise antreten zu dürfen, hatte jeder von ihnen siebentausend US-Dollar gezahlt. Sollten sie es nach Amerika schaffen, würden sie weitere zehntausend Dollar zahlen.
In dem Frachtraum gab es keine Fenster und nur einen schwachen Ventilator, der gegen den Gestank von Urin und Fäkalien nichts auszurichten vermochte. Als Toiletten hatte man ihnen zwei Eimer zur Verfügung gestellt, einen für die Männer und einen für die Frauen. Die meisten Flüchtlinge, so auch Maryna, litten unter Hautekzemen und Blasenentzündungen. Es war schon einige Tage her, dass man ihr gestattet hatte, an Deck zu kommen, um sich mit Salzwasser abzuwaschen.
Ihre rot geschwollenen Augen brannten von einer Entzündung. Sie konnte kaum noch sehen. Aber nachts, wenn es stockdunkel wurde und man nur die unregelmäßigen Atemzüge der Menschen hörte, die vor Kälte nicht schlafen konnten, war das sowieso egal. Ihr einziger Trost waren der knochige Arm ihrer Mutter, der sanft auf ihrem Rücken lag, und ihre zarten Hände, die immer wieder Marynas Schultern warm rieben.
Maryna konnte die Snakeheads hören – so nannten sich die chinesischen Schmuggler, die einen Menschenhändlerring betrieben –, die zusammen mit den kambodschanischen Auftragskillern an Deck tranken und feierten. Die Auftragskiller waren ehemalige Rote-Khmer-Soldaten, angeheuert von den Snakeheads, um ihre menschliche Fracht zu bewachen. Je weiter die Nacht voranschritt und je lauter der Lärm wurde, umso dichter drängte sich Maryna an ihre Mutter, aus Furcht vor den unausweichlichen Besuchen: Die Luke wurde geöffnet, ein Lichtspalt fiel auf die zusammengepferchte Fracht, und das grausame Auswahlspiel der Snakeheads und ihrer Handlanger nahm seinen Lauf.
In dieser Nacht, der Nacht, die sich für immer in ihr Gedächtnis einbrennen sollte, blieb der Lichtstrahl einer Taschenlampe an ihrem Körper hängen. Sie vergrub den Kopf in der Achsel ihrer Mutter, versteckte ihr Gesicht und hoffte, dass ihr langes schwarzes Haar sie vor den Blicken der Männer schützen würde.
Doch der Kambodschaner hatte seine Beute bereits entdeckt. Sie hörte, wie er über die Reihen von Körpern stieg, bis er direkt über Maryna stand und das zitternde Mädchen zwischen seinen gespreizten Beinen lag. Er packte sie an den Haaren, zog ihren Kopf bis in den Nacken zurück, leuchtete ihr mit der Taschenlampe ins Gesicht und erspähte ein elegant geschnittenes junges Gesicht mit großen braunen Augen. Weder der Dreck, der Hautausschlag noch die entzündeten Augen konnten ihre Schönheit verbergen.
»Komm mit«, knurrte er. Seine zusammengekniffenen Augen starrten sie lüstern aus seinem dunklen und harten Gesicht an, das von einem dichten Bart und offenen Geschwüren bedeckt war. Er ließ Marynas Haare los, die gehorchte und langsam auf die Knie kam. Sie blickte nicht auf.
Doch Marynas Mutter, zweiunddreißig Jahre alt und ebenso zierlich wie ihre Tochter, war bereits aufgesprungen und stellte sich zwischen Maryna und ihren Peiniger. Sie streichelte ihm die Brust und trat dann einen kleinen Schritt zurück, um zu sehen, wie der gierige Blick des Mannes langsam von Maryna zu ihr wanderte. Ohne eine Regung zu zeigen, hielt sie seinem Blick stand.
»Sie ist nicht die richtige Frau für dich«, sagte Marynas Mutter, während sie die obersten Knöpfe ihrer zerrissenen Bluse öffnete. Vorsichtig griff sie nach der schwieligen Hand des Mannes, drehte sich um und zog ihn in Richtung des Oberdecks hinter sich her.
Mit tränenüberströmtem Gesicht streckte Maryna die Arme nach ihrer Mutter aus, die über und um die Körper der anderen Flüchtlinge stieg und mit dem Soldaten verschwand.
Wieder zitterte Maryna, doch diesmal war die kalte Nachtluft der Wüste Arizonas schuld. Sie hatte nicht geahnt, dass es in Amerika nachts so kalt werden konnte, die Luft so schneidend, das Land so karg.
Im Januar hatte der koreanische Frachter Guatemala erreicht. Maryna, ihre Mutter und einige andere wurden in dem engen Hohlraum unter dem Zwischenboden eines Grapefruitlasters versteckt und nach Mexiko geschmuggelt. In Mexiko wurde die Gruppe von bewaffneten »Kojoten« abgeholt, wie sich die Männer nannten, die illegale Einwanderer über die Grenze schleusten. Ausgestattet mit nur wenig Wasser und noch weniger Proviant, durchquerten sie die Wüste zu Fuß. Um warm zu bleiben, hielten sich die Flüchtlinge nachts fest umschlungen, da ihnen die Kojoten verboten, Feuer zu machen.
Am sechsten Tag schnitten sie sich ihren Weg durch einen Maschendrahtzaun in die USA. Die Kojoten hatten ihren Auftrag erfüllt. Irgendwie hatten sie es geschafft, den Infrarotkameras und seismischen Sensoren, die selbst Schritte erfassen konnten, zu entgehen. Sie waren von den Helikoptern und Flutlichtern der amerikanischen Grenzpatrouille nicht bemerkt worden.
Doch nun, gerade als sich die Gruppe von dreiundzwanzig Flüchtlingen bereit machte, die erste Nacht auf amerikanischem Boden zu verbringen, waren sie Charlie Coggins, einem berüchtigten selbsternannten Ordnungshüter und Landbesitzer, in die Falle getappt. Coggins hatte es sich zur Aufgabe gemacht, illegale Einwanderer zu jagen.
Die Kojoten hatten sie vor Charlie gewarnt. »Mexikaner«, hatte Charlie einst angeblich geprahlt, »sind das beste Freiwild, das es gibt.« Die Kojoten wollten die kleine Gruppe eigentlich an Charlies Land vorbeiführen. Doch ihnen war ein Fehler unterlaufen – und nun befanden sie sich auf Charlies Boden und waren von einer Meute Jagdhunde umzingelt.
»Hombre! Hombre!«, rief Charlie in die Nacht. »Komm raus mit den Händen über den Kopf. Du wanderst zurück nach Meh-hii-ko!« Dann ließ er ein hämisches Lachen erschallen.
Maryna und die anderen drängten sich starr vor Schreck dicht aneinander. Plötzlich durchbrach ein Schuss die Nacht, ein Warnschuss, abgegeben aus der Waffe eines Kojoten. Charlie duckte sich hinter seinen Truck und erwiderte das Feuer.
Maryna hörte, wie eine Kugel an ihr vorbeischoss, und spürte, wie der Sand durch den Einschlag um sie herum aufgewirbelt wurde. »Ich liebe dich«, sagte Marynas Mutter, während sie die Schultern des Mädchens umschlang und sie auf die Stirn küsste. »Renn los, wenn ich es tue, aber in die andere Richtung.«
Bevor Maryna antworten konnte, stand ihre Mutter auf und sprintete aus dem Gehölz hervor, ein fliehender Schatten im Mondlicht. Die Hunde heulten auf und setzten ihr nach, als jemand Marynas Arm ergriff und sie in eine andere Richtung, tiefer in das Gehölz hinein, hinter sich her zerrte. Wieder erklangen Schüsse, diesmal aber weiter entfernt. Maryna warf einen Blick über ihre Schulter und suchte nach der schlanken Silhouette im Mondlicht. Sie streckte die Arme aus, doch die Gestalt war verschwunden.
Langsam tauchte die Silhouette wieder auf und sagte leise ihren Namen. »Maryna, Maryna«, rief sie liebevoll. Sie wurde immer größer und schwebte über ihr, während sie Maryna sanft schüttelte und anstupste.
Durch ihren verschwommenen Blick wurde die Gestalt, die sich nun über Maryna beugte, deutlicher. Sie versuchte nach ihr zu greifen, doch ihre Muskeln wollten nicht gehorchen. Sie blinzelte träge … einmal … zweimal und versuchte verzweifelt, das Objekt oder die Person zu erfassen. Das Bild wurde schärfer, die Dunkelheit wich, und das Licht strömte zurück.
Sie blinzelte erneut und erkannte Dr. Lars Avery, ihren Gynäkologen, der neben ihrem Bett stand und lächelte.
»Herzlichen Glückwunsch, Maryna. Der Eingriff ist gut verlaufen. Sie sind schwanger.«
Maryna erwiderte das Lächeln und sank langsam in einen unruhigen Schlaf zurück. Selbst in ihren Träumen war die Gestalt ihrer Mutter nicht mehr aufzufinden.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1
Montag, 29. März. Sechs Wochen später.
Mitchell Taylor, Jurastudent im dritten Jahr an der Regent University in Virginia Beach, Virginia, lief die langen Flure der Rechtsfakultät entlang, während ihm sein schwerer Rucksack rhythmisch gegen die Schultern schlug. Um andere Studenten, die es weniger eilig hatten, schlug er einen Haken, nahm auf der Treppe zwei Stufen auf einmal und schlich sich um genau 9.04 Uhr in den Hörsaal 230. Der Unterricht hatte um neun Uhr begonnen.
Es war das erste Mal, dass Mitchell in diesem Semester zu spät kam. Und auch das erste Mal seit Monaten, dass er die vorgegebene Lektüre nicht komplett gelesen hatte. Kurz hatte er in Erwägung gezogen, gar nicht zum Unterricht zu erscheinen, doch die Werte, die ihm in seinem Grundstudium am Virginia Military Institute, einer Militärakademie, eingetrichtert worden waren, verwehrten ihm das Vergnügen, eine Stunde zu schwänzen. Stonewell Jackson, dessen Lektionen noch immer durch die Vorlesungssäle des VMI geisterten, hätte ein solch undiszipliniertes Verhalten niemals gebilligt.
Noch immer nach Atem ringend, zog Mitchell seinen Laptop aus dem Rucksack und fuhr ihn hoch. Er legte einen zehn Zentimeter dicken Wälzer über Verfassungsrecht auf den freien Platz neben sich und schlug den Fall auf, den sie heute behandeln wollten. Sein Blick folgte Professor Charles Arnold, einem jungen Afro-Amerikaner, der vor den Studenten auf und ab ging.
»Heute«, wandte sich Mr Arnold an die fast 120 Jurastudenten, »werden wir die Abgründe des Rechts zum Thema Durchsuchung und Beschlagnahmung erforschen – die Frage, in welchen Fällen die Regierung einen Durchsuchungsbefehl vorweisen muss, um in unserem persönlichen Hab und Gut herumzustöbern, und in welchen nicht.«
Professor Arnold trat hinter sein Rednerpult zurück. Für einen kurzen, dramatischen Moment verstummte das Geräusch herumrutschender Körper, des Auspackens von Taschen und das Flüstern im Auditorium, als Mr Arnolds langer, dünner Finger die Anwesenheitsliste entlangfuhr. Geschlossen wandten die Studenten den Blick ab. Es galt als unschicklich, aufzusehen, während Arnold sein Opfer wählte, also konzentrierten sich alle auf die Bücher und Monitore vor ihren Nasen. Auch wenn alle anwesenden Studenten bereits in ihrem zweiten und dritten Jahr waren – Zweitler und Drittler, wie sie umgangssprachlich in der Rechtsfakultät bezeichnet wurden – und viele von ihnen, darunter auch Mitchell, schon in ein paar Wochen ihren Abschluss machen würden, wollte keiner von ihnen Mr Arnolds Opfer des Tages werden. Nur wenige entgingen seinen Befragungen unbeschadet.
Mr Arnolds Finger hielt kurz vor Ende der Seite. Mit hämischem Grinsen schaute der Professor auf. »Mr Taylor«, rief er, »da Sie gerade jetzt zu uns gestoßen sind, dürfen Sie heute den Anfang machen.«
Im Hörsaal breitete sich ein kollektives Aufatmen aus, von einem Platz in der Mitte der linken Seite am Gang ausgenommen, wo Mitchell Taylor gerade aufsprang. Er war nicht glücklich darüber, auserwählt worden zu sein, entschied sich aber, das Beste daraus zu machen. Angriff war immer noch die beste Verteidigung, davon war er überzeugt.
»Jawohl, Sir«, antwortete er mutig. Mit kerzengeradem Rücken und hocherhobenem Haupt stellte er sich auf. Mitchell war durchschnittlich groß, mit breiten Schultern und schmalen Hüften. Sein blondes Haar war kurz geschoren, seine Augenbrauen zusammengewachsen, sein Kiefer kantig und sein Gesicht glatt rasiert. Er wischte sich die schwitzenden Hände an seiner Jeans ab.
»Haben Sie den Fall des Obersten Gerichtshofes Kalifornien vs. Greenwood studiert?«, fragte der Professor. Mit dieser Routinefrage eröffnete er immer das Kreuzverhör.
»Jawohl, Sir«, antwortete Mitchell, und etwas weniger laut, »zumindest die relevanten Abschnitte, Sir.«
Professor Arnold blieb stehen und sah Mitchell mit einem Ausdruck übertriebener Überraschung an. »Was soll das heißen, die relevanten Abschnitte?«
Leugnen war zwecklos, das wusste Mitchell. »Ich habe die Mehrheitsentscheidung gelesen, Professor.«
»Ich verstehe. Und gibt es einen Grund, warum Sie sich die Minderheitsentscheidung von Richter Brennan erspart haben?«
Zu sagen, dass ihm dazu die Zeit gefehlt hatte, wäre keine gute Antwort gewesen. »Da Richter Brennan bekanntermaßen sehr liberal ist, sind seine Ansichten meiner Meinung nach meist schlecht begründet und selten erleuchtend.«
Einige Studenten kicherten leise. Auch Mitchell musste ein Grinsen unterdrücken. Professor Arnold hingegen schien das allerdings ganz und gar nicht amüsant zu finden.
»Nun denn, Mr Taylor, da Ihnen die Mehrheitsentscheidung so am Herzen zu liegen scheint, könnten Sie uns ja vielleicht die Mehrheitsentscheidung im Fall Kalifornien vs. Greenwood erläutern.«
Mitchell warf einen Blick auf das dicke Buch, das neben ihm lag, und las einen der wenigen Abschnitte vor, die er markiert hatte. »Da die Beklagten ihren Müll an einem öffentlich zugänglichen Ort entsorgt haben, ist ihr Anspruch auf Privatsphäre hinsichtlich der belastenden Gegenstände, die von ihnen entsorgt wurden, objektiv gesehen nicht gerechtfertigt.«
Er schaute zu Professor Arnold auf, der den Kopf schüttelte. »Und nun in verständlichem Deutsch, bitte.«
»Nun, ähm, die Polizei hat belastendes Material im Müll dieser Typen gefunden und sie daraufhin verhaftet. Die Frage war, ob die Beamten dafür einen Durchsuchungsbefehl gebraucht hätten oder nicht. Das Gericht meinte, dass es sich bei Müll um so was wie, ähm, aufgegebenes Eigentum handelt, und da man nicht davon ausgehen kann, dass der Inhalt unserer Mülltonnen privat bleibt, ist ein Durchsuchungsbefehl überflüssig.« Mitchell schaute zu den konservativen Kommilitonen im Saal hinüber, die zustimmend mit den Köpfen nickten.
»Und ich nehme an, Sie stimmen mit diesem Urteil überein?«, fragte Professor Arnold.
»Absolut«, erwiderte Mitchell selbstbewusst, »die bösen Jungs sind ins Kittchen gewandert.«
»Gesprochen wie ein echter Staatsanwalt«, sagte der Dozent spottend. Er lief einen Moment schweigend auf und ab, hielt dann inne und schaute Mitchell direkt in die Augen. »Da Sie sich nicht die Zeit genommen haben, die Gegenmeinung zu lesen, sollte ich vielleicht Brennans Hauptargumente für Sie zusammenfassen, um zu sehen, ob Sie diese zu einem Umdenken bewegen könnten.«
»Aber gerne«, gab Mitchell zurück. Er sah, wie einige Studenten das Gesicht verzogen. Eine Studentin im dritten Jahr, die vor ihm saß, tippte die Worte »SEI VORSICHTIG« in Großbuchstaben auf den Bildschirm ihres Laptops.
Der Professor lief bereits wieder mit gebeugtem Kopf auf und ab, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, während er seinen Vortrag hielt. »Richter Brennan meint, dass die meisten Menschen davon ausgehen, der Inhalt der Müllbeutel, die sie am Straßenrand deponieren, bleibe privat. Im Grunde sagt er: Man ist, was man wegschmeißt. Will man wissen, was hinter den geschlossenen Türen eines Mitglieds der Gemeinde vor sich geht, muss man sich nur dessen Müll anschauen. Eine einzige Mülltüte reicht aus, um die Gewohnheiten der entsprechenden Person hinsichtlich ihrer Ernährung, Lektüre, Gesundheit, Hygiene und selbst ihrer Sexualität aufzudecken. Wühlt man durch den Müll eines Menschen, so lassen sich sein finanzieller Status, seine privaten Gedanken, persönlichen Beziehungen und sexuellen Interessen enthüllen. Mir scheint, dass die Durchsuchung von Mülltonnen ohne Durchsuchungsbefehl einen groben Eingriff in die Privatsphäre darstellt.« Wieder blieb der Professor stehen und schaute Mitchell mit geneigtem Kopf an, in stiller Erwartung einer Antwort.
»Das sind ein paar schlagkräftige Argumente, Professor«, erwiderte Mitchell, »doch es gibt einen Grund dafür, warum Brennans Meinung die Minderheitsentscheidung blieb.« Ein paar seiner Kommilitonen stöhnten auf. Die Frau vor ihm markierte die Worte »SEI VORSICHTIG« nun rot.
»Legt man seinen Müll am Straßenrand ab«, fuhr Mitchell fort, »so gibt man dieses Eigentum auf. Es ist allgemein bekannt, dass die Müllbeutel auf der Straße Tieren, Kindern, Plünderern, Schnüfflern und den Paparazzi ausgesetzt sind. In der Mehrheitsentscheidung wird sogar der Fall einer reichen Frau aus Westmont erwähnt, die einmal in der Woche Gummihandschuhe und Anglerstiefel anzieht, die städtische Müllhalde besteigt und nach speziellen Coupons sucht, die als Kaufnachweis gelten, und diese dann an die Hersteller schickt, um die Rabattzahlungen für die entsprechenden Artikel einzuheimsen. Bei allem gebotenen Respekt, Sir, aber in dem Moment, in dem man seinen Müll an den Straßenrand legt, gehört er der Öffentlichkeit. Wie heißt es so schön? ›Des einen Müll ist des anderen Schatz.‹ In diesem Fall war es eben so, dass die Polizei den Schatz gefunden hat.«
Höchst zufrieden mit sich selbst beendete Mitchell seine Ausführungen. Als Opfer des Tages ausgewählt zu werden, war gar nicht so schlimm, wenn man Ahnung von der Materie hatte.
»Glauben Sie das wirklich?«, fragte Professor Arnold skeptisch. »Sobald Sie Ihren Müll rausbringen, verlieren Sie jegliches Anrecht auf Privatsphäre, was seinen Inhalt angeht?«
»So ist es«, sagte Mitchell. »Der Inhalt wird zu öffentlichem Eigentum.«
»Und diese Ansicht würden Sie auch vertreten, wenn es dabei um Ihren persönlichen Müll ginge?«
»Aber ja.«
»Gut«, sagte Professor Arnold zufrieden. Er trat hinter sein Pult und holte eine Rolle durchsichtiger Plastikfolie hervor. Während Mitchell und die anderen Studenten ihm gebannt zusahen, breitete Arnold die Folie vorsichtig auf dem Teppichboden vor dem Auditorium aus, sodass nun ein großer Teil des Bodens bedeckt war. Dann ging er zu einem kleinen Schrank im vorderen Teil des Raumes, öffnete die Tür und zog einen prall gefüllten, großen grünen Müllbeutel heraus. Er stellte ihn auf die Folie und sah zu Mitchell hoch.
»In vager Erwartung, dass Sie sich als unser hauseigener Vertreter für Recht und Ordnung der Meinung der Mehrheitsentscheidung anschließen würden, habe ich einen Ihrer Kommilitonen, der hier ungenannt bleiben soll, gebeten, mir einen der Müllbeutel zu bringen, die Sie am letzten Dienstag pünktlich zur Abholung am Straßenrand abgelegt haben.«
Mitchell riss erstaunt die Augen auf. Ein Murmeln ging durch die Reihen.
Professor Arnold war dabei, das Zugband des Müllbeutels zu lösen. »Bevor ich nun den Inhalt dieses Beutels auskippe und seinen Inhalt vor dem gesamten Kurs unter die Lupe nehme, möchte ich Ihnen noch einmal die Gelegenheit geben, sich die Vorteile der abweichenden Meinung vor Augen zu führen.«
In Gedanken raste Mitchell durch die Liste von Dingen, die er kürzlich weggeworfen hatte. Vergammelte Lebensmittel, ein paar alte T-Shirts und Unterhosen – was peinlich werden konnte –, Wurfsendungen und Zeitungen, die er wahrscheinlich besser in die Recyclingtonne geworfen hätte. Er fühlte sich durch den Trick des Professors vorgeführt. Trotzdem blieb er stur.
Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Im Bruchteil einer Sekunde, die ihm zum Nachdenken blieb, entschied er sich, es einfach darauf ankommen zu lassen.
»Toben Sie sich aus«, sagte Mitchell gelassen. »Aber ich möchte Sie schon im Voraus darauf hinweisen, dass ich alle Coupons bereits ausgeschnitten habe.«
Die anderen Studenten lachten, während Professor Arnold den Beutel aufknotete und seinen Inhalt auf die schützende Folie kippte. Er breitete den Müll aus und schaute ihn sich genauer an. Von Unterhosen keine Spur. War das vielleicht schon zwei Wochen her?
»O Mann«, stöhnte einer der Studenten in der ersten Reihe und wich entsetzt vor dem Gestank zurück.
»Zwei Pizzakartons in einer Woche«, murmelte Professor Arnold. »Ein leerer Eiscremebehälter und unzählige Pepsi-Light-Dosen.« Die beschriebenen Gegenstände legte er in die Tüte zurück, als wolle er eine Bestandsaufnahme machen. »Nicht gerade ein Gesundheitsfanatiker.«
Mitchell zwang sich ein gutmütiges Lächeln ab. Er dachte an all die privaten Dinge, die der Professor nun zu Gesicht bekommen würde. Am liebsten wäre er nach vorne gerannt, hätte sich die Tüte geschnappt und alles schnell wieder hineingestopft. Noch immer hielt er Ausschau nach seiner Unterwäsche. Aber er wollte Stellung beziehen. Jetzt gab es kein Zurück mehr.
»Hier haben wir einen alten Kontoauszug«, verkündete der Professor und hielt den Umschlag von Mitchells Bank hoch. Nun ging er die geplatzten Schecks durch.
Mitchell, der geplant hatte, vor seinem Abschluss seine finanziellen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, fühlte sich verraten. Seine Haltung verlor etwas von ihrem Selbstbewusstsein.
»Und hier haben wir einen Scheck für den Military Highway Ladies Club«, gab Arnold bekannt, den Scheck hin und her wedelnd. Einige Studenten lachten leise, genau wissend, dass der sittenstrenge Mitchell niemals ein solches Etablissement betreten würde. Andere Kommilitonen wiederum, denen dieses Ausmaß an Voyeurismus unangenehm war, rutschten nervös auf ihren Plätzen herum.
Und dann erstarrte Mitchell an seinem Platz zu Stein. Professor Arnold hatte einen Stapel von Absagen von Anwaltskanzleien entdeckt – es waren vier, um genau zu sein –, bei denen sich Mitchell vor Kurzem beworben hatte. Die hatte er ganz vergessen.
Bis zur vergangenen Woche hatte er sich auf einem äußerst attraktiven Angebot einer der größten Kanzleien der Region ausruhen können. Doch zu Mitchells Entsetzen hatte die Firma mit einem Großkonzern fusioniert, der über fünfhundert Anwälte beschäftigte. Das Angebot stand noch, doch Mitchell würde in der New Yorker Niederlassung arbeiten müssen. Er wusste genau, dass er dort in der Bibliothek verrotten würde, weil es sicherlich mindestens fünf Jahre dauern würde, bis er das Innere eines Gerichtssaals zu Gesicht bekam. Das war nicht der Job, um den er sich beworben hatte. Also verschickte er erneut Bewerbungen. Allerdings waren nun die meisten attraktiven Stellen bereits vergeben und seine Aussichten alles andere als rosig.
Professor Arnold sah sich gerade den ersten Brief an und warf Mitchell einen Blick zu. Jetzt handelte es sich ganz eindeutig um die Verletzung seiner Privatsphäre: Absagen, von denen nun der gesamte Kurs erfahren würde. Der Professor hatte gewonnen. Mitchell wollte, dass er aufhörte, aber es war zu einer Frage der Ehre geworden, wer sich durchsetzen würde, und Mitchell würde nicht nachgeben. Er hielt den Atem an.
»Dann sehe ich noch Wurfsendungen und anderen Kram«, sagte der Professor und blickte weg. »Unglücklicherweise scheint Mr Taylors Weste blütenweiß zu sein, sodass wir aufgrund seines Mülls keine Klagen gegen ihn anstrengen können.« Ohne ein Wort über den Inhalt der Briefe zu verlieren, stopfte Arnold sie zurück in den Sack.
Mitchell atmete langsam aus und erlaubte sich ein entspanntes Grinsen.
»Aber was ist das!«, rief Arnold plötzlich und hielt eine Schachtel Honey-Nut-Cheerios-Frühstücksflocken in die Luft. »Ein Kaufbelegcoupon, den er übersehen hat.«
Die Studenten lachten, Mitchell atmete auf und Professor Arnold ließ den Rest des Mülls wieder im Beutel verschwinden und ging zum nächsten Fall über. Mitchell warf einen Blick auf seine Notizen und machte sich auf etwas gefasst. Auch bei diesem Fall hatte er es versäumt, die abweichende Meinung zu lesen.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
2
Ein paar Stunden später sprach Mitchell ein nervöses Stoßgebet, bevor er an die Tür des Raumes klopfte, in dem das Vorstellungsgespräch stattfinden sollte. Die Jobinterviews im vergangenen Herbst hatte er sogar genossen – dort traf er auf Anwälte, die ihre Kanzleien anpriesen und auf der Suche nach ehrgeizigen, jungen Mitarbeitern waren. Und dank seiner hervorragenden Noten und seiner überzeugenden Arbeitsmoral war Mitchell schwer umworben worden. Bei den Vorstellungsgesprächen hatte er den Ton angegeben, und die Arbeitsangebote waren sowohl zahlreich als auch lukrativ gewesen. Doch heute, nur ein paar Wochen vor den Abschlussprüfungen und seiner Promotion, hatte das Blatt sich gewendet. Es gab kaum noch offene Stellen, und die Liste der Bewerber war lang.
Zu allem Übel hatte er im vergangenen Herbst ein Vorstellungsgespräch ausgeschlagen, das Carson & Partner, die Kanzlei, bei der er sich nun bewarb, ihm angeboten hatte. Er hoffte, dass sie sich nicht mehr an ihn erinnerten oder ihn zumindest nicht fragen würden, warum er damals kein Interesse gehabt hatte. Obwohl Brad Carson ein bekannter Name in der Gegend von Tidewater war, hatte sich Mitchell einfach nie vorstellen können, Personenschäden zu verhandeln. Bis heute.
An der Tür des Konferenzraumes hing ein Zeitplan für die Vorstellungsgespräche mit den Namen von zwölf Studenten, die sich auf die Stelle bewarben. Mitchell warf einen Blick auf die Liste und vergewisserte sich, dass er seinen Termin richtig im Kopf hatte. 14 Uhr. Der Bewerber vor ihm hatte bereits fünf Minuten überzogen. Mitchell hörte durch die Tür gedämpftes Gelächter und las, was etwas weiter unten auf der Liste geschrieben stand. »Bitte klopfen, wenn Sie an der Reihe sind.« Mitchell hasste so etwas.
Er klopfte selbstbewusst an die Tür und wischte sich die schweißnassen Hände an seiner Hose ab. Der erste Händedruck – trockene Handflächen, fester Griff – war entscheidend. Wieder ertönte Lachen aus dem Zimmer. Mitchell wartete ein paar Sekunden, wobei er sich wie ein völliger Idiot vorkam, und klopfte dann erneut. »Einen Moment bitte«, rief eine weibliche Stimme.
Mitchell warf noch einmal einen Blick auf den Plan. Brandon Jackson, ein gut aussehender Student im dritten Jahr, der gerne und viel lachte und erbärmliche Noten hatte, war für den Termin um 13.30 Uhr eingetragen. Brandon Jackson, dachte Mitchell ungläubig, klaut mir meine Zeit. Ich muss wirklich verzweifelt sein.
Die Tür wurde aufgeschlagen, und das Gelächter schallte in den Flur hinaus. Brandon war so damit beschäftigt, die Hand der Frau zu schütteln und über das ganze Gesicht zu grinsen, dass er auf seinem Weg nach draußen fast über Mitchell gestolpert wäre. Er grummelte etwas, das Mitchell als eine Entschuldigung auffasste.
»Nichts passiert«, murmelte Mitchell, während er einen Schritt zur Seite ging und der Frau die Hand reichte. »Mitchell Taylor.«
»Nikki Moreno«, erwiderte sie und schüttelte ihm lächelnd die Hand. Mit jemandem wie ihr hatte Mitchell ganz und gar nicht gerechnet. Eine exotische Schönheit, wie ein lateinamerikanisches Model, mit langem, dunklem Haar, einem umwerfenden, strahlendweißen Lächeln und dunklen, leuchtenden Augen. Sie trug einen engen schwarzen Minirock, der ihre langen Beine zur Geltung brachte, und ein Spaghetti-Oberteil, unter dem ein Bauchnabelpiercing hervorblitzte. Mitchell entging außerdem nicht das kleine Tattoo auf ihrer Schulter, auch wenn er nicht erkennen konnte, was es darstellen sollte.
»Setzen Sie sich, Mitch«, sagte Nikki und wies auf den Stuhl neben ihrem. Mitchell nahm Platz und schlug die Beine übereinander. Er hasste diesen Spitznamen und hatte die letzten drei Jahre damit zugebracht, ihn seinen Kommilitonen auszutreiben. »Mitchell« klang doch viel mehr nach seriösem Anwalt. Aber man begann schließlich kein Vorstellungsgespräch mit kleinlichen Korrekturen, was den eigenen Namen anging, also verkniff er sich den Kommentar.
»Kennen Sie Brandon?«, fragte Nikki, während sie einen Blick in Mitchells Bewerbungsunterlagen warf. Er musste sich beherrschen, nicht die ganze Zeit auf ihr Tattoo zu starren.
»Ja – nicht sonderlich gut, aber ich kenne ihn.« Mitchell hielt inne. Er brauchte diesen Job, wusste aber, dass auch Brandon ihn bitter nötig hatte. »Er ist ein netter Kerl. Ziemlich schlau.«
»Er bemüht sich zu sehr.« Nikki grinste. »Außerdem kann er nicht Ihre Noten vorweisen.« Sie sah auf. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle?«
Mitchell lehnte sich entspannt zurück. Nikkis Vorgehensweise gefiel ihm zusehends. »Nein, gar nicht. Schießen Sie los.«
In den folgenden Minuten machte Nikki ihm ihre Kanzlei schmackhaft, ohne auch nur eine Frage zu stellen. Brad Carson, sagte Nikki, sei ein erfolgreicher Klägeranwalt, der im ganzen Land bekannt war. Der »&-Partner«-Teil der Firma bestand eigentlich nur aus Nikki, der Rechtsanwaltsgehilfin, und Bella, seiner Pit-Bull-gleichen Sekretärin. Mittlerweile sei Brad bereit, einen oder zwei echte Kollegen anzustellen. Tatsächlich liefen die Bewerbungsgespräche schon seit dem letzten Herbst.
Nikki hielt einen Moment inne und warf Mitchell einen Blick zu. »Sie waren im Herbst nicht an einem Jobinterview interessiert, stimmt’s?«
Mitchell rutschte auf seinem Platz hin und her. Es machte keinen Sinn, um den heißen Brei zu reden. »Das stimmt, Ma’am.«
»Ma’am?«, wiederholte Nikki spöttisch, »so alt bin ich nun auch wieder nicht.«
»Verzeihung.«
»Machen Sie sich keinen Kopf, Mitch.« Bei der erneuten Erwähnung des verhassten Spitznamens fuhr er zusammen und hoffte, dass sie es bemerken würde … aber keine Chance. Sie schenkte ihm nur ein weiteres strahlendes Lächeln, das den Raum erhellte, und wurde dann ernst. »Darf ich fragen, warum Sie im letzten Herbst nicht an einem Vorstellungsgespräch interessiert waren? Und wie kommt es, dass ein heller Kopf wie Sie noch immer keinen Job gefunden hat?«
Wieder zögerte Mitchell, während er kurz darüber nachdachte, wie er einer direkten Antwort ausweichen könnte. Aber dann entschied er sich, ehrlich zu bleiben. »Ich war im Herbst einfach nicht daran interessiert, Schadensersatzfälle zu verhandeln«, erklärte er. »Also habe ich das Angebot einer großen Kanzlei angenommen, die sich hauptsächlich mit Zivilprozessen beschäftigt. Doch vor Kurzem hat eben diese Firma mit einem großen New Yorker Konzern fusioniert. Ich wusste, dass ich unter den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, die in einem solch großen Unternehmen herrschen, niemals das Innere eines Gerichtssaales zu Gesicht bekommen würde, und ich will unbedingt Fälle vor Gericht verhandeln …«
»Wenn Sie kein Interesse haben, Schadensansprüche zu vertreten, was dann?« Nikki schlug die Beine übereinander und rutschte ein wenig tiefer in ihren Sitz. Mitchell versuchte angestrengt, sich auf die Frage anstatt auf Nikki zu konzentrieren.
»Irgendwann einmal möchte ich es zur Staatsanwaltschaft schaffen und Straftäter verfolgen.«
»Haben Sie eine Ahnung, wie wenig Sie dabei verdienen werden?«
»Ja, ich weiß.« Mitchell zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Aber mir geht es nicht um das Geld.«
»Schön zu hören.« Nikki hielt einen Moment inne, während sie ihn von Kopf bis Fuß musterte, bis die Stille unangenehm wurde.
»Haben Sie noch Fragen zu meinem Werdegang?«, fragte Mitchell höflich.
»Nein«, antwortete sie und legte ihre Notizen und den Stift auf dem Tisch ab. »Mehr muss ich nicht wissen.«
Mitchell schaute sie ungläubig an. Es waren gerade einmal fünfzehn Minuten vergangen, für Brandon hatte sie sich mehr als doppelt so viel Zeit genommen! Was hatte er nur falsch gemacht? Er spürte, wie sich seine Verwirrung in Frustration wandelte, die fast schon an Wut grenzte. Das ganze Gespräch war ein reines Täuschungsmanöver gewesen. Nikki Moreno hatte längst entschieden, wem sie den Job geben wollte, und er war es offensichtlich nicht.
»Manchmal«, sagte Mitchell mit stoischer Miene, während er jedes Wort genau bedachte, »hat ein Mensch viel mehr zu bieten, als sein Lebenslauf preisgibt. Ich möchte nicht unhöflich sein … aber ich habe nicht das Gefühl, dass Sie genug über mich wissen, um sich eine Meinung darüber bilden zu können, ob ich einen fähigen Mitarbeiter abgeben würde. Wenn Sie gestatten, würde ich gerne noch ein paar Punkte ansprechen.« Mitchell hielt inne und wartete auf die Aufforderung fortzufahren. Doch Nikki saß nur mit einem dünnen, neckischen Lächeln auf den Lippen da, als wüsste sie etwas, das Mitchell nicht wusste.
»Wenn Sie meinen, schießen Sie ruhig los«, sagte Nikki schließlich, »aber ich weiß sehr viel mehr über Sie, als Sie ahnen.«
Mitchell zog erstaunt die Augenbrauen hoch. Jetzt bin ich aber gespannt.
»In Ihrem Lebenslauf steht, dass Sie im Südwesten von Virginia groß geworden sind«, sagte Nikki selbstsicher. »Etwa dreißig Kilometer von Roanoke entfernt. Sie sind wahrscheinlich ein begeisterter Countrymusik-Fan.«
Eine naheliegende Vermutung, dachte Mitchell.
»Sie tragen keinen Ring, also sind Sie nicht verheiratet. Und da Sie am VMI Football gespielt haben, das Gesicht eines Models und einen traumhaften Körper haben« – Nikkis Einschätzung, die sie hier so sachlich herunterratterte, brachte Mitchells Gesicht zum Glühen –, »hatten Sie während des Grundstudiums mit Sicherheit eine Freundin, die Sie aber verlassen hat, als Sie an die juristische Fakultät gewechselt sind.«
Mitchell konnte sein Erstaunen kaum verbergen. Erheitert lachte Nikki auf.
»Und wenn man Ihren Wunsch berücksichtigt, eines Tages für die Staatsanwaltschaft zu arbeiten, Ihre Kindheit im protestantisch geprägten Süden und die Tatsache, dass Sie an der evangelikalen Regent University studieren, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Sie einer dieser extrem gläubigen Christen sind, die mithilfe des Rechtssystems die Welt verbessern wollen.«
»Nicht schlecht«, erwiderte Mitchell. »Obwohl das ›extrem gläubig‹ vielleicht etwas weit hergeholt ist. Jetzt will ich aber etwas über mich hören, das nicht ganz so offensichtlich ist.«
Nikki runzelte konzentriert die Stirn, als würde sie versuchen, Mitchells Gedanken zu lesen. »Zum Beispiel, dass Sie einen schwarzen Ford F-150-Pick-up fahren und dank einer alten Footballverletzung Probleme im unteren Rücken haben …«
Mitchell fiel die Kinnlade herunter.
»… und dass Sie es hassen, ›Mitch‹ genannt zu werden.« Nikki legte den Kopf auf die Seite und grinste.
»Wie zum Henker …? Ich meine, woher wissen Sie das?«
»Wenn jemand solch gute Noten vorzuweisen hat, recherchiere ich seinen Hintergrund, sobald mir die Uni die Kopie seines Lebenslaufes aushändigt«, erklärte sie mit verschmitzt funkelnden Augen. »Und zwar schon lange bevor das Vorstellungsgespräch stattfindet. Brandon ist ein alter Freund. Und er weiß nur Gutes über Sie zu berichten.«
Mitchell konnte sein Grinsen nicht unterdrücken. »Jetzt weiß ich, wie sich diese armen FBI-Anwärter fühlen müssen.«
Nikki antwortete mit einem Lachen, wurde dann wieder ganz sachlich. »Es gibt nur eine einzige Frage, die ich Ihnen wirklich stellen muss«, erklärte sie. »Wenn wir Ihnen die Stelle anbieten – sind Sie bereit, sich langfristig an uns zu binden, oder werden Sie die Kanzlei nur als Sprungbrett nutzen, um Erfahrungen zu sammeln, bis Sie eine Chance bei der Staatsanwaltschaft bekommen?«
Mitchell senkte den Blick und betrachtete angestrengt den Boden. Nikki war schlau, sie sprach das grundlegende Problem direkt an. Auch wenn es ihn wahrscheinlich die Stelle kosten würde, sein Gewissen erlaubte es ihm nicht zu lügen. »Ich glaube nicht, dass ich mich langfristig binden will«, gab Mitchell offen zu. »Aber während meiner Zeit bei Ihrer Firma werde ich hart arbeiten und sicherstellen, dass es kein Fehler war, mich einzustellen.«
Nikki zögerte. »Das dachte ich mir bereits. Aber so sympathisch Sie mir auch sind, Brad würde mich umbringen, wenn ich ihm jemanden empfehle, den wir dann einstellen und ausbilden, nur um ihm dabei zuzusehen, wie er die Seiten wechselt.«
»Das verstehe ich«, sagte Mitchell. »Und ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich würde an Ihrer Stelle genauso denken.«
Sie saßen eine Weile schweigend da, dann wurde Nikki wieder munter. »Aber ich mag Ihre Art«, erklärte sie. »Und ich habe eine Idee. Ich habe früher für Billy The Rock Davenport gearbeitet und weiß zufällig, dass er noch Mitarbeiter sucht, auch wenn er von diesen klassischen Bewerbungsgesprächen nichts hält. Und offen gesagt, ich glaube, es ist ihm egal, wie lange Sie bleiben würden. Er braucht jetzt dringend Leute. Ich könnte ihn für Sie anrufen.«
Mitchell verzog das Gesicht. Bei dem Gedanken, für The Rock arbeiten zu müssen, wurde ihm übel. Der König der peinlichen Anwaltsreklamen, die Zielscheibe aller schlechten Anwaltswitze, die durch Tidewater, Virginia, kursierten. Wie konnte Mitchell das auch nur in Erwägung ziehen? Aber hatte er andererseits überhaupt eine Wahl?
»Danke«, hörte er sich selbst sagen.
»Keine Ursache«, erklärte Nikki großzügig. »Es gibt einen Grund, warum ich nicht mehr dort arbeite.« Ohne Mitchell die Gelegenheit zu geben, etwas zu erwidern, lehnte sie sich vor und wechselte schnell das Thema. »Und nun, da das Bewerbungsgespräch zu Ende ist, würde ich gerne von Ihnen hören, was Ihr Herz wirklich höher schlagen lässt, Mitchell.«
Zwanzig Minuten später, nachdem der nächste Bewerber bereits dreimal an die Tür geklopft hatte, verließ Mitchell lächelnd den Raum. Nikki war wirklich eine Marke. Auch wenn er immer noch keinerlei Aussicht auf einen Job bei Carson & Partner hatte, hatte Nikkis energiegeladenes Wesen seiner Stimmung Auftrieb verliehen. Er schob ihre Visitenkarte in die Innentasche seines Jacketts. Vielleicht würde er sie ja irgendwann einmal anrufen.
Doch er war nicht zu dem Bewerbungsgespräch erschienen, um eine Frau kennenzulernen – er brauchte einen Job. Und die warmen Gedanken an Nikki wichen schnell der trübseligen Aussicht, für The Rock arbeiten zu müssen.
»Wenn Ärger anrollt, wende dich an The Rock«, murmelte Mitchell auf seinem Weg den Gang hinunter. So lautete der Werbeslogan, mit dem jeder, der in Tidewater einen Fernseher besaß, vertraut war. Selbst die Telefonnummer war allgemein bekannt: 1-800-CASH-NOW.
Mitchell fühlte sich, als würde er durch Nebel laufen. War er wirklich so tief gesunken? Sollten all die schwer erarbeiteten Noten und Auszeichnungen nur dazu gedient haben, dass er nun für einen Mann arbeiten würde, der jedem Krankenwagen hinterherfuhr, in der Hoffnung, eine Schadensersatzklage vertreten zu können?
Sollte er diese Option nicht lieber direkt verwerfen und weiter geduldig sein, im Glauben an bessere Angebote? Als hätte ich nicht bereits dafür gebetet, dachte er bei sich, während er schnellen Schrittes zum Parkplatz ging.
Tatsächlich hatte er jeden Tag für ein attraktives Jobangebot gebetet. Ruhigen Gewissens hatte er der New Yorker Firma mitgeteilt, dass er die Stelle nicht antreten würde. Von diesem Tag an hatte er voller Inbrunst für einen Arbeitsplatz gebetet, an dem er etwas für das Gesetz und das Leben der Menschen bewirken konnte.
Aber hatte er Gott nicht auch darum gebeten, alle Türen bis auf die eine, die Mitchell nehmen sollte, zu schließen? Hatte er Gott nicht ersucht, ihm seinen Willen so deutlich wie nur möglich zu zeigen?
Das kann nicht sein, dachte er. Welche großen Taten sollte ich bei einer Kanzlei wie der von The Rock bewirken können?
Während er über diese Frage nachdachte, fing Mitchell an, mit offenen Augen zu beten. Lieber Gott, sprach er, dabei wurden seine Schritte immer schneller, das kann nicht dein Ernst sein …
[Zum Inhaltsverzeichnis]
3
Winsted Aaron Mackenzie IV dachte, er hätte schon alles gesehen. In seinen sechzehn Jahren als Anwalt in einer der größten Kanzleien von Norfolk war er mit Facetten des Lebens konfrontiert worden, die die meisten Menschen nur aus dem Fernsehen oder der Zeitung kannten. Er hatte die dunkle Natur des Menschen kennengelernt und sie sich zunutze gemacht: Eifersucht, Gier, Egoismus und Neid. Er hatte die großen Multimillionen-Dollar-Fälle kommen und gehen sehen. Die Tatsache, dass er einer höchst angesehenen Familie entstammte, die schon seit Generationen in Virginia ansässig war, wie auch seine kompromisslosen Verhandlungstaktiken verschafften ihm Ansehen und Wohlstand und machten ihn zur ersten Wahl vieler Konzernvorstände, die vor Gericht mit harten Bandagen kämpfen wollten.
Doch bis zu dem heutigen Tag war er niemals mit einem Aidskranken in Kontakt gekommen, geschweige denn, dass er einer solchen Person gestattet hätte, sein Büro zu betreten. Und das wäre auch jetzt nicht der Fall gewesen, wenn nicht einer seiner besten Klienten, Dr. Blaine Richards, Geschäftsführer von GenTech, Mackenzie angerufen und ihn darum gebeten hätte, sich des Falls persönlich anzunehmen. Im vergangenen Jahr hatte Mackenzie allein mehr als zweihunderttausend Dollar Honorar von GenTech bezogen. Eine Anfrage von ihnen abzulehnen, kam gar nicht infrage.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: