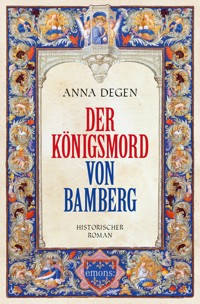
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historischer Roman
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder und exzellent recherchierter Roman, der ein Stück europäischer Geschichte lebendig werden lässt. Bamberg, 1208: Der römisch-deutsche König Philipp wird am Tag der Hochzeitsfeier seiner Nichte ermordet. Die zwölfjährige Sophie beobachtet die Tat und wird damit für mächtige Männer zur gefährlichen Zeugin. Zusammen mit ihrem Lehnsherrn, dem Bamberger Bischof, kann sie fliehen und begibt sich auf eine Reise, die sie bis nach Rom und Ungarn führt. Doch die Schatten ihrer Erlebnisse folgen Sophie und zwingen sie zu schwerwiegenden Entscheidungen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Degen ist das Pseudonym der Historikerin Karin Dengler-Schreiber. Sie promovierte über die mittelalterlichen Handschriften des Klosters Michelsberg und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte von Bamberg. Für ihre umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich der Denkmalpflege erhielt sie 2004 das Bundesverdienstkreuz und 2009 den Bayerischen Verdienstorden. Sie lebt mit ihrem Mann in Bamberg.
Leserinnen und Leser, die erfahren möchten, was im Roman erfunden ist und was gesicherte historische Erkenntnisse sind, können das auf der Homepage der Autorin (www.dengler-schreiber.de) in einem Leseerlebnis der besonderen Art erfahren.
Dieses Buch ist ein historischer Roman. Die geschilderten Geschichtsereignisse und Personen wurden, soweit möglich, gemäß dem Stand der wissenschaftlichen Forschung dargestellt. Im Anhang finden sich eine Zeittafel, ein Personenverzeichnis, ein Stammbaum der Andechs-Meranier und eine Karte.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: The Belles Heures of Jean de France, duc de Berry
Umschlaggestaltung: Leonardo Magrelli
Karte: Anna Hopfner
Lektorat: Uta Rupprecht
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-133-1
Historischer Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Für meine Enkelinnen und EnkelAnton, Daphne, Valeria und Lukas
Freude am Schreiben,Möglichkeit des Erhaltens,Rache der sterblichen Hand.
Wisława Szymborska,»Freude am Schreiben«
Sophies NotizenBamberg, im Juni 1248
Wir lachen viel gemeinsam, meine Enkelin Ela und ich, über ulkige oder unglaubliche Begebenheiten, die mir irgendwann einmal zugestoßen sind. Wir haben nämlich einen kleinen Tauschhandel ausgemacht: Sie massiert meinen schmerzenden Rücken, und ich erzähle ihr dafür eine Geschichte aus meinem Leben.
Ela erinnert mich so sehr an mich selbst, als ich in ihrem Alter war. Sie hat die gleichen dicken blonden Zöpfe wie ich damals, immer ein bisschen unordentlich. Sie ist mit ihren zwölf Jahren ein langes, schlaksiges Geschöpf, aufmerksam, klug und fröhlich. Und sie hat wunderbar heilsame Hände, die meine Schmerzen meist für viele Stunden lindern.
Natürlich liebe ich alle meine sechs Enkelinnen und Enkel, aber Ela ist mir doch am nächsten. Schon als ganz kleines Mädchen hatte sie diese großen, neugierigen Augen; stundenlang beobachtete sie, was um sie herum geschah. Sie war ein leicht zu liebendes Kind, das diese Liebe mit Anschmiegsamkeit und großer Zuneigung erwiderte.
Sie besucht mich jetzt oft, und jedes Mal wenn ich ihr eine Geschichte erzählt habe, bedrängt sie mich: »Schreib sie auf, Großmutter, schreib sie auf!« Jetzt hat sich unversehens die Gelegenheit ergeben, Elas Wunsch zu erfüllen. Denn heute früh kam ihr Vater, der Notar des Bischofs, und brachte mir einen beachtlichen Stapel Pergamentbögen vorbei. Ich bin ja überzeugt davon, dass mein geliebter kleiner Frechdachs Ela dahintersteckt, und frage mich, wie lange sie ihren Vater bearbeiten musste, bis er diesen wertvollen Schatz aus seinen Vorräten abgezweigt hat.
Was für ein wundervolles Geschenk! Ganz hell ist das Pergament, weich und fast ohne Löcher. Es gibt mir ein zärtliches Gefühl in den Fingerspitzen, wenn ich über die Seiten streiche. Ich liebe den Geruch von Pergament. Er ist schwer zu beschreiben, ein bisschen herb, fast bitter und dennoch ganz sanft, und wenn man es beschreibt, legt sich der unverwechselbare Geruch der Tinte darüber. Ach, und wenn dann die Buchstaben aus der Hand durch die Feder auf den Bogen fließen – was für eine Freude, aus Sprache und Gedanken ein Ding zu machen, das man anfassen und jemand anderem geben kann, der es wieder in Sprache und Gedanken verwandelt! Ist das nicht ein Wunder?
Vorhin, als Ela mich besuchte und wir in meinem kleinen Garten unterm Kirschbaum saßen, habe ich ihr von meinem Plan erzählt. Mir wurde die Kehle eng, als ich die Freude in ihren Augen aufleuchten sah. Sie sprang von der Bank und drehte sich einmal vor mir im Kreis. »Jetzt muss ich aber wirklich noch besser lesen lernen!«, rief sie. »Ach was«, antwortete ich, »du kannst doch schon ganz gut lesen. Schließlich hattest du die beste Lehrmeisterin der Welt – mich!« Ela kicherte. Dann umarmte sie mich. »Ich weiß, du hast es lustig gemeint. Aber du bist wirklich die beste Lehrerin der Welt für mich.«
Ach, solche Momente unvermuteten Glücks tun so gut in meinem Alter. Denn oft bin ich jetzt mutlos und traurig. Die Welt verändert sich so schnell und nicht zu ihrem Besseren. Mir kommt es vor, als ginge gerade eine Epoche zu Ende, eine Zeit voll strahlenden Lichts und tiefer Schatten, voller steiler Aufstiege und jäher Abstürze, voll glitzernder Pracht und unsagbaren Elends, voller Feste und Kämpfe und bewegender Lieder.
Für uns hier in Bamberg war das die Zeit des Hauses Meranien. Über sechzig Jahre lang wurden wir regiert von drei Bischöfen aus dieser Familie: Bischof Otto II., Bischof Ekbert und Bischof Boppo. Mein Herr war Bischof Ekbert, ein starker, schlauer Fürst, dessen Leben mit dem meinen auf seltsame Weise verwoben war. Vor wenigen Wochen ist nun sein Neffe Otto gestorben, der letzte Herzog aus dem Haus Meranien. Sein Tod macht mir Angst, denn nach dem Aussterben eines Fürstengeschlechts gibt es immer Streit und Krieg um das Erbe. Diese Ahnung hat die schützende Glasur des Alltags in mir aufgebrochen, und aus den Schrunden und Rissen stiegen alte Ängste auf, Ängste, die ich längst vergangen glaubte.
Wie oft habe ich mir gewünscht, ich hätte meinen Mund gehalten, damals, als der Mord geschah. Aber inzwischen bin ich froh, dass ich das nicht getan habe, denn sonst hätte ich Prag und Wien und Rom nicht gesehen, nicht die mächtige Donau, die blauen Alpen und die staubigen Steppen Ungarns, und ich könnte nicht davon berichten. So werden aus meinen Erinnerungen vielleicht auch noch die Erinnerungen meiner Enkel und Urenkel. Mir ist das eine tröstliche Vorstellung.
Ich freue mich aufs Schreiben, aber ich weiß nicht, wie lange es noch geht … Hin und wieder vergesse ich, was ich beim letzten Glockenschlag getan habe oder am gestrigen Tag. Doch an jenen Tag, mit dem ich beginnen will, an den erinnere ich mich ganz genau.
Vierzig Jahre ist das jetzt her, aber ich weiß … ja, ich glaube, ich weiß noch jede Einzelheit, die Gerüche, die Geräusche und die Farben, die hochgemuten Farben in der hellen Sonne. Zwölf Jahre war ich damals, ein seltsames Alter für uns Mädchen: Äußerlich sind wir noch Kinder, aber innerlich bricht etwas auf in uns, schon stehen wir auf der Schwelle zum Erwachsenwerden. Ich war ein privilegiertes Kind, mein Vater, der Kämmerer des Bischofs, und meine Mutter, die Verwalterin des bischöflichen Haushalts, waren geachtete Leute. Alle Bediensteten am Bamberger Bischofshof verwöhnten mich. Und weil ich ihnen zuhörte, erzählten sie mir vieles. Denn ich war neugierig, immer auf der Lauer nach neuen Geschichten. Auch wenn die Priester sagen, dass Neugier eine Sünde sei – ich finde Neugier etwas Wunderbares. Sie macht das Leben bunt. Ich wollte immer wissen, was um mich herum vorgeht, wie die Dinge und die Welt sich wandeln und wo die Rädchen sind, die diesen Wandel bewirken. Einen solchen Moment des Wandels habe ich erlebt, als mehrere kleinere und größere Schicksalsrädchen ineinandergriffen, damals im heißen Juni 1208.
SOPHIES KLEINE WELT
Bamberg, 20. Juni 1208
An diesem Freitag, dem Tag vor St. Alban des Jahres 1208, war Bischof Ekbert mit seiner gesamten Familie, mit den Herren des Domkapitels und einem prächtigen Gefolge zahlreicher Ritter am frühen Nachmittag den Berg hinaufgeritten, um König Philipp zu begrüßen. Dort oben, kurz vor dem Wildensorger Pass, hatte mein Vater ein großes Zelt aufstellen lassen, in dem Philipp und seine Gemahlin Irene-Maria ihre Reisekleidung gegen die feierlichen Staatsgewänder für den Einzug in die Stadt wechseln konnten.
Vater hatte den Platz sorgfältig gewählt, denn von dort aus hatte man den ersten Blick auf Bamberg, das sich am Fuß der Hügel unten im Flusstal ausbreitet. Vor gut hundert Jahren soll unser wunderbarer heiliger Bischof Otto an dieser Stelle vom Pferd gestiegen sein, um barfuß durch den Schnee bis zum Dom zu gehen. Diese Geschichte wurde uns Kindern immer wieder erzählt.
Vater hatte wirklich ein Gespür für Orte und Zeiten. Das war sicher einer der Gründe, warum Bischof Ekbert ihn zum Kämmerer machte, dem der gesamte bischöfliche Haushalt unterstand. Mit seinem Organisationstalent und seiner freundlichen Autorität hatte er sich allgemeine Anerkennung erworben. Das spürte ich von klein auf, wenn die Hofbediensteten mich auf den Arm nahmen oder mit mir spielten.
Den Ablauf des Festes hatte Vater seit Monaten geplant, denn die Hochzeit von Bischof Ekberts Bruder, Herzog Otto I. von Meranien, und König Philipps Nichte Beatrix, der Erbin von Burgund, war sowohl für den Bischof als auch den König selbst ein überaus bedeutsames und vor allem hochpolitisches Ereignis.
Vor acht Wochen war sogar der Reichstruchsess von König Philipp hier gewesen, und Vater war gemeinsam mit ihm sämtliche Stationen des feierlichen Einzugs abgegangen.
Und doch war trotz der guten Vorbereitung an diesem Tag einiges schiefgelaufen, wie man sich später erzählte. Das Pferd, das die Kinder dem König überbringen sollten, war, von einem besonders freudigen Trompetenstoß erschreckt, durchgegangen und durch die Menschenmenge geprescht. Es hatte einige Zeit gebraucht, das Tier wieder einzufangen und zurückzubringen. Den achtundvierzig Stiftsherren und Mönchen, die den König vor dem Burgtor begrüßen sollten, war die Warterei in der Hitze zu lang geworden, weshalb sie sich in die kühle Jakobskirche geflüchtet hatten. Vater musste sie erst wieder herbeiholen, damit sie sich neu aufstellten. Die Menschen, die schon seit Stunden in der heißen Sonne auf dem Domplatz und entlang der Straßen standen, um ihrem König zu huldigen, schwitzten, und die Blumen in ihren Händen ließen schon die Köpfe hängen.
Dennoch war die Stimmung gut. Ganz Bamberg hatte sich für den Empfang versammelt, denn es war schon sieben Jahre her, seit König Philipp das letzte Mal die Stadt mit seinem Besuch beehrt hatte, zum Fest der Heiligsprechung von Kaiserin Kunigunde. Die Feierlichkeiten hatten über eine Woche gedauert, und Vater hatte alle Mühe gehabt, für all die Gäste genügend Essen und Getränke herbeizuschaffen. Ich war damals erst fünf Jahre alt, aber ich kann mich noch genau an die Aufregung erinnern, die den ganzen Bischofshof in einen Ameisenhaufen verwandelt hatte.
Natürlich wollten jetzt alle den König, seine Gemahlin und ihre vier Töchter sehen, aber die Geduld der Menschen wurde auf eine harte Probe gestellt. Allmählich wurde es unten auf dem Domplatz unruhig, viele Leute suchten sich eine der spärlichen Schattenstellen, um sich hinzusetzen.
Ich dagegen war, wie schon oft, in mein Versteck geklettert, ein dämmriges Refugium hoch oben über dem Domplatz. Noch heute rieche ich den warmen Harzduft der Dachbalken und spüre in meinem Haar den leichten Luftzug, der dort immer zwischen den Mauern entlangstrich. Mein geheimes Reich lag in der Kuhle zwischen dem steilen Dach der Andreaskapelle und der weit überstehenden Traufe der Pfalz, und ich nannte es »meine kleine Welt«.
Zwischen dem achten Eck der Kapelle und der Pfalz gibt es nämlich einen dreieckigen Raum, der unten als Sakristei genutzt wird und im Obergeschoss als Lagerraum dient, für Putzsachen, Streusand und die Tischtafeln aus dem großen Saal. Dort sind in die Wand Metallkrampen eingelassen, damit die Dachdecker durch eine Luke aufs Dach steigen können. Sonst nutzt sie eigentlich keiner, und ich achtete stets sehr darauf, dass niemand mich sah, wenn ich hinaufkletterte. Auf diesem Weg entkam ich immer wieder für kurze Zeit meinen Pflichten, um zu träumen oder auch um zu beobachten, was unten auf dem Domplatz passierte. Dort lag ich dann unter dem schützenden Rand des Dachs auf dem zerrissenen Rest eines alten Teppichs, den Mutter hatte wegwerfen wollen, und konnte über das Tal der Regnitz hinweg bis hinüber zur Giechburg schauen.
In einer kleinen Holzkiste, die ich zwischen die Sparren geklemmt hatte, steckten all meine Schätze: ein paar Münzen, die mir Gäste des Bischofs beim Aufwarten zugesteckt hatten, eine winzige hölzerne Marienfigur, die Mutter von einer Pilgerreise mitgebracht hatte, mein schönstes, leuchtend blaues Haarband, das ich mir gern in den langen Zopf flocht, und, als Wertvollstes von allem, eine Wachstafel mit einem Griffel. Ich konnte mit meinen zwölf Jahren nämlich nicht nur lesen, sondern sogar schreiben, und darauf war ich unbändig stolz. Das können eigentlich nur adelige Mädchen; sogar die meisten Männer müssen, wenn sie einen Brief bekommen, ja immer noch ihren Kaplan herbeirufen, damit er ihnen das Schriftstück vorliest.
Aber ich hatte großes Glück gehabt. Meine Mutter war vor ihrer Hochzeit Zofe bei der Gräfin Nicole gewesen, einer Hofdame von Kaiserin Beatrix. Als Beatrix Kaiser Friedrich Barbarossa heiratete, war die Gräfin zu ihrer Begleitung aus Burgund mit nach Deutschland gekommen. Mutter bekam immer ganz leuchtende Augen, wenn sie von ihrer »Comtesse« erzählte, die sie fast wie eine Freundin behandelt und ihr Lesen und Schreiben beigebracht hatte.
In ihrer Gegenwart war es Pflicht gewesen, sich »höfisch« zu benehmen, so wie das in Frankreich der Brauch war – Sauberkeit, feine Tischsitten und maßvolles Verhalten waren Voraussetzung, um in den engeren Kreis der Gräfin aufgenommen zu werden; dort hatte keiner abgenagte Knochen auf den Tisch gespuckt oder sich ins Tischtuch geschnäuzt.
Einen Abglanz dieser guten Sitten hatte Mutter, die die Küche und die gesamte Dienerschaft unter ihrer Fuchtel hatte, auch auf den Bamberger Bischofshof übertragen. Und natürlich brachte sie auch ihrer Tochter »feines Benehmen« bei. In diesem Punkt machte ich ihr die Erziehung allerdings leicht: Ich sog jede ihrer Geschichten über die »Comtesse« in mich auf und wollte sie wieder und wieder hören, übte Schreiben wie eine Besessene und las alles, was ich in die Finger bekam. Es war wenig genug. Ach, was war das für eine Freude, als ich einmal eines der Ritterbücher, die Bischof Ekbert so gern las, beim Saubermachen in seinem Zimmer fand und für ein paar Stunden in mein Reich mitnehmen konnte. Die Aufregung war riesig, als man den Verlust entdeckte, und nur mit Mühe gelang es mir, das Buch heimlich ins Zimmer zurückzubringen und es dann wie zufällig hinter einer Truhe »wiederzufinden«.
Ich glaube, das war die glücklichste Zeit meines Lebens. Meine größte Sorge war, dass ich hoffentlich nicht so bald meine Rosen bekam, damit sie sich mit Heiratsplänen für mich noch Zeit ließen. Damals interessierten Männer mich überhaupt noch nicht, außer Bischof Ekbert natürlich. Für den schwärmte ich seit meinem achten Lebensjahr, als er mich einmal vorn auf sein Pferd genommen hatte und mit mir über den Burghof geritten war. Seine schönen schmalen Hände waren zwar hart und schwielig vom Reiten und Kämpfen, hatten mir aber erstaunlich sanft übers Haar gestrichen. Seitdem war er mein Abgott.
Er sah ja auch wirklich sehr gut aus, groß und schlank – ja, damals war er noch schlank –, mit strahlend blauen Augen unter hochgeschwungenen Augenbrauen. Vor allem aber sein Lächeln – da wurden allen Mädchen die Knie weich. Als dritter Sohn hatte er Geistlicher werden müssen, aber eigentlich war er seiner Natur nach ein Kriegsmann, ein Ritter, wie er im Buche steht. Und mächtig stolz auf den Aufstieg seiner Familie.
Dazu hatte er ja auch gerade zu der Zeit, von der ich erzähle, allen Grund: Am nächsten Tag würde sein Bruder Otto, der Herzog von Meranien, die Nichte des Königs heiraten. Damit wurde Ekbert ein enger Verwandter des deutschen Königs, er, der schon der Schwager des französischen und des ungarischen Königs war. Seine Familie gehörte so zu den höchsten Adelsfamilien Europas. Darauf konnte man schon stolz sein.
Aber Stolz ist eine gefährliche Sache, denn der Schritt zum Hochmut ist klein. Und Hochmut kommt vor dem Fall, wie das Sprichwort sagt. Manchmal taucht ganz plötzlich vor dem hellen Hintergrund das große Rad der Fortuna auf, das die Menschen auf der einen Seite emporhebt und sie auf der anderen hinabschleudert. Ich frage mich immer wieder, wer an diesem Rad wohl dreht.
Sophies NotizenBamberg, im Juli 1248
Vorhin ist Ela vorbeigekommen und hat mir ein Körbchen voll Himbeeren und außerdem – oh, welche Freude! – die Bedenken ihrer Familie mitgebracht. Alle würden sich aufregen über meinen Entschluss, meine Erinnerungen aufzuschreiben. Vor allem ihre Mutter, meine Tochter Barbara, mache sich ›solche Sorgen‹, ich sei doch nicht gesund und die Anstrengung würde mir sicher schaden. »Morgen will Mutter dich besuchen, sobald sie die große Wäsche hinter sich hat. Sie wird versuchen, dir das Schreiben auszureden.« Ela fasste meine Hand. »Lass das nicht zu, Großmutter, bitte. Ich bin schon so gespannt, wie es weitergeht!«
Barbara hat zum Teil ja recht, das Schreiben ist wirklich nicht immer ein Genuss; meist tun mir nach einiger Zeit die Finger und das Kreuz weh. Aber es drängt mich ja nichts, ich kann meine Arbeit jederzeit unterbrechen.
Ach ja, Barbara war schon als kleines Mädchen ein »Sorgenkind«. Nicht weil sie mir Sorgen gemacht hätte – sie war brav und pflichtbewusst –, sondern weil sie sich ständig Sorgen um alle in ihrer Umgebung macht. Sie versteht einfach nicht, dass mich die Ruhe, die sie mir anempfiehlt, tödlich langweilt. Welch ein Lebenselixier ist dagegen Elas Freude an meinen Erzählungen. Oft schnappt sie sich die Seiten, die ich schon geschrieben habe, und verzieht sich damit zum Lesen in eine Ecke. Wenn wir dann darüber reden, fällt mir vieles ein, was ich längst vergessen glaubte. Und wenn ich dann weiterschreibe, sehe ich ihre wachen Augen vor mir, und die Feder bewegt sich wie von selbst.
DER EINZUG DES KÖNIGS
Endlich kamen sie.
Vorneweg gingen die Trompeter und Trommler, die vor Begeisterung einen solchen Lärm machten, dass der Domkantor Mühe hatte, sie in Schach zu halten. Hinter ihnen schritten die Bannerträger, und dem rot-weißen Reichsbanner und dem schwarz-goldenen Adler des Königs folgten die Paniere der nach Bamberg angereisten Reichsfürsten. Die einzelnen Gruppen überboten sich im geschickten Schwenken und Herumwerfen der Fahnen, bis die bunten Farben vor meinen Augen zu wirbelnden Mustern verschmolzen.
Ein Raunen ging durch die Menge, als schließlich die Meranierbrüder auftauchten, alle vier groß und schön und sehr aufrecht auf großen schönen Rappen, Ekbert als Hausherr eine Pferdekopflänge vor den anderen. Rechts neben dem Bischof ritt sein ältester Bruder Otto, der Herzog, links befanden sich Hezilo und Berthold. Alle hatten sie diese weichen hellbraunen Haare, aber bei Otto hingen sie kerzengerade herab, während Berthold, der jüngste Bruder, sie zur Feier des Tages kunstvoll zu kleinen Löckchen gekräuselt trug. Ekbert und Hezilo hingegen fielen die Locken in natürlichen Wellen bis auf die Schultern. Die beiden, die nur ein Jahr trennte, glichen einander sehr, abgesehen davon, dass Ekbert natürlich in seinen silberdurchwirkten Bischofsornat gekleidet war, mit der edelsteinbesetzten Mitra auf dem Kopf und dem funkelnden Bischofsstab in der Hand, am Steigbügel aufgesetzt wie eine Lanze.
Die drei anderen trugen trotz der Hitze über ihren knielangen Surcots blaue, mit Silber bestickte Seidenmäntel, deren Tasselschnur sie mit der rechten Hand nach vorn zogen, während sie mit der linken lässig ihre Pferde lenkten, ganz stolze Ritter, höfisch und elegant. Ihre Knappen trugen die Schilde hinter ihnen her, die auf blauem Untergrund den silbernen Adler der Meranier zeigten, und auch die jungen Adeligen steckten alle in neuen blau-silbernen Gewändern.
Was war ich damals stolz auf meinen Herrn und seine Familie, die Meranier, wie sie seit der Verleihung der Herzogswürde meist genannt wurden! Ich lag da oben auf dem Dach und glühte, und das nicht nur wegen der Hitze.
Als die Brüder auf den Platz ritten, grüßten sie zur Pfalz herüber. Einen Moment lang dachte ich, sie hätten mich gesehen, und rutschte verlegen noch etwas tiefer in den Schatten des Daches. Aber natürlich meinten sie ihre Schwestern, die an den Fenstern des großen Saales standen, den Bischof Ekbert hatte bauen lassen.
Die prächtigen Arkaden mit den reich geschmückten Säulchen umrahmten die Damen wie auf einem Gemälde: Gertrud, die Königin von Ungarn, herrisch und hochmütig, mit dem Kronenreif auf dem Kopf und in engen modischen Kleidern, neben ihr die Herzogin Hedwig von Schlesien, die in ihrem faltenreichen Übergewand und dem dichten Schleier fast körperlos wirkte. Sie glich viel mehr einer Nonne als ihre Schwester Mechthild, die sich tatsächlich im Kloster St. Theodor auf ihre Zeit als Äbtissin vorbereitete. Am meisten mochte ich ihre Schwägerin Sophie, Hezilos junge Frau, und nicht nur, weil sie so hieß wie ich, sondern weil sie so freundlich war. Jetzt lächelte sie, über das ganze Gesicht strahlend, ihrem Mann zu. Die Herren neigten das Haupt, und der versammelte Damenflor des Hofes grüßte gemessen zurück, wie es sich gehörte.
Plötzlich wurde es ganz still auf dem Domplatz, und die Menschen sanken auf die Knie, denn jetzt erschienen unter einem funkelnden, goldbestickten Baldachin der König und die Königin. Sie wurden zu dem Podest geleitet, das vor der Pfalz errichtet worden war, damit die Gäste bequem absteigen und außerdem von der Menge gesehen werden konnten.
Philipp glitt mit einer einzigen geschmeidigen Bewegung vom Pferd und half dann seiner Gemahlin aus dem Sattel. Irene-Maria war deutlich sichtbar schwanger, aber sie war noch immer so zart und zierlich, dass es aussah, als trüge sie einen kleinen Ball unter ihrem Gewand. Ach, was für ein wunderbares Gewand sie anhatte, aus weich fließender dunkelblauer Seide, bestickt mit Sternen und allerlei Getier, und darüber, unter der Krone, einen weißen Schleier, der so durchsichtig und duftig war, dass man meinte, ein feiner Nebel habe sich über ihr schweres schwarzes Haar gelegt. Solch ein Spinnengewebe hatte ich noch nie gesehen – sie musste es aus ihrer Heimat Byzanz mitgebracht haben –, und ich beneidete sie sehr darum. Ich hätte es gern angefasst.
Hätte ich damals schon gewusst, unter welch traurigen Umständen ich diesen Schleier einst in den Händen halten würde, hätte ich mir diesen Wunsch nicht einmal in Gedanken erlaubt.
Der König und die Königin standen in der Mitte des blumengeschmückten Podestes, zeigten sich freundlich grüßend dem Volk und warteten, bis auch die Reichsfürsten herankamen. König Philipp rief den Leuten etwas zu, was aber im Geläut der Glocken und in den Hochrufen der Menge unterging. Eine leichte Brise kam auf und wehte dem König Irene-Marias Schleier ins Gesicht; der lachte und drapierte ihn mit einer zärtlichen Geste wieder um die schmalen Schultern seiner Frau.
Herzog Ludwig von Bayern, der inzwischen auf das Podest getreten war, neigte ehrerbietig das Knie, bevor er hinter den König trat. Ludwig war ein schöner Mann mit langen, lockigen blonden Haaren, groß und stolz und unbändig ehrgeizig, wie ich aus Gesprächen meiner Eltern wusste. »Der weiß, wo der Barthel den Most holt«, sagte mein Vater immer, wenn die Rede auf Herzog Ludwig kam. Lange hatte ich mich gefragt, warum der Herzog wissen wollte, wo jemand Most holt, bis ich begriff, dass Vater meinte, Ludwig sei schlau und wisse immer, was gut für ihn sei.
Überaus vorteilhaft für das Ansehen eines Fürsten war es jedenfalls, wenn er zum Träger des Reichsschwerts ernannt wurde. Und das hatte Ludwig tatsächlich durchsetzen können.
Wochenlang hatten sie darüber debattiert, wem diese Ehre zuteilwerden sollte, und es hatte den Herzog einiges gekostet, bis die Entscheidung auf ihn gefallen war. Nur deshalb war er auch im Zug vor allen Erzbischöfen, Bischöfen und Fürsten unmittelbar hinter dem König geritten. Nur deshalb durfte er als Erster der Fürsten auf dem Podest neben dem Königspaar stehen und sich der Menge präsentieren. Als Truchsess Heinrich von Waldburg, der im Hintergrund gewartet hatte, ihm das Reichsschwert übergab, huschte ein triumphierendes Lächeln über Herzog Ludwigs Gesicht.
Eine Gruppe nach der anderen ritt heran; die Fürsten erklommen das Podest, ihr Gefolge stellte sich auf dem Domplatz auf. Alle waren prächtiger Stimmung. Sie lachten, rissen Witze und waren vergnügt. Dann zogen sie in feierlicher Prozession über die schönen Teppiche, die Bischof Ekberts Vater vom letzten Kreuzzug mitgebracht hatte, in den Dom zur Begrüßungsmesse, und ihnen folgten Hunderte von Rittern und Bürgern, so viele, dass ich den Eindruck hatte, der Dom müsste auseinanderbrechen. Von oben erinnerte das farbenfrohe Gewimmel, das Leuchten von Rot und Blau und Grün, von Gold und Silber und blitzenden Edelsteinen, an das große Mosaik im Boden des Doms, wenn es frisch gewischt war und die Feuchtigkeit die Farben zum Leuchten brachte.
Plötzlich bemerkte ich, dass die Schatten vor dem Palas langsam länger wurden, und mir fiel siedend heiß ein, dass Mutter mir aufgetragen hatte, im Gemach des Königs noch ein letztes Mal Staub zu wischen. Dazu war jetzt keine Zeit mehr. Ich beeilte mich, vom Dach herunterzukommen, denn Mutter würde sicher noch jede Menge andere Aufträge für mich haben.
Gerade als ich aus dem Vorraum vor dem Gemach des Königs kam, lief ich Richard in die Arme.
»Ach, Sophie«, sagte er hölzern, »wo warst du denn die ganze Zeit?«
»Das geht dich einen feuchten Kehricht an«, zischte ich und versuchte, an ihm vorbeizukommen.
Aber er streckte die Hand aus, um mich aufzuhalten. »Das geht mich schon etwas an!« Er schluckte. »Deine Mutter hat mich nämlich geschickt, dich zu suchen. Beeil dich lieber. Sie sagt, sie wird dir die Hölle heißmachen, weil du so lang weg warst.«
Zu meinem Ärger spürte ich, dass ich rot wurde. »Ich habe im Zimmer des Königs Staub gewischt«, murmelte ich verlegen und dachte noch im selben Augenblick, dass das eine Lüge mit teuflisch kurzen Beinen war.
Wegen des Staubs machte ich mir keine Gedanken; ich hatte erst gestern sauber gemacht, und ein Staubkörnchen hie und da würde den König schon nicht umbringen. Aber wenn jetzt jemand in den Räumen war, würde leicht herauskommen, dass ich sie überhaupt nicht betreten hatte. Ich erinnere mich, wie wütend ich damals war, weil Richard immer dort aufzutauchen schien, wo man ihn nicht brauchen konnte, und sich aufführte, als hätte er was zu sagen.
Richard war der Sohn des bischöflichen Marschalls, und zwischen seiner und meiner Familie, vor allem zwischen unseren Vätern, herrschte eine tief sitzende Abneigung. Es wunderte mich etwas, dass Mutter ausgerechnet ihn nach mir ausgeschickt hatte, aber sie hatte ein großes Herz und sagte immer, der Junge könne ja nichts für seinen Vater. Aber es musste schon ziemlich dringend sein, dass sie überhaupt jemanden beauftragt hatte, mich zu suchen.
Richard sah mich noch immer an. Seine Augen waren schmaler geworden, und ich fühlte mich zunehmend unsicher. »Du hast Staub an der Nase«, sagte er und hob die Hand, als wollte er ihn abwischen.
»Ach ja? Das kommt von der Arbeit«, rief ich, huschte unter seinem Arm durch und rannte davon.
Sophies NotizenBamberg, im August 1248
Das Leben ist doch sehr unstet. Immer wenn man sich besonders freut, kommt es anders, als man denkt. Ela wird mich ein paar Wochen lang nicht besuchen können. Meine Tochter Katharina, die mit dem Truchsess des Herrn von Frensdorf verheiratet ist, erwartet wieder ein Kind. Und da sie nicht mehr die Jüngste ist, ist Barbara ihrer Schwester zu Hilfe geeilt, um dafür zu sorgen, dass sie und das Neugeborene am Leben bleiben, und sie hat Ela mitgenommen. Barbara ist immer noch etwas beleidigt, weil sie mich nicht davon überzeugen konnte, mit dem Schreiben aufzuhören. Und weil ich nicht auf ihr Angebot eingegangen bin, zu ihr nach oben in die Burg zu ziehen, in die ehemalige Wohnung meiner Eltern, damit sie sich um mich kümmern kann.
Ich will nicht, dass sich jemand um mich kümmert. Ich befinde mich durchaus wohl hier in meinem Haus im Bachtal, das ich von Großmutter Eva geerbt habe. Meine Magd Euphemia versorgt mich mit allem, was ich brauche, und ich bin gern allein. Nur Ela vermisse ich gerade, ihre Wissbegier und ihre sanften Hände.
Dafür kann ich ein bisschen innehalten und über die Frage nachdenken, die Ela mir letzthin gestellt hat. Sie wollte wissen, wie wir damals eigentlich in den Schlamassel mit den zwei Königen, die sich bekämpften, und all das Hin und Her gerieten. Sie hat so gelacht! »Schlamassel« ist ja wirklich ein ulkiges Wort, unsere jüdischen Nachbarn haben es früher immer gesagt, wenn einer richtig in der … na ja … saß.
EIN FÜRSTLICHES FESTMAHL
Bamberg, 20. Juni 1208
Ich … ich weiß gar nicht so recht, wo ich beginnen soll, um zu erklären, wie es zu diesem verhängnisvollen Hader kam. Vielleicht mit Kaiser Friedrich Barbarossa? Den hat nämlich mein Großvater noch gut gekannt, weil er mit ihm auf dem Kreuzzug war, als Truppenführer von Herzog Berthold, dem Vater von Bischof Ekbert. Großvater hat Berthold immer nur den »alten Herzog« genannt, da er als erster Andechser Graf das Herzogtum Meranien erhielt. Der alte Herzog war ein feiner Herr und hat seine Leute sehr großzügig belohnt, sodass wir uns dieses Haus hier leisten konnten.
Großvater hat Kaiser Friedrich Barbarossa, der aus der Familie der Staufer stammte, sehr bewundert. Aber es gab im Reich noch eine zweite Familie, die ähnlich mächtig und reich war, die Welfen. Und zwischen den Staufern und den Welfen gab es immer wieder Streit um die Königswürde.
Friedrich Barbarossa also hat sich mit seinem welfischen Vetter Heinrich, den sie den Löwen nannten, zunächst gut verstanden und ihm zum Herzogtum Sachsen auch noch Bayern dazugegeben. Jahrzehntelang haben die beiden fast alles gemeinsam gemacht. Das war eine gute Zeit, davon hat Großvater Bertram immer erzählt wie vom Paradies. Die Straßen waren sicher, man konnte gut Handel treiben und Häuser bauen, und als Kriegsmann kam man oft nach Italien mit seinen vielen Annehmlichkeiten und konnte wunderbare exotische Dinge mit nach Hause bringen, falls man nicht vorher am Sumpffieber oder am Bauchfluss starb. Den kleinen Reliquienschrein in meiner Gebetsnische, ein paar der Teppiche und den Kirschbaum im Garten hat er seiner geliebten Frau, meiner Großmutter Maria, damals von dort mitgebracht.
Aber dann haben sich Barbarossa und Heinrich der Löwe leider gestritten, ich weiß nicht mehr, weshalb. Jedenfalls hat der Löwe vor einer wichtigen Schlacht seine Truppen aus Barbarossas Lager abgezogen, obwohl der Kaiser ihn angeblich sogar auf Knien um Hilfe gebeten haben soll. Das hat ihm Barbarossa nie verziehen und ihm einige Zeit später die Herzogtümer Sachsen und Bayern weggenommen.
Heinrich der Löwe und seine Familie mussten ins Exil gehen und lebten viele Jahre lang beim Vater von Heinrichs Frau Mathilde, dem König von England.
Heinrichs Sohn Otto wurde in dieser Zeit der Liebling seines Onkels Richard Löwenherz, der ihn wie den Sohn behandelte, den er nie hatte. Er ließ ihn zu einem vollendeten Ritter ausbilden, schanzte ihm die reichsten Besitzungen zu und wollte aus ihm unbedingt einen König machen. Gerüchten zufolge soll zwischen den beiden viel mehr gewesen sein als nur die Liebe zwischen Onkel und Neffe, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Und dann geschah dieses große Unglück, dass Kaiser Friedrich Barbarossa auf dem Kreuzzug ertrank. Und als Barbarossas Sohn Heinrich acht Jahre später ebenfalls starb, da wählte zwar ein großer Teil der deutschen Fürsten den Staufer Philipp, den jüngsten Sohn Barbarossas, zum König, aber die anderen Großen stimmten, angestachelt vom Kölner Erzbischof Adolf und bestochen von Richard Löwenherz, für dessen Liebling Otto, den Welfen. Und zwischen den beiden Königen brach ein Krieg aus, der zehn Jahre dauerte und viele Menschen das Leben kostete.
Ich selbst habe diesen Welfenkönig ja nie leiden können, obwohl ich ihm, das muss ich zugeben, nie persönlich begegnet bin. Aber was ich von unseren Gästen so über ihn gehört habe, ach! Er muss ein arroganter Mensch gewesen sein, hochmütig und stur und wohl auch etwas dumm.
Nun ja, damals auf dem großen Fest in Bamberg waren wir so hochgestimmt und fröhlich, weil es endlich, endlich so aussah, als wäre der elende Krieg zwischen Philipp und Otto zu Ende und als hätte Philipp endgültig gesiegt. Der Papst, dessen Günstling Otto so lange gewesen war, hatte Philipp in Gnaden wieder aufgenommen, die meisten Fürsten standen auf seiner Seite und waren nun mit ihren Truppen nach Bamberg gekommen, um mit ihm dieses Hochzeitsfest zu feiern. Danach wollten sie gemeinsam nach Braunschweig ziehen, wo Otto sich verschanzt hatte, und ihm endgültig den Garaus machen.
Darauf freuten sie sich, diese Herren, wie rauflustige Buben, als hätten sie in den vergangenen zehn Jahren nicht genug Krieg gehabt. Aber sie waren vor allem auf Beute aus. Dabei hatten sie doch jeden der beiden Könige schon so viel gekostet, so viel Geld und Rechte und Besitzungen, die sie ihnen geben mussten, um sie jeweils auf ihre Seite zu ziehen. Gierige Bande! Obwohl – vielleicht sehnten sich zumindest einige von ihnen wirklich nach Frieden und danach, dass das Reich wieder einen einzigen starken Herrscher bekam. Wie viel Leid wäre uns erspart geblieben, wenn dies gelungen wäre.
Die Erinnerung an das Fest am Vorabend der Hochzeit ist eine meiner liebsten. Unser Saal sah wunderbar aus. Zwei Stunden hatten Mutter, ich und fünf Mägde gebraucht, um ihn so prächtig herzurichten. An der Stirnseite stand auf einem Podest der Tisch für das Königspaar und die Ehrengäste und im rechten Winkel dazu die langen Tafeln mit Bänken auf beiden Seiten, wo die anderen hochrangigen Gäste sitzen würden, während für deren Begleiter im Hof gedeckt worden war. Ein Glück, dass das Wetter so schön war, wir hätten sonst überall Zelte aufstellen lassen müssen. Das hätte eine Menge Mühe bedeutet, und wir waren trotz der zusätzlichen Mägde und Diener, die mein Vater eingestellt und angelernt hatte, sowieso mehr als ausgelastet.
Wir hatten über alle Tafeln lange weiße Tücher gebreitet, die fast bis auf den Boden hingen. Jedem Gast waren ein frisch gebackenes flaches Brot aus gutem Mehl und ein Messer zugeteilt. Am Ehrentisch bekam jeder seinen eigenen silbernen Becher. Die Pokale für den König und die Königin waren sogar aus Gold und funkelten von Edelsteinen. Als Knauf für den Pokal von Irene-Maria diente ein riesiger Amethyst, den der »alte Herzog« vom Kreuzzug mitgebracht hatte. Meine zweite Großmutter Eva, Mutters Mutter, sagte immer, das sei der einzige Grund, warum die adeligen Räuber ins Heilige Land zögen: um Abenteuer zu erleben und Beute zu machen. Von wegen Religion!
Auf den anderen Tischen standen Zinnbecher. Bischof Ekbert hatte eigens noch fünfzig Stück in Auftrag gegeben, als sich herausstellte, dass so viele Leute zu dieser Hochzeit kommen würden. Der Boden des Saals war schon vor Tagen mehrfach gescheuert und gewischt worden, und zu Ehren Irene-Marias, der »Rose ohne Dornen«, hatten wir ihn nicht mit Sand, sondern mit getrockneten Rosenblättern bestreut, die zart dufteten und leise raschelten, wenn man darüberging. Aus demselben Grund hatten wir auch den Ehrentisch mit Rosenknospen bestreut, und über dem Platz des Königspaares hing ein Kranz aus roten Rosenblüten. Auf den anderen Tischen lagen Sträußchen blauer Kornblumen, die mit Silberfäden zusammengebunden waren – die Farben der Meranier. Das war meine Idee gewesen, und ich war sehr gelobt worden dafür.
An den beiden Stirnseiten des Saals hingen Bildteppiche mit Szenen aus dem Leben von König David. Die hatte Ekberts Bruder, Herzog Otto, leihweise von der Plassenburg mitgebracht, denn die Teppiche, die der Bischof in Auftrag gegeben hatte, waren leider nicht rechtzeitig fertig geworden. Vater und Bischof Ekbert hatten lange diskutiert, wie man sie aufhängen sollte. Jetzt war hinter dem Ehrentisch das Hochzeitsmahl Davids und Michals zu sehen und daneben David, der mit einem innigen Kuss von seiner jungen Frau Abschied nimmt, während die Teppiche gegenüber, auf die der König schauen würde, eine Schlachtenszene mit Rittern in heftigem Kampf und den König als Richter auf dem Thron darstellten. Ich liebte diese Bilder und war immer mal wieder in den Saal geschlichen, um sie mir anzusehen.
Die Kerzen waren wegen der Hitze noch nicht entzündet, aber durch die Fenster im Westen floss das warme Abendlicht und löste alle dunklen Schattenlinien auf. Ich stand in meinem besten blauen Kleid, das zu meinem blauen Haarband passte, neben Mutter und den Dienerinnen, und ich erinnere mich genau, dass ich, während wir auf die Gäste warteten, gedacht habe, ich sei noch nie in meinem Leben so glücklich gewesen.
Nachdem sich die Musiker in ihrer Ecke eingerichtet hatten, ließen sie ein Trompetensignal hören, und die Tür an der Nordseite des Saales öffnete sich. Nach Vaters Anweisung führten Diener die Gäste an die für sie reservierten Plätze. Die Platzordnung war das Ergebnis tagelanger Überlegungen, Diskussionen und mehrfacher Neugruppierungen, damit niemand in seiner Ehre verletzt würde. Es galt zu vermeiden, dass zwei nebeneinandersaßen, die sich nicht leiden konnten und vielleicht einen Streit oder eine Rauferei anfangen könnten. Beides war oft genug vorgekommen und hatte schon so manches Festmahl verdorben.
Am schwierigsten war die Sitzordnung am Ehrentisch gewesen. An dieser Stelle hatte sich sogar der Reichstruchsess in die Planungen von Vater und Bischof Ekbert eingeschaltet. Natürlich mussten in der Mitte der Tafel König Philipp und seine Gemahlin sitzen, aber dann hatten wir noch zwei weitere Königinnen und einen König, zwei Erzbischöfe, vier Herzöge und vier Herzoginnen, die Braut Beatrix und die Geschwister von Ekbert. Das waren zwanzig Personen, und es war von vornherein klar, dass jeder von ihnen am Ehrentisch und dort möglichst in der Nähe des Königs platziert werden wollte. An diesem Tisch, der ja nur auf einer Seite besetzt werden konnte, hatten aber höchstens sechzehn Stühle Platz.
Trotz aller Überlegungen, trotz der vielen Versuche, die Ekbert und Vater mit Schachfiguren gemacht hatten, die sie mal hierhin, mal dorthin setzten, ging es am Schluss doch nicht ohne Ärger ab. Am ärgsten verstimmt war vor allem Herzog Ludwig von Bayern, der mit seiner Gemahlin am linken Ende des Tisches sitzen musste. Ludwig war der Meinung, dass ihm, dem Herzog aus dem vornehmen Haus Wittelsbach, der Platz neben der Königin gebührt hätte. Den aber hatte sich Ekbert als Hausherr und Gastgeber selbst vorbehalten, und das hat Ludwig Ekbert nie verziehen. Zwischen den Andechser Grafen und den Wittelsbachern herrschte sowieso seit vielen Jahrzehnten ein zäher Kampf um Ansehen und Macht, erst recht, seit Kaiser Friedrich Barbarossa 1180 zuerst Ludwigs Vater das Herzogtum Bayern und dann Ekberts Vater das Herzogtum Meranien verliehen hatte. Überdies konnten sich Ekbert und Ludwig schon als Kinder nicht leiden. Das hatte Vater mir erzählt und stirnrunzelnd hinzugefügt: »Immer wenn die zwei aufeinandertreffen, wirken sie wie zwei knurrende Hunde, die darauf lauern, den anderen zu beißen.«
Zunächst aber übertünchte die Festtagsstimmung alle Verwerfungen. Die Ehrengäste betraten den Saal durch die Tür, die dem Gemach des Königs gegenüberlag. Alle waren noch kostbarer gekleidet als beim Festzug am Nachmittag, wo sie in der Hitze in ihren teuren, schweren Tuchen und unter ihren Mänteln ziemlich geschwitzt und sich nach Erleichterung gesehnt hatten. Damit alle, die wollten, baden konnten, hatte Vater eigens dreißig neue Badezuber bestellt und in der großen Halle neben den Ställen aufstellen lassen. Nur dem König und der Königin waren Wannen in ihre Räume gebracht worden, während die Damen die Badestube des Palas benutzen durften. Dank des heißen Wetters musste das Badewasser glücklicherweise kaum erwärmt werden; ich weiß nicht, wie die Bademägde sonst mit der Arbeit nachgekommen wären.
Jetzt sahen alle Ehrengäste sehr erfrischt aus und zeigten sich in herrlichen Gewändern aus orientalischer Seide und Brokat, aus Purpur und Damast. Am schönsten waren die Stoffe, die Philipp und Irene-Maria trugen. Großvater Bertram hatte uns erzählt, dass sich in dem sizilianischen Thronschatz, den Philipps Bruder, Kaiser Heinrich VI., einst nach Deutschland hatte bringen lassen, auch viele äußerst kostbare Seidenstoffe befunden hatten.
Aber auch die Kleider der übrigen adeligen Herrschaften im Festsaal strotzten nur so vor Gold, Perlen und Edelsteinen, manche schimmerten wie Pfauenfedern, das Gewand des Herzogs von Brabant war sogar nach der neuesten französischen Mode halb grün, halb rot. Außer Herzogin Hedwig, die in schlichtes Weiß gekleidet war, hatten sich die Damen so mit Schmuck beladen, dass man glauben konnte, sie müssten unter der Last zusammenbrechen.
Schließlich hatten sich alle niedergesetzt, und unter der fröhlichen Musik der Pfeifen und Trompeten begannen die Diener mit dem Auftragen. Es gab sieben Gänge, die Vater jeweils mit einem Klopfen seines großen Stabes ankündigte, und zu jedem Gang servierte man mehrere Speisen. Auf den Platten lagen zehn verschiedene Arten von Fischen, Gänse, Hühner und allerlei Vögel, Hirsche und Hasen und Wildschweine, es gab Rindfleisch, Bamberger Würste, Schinken und verschiedenes Gemüse, aber die Hauptattraktion waren Schwäne, die mit zierlich gebogenem Hals und in ihrem Federkleid aufgetragen wurden und mit köstlich gewürztem Ragout gefüllt waren. Man konnte es sich nehmen, wenn man die Flügel hochhob. Zum Nachtisch reichten wir Mandelpudding und Feigen, die wirklich teuer gewesen waren. Um die gute Stimmung der Gäste zu befeuern, hatte Vater große Fässer mit Wein aus dem Rheinland und von den Kitzinger Klosterschwestern besorgt, dem von allen Seiten kräftig zugesprochen wurde. Der Wein war stark und unverdünnt, und ich war gespannt, wer als Erster von der Bank fallen würde.
Nach dem Essen waren die Kerzen angezündet worden. Ein weiches Licht floss über die Tische und machte die Menschen schön, auch die harten Krieger und die eitlen Damen, es ließ die Hände sanfter und die Blicke freundlicher wirken, verbarg Ehrgeiz und Hinterlist, Habsucht und Geiz, Grausamkeit und Neid. Ich konnte sehen, wie sich eine Atmosphäre des Wohlwollens ausbreitete wie ein Duft und die Anwesenden zu einer Gemeinschaft von Freunden machte. Sie hatten gesiegt, der Krieg war vorbei, Brüder würden einander nicht mehr betrügen müssen, und das Korn durfte wieder wachsen, ohne verbrannt zu werden. Und nach dieser letzten Heerfahrt, zu der sie übermorgen aufbrechen wollten, würden sie alle reich sein und das Imperium nur noch einen König haben. Für eine kleine Weile war das Leben schön.
Ich saß auf einer Bank in einer der Fensternischen, die etwas erhöht lag, sodass ich einen guten Überblick hatte. Knechte hatten die mittleren Tafeln aufgehoben und weggeräumt und an den Wänden entlang Bänke in Zweierreihen aufgestellt, wodurch in der Mitte eine freie Fläche für das Unterhaltungsprogramm entstanden war. Das hatte Vater mit Christian, dem Leiter der Hofmusiker, zusammengestellt.
Ich mochte Christian. Seine langen dunklen Haare waren zwar schon von vielen grauen Strähnen durchzogen, aber er benahm sich immer noch wie ein junger Kerl, fröhlich und mit einer Vorliebe für unanständige Witze. Mutter hatte ihm strengstens untersagt, mir so etwas zu erzählen, aber ich hörte ihn natürlich trotzdem bei den Mägden in der Küche. Er war ein großer Schelm mit wer weiß wie vielen unehelichen Kindern überall in der Welt.
Christian kannte jeden unter den Gauklern und Spielleuten, denn er war viele Jahre von Hof zu Hof gezogen, bevor ihn Bischof Ekbert angestellt hatte. Jetzt organisierte er die Vorführungen am bischöflichen Hof und begleitete Ekbert auch auf seinen Reisen. Da war er nicht nur wegen seiner Künste auf der Fiedel willkommen, sondern auch als Verstärkung der Wachmannschaft, denn Christian war auch ein geschickter Bogenschütze. Als Kind war er mit seinem Vater, einem Händler, in Wales gewesen und hatte dort gelernt, einen Bogen aus Eibenholz zu bauen und damit zu schießen. Die anderen Soldaten aus Ekberts Truppe belächelten diese Waffe oft ein bisschen verächtlich. Ihr Ansehen war nicht mit dem der Schwerter zu vergleichen, aber Ekbert wusste, was er an Christian und seinem Bogen hatte. Noch mehr allerdings schätzte er Christians Fähigkeit, die besten Künstler und Akrobaten aufzutreiben.
Da gab es einen, der jonglierte mit Messern, eine Gruppe junger Männer in eng anliegenden bunten Gewändern vollführte Saltos in atemberaubender Geschwindigkeit, und dann stiegen sie einander auf die Schultern, bis der Oberste die Saaldecke erreichte. Zwei Mädchen tanzten auf Kugeln, und die Glöckchen an ihren Armen klingelten dazu eine hübsche Melodie. Diese Mädchen waren anständig gekleidet, aber eine Gruppe anderer Tänzerinnen, die sich auch um einen Auftritt beworben hatten und deren Kleidung etwas spärlicher war, hatte Vater hinunter ins Truppenlager vor der Stadt geschickt. Im Saal säßen zu viele geistliche Herren, hatte er gemeint.
Meine unfromme slowakische Großmutter Eva hatte ihn deswegen verspottet. »Ausgerechnet wegen die Bischöfe?«, hatte sie lachend gefragt. »Lebst du hinter Mond?« Aber Vater war standhaft geblieben.
Viel wichtiger war seinem Herrn, Bischof Ekbert, allerdings der zweite Teil des Abends, der von den Dichtern und Sängern gestaltet werden sollte. Am liebsten hätte Christian natürlich mit Walther von der Vogelweide aufgetrumpft. Der war nun einmal der Morgenstern am Himmel der Sänger; alle Welt kannte ihn, und seine Lieder sangen sogar die Küchenmägde. Aber Walther hatte sich leider einige Zeit zuvor in einem Lied so hämisch über König Philipps angeblich mangelnde Großzügigkeit lustig gemacht, dass man ihn unmöglich bei einem Fest auftreten lassen konnte, auf dem der Herrscher anwesend war.
Da traf es sich gut, dass Bischof Ekberts Vetter Otto von Botenlauben sich gerade in Deutschland aufhielt. Die beiden waren schon als Kinder gemeinsam durch die Plassenburg getobt, wo Ekbert aufgewachsen war. Otto war ein Ritter wie aus dem Bilderbuch: groß und schön, ein starker Kämpfer und ein begabter Minnesänger mit besten Kontakten zum Kaiserhof. Otto war mit dem Kreuzzug von 1197 nach Jerusalem geritten, dort am Königshof zu höchsten Ehren gekommen und hatte schließlich – ganz ritterlicher Held – das Herz einer reichen Erbin, der Herrin von Courtenay, erobert. Die wollte er nun heiraten und als Herr ihrer »Seigneurie« im Morgenland bleiben. Deshalb war er noch einmal in die alte Heimat gereist, um seine Angelegenheiten hier zu ordnen. Unser Mittelsmann hatte ihn auf seiner Burg bei Kissingen erreicht, und er hatte die Einladung zum Hochzeitsfest gern angenommen, weil wir für seine Weiterreise nach Venedig sozusagen auf dem Weg lagen.
In Würzburg hatte er sich mit Wolfram von Eschenbach getroffen, der ebenfalls eingeladen war. Wolfram war gerade wieder einmal für ein paar Monate auf der Wildenburg im Odenwald gewesen, um an seinem »Parzival« zu arbeiten. Am Thüringer Hof komme man zu gar nichts, so ein Auftrieb sei da, hatte er zu Ekberts Boten gesagt.
Otto und Wolfram waren schon drei Tage vor der Hochzeit nach Bamberg gekommen, um sich gründlich auf ihren Auftritt vorzubereiten. Und Wolfram hatte sehr geheimnisvoll getan und uns eine ganz neue Abenteuergeschichte versprochen. Er war ein komischer Kauz und behauptete immer, er kenne die Buchstaben nicht und wolle von den Damen nur nach seinen ritterlichen Taten beurteilt werden. Dabei hatte ich selbst gesehen, wie er in Bischof Ekberts Zimmer eifrig in dessen Manuskripten blätterte. Ich weiß auch nicht, warum er dieses Märchen verbreitete. Vielleicht lag es daran, dass er in dem hinterwäldlerischen Eschenbach groß geworden war? Es gibt ja bis heute Männer, die Bildung für unmännlich halten, nur etwas für Weiber und Pfaffen. Aber so stolz Wolfram auch auf seine Muskeln war, die er bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit herzeigte, ungebildet war er wahrhaftig nicht.
An jenem Abend trug er das erste Abenteuer von Parzivals Vater Gahmuret vor. Gahmuret, erzählte Wolfram, sei der zweite Sohn des Königs von Anjou gewesen, und nach dem Tod seines Vaters habe sein älterer Bruder das ganze Land geerbt. Da habe Gahmuret beschlossen, seine Heimat zu verlassen und sich in der Fremde eine eigene Herrschaft zu erwerben. Mit seinem jungenhaft-spöttischen Grinsen erklärte Wolfram, zu Ehren seines Freundes Otto von Botenlauben habe er die Szene vom Aufbruch Gahmurets ganz neu verfasst. In den Rittergeschichten um König Artus, die wir bisher gehört hatten, zogen die Helden stets tapfer und einsam in die weite Welt hinaus. Gahmuret aber nimmt in Wolframs Erzählung zwanzig Knappen mit auf die Reise, außerdem seinen Kämmerer, einen Kaplan, einen Koch und eine ganze Musikkapelle. Seine Mutter und sein Bruder geben ihm Truhen voller Gold und Edelsteine, edle Pferde und Ballen kostbarster Seidenstoffe mit, und er heuert einen Kapitän an, dessen Schiffe nur für ihn fahren.
Das waren spiegelbildlich die Vorbereitungen des Botenlaubers für seine Reise in den Orient, und alle erkannten das auch sofort. Als Wolfram dann auch noch einen wertvollen Stein erwähnte, den eine – nun ja, nicht nur finanziell großzügige – Freundin dem Abschiednehmenden schenkte, schaute Otto verlegen und etwas mürrisch drein.
Eine kleine Bewegung ließ meinen Blick zur hohen Tafel wandern. König Philipp hatte sich zu seiner Frau hinübergebeugt und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Königin Irene-Marias höflich gelangweilte Miene erhellte sich plötzlich, sie sah ihren Mann verschmitzt lächelnd von der Seite an und schüttelte leise tadelnd den Kopf, als wollte sie sagen: Wie kannst du nur!
Die anderen an der Tafel schienen nichts von dem kleinen Zwischenspiel bemerkt zu haben. Herzog Leopold von Österreich schielte noch mehr als sonst und gähnte ungeniert, Herzog Ludwig sah weiterhin beleidigt aus und starrte mürrisch seine Frau an, die sich offensichtlich vergnügte, und die fromme Herzogin Hedwig von Schlesien war bei Wolframs schlüpfrigen Versen schier zur Salzsäule erstarrt. Doch für die empfindsamen Seelen dieser Tischgesellschaft sollte es noch schlimmer kommen.
Denn nun besang Wolfram, wie Gahmuret in die Dienste des Fürsten von Bagdad – eines Muslims! – tritt und für ihn in allerlei Gefechten kämpft. Die Kampfschilderungen hörten die Männer natürlich besonders gern, und immer wieder unterbrachen sie Wolfram mit witzig gemeinten Kommentaren. Aber den größten Beifall bekam er, als er die Begegnung von Gahmuret und Belakane, der schönen Mohrenkönigin, schilderte. Die beiden verlieben sich auf der Stelle heftig ineinander.
Als Wolfram nun anfing, die körperlichen Vorzüge der dunkelhäutigen Schönheit anzupreisen, wurde Otto von Botenlauben über und über rot. Denn alle im Saal schauten ihn an und dachten sich ihren Teil. Wie ich aus Gesprächen in der Küche wusste, hatte Otto seinem Freund Wolfram tatsächlich von so einer Frau erzählt. Und der besang nun in ausführlichen Reimen, wie Belakane mit Blicken und Gesten Gahmurets Liebesverlangen anheizt. Die Art von Wolframs Vortrag, seine einschmeichelnde Stimme und seine lasziven Bewegungen brachten die Männer zum Grölen und die Damen zum Erröten. Als sein Lied erzählte, wie Gahmuret von schwarzer Hand entwaffnet und zum weichen Bett geführt wird, barst der Saal vor Lachen. Mit einem Trinkspruch auf das gegenwärtige Brautpaar Otto von Meranien und Beatrix von Burgund, die händchenhaltend am Obertisch saßen, beendete er seinen Auftritt. Tosender Applaus brach los, und Königin Irene-Maria überreichte ihm huldvoll ein Säckchen voller Münzen, das ihr König Philipp zugesteckt hatte.
Als Otto von Botenlauben an der Reihe war, versuchte er unglücklicherweise, Wolfram ausgerechnet auf dem Feld der Erotik zu übertrumpfen, und trug eines seiner gewagteren Lieder vor. Obwohl Otto eine sehr schöne Stimme hatte und sein Instrument, eine kleine Harfe, hervorragend beherrschte, wirkten seine Verse neben Wolframs geballter Kraft doch seltsam gestelzt und blass. Er hätte besser ein anderes Thema gewählt, für dieses war er wohl zu sensibel und im Grunde auch, trotz seiner dunkelhäutigen Erlebnisse, einfach zu fromm.
Bevor Wolfram nun ebenfalls mit einem Tagelied kontern konnte, schickte Mutter mich zu Bett. Ich maulte: »Ich bin doch schon zwölf!«, aber sie antwortete: »Du bist erst zwölf, mein Mädchen«, in einem Ton, gegen den Widerspruch zwecklos war. Sie ahnte nicht, dass mir viel Raueres bevorstand als alles, was ich im Saal hätte hören können.
GEFAHREN IM BURGHOF
Ich trat aus dem Laubengang hinaus auf die Treppe, die hinunter in den Hof führte. Das Geißblatt, das die Treppe bis hinauf zum Dach überwucherte, roch nach der Luft im Saal, die schwer war von Fackelrauch und menschlichen Ausdünstungen, süß und weich und wunderbar rein. Eine Weile lang blieb ich auf dem Treppenabsatz stehen und genoss den Duft und den Blick in den Hof. Auch dort brannten Fackeln. An den langen Tischen saßen noch viele der geladenen Ritter, die meisten offensichtlich schon ziemlich betrunken und mit einer kreischenden oder kichernden Magd im Arm.
Plötzlich entstand Unruhe in einer Ecke des Gevierts. Acht bis zehn Ritter standen sich gegenüber, schubsten einander und brüllten sich an. Ich erkannte einige unserer Ministerialen, die anderen waren Männer Herzog Ludwigs von Bayern.
»Ihr wittelsbachischen Arschlöcher«, schrie Eberhard von Frensdorf, »ihr arrogantes Pack! Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, hier Befehle geben zu können!« Einer der Wittelsbacher stürzte sich auf ihn, schlug ihn so hart gegen das Kinn, dass Eberhard hinfiel, und schon war eine wilde Prügelei im Gange.
Aber Gunther, der an diesem Abend die Aufsicht im Hof hatte, hatte bereits die Wachen informiert, die nun mit gezogenen Klingen die Männer auseinandertrieben. Viele der anderen Ritter bildeten inzwischen einen Kreis um das Geschehen.
»Das wird ein Nachspiel haben!«, rief Gunther mit harter Stimme. »Ihr wisst alle, dass während der Festtage absoluter Friede geboten ist. – Das gilt auch für euch!«, fuhr er die Wittelsbacher an. »Und ihr da, ihr kommt mit mir.« Mit gesenkten Köpfen trotteten die vier Bamberger hinter ihm her. Sie würden die Nacht wahrscheinlich im Turm beenden, hatten sie doch den ausdrücklichen Befehl Bischof Ekberts missachtet, die Gäste so gut wie möglich zu betreuen.
Ihr Glück war, dass sie auf dem geplanten Kriegszug dringend gebraucht wurden, daher würde ihre Strafe wohl glimpflich ausfallen. Das beruhigte mich, denn eigentlich mochte ich Eberhard, auch wenn er ein schrecklicher Hitzkopf war.
Ich stieg endlich die Treppe hinunter und ging unter dem Laubengang entlang zum Westflügel, in dem unsere Wohnung lag. Manche der hohen Beamten des Bischofs, etwa der Kellermeister, der Truchsess und der Küchenmeister, hatten sich in den vergangenen Jahren im Tal südlich der Burgmauer eigene Häuser gebaut, aber meine Eltern mussten ständig am Hof zugegen sein, irgendetwas war immer zu regeln oder zu entscheiden. Daher hatte ihnen Bischof Ekbert eine Wohnung im neuen Westflügel der Hofhaltung zur Verfügung gestellt. Ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, wie das früher gewesen war, als die meisten noch keine eigenen Räume hatten, sondern dort schliefen, wo gerade Platz war.
Sogar ich hatte zusammen mit meinem Mädchen eine eigene Kammer. Die war zwar sehr klein, aber für uns gerade recht. Grit war die uneheliche Tochter der Dienerin meiner Mutter, die wiederum die uneheliche Tochter einer unehelichen Tochter war. Frauen wie sie hatten keinerlei Rechte und mussten froh sein, irgendwo unterzukommen.
Allerdings war Grit für mich viel mehr als eine Dienerin, sie war fast so etwas wie eine größere, anhängliche Schwester. Sie war drei Jahre älter als ich und hatte mich seit meiner frühen Kindheit umsorgt und herumgeschleppt. Sie bemutterte mich noch immer ein bisschen, auch wenn mir das zuweilen lästig war. Aber sie nahm mir auch oft Arbeiten ab, die ich nicht gern tat, Gänse rupfen zum Beispiel. Wahrscheinlich würde auch sie irgendwann von einem Mann am Hof genommen und geschwängert werden. Bisher war ihr das erspart geblieben, weil sie nicht besonders hübsch war. Sie schielte, ihr fehlten etliche Zähne, und ihre Figur war, na, sagen wir, eher unförmig.
In dieser Nacht jedoch half ihr das nicht. Ich hörte ihre flehentliche Stimme aus dem Südflügel: »Nein, bitte lasst mich. Ihr tut mir weh!«, und rannte los. In der Ecke neben der Treppe drückte Ritter Waldo Grit gegen die Wand, seine Linke war unter ihren Röcken verschwunden.
Waldo war der Hauptmann der bischöflichen Soldaten, ein großer, schwerer Kerl mit rauen Manieren und Händen wie Schaufeln. Ich versuchte, ihn am Arm zu packen. »Lasst sofort meine Dienerin los!«, schrie ich. Langsam drehte er den Kopf zu mir. Sein saurer Weinatem schlug mir ins Gesicht, er war schwer betrunken.
»Immer mit der Ruhe, mein Täubchen«, lallte er. »Willst lieber du … Du brauschst es bloß zu sagen. Ich bin alls… allzeit bereit! Ein Ritter issst in der Liebe allseit bereit!«
Ich trat gegen seine Beine und zog an seinem Gürtel, aber genauso gut hätte ich versuchen können, einen Felsblock zu bewegen. Mit einer Hand hielt er Grit fest, mit der anderen erwischte er mich und zog mich ganz nah an sich heran. Sein Mund näherte sich dem meinen, als wollte er mich küssen.
Ekel brannte in meiner Kehle, ich stieß ihn mit aller Kraft zurück. Er lachte und fegte mich umstandslos beiseite, als würde er eine Fliege verscheuchen. Ich fiel auf den Steinboden und schlug mir den Ellenbogen auf. Vor Wut begann ich zu schluchzen.
Gerade als ich mich aufrappelte, trat Richard hinter der Treppe hervor. »Ritter Waldo, Ihr sollt zum Herrn Bischof kommen«, sagte er ruhig, aber sehr bestimmt. Waldo knurrte unwillig. Richard trat einen weiteren Schritt auf ihn zu. »Sofort. Es ist dringend.«
Waldo schnaubte noch einmal, ließ Grit aber los. Schwer atmend sahen wir beide den Männern nach, als sie im Dunkel des Laubengangs verschwanden.
»Puh, das war knapp«, sagte ich mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung.
In unserer Kammer fiel Grit auf ihren Strohsack und schlief nach einigen Schluchzern sofort erschöpft ein. Ich war ihre tiefen, dunklen Atemzüge gewohnt, die manchmal von einem winzigen Schnalzlaut unterbrochen wurden, und normalerweise wiegten sie mich nach kurzer Zeit in den Schlaf. Aber diesmal gingen sie mir auf die Nerven.
Ich saß auf meinem Bett – das hatte Großvater für mich gebaut, ein richtiges neuartiges Spannbett und ein ungeheurer Luxus für ein nicht adeliges Mädchen –, und in mir tobte ein Sturm von Gefühlen. An der Oberfläche war da vor allem Wut, Wut auf Waldo. Außerdem ärgerte ich mich, dass Richard mich in so einer unwürdigen Situation gesehen hatte. Wieso war er überhaupt dort gewesen? Wie hatte er gewusst, wo er Waldo in all dem Durcheinander finden würde?
Irgendwann hielt ich es einfach nicht mehr aus. Es war so heiß im Zimmer, so stickig. Außerdem brachte mich eine Stechmücke, die dauernd um mich herumschwirrte und die ich nicht erwischen konnte, halb um den Verstand. Schließlich stand ich auf, warf mir mein Kleid über und trat hinaus in den Laubengang, in der Hoffnung, irgendwo ein Plätzchen mit etwas Luftzug zu finden.
Ich setzte mich auf die Brüstung und lehnte mich gegen die Säule, die den Gang trug. Was für ein gewaltiger Baum musste sie einst gewesen sein, sicher ein paar hundert Jahre alt. Vielleicht hatte sie schon die Babenberger vorbeireiten sehen. Deren schreckliche Geschichte von Krieg und Hinterlist hatte mir meine Mutter schon als kleines Kind erzählt.
Die Nachtluft hatte sich etwas abgekühlt, und ich wickelte mir mein Hemd um die nackten Beine. Die Sterne flimmerten an einem wolkenlosen Himmel, weiß und blau und rötlich, und im Osten über dem Tal stand ein Fingernagelmond. Im Hof wurde es ruhiger, viele Ritter waren mit den Mägden irgendwohin verschwunden oder in die Stadt hinuntergegangen, in die Frauengasse wahrscheinlich, zu den Rosenmädchen. Für diese Nacht hatten die Wachen am unteren Burgtor an der Schütt den Befehl, die Männer passieren zu lassen. Langsam wurde auch ich ruhiger. Es war ein aufregender Tag gewesen. Aber er war noch nicht zu Ende.
Denn plötzlich hörte ich ein seltsames Geräusch, ein unterdrücktes, ganz, ganz leises Schluchzen. Es war das Schluchzen eines Kindes und kam aus der Richtung, wo die Schlafzimmer der Königin und ihrer Damen lagen. Dort war die Brüstung des Laubengangs nicht, wie vor unserer Wohnung, mit Brettern verschalt, stattdessen wurde das Geländer von zierlichen, fein geschnitzten Balustern getragen, durch die der Schein der letzten Fackeln im Burghof fiel. In diesem spärlichen, flackernden Licht kauerte im Winkel neben einer der Bänke Bebe, die jüngste Tochter König Philipps, und weinte bitterlich. Sie war damals erst fünf Jahre alt und machte einen so verlorenen Eindruck, dass ich krampfhaft überlegte, ob ich mir erlauben durfte, sie, eine Königstochter, zu trösten. Gerade wollte ich aus dem Schatten treten, als sich leise die Tür der Schlafkammer der Mädchen einen Spaltbreit öffnete und ihre älteste Schwester Bea herausschlüpfte. Sie kniete neben der Kleinen nieder, nahm sie in den Arm und murmelte die einsilbigen Worte des Trostes, die guttun, auch wenn sie sinnlos sind: »Ist ja schon gut, wein doch nicht, sch, sch!«
Sie wurde von Maria unterbrochen, die auch herausgekommen war, sich auf die Bank gesetzt hatte und von oben auf ihre Schwestern herabsah. Mit ihren dicken blonden Zöpfen, den runden roten Wangen und den strammen Waden sah sie schon jetzt, im Alter von neun Jahren, wie ein Beweis für das üppige Essen in Brabant aus. Dorthin war sie nämlich ein Jahr zuvor gebracht worden, weil König Philipp sie mit dem Sohn des Herzogs von Brabant verlobt hatte. Sie hatte mit der Familie des Herzogs ihren Vater nach Bamberg begleitet. Maria zog die Beine an, schlang Hemd und Arme darum und fragte mit leicht verächtlichem Unterton: »Was hat sie denn? Was heult sie denn so?«
Bea schaute verärgert zu ihr auf, schüttelte leicht den Kopf und zog Bebe noch enger an sich. Sie küsste die Kleine auf die Stirn und fragte zärtlich: »Was ist denn los, Bebe? Warum bist du denn so traurig?«
Bebe schluckte mehrmals, dann brachte sie leise heraus: »Ich will den Pfalzgrafen nicht heiraten, ich will nicht! Aber ich muss, sagt die Amme.«
»Ach, was die Amme sagt!«, warf Maria geringschätzig ein. »Aber ich würde Otto auch nicht heiraten wollen. Der ist ja bloß ein Pfalzgraf, noch nicht mal ein Herzog!«
»So sei doch still!«, fauchte Bea. Und sagte sanft zu Bebe: »Warum willst du Otto denn nicht?«
»Er ist so garstig!«
»Aber er sieht doch recht gut aus, so groß und stark. Und er ist ein berühmter Kämpfer.«
»Aber er hat so garstige Augen. Ich habe solche Angst vor ihm. Und er hat … er hat … Aber Amme sagt, ich darf niemandem etwas sagen.«
»Doch, mein Schätzchen, mir darfst du es sagen. Ich bin doch deine Schwester. Was hat Otto?«
»Er hat mir unter den Rock gefasst. Und er hat mir wehgetan.«
»Was hat er?« Bea klang fassungslos. »Dieser Unhold! Das werde ich Vater –«
»Nein, nein«, unterbrach Bebe sie. »Die Amme sagt, niemand darf was wissen, sonst wird es po… po… potilisch.«
»So etwas wird er nie wieder tun.« Bea sprach jetzt sehr entschieden. »Das verspreche ich dir.«





























