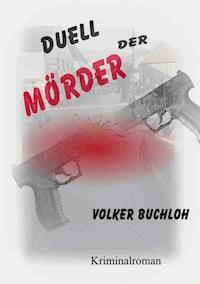2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ich liebe Kriminalromane, in denen Spannung den Leser einbindet. Gleichzeitig möchte ich Geschichten erzählen, die den Leser zum Denken anregen, vielleicht auch zum Widerspruch reizen. Ausgangspunkt meiner Erzählungen sind die spannenden Wege, die Ermittlungen gehen können. Meine Erzählungen sind reine Fiktion. Ich bemühe mich aber so hart die Realität zu beschreiben, wie Polizeiarbeit in geraffter Form stattfindet. Ein deutscher Kommissar ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Beamte mit psychischen Problemen oder Schrullen sind realitätsfern. Das bedeutet nicht, dass sie nicht menschlich sind. Dabei ist das Ergebnis dieser Ermittlungen für den Leser nicht immer angenehm, aber immer spannend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der vierte Fall von Mikael Knoop
Volker Buchloh
Kriminalroman
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen aller Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherungen und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Copyright © 2018. Alle Rechte liegen beim Autor.
Impressum
Der Kopf von Ruhrort
Volker Buchloh
Copyright © 2018 Volker Buchloh
Auch: http://www.buchloh-krimis.de/
Verlag und Druck: tredition Verlag GmbH
Halenreie 40 – 44
22359 Hamburg
Paperback: ISBN 978-3-7439-8191-1
Hardcover: ISBN 978-3-7439-8192-8
E-Book: ISBN 978-3-7439-8193-5
Montag, 9. August
Das Kind protestierte laut und anhaltend. Sein Geschrei durchdrang das gesamte Haus. Ein Haus, dass aus einer Vielzahl großer Räume bestand. Das war bei 340 Quadratmetern Wohnfläche eine beachtliche Dimension. Ein klagendes Kind, so könnte man vermuten, könnte man hier klaglos entfliehen, aber das kann nur jemand annehmen, der keine Kinder sein Eigen nennt. Der Junge hörte einfach nicht auf zu wehklagen. Und es war sicher, dass er damit fortzufahren gedachte. Ein solcher Kinderlärm brachte alle Eltern in Not. Es war stets die Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen Protest und Krankheit. War es eine Körperqual, welche man nicht mitteilen konnte, die Ursache, mit der Bitte um Beseitigung? Oder hatte das junge Leben gelernt, dass man dieses Schreien nur lang genug durchhalten musste, um seinen Willen zu bekommen? Dieses Kind war aber fünf Jahre alt, was die erste Möglichkeit ausschloss.
Die Stimme der Frau klang besorgt und beruhigend. Das Kind wollte aber nicht umsorgt oder beruhigt werden. Es wollte unbedingt seinen Willen durchsetzen. Der kleine Fratz stand vor dem mannshohen Eisschrank in der Küche des Hauses und versuchte vergeblich, dessen Türe zu öffnen. Jedesmal, wenn der Versuch mißlang, war dies ein neuer Anlaß, sein ständiges Brüllen zu steigern. Die Tränen liefen in breiten Bächen über seine fleischigen Wangen. Es war also der Trotz, der seine Gesichtszüge verzerrte. Es wollte etwas aus vollstem Herzen und es gelang ihm nicht, diesen Willen durchzusetzen. Er wollte nicht einsehen, warum die Mutter nicht so handelte, um seinen Willen zu erfüllen. Er selbst hatte aber nicht die Kraft und die Kenntnisse, diesen mannshohen Kühlschrank zu öffnen. So blieb nur das, was er perfekt konnte, das Gebrüll.
Igor Satchenkow hörte sich die Lärmbelästigung in seinem Arbeitszimmer eine Weile an. Er erwartete, dass seine Frau diese Störung aus der Welt schaffen würde. Wie es die Pflicht einer jeden Hausfrau war, Störung aus der Welt zu schaffen. Jedoch jedesmal, wenn er sich konzentrieren wollte, machte das Gebrüll dieses Vorhaben zunichte. Satchenkow hatte eine gedrungene Gestalt. Sein gewaltiger Bauch steckte in dem voluminösen Bund seiner Tuchhose. Seine Augen ruhten in dicken Polstern. Die Pupillen erschienen dadurch verkleinert. Sie waren aber stets in Bewegung, so als drohte eine nicht bekannte Gefahr. Auf fleischigen Schultern ruhte ein gewaltiger Kopf. Auf seinem nach vorne gewölbten Kropf ruhte ein fülliges Kinn, nur von einer Hautfalte voneinander getrennt. Wütend warf er schließlich den Schreiber auf die Unterlagen.
„Schnauze, Verdammt!“
Keiner beachtete seinen Wutausbruch. Wieder fluchte er. Wenn auch leiser, weil anscheinend doch keiner zuhörte. Das Aufstehen machte ihm ein wenig Mühe in den Kniegelenken, was seine schlechte Laune noch steigerte.
Der Unruheherd kam zweifelsfrei aus der Küche. Wütend stapfte Satchenkow dorthin. Aus der angelehnten Türe drang der Geruch von Kartoffeln, Essig und Gurken. Obwohl Satchenkow Kartoffeln über alles liebte, ignorierte seine Wut den Wohlgeruch. Mit einem Fußtritt wurde das Türblatt an die Wand geschleudert. Igor, der Zweite, stand vor dem Eisschrank und versuchte, ihn mit seinen Wurstfingerchen zu öffnen. Offensichtlich gelang es ihm nicht. Wenn er nicht brüllte, dann rief er stakkatohaft: „Eis, Eis. Will Eis!“
Seine Frau machte keinerlei Anstalten, dem Knaben zu helfen. Sie war inzwischen mit Kartoffelschälen beschäftigt. Zum Abendessen sollte es warmen Karoffelsalat geben. Sie hatte ihrem Sohn den Rücken zugekehrt. Erst als die Türe gegen die Wand stieß, drehte sie sich um. Galina Satchenkowa hatte einen gewaltigen Oberkörper. Durch ihre zu kleinen Beine reichte sie ihrem Mann nur bis zur Schulter. Sie unterbrach ihre Tätigkeit und sagte nach hinten gewandt zu ihrem Mann: „Er hat vor einer Stunde schon Eis bekommen. Von zu vielem Eis bekommt er immer Bauschschmerzen.“ Für sie schien damit die Angelegenheit beendet.
Der Junge interessierte sich weder dafür, was er schon verspeist hatte, noch kümmerten ihn die angedrohten Folgen. Er wollte nur eins, seinen Willen durchsetzen. „Eis! Eis!“
Als er seinen Vater sah, verstummte er zwar, gab den Versuch, den Eisschrank zu öffnen, aber nicht auf.
Klatschend landeten die Schläge mit der flachen Hand auf den Rücken des Kindes. Galina, die ahnte was kommen würde, schlug die Augen nieder. Ihr Interesse galt besser der Dicke der Kartoffelschalen.
Satchenkows Wut war verraucht. „So, ein Eis willst du haben?“
Der Knabe zögerte, ob er „Eis“ sagen sollte. Er entschied sich, besser zu schweigen.
„Komm´ mal zu Tata!“ Tata war die belarussische Bedeutung für Papa. Er ging in die Knie, so weit es ihm möglich war. Dabei klatschte er leicht in die Hände.
Der Junge wollte nach wie vor ein Eis, hatte aber überhaupt kein Interesse an Gehorsamkeitsübungen. Dreimal ließ er sich auffordern, dreimal kam er dieser Anordnung nicht nach. Wieder stieg das Blut in Satchenkows Kopf. Blitzschnell griff Igor nach dem Kleinen, bekam ihn mit der linken Hand am Kragen seines Hemdes zu fassen. Die andere schlug mehrfach auf den kleinen, aber speckigen Po. Der Knabe schrie, was kein Ende der Mißhandlung bedeutete.
„Du sollst zu Tata kommen, wenn Tata dies sagt. Ist das klar?“
Das Geschrei ging in ein leises Wimmern über. Der Trotz war ebenso verschwunden, wie der Wunsch nach Eis. Der Vater hob nun drohend die Hand. Sein Sohn wusste, was diese Geste bedeutete. Weiterer Schmerz. Das Wimmern verstummte ganz. Mit dem gebogenen Zeigefinger wurden die Tränen aus den Augen gewischt. Der Mann ging einen Schritt zurück. Er kniete sich nun nicht mehr, weil seine Knie schmerzten. Er zog einen Küchenstuhl heran, und nahm plumpsend Platz.
„Komm zu Tata.“ Der Befehlston war unverkennbar.
Der Junge zögerte, ob er einen Schritt gehen sollte. Das erneute Kommando „Komm!“ klang eine Oktave ernster. Vorsichtig machten die kleinen aber fleischigen Beine einen Schritt nach vorne. Er zögerte erneut. Als der Vater sich zu einem Lächeln zwang, unternahm das Kind die restlichen Schritte.
„Brav, Junior. Brav. Braver Junge. Du willst ein Eis?“ Igor der Große öffnete den Eisschrank, entnahm ihr zwei Lutscheis, entfernte die Verpackung und hielt seinem Sohn vom Küchenstuhl aus ein Stileis hin.
„Setzt dich zu Tata.“
Igor Junior gehorchte. Eigentlich wollte er so schnell wie möglich den Raum verlassen, um möglichst viel Abstand zwischen sich und seinem Vater zu bekommen. Dazu fehlte ihm aber der Mut. Er setzte sich zitternd auf den Boden vor seinem Vater. Die Rollen an seinem Bauch waren nun unverkennbar. Missmutig begann er an seinem Eis zu lutschen, das nun nicht mehr so richtig schmecken wollte. Satchenkow sah die kalte Köstlichkeit als Entschädigung für die Mühen, die Kindererziehung mit sich brachte. Er lehnte sich zufrieden zurück. So einfach war Kindererziehung. Bei jeder Zungenbewegung schaute der Knabe zu seinem Vater auf, und betrachtete dessen Gesichtszüge. Solange diese friedfertig schienen, konnte er weiterlutschen.
Der letzte Rest war vom Holzstil abgeleckt. Satchenkow hielt seinem Sohn das Holzstück hin. „Schmeiß das mit weg.“
Der Junge gehorchte. Als er den Abfallbehälter schloss, hörte er den nächsten Befehl.
„Geh auf dein Zimmer!“
Frohen Herzens kam Igor, der Zweite, dieser Anweisung nach. Satchenkow watschelte zu seiner Frau. Von hinten schlug er ihr hart rechts und links gegen den Kopf.
„Sorge gefälligst dafür, dass man in diesem Haus ruhig arbeiten kann, Weib.“ Wortlos drehte er sich um, und verließ die Küche.
Samstag, 14. August
Das rhythmische Geräusch des Weckers erinnerte an das Stimmen eines Klaviers. Schon nach seiner dritten Tonfolge wurde er bereits ausgeschaltet. Vieruhrdreißig zeigte die Digitalanzeige mit roten Ziffern an. Der Samstag hatte begonnen. Scheuerle hatte eine innere Uhr, wenn es zum Angeln ging. Er stellte seinen Wecker nicht, weil er sich nicht verschlafen wollte, sondern um den Aufstehgewohnheiten zu genügen. Wenn er etwas bei seinem Hobby in den letzten Jahrzehnten gelernt hatte, dann war es Stetigkeit. Zu früh, das bedeutete Dunkelheit. Zu spät, dann hatten andere Angler die besten Plätze schon besetzt. Während er sich anzog, wusch und seine Angelutensilien zusammenstellte war seine Frau schweigend in der Küche verschwunden, um Brote zu schmieren, Schnitzel und Mettwürstchen einzuschlagen und Kaffee zu kochen. Ebenso lautlos verschwand sie dann jedesmal wieder im Schlafzimmer. Scheuerle wusste, dass er von nun an keinen Lärm mehr machen durfte. Er hatte es aufgegeben, sich darüber Gedanken zu machen. Wie man beispielsweise noch einschlafen konnte, nachdem man einmal aufgestanden war. Seine Frau gings ins Bett, drehte sich um, und war im Nu eingeschlafen. Nur wecken durfte man sie dann nicht mehr.
Nebelstreifen bedeckten die Wasseroberfläche des Rheins. Sie verhinderten die Sicht auf das, was dahinter lag. Es war die Friedrich-Ebert-Brücke, die von den Ruhrortern allgemein nur als Homberger Brücke bezeichnet wurde. Sie verband von dieser Seite Ruhrort mit dem linken Flussufer, und dadurch auch mit dem Stadtteil Homberg. Ruhrort und Homberg waren Stadtteile von Duisburg. Duisburg lag am westlichen Rand des Ruhrgebietes. Gleichzeitig gehörte es wegen seiner Lage am Rhein zum Gebiet des Niederrheins. Die Stadt hatte eine Breite von 14 Kilometer. Sie krümmte sich aber über 25 Kilometer beiderseits entlang des Rheins, wobei die Rheinfront fast vierzig Kilometer ausmachte.
Ab und zu schob die Stahlwand eines vorbeifahrenden Schubverbandes die Nebelschicht etwas beiseite. Aber hartnäckig, wie Nebel nun einmal war, fand er sich nach dieser willkürlichen Trennung wieder zusammen. Viel Verkehr herrschte um diese Zeit sowieso nicht auf dem Fluß. Aber das würde sich in den nächsten Stunden ändern. Ein Tankschiff eilte wenig später Richtung Arnheim mit einer Geschwindigkeit über die Wasseroberfläche, so als gelte es, zum Frühstück noch sein Ziel zu erreichen.
Scheuerle hatte sich für den heutigen Tag für eine Stelle in der Nähe des Pumpwerks am Eisenbahnhafen entschieden. An dieser Stelle war die Geschwindigkeit des Rheins niedriger, als in der Stromlinie. Dennoch spülte der Fluss in die nahe Mündung des ehemaligen Eisenbahnhafens genügend Futter heran. Die Fische brauchten weniger Energie zum Schwimmen, und brauchten eigentlich zum Speisen nur ihr Maul zu öffnen. Der Angler öffnete den Kasten mit den Ködern. Er zögerte etwas, bevor er sich für einen Lebendköder entschied. Mit kräftigem Schwung, dem man die Routine ansah, schleuderte er den Schwimmer in die Fluten. Die beiden Angelruten ließen sich problemlos in den großen, kantigen Felsbrocken der Uferböschung befestigen, Vom erhöhten Uferweg auf dem Damm bis zur Wasserlinie bedeckte eine Rasenfläche den Uferbereich. Einzelne Büsche boten die Möglichkeit für Schatten, aber um diese Zeit brauchte man diesen nicht. Erst, wenn die Sonne alles erwärmt hatte, würde dies eventuell nötig sein, aber dann würden die Fische sowieso nicht mehr anbeißen. Ein Zeitpunkt bei dem Scheuerle das Feld längst geräumt hatte.
Scheuerle klappte Stuhl und Tisch auf, und stellte sie standsicher auf den grünen Untergrund. Er fand seine Thermoskanne, und füllte ungesüßten Kaffee in eine Thermotasse. Scheuerle liebte Rituale. Zuerst musste die Mettwurst daran glauben. Nur in Verbindung mit Kaffee bildete sie den ersten Teil seines Frühstücks. Während seine Zähne der aktivere Teil seines Körpers waren, beobachtete er, wie die beiden Schwimmer seiner Ruten gemächlich auf den Wellen tanzten. Ein Gefühl der Ruhe und Entspannung durchflutete seinen Körper. Übermorgen würde das Leben wieder hektischer ablaufen. Dann musste er wieder in der Metallbaufirma Heinrichs & Söhne in Beek arbeiten. Der Arzt hatte ihn wegen einer mittelprächtigen Erkältungskrankheit bis heute krankgeschrieben. Was gab es da Besseres, als den letzten Krankheitstag beim Angeln zu verbringen.
Die Schwimmer tanzten immer noch in der sich bewegenden Wasseroberfläche. Die Wellen trieben sacht auf ihn zu, bevor sie sich in der massiven Uferbefestigung lautlos brachen Er verspürte Appetit auf eine Stulle, von der er wusste, dass sie mit Leberwurst bestrichen war. Um ihn herum wurde es hektisch. Der erste Radfahrer fuhr über den Uferweg. Warum musste dieser Idiot gerade auf seiner Höhe klingeln? Eine dieser Lärmmaschinen, die vom Reifen angetrieben wurden, um das Blut anderer Verkehrsteilnehmer in den Adern zum Gefrieren zu bringen. Im Blickwinkel meinte er eine Bewegung im Wasser wahrgenommen zu haben. Als er aber danach suchte, fand er nichts. Gemütlich schenkte er sich Kaffee nach. Da, einer der Schwimmer änderte den Bewegungsrhythmus. Fehlalarm. Wahrscheinlich hatte Treibgut oder Vergleichbares mit ihm Kontakt gehabt. Nach zwanzig Minuten hatte er Glück. Ein Rotauge hatte sich am Köder verschluckt. Es war zu klein. Behände warf Scheuerle sie wieder in das Wasser.
Der erste Fußgänger hastete über die asphaltierte Dammkrone. Er machte Skiwandern ohne Schnee. Wenigstens geschah dies ohne störende Geräusche. Peter Scheuerle lehnte sich zurück in seinen Campingstuhl. So weit wie es ging streckte er die Beine von sich. Er zog seinen breitkrempigen Filzhut in die Stirn. Das Abkühlen seiner Ohren hatte er durch ein Tuch verhindert, welches er piratenähnlich um seinen Kopf geknotet hatte. So konnte er es noch stundenlang aushalten. Die Sonnenscheibe hatte sich schon zu Zweidrittel über dem Horizont erhoben. Sie wechselte von dunklem zu hellem Rot. Bald würde sie die hellweiße Farbe annehmen. Scheuerle wusste, dieser Tag würde ein sonniger werden. Der Nebel befand sich auf dem Rückzug.
Ein mit Schüttgut beladener Frachter teilte die Wellen des Flusses. Die Flagge bewegte sich leicht durch den Fahrtwind. Ihre Nationalitätsangabe war nicht erkennbar. Aus dem sichtbaren Farbstreifen vermutete Scheuerle einen Holländer. Der Nebel schien schwächer zu werden. Die Konturen des Fahrzeuges waren schon deutlicher zu sehen. Die Positionslichter zeigten die Bergfahrt an. Die Bugwelle ordnete die regellose Bewegung der Wellen. Pfeilförmig strebten sie verstärkt dem Ufer zu. Es war abzusehen, wann sie seinen Standort erreicht würden. Als das geschah, brachten sie Unruhe in die Bewegungen der Schwimmer. Scheuerle folgte den Wellen, wie sie von ihm wegliefen. Da sah er es erneut. Die Bewegung. Instinktiv schüttelte er seinen Kopf, wenn man etwas wahrnahm, was man nicht für möglich hielt. Die Bewegung. Ein Stein, der sich im Wasser bewegte? Das widersprach doch aller Logik. Eine Möwe landete in der Nähe des Fundes. Umsichschauend hopste sie auf den schwimmenden Stein zu. Scheuerles Neugier war erwacht. Bedächtig erhob er sich, um sich das genauer anzusehen. Indertat ein Stein, der sich im Wasser bewegte. Nicht viel, aber er bewegte sich. Die Möwe gab ihr Objekt der Begierde auf. Nun, weil das Schiff schon vorausgeeilt war, waren die Tippbewegungen im Wasser etwas ruhiger. Aber es bewegte sich zweifellos. Ein kugelförmiges Wesen in dieser Größenordnung war ihm nicht bekannt. Denn Steine in dieser Größenordnung waren eher eckig und nicht rund. Es konnte also kein Stein sein. Als er die Haare sah, glaubte er wieder an ein Lebewesen. Nun war Scheuerle kein Mensch, der sich scheute Lebendes anzufassen. Er war es gewohnt Fischen den Hals abzuschneiden, oder sie auszunehmen. Als sich beim Zugriff die Haare von dem Objekt lösten, schaute er zunächst was er in der Hand hatte. Es waren zweifellos Haare. Welches Wassertier hatte aber Haare? Beherzt griff er diesmal mit beiden Händen zu. Neugierig drehte er seinen Fund in alle Richtungen. Das, was ein Ohr sein könnte, wurde sichtbar. Er zögerte, bevor die Augen seine Erkundung wieder aufnahmen. Der Blick auf zwei leere Augenhöhlen, einem weitoffenen Mund und das, was einmal eine Nase gewesen sein könnten, schockierte ihn dann doch. Das, was wohl einmal Haut gewesen war, war an vielen Stellen durchbrochen. Darunter wurde Muskelmasse sichtbar, die sich auch abzulösen begann. An einigen Stellen schimmerte das durch, was den Schädelknochen sichtbar machte. Es gab keinen Zweifel. Das, was er in den Händen hielt, waren die Überreste eines menschlichen Kopfes.
Die morgendliche Ruhe konnte man genau so vergessen, wie das Angeln. Peter Scheuerle hatte seine sieben Sachen längst verstaut, aber man deutete ihm an, er hätte noch zu warten. Im nachhinein verfluchte er, warum er die 112 gewählt hatte. Aber es war nur eine halbe Entrüstung. Natürlich sah er es ein, dass man einen solchen Fund melden musste. Er wusste nicht, wie viele Male er unterschiedlichen Personen schon geschildert hatte, wie es zum Fund des Leichenteils gekommen war. Zuerst hatte er dem Wachmeister, der zu ihm heruntergestiegen war, den Ablauf erzählen müssen. Dann wollte der Streifenwagenführer auch informiert werden. Und dann waren da die anderen Uniformierten, deren Neugier er stillen musste. Scheuerte hatte zu Beginn der Befragung noch gehofft, weiter rheinabwärts einen anderen Angelplatz zu finden, aber je länger die Warterei dauerte, um so mehr konnte er sich von dieser Illusion verabschieden. Mehrfach fragte er, ob er denn nun verschwinden könnte. Aber alle hatten die gleiche Antwort. Nein, er durfte noch nicht nach Hause, obwohl mehrere Polizisten doch seine Anschrift notiert hatten. Statt dessen musste er seinen Angelplatz räumen. Man informierte ihn, dass die wichtigen Personen erst noch kämen. Diese hätten bestimmt noch weitere Fragen an ihn.
Wibke Pralewski hatte am heutigen Tage Bereitschaft. Bereitschaft hieß nicht Anwesenheit in der Dienststelle, sondern ledig Rufbereitschaft. Pralewski war Kommissarin bei der Duisburger Mordkommission. Der Anruf erreichte sie in der letzten Traumphase. Sie drückte die grüne Taste ihres Mobiltelefons und schaute gleichzeitig auf die Anzeige ihres Radioweckers auf dem Nachttisch. Es war noch keine Halbsechs. Was dann ablief war Routine. Sie brauchte zwanzig Minuten bis zum Fundort. Die Schar der Neugierigen verriet ihr, wo sie hin musste. Einige hatten sich mit Ferngläsern ausgerüstet, um näher am Geschehen zu sein. Leider gab es nur wenig zu sehen. Die Stelle des Fundortes war von ihren Kollegen weiträumig abgesperrt worden. Das Flatterband mit der Aufschrift ′Polizeiabsperrung′ wackelte ungeduldig im Winde. Die Spurensicherung war bereits vor Ort. Es gab nur eine Markierung, und die trug die Nummer Eins. So wie Pralewski die Situation einschätzte, würde es keine weiteren Fundstellen für Hinweise geben. Dennoch versuchten die Kollegen von der Spurensicherung ober- und unterhalb der Fundstelle nach weiteren Hinweisen für die Tat zu finden. Die Jungs und Mädels waren eben gewissenhaft.
Pralewski hatte ihre langen, blonden Haare in eine Baseballkappe gezwängt. Hinter dem Verstellband am Hinterkopf schaute ein kurzer Pferdeschwanz hervor. Sie glaubte nicht die einzige Frau zu sein, die unzufrieden mit ihrer Haarfarbe war. Blond zu sein war mehr Stein des Anstoßes, denn Zeichen von wirklicher Bewunderung. Um diese primitive anmache als blondes Dummchen zu vermeiden, hatte manche Frau ihre Haare gefärbt. Nicht so Wibke. Wer auf dieser Masche bei ihr andocken wollte, der fiel ins kalte Wasser. Sie war in Nullkommanichts von Null auf Hundert und konnte den Anmacher zusammenfalten, dass es ihr eine Freude war. Die Kommissarin zog den Kragen ihrer Daunenjacke hoch. Unwillig schüttelte sie ihren Kopf. Wie konnte man nur um eine so frühe Zeit angeln?
Etwas linkisch trat Peter Scheuerle an die Absperrung. Die Frau mit der grün-gelben Daunenjacke hatte längere Zeit mit einem der Uniformierten gesprochen, mehrmals in seine Richtung geschaut, und hatte ihn schließlich zu sich gewunken. Frauen bei der Verkehrspolizei waren Scheuerle wohl bekannt. Aber bei einer solchen Sache? Die Frau war höflich und nett. Sie bat ihn zu schildern, wie es zu diesem Fund gekommen war. Wieder erzählte er den Ablauf des heutigen Morgens. Viel war es ja nicht. Die bernsteingelben Augen der Beamtin beobachteten alle seine Bewegungen. Scheuerle hatte den Eindruck, als befände er sich unter einer Lupe. Pralewski erkannte schnell am Verhalten des Zeugen, dass das Wissen dieses Menschen die Ermittlungen keineswegs beschleunigen konnte. Scheuerle war erfreut, als man ihm andeutete, man könnte nun auf ihn verzichten. Er packte seine Sachen unter den Arm und ging zu seinem Wagen.
Pralewski schaute sich um, bis ein Polizist vorbeikam. Sie gab die Anweisung, den Leichensack zu öffnen. Was sie sah bedurfte keiner weiteren Untersuchung. Der Kopf hatte tagelang im Wasser gelegen. Nur der Gerichtsmediziner konnte hier genauere Informationen geben.
„Hallo, die neue Kollegin. Einen Kaffee gefällig?“ Es war der Pathologe Liesner, der ihr einen Pappbecher hinhielt. „Ist aber ohne Milch und Zucker. Mein Magen.“ Er legte die Hand auf seinen Bauch.
„Danke. Hauptsache warm.“ Bevor Wibke einen Schluck nahm, wärmte sie ihre Finger an dem Hilfsgefäß aus Wachspappe.
„Wo ist denn Ihr Chef?“
Wibke wärmte ihre Lippen an dem Getränk. „Der hat heute dienstfrei. Hochzeit der Tochter, glaube ich. Ich weiß nicht, wann der kommt.“
„Dann machen wir die Leichenschau zusammen?“
Pralewski nickte. “Wann soll ich kommen?“
Liesner schaute auf den Kopf. „Hier kann ich sowieso nichts machen. Sagen wir in zwei Stunden bei mir im Institut? Den nehme ich sofort mit. Dann geht es schneller.“ Er griff nach dem Plastiksack und kletterte die Uferböschung hoch.
Pralewski nahm sich vor, in der Zeit, die ihr nun blieb, nach einem Cafe zu suchen. Wenn um diese Zeit schon eines in Ruhrort geöffnet hatte. Sie verspürte ein Verlangen nach heißem Kaffee und Hunger auf ein frischgebackenes Brötchen mit Schinken.
Die Absaugvorrichtung arbeitete mit voller Leistung, aber dennoch stand ein Geruchsgemisch von Verwesung, Blut und Desinfektionsmitteln im Raum. Dr. Liesner schaltete das Mikrofon ab, das über den Seziertisch hing. Dann zog der Rechtsmediziner den Mundschutz herunter, streifte die Schutzhandschuhe und die Kunststoffschürze ab. Er knüllte beides zusammen. Mit dem geübten Wurf eines Basketballers warf er das Plastikknäuel in den Abfallbehälter. Er drehte sich zu der Ermittlerin um, die seiner Untersuchung beigewohnt hatte.
„Sie haben gehört, was ich diktiert habe? Noch Fragen?“
Wibke Pralewski nickte. „Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schiffsschraube oder eine Seilbewegung für das Abtrennen verantwortlich waren?“ Sie hatte der Kopfbeschau schweigend beigewohnt.
Der Arzt ging zu der Wand, an welcher das Röntgenbild eines Kopfes projiziert war. Sein Zeigefinger fuhr über die Trennlinie zum Hals. „Eine Seilbewegung kann ich sofort ausschließen. Eine Schiffsschraube? Sehr unwahrscheinlich. Ich müsste mich schon sehr irren. Ein Schiffspropeller hat eine Materialstärke von 3 bis 20 Millimetern. Je nachdem, ob es sich um ein Sportboot oder einen Schuber handelt. Wenn sie den Kopf abtrennt, dann zerschlägt sie den Knochen. Es müssen dann in jedem Fall jede Menge Knochensplitter auftreten. Die gibt es aber nicht. Außerdem ist es unwahrscheinlich, wenn eine Schraube gerade rechtwinklig auf den Halsansatz trifft. Schauen Sie sich die Trennfläche an. Das wenig vorhandene Fleisch ist durch mehrere Schnitte abgetrennt worden. Man hat mehrfach angesetzt. Ein Anzeichen, dass es sich um einen Ungeübten handeln muss. Die Feinheit des Schnittverlaufs lässt auf eine schlanke Schneide schließen. 15 bis 20 Zentimeter lang, würde ich schätzen. Ich bin mir fast sicher, dass hier ein ungeübter Metzger zugange war. Er hat mehrmals, mindest dreimal zum Schnitt angesetzt. Die mikroskopischen Untersuchungen werden zudem zeigen, man hat den Atlas mittels Bruch vom Körper getrennt. Die Druckstellen oberhalb des Ohres werden dies bestätigen. Der Täter war sich nicht sicher, wie er die Trennung durchführen sollte. Ein Hacken mit einer Schneide hätte mehrere Kerben ergeben. Nein, er benutzte etwas anderes. Ich muss das noch genauer untersuchen.“ Liesner zeigte auf eine verdunkelte Stelle an der Trennstelle. „Hier hat er die Schittführung geändert. Ich bin mal gespannt, was die Mikroskopuntersuchung mir verrät.“
„Wie darf ich mir das vorstellen?“
Liesner näherte seinen Kopf einem Flippboard neben der Projektionsfläche des Bildschirms, so als könne er in die Aufnahme eintreten. Mit schnellen Zügen, die einen Profi erkennen ließen, entstand eine sanft gebogene Fläche. Auf der oberen Linie entstand die Skizze eines Quadrats, welches er mit ′Gegenstand′ beschriftete. Einer Hinweislinie auf die untere Begrenzung folgte der Schriftzug ′Hals′. „So in etwa.“
„Kann man nicht mit der Hand einen solchen Kopf abtrennen?“ Pralewski malte an den kurzen Seiten der Schneide jeweils einen Griff. „So in etwa?“ Sie mimte schaukelnde Bewegungen eines Messers nach.
„Das glaube ich nicht. Wenn man ein Fachmann ist, dann trifft man die Bandscheibe. Dann wäre die Trennung mittels Messer möglich. Bei viel Krafteinsatz allerdings. Aber ich sagte ja, es handelt sich um einen Laien. Der ist aber auf den Knochen gestoßen. Ich bleibe dabei. Der Rest erfolgte mit stumpfer Gewalt.“
„Und wann können Sie mir etwas Genaueres über den Todeszeitpunkt sagen? Die Zeit drängt nämlich.“
Dr. Liesner nickte. „Natürlich! Ich habe da noch ein paar andere Leichen liegen. Einer ist von der Leiter gefallen. Eine Frau ist bei einem Arzt zusammengebrochen. Ein Autofahrer, der den Weg durch einen Eisenbahntunnel verpasst hat, und gegen die Ausmauerung gefahren ist. Und ein Kind, wo die Todesursache von außen nicht erkennbar ist. Euer Kopf kommt direkt nach dem Kind. Das kann ich versprechen. Was ich jetzt schon sagen kann? Natürlich unter Vorbehalt.“
„Natürlich“, bestätigte die Kommissarin.
Liesner griff nach einem Operationsbesteck und berührte damit einige Stellen des Schädels. „Das Fleisch trennte sich schon leicht von den Knochen. Dadurch, dass der Kopf im Wasser lag, gibt es kaum Spuren von Insekten. Ich muss das Gewebe sehen, um Genaueres zu sagen. Lassen Sie mich vorsichtig schätzen. Mindestens drei Wochen, eher mehr.“ Liesner zeigte auf den konturlosen Haufen, der einmal Teil eines Menschen gewesen war. Nun hatte er noch weniger Ähnlichkeit mit dem Kopf, den man aus dem Wasser gezogen hatte.
Pralewski hatte den Fund am Fundort dokumentiert. Da war der Kopf noch menschenähnlicher als jetzt. Aber er war immer noch so scheußlich anzusehen, dass er als Fahndungsfoto nicht infrage kam.
„Können Sie über den Rechner ein Phantombild des Kopfes machen?“
Liesner nickte. „Damit habe ich vorher schon das LKA in Düsseldorf beauftragt. Es wird aber bestimmt ein paar Tage dauern, bis ich Antwort habe.“
„Gut. Und nun muss ich noch die Todesursache wissen.“ Palewski zwirbelte ihren Haarzopf und ließ ihn fallen.
„Das Abtrennen des Kopfes ist eine Möglichkeit. Das Fehlen von Abwehrverletzungen wäre ein Hinweis auf pre mortem. Sie müssen mir schon den Rest ranschaffen, wenn ich diese Frage beantworten soll.“
„Was ist mit dem Gebiss? Kann man so an den Namen kommen?“
Liesner hielt eine Akte in die Höhe, bevor er sich setzte. „Ich habe den Kontakt zu den Zahnärzten schon aufgenommen. Ich muss Sie aber enttäuschen. So wie das Gebiss aussieht, hat der Tote in letzter Zeit, wenn überhaupt, keinen Zahnarzt aufgesucht. Ein Zahn zerstörte sich durch Karies. Es gibt keine Plomben oder Kronen. Der Zahnstein...“
Pralewski winkte ab. „Gut, gut. Dann haben wir also nichts.“ Sie wedelte mit der rechten Hand, als sie den Sezierraum verließ.
Die Kantine des Klinikums Duisburg war nur noch zum Teil besucht. Hier war auch die Rechtsmedizin untergebracht. Die Speisung der hungrigen Bediensteten hatte ihren Höhepunkt überschritten. Es roch nach frischen Kaffee, Zigarettenrauch und Essig. Obwohl hier ein Rauchverbot galt, hielten sich viele Bewohner und Studenten nicht daran. Pralewski hatte die Gelegenheit genutzt, etwas für ihren Magen zu tun. Das mit dem Cafe hatte nicht geklappt. Ohne Frühstück war ihr Hunger nun immens. Die Küche hatte hier einen ausgezeichneten Ruf. Man munkelte, wer dem Ableben jeden Tag so nahe war, der schätzte einen schmackhaften Bissen. Wibke dirigierte ihr Tablett in den hinteren Teil der Kantine. Hier war es ruhiger, und sie brauchte im Moment keine Ablenkung. Sauerbraten mit Rotkohl hatte sie gewählt. Der saure Geschmack des Fleisches übertünchte den Geschmack von Resoportan. Resoportan-Tropfen unterbanden den Brechreiz, den die Gerüche von toten Körpern in Mund und Nase zur Folge hatten.
Sie sah wieder den Kopf vor Augen, den sie gerade verlassen hatte. Es kam nicht jeden Tag vor, auf Einzelteile einer Leiche zu treffen. Wenn, dann traf man in der Regel auf den Restkörper. Man trennte den Kopf ab, weil dies die Bestimmung des Toten in der Regel erschwerte. Eigentlich versteckte man ihn sorgfältig, um sein Auffinden zu verhindern. Der Restkörper wurde eher bedenkenloser entsorgt. Der Glaube war verbreitet, dass man mit dem Abtrennen des Kopfes der Leiche ihre Identität raubte. Gleichzeitig glaubte man, eine Leiche ohne Haupt wäre schlechter oder sogar kaum zu identifizieren. Aber das war ein Trugschluß. Die Vielzahl biometrischer Daten erlaubte auch eine Identifizierung ohne Kopf. Das Problem stellte sich für Pralewski anders dar. Warum man in diesen Fall nicht den Kopf sondern den Restkörper entsorgt hatte, musste einen Grund haben. Diesen würde Pralewski im Moment gerne wissen. Sie musste Kontakt zum Wasserschutz aufnehmen. Die Kollegen konnten einem sagen, wo der Körper voraussichtlich in den Rhein geworfen wurde. Es war einfache Mathematik. Liesner lieferte den Todeszeitpunkt. Damit stand fest, wie lange dieses Körperteil überhaupt im Wasser gewesen sein konnte. Die Obduktion lieferte weitere Fakten. Wenn man Fließgeschwindigkeit und Zeit kannte, dann ergab dies den Weg zwischen Ablegen des Körpers und dem Fundort. Ob dieser Ort aber genau stimmte, hing von der Zeit ab, die das Objekt bis in den Anlandepunkt oberhalb des Eisenbahnhafens gebraucht hatte. Pralewski bezweifelte, dass man dies ebenso einfach berechnen konnte.
Dienstag, 24. August
Der Junge tat das, was man ihm beigebracht hatte. Er trug blaue Jeans und einen Kaputzenpullover, auf dem im Rücken die Zahl 76 stand. Seine Füße steckten in Sportschuhen mit weißen Sohlen. Er betrat den Mercado-Supermarkt in Ruhrort zusammen mit einer Frau, die zwei Kinder an der Hand hielt. Der Mercado lag in der Nähe des ehemaligen Ruhrorter Bahnhofs. Die Zeiten, bei denen man von hier aus mit der Eisenbahn in die weite Welt reisen konnte, gehörten schon lange der Vergangenhait an. Aber dass wusste der Knabe nicht, und es interessierte ihn auch nicht. Er hatte anderes im Sinn. Alexej, so hieß er, ging so nah hinter den beiden Kindern her, dass ein Beobachter glauben musste, die Frau hätte drei, nicht zwei davon. Der Junge vor ihm, obwohl zwei Jahre jünger als er, trug seine Haare so, wie Alexej sie gerne getragen hätte. Viel Gel und dann spitz nach oben geformt. Aber das war ihm nicht erlaubt. Man erlaubte ihm nur eine Frisur, die nicht auffiel. Sollte man ihn einmal ergreifen, dann sollten immer Zweifel an seiner Identität möglich sein. Ihre beiden Kinder hielt die Mutter nach Möglichkeit an den Händen. So wollte sie sichergehen, damit der Nachwuchs nicht alles in den Regalen anfasste, was ihm interessant und begehrenswert erschien. Aber immer wieder fanden die beiden Kinder eine Möglichkeit, das ein oder andere, aus den Regalen zu ziehen. Sie hantierten damit rum, um es dann fallen zu lassen, wenn das akustische Verbot der Mutter ertönte. Ein solches Verhalten erregte häufig das Interesse von Ladendetektiven, weil Lebhaftigkeit meist deren Aufmerksamkeit nach sich zog. Ein Grund, um nicht zu lange hinter den Drei herzulaufen.
Alexej folgte eine Weile der Familie, bis er sich als Kind sicher vor Beobachtung durch Mitarbeiter und Ladendetektiven fühlte. Was er im Mercado wollte, hatte er vor seinem Arbeitseinsatz auswendig hersagen müssen. Eigentlich war es nicht schwer, denn es war fast immer das Gleiche: Rasierapparate, Fahrradschlösser, elektrische Haustürklingel, Klingeltransformatoren, Werkzeuge aller Art, wenn sie nicht zu raumgreifend waren. Bevor die Gruppe mit dem Bus aufbrach, telefonierte sein Brigadier immer mit einer unbekannten Stelle, um sich genauere Anweisungen zu holen. Bevor der Transporter losfuhr, gab sein Chef immer die konkreten Ziele vor. Alle passten auf, denn Fehler wurden sofort mit Schlägen bestraft. Und die waren nicht ohne.
Auch die Beschaffung war präzise durchorganisiert, lange erprobt und immer wieder den geänderten Gegebenheiten angepasst. Das Wort ′Diebstahl′ zu gebrauchen, war verboten. Sie gingen, wie ihre Eltern, zur Arbeit. Es war nur eine andere Art von Arbeit. So einfach war das. So trugen sie mit ihrem Teil für die Ernährung der Familie bei. Und es war eine Reihe von Familien, die davon abhängig waren. In seiner Gruppe gab es noch fünf weitere Kinder. Und es gab noch eine Reihe weiterer Gruppen, wie er selbst wusste. Alexejs Aufgabe war es, die geforderte Ware zu ′besorgen′. Diese hatte er dann unauffällig in die Tasche seines Kollegen zu stecken. Dieser war fünf Jahre älter als er selbst, und hatte drei Jahre mehr Erfahrungen als er. Die Tasche war ein Zwischenlager. Sie stand meist in einem Einkaufswagen, der immer seine Position wechselte. Bloß nicht auffallen war der Leitsatz ihres Handelns. Fiel man auf, dann ließ man das Sammelgut einfach zurück. Die Arbeit war dann zwar umsonst gewesen, aber keiner konnte ihnen nachweisen, dass dies ihre Beute gewesen war.
In der Sanitärabteilung war wenig Betrieb. Zwei Handwerker standen vor einem Regal von Befestigungsmaterial für Badezimmerartikel. Einer las von einem Zettel das Gewünschte vor, der andere suchte und zählte, bevor er die Sachen in einen Gitterwagen warf. Ein älterer Mann fuhr mit seinen Blicken über die Regalreihen. Wahrscheinlich fand er nicht das, was er suchte. All das interessierte Alexej nicht. Er sah sich nach dem Verkäufer um, der durch seinen Arbeitsdress schon von weitem zu erkennen war. Ein Kontrollblick, sein Kumpel schob den Einkaufswagen in den Parallelgang. Der Junge musste sich strecken, um an die Seifenschale zu kommen. Die teuersten Sachen hingen immer in Augenhöhe der Erwachsenen. Für ihn bedeutete das aber enorme Anstrengungen. Sein Kumpel stand nun mehrere Meter von ihrem Gitterwagen entfernt, als Alexej den Verpackungskaron dort herein legte. Wortlos verschwand er wieder. Wenn die Luft rein war, würde der andere ihm mit dem Wagen folgen. Der Einkaufszettel in seinem Kopf sagte ihm, für den Klingeltransformator musste er in die Elektroabteilung wechseln.
Die Masche mit der Ablenkung war immer noch erfolgreich. Während sich sein Kumpel für den Kauf einer lektrischen Zahnbürste beraten ließ, packte Alexej die Elektronik ein, die außerhalb der Sichtweise der Verkäuferin auf ihn wartete. Diese Verkäufer standen meist auf verlorenem Posten. Wegen des Personalmangels gab es in jeder Abteilung nur eine Arbeitskraft. Wenn überhaupt. Häufig noch nicht einmal das.
Das Herausschaffen der Diebesbeute war ebenfalls gut organisiert. War das Diebesgut klein, dann beließ man es in der eigenen Tasche, und schloß sich einem Erwachsenen, oder einem solchen mit Kind an. Da dieser alles bezahlte, was sich in seinem vollen Einkaufswagen befand, kam nie Argwohn auf, wenn er als Kind unbezahlte Waren mit sich führte. Oder man steckte einem Erwachsenen, der zu ihnen gehörte, unbemerkt Beute zu. Da dieser nie stahl, oder solche Anstalten machte, erregte er bei den Detektiven auch nie Verdacht. Alexejs Kumpel zahlte an der Kasse einen kleinen Betrag, was ihn unauffällig erscheinen ließ. Hatte man den Kassenbereich verlassen, war alles weitere ein Kinderspiel. In hinteren Bereich des Parkplatzes parkte ihr Transporter, der gleichzeitig als Zwischenlager diente.
Alexej war in eine andere Abteilung gewechselt und sah sich nach Sachen um, die noch auf seiner Liste standen. Weil ihm die Beobachtung der Umgebung zur zweiten Natur geworden war, bemerkte er das Mädchen sofort. Nachdem er sie eine Weile beobachtet hatte, lag es für ihn klar auf der Hand. Diese Kleine arbeitete in der selben Branche, wie er selbst. Sie konnte aber noch nicht lange im Geschäft sein, denn viele ihrer Handgriffe waren ungelenk und nicht optimal aufeinander abgestimmt. Weil er alle Mitglieder seiner Gruppe gut kannte, musste die Kleine zur Konkurrenz gehören. Der Beobachtungskreis, den er um das Mädchen zog, war nicht zu weit und nicht zu nah. So, wie das Mädchen aussah, konnte es sich nur um eine Türkin handeln. Die türkische Konkurrenz hatte sich in letzter Zeit ausgeweitet. Mehrfach hatte sein Brigadier auf diese Gefahr hingewiesen. Es waren nicht die gestolenen Sachen, welche die Nebenbuhler erbeuteten. Davon war überreichlich vorhanden. Nein es war ihre mangelnde Professionalität. Sie erregte Argwohn, und Argwohn erzeugte die Aufmerksamkeit der Warenhausdetektive. Und das betraf dann direkt auch seine Gruppe. Alexej konnte nicht sagen, wie oft Olaf, sein Brigiader, sie auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht hatte. Alexej hatte stets geglaubt, Olaf wollte sich interessant machen. Nun war er selbst Zeuge dieser Gefahr geworden.
Alexej eilte an die Kasse. Nervös suchte er eine Möglichkeit, sich nach draußen schleusen zu lassen. Die Frau mit dem Kinderwagen schien alle Zeit der Welt zu haben. An dem Regal für den Kauf letzter Möglichkeiten, wo sogenannte Greifware angeboten wurde, blieb sie unschlüssig stehen und verglich umständlich Waren und Preise. Aus dem Kinderwagen drang der Geruch von Urin, was die Frau nicht störte. Alexej vergrößerte den Abstand zum fahrbaren Kinderbett. Die nächste Station dieser Kundin waren Kassenwaren. Die Mutter überlegte, ob sie das Überraschungs-Ei in die ausgestreckten Arme des Kindes, oder auf das Transportband legen sollte. Alexel fluchte auf russisch. Endlich landete das Schoko-Ei auf dem Band. Das Auspacken der Waren und das Bezahlen zerrte ebenfalls an den Nerven des Jungen. Als beim Einpacken eine Konservendose auf dem Boden fiel, hob er sie auf. Dankbar nahm die Frau die Ware entgegen. Mit einem Lächeln bedankte sie sich bei Alexej. Für die Bedienung war damit klar, Junge und Frau gehörten zusammen. Schnell steuerte die Tarnmutter auf einen Zeitungskiosk zu. Beim Blättern in Zeitschriften löste sich Alexej von seiner Passagiermöglichkeit. So schnell er konnte, lief er zu seinem Fahrzeug.
„Brigadiere, Brigadiere! Ich habe sie gesehen.“ Der Junge bekam vor Atemnot seinen Satz nur stoßweise heraus.
„Was hast du gesehen?“ Olaf zog unwillig die Stirne kraus.
„Die, von denen Sie gesprochen haben. Die Türken.“
„Hier im Mercado?“
Alexej nickte wie ein Jojo.
„Dann wollen wir uns die Schweine mal anschauen.“
Er quälte sich aus dem Fahrersitz. Alexej, der schon viele Meter vorausgeeilt war, holte er nicht mehr ein. Unter dem überdachten Vorraum des Eingangs vom Mercado warteten sie. Auf hüfthohen Packtischen verstauten einige der Kunden ihre gekauften Sachen. Sie schoben den Einkaufswagen in die Schlange der leeren Wagen und entnahmen der Verriegelung ihre Münze. Die kleine Türkin erschien nicht. Eine Imbisstube und ein Backwarenstand fanden ebenfalls Kunden. Wenn man schon einmal hier war...
Olafs Unmut war offensichtlich. Sichtbar spielte er mit dem Gedanken, dieser Verarsche mit einem Schlag auf den Kopf zu ahnden. Da zeigte Alexej auf ein Mädchen im braunen Mantel.
„Die da. Die ist es.“
„Geh´ zum Auto und warte dort.“ Dieser Befehl ließ keinen Widerspruch zu.
Ohne darauf zu achten, ob man seiner Anweisung folgte, schlenderte der Brigadier hinter der Kleinen im braunen Mantel her. Das Mädchen überquerte den Teil der Parkfläche, der dicht mit Autos besetzt war. Die Kunden suchten halt immer den kurzen Weg zum Eingang. Auf der wenig benutzten Fläche dahinter stand ein Ford-Transporter, betagt und mit vielen Roststellen übersät. Wie Olaf vermutet hatte steuerte die Kleine direkt darauf zu. Olaf, der Brigardier, lächelte hinterlistig. Die Türken verfolgten also die gleiche Strategie, wie er selbst.
Die Kleine öffnete die seitliche Schiebetüre. Ohne sich umzuschauen, verschwand sie darin. Sie hatte also keinen Argwohl geschöpft. Olaf wusste, im Moment waren alle im Innern des Wagen damit beschäftigt, die neue Ware zu verstauen. Auch der Fahrer des Transporters schaute nach hinten in den Laderaum. Der Brigadier schätzte, dass dieser auch der Chef der türkischen Truppe sein musste. Er nutzte den toten Blickwinkel, als er sich der Fahrertüre näherte. Das Überraschungsmoment war ganz auf seiner Seite, und er hatte vor, dieses zu nutzen. Er riß die Fahrertüre auf, fasste den Mann an der Schulter und riß ihn aus dem Wagen. Kopfüber fiel der Körper auf den Asphalt. Die Schuhspitze traf den Hals des am Boden Liegenden. Reflexhaft wollte der Türke seinen Kopf schützen, da trafen weitere Tritte seinen Kopf. Der Brigadier hörte ein dumpfes Geräusch, als er erneut zutrat. Dennoch hörte er nicht auf. Er zog den schon wehrlosen Körper nach oben, um sein rechtes Knie in den Schritt und den Magen des anderen zu rammen. Rinnsale von Blut traten aus Mund und Nase hervor. Olaf störte das nicht im geringsten. Mit gezielten Handkantenschlägen brach er beide Schlüsselbeine. Diese Arme würden keinen mehr angreifen können. Olaf ließ den Körper des Türken los. Wie ein abgelegtes Kissen sank dieser in sich zusammen. Olaf drückte den fast Besinnungslosen mit dem Fuß an die Karosserie. Die Augen des Zusammengeschlagenen begannen sich zu schließen. Die Pupillen waren hinter dem Unterlid verschwunden. Olaf sah nur das Weiße der Augen. Aber das störte ihn nicht.
„Du, Arsch, wilderst in meinem Revier. Mach dich und deine Truppe vom Acker. Beim nächsten Mal kommst du nicht so glimflich davon. Hast du mich verstanden?“
Der Körper zeigte keine Reaktion. Wieder landete das Knie an den Kopf des anderen. Nur ein Zucken bewegte die Lippen. Olaf interessierte nicht was sie sagten. Er wuchtete den Halbtoten auf den Fahrersitz, zog den Schlüssel ab, und knallte die Wagentüre zu.
Kurz darauf parkte er seinen Transporter rechts neben dem türkischen Fahrzeug. Barsch zog er die Seitentüre des türkischen Transporters auf. Die ängstlichen Augen von zwei Mädchen und einen älteren Jugen schauten ihn an.
„Verschwindet!“
Sprache und Gestik waren so aggressiv, dass die drei sofort die Flucht ergriffen. Er drehte sich zu seinem Fahrzeug um.
„Umladen!“
Die vier Kinder seiner Truppe gehochten ohne zu fragen. Nach zehm Minuten war die Ladefläche des anderen Transporters geräumt. Zum erstenmal bei diesem Zwischenfall grinste Olaf.
„Da haben wir heute aber eine tolle Unterstützung gehabt.“
Ängstlich nickten die Kinder.
Ihre Erwartung wurde enttäuscht. Statt in ihren Wagen zu steigen, ging der Brigadere zur linken Türe des anderen Gefährts zurück. Das Öffnen der Fahrertüre zeigte bei dem zusammengesunkenen Mann keine Reaktion. Olaf drehte den Kopf des Mißhandelten zu sich.
„Das ist mein Revier. Und damit du das begreifst und niemals vergisst...“
Mit der Faust schlug er mit aller Kraft in das Gesicht des Wehrlosen. Der Hieb war so kraftvoll, dass sich die Schneidezähne endgültig aus dem Oberkiefer lösten. Er warf die Wagenschlüssel in den Fußraum der Fahrerseite. Dann knallte er die Türe zu.
Montag, 30. August
Der schwarze Audi A 6 war auf der Suche nach einem Abstellplatz. Obwohl es noch keine acht Uhr war, zeigte sich die Parkplatzsuche auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Duisburg als beschwerlich. Dies war eigentlich ungewöhnlich, aber nun nicht zu vermeiden. Bei Mikael Knoop änderte dies nichts an seiner guten Laune. Er hatte drei Wochen Urlaub in Zentralspanien hinter sich. Bei dem Gedanken daran entstand vor seinen Augen das Bild einer spanischen Landschaft. Er fühlte die Wärme auf der Haut, die verschwand, als er die Augen öffnete. Dort würde er noch einmal einen weiteren Urlaub verbringen. Er blinzelte, und der Erinnerungsfilm riss ab. Ach, da war ja schon ein freier Fleck. Das Wetter in Duisburg war um ettliche Grade kälter, aber die Sonne über Duisburg hatte jede Menge Platz. Knoop überlegte, ob er die Sonnenbrille brauchen würde. Er ließ sie im Handschuhfach zurück.
Nach dieser Phase der Untätigkeit freute er sich wieder auf das was ihn heute erwartete. Er wusste nicht was das war. Aber komisch war nur, dass van Gelderen ihn per Mail vor Dienstantritt zu einem Gespräch gebeten hatte. Van Gelderen war sein Chef und Leiter des KK 1, wie das Kriminalkommissariat für Kapitalverbrechen abgekürzt wurde. Eigentlich war ein solcher Einstand nach einem Urlaub bislang nicht üblich gewesen, aber alles Neue macht der Mai. Nichts, was seine gute Laune verderben konnte.
Mikael Knoop war Jahrgang 1963. Er liebte den Sport, vor allem das Volleyballspielen. Und so überraschte seine sportliche Figur nicht. Sein dunkles, krauses Haar begann sich merklich zu melieren. Er schloss den Reißverschluss seiner grünen Lederjacke, weil die morgendlichen Temperaturen begannen den nahenden Herbst anzukündigen. Knoop schaute nach oben. Keine geschlossene Wolkendrecke trennte Duisburg von der Sonne. Es sah so aus, als würde der heutige Tag ein sonniger werden. Da, wo er herkam, war es bestimmt fünfzehn Grad wärmer.
Im Vorzimmer der Kommissariatsleitung schaute Barbara Hallfels kurz nach oben. Sie hatte den Kopfhörer ihres Diktiergeräts an den Ohren. „Er erwartet sie schon!“ Dann begannen ihre Finger wieder auf der Tastatur zu tanzen.
Obwohl er bereits erwartet wurde, klopfte Knoop an der kunststoffbeschichteten Holztüre. Nach einigen Sekunden Wartezeit trat er ein, weil man von außen selten hören konnte, wenn drinnen jemand etwas sagte. In seinen drei Wochen Abwesenheit hatte sich hier nichts verändert. Sein Chef saß an einem Schreibtisch, der im hinteren Ende des Raumes stand. Die Platte war mit Akten, Ablagekörben, Kopierer und Asservaten angehäuft. Neben dem Tisch an der linken Raumseite stand ein Schrank, der eher Wohnzimmer- denn Arbeitscharakter versprühte. Man könnte den Eindruck haben, hier auf die Erbschaft der Großmutter des Chefs zu schauen. Das wiederholende Merkmal in der Front des Schrankes waren die schnörkligen Holzelemente, die überall befestigt waren. Die überreichlichen Fenster der Schrankfront waren aus dunklem Glas. So konnte der Besucher nicht erkennen, was dahinter verborgen war. Vor all diesen Möbeln stand ein weiterer überdimensionaler Schreibtisch. Ein Augenfang. Die Stärke der Tischplatte und die Dimension der Füße waren ein sicheres Anzeichen für die Montierbarkeit des Möbels. Zusammengebaut bekäme man einen solchen Tisch sonst wohl nicht durch eine normale Zimmertüre. Auch die Segmente des anderen Mobiliars waren gewaltig. Um sie zu bewegen, brauchte man mehrere starke Männer. Im Kontrast zu seiner Größe befanden sich auf dieser Tischplatte nur wenige Gegenstände. Eine Telefonanlage, eine Schreibunterlage und eine Blumenvase, in die wöchentlich eine neue Pflanze gesteckt wurde, waren alles. Im rechten Teil des Raumes befand sich eine Sitzecke. Sie bestand aus einem Beistelltisch und vier Stühlen. Hier war sofort klar, wer wo saß. Ein wuchtiger mit Leder gepolsterter Lehnstuhl und drei ungepolsterte einfache Stühle ohne Lehne und Sitzpolster standen um einen niedrigen Holztisch herum.
Die Sehhilfe landete auf den Unterlagen. Van Gelderen erhob sich, und begrüßte seinen Gast. „Sind Sie gut erholt?“
Knoop zögerte etwas mit seiner Antwort. Auf diese Weise war er noch nie von seinem Chef begrüßt worden. „Doch, doch, es war sehr schön.“
„Das ist gut, denn wir brauchen Ihre ganze Energie.“ Der Chef ging auf die Sitzgruppe zu. Während er sich in den gepolsterten Lehnstuhl setzte, machte er eine einladende Handbewegung. „Ich muss es kurz machen. Ich muss in zehn Minuten zu einer Besprechung. Sie wissen von der Sache Dom Pellegrino?“
„Sie meinen das Restaurant in Homberg?“ Knoop unterdrückte den folgenden Gedanken. Wollen Sie mich zum Essen dort einladen? Nein, das passte nicht hierher.
„Richtig! Haben Sie gehört, was da vorgefallen ist?“
Knoop schüttelte den Kopf. „Ich habe in den drei Wochen weder ferngesehen, noch die Tageszeitung gelesen. Nicht, weil ich es nicht wollte, allein, weil ich nur zwanzig spanische Worte beherrsche. Wir sind gestern erst zurückgekehrt.“ Knoop zog bedauernd seine Achseln hoch. „Habe ich was versäumt?“
„Das kann man wohl sagen. Im Dom Pellegrino ist am Donnerstag eine Bombe explodiert. Wie es aussieht eine Fehde unter Mafioso. Das ist auch der Grund, warum ich gleich zur Besprechung muss.“ Van Gelderen schaute kurz auf seine Armbanduhr. „Ich muss diese Ermittlungen leiten. Deshalb kann ich mich um die Ermittlung ′Kopf′ nicht kümmern. Sie sollen das übernehmen.“ Er ging zu seinem hinteren Schreibtisch und kehrte mit einer Mappe zurück. „Hierin steht alles drin, was Sie im Moment wissen müssen. Nur so viel. Im Rhein bei Ruhrort ist ein Kopf angelandet. Wir haben immer noch keine Identifizierung. Vielleicht ein Türke, jedenfalls einer, der mit Rauschgift zu tun hat.
„Dann ist der Fall so gut wie gelöst.“ Mikael grinste. „Es ist ein Schiffer. Hier müssen wir suchen.“
„Woher...äh...wissen...äh Sie?
Mikael Knoop hatte seinen Chef noch nie so stottern sehen. Sein Gesicht wurde ernst.
„In Ruhrort hat es schon einmal einen solchen Fund gegeben. Allerdings der Kopf einer weiblichen Leiche. Ich erinnere mich noch so daran, weil mich diese Sache für die Kriminalistik früh begeistert hat. Mein Vater erzählte mir immer von diesem Kriminalfall. Ich weiß auch noch wer der ermittelnde Leiter der MK war: Woltersdorf. Woltersdorf war ein Schulkamerad meines Vaters. Der hatte, das muss so fünfzig bis sechzig Jahre her sein, ermittelt, dass nur ein Schiffer der Mörder sein konnte. Dieser hatte, wie sich im nachhinein herausstellte, eines der leichten Mädchen zu sich in die Bugwohnung geholt. Hier wohnte er allein. Im Streit um den Dirnenlohn hatte er die Prostituierte getötet. Er glaubte den perfekten Mord gemacht zu haben. Er zerstückelte die Leiche, und warf die Teile bei seiner Fahrt über den Rhein nach und nach über Bord. So verstreute er sie über den Rhein von Rotterdamm bis Straßburg. Alles sollte man finden, nur den Kopf nicht. Dieser tauchte aber als erster auf. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein spülte ihn schließlich frei. Er brachte die Ermittler letzendlich auf die Spur des Täters.“
„Interessante Sache. Muss aber vor meiner Zeit bei der Kripo gewesen sein. Aber suchen Sie ruhig meinetwegen in der Schifffahrt nach dem Täter. So, ich muss weg. Sollten Sie weitere Fragen haben...“ Er erhob sich.
„...werde ich Sie ansprechen. Das ist doch klar.“
Van Gelderen nickte. „Ach so. Ich habe da noch einen Punkt.“ Er setzte sich wieder. „Das ist aber der Punkt, weshalb ich unbedingt vorher mit ihnen sprechen muss. Wir haben seit zehn Tagen eine neue Kollegin. Pralewski heißt sie, Oberkommissarin Wibke Pralewski. Und hier muss ich Sie vorwarnen. Sie hat engen Kontakt zur GeiB.“
Mikael runzelte die Stirne. „Weib? Ich versteh´ nicht.“
„Nein, GeiB.“
„Geib, wer oder was ist Geib?“
„GeiB ist das Kürzel für Gleichstellungsbeauftragte.“ Van Gelderen machte ein Gesicht als habe er in eine Grapefruit gebissen.
Mikael zog seine Augenbrauen hoch. Es war in der Abteilung bekannt, dass Albino, wie man den Chef wegen seiner weißen Haare hinter seinem Rücken nannte, von Frauen in der Kriminalistik wenig hielt. Man munkelte, van Gelderen sprach ihnen kriminalistische Intuition ab. Öffentlich geäußert hatte er sich darüber nie. Das war auch nicht sinnvoll, weil Rosemarie Stendal, die Gleichstellungsbeauftragte, seit Kurzem immer mit am Tisch saß, wenn van Gelderen Personalentscheidungen treffen musste. Und Personalentscheidungen gingen Frauen immer etwas an. Es war bekannt, dass die Stendal Haare auf den Zähnen haben sollte.
Der Chef fuhr inzwischen fort. „Sie ist eine Suffragette. Eine von der schlimmsten Sorte.“
„Eine was?“ Knoop konnte diese Frage nicht zurückhalten. Zu spontan reagierte Mund vor Gehirn.
„So eine militante Frauenrechtlerin. Schon am zweiten Tag, als sie hier war, hat sie dafür gesorgt, das HK Blassfeld eine Abmahnung bekam, weil er einen Blondinen-Witz vor einer Besprechung erzählte. Durch Zufall hatte die Pralewski das wohl gehört. Nun weigert sich Blassfeld mit der zusammen zu arbeiten. Ich habe dann aus ihrer Akte in Erfahrung gebracht, dass dies nicht ihr einziger Fall war. Ich glaube, sie beschäftigt unsere Frauenbeauftragte des Öffteren. Ich bitte Sie, gehen Sie vorsichtig an die Sache ran.“
Mit gemischten Gefühlen begab sich Mikael Knoop zu seinem Arbeitszimmer. Er kannte die neue Kollegin noch nicht. Sie musste während seines Urlaubs den Dienst angetreten haben. Das Türschild war schon ausgewechselt. Richtig. Pralewski hieß mit Vornamen Wibke und war Oberkommissarin. Er zögerte, ob er klopfen sollte. Dann straffte sich sein Körper. Es war schließlich sein Zimmer. Er drückte die Klinke herunter. Im Raum war keiner, aber er war anders eingerichtet. Ein leichter Fliederdurft verbreitete sich im Raum. Auf der Fensterbank thronte eine Grünlilie. Jedesmal, wenn man das Fenster öffnen wollte, würde man sie beiseite tragen müssen. Knoops Mundwinkel zuckten. An der Wand neben dem Fenster hing der Druck eines Impressionisten, der seine Albträume darauf zum Ausdruck gebracht haben musste. Anders konnte sich Mikael den Sinn des Bildes nicht erklären. In einer hohen Bodenvase standen ein Arrangement von Rohrkolben, Ginster und Fichtenzweigen. Gottseidank war alles aus Plastik, was bedeutete, man musste sie nicht gießen. Sie würden von allein zustauben. Sein prüfender Blick wanderte weiter. Die zwei einfachen Kleiderhaken waren durch einen modischen Ständer ausgetauscht worden. Das giftgrüne Plastikgeweih bot Platz für große Garderobe. Im Moment suchte ein hellroter Ledermantel nach Begleitung. Knoop hing seine grüne Lederjacke ihm gegenüber. Knoop atmete erleichtert durch. Auf seinem Schreibtisch war alles so, wie er es vor dem Urlaub hinterlassen hatte. Nur ein paar schmale Akten hatte jemand dazu gelegt. Sein Blick sprang zu dem anderen Schreibtisch herüber. Pralewski schien im Gegensatz zu ihm mehr Wert auf Ordnung zu legen. Die Stapel von Akten waren säuberlich geschichtet, die Büroutensilien befanden sich in einer großen Ablagebox. Ein aufgeschlagener, aber ungebrauchter Schreibblock lag neben einer Schreibunterlage, an deren Rand eine Reihe von Merkzetteln geklebt waren. Auch der Monitor sah durch die vielfarbigen Postits wie ein Weihnachtsbaum aus.
Knoop setzte sich in seinen Drehstuhl, wippte ein paar mal in der Luftfederung, bevor er die Beine auf eine freie Stelle seines Schreibtischs legte. Er öffnete die Mappe, die van Gelderen ihm gegeben hatte, und begann den Inhalt zur Kenntnis zu nehmen. Im Rhein bei Ruhrort hatte man einen einzelnen menschlichen Kopf gefunden. Der Kopf gehörte einem Mann, dessen Name noch nicht feststand. Er war noch nicht ermittelt worden. Die Mordkommission hatte alle Dateien abgesucht, war aber bei der dürftigen Informationslage nicht weiter gekommen. Keiner schien den Toten zu vermissen. Man hatte die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Die Presse hatte mehrere Tage darüber berichtet. Es gab fast einhundertdreißig Rückmeldungen aus der Bevölkerung, aber keine von denen war brauchbar gewesen und hatte die Ermittlungen weiter voran gebracht.
Die Obduktion hatte eine Reihe interessanter Tatsachen geliefert. Es war ein Mann, so um die Dreißig. In den Haaren hatte man regelmäßigen Rauschgiftkonsum nachgewiesen. Van Gelderen hatte daraufhin die Ermittlung in diese Richtung gelenkt. Er hatte in der Fixerscene ermitteln lassen. Aber einen Treffer hatte er und seine Kollegen nicht landen können. Das war nicht verwunderlich, weil diese Scene für ihre Weigerung, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, bekannt war. Der einzige Lichtblick war die computerunterstützte Rekonstruktion des Opfers. In der Akte befand sich zumindest ein Bild des Toten. Ohne die DNA-Analyse heranziehen zu müssen, ordnete Knoop diesen Menschen dem vorderasiatischen Raum zu. Es gab aber auch eine Videodatei über den Toten. Die Annahmen bei der Bildgestaltung standen in einer langen Liste auf dem dunklen Streifen neben dem Phantombild. Hier konnte man im Programm noch Merkmale korrigieren, wenn man sie während der Ermittlung präzisieren konnte. Das Opfer stammte, so die mutmaßliche Analyse, aus Vorderasien. Knoop lächelte. So viel zu seiner Sachkenntnis. Die Gesichtszüge ließen, so die Expertise, auf einen Türken, Syrer oder Libanesen schließen. Die Augen standen eng, und die Muskeln der Augenpartie formten ein verkniffenes Gesicht. Der Tote war wohl kein angenehmer Zeitgenosse gewesen. Auf jeden Fall hatte er kein Allerweltsgesicht. Es musste also Leute geben, die sich an ihn erinnern konnten. Man müsste nur...
„Ach, der andere Kollege. Aus dem Urlaub zurück? Schön. Ich bin Ihre neue Zimmerkollegin.“
Vor Knoop stand eine für Frauen lange Gestalt, die ihm die Hand reichte. Der leichte Duft eines herben Parfüms drang zu ihm herüber. Ihre langen, blonden Haare waren zu einem Knoten verkürzt. Nun verstand Knoop die Andeutung mit den Blondinenwitzen. Eine beige Bluse gab einen Teil ihres Dekolletes frei. Ein ponchartiger Pullover baumelte über einer dunkelbraunen Hose. Sie sieht aber nicht aus, wie ein Möfchen, dachte Knoop. Er sprang auf und griff nach der dargebotenen Hand.
„Angenehm, Knoop. Auf gute Zusammenarbeit.“ Mikael schaute in ein Paar bernsteingelbe Pupillen.
Ein breites Lächeln erschien in den Gesichtszügen. Ein aufreizender Rosaton ließ ihre Lippen durchaus verführerisch erscheinen. „Auf mich soll es dabei nicht ankommen. Ich muss aber eines sofort klarstellen. Ich habe Probleme mit Männern. Nicht mit allen, und nicht so wie Sie denken. Aber bei solchen, die unbedingt den Macho herauskehren müssen, sehe ich Rot. Ich brauche diesen Schmus mit Komplimenten und dergleichen nicht. Ich will auch keine Sonderbehandlung als Frau. Unterlassen Sie jedenfalls allen Schmus. Und...“ Ein Zucken durchlief ihre Augenwinkel. „... ich sage es gleich. Ich bin lesbisch. Haben Sie ein Problem damit?“
Knoop schluckte. So barsch hatten noch kein neuer Kollege oder Leute aus seinem Bekanntenkreis die Fronten abgesteckt. Er stammelte ein „Nein! Nein!“ und ärgerte sich sogleich über seine Ungeschicklichkeit. Er musste das Thema wechseln. Er griff nach der Mappe, die er gerade studiert hatte und setzte sich hin.
„Sie sind ja schon länger mit der Ermittlung vertraut. Sie können...“
„Ich habe das Leichenteil als Erste in Augenschein genommen“, unterbrach Pralewski Knoops Redefluss.
„Das ist gut“, fuhr Knoop fort. „Gibt es da Sachen, die nicht in dieser Mappe stehen?“ Er hob dabei den Aktendeckel hoch.
Wibke Pralewski war auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Sie drehte sich so schnell um, dass Mikael glaubte, sie würde wie in einem Western jetzt die Pistole ziehen. „Ich verstehe nicht, was Sie meinen.“
„Kommen Sie“, brummte Knoop, „Sie sind lange genug im Geschäft. Es gibt Sachen für den Staatsanwalt und das Gericht. Das ist das Eine. Und dann gibt es noch das, was man sich niederzuschreiben erspart.“
Zwei bernsteingelbe Pupillen fixierten ihn. Sie überlegten den Hintergrund der Frage. Wollte man sie auf den Arm nehmen? „Ich weiß nicht, was Sie damit meinen.“
„Kommen Sie!“ Mikael grinste. „Man macht doch unverbindliche Bemerkungen oder trifft Abschätzungen, die nur mündlich geäußert werden. Weil man sich nicht sicher ist. Kommen Sie, nennen wir es Vermutungen.“
Pralewski hatte sich inzwischen hingesetzt. Sie griff nach einem Kugelschreiber und betätigte mehrmals den Klickverschluss. „Wissen Sie, van Gelderen ist kein Mensch, der sich mit anderen austauscht.“
Knoop leuchtete das ein. So kannte er van Gelderen. Er diskutierte keine Ergebnisse, sondern teilte seine Schlussfolgerungen einfach mit. Sei´s drum. Er würde schon mit der Zeit dahinter kommen. „Ok, vergessen wir das. Ich habe noch nicht alles lesen können.“ Er hielt wiederum die Akte hoch. „Sie sind ja über alles bestens informiert. Bislang habe ich nichts über den Restkörper gefunden. Ist der inzwischen aufgetaucht?“
Pralewskis Gesicht entspannte sich. „Nein, dann wären wir auch einen Schritt weiter.“
„Schade“, kommentierte Knoop die Neuigkeit. „Wann trifft sich die MK?“
Sein Gegenüber schreckte hoch. „Da sagen Sie etwas.“ Sie schaute auf ihre Uhr. „Die warten schon seit fünf Minuten auf uns.
Der Besprechungsraum hatte die Form eines Schlauches. Eine lange Seite war nur Fensterfront. Man konnte auf ein paar Pappeln schauen, welche die Sicht auf das Nachbargebäude eingrünten. In der Luft hing ein leichter Tabakgeruch. Sofort brachen die Gespräche ab, als Pralewski und Knoop eintraten. Eine eigenartige Stimmung machte sich breit, die Knoop auch durch ein freudiges „Guten Morgen!“ nicht aus der Welt schaffen konnte. Man wartete ab, welche neuen Entwicklungen man ihnen mitteilen würde. Knoop teilte der Gruppe mit, dass man ihn mit der Leitung der Ermittlung im Fall ′Kopf′ beauftragt hatte. Er brauche aber einige Tage, um den Kenntnisstand aufzuarbeiten, den alle Anwesenden bereits hatten. In der Reihenfolge, wie seine Kollegen saßen, bat er um einen kurzen Bericht.
Walter Weber war ein, um ihn auf den ersten Blick zu beurteilen, Gemütsmensch, der seine Herkunft aus dem östlichen Ruhrgebiet nicht verleugnen konnte. Er bewegte sich wenig und hatte deshalb einen Bauch vor sich herzutragen. Er war der Raucher. Weber machte daraus keinen Hehl. Obwohl das Rauchen im Gebäude strikt verboten war, hielten sich viele Nikotiner, wie er, nicht an dieses Verbot. Die Kollegen tolerierten dies. Teils, weil sie das Rauchen nicht störte, teils, weil ihnen das Verbot egal war. Weber war der für die Technik Verantwortliche. Nachdem er einige Worte ausgesprochen hatte hustete er sich erst einmal die Lunge frei. Während seiner Ausführungen zog er mehrfach an seiner Zigarrette, stieß den Rauch aber so dezent aus, das er keinen damit belästigte. Er bedauerte, fast keine Informationen zu haben. Seine Messpunkte, die für die Telefonüberwachung nötig waren, waren zu ungenau, um genauere Kenntnisse zu präsentieren. Er hatte einige Sendezentren um den Fundort ins Visir genommen, kannte die Verbindungen, die darüber gelaufen waren. Aber etwas stichfestes konnte er leider noch nicht vorführen, weil die Namenlosigkeit des Toten eine Zuordnung zu anderen Gesprächsteilnehmern erschwerte. Aber er versicherte, am Ball bleiben zu wollen. Er würde also im Moment nur für den Papierkorb arbeiten.
Gundula Krebs hatte Kontakt zum ′Amt für Hydrografie und fließende Gewässer′ in Düsseldorf aufgenommen. Mit dem was Gundula ihnen mitteilen konnte, könnte der Körper zwischen Oberkassel und Königswinter in den Rhein gelangt sein. Aber dies war auch nur eine vage Annahme. Zu viele Faktoren waren unbekannt. Die Kollegen von Bonn waren eingeschaltet worden, konnten aber bislang keine Resultate liefern. Es konnte aber auch sein, so eine andere Variante, dass der Kopf alleine auch an dieser Stelle oder in der Nähe in den Fluss geworfen worden war. Seine geringe Masse würde, so die Hydroexperten, kaum weggetrieben, wenn er sich irgendwo im seichten Wasser des Rheinufers zum Beispiel im Außenradius einer Rheinbiegung verhakt hatte. „Noch ist alles drin“, beendete sie ihren Beitrag.
„Wer“, wollte Knoop wissen, „hält den Kontakt zu Bonn?“
Ein Mann, Anfang Vierzig erhob sich. Eine Nerdbrille verbarg wieselflinke Augen. Ein Schnauzer in Form eines Walrosses zierte seine Lippe. Es war Jürgen Trolpsch, der eigentlich auf Wirtschaftsfragen spezialisiert war. Weil die Identität des Toten noch nicht bekannt war, er also quasi arbeitslos war, hatte van Gelderen ihm diese Aufgabe zugewiesen. Er berichtete, wie erstaunlich gut die Zusammenarbeit mit den Bonner Kollegen lief. Obwohl sie auch dort unter Personalknappheit litten, hatte man dort extra einen Kollegen für die MK ′Kopf′ abgestellt. Man hatte jede Menge Einwohner aus dem Teil Asiens in der Bonner Bevölkerung, aus dem der Toten zu kommen schien. Aber es gab in ihrem Bereich keinerlei Hinweise auf einen Vermissten. Man hatte sogar den informellen Bereich der islamischen Rechtsprechung beschritten. Nicht jede Straftat unter anatolischen Bewohnern wurde den deutschen Behörden gemeldet. Auch in Bonn gab es eine ausgeprägte Parallelgesellschaft, die Vergehen nach islamischem Recht ahndete. Es kam zwar selten vor, aber auch Morde wurden quasi unter der Hand deutscher Gerichte und Strafverfolgungsorgane verhandelt und entschieden. So gesprächig, wie sich Streitende vor dem Iman gaben, um so schweigsamer verhielt man sich gegenüber deutschen Dienststellen. Aber auch hier fanden die Informanten keinerlei Gerüchte, geschweige denn Hinweise auf den Toten. Mit einem bedauerlichen Schulterzucken fuhr Trolpsch sich über seinen Bart, dann lehnte er sich in seinen Stuhl zurück.
„Wir sollten Bonn nicht sofort aus unserem Blickfeld nehmen. Jürgen, ich möchte dich bitten bei deinen Ermittlungen weiter zu machen.“
Der Mann mit dem Walrossbart nickte.