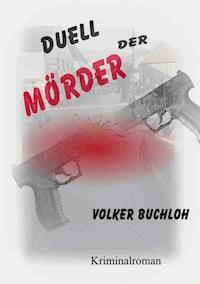
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
In Schermbeck (Niederrhein) wird die Leiche einer dunkelhäutigen Frau aufgefunden. Der Körper ist oberflächlich entsorgt worden, Die Enträtselung des Mordfalls erscheint einfach, weil sich die Asylbewerberin prostituierte, und einige Freier durchaus ein Motiv haben. Dem ermittelnden Kommissar Mikael Knoop wird eine Kollegin vor die Nase gesetzt. Diese glaubt an eine schnelle Beförderung. Je tiefer sich die Ermittlungen indes gestalten, um so langwieriger erweist sich der Ermittlungsweg. Immer deutlicher tritt nämlich ein anderes Mordmotiv in den Vordergrund. Der internationale Waffenhandel scheint auch von Schermbeck aus gesteuert zu werden. Als der Auftraggeber des Mordes bekannt ist, wird dieser ermordet. Schnell stellt Mikael Knoop fest, es muss einen weiteren Mörder geben. Während die Polizei nun gleichzeitig gegen zwei Verdächtige ermitteln muss, haben auch die beiden Mörder ein gemeinsames Problem miteinander. Sie können es nur lösen, wie sie gelernt haben Probleme zu lösen: Durch Mord.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis 1
Das Buch 3
Der Autor 4
Duell der Mörder 6
Brazzaville, Kongo, 30. April 6
Schermbeck, 2. Mai 13
Schermbeck, 10. Mai 15
Weilburg an der Lahn, 10. Mai 19
Schermbeck, 11. Mai 26
Duisburg Dellviertel, 11. Mai 43
Duisburg Röttgersbach, 11. Mai 50
Duisburg Wedau, 12. Mai 54
Duisburg Wedau, 12. Mai 58
Indischer Ozean, 4. Mai 64
Schermbeck, 12. Mai 74
Duisburg Dellviertel, 13. Mai 91
Schermbeck, 13. Mai 95
Duisburg Dellviertel, 14. Mai 108
Schermbeck, 14. Mai 110
Duisburg Dellviertel, 14 Mai 115
Schermbeck, 14. Mai 126
Duisburg Röttgersbach, 14. Mai 131
Schermbeck, 15. Mai 134
Duisburg Dellviertel, 17. Mai 145
Duisburg Dellviertel, 19. Mai 149
Duisburg Dellviertel, 20. Mai 155
Schermbeck, 20. Mai 159
Duisburg Dellviertel, 21. Mai 165
Schermbeck, 22. Mai 167
Nairobi, 22. Mai 172
Ratingen, 23. Mai 190
Gladbeck, 23. Mai 196
Meru – Wajir, 24. Mai 200
Pakistan, Khaiberpass, 24. Mai 215
Wajir – Buta, 25. Mai 222
Schermbeck, 25. Mai 244
Buta – Meru, 26. Mai 249
Duisburg Röttgersbach, 28. Mai 253
Duisburg Dellviertel, 29. Mai 255
Duisburg Röttgersbach, 29. Mai 261
Schermbeck, 1. Juni 265
Potsdam Babelsberg, 1. Juni 276
Duisburg Dellviertel, 1. Juni 281
Duisburg Röttgersbach, 2. Juni 288
Duisburg Dellviertel, 3. Juni 292
Duisburg Orsoy, den 4. Juni 297
Duisburg Dellviertel, 5. Juni 303
Duisburg Dellviertel, 6. Juni 306
Schermbeck, 6. Juni 308
Duisburg Dellviertel, 7. Juni 312
Schermbeck, 7. Juni 314
Duisburg Dellviertel, 7. Juni 319
Düsseldorf Stadtmitte, 8. Juni 321
Duisburg Dellviertel, 9. Juni 324
Gladbeck, 9. Juni 328
Schermbeck, 10. Juni 331
Duisburg Dellviertel, 11. Juni 340
Ratingen, 11. Juni 343
Duisburg Dellviertel, 11. Juni 350
Ratingen, 11. Juni 353
Düsseldorf Kaiserswerth, 11. Juni 356
Duisburg Mitte, Kaiserswerth, 11. Juni 364
Duisburg Dellviertel, 12. Juni 370
Düsseldorf Kaiserswerth, 12. Juni 374
Breitscheid, 12. Juni 382
Ratingen Lintorf, 12. Juni 384
Duisburg Dellviertel, 12. Juni 390
Ratingen, 12. Juni 394
Duisburg Meiderich, 12. Juni 398
Duisburg Dellviertel, 13. Juni 412
Ratingen Hösel, 13. Juni 422
Duisburg Dellviertel, 13. und 14. Juni 432
Duisburg Neudorf, 14. Juni 438
Duisburg Dellviertel, 15. Juni 441
Duisburg Neumühl, 15. Juni 446
Duisburg Kasslerfeld, 15. Juni 449
Duisburg Dellviertel, 16. Juni 452
Ratingen, 17. Juni 455
Düsseldorf Lohausen, 17. Juni 458
Duisburg Dellviertel, 17. Juni 467
Duisburg Hamborn, 18. Juni 472
Duisburg Dellviertel, 18. Juni 475
Schermbeck, 18. Juni 477
Duisburg Dellviertel, 18. Juni 480
Schermbeck, 18. Juni 482
Duisburg Dellviertel, 29. Juli 491
Duisburg Dellviertel, 11. August 496
Anmerkung 498
Der Mann ohne Konturen 499
Der Flug des Fasans 500
Das Buch
In Schermbeck wird die Leiche einer dunkelhäutigen Frau aufgefunden. Der Körper ist oberflächlich entsorgt worden. Die Enträtselung des Mordfalls scheint einfach, weil die Frau sich prostituierte, und einige Freier durchaus ein Motiv haben. Dem ermittelnden Kommissar Mikael Knoop wird eine Kollegin vor die Nase gesetzt. Diese glaubt an einen schnellen Ermittlungserfolg und dadurch an eine schnelle Beförderung.
Der Autor
Volker Buchloh, Jahrgang 1947, hat neben dem Studium des Lehramts an beruflichen Schulen ein Diplom in Sozialwissenschaften erworben. Durch eine Schlosserlehre und zwei Studiengängen ist die Verbindung zwischen Theorie und Praxis geschlossen. Dabei besteht sein Interesse am Menschen im Vordergrund.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielgältigungen aller Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherungen und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Copyright
Impressum
© 2016 Volker Buchloh
Duell der Mörder
veröffentlicht als ebook über: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Veröffentlich als Buch: Eigenverlag
Homepage: www.buchloh-krimis.de
Printed in Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-****-***-*
Triologie
Duell der Mörder
Brazzaville, Kongo, 30. April
Die Bezeichnung 'De Broughler Avenue' war der Kolonialzeit geschuldet. Die Belgier hatten die Namensgebung der wichtigsten Straßen ihrer Kolonie selbst vorgenommen. Die Benennung war schon erfolgt, als der Kongo noch Privateigentum des Belgischen Königs war. Als diesem sein Besitztum zu kostspielig wurde – er musste mehr hineinstecken, als er herauspressen konnte - ließ er sich sein koloniales Eigentum vom Belgischen Staat abkaufen. So waren auch die Straßen in Brazzaville bei den belgischen Bezeichnungen geblieben. Als die Kongolesen 1964 in die Freiheit entlassen worden waren, hatten sich die Probleme im Lande überschlagen. So hatten die herrschenden Eliten keine Zeit gefunden, die Straßenbezeichnungen in einheimische Namen zu überführen. Viel wichtiger war damals die Sicherung und Verteilung der künftigen Staatseinnahmen durch die einheimische Oberschicht gewesen.
Besagte De Broughler Avenue zog sich parallel zur Avenue Central hin. Sie war asphaltiert, was sie als einen Hauptverbindungsweg auszeichnete. An ihr stand ein buntes Gemisch von Kolonialbauten, Steinhäusern, Stahlbetonskeletten und niedrigen Hochhäusern. Aber es gab auch freie Flächen, wo das Unkraut den fliegenden Müll eingefangen hatte.
Die Sonne strahlte aus wolkenlosem Himmel. Man hatte sich mit der Temperatur von über 30 Grad Celsius arrangiert. So war es eben. Wer kein schattiges Plätzchen fand, der eilte über Straße und Bürgersteig, um den Sonnenstrahlen zu entfliehen. Die Männer trugen Hosen. Die waren bei den älteren länger und bei den jüngeren kürzer. Wenn sie nicht mit nacktem Oberkörper herumliefen, dann trugen sie Buschhemden oder langärmlige Blousons. Die Frauen trugen Blusen und knöchellange Röcke. Ein abendländisch geschultes Auge vermisste eine Abstimmung von Mustern und Farben. Dabei verkannte es, dass gerade diese vielfältige Kombination von Farben und Mustern das Modische ausmachte. Für die Größe einer Metropole wie Brazzaville waren zu dieser Zeit wenige Fahrzeuge unterwegs. Es war Mittagszeit. Unter den Kraftfahrzeugen befanden sich weniger Pkws als Lastwagen. Unabhängig von der Außentemperatur musste man Geld verdienen, wenn man denn zu den Glücklichen gehörte, welche die Möglichkeit dazu hatten. Häufiger traf man auf die Lkws der Kleinen Leute - Fahrräder. Geschoben oder gefahren waren sie mit allem beladen, was man stapeln konnte. Kästen, Kisten, Behälter oder Ballen gehörten ebenso dazu, wie Bretter, Balken oder Rohre. Die Grenze der Beladung war nicht die Menge der Ladung, sondern die Festigkeit der Fahrradkonstruktion. Wer fortschrittlicher transportierte, der setzte Mopeds ein.
Vor einem unscheinbaren, vier Etagen umfassenden Ziegelsteinbau standen zwei uniformierte Männer im Schatten des Eingangs. Ihre einzige Aufgabe bestand darin, nur die Umgebung zu beobachten und den Zutritt zu kontrollieren. Suchte eine Person den Zugang zum Gebäude, wurde sie abgetastet und bei befriedigendem Ergebnis nach innen weitergereicht. Da dies recht selten geschah, war dies ein langweiliger Job, der bei dem hohen Stand der Sonne mehr eine Tortur war, denn eine Sicherungsaufgabe.
Die beiden Männer in einer fußknöchellangen Galabiya erregten keine Aufmerksamkeit. Sie passten ins Straßenbild. Ihr Abstand zueinander war abgestimmt, aber er erschien für den Betrachter zufällig. Sie waren nicht die einzigen, welche die Häuserfront der Firma Lambarde Traffic Ltd. passierten. Lambarde Traffic hatte als Geschäftsfeld internationalen Transport auf einem schmutzigen Messingschild angegeben. Als beide Männer so gleichzeitig an den Wachen vorbeischlenderten, verschafften zwei kleinkalibrige Pistolen dem Sicherheitspersonal ein schnelles Ende. Während die Mörder die Leichen einfach an der Hauswand ablegten, fuhren zwei schwarz lackierte Range Rover vor. Neun mit Kuffija vermummte Gestalten sprangen aus dem ersten Fahrzeug heraus. Während sie geräuschlos im Gebäude verschwanden, blieben einige Passanten stehen. Kommentarlos warteten sie auf weitere Ereignisse. Weil alles ruhig blieb, schüttelten sie nach einiger Zeit ihren Kopf, um ihre eigentlichen Tätigkeiten zur Sicherung ihres Lebensunterhaltens wieder aufzunehmen.
Im Innern des Gebäudes wurde das Sicherungspersonal von den Vorderen des Stoßtrupps durch Schläge mit den Gewehrschäften außer Gefecht gesetzt, während die Letzten den Ohnmächtigen jeweils zwei Kopfschüsse verpassten. Die Eindringlinge kannten sich aus, und sie hatten ein Konzept. Sie wussten, wo das Sekretariat war, wohin sie wollten. Während die ersten beiden sofort in das Zimmer des Chefs von Lambarde Traffic Ltd. durchstürmten, legten die nachfolgenden Söldner mit angelegten Kalaschnikows das Sekretariat lahm. Drei Frauen und ein junger Mann warfen sich sofort auf den Boden. Sie wollten schließlich überleben.
Das Büro war durchaus komfortabel eingerichtet. Ein Schreibtisch aus Ebenholz trug eine moderne Telefonanlage. Ein Flachbildschirm verriet, dass es irgendwo einen Computer geben musste. An der Wand hinter dem Schreibtisch hatte man das Fell eines Löwen gespannt, dem man den Kopf und die Krallen nicht entfernt hatte. Schräg vor dem Ebenholztisch stand eine übermannshohe Wurzel, aus der man Teile von Elefanten, Krokodil und Gepard geschnitzt hatte.
Immerhin schaffte es Abduhl Barnasadahleh, so der Name des Firmeninhabers, nach seiner Pistole in der Schreibtischschublade zu fischen. Nachdem er aber in den Lauf zweier Brownings blickte, gab er seine Verteidigung auf. Ohne Waffe zog er seine Hand aus der Schublade. Nachdem man seinen Ledersessel gegen die seitliche Wand unter einem Bild des Staatspräsidenten Secu Sese Secam gefahren hatte, griff einer der Kuffijaträger zum Mobiltelefon. Daraufhin verließ ein Mann im hellen Anzug westlichen Zuschnitts den zweiten Range Rover. Er war ein unscheinbar wirkender Weißer mit kurzgeschnittenen Haaren, die er linksgescheitelt trug. Seine Bewegungen verrieten Geschmeidigkeit.
Bei dieser Aktion lauteten seine Papiere auf den Namen Pierre Lacuste, Belgien. Lacuste hatte viele Ausweispapiere. Er fühlte sich in keiner Nationalität heimisch. Nur seinen Geburtsnamen gebrauchte er nie. Es waren keine Schutzgründe dafür ursächlich. Nein, er wollte nur nicht an seine Gebärerin erinnert werden. Außer Prügel und Hunger hatte er von dieser Nutte nichts geerbt. Seit er denken konnte, hatte diese 'Mutter' es darauf angelegt, dass er aus ihrem Leben verschwinden sollte. Als er es dann schließlich tat, befand er sich im Sumpf von Tirana. Alles, was er benötigte, musste er sich erkämpfen. Bald fand er heraus, wo man schnell an Geld kam: Drogen. Nachdem er anstelle eines Konkurrenten ein Geschäft auf eigene Rechnung gemacht hatte, setzte ihm dieser ein Messer an den Hals. Dass es nicht zum entscheidenden Schnitt kam, lag an einem Partner, der lieber mit Lacuste dealen wollte. Während dieser Partner den Angreifer nur in den Rücken trat, vollendete er, Lacuste, selbst das, wozu sein Gegner nicht den Mut dazu hatte. Er schnitt ihm die Kehle durch.
Mit angsterfüllten Augen starrte Abduhl Barnasadahleh den hereinkommenden Lacuste an. Er erinnerte an einen überdimensionalen dunkelhäutigen Schneemann. Barnasadahleh hatte gewaltige vertikale Körpermaße. Deshalb saß er auf einem gutgepolsterten Rollsessel, dessen Sonderkonstruktion den Massen seines Benutzers durchaus standhielt. Um den Hals trug er eine Menge goldener Ketten, die auf einer behaarten Brust baumelten. Es war seine Art, den Reichtum zu zeigen, den er sich ergaunert hatte. Ein kurzärmeliges, fünffarbiges Seidenhemd verhüllte seine Leibesfülle wie ein Segel.
Ein Deckenventilator verteilte die herumliegenden Blätter weiter auf dem Boden. Es roch nach Zigarettenqualm, obwohl keiner der Anwesenden im Moment rauchte. Gelassen hob der momentane Belgier einen Stuhl vom Boden auf, der beim Stürmen des Zimmers durch den Raum gesegelt war.
„Wir kennen uns nicht. Das ist auch nicht wichtig. Aber wir haben einen gemeinsamen Freund. Und sie, Abduhl, haben unseren Freund verärgert, sehr verärgert.“ Er schnalzte mit der Zunge, als er den Kopf schüttelte. Die dunkelbraunen Augen des Weißen standen etwas eng und waren nur auf das Gesicht seines Gegenübers gerichtet. Sie verbreiteten den Eindruck, als verabscheue er solche Gespräche.
Barnasadahleh zerrte an den Stricken, mit denen man inzwischen seinen massigen Oberkörper mit seinem Drehstuhl fixiert hatte. Vergebens. Auf eine müde Handbewegung von Lacuste hin verkürzte einer seiner Begleiter den Strick um dessen fetten Hals. Schweiß rann über die Schläfen des Gefesselten, eilte die feisten Backen hinunter, um am Hals vom Stoff seines Kaftans aufgesogen zu werden. Der Luftmangel beendete die Gegenwehr.
„Wir wollen uns doch vernünftig unterhalten. Das ist doch in Ihrem Sinne, oder? Wo war ich stehen geblieben? Ach, ja. Unser gemeinsamer Freund. War er nicht sehr entgegenkommend? Zweimal hatte er Ihnen einen Termin gesetzt. Leider kam Ihnen wohl immer etwas dazwischen. Nun sind wir beim dritten Meeting. Drei ist Ihre Glückszahl, denn heute wird gezahlt.“
Barnasadahleh schnappte nach Luft. Seine Augen weiteten sich. „Die Geschäfte schlecht sind, sehr schlecht. Ich habe...“
Mit einer barschen Handbewegung beendete der Belgier den Satz. „Wir sind nicht hier, um Sprüche auszutauschen oder zu verhandeln. Ich will Geld. Wir haben ohne Visematentschen die Maschinengewehre, Panzerfäuste und Kalaschnikows geliefert. Nun will unser gemeinsamer Freund auch die Bezahlung, die ihm zusteht.“
Hoffnung tauchte in Barnasadahlehs Augen auf. „Soviel Geld habe ich nicht hier, 12 Millionen. Wer hat soviel in der Tasche? Und die Bank?“
Ausdruckslos ruhten die Augen des Weißen auf den Lippen des Kongolesen. Nichts geschah. In den Augen des Misshandelten keimte Hoffnung auf. Seine Ausrede mit der Bank hatte doch bislang immer funktioniert. Der Belgier hatte von einem Beistelltisch den Unterkiefer eines fast dreijährigen Alligators ergriffen und damit herumgespielt, so als langweile ihn diese Angelegenheit über alle Maßen. In dem Moment, wo der Zahlungsunwillige sich entspannte und sich mit der rechten Hand auf dem Schreibtisch aufstützte, schnellte der Unterkiefer des Reptils nach vorne. Die gebogenen Zähne bohrten sich in die Handoberfläche. Instinktiv wurde die Hand zurückgezogen, was die Schmerzen allerdings noch erhöhte. Es dauerte etwas, bis der Schwarze begriff, dass Wegziehen keine Option war. Ungerührt drückte Lacuste den umgedrehten Unterkiefer des Reptils in den Handrücken. Die Schmerzensschreie des Gemarterten beeindruckten ihn ebenso wenig wie dessen Tränen, die nach unten abliefen.
„Hören Sie zu! – Hören Sie einfach zu! Und halten Sie vor allem die Schnauze.“
Barnasadahlehs Kopf nickte wie eine Nähmaschine. Als Entgegenkommen wurde der Druck etwas verringert, blieb aber die ganze Zeit über bestehen.
Langsam schüttelte Lacuste den Kopf mit den kurzgeschnittenen blonden Haaren. „Mein Guter, Sie begreifen nicht. Vor allem halten Sie uns doch nicht für so dumm. Sie zahlen elektronisch, wir kassieren elektronisch. Internet Banking heißt das. Wo ist da das Problem? Sie mailen Ihre Bank an. Selbstverständlich schaue ich weg, wenn Sie Ihr Kennwort eingeben. Wenn die Summe auf unserem Konto in Barbados angekommen ist, dann erhalte ich einen Anruf.“ Der Belgier hob sein Satelliten-Mobiltelefon in die Höhe. „Dann sind Sie uns los. So einfach ist das. Haben Sie noch Fragen?“
Um seiner Erklärung wieder Nachdruck zu verleihen wurde der Druck des Kiefers erneut erhöht. An einigen Stellen begannen die Raubtierzähne den Zusammenhalt der Haut aufzuheben. Der Kongolese hatte weder weitere Fragen, noch Anmerkungen. Es dauerte über eine halbe Stunde bis das Satellitentelefon seine Melodie in den Raum schmetterte und die Wartenden aufschreckte. Der Belgier drückte eine Taste, bevor er das Gerät ans Ohr hielt. Er nickte nur mit dem Kopf. Dann lächelte er. „Das Geld ist da. Wir können aufbrechen.“
Abduhl Barnasadahleh atmete erleichtert auf. Er blinzelte gegen die Schweißtropfen an, die ihm auch in die Augen gelaufen waren. Er hatte sich nicht getraut auch noch dagegen zu protestieren. Auf dem Wege zur Türe drehte sich der Belgier um.
„Ach, noch was. Sie sollten in Zukunft beim Abschluss der Geschäfte mit uns daran denken.“ Er machte eine Handbewegung.
Die beiden Kuffijaträger rollten den Ledersessel eng an die Tischplatte. Während der eine den Arm von Barnasadahleh auf der Oberfläche fixierte, presste der andere die Hand auf die Fläche. Lacuste zückte ein Messer. Es war Schneide und Säge in einem. Bevor der Gefesselte überhaupt denken konnte, wurde ihm der kleine Finger abgetrennt. Ruhigen Fußes verließen die eigenartigen Besucher das Gebäude.
Die Range Rover fädelten sich in den nachmittäglichen, spärlich fließenden Verkehr von Brazzaville ein. Der Belgier griff zu seinem Satellitenhandgerät. Im fernen Schermbeck schlug der Festnetzanschluss an. Es dauerte eine Weile, bis jemand abnahm.
„Das Geschäft ist abgeschlossen.“ Lacuste lehnte sich in die Rückenpolster.
„Gut.“
„Was ist mit der Sache von nächster Woche?“ Die Stimme des Angerufenen klang drängend.
Lacuste setzte die Sonnenbrille auf die Nase. „Im Moment nicht. Darüber reden wir später. Aber ich glaube, es klappt.“
„Gut.“
Die Verbindung nach Deutschland war unterbrochen.
Schermbeck, 2. Mai
Angst weitete die Augen auf maximale Größe. Das Gehirn hatte keine Befehlsgewalt mehr über den Körper. Alles, was ablief, unterstand dem Kommando autonomer Reflexe und diese wurden durch die Sinneseindrücke bestimmt, die ihr Gehirn wahrnahm. Und diese befahlen die absolute Starre aller Muskeln. Die Hände hatten sich am Saum der Bettdecke festgekrallt. Die Kraft war so gewaltig, dass der obere Teil der Finger nicht mehr durchblutet wurde. Die dunkle Farbe der Haut erschien dadurch heller. Die Frau wollte die Bettdecke über den Kopf ziehen, um das Grauen nicht mehr ansehen zu müssen. Aber genau so gewaltig wie dieser Drang war auch die Angst, sie würde nicht mehr mitbekommen, was Matatanga mit ihr vorhatte.
Draußen wurde es dunkel und es war nicht das erste Mal gewesen, dass der große Geist sie um diese Zeit besuchte. Es war abgelaufen, wie es immer ablief. Der Wind wehte Steine gegen die Scheiben ihres einzigen Zimmerfensters. Dann ertönten Stimmen, deren Sinn sie nicht verstand. Nomfunda wusste aber, der Große Geist sprach nie Worte, die Menschen verstehen konnten. Das wusste sie von ihrer Mutter und die hatte es von ihrer Mutter gelernt. Und wenn die Ahnen das sagten, dann war dies die Wahrheit. Und Wahrheiten bezweifelte man nie. Langsam bewegte sich der Kopf Matatangas von unten nach oben. Er schwankte, so als klettere er die Außenfassade des Gebäudes hoch. Geister brauchten keine Leitern und Matatanga erst recht nicht. Und die Höhe eines zweiten Stockwerks war für den Geist eine Kleinigkeit. Die krausen Kopfhaare bewegten sich im Winde, der draußen herrschte. Die in Falten gelegte Stirne kündigte das Unheil an, denn nun erschienen wieder die glühenden Augen oberhalb der Fensterbank. Blutrot gefärbt suchten sie nach ihr. Und Matatanga fand immer, was er suchte. Die abgeknickte Nase, verunstaltet mit vielen Runzeln und Warzen, drehte sich zu ihr hin. Der Odem des Todes drang aus den Nasenlöchern. Pendelnd erschien nun der Mund in ihrem Sichtfeld. Weit aufgerissen zeigten sich riesige Zähne, die mehr an das Gebiss eines Hais erinnerten, als an die eines Menschen. Aber wer hatte behauptet, Matatanga sei ein Mensch?
Als ihre Mutter ihr als Kleinkind von Matatanga erzählte, hatte sie ein anderes Bild vom Großen Geist gehabt. Aber dies waren Gedankenbilder längst vergangener Tage. Dass er selbst tatsächlich so furchtbar aussah, hatte sie sich in ihren schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können. Aber es war einleuchtend. Matatanga, so hatte man ihr immer eingebläut, erschien nie ohne Grund. Und sie aufzusuchen, das war eigentlich überfällig. Sie hatte schwere Schuld auf sich geladen. Es gab keine Ausreden bei den Begleitumständen, unter denen dies geschehen war. Matatanga hatte sie für schuldig befunden. Der Große Geist wusste alles, auch das, was sie entgegnen wollte. Sie musste seinen Schiedsspruch widerspruchslos akzeptieren. Alles andere würde nur viel schlimmer sein.
Schermbeck, 10. Mai
Bevor der Hund ihn spazieren führte und durch Wiesen und Büsche zog, löste der Mann die Leine vom seinem Halsband: Der Retriever verstand diese Geste und war kurz darauf im Unterholz verschwunden. Der Mann erreichte fast die Marke Einsneunzig. Er war schlank, aber nicht muskulös. Die schlabbernden Beine seines Trainingsanzugs waren ein beredtes Zeichen davon. Der Kopf ließ nur einem Halbkreis Haare Platz zum Wachsen, die zudem noch streng ausrasiert waren. Wenn man ihn so musterte, dann würde man auf Verwaltungsbeamter tippen: Ordnungsamt, Liegenschaftskataster oder Innenrevision. Aber Henno Farch war keines von alldem. Er war Autoverkäufer bei der Firma Autohaus Mazda in Dorsten. Wie er sich selbst einschätzte, war er ein guter Verkäufer. Im Laufe seines Berufslebens hatte er sich eine Aufstellung von Verkaufstipps erarbeitet. Versuchsballon starten und Zuhören waren die bedeutsamsten Regeln beim Autoverkauf. Erst, wenn er sich darüber im Klaren war, dann erst berücksichtigte er Aussehen und Verhalten der Käufer.
Bei männlichen Kunden war sein erster Versuchsballon die: PS. Nicht die Angabe in KW, wie die heutige Norm die Leistung eines Motors vorschrieb. Die Angabe in PS hatte einen höheren Wert, und damit ein günstigeres Leistungs-Preis-Verhältnis. Ein Autoverkäufer wäre nie im Leben auf den Gedanken gekommen, Motorleistung in KW vorzugeben. Ein Käufer, der PS nachfragte, wollte soviel wie möglich davon haben, egal ob er das Fahrzeug kaufte oder finanzierte. Zweihundert PS hörten sich doch besser an als 147 KW?
Zu der anderen Gruppe gehörten meist Frauen. Diese interessierte nicht, wie schnell sie irgendwo hinkamen, ob der Wagen tiefer gelegt worden war, oder nicht. Sie legten Wert auf das Wie. Auf die Linienführung der Karosserie, die Stoffe und ihre Kombination von Polster und Abdeckungen, die Eleganz des Cockpits, die Form von Spiegeln und Bedienungselementen.
Bei der letzten Gruppe, die sich herauskristallisiert hatte, konnte man nichts verdienen. Kaum jedenfalls. Sie fragten nach CW-Werten, Benzinverbrauch oder Abgasnorm. Sie feilschten um Rabatte, prüften den Lack auf mögliche Schäden hin. Nichts war ihnen fremd, den Preis zu drücken. Eigentlich würden sie Geld dafür einfordern, dass sie sich herabließen, ein solches Umweltmonster in ihren Besitz zu bringen. Aber haben wollten sie es letzten Endes dann doch.
Henno Farch trat gegen einen Stein auf der Fahrstraße. Dieser hopste über die Fahrasche und verschwand schließlich im Gras des Fahrbahnrandes. Benno, der Retriever, stellte die Geruchaufnahme ein, hob kurz seinen Kopf. Nahm dann wieder Gerüche auf, weil sich das gehörte Geräusch fortsetzte. Farch fluchte laut bei dem Gedanken an seinen Verdienst. Ja, er hatte gut verdient und er verdiente immer noch gut. Bei Verheirateten, sagte man, wäre jede Mark nur die Hälfte wert. Bei ihm waren es genau 40,2 Prozent. Das hatte er genau berechnet. Und Schuld daran war nur Petra. Petra Schmittberg hieß sie. Mit ihr hatte er fünf Jahre zusammengelebt. Die Trennung von ihr berührte ihn nur noch am Rande. Was ihn zutiefst erbitterte war die Situation mit Kevin, seinem vier Jahre alten Wonneproppen. Das Fatale an dieser Angelegenheit war, er war Vater, aber nicht verheiratet. Mit der Geburt hatten die Verwerfungen in der Beziehung angefangen und sich nie mehr kitten lassen. Sofort hatte er sich bereiterklärt, für Kevin aufzukommen. Er wollte aber nicht nur zahlen, er wollte Teil des Lebens seines Sohnes sein. Wie hatten es die Juristen in ihrer merkwürdigen Wortwahl bezeichnet?
Ein entgegenkommender Fahrradfahrer riss Henno Farch aus seinen Gedanken. Aber Benno interessierte sich wie immer nicht für Fahrradfahrer. Die Felder und Wiesen schoben sich nun an die Üfter Mark heran. Er brauchte sich nicht um Benno zu kümmern. Benno kannte sein Gebiet und es war groß genug, um es zu kontrollieren.
Da fiel ihm dieses juristische Wort wieder ein. Alltagspapa. Alltagspapas waren solche Väter, welche einen Großteil der Betreuung ihres Nachwuchses übernehmen wollten. Petra war dies recht, weil sie auf diese Weise zeitliche Entlastung erfuhr. Dass er, Farch, dadurch auch finanziell stärker belastet wurde, akzeptierte seine Kindsmutter nur als Beitrag zur Kostensenkung. Nicht aber als Beitrag zur Erziehung, zur Mitverantwortung. Der Streit hatte das Einkommen zweier Rechtsanwälte und eines Verwaltungsrichters gesichert. Drei Ordner hatten sich dabei gefüllt. Letztendlich hatte er zugunsten Kevins kapituliert. Er schaute auf die Uhr. In guten zwei Stunden hatte er sich bereit erklärt, Kevin zu übernehmen. Mit einem Vierjährigen konnte man solche Spaziergänge wie mit dem Hund noch nicht unternehmen. Deshalb musste er vorher für Bennos Auslauf sorgen. Der Geruch von Kiefern und Tannen lag in der Luft. Henno Farch atmete tief ein und noch sorgenvoller aus. Wohin das alles führen würde; er wusste es nicht.
Der Blick auf die Armbanduhr zeigte die knappe Zeit an, die ihm noch mit Benno blieb. Er suchte den Hund im Gewirr wachsender Baumstämme. Wie gut, dass sich Bennos Fellfarbe deutlich vom dunklen Braun der Bäume unterschied. Das erste Bellen erregte seine Aufmerksamkeit nicht. Hier fühlte sich keiner von Hundegebell gestört. Das Bellen nach einer Pause war schon lauter und drängender. Er suchte den Retriever und fand ihn fünfzig Meter abseits des Schotterwegs. Benno hatte etwas gefunden. Einen Kaninchenbau, von dem es hier so viele gab? Er hatte weder Lust noch Zeit, Benno die Eigenständigkeit zu geben, seinen Trieben zu folgen. Kurzerhand pfiff er den Hund zurück.
Henno Farch konnte sich nicht erinnern, wann ein solcher Befehl schon einmal ignoriert worden war. Das folgende Kommando erklang deshalb um einige Oktaven lauter und aggressiver. Aber auch dies interessierte Benno nicht. Wie ein Akkordarbeiter war er damit beschäftigt Erde beiseite zu schaufeln. Unmut machte sich in Henno Farch breit. Wohl oder übel musste er sich zu seinem Hund hinbegeben. Unterbrochen von weiteren Befehlen stapfte er durch den tiefen Waldboden. Dabei fluchte er, wie seine Schuhe nachher wohl aussehen würden. Ob er sie vorher noch säubern konnte?
Er war wirklich ärgerlich. Er fasste die Hundeleine so, damit er sie dem Köter sofort überziehen konnte. Er würde ihm schon die Flötentöne beibringen. Jedes Mal, wenn er das Kommando „Fuß!“ brüllte, schaute Benno kurz zu ihm rüber, wedelte mit dem Schwanz und setzte seine Grabungsarbeiten fort. Als Farch sich der Stelle näherte, bemerkte er eine Silofolie, welche auf der einen Seite schwarz, auf der anderen weiß gefärbt war. Er schüttelte den Kopf. Welche Menschen mussten das sein, mitten im Wald Plastikmüll zu entsorgen? Er begriff es nicht. Nein, er würde es nie begreifen. Benno hatte inzwischen das Ziel seiner Begierde im Maul. Es schien festzuhängen. Mehrmals fasste der Hund nach, um eine bessere Ausgangsposition für das Abtrennen zu finden. Endlich löste sich die Verbindung. Benno machte einige Bissversuche, um die Beute besser tragen zu können. Schwanzwedelnd kam er auf sein Herrchen zu. Unbeeindruckt von der tobenden Stimme seines Herrchens näherte sich der Hund - stolz etwas präsentieren zu können. Zunächst glaubte Farch nicht, was seine Augen sahen. Als kein Zweifel mehr an dem Teil einer menschlichen Leiche bestand, brach er in hysterische Schreie aus.
Weilburg an der Lahn, 10. Mai
Der Campingplatz 'Grüne Aue' lag direkt an der Lahn. Er hatte eine Größe von über 15 Hektar. Hecken parzellierten einzelne Flächen. Der Platz war zweigeteilt. In dem einem Teil parkten Wohnwagen und Wohnanhänger. Die meisten Stellplätze hier waren dauervermietet. Man erkannte dies daran, dass die Besitzer erfolgreich versuchten, ihren Stellplatz zu individualisieren. Der zweite, etwas kleinere Teil der Anlage war für Zelte aller Art vorgesehen. An diesem Wochenende gab es nicht viele davon. Zwei Zelte waren abseits des Hauptplatzes in Nischen aufgebaut worden, die zudem noch den Sichtschutz von einzelstehenden Sträuchern genossen. Man konnte glauben, dass hier Liebespaare nächtigten. Auf dem Hauptplatz war eine Wagenburg von Zelten errichtet worden. Bei dieser Anordnung legte man auf Gemeinsamkeit Wert. Die Zelte gehörten den Mitgliedern des VV Walsum. VV war die Abkürzung für Volleyball und Verein. Sie hatten sich hier zusammengefunden, um eine gemeinsame Freizeit zu unternehmen. Einmal im Jahr – und die Sache hatte schon langjährige Tradition - kam man an wechselnden Orten zusammen, um mal eine andere Sportart als das Volleyballspielen auszuüben. In diesem Jahr stand Bootfahren auf dem Vergnügungsplan. Man war einen Tag vorher angereist, hatte den heutigen Tag auf dem Wasser verbracht und nun genoss man den letzten Abend dieser Zusammenkunft. Morgen nach dem Abbau der Zelte ging es heimwärts. Das Zentrum dieser Wagenburg war eine Feuerstelle, die nun in Betrieb war.
Die Glut des Holzfeuers trieb die Wassertemperatur in den Kapillaren des Holzes nach oben. Immer, wenn das eingeschlossene Wasser dort den Aggregatzustand zum Dampf überschritt, wurden Holzteile weggesprengt. Die glühenden Funken segelten im hohen Bogen durch die Luft. Dort, wo sie im Gras landeten, versuchten sie einen neuen Brand zu legen. Weil aber die mitgebrachte Energie dazu nicht ausreichte, verpufften diese Versuche im taufrischen Boden.
Das Licht dieses Holzfeuers erleuchtete die Gesichter der Männer, die sich um den Brandherd gruppiert hatten. Während die ausgestrahlte Glut Gesicht und Brust angenehm erwärmte, kroch die Kälte der Nacht in die Rückseite der Versammelten. Kopf, Nacken und Rücken in dicke Decken gehüllt, schützte man sich so vor diesem Frösteln. Fast jeder dieser Männer hielt eine Bierflasche in den Händen. Einige drehten sie in den Fäusten, andere benutzten sie als Demonstrationsobjekt, so als wollte man das Gesprochene unterstreichen. Alle aber führten in unregelmäßigen Abständen die Flaschen zum Mund, um aus ihnen zu trinken.
Eine lange, hagere Gestalt erhob sich, warf die Decke über die Lehne seines Campingstuhles und verschwand aus dem Lichtkreis des Feuers. Im Halbschatten des Lagerfeuers sah man, wie er an einen Tisch herantrat, von ihm etwas herunternahm, um damit zum Feuerkreis zurückzukehren. Er schenkte ein Schnapsglas voll und hielt es dem Nächstsitzenden vor die Nase. Ohne sich dabei im Gespräch mit seinem Nachbarn irritieren zu lassen, ergriff dieser das dargebotene Glas und trank es mit einem Zug leer. Ohne hinzuschauen, hielt er das geleerte Pinneken in die Luft. Der Hagere ergriff dies, um es erneut zu füllen. Diesmal wurde dem Nachbarn daneben der gleiche Trunk angeboten. Der bemerkte nicht, wie ein Teil der Flüssigkeit auf seine Hose tropfte. Vorsichtig nippte er, um dann das Angebotene mit einem Ruck des Nackens im Munde verschwinden zu lassen. Ein Schütteln des Oberkörpers folgte. Er sagte aber nichts, sondern hörte seinem Gesprächspartner weiterhin aufmerksam zu. Er fand aber die Zeit, um durch ein Heben seiner Bierflasche seinen Dank für die Bewirtung auszudrücken.
Mikael Knoop streckte seine Füße dem Feuer entgegen. Er war ein sportlicher Mann mit breiten Schultern. Gerne wäre er statt seiner Einseinundachtzig einen Kopf größer gewesen. Dann wäre das Abblocken am Netz nicht so mühsam. Aber es war ja Sport. Was ihm an Länge fehlte, mussten seine Wadenmuskeln halt ausgleichen. Er liebte das Volleyballspiel. Mit diesem Verein war er hier. Einmal im Jahr machte man einen solchen Ausflug, der aber immer an anderen Orten stattfand. Diesmal war es die Lahn. Rudern auf der Lahn war das diesjährige Motto. Knoops dunkles, krauses Haar begann an vielen Stellen hell zu werden, aber Gottseidank nicht lichter. Mikael hatte eine Daunenjacke angezogen, deren dick gepolsterter Kragen auch seinen Nacken vor der Kälte schützte. Die Daunenfütterung blähte seinen Oberkörper mehr auf, als es die Muskeln vermochten. Er liebte den Geruch verbrannten Holzes und genoss das Zusammensein mit seinen Volleyballern. Er hatte rechts neben sich einen Gesprächspartner sitzen, der ihm vom Umbau seines Hauses berichtete. Josef redete nur von Renovierung, denn bei ihm gab es jede Menge zu renovieren. Wer sich neben ihn setzte, der musste mit solchen Gesprächen rechnen. Mikael hielt von solchen Arbeiten recht wenig. Handwerkliches Geschick fehlte ihm. Notwendige Tätigkeiten erledigte er zwar, aber Spaß an Renovierungsarbeiten empfand er beileibe nicht. Aber es war immer gut, solche Leute zu kennen. Und die kollegialen Bande waren hilfreicher als ein gekaufter Handwerker, jedenfalls für kleinere Arbeiten und wenn es mal eben schnell gehen musste. Als das Schnapsglas vor seinen Augen auftauchte und seine Nase berührte, schrak er zusammen.
„Was ist das, Jürgen?“
Wie der Hagere das Wort „Bommelunder!“ aussprach, sagte viel über den angetrunkenen Zustand des Kellners.
Knoop runzelte die Stirn. „Mag ich nicht. Haben wir nicht auch...“ Wie das Glas zum nächsten in der Runde geschwenkt wurde, zeigte Mikael, man hatte seine Frage überhaupt nicht verstanden. Er erhob sich, legte dem Hobbywerker zur Entschuldigung die Hand auf die Schulter, dann wankte er in Richtung Tisch. Eigentlich hatte er schon genug, aber ein guter Trester gehörte einfach zum Bier. Außerdem würde er morgen lange schlafen können und- was auch wichtig war - er brauchte nicht zu fahren. Man hatte Fahrgemeinschaften gebildet und ihn zu dieser Wochenendfahrt mitgenommen. Das Etikett seiner Hausmarke erkannte er erst, als er die Flasche zum Feuerschein drehte. Wohlig ließ er den Schnaps über seinen Gaumen gleiten.
„Säufst du immer alleine?“ Es war Herbert Timpel, der Kassierer des Vereins. Er war über Einmetersiebenundachtzig groß und überragte Knoop um etliche Zentimeter. Er hatte die Decke über seinen Kopf gezogen und sah darin aus, wie ein mittelalterlicher Dorfbewohner. Nur die Nase und ein Teil des Drei-Tage-Barts wurden durch den Schein des Feuers beleuchtet.
„Eigentlich nicht. Willst du auch einen?“
„Ist der von Hucki?“
Mikael nickte. Hucki hieß eigentlich Werner Huckenberger und arbeitete in der Kunststoffverarbeitung. Hucki hatte Beziehungen zur Mosel und brachte zu den Sportausflügen immer eine Flasche Trester mit.
„Trester?“, wollte Timpel wissen und griff nach der Flasche.
Unwillig zog Mikael die Pulle an sich. Er füllte das Glas erneut und hielt es Herbert hin. „Ist desinfiziert!“
Herbi schüttete den Inhalt in seinen Rachen, wie er jeden Schnaps in seinen Rachen schüttete. Dabei schüttelte er sich demonstrativ, als nähme er bittere Medizin zu sich. Dann hielt er Mikael das Glas hin. „Noch einen, damit man sich an dieses Sauzeug gewöhnt.“
„...sagte ein Alkoholiker zum anderen.“ Mikael grinste und schenkte nach. „War ein schöner Tag heute. Das Wetter war heiß und auf dem Wasser war es kühl.“
„Ich finde es gut, dass wir jedes Jahr eine solche Tour machen. Rudern auf der Lahn, das ist doch wirklich ein Erlebnis. Ich glaube, wir machen solche Touren schon zum achten Male. Nicht wahr? Egal! Ich war bei jedem Mal dabei.“ Er setzte sein Glas auf dem Tisch ab.
„Ja, ja, ich kann nicht jedes Mal dabei sein. MK, du weißt?“ Mikael seufzte. „Aber dieses Mal habe ich keine Mordkommission. Deshalb hat es geklappt. Hast du auch Muskelkater in den Oberarmen?“
Herbi lachte. „Im Gegensatz zu dir Sesselfurzer gehöre ich zur arbeitenden Bevölkerung. Da gehört Handarbeit zur täglichen Plage.“
Die beiden Männer lachten. Herbi griff Mikael an den Oberarm und drückte ihn zusammen. Nur mit Mühe konnte dieser den Schmerzensschrei unterdrücken.
„Hey Mickey, ist das nicht dein Mobiltelefon, das da klingelt?“ Irgendjemand aus dem Kreis der Kumpel musste dies gerufen haben. Erst jetzt hörte Mikael die bekannte Tonfolge, die nichts Gutes verhieß. Es musste sich um eine dienstliche Angelegenheit handeln. Er trat mit dem Telefon beiseite, bis er sicher war, dass keiner ihn hören konnte. Dann drückte er die Taste, um das Gespräch anzunehmen. Das Display verriet, um wen es sich handelte. Es war sein Chef.
„Knoop.“
„Van Gelderen hier. Ich brauche Sie in einer MK. Wann können Sie kommen?“ Die Stimme klang, als verkündete sie das Selbstverständlichste der Welt.
Knoop war perplex. “Ich habe getrunken.” Gleichzeitig verspürte er keine Lust, den gastlichen Ort zu verlassen.
„Können Sie nicht fahren?“ Die Aufforderung seines Chefs war eigentlich eine Frechheit. Es war die Aufforderung zu einer strafbaren Handlung.
„Nein, ich glaube nicht.“ Knoop betrachtete die feuchten Fußspitzen, weil Feuchtigkeit durch seine Socken drang.
„Dann nehmen Sie einfach eine Taxe. Also, wann?“ Der Ärger des Anrufers war nun deutlich zu bemerken.
„Ich kann nicht kommen, weil ich in Weilburg bin.“ Knoop ärgerte sich, über die Trägheit seiner Gedanken.
„Weilburg? Wo zum Teufel ist Weilburg?
Knoop schluckte, um einem Versagen seiner Stimme vorzubeugen. „An der Lahn.“ Es war Zeit einem solchen Verhalten seines Vorgesetzten zu begegnen. „Ich habe mich doch im Dienstplan für dieses Wochenende freistellen lassen. Oder?“
„Das weiß ich doch, aber der Kollege Schmittbaur ist wegen eines Blinddarmvorfalls ausgefallen. Und in Notfällen wie heute kann ich... also, wann können Sie hier sein?“
Knoop atmete tief durch. Schlagartig war aller Alkohol aus seinem Kopf verschwunden. Sein Chef hatte wohl keine Ahnung, wo sich die Lahn befand. „Die Fahrt dauert bestimmt zwei Stunden. Zahlen Sie das Taxi?“
„Ich?“
Knoop hielt das Smarty vom Ohr weg, weil die Stimme ihn schmerzte. „Dann schicken Sie mir einen Streifenwagen.“
„Sind Sie Bundeskanzler oder was?“, tönte es aus der Hörmuschel. „Ich schick doch keinen...“ Van Gelderen begann zu begreifen, was er von Knoop forderte.
„Ich bin auch nicht mit meinem Wagen hier. Und mein Fahrer hat auch getrunken. Vielleicht mehr als ich.“ Knoop stampfte mit den Füßen. Einmal, weil seine Füße kalt wurden. Außerdem hoffte er, so die Feuchtigkeit besser fern halten zu können.
„Gut, wann können Sie morgen hier sein?“ Die Stimme klang auf einmal einige Grade freundlicher. „Zehn Uhr?“
Sind wir jetzt auf einem Basar, dachte Knoop? „Das kann ich nicht sagen. Wie ich ihnen schon sagte, bin ich Mitfahrer. Im Übrigen sind wir zu Dritt. Und was die anderen beiden wollen, das kann ich jetzt beim besten Willen nicht sagen. Was ich zusagen kann ist, ich werde nüchtern sein und sofort kommen, wenn ich wieder in Duisburg bin.“
Sein Chef hatte wortlos die Verbindung getrennt.
Knoop trat wieder in den Kreis des Lagerfeuers. Er suchte in den schattierten Gesichtern den Fahrer, der ihn mitgenommen hatte. „Äh, Paul, du musst mich sofort nach Duisburg bringen. Ich habe seit fünf Minuten Dienst.“
Pauls Mund öffnete sich ungläubig. Seine Bierflasche kippte nach vorne. Ohne es zu bemerken, floss Bier auf den Boden und spritzte auf seinen rechten Schuh. „Bist du bescheuert? Hast du zu viel getrunken? Trink noch einen, dann geht dieser Anfall schnell vorbei.“ Er wendete sich wieder seinem Gesprächspartner zu.
Knoop lächelte. Paul hatte recht. Auf diesen Schreck musste er noch einen heben. Wenn alles normal ablief wie immer, dann würde er frühestens morgen Nachmittag in Duisburg sein. Bis dahin konnte er sein Versprechen auf Nüchternheit spielend einhalten. Es wurden dann aber doch zwei Trester. Aber im Laufe der nächsten Stunde merkte er, wie sein Durst nachließ. Van Gelderen hatte ihm den restlichen Abend verdorben.
Schermbeck, 11. Mai
Die freundliche Frauenstimme legte dem Fahrer nahe, nun die Autobahn zu verlassen, wollte er zu seinem Ziel kommen. Knoop verließ die A31 und bog in Richtung Schermbeck ab. Schon nach zwei Kilometern wurde er aufgefordert, rechts abzubiegen. Er befand sich nun auf einem geteerten Landwirtschaftsweg. Holpernd näherte er sich einem Paar, welches hier wohl spazierenging. Der Mann schob einen Rollator vor sich her. Sie, weil besser zu Fuß, blieb an seiner Seite, so als befürchte sie Schlimmes. Knoop fuhr schneller, als der Rollator geschoben werden konnte, denn im Rückspiegel erblickte er einen zornigen alten Mann, der schneller mit einem Krückstock drohen, als die Gehhilfe bewegen konnte. Kurz darauf hieß es, nach rechts abzubiegen. Der Straßenbelag änderte sich. Auf dem Schotter begannen die Reifen seines Dienstwagens zu singen. Lange bevor die Stimme das Erreichen seines Zieles ankündigen konnte, sah er den Tatort.
Knoop hatte sich am Polizeipräsidium absetzen lassen. Auf seinem Schreibtisch lag eine Mappe, die nur aus einem Blatt bestand. Nur die dürftigsten Informationen waren hier handschriftlich vermerkt: Name des Opfers, vermutlicher Todeszeitpunkt, Zeitpunkt des Auffindens, Tatort. Mit der Leitung der Mordkommission hatte van Gelderen Ingrid Höfftner beauftragt. Sein Chef musste die Kollegin für diese Ermittlung zugeteilt bekommen haben. Mit der Nennung dieses Namens hatte sich in Mikael ein merkwürdiges Gefühl breit gemacht. Er kannte Ingrid von früheren MKs. Sie war eine der wenigen Frauen, zu der es ihm nicht gelang eine kollegiale Beziehung aufzubauen. Sie befand sich in einem permanenten Kampf gegen das männliche Geschlecht. Entweder fühlte sie sich von den Männern benachteiligt oder sie standen ihr bei ihrer persönlichen Karriereplanung im Wege. Unter Kollegialität verstand Höfftner immer den eigenen Vorteil. Hatte sie den Kollegen dienstlich in den Schatten gestellt, dann war sie freundlich, lieb und nett. Damit war sie für Mikael eine Alfa-Hündin, die jeden Konkurrenten wegbiss. Na, das konnte ja heiter werden. Von unterwegs auf der Rückreise hatte er telefonisch einen Dienstwagen bestellt. Den Schlüssel dazu hatte er sich bei der Wache des Haupteingangs des Präsidiums abgeholt.
Durch sein verspätetes Dazustoßen hatte er jede Menge Informationslücken. Weder wollte er als dummer Junge erscheinen noch als uninformiert. Deshalb hatte er beschlossen, sich erst einmal selbst ein Bild von dem Ort des Auffindens zu machen. Dazu hatte er sich einem Navi anvertraut. Schließlich lag diese Stelle irgendwo in einem großen Waldgebiet und Knoop hatte keine Lust, ziellos dort herumzuirren. Seine Befürchtungen erfüllten sich indes nicht. Das rot-weiße Absperrband mit dem Endlosaufdruck 'Polizeiabsperrung' war vom Wege her gut zu erkennen. Viel Mühe schien man sich bei dem Ablegen der Leiche nicht gemacht zu haben.
Als Knoop die Wagentüre öffnete, drang der Geruch von Harz und verwesendem Laub in seine Nase. Ein paar Mal atmete er tief durch. An Ort und Stelle befand sich keiner mehr von der Spurensicherung. Knoop erstaunte das nicht. Schließlich kam er ja einen guten Tag zu spät. Gleichzeitig war ihm klar, die Spurensicherung musste auch nicht viel Arbeit gehabt haben. Der Boden des Fundorts war aufgewühlt. Nicht sehr tief. Die Leiche konnte somit nicht sehr tief verbuddelt worden sein. War es ein Laie oder geschah die Tat unter Zeitdruck? Diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Der Haufen Reisig, der wohl von der Technik kontrolliert und dann aufgeschichtet worden war, musste den Körper verdeckt haben. Eine Schleifspur war nicht zu übersehen. Als er näher kam, korrigierte er seine Vermutung. Die Tote war nicht gezogen, sondern transportiert worden. In dem weichen Waldboden waren die Eindrücke zwangsläufig tief, und waren gut zu erkennen. An mehreren Stellen hatte man mit Gips gute Abdrücke archiviert. Um Spuren zu beseitigen, musste die Person den gleichen Weg zurückgegangen sein und hatte mit einem Reisigbündel versucht, Informationen über sich zu verwischen. Man war dabei aber wohl nicht erfolgreich gewesen, denn Knoop erkannte an weiteren Stellen Gipsreste. Mal gespannt, was dabei herauskommen würde. Der Täter musste vom Waldweg gekommen sein, um den Körper abzulegen. Der mittels Schotter befestigte Weg mündete laut Karte wenig später in den Weg 'Zum dicken Stein'. Mehr Spuren waren nicht zu erkennen. Er hatte einen ersten Eindruck. Mal sehen, ob seine Kollegen sich noch in der Wohnung der Toten aufhalten würden. Er beschloss, sich nicht wie ein Laufbursche anzukündigen oder nachzufragen, wo man denn sei. Er lenkte den Wagen über den Weg zurück, den der Täter genommen haben musste. Die Gipsspuren am Wegesrand waren ein beredtes Zeichen dafür.
Die Vielzahl der Autos, die vor dem mehrgeschossigen Haus auf der alten Poststraße kreuz und quer geparkt waren, zeigten ihm, hier war er richtig und hier war richtig was los. Vor dem Gebäude, auf den Fluren und im Treppenhaus debattierte man in Gruppen. Ohne es genauer zu wissen, musste er sich in einer Flüchtlingsunterkunft befinden. So viele fremdländische Gesichter auf einen Haufen, das konnte kein Zufall sein. Knoop zeigte den beiden uniformierten Kollegen, welche das Gebäude zur Straße hin sicherten, seinen Ausweis. Der Fingerzeig des kleineren Polizisten besagte, er musste in die obere Etage. Wortlos schlängelte er sich durch die Wartenden. Keiner interessierte sich für ihn. Stellenweise musste er seine Schultern einsetzen, damit man ihm Platz machte. Ein undefinierbarer Geruch trat ihm von allen Seiten entgegen. Auf den Stufen gab es zwar keinen Müll, aber sauber waren sie auch nicht. Überall stand man herum und schwadronierte. Die ihm unbekannten Sprachfetzen unterstrichen seine Annahme, wo er sich befand. Das Zimmer der Ermordeten war leicht auszumachen, denn vor der Tür stand ein weiterer Polizist, der mit seiner Figur den gesamten Türrahmen ausfüllte. Knoops Ausweis ermöglichte ihm den Zutritt.
Der Raum war eng und lang. Die Wände hatte man in einfaches Weiß getaucht. An der rechten Wand befand sich ein dreistöckiges Bettgestell. Am Fenster gab es einen kleinen Tisch mit drei Stühlen. Davor, den Betten quasi gegenüber, ein gebrauchter alter Holzschrank. Weil dessen Türen offen standen, sah man, er diente als Kleiderschrank. In seine Querseite hatte man Nägel geschlagen, an denen Kleidungsstücke, Taschen und andere, meist weibliche Utensilien hingen. Das Gleiche galt auch für die Wände neben dem Schrank. In den vier Raumecken oder wo sonst noch Platz war, hatte man all das angehäuft, was anderswo nicht aufbewahrt werden konnte. Aber es gab dort auch Lebensmittel und Küchengeräte. Hier hatte jemand gesammelt, was er finden konnte.
Das erste, was Mikael auffiel, waren die vielen Personen, die sich in dem schlauchförmigen Raum aufhielten. Alle trugen Spurensicherungsanzüge. Aber nicht alle waren von der Kriminaltechnik. Man nahm Fingerabdrücke, tütete ver-dächtige Gegenstände in Plastikbeutel oder klebte Oberflächen ab. Eine Vermummte stürzte sich auf ihn: Rita Minkoleit von der Spurensicherung.
„Mensch Knoop, Sie beschädigen all unsere Spuren. Und das bei so einer Müllhalde.“ Sie griff nach einem Kunststoffanzug. „Marsch rein mit ihnen.“
Knoop hasste diese Spurensicherungsbekleidung. Sie war atmungsinaktiv. Nach einer Stunde Tragen schwitzte man wie in einer Sauna.
Eine Frau, mit dem Rücken zu ihm, hielt einen Gegenstand mit spitzen Fingern hoch, um das Teil in die bereitgehaltene Plastiktüte fallen zu lassen. Als sie sich umdrehte, erkannte er Ingrid Höfftner.
„Ach, der Herr Knoop! Auch schon da?“ Die Stimme klang unverhohlen ironisch.
Höfftner war Hauptkommissarin so wie er. Ihre Art, sich zur Schau stellen, was bekannt. Höfftner reichte ihm bis zur Schulter und füllte den ganzen Spurensicherungsanzug aus. Ihr Busen und ihr Becken waren sprichwörtlich. In dem Spurensicherungsanzug erinnerte ihn die Frau an einen riesigen Schneemann, den er als Kind immer gebaut hatte. Ihre breiten Lippen gaben ihrem Aussehen einen gewöhnlichen Ausdruck. Aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Ingrid war gewitzt und feinfühlig.
Mikael schluckte und schluckte dabei die Erwiderung mit runter, seit wann es denn Anzüge in Größe S gebe. „Kannst du mich auf den Stand der Dinge bringen, Ingrid? Wo ist das Bett der Toten?“
Höfftner zeigte nach oben. Sie beherrschte sich, ihr Gesicht zu verziehen. Sie kannte diesen Knoop von einigen MKs. Aber dies lag schon lange zurück. In letzter Zeit waren sie sich manchmal irgendwo auf den weitläufigen Fluren des Polizeipräsidiums begegnet, hatten knapp 'Tag' gesagt. Sie mochte ihn wohl immer noch nicht. Dabei konnte sie nicht sagen, warum. War es sein Wesen, seine Einstellung, die Bemerkungen, die er machte? Und nun mussten sie zusammenarbeiten! Ihre Unbehaglichkeit stellte sie unverholen zur Schau. In ihrer Gefühlaufwallung hätte sie bald seine nächste Frage nicht verstanden.
„Warst du bei der Sektion der Leiche dabei?“
Sie nickte mit dem Kopf. „Ja, heute in der Früh. Wir wissen inzwischen, die Frau hieß Nomfunda Mafalele. Sie war 39 Jahre alt. Kenianerin. Sie...
„Kenianerin?“, unterbrach Knoop sie. „Das heißt, sie ist...“
„...eine Dunkelhäutige. Richtig!“ Sie unterbrach Knoop genauso, wie sie selbst unterbrochen worden war. „Sie hatte Asyl beantragt und wartete auf den Bescheid.“
„Asylbewerberin, ach so.“ Knoops Gesicht war nicht zu entnehmen, ob er sie auf den Arm nehmen wollte.
Unbeirrt sprach Höfftner weiter. „Man hat ihr die Kehle durchgeschnitten. So.“ Sie machte mit der Hand eine Bewegung, um den Vorgang nicht beschreiben zu müssen. „Der Fundort ist wohl nicht der Tatort. Wir kennen ihn noch nicht. Man hat den Körper getragen. Aber die Sache ist noch nicht endgültig geklärt. Warst du schon draußen?“ Sie machte eine Pause.
Knoop nickte. „Wer hat sie gefunden?“
Höfftner schaute ihn ungehalten an. Sie liebte es wohl nicht, unterbrochen zu werden. „Es war ein Spaziergänger. Genauer gesagt sein Hund, ein Retriever, glaube ich. Der kam plötzlich mit einem Unterarm der Toten an. Der Hundebesitzer muss kurz vor einem Herzinfarkt gestanden haben. Offensichtlich hat er mit der Tat nichts zu tun. Laurenzo hat ihn vernommen.“
„Ach, Carlos ist auch hier? Das ist aber schön. Hat er ein Telefon, das wir abhören können?“
„Laurenzo?“ Höfftner quittierte mit einem Lächeln Knoops ungenaue Frage.
„Nein, der Hundebesitzer.“
„Frag Laurenzo.“ Sie zeigte auf einen Mann, der am Boden kniete und in einem Holzkasten wühlte. „Laurenzo, kommst du mal? Wir haben Besuch für dich.“
Laurenzo erhob sich, dabei murmelte er etwas, weil er sich in der Arbeit gestört fühlte. Als er Knoop erkannte, glitt ein Lächeln über seine Züge. Carlos Laurenzo war Kriminalkommissaranwärter. Krause, schwarze Haare rahmten sein rundes Gesicht ein. Sein fetter, massiger Körper verriet seine Abneigung zu aktivem Sport. So stöhnte er dann auch, als er sich überschnell aufrichtete und auf Knoop zustürmte. Er war etwas kleiner als Mikael. Die beiden umarmten sich.
„Hallo Mickey, wie geht’s? Ich dachte, du bist auf deinem Sportwochenende.“
Knoop winkte ab. „Man hat mich dienstverpflichtet.“
„Mickey?“ Ingrid Höfftner mischte sich in die Unterhaltung der beiden Männer ein. „Ist mir neu, wie man dich so ruft. Übrigens, Laurenzo hat inzwischen die beiden Mitbewohner des Zimmers und die Nachbarn einvernommen. Aber sag mal: Woher kennt ihr euch so gut - so als Bruder unter Brüdern?“
Laurenzos Gesicht verfärbte sich. Er blähte die Backen aus und wollte lospoltern. Knoops abwertende Handbewegung ließ ihn aber verstummen.
„Lass!“, beruhigte er seinen Kollegen.
Carlos atmete tief durch. „Ich bin noch nicht durch. Ich habe nur mit denjenigen gesprochen, die Deutsch konnten. Das waren nicht viele. Das Bild ist ziemlich uneinheitlich. Fest steht, die Tote soll 'plemplem' sein. Hatte Geisterbesuche oder Ähnliches. Sie sprach auch mit ihnen. Hokus Pokus, du verstehst?“ Er machte wischende Handbewegungen vor seinem Kopf. „Das ist die Aussage verschiedener Personen.“
„Ich nehme an, dies hier ist nicht der Tatort?“ Mikael wiederholte die Handbewegung von Höfftner.
Carlos nickte. „Wie, du weißt?“ Er machte eine Kopfbewegung in Richtung seiner Kollegin.
„Und das Alibi der anderen Zimmerbewohner?“
Laurenzo schüttelte den Kopf. „Das wird schwierig. Sie haben etwas gegen Polizei, haben leider keine Uhr, wenn sie mich denn überhaupt verstehen. Sie sind alle hier im Gebäude gewesen. Mehrere haben die beiden Zimmergenossinnen zur Tatzeit gesehen. Auch andere Heimbewohner bestätigen dies. Man hat da draußen vor der Türe gequatscht und gealbert. Das sagen unabhängig von einander mehrere Zeugen.“ Laurenzo warf einen Blick in seine Aufzeichnungen. „Die Zimmernachbarin aus diesem Raum hat sogar behauptet, Mafalele habe ihren nahen Tod vorausgesagt. Einer Spur müssen wir noch nachgehen. Ein Bewohner aus der unteren Etage hat behauptet, die Tote gehöre zum horizontalen Gewerbe. Es ist aber bisher nur eine singuläre Aussage.“
„Prostituierte?“, staunte Knoop.
„Weiß ich noch nicht. Kann sein, kann aber auch Eifersucht sein. Der Zeuge hat nach anderen Aussagen die Tote gemocht. Wir müssen hier noch weiter...“
„Meine Herrn Kollegen. Könnte der Freier vielleicht Benjamin Schnittler sein?“ Ingrid Höfftner wedelte mit einer Ansichtskarte.
In der Tat hatte ein Benjamin Schnittler Urlaubsgrüße aus Borkum an die Tote geschickt. Nach wenigen Minuten wussten die drei Kommissare, dass es eine Person solchen Namens gab und dass diese in Schermbeck wohnte.
„Wenn wir hier fertig sind, dann werden wir ihn besuchen.“ Höfftners Ironie wechselte zu einem dienstlichen Sprachgebrauch.
Einer von der Spurensicherung kam mit einer Einkaufstüte und hielt sie ihnen geöffnet hin. Es war Krimskrams, bunte Figuren und abstruse Gegenstände, Kakteenstacheln steckten in Stoffteilen. Knoop drehte seine Nase weg. Es roch stärker noch als Pferdeurin. Die Sammlung unterstrich jedoch, was Carlos bei der Befragung herausgefunden hatte. Der Hang zum Okkulten war naheliegend.
Es war Laurenzo, der hinten auf dem Kleiderschrank einen flachen Karton fand. Höfftner bestand darauf, die Schachtel zu öffnen. Obenauf lag eine Kinderpuppe. Es handelte sich um einen Mann. Mitten durch die Brust hatte man diesem einen Holzstab gespießt. An den ausgestreckten Armen baumelten Bilder von Waffen, wie Kinder sie zu malen pflegen. Darum hatte man bunte Steine und Trockenobst garniert. Der Fotograf musste seine Arbeit unterbrechen, um das Leeren des Inhalts zu dokumentieren. Als Höfftner die erste Lage vorsichtig herausnahm, kamen alte, vergilbte Fotografien zutage. Sie zeigten mehrere Brustbilder eines alten Mannes, der immer die gleiche bunte Strickmütze trug. Im V-Ausschnitt seines mit bunten, geometrischen Mustern gestalteten Hemdes baumelte eine Vielzahl von Ketten. Teils waren dies aufgereihte Muscheln, teils hatte man daran Zähne verschiedener Tierarten zusammengebunden. Weitere Bilder zeigten ein Kind, welches ein Äffchen auf dem Arm hielt. Waren diese ersten Fotos Farbbilder, so kamen darunter noch solche in schwarzweiß zum Vorschein. Vor einer kugelförmigen Hütte stand ein Ehepaar. Das Bild war unscharf, so dass man die Gesichter der Personen nicht genau erkennen konnte. Es handelte sich aber zweifellos um Mann und Frau, vielleicht ein Ehepaar. Auffallend war, die Frau stand einen Halbschritt hinter dem Mann.
„Wir werden wohl nie erfahren, welche Bedeutung diese Fotografien für die Tote hatten“, murmelte Carlos.
Höfftner legte die Fotos beiseite und holte danach einige handbeschriebene Blätter hervor. Die Handschrift war ungelenk. Der Schreiber hatte sich wohl Mühe gegeben, war aber offensichtlich des flüssigen Schreibens nicht sehr mächtig.
„Was ist das denn für eine Sprache?“ Höfftner fluchte.
„Kenn´ ich auch nicht. Es ist aber bestimmt kein Spanisch“, bemerkte Carlos.
„Darf ich mal sehen?“ Knoop griff nach den Aufzeichnungen.
Widerwillig gab Höfftner sie aus der Hand. „Oh, der große Schriftexperte der Kripo.“ Sie wollte ihren Spott nicht verbergen.
Knoop strich mit der Hand durch sein dunkles, krauses Haar, welches sich schon stichelartig weiß verfärbte. Er überflog den Text, dann blätterte er langsam durch die Aufzeichnungen. Als er am Ausgangsblatt angekommen war, grinste er. „Das ist Suaheli.“
„Suaheli? Was ist das denn?“ Carlos hatte Augen wie Scheunentore.
Ingrid Höfftner sperrte nur ihren Mund auf.
„Suaheli ist neben Englisch die Hauptsprache in Ostafrika. Mafalele kommt doch aus Kenia, oder?“
Die Kommissarin nickte widerwillig.
„Ich bin vor ein paar Jahren in Kenia gewesen. Strandurlaub in Verbindung mit einer Safari. Da habe ich mir Mühe gemacht, ein paar Worte Suaheli zu lernen. Völkerverständigung – ihr versteht? Ich kann euch den Text nicht übersetzten, aber einige Worte Suaheli kann ich entziffern. 'Sana' ist 'schwer', 'Mtoto heißt 'Kind'. Und..." Er blickte auf den Bogen und blätterte. „'Ni' bedeutet 'Es sind'. Nein, für mich ist das eindeutig Suaheli. Carlos, kannst du das ans LKA schicken und übersetzen lassen?“
Laurenzo und Höfftner nickten. Laurenze lächelte dabei, während seine Kollegin die Stirne in Falten zog.
Knoop schien es an der Zeit, etwas gegen die angespannte Atmosphäre zu unternehmen, die zweifellos spürbar war. „Soll ich euch einen Kaffee besorgen?“
Carlos nickte erfreut.
Höfftner hielt ihren abweisenden Gesichtsausdruck bei. „Nee, trinke nur Pfefferminztee.“ Sie begann, den Kleiderschrank von der Wand zu rücken.
Der anderer Teil des Erkennungsdienstes vor Ort war draußen damit beschäftigt, von Personen die Fingerabdrücke einzuscannen. Einem davon hatte Knoop einen Becher Kaffee abgeschwatzt. Carlos bedankte sich überschwänglich. Während er trank, wischte er den Schweiß von der Stirn.
„Es gab leider keinen, der Pfefferminztee dabei hatte“, vermittelte Knoop.
Höfftner murmelte etwas Unverständliches, während sie alle Poster von der Wand abnahm.
Nach einer ergebnislosen Suche, die nur Zeit kostete, aber keine neuen Erkenntnisse brachte, brach man die Untersuchung des Zimmers ab. Höfftner schälte sich aus dem Sicherungsanzug. Ihre Zivilkleidung kam zum Vorschein. Sie trug Rock und Pullover. Das mit dem blauen Rock, das ging ja noch, aber der gelb-schwarze Ringelpullover war für Mikael das Letzte. Die Farben passten zwar zu der des Rocks, aber sie betonten übermäßig die Proportionen des weiblichen Körpers. Ein breiter Rettungsring umspannte ihre Bauchpartie. Er hatte wohl nur die Aufgabe, die beiden gewaltigen Brüste vor dem Herunterfallen zu stützen. Dieser Unterbau wurde verstärkt durch einen Bauch, der nicht ganz den Umfang des Rettungsrings hatte. Höfftner schüttelte ihre Haare. Dabei rutschten ihre glatten, leicht fettigen Haare nach vorne. Die Frisur sah aus, als hätte der Friseur als Hilfsmittel einen Topf benutzt. Auch die Korrektur am Handspiegel brachte keine wirkliche Änderung des Aussehens.
„Also, ab zu Benjamin Schnittler“, kommandierte Höfftner.
Knoop schüttelte unwillig den Kopf. „Nein, ich halte es für sinnvoller, wenn wir hier erst das Umfeld durchkämmen. Der Schnittler läuft uns nicht davon.“
Das Kinn von Ingrid Höfftner sackte nach unten. Die Mundwinkel folgten dem Kinn. Ihr Gesicht glich dem eines Nussknackers. Der Knoop war und blieb doch ein arrogantes Arschloch. Van Gelderen, ihr Chef, hatte sie zwar mit der Leitung der Untersuchung beauftragt, ihr aber nicht die Disziplinargewalt über ihre Kollegen gegeben. Und jetzt war dieses Gummibärchen auch noch ein guter Freund dieses Laffen. Das konnte ja heiter werden. Sie entschloss sich, die Zügel der Ermittlung fester in die Hand zu nehmen. Die bislang vorliegenden Ergebnisse schienen in die richtige Richtung zu weisen. Dies war ein Fall ganz nach ihrem Geschmack. Morde mit Prostituierten klärten sich schnell auf. So viele Möglichkeiten gab es ja auch nicht. Entweder es war der Streit um die Bezahlung oder um die Ausführung der Dienstleistung. Sie war sich sicher, diese Angelegenheit in ein paar Tagen vom Tisch zu haben. Eine solche Sache stemmte sie, Ingrid Höfftner, ratzfatz. Sie trippelte den beiden Männern hinterher, bemüht, das Gesetz des Handelns nicht aus der Hand zu geben.
Mikael Knoop hatte vor der Zimmertüre noch ein paar freundliche Worte mit dem Polizisten gewechselt. Sie hatten die Durchsuchung beendet. Die Sicherung des Zimmers war nicht mehr notwendig. Erfreut grinste der Uniformierte und begab sich nach unten. Als Höfftner erschien ging Knoop voran. Er drehte sich zu Carlos um.
„Charley, gibt es hier einen Sicherheitsdienst oder so was?“
Laurenzo schüttelte den Kopf. „Die hier in Schermbeck kommen mit einem Hausmeister aus.“
„Dann will ich mit dem Hausmeister sprechen.“
Während Laurenzo sich umschaute, wo sich der Hausmeister aufhielt, trat Höfftner unruhig auf der Stelle. „Mensch, das riecht hier wie auf einem Basar.“
Knopp lächelte zu ihr herunter. „Wenn Menschen aus dem Orient hier leben, dann riecht es hier auch wie im Orient. Wie sonst?“
Die spitze Stimme seiner Kollegin verstummte. Ihre Mundwinkel sanken wieder nach unten. Sie entgegnete aber nichts. Nach einiger Zeit tauchte Carlos mit einem Mann auf, der ihn zwei Köpfe überragte. Sein Kopf war kahl rasiert und entblößte dadurch eckige Konturen seiner Knochen. Im linken Ohr trug er ein Steckerchen. Laurenzo stellte ihn als Werner Niedrighaus vor. Niedrighaus trug eine schlabberige Jeans und ein Holzfällerhemd. Er wechselte die Zigarette und streckte dem Polizisten seine gelben Finger entgegen. Als Knoop ihm die Hand gab, lächelte der Hausmeister.
„Wenn man diesen Job hier macht, dann bekommt man nicht von jedem die Hand. Was kann ich für Sie tun?“
Knoop grinste. „Was für Leute sind hier untergebracht? Nationalitäten meine ich.“
Niedrighaus atmete tief durch. Dann bewegte er bei der Nennung jeden Namens einen Finger seiner rechten Hand. „Iraker, Syrer, Eritreer und Afghanen. Wir hatten auch mal Somalier hier, aber die sind nun in Wesel. Die haben sich immer mit den Eritreern gefetzt. Weiß der Teufel warum. Die Restlichen sind aber friedlich.“
„Ist doch klar“, mischte sich Höfftner in das Gespräch ein. „Die beiden Länder befinden sich im Kriegszustand.“
Keiner ging aber auf ihre Bemerkung ein.
„Können wir eine Liste aller Bewohner haben?“
Werner Niedrighaus kratzte an seinem Mongolenbart. „Welche wollen Sie?“
Knoop zog seine Stirne in Falten. „Ich verstehe nicht. Können Sie...“
„Wissen Sie. Wir haben hier Betten für 40 Personen. Aber es kann sein, dass sich hier mehr Personen aufhalten. Es handelt sich um Fremdschläfer, wie wir sagen. Das können Freunde, Bekannte oder Familienangehörige sein. Die kommen aus anderen Heimen. Weiß der Teufel, wie die hier an Ihre Adressen kommen. Es kann aber auch sein, dass sich hier nur 15 Menschen aufhalten.“
„Und wie viele haben sich in den letzten Tagen hier aufgehalten?“ Die Stimme gehörte zweifelsfrei Höfftner.
„Das kann ich nur schätzen. Im Moment könnten es 45 sein. Genau weiß ich es nicht. Das immer zu kontrollieren wäre ein zu großer Aufwand.“ Niedrighaus zuckte mit den Schultern. „Ich bin hier alleine. Tut mir leid, ehrlich.“
„Geld?“, mutmaßte Ingrid Höfftner. Sie unterstrich mit einer zählenden Handbewegung ihre Worte.
Der Hausmeister schüttelte seinen Kopf. „Nein, wir sind kein Gefängnis. Wir haben hier keine 24-stündige Zugangskontrolle. Auch Asylanten dürfen sich frei bewegen. Wenn auch nur in einem angeordneten Kreis. Residenzdingsbums heiß das. Nee, wer will das denn kontrollieren? Wir kontrollieren auch nicht das Geld unserer Bewohner. Ich weiß, dass man hier Zigaretten klaut, auch gibt es hin und wieder kleinere Diebstähle. Meist werden die Sachen dann versilbert. Aber von mir haben Sie das nicht.“ Werner Niedrighaus legte seine zigarettenfreie Hand auf den Mund.
„Wie sieht es hier mit Gewalttätigkeiten aus“, wollte Knoop wissen?
Niedrighaus zog die Enden seines Mongolenbarts lang. „Das ist nicht einfach zu beantworten. Meist geschieht hier nichts.“
„Sie wollen uns doch nicht erzählen, dass hier die friedlichste Asyl-Unterkunft Deutschlands ist.“ Höfftners Stimme wurde lauter.
Der Hausmeister räusperte sich. „So war das nicht gemeint. Ich dachte hier eher an Mord und Totschlag. Aber Schlägereien nach einer Sauferei, das gibt es hier schon.“





























