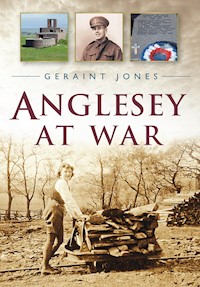13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
A. D. 9, im Norden Europas.
Die germanischen Stämme sind nahezu in die Knie gezwungen. Der Wille Roms wird von den Legionen mit eiserner Härte durchgesetzt. Der römische Statthalter Varus soll die letzten nördlichen Germanenstämme unterwerfen. Ihm zur Seite steht Arminius, ein germanischer Fürst, der nun wie viele seiner Stammesgenossen auf Seiten Roms kämpft. Doch Arminius, der es als Fremder geschafft hat, in höchste Ränge aufzusteigen, wird von vielen Römern bis aufs Blut gehasst. Für Varus ist Arminius ein Garant zum Überleben, denn nur er kennt die dichten Wälder und das tückische Gelände des wilden, barbarischen Landes. An einem schicksalhaften Tag ändern sich für beide Krieger die Pfade ihre Lebens: In den finsteren Wäldern Germaniens kommt es zu einer gewaltigen Schlacht, welche die Geschichte Europas für immer verändern wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ZUM BUCH
A. D. 9, im Norden Europas.
Die germanischen Stämme sind nahezu in die Knie gezwungen. Der Wille Roms wird von den Legionen mit eiserner Härte durchgesetzt. Der römische Statthalter Varus soll die letzten nördlichen Germanenstämme unterwerfen. Ihm zur Seite steht Arminius, ein germanischer Fürst, der nun wie viele seiner Stammesgenossen auf Seiten Roms kämpft. Doch Arminius, der es als Fremder geschafft hat, in höchste Ränge aufzusteigen, wird von vielen Römern bis aufs Blut gehasst. Für Varus ist Arminius ein Garant zum Überleben, denn nur er kennt die dichten Wälder und das tückische Gelände des wilden, barbarischen Landes. An einem schicksalhaften Tag ändern sich für beide Krieger die Pfade ihres Lebens: In den finsteren Wäldern Germaniens kommt es zur gewaltigen Varus-Schlacht, welche die Geschichte Europas für immer verändern wird …
ZUM AUTOR
Geraint Jones war als Soldat in Irak und Afghanistan, bevor er nach seinem Ausscheiden aus dem Militär zu schreiben begann. Jones ist fasziniert von der Antike und dem Überlebenskampf des Menschen. Mit seinem Roman Der Krieger erschafft er den Auftakt zu einer Blockbuster-Historienserie, die ihresgleichen sucht.
GERAINT
JONES
DER
KRIEGER
ROMAN
AUS DEM ENGLISCHEN
VON KRISTOF KURZ
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe BLOOD FOREST erschien 2017 bei Michael Joseph/Penguin Randomhouse UK
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 09/2018
Copyright © 2017 by Geraint Jones
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Heiko Arntz
Umschlaggestaltung: bürosüd, München, unter Verwendung von Motiven von © CollaborationJS / Trevillion Images / Stephen Mulcahey / Trevillion Images
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-22301-4V001
Für meine Mutter
Prolog
Eine Armee starb. Ein Imperium wurde in die Knie gezwungen.
Der Soldat war mittendrin, war es schon immer gewesen, und obwohl er das Ausmaß der Tragödie um sich herum nicht abschätzen konnte, hatte er doch genug Kameraden fallen sehen, um zu einer unvermeidlichen Schlussfolgerung zu kommen.
»Wir sind im Arsch.« Er grinste den Mann neben sich an.
Es war ein leeres Grinsen. Das Imperium bedeutete ihm nichts. Kultur? Romanisierung? Schöne Worte für fette Politiker. Seine Welt war das Contubernium, die Zeltgemeinschaft, die Kameraden an seiner Seite. Seine Welt waren die wenigen Schritt Boden, die er über seinen Schildrand hinweg erblicken konnte.
»Sie kommen!«, rief der Zenturio.
Und dann fing es an. Eine Horde von Kämpfern brach aus dem Schutz der Bäume.
Es waren kräftige Männer, einen Kopf größer als die Römer, und wie sie so die Anhöhe hinabstürmten, wirkten sie wie Riesen. Frische Truppen, bemerkte der Soldat, noch unversehrt, mit lebhaft funkelnden Augen. Noch hatten sie nicht begriffen, dass sie auf diesem Platz womöglich den Tod finden würden.
»In Formation!«, rief der Zenturio. Der Soldat legte seinen Schild über den seines Nachbarn und verlagerte das Körpergewicht auf das vordere Bein. So schwach seine Glieder auch waren, sie gehorchten. Er spürte, wie seine Sandalen über den Matsch rutschten, und stemmte sie fester in den Boden. Im nun folgenden Handgemenge konnten wenige Fußbreit über Leben und Tod entscheiden.
Der Soldat wechselte einen Blick mit seinem Nebenmann. Vor drei Tagen war dieser Kamerad noch ein junger Krieger gewesen. Jetzt waren die Bartstoppeln auf seinem ungeschützten Hals ergraut.
Augen zurück zur Front. Die Germanen waren nur noch wenige Schritt entfernt. Sie schrien und fluchten, die Gesichter von Hass und der Vorfreude auf den Sieg verzerrt.
Dann prallten sie aufeinander, Schild auf Schild. Es krachte, splitterte. Metall bohrte sich in Fleisch, bis die Klinge auf Knochen stieß und mit einem schmatzenden Geräusch wieder herausgezogen wurde. Die Männer spuckten und knirschten mit den Zähnen. Ihre Augen waren leer vor Hoffnungslosigkeit oder funkelten in Todesverachtung.
Für den Soldaten verlor die Zeit jede Bedeutung. Er maß sein Leben in Atemzügen und wusste daher nicht, wie lange es dauerte, einen Augenblick oder eine Ewigkeit, bis die römische Linie schließlich zusammenbrach, die Germanen in die Lücke strömten und sich die Schlachtordnung in eine Reihe kleinerer Scharmützel auflöste.
Ein Krieger nach dem anderen stellte sich ihm entgegen. Die meisten nahm er nur undeutlich wahr. Er schlug zu, parierte, stach auf den Gegner ein, marschierte weiter. Nur wenige Einzelheiten prägten sich ihm ein: ein Römer, der verwirrt auf den Stumpf des Armes blickte, den ihm eine germanische Axt vom Leib getrennt hatte; eine Frau, eine Hure aus dem Tross, die die Speerkämpfer mit wilden Stabhieben auf Distanz hielt; ein Maultier im Todeskampf, dem die Augen vor Entsetzen aus dem Schädel quollen. Die Pinselstriche einer Schlacht auf der Leinwand des Krieges.
»Sammeln, sammeln, sammeln! Alle zu mir!« Der gebrüllte Befehl hatte zur Folge, dass sich die in Auflösung begriffene Schlachtreihe wieder um den Soldaten schloss. Dieser war sich nicht bewusst, dass die bellende Stimme ihm gehörte. Seine Zunge hatte aus eigenem Antrieb gehandelt – wie sein Schwertarm, der ohne sein Zutun die tausendmal geübten Hiebe ausführte.
Die kleine Gruppe hielt den germanischen Kriegern, die sie umkreisten, hartnäckig stand. Andere Soldaten schlossen sich ihnen an, schoben die Schilde übereinander und ergriffen Schwerter und Speere mit zitternden Händen. Die über dem Schlachtfeld kreisenden Aasvögel beobachteten, wie sich die Flut der Feinde an dieser Insel aus gepanzerten Männern brach.
Die Hitze des Gefechts ließ nach. Zwar wurde noch gestorben, doch der anfängliche Zusammenprall war zu einer Reihe einzelner Gefechte abgeebbt. Die Verwundeten wurden von ihrem Leid erlöst. Männer schrien in allen Sprachen des Imperiums nach ihren Müttern. Der Soldat kannte den Verlauf einer Schlacht. Diese Kampfpause war nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Es war noch nicht vorbei. Auch der Wald selbst schien den Atem anzuhalten und darauf zu warten, was als Nächstes geschah.
Was folgte, war ein Donnern vom Ende der Straße. Das Donnern von Hufschlägen.
Die Kavallerie der Germanen ging zum Angriff über, stürmte in den schmalen Pfad zwischen den Bäumen, machte die Römer nieder, die drei Tage des Schreckens überlebt hatten, nur um jetzt niedergetrampelt oder von den Lanzen der Reiter aufgespießt zu werden.
Im Angesicht dieses Ansturms löste sich die römische Schlachtordnung auf. Der animalische Fluchtreflex war stärker als jede Disziplin. Vielleicht boten die Bäume Schutz. Vielleicht gab es dort Hoffnung auf Überleben …
Einige widerstanden diesem Drang. Bissen die Zähne zusammen und kämpften dagegen an. Diese Männer waren das Rückgrat der Legion. »Haltet die Stellung, ihr verdammten Feiglinge! Stellung halten!«, rief der Zenturio, bevor er selbst unter den Hufen eines Schlachtrosses verschwand.
Die Formation brach endgültig auseinander. Lediglich ein halbes Dutzend Männer war jetzt noch um ihn – die letzten Überlebenden seines Contuberniums, Männer, mit denen er das Zelt geteilt, mit denen er so oft zum Scheißen zusammengesessen hatte, dass sie beinahe zu einem einzigen Organismus verschmolzen waren. Dieser Zusammenhalt gewährte ihnen nun einen gewissen Aufschub, da die gegnerischen Reiter einen Bogen um die erhobenen Schilde der unerschrockenen Männer machten und sich nach leichterer Beute umsahen.
Es gab nichts Ruhmreicheres als den Adler der Legion. Diese silberne Standarte war die Seele der Truppe. Während die Soldaten im Dreck starben oder in den Wald flohen, wankte der Adler. Der Standartenträger wurde durch seine vielen Wunden in die Knie gezwungen. Das Bärenfell um seine Schultern troff von Blut.
Der Soldat sah, wie der Mann zu Boden ging, wurde Zeuge des letzten Gefechts der Infanterie, die den Adler verteidigte. Erst als der Standartenträger nicht mehr weiterkämpfte, begriff der Soldat, dass der Mann mit dem heiligen Stab in den Händen gestorben war. Der Stiefeltritt eines feindlichen Kavalleristen brachte seinen Leichnam zu Fall. Dann hob ein langhaariger Krieger die Standarte hoch in die Luft und schrie, bis er heiser war. Seine Landsmänner hielten im Kampf inne und jubelten. Sie hatten eines der heiligsten Symbole Roms erbeutet.
Der Soldat hatte sich längst von der Adlerstandarte abgewandt.
Doch nicht aus Entsetzen. Er sah aus dem Augenwinkel, wie einer der Begleiter des Standartenträgers still und heimlich in den tiefgrünen Schatten des Waldes verschwand.
Bei diesem Begleiter handelte es sich um ein Maultier, und der Soldat wusste genau, was sich in den Kisten befand, die auf seinen schweißnassen Flanken befestigt waren – die Soldkasse der Legion. In diesem Wald der Gefallenen konnte sie die Gelegenheit zu einer Wiedergeburt darstellen.
Der Soldat ergriff sie.
TEIL I
1
Ich hatte schon schlimmere Orte zum Sterben gesehen.
In dem schattigen Wäldchen aus gewaltigen, uralten Eichen herrschte verdächtige Stille, von dem zu erwartenden Chor aus Vogelstimmen war nichts zu hören. Der durch das hohe Blätterdach sichtbare Himmelsstreifen war so blau wie die Augen der Menschen, die dieses Land der endlosen Wälder und reißenden Flüsse bewohnten – die Germanen.
Ich hatte sie zum ersten Mal weit weg von hier gesehen, und obwohl die Gesichter jener Krieger mit der Zeit undeutlich geworden waren, erkannte ich ihre knurrende, kehlige Sprache und ihren massigen Körperbau sofort wieder: dichte Bärte, breite Schultern und muskulöse Gliedmaßen. Im Vergleich zu meiner eigenen, inzwischen dürren und sehnigen Gestalt erschienen sie wie wahre Götter.
Von ihren Gottheiten hatte ich bis heute Morgen nichts gewusst. Jetzt wünschte ich mich in diesen seligen Zustand der Unwissenheit zurück.
Denn die germanischen Götter liebten Opfer. Menschenopfer.
Ich hatte ganz in der Nähe auf einem Lager aus Erde und Farnblättern geschlafen und daher die Tat selbst glücklicherweise nicht mit ansehen müssen. Erst der Geruch hatte mich angelockt, der Duft von gebratenem Fleisch. Mein Hunger war größer als der Wunsch nach Einsamkeit gewesen. Ich hatte ein Lagerfeuer vermutet und mich vorsichtig genähert, um – je nachdem, wer sich dort ein Festmahl zubereitete – ein paar Bissen zu erbetteln oder zu stehlen.
Doch der Schmaus, den ich vorfand, war allein den Göttern vorbehalten. Ich zählte sechs Körper in sechs verkohlten Weidenkörben über inzwischen erkalteten Feuerstellen. Die überkreuzten Ledergürtel um die Hüften der rußschwarzen, verschrumpelten Leichen verrieten mir, dass es sich um römische Soldaten handelte. Das wusste ich, weil ich selbst einer gewesen war. Sechs weitere Kameraden lagen im Kreis auf dem Boden, sodass sich ihre Füße berührten. Ihre Bäuche waren aufgeschlitzt, die Eingeweide auf ihrer Brust aufgehäuft.
Ja, es gab schlimmere Orte, um zu sterben, aber es gab weitaus angenehmere Todesarten. Beim Anblick der bluttriefenden Innereien und zerteilten Muskeln wurde mir übel. Ich musste mich übergeben, doch nur eine jämmerliche Handvoll halbverdauter Beeren landete auf dem Waldboden.
Wieder beobachtete ich die daliegenden Männer. Ihre Gesichter waren vom Schmerz und der Demütigung verzerrt. Wie hatte ich ihre Schreie überhören können?
Und wie das Hufgetrappel, das in diesem Augenblick hinter mir ertönte?
Sie hatten mich fast erreicht. Am gegenüberliegenden Ende des Hains blitzten Rüstungsteile zwischen den Bäumen auf.
Bei allen Göttern. Römische Kavallerie. Mein Fluchtweg war abgeschnitten.
Jetzt sah ich auf der anderen Seite auch die Infanteristen. Sie bahnten sich in Gefechtsformation einen Weg durch den Wald. Die Männer hatten den Blick auf das Unterholz vor sich gerichtet und mich noch nicht bemerkt. Die Beute dieser Treibjagd war seit Langem über alle Berge. Die Fußsoldaten würden allein mich in die wartenden Lanzen der Reiterei treiben.
Ich warf einen Blick auf die im Kreis liegenden Leichen und wusste genau, was ich zu tun hatte. Und doch zögerte ich, noch als ich bereits die lateinischen Worte der Soldaten hörte.
»In Linie bleiben! Du – stich mit dem Speer in den Busch da! Und behaltet auch die Baumwipfel im Auge!«
Nein, sie würden mich wohl kaum übersehen. Mir blieb keine andere Wahl.
Ich kniete mich neben einen der auf dem Boden liegenden Männer. Er war Ende vierzig und wahrscheinlich kurz vor Ende seiner Dienstzeit gewesen. Seine Lippen waren aufgerissen – er hatte sie sich vor Schmerz entzweigebissen. Ich sah die Insekten, die über die aufgehäuften Organe in die tiefe Höhle seines ausgeweideten Bauches krochen.
Ich steckte die Hand hinein und tastete nach der Leber. Mein Messer war nur wenige Zoll lang, und es war stumpf, weil es mir so lange Zeit so gute Dienste geleistet hatte. Aber für meine Zwecke reichte es. Ich schnitt die Leber heraus, bohrte das Messer tief in den Leichnam, ließ es dort stecken und schlug mich in die Büsche.
Mein Versteck – dichtes Dorngestrüpp – war ideal. Ich riss mir die zerfetzte Tunika vom Leib und stopfte sie unter ein paar Wurzeln in den Erdboden. Dann wälzte ich mich hin und her, sodass sich die Dornen in meine Haut bohrten. Schon flossen die ersten Blutstropfen – meine Tarnung. Mit dem Blut kam auch die Erinnerung. Wieder sah ich die in der Sonne glühenden Hügel über einem hellblauen Meer, sah mich selbst, wie ich mit blutverschmierten Gliedmaßen durch widerspenstiges Gestrüpp lief, hörte das Hundegebell, das der Wind mit sich trug …
Die Dornen bohrten sich immer tiefer in meine Haut.
Zwei Männer betraten den Hain. Ich blieb still liegen. Da ich an den unruhigen Grenzen des Römischen Reiches gelebt hatte, erkannte ich die üppigen Ornamente und Verzierungen auf dem Schild eines Mannes sofort: ein Präfekt, der dritthöchste Rang in einer Legion und der höchste, den ein Mann erreichen konnte, der nicht aus einer Senatorenfamilie stammte. Dieser Soldat hatte über dreißig Jahre an den Fronten des Imperiums gedient. Ich schätzte ihn auf etwa fünfzig, und er ähnelte auf gewisse Weise seinem Schild: massiv gebaut, rau an den Kanten und im Mittelteil etwas nach außen gewölbt. Selbst der eiserne Schildbuckel fand seine Entsprechung in der großen Knollennase des Offiziers.
Der Mann an seiner Seite war allerdings noch interessanter: nur halb so alt wie der Römer, aber dennoch der geborene Anführer. Das Selbstbewusstsein, das er verströmte, ließ auf einen Menschen von edler Geburt schließen. Doch dieser Mann war auffallend hochgewachsen und hatte blondes, schulterlanges Haar. Offensichtlich ein germanischer Adliger, vermutlich aus einem mit dem Imperium verbündeten Königreich.
Er betrachtete die Körbe und ihren Inhalt mit einem wissenden Lächeln, das er sorgfältig vor seinem Begleiter verbarg. Schließlich deutete er auf die Ledergürtel. Er war zu demselben Schluss gekommen wie ich.
Ich zwang mich dazu, still dazuliegen und zu lauschen, ruhig durch den offenen Mund zu atmen. Durch halbgeöffnete Augenlieder sah ich, was vor sich ging.
»Ein Soldat. Aber keiner von meinen.« Der ältere Veteran zuckte mit den Schultern. »Die Arbeitstrupps sind alle vollzählig. Vielleicht ein Spähtrupp von einem der Kastelle am Rhein?«
»Nur zwölf Mann?«, gab der große Germane zu bedenken.
»Sie könnten von der ersten Legion sein. Das sind zähe Burschen, Herr«, fügte er hinzu. Er schwieg einen Moment, bevor er fortfuhr. »Sechs in Käfigen, sechs ausgeweidet.«
Die Frage, die in dieser Feststellung mitschwang, konnte ihm der Kavallerieoffizier nicht beantworten. »Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Vielleicht überhaupt nichts.« Er zuckte mit den Schultern. »Aber eins kann ich dir sagen, Caeonius, und das kannst du dem Statthalter von mir ausrichten. Ich werde meine besten Männer und Fährtensucher auf die Barbaren hetzen, die hierfür verantwortlich sind. Die Asche ist noch warm, und dem Zustand der Leichen nach haben sie wohl nicht mehr als einen Tag Vorsprung. Wenn überhaupt.«
Der Präfekt – Caeonius hatte ihn der Germane genannt – nickte eifrig. Nach Jahrhunderten der Eroberung wusste die ganze Welt, dass der Rachedurst des Römischen Reichs unstillbar war. Der Zorn des Imperiums würde so sicher wie der fahle Herbst über diese Wälder kommen.
»Herr, ich werden den Männern befehlen, die Toten zu bestatten.« Der alte Soldat salutierte und wollte davongehen, blieb allerdings wie angewurzelt stehen, als er die unerwartete Antwort seines jüngeren Vorgesetzten hörte.
»Nein«, sagte der Kavallerieoffizier knapp.
Caeonius überlegte gerade, wie er sein Anliegen höflicher formulieren konnte, als der Germane neben einem verkohlten Käfig in die Hocke ging. Er bedeutete dem Römer, näherzutreten. Der mürrische Veteran gehorchte und kauerte sich ebenfalls mit knackenden Gelenken hin.
»Da.« Der Adlige deutete unter den Rand des Käfigs. »Siehst du den Holzkeil, der im Rahmen steckt? Sobald der Käfig bewegt wird, setzt dieses Seil hier ein Gewicht frei« – er deutete auf eine aus Schlingpflanzen geflochtene Schnur – »das denjenigen, der den Käfig berührt, erschlägt.«
»Erschlägt, Herr?«, fragte Caeonius, während der Kavallerieoffizier den Blick über die Baumkronen schweifen ließ.
»Dort.« Er deutete mit wenig triumphierender Miene auf einen dicken Ast, der in einem unnatürlichen Winkel vom Stamm abstand. Ich hatte ihn ebenfalls bemerkt. Anscheinend hatten ich und der Germane etwas gemeinsam. Wir kannten uns beide mit den schmutzigen Tricks des Krieges aus. »Wenn der Ast aus dieser Höhe auf dich herabfällt, bist du auf der Stelle tot.«
»Ist denn nichts mehr heilig?«, knurrte der Veteran, der sich zweifellos nach den guten alten Tagen des Kampfes Mann gegen Mann zurücksehnte. Die Ironie dabei war, dass der Hain, in dem er stand, seinen ursprünglichen Bewohnern sehr wohl heilig war. Die Römer dagegen waren für die Vernichtung, nicht die Bewahrung fremder Kulturen bekannt. »Danke, Herr«, fügte der Präfekt in aufrichtigem Ton hinzu. »Dann sollen sich die Sklaven um die Leichen kümmern.«
Sie standen vor den auf dem Boden liegenden Körpern, keine drei Schritt von mir entfernt. Hinter mir hörte ich die sich langsam nähernden Legionäre. Wahrscheinlich rechneten sie nicht mehr damit, jemanden aufzustöbern. Trotzdem würden sie mich früher oder später entdecken.
Es war höchste Zeit.
Ich stand auf.
»He«, rief ich den beiden Offizieren zu und hob mit zitternden Händen ein Legionärsschwert. Natürlich zitterte ich vor Angst, aber ich musste auf sie wirken wie ein Mann am Rande des Wahnsinns.
Die beiden Offiziere drehten sich um. Der Römer griff nach seinem Schwert, doch der Germane hob beschwichtigend die Hand. Der Edelmann hatte sich schnell von seinem Schrecken erholt, und sein offen stehender Mund verzog sich schon bald zu einem schiefen Lächeln, als hätte er soeben den besten Witz des Imperiums gehört.
»Du da«, krächzte ich heiser, da ich seit Wochen kein Wort gesprochen hatte.
Staunend betrachteten sie mich. Nur eine Schicht aus tiefrotem Blut bedeckte meinen nackten Körper. Außerdem hatte ich unter Würgen in das kalte Fleisch der Leber gebissen und sie wie einen Schwamm benutzt, um mich von einem heruntergekommenen Landstreicher in eine blutüberströmte Schreckgestalt zu verwandeln.
»Du da«, sagte ich erneut, richtete das Schwert auf den Germanen und blinzelte das Blut aus den Augen. »Wer bist du?« Ich wankte.
Er hob langsam die geöffneten Handflächen und sprach mit ebenso bestimmter wie freundlicher Stimme. Wenn er glaubte, ein Gespenst statt eines Mannes aus Fleisch und Blut vor sich zu haben, ließ er sich nichts anmerken. »Ich bin Arminius und befehlige eine dem Römischen Reich unterstellte Kohorte cheruskischer Reiterei. Ich wurde als cheruskischer Fürst in Germanien geboren, bin aber römischer Bürger. Und wer bist du, mein Freund?«
Ich ließ das Schwert in den Staub fallen. Nun verließ mich der letzte Rest meiner Kraft.
Es war vorbei.
»Ich weiß es nicht.«
2
Kurz darauf verlor ich das Bewusstsein. In einem engen Militärzelt kam ich wieder zu mir. Da ich einst Soldat gewesen war, hatte ich oft unter ähnlichen ausgebleichten Ziegenlederbahnen geschlafen. Die Geräusche, die von draußen hereindrangen, stammten unverkennbar von einem Feldlager. Das Trampeln genagelter Sandalen; das Klirren von Metall auf Metall; Zeltpfosten, die in den Boden gehämmert wurden; gebrüllte Befehle, manche auf Latein, andere in einer mir unbekannten Sprache.
Offensichtlich befand ich mich im Lager der germanischen Hilfstruppe. Und sogar im Quartier ihres Kommandanten Arminius, wie ich feststellte, nachdem ich mich im Zelt umgesehen hatte. Anscheinend lebte er recht bescheiden, was ihn zweifellos beliebt bei seinen Männern machte. Die einzigen Hinweise auf seinen Status als Befehlshaber waren eine Feldkiste und eine auf einem Tisch ausgebreitete Landkarte.
Eine Karte! Wo war ich? Mein Ziel lag im Norden, doch ich hatte mich durch dichte Wälder geschlagen und ausschließlich an der Sonne orientiert. Hoffentlich war ich nicht vom Weg abgekommen, in die entgegengesetzte Richtung und noch tiefer in das Römische Reich hineinmarschiert.
Das musste ich unbedingt herausfinden. Ich musste einen Blick auf die Karte werfen.
Doch stattdessen richtete ich meine Aufmerksamkeit zum Zelteingang, durch den in diesem Augenblick Arminius trat. Das freundliche Lächeln passte so gar nicht zu seinen wachsam funkelnden Augen.
»Habe ich dich geweckt?«, fragte er in einem Latein, das weitaus besser zu sein schien als meins.
Das Schweigen war mein Verbündeter, beschloss ich und schüttelte langsam den Kopf.
»Na gut. Wein?« Er hatte bereits eingeschenkt und drückte mir einen Becher in die Hand. Sobald ich begriff, dass er sich neben mich auf die Pritsche setzen wollte, rutschte ich hastig beiseite.
»Auf deine Genesung«, sagte er und nahm einen tiefen Schluck. »Du hast viel durchgemacht.«
Ich murmelte einen Dank und trank gierig. Der Wein war ausgezeichnet. Als er meine Kehle hinunterrann, weckte er eine Erinnerung an die Heimat: die Sonne über dem Mittelmeer, warme Hügel, blaues Wasser. Wie lange war das jetzt her?
»Danke«, sagte ich. Es war ehrlich gemeint und klang trauriger als beabsichtigt. Arminius dagegen hielt mich für verwirrt.
»Du bist ohnmächtig geworden. Wir dachten schon, du wärst tot.« Er hielt inne, und ein Schatten huschte über sein Gesicht. »Diese anderen Männer, waren das deine Kameraden?«
Ich zuckte mit den Schultern. Das Schweigen war mein Verbündeter.
»Ein Verstärkungstrupp von den Garnisonen am Rhein«, erklärte Arminius, dann sah er mir mit eindringlichem Blick in die Augen. Mein Bauchgefühl warnte mich eindringlich vor diesem Mann und seiner Wachsamkeit. Ganz offensichtlich würde er meine Tarnung durchschauen, und ich würde mit einem Schrei auf den Lippen sterben. Ich umklammerte den Becher in meiner Hand noch fester. Wenn ich ihm den über den Schädel zog und ihm dann an die Gurgel ging …
»Du bist ein Soldat, mein Freund«, sagte er und unterbrach meine Mordfantasien. »Du warst zwar nackt, aber deine Sandalen sind die eines Legionärs.«
Ich blickte auf meine Füße. Neue Sandalen aus glattem Leder. Wahrscheinlich glänzten die Metallnägel in der Sohle noch. Plötzlich vermisste ich meine alten Schuhe, diese guten Kameraden. Dann verfluchte ich mich, dass ich diesen Hinweis auf meine Vergangenheit nicht abgelegt hatte.
Ich zuckte mit den Schultern und berührte unwillkürlich die Tunika, die man mir im Schlaf angezogen hatte. Sie war tiefrot – ideal, um Blutspuren zu verbergen.
Arminius folgte meinem Blick und las meine Gedanken. »Nackt kannst du nicht durch das Lager laufen. Wir sind ja keine Briten.«
Die Briten. Als Kind hatte ich einen Briten zum Freund gehabt. Ein Sklave, der mir viel von seinem Volk erzählt hatte. Wilde Stämme jenseits des Nordmeeres, die nicht unter römischer Herrschaft standen und weder Abgaben zahlen noch Vergeltung fürchten mussten. Julius Caesar hatte das Meer vor sechzig Jahren überquert, mit den südlichen Stämmen Frieden geschlossen und Handelsbeziehungen geknüpft. Ich wollte dem Weg, den er genommen hatte, folgen. Im Schatten der weißen Klippen hoffte ich, dem hasserfüllten Blick des römischen Adlers zu entgehen.
»Zu deinem Trupp gehörten auch mehrere Veteranen«, sagte der Germane. »Du hast selbst ein paar Narben aufzuweisen, Soldat.«
Soldat. Diese Rolle wurde ich offenbar nicht los. Selbst ohne die Sandalen hätte jeder Veteran die Geschichte deuten können, die meine Haut erzählte. Und dieser Germane verfügte über eine Menge Kriegserfahrung, so viel war sicher.
»Ich bin Kavallerist. Ich sitze im Sattel, seit ich gehen kann. Und als Kavallerist schaue ich immer nach vorn, mein Freund. Genau das musst du auch tun. Vielleicht gibt es Dinge in deiner Vergangenheit, an die du dich nicht erinnern willst oder kannst. Sei’s drum. Schau nach vorn.«
Ich nickte wie betäubt. Worte, bloße Worte.
Die Zeit löscht bestimmte Erinnerungen. Warte lange genug, und selbst das Gesicht deiner Mutter wird undeutlich und verschwommen. Aber die grässlichen Dinge? Die schlimmen Dinge? Die Dinge, die wir vergessen wollen? Die vergessen wir niemals. Sie suchen uns heim, sobald wir die Augen schließen.
»Du brauchst einen Namen«, sagte Arminius plötzlich. »Wie wäre es mit Felix? Der Glückliche?«
Ich nickte. So sollte es sein. Felix war ein Name wie jeder andere. Arminius war offenbar zufrieden damit, sprang auf, schenkte sich erneut Wein ein und legte den halb geleerten Schlauch auf die Karte. Beim Gedanken an die Antworten, die auf dieser zu finden waren, schlug mein Herz schneller.
»Jetzt, wo du einen Namen hast, brauchst du auch einen Beruf. Du darfst dich mir gerne anschließen, Felix. Meine Einheit besteht aus Germanen meines eigenen Stammes, den Cheruskern. Ich könnte in deinem Fall eine Ausnahme machen, aber deinen Beinen sieht man deutlich an, dass du kein Kavallerist bist. Stimmt’s?«
Ich schüttelte den Kopf, was entweder Nein oder Keine Ahnung bedeuten konnte. Egal. Er hatte einen Platz für mich gefunden.
»Die siebzehnte Legion«, verkündete Arminius. »Dein Trupp war eigentlich für die achtzehnte bestimmt, aber … irgendwie glaube ich, dass dir ein Neuanfang guttun wird.«
Das konnte ich nicht so recht nachvollziehen. Ich würde so oder so Aufsehen erregen, egal, wo ich landete. Man würde wissen wollen, wo ich herkam und wo meine Kameraden abgeblieben waren. Schließlich bestand ein Verstärkungstrupp üblicherweise nicht nur aus einem Mann.
Ein Kopf tauchte im Zelteingang auf. Der hässliche Kopf eines Germanen. Er teilte seinem Fürsten etwas in seiner Muttersprache mit, dann zog sich die Fratze wieder zurück.
»Berengar sagt, dass dein neuer Kommandant eingetroffen ist«, berichtete Arminius. »Doch bevor du mich verlässt, muss ich selbst noch mit ihm reden. Ruh dich noch etwas aus, Felix. Nimm dir Wein. Mein Zelt ist dein Zelt.« Er hielt mir die Hand hin – der Offizier dem Soldaten, eine ungewöhnliche Geste, doch was war an diesem Fürsten schon gewöhnlich? Eingeschüchtert schüttelte ich sie.
»Auf bald, mein Freund«, sagte er und verließ das Zelt. Seine Worte hallten in meinem Kopf nach. Auf bald. War das nur ein einfacher Abschiedsgruß oder hatten sie eine tiefere Bedeutung?
Doch darüber konnte ich mir jetzt keine Gedanken machen. Ich trat eilig zu der Karte hinüber. Sie war überaus detailliert. Flüsse, Straßen, Dörfer und Kastelle waren darauf verzeichnet. Es gab nur ein Problem – ich wusste nicht, wo ich mich befand.
Nun, dem Ausschnitt der Karte nach zu urteilen in der Provinz Germania Magna, einem Gebiet östlich des Rheins, das von zahlreichen mit Rom verbündeten Stämmen beherrscht war. Diese Stämme entrichteten Tribut an Rom, manche – wie etwa Arminius’ Volk – stellten sogar Kämpfer für die Hilfstruppen, die die eigentliche Hauptstreitmacht des Imperiums bildeten. Die römischen Legionäre hingegen agierten vor allem als Stoßtrupps, bildeten die schwere Infanterie und waren Dreh- und Angelpunkt der römischen Grenzverteidigung.
Wenn ich mich in Germanien befand, dann bestand die Hoffnung, dass ich in der richtigen Richtung unterwegs gewesen war. Höchstwahrscheinlich war die Armee am Rande des römischen Einflussbereiches stationiert, und der lag im Osten und Norden. Ich spürte, wie meine Zuversicht wuchs, was aber auch am Wein liegen konnte.
Vorsichtig näherte ich mich dem Ausgang. Ich hörte Stimmen. Ich spähte durch den Spalt der Zeltbahnen. Einer der Sprechenden war Arminius. Er wirkte entspannt und gleichzeitig gebieterisch. Ihm gegenüber stand ein nervös und verbittert aussehender Offizier, ein Zenturio, wie an dem querstehenden Kamm auf seinem in der Sonne glitzernden Helm zu erkennen war. Diese markante Gestalt war wohl mein neuer Kommandant. Arminius bekleidete zwar den höheren Rang, befand sich jedoch außerhalb der Befehlskette des Zenturios. Offensichtlich hatte Arminius diesen Mann in der Hand, und ich fragte mich, womit.
Ich würde viel Zeit haben, darüber nachzudenken, wie ich mit wachsender Sorge begriff. Mein Gefängnis verfügte zwar nur über Lederwände, doch davor warteten Wachposten. Von Arminius und dem Zenturio ganz zu schweigen. Genauso gut hätte ich in den tiefsten Verliesen Roms sitzen können.
Ich griff nach meinem einzigen Trost: dem Wein.
3
Anfang des Sommers war die Stadt Minden von mehreren Hundert Cheruskern bewohnt gewesen, Angehörigen jenes germanischen Volksstammes, der Arminius’ Geschlecht die Treue geschworen hatte. Wie in den beiden vorherigen Jahren hatte der Statthalter der germanischen Provinzen – ein Aristokrat namens Varus – drei seiner fünf Legionen hinter den Steinmauern ihrer Kastelle am Rhein hervorgeholt und durch die angrenzenden Gebiete marschieren lassen, um Freund wie Feind gleichermaßen zu beeindrucken. Auf Arminius’ Rat hin hatte der Statthalter beschlossen, das Feldlager in diesem Sommer in Minden aufzuschlagen. Eine Zeltstadt war entstanden, die zwanzigtausend Soldaten beherbergte.
Vor der Ankunft der Römer war Minden nicht mehr als eine bloße Siedlung gewesen. Nach der Ankunft der Armee war es immer noch eine Siedlung, nur dass diese Siedlung jetzt über jede Menge Prostituierte verfügte, darunter auch einige Einheimische, die die Gelegenheit nutzten, die ihnen so unverhofft sozusagen in den Schoß gefallen war. Andere waren der Armee aus den Winterquartieren entlang des Rheins gefolgt. Und sie kamen nicht allein. In ihrer Begleitung waren Musiker, Gaukler, Diebe und die inoffiziellen Frauen und unehelichen Kinder der Soldaten. Den Legionären war es verboten zu heiraten, doch solange ihr Anhang den Kommandanten keine Probleme bereitete, drückten diese ein Auge zu.
Außerdem hatte die Truppe einen gewaltigen Durst mitgebracht, und so gab sich jedes zweite Haus in Minden, mochte es noch so klein und schäbig sein, als Wirtshaus aus. In die anderen Häuser wurden die jungen Frauen des Ortes eingesperrt, um ihre Jungfräulichkeit nicht zu gefährden.
Dies alles erzählte mir Pavo, mein neuer Zenturio. Er war noch ziemlich jung für diesen Posten, was entweder bedeutete, dass er besonders tüchtig war oder über Beziehungen verfügte. Der gut aussehende Mann strahlte das für seinen Rang erforderliche Selbstvertrauen aus, doch sein verächtlicher Blick verriet eine gewisse Bitterkeit, die an ihm zu nagen schien.
Zunächst hatten wir das germanische Lager schweigend durchquert. Pavo hatte mich anfangs wie einen streunenden Hund durch Grunzen und schnelle Handbewegungen herumgescheucht. Ich war ihm hinterhergetrottet und hatte weiter die Rolle des Verwirrten gespielt. Irgendwann war mir aufgefallen, dass er sich ständig nach mir umdrehte. Anscheinend hatte ich seine Neugier geweckt, und als wir uns dem Hauptlager und Minden selbst näherten, plauderte er mit mir über die Siedlung und den diesjährigen Feldzug wie mit einem alten Freund.
Ihm zufolge hatte es überhaupt keinen richtigen Feldzug gegeben. Statthalter Varus hatte die drei Legionen von der westlichen Rheinseite aufmarschieren lassen, um mit dieser Machtdemonstration die streitlustigen germanischen Stämme einzuschüchtern. Doch anstatt die Gebiete der Länge und Breite nach zu durchstreifen, hatte sich Varus damit begnügt, seine Zelte in Minden aufzuschlagen und dort Hof zu halten, den Tribut von den verbündeten Stämmen zu kassieren und diejenigen, die sich nicht blicken ließen, ungeschoren davonkommen zu lassen. Aus eigener Erfahrung wusste ich jedoch, dass nicht alle Germanen willens waren, die römische Besatzung noch länger zu tolerieren.
»Und jetzt, Herr?«, fragte ich den Offizier.
»Hast du etwas gesagt?«, fragte er. Anscheinend war er in Gedanken gewesen.
Ich nickte respektvoll und wiederholte meine Frage.
»Jetzt?«, knurrte er. »Jetzt packen wir unsere Sachen und marschieren zum Rhein zurück. Ein ganzes verdammtes Jahr ohne Beute.«
Kriegsbeute. Das also war seine Schwäche. Pavo war entweder geldgierig, verschuldet oder – was am wahrscheinlichsten war – beides. Hatte ihn Arminius etwa damit in der Hand?
Jetzt, da ich endlich den Mund aufgemacht hatte, zerstreute Pavo meine Besorgnis mit einem heuchlerischen Lächeln. »Ich habe von dem Hain und den Männern gehört, die dort geopfert wurden«, sagte er.
Das überraschte mich nicht. Soldaten tratschen wie die Waschweiber. Die Geschichte hatte sich zweifelsohne bereits im ganzen Lager verbreitet.
»Tja, dass du ganz allein hier bist, wirft natürlich Fragen auf.« Er blieb stehen und legte freundschaftlich eine Hand auf meine Schulter. »Aber darüber musst du dir keine Sorgen machen, hörst du? Wenn es Probleme gibt, dann komm einfach zu mir.«
Ich nickte dankbar und wir gingen weiter. Anscheinend war der Zenturio der Meinung, dass ich unter Arminius’ Schutz stand. Das Wohlwollen des Fürsten erstaunte mich ja selbst, und ich konnte es mir nur mit der Laune eines Augenblicks erklären.
Wir betraten das Lager durch ein offen stehendes Holztor. Wachposten patrouillierten auf dem Wehrgang darüber. Zu beiden Seiten des Tors verlief ein von angespitzten Holzpfählen gekrönter Erdwall, der bereits von grünem Gras bedeckt war. Was als vorübergehendes Lager gedacht gewesen war, stand nun schon seit Monaten. Dennoch folgte es dem vertrauten Aufbau eines römischen Heerlagers. Eine breite Straße verlief schnurgerade vom nördlichen zum südlichen Tor. In der Mitte des Lagers befand sich das Hauptquartier, in dem vermutlich der Statthalter residierte. Die Soldaten waren gemäß der Schlachtordnung aufgeteilt: eine Legion nach Kohorten, eine Kohorte nach Zenturien, eine Zenturie nach Contubernia. Römische Disziplin vom Feinsten. Obwohl ich noch nie einen Fuß in dieses Lager gesetzt hatte, wusste ich allein aufgrund des Weges, den wir zwischen den säuberlich aufgereihten Zelten einschlugen, wohin wir gingen – zum Quartiermeister.
Dieser stand hinter einem langen Holztresen, blankpoliert von der Ausrüstung Tausender Soldaten. Mit seiner blassen, von Muttermalen übersäten Haut und seiner massigen Statur glich er einem Marmorklotz. Meiner Erfahrung nach waren hässliche Menschen in der Regel entweder besonders freundlich oder jähzornig.
»Scheiße, was willst du, Pavo?«
Dieser Quartiermeister war offensichtlich Letzteres.
»Der Mann hier braucht Ausrüstung.« Pavo deutete mit dem Daumen auf mich.
»Dass wir einen Neuzugang kriegen, hat mir niemand gesagt«, knurrte der Koloss. »Was ist das für einer?«, fragte er Pavo, als wäre ich überhaupt nicht da.
»Einer von meinen Männern. Gib ihm seine Sachen, alles andere regeln wir später.«
»Wenn’s sein muss«, sagte der Quartiermeister und griff nach der Ausrüstung, die hinter ihm aufgestapelt war.
»Ist Titus schon zurück?«, fragte Pavo den Mann, der immer mehr Gegenstände vor sich auftürmte.
»Seit heute Morgen. Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn sprechen will. Anscheinend gibt’s hier bald Beute zu machen, und wenn er draufgeht, ohne mir vorher meinen Anteil zu geben, werd ich auf seine beschissene Leiche pissen.«
Pavo ging nicht auf diese wüste Drohung ein. »Welche Beute?«, fragte er stattdessen. »Der Statthalter wird bald aufbrechen. Wir marschieren zum Rhein zurück.«
»Wollte er, ja. Aber jetzt sieht’s anders aus. Hier gibt’s immer mehr Tote, und die sterben auf ziemlich unschöne Art und Weise. Gestern wollte ein Pioniertrupp eine Brücke auskundschaften. Sie sind bis auf einen einzelnen Mann niedergemetzelt worden. Und im Wald passierte noch Schlimmeres. Die Ziegenficker haben unsere Jungs bei lebendigem Leib verbrannt. Jetzt muss ich mich um die Bestattungsriten kümmern, als hätte ich nicht schon genug zu tun.«
Ich erstarrte vor Schreck, dabei hätte ich mir keine Sorgen zu machen brauchen. Der Quartiermeister hatte mich völlig vergessen. Seine Worte waren ausschließlich an Pavo gerichtet. Der Zenturio wiederum widerstand tapfer dem höchstwahrscheinlich unwiderstehlichen Drang, mich anzusehen.
»Das heißt noch lange nicht, dass es Krieg gibt. Varus ist ein fauler Sack.«
»Der schon, aber dieser Germane nicht.«
»Welcher Germane?«
»Arminius.«
Pavo tat weiter unbekümmert, obwohl ich spürte, dass die Neugier von ihm ausstrahlte wie Wärme von einem Ofen. Hoffentlich war mein eigenes Interesse nicht ganz so offensichtlich.
»Er trägt einen römischen Namen?«, fragte der Zenturio.
»Ja.« Der Quartiermeister wuchtete ein rostiges Kettenhemd auf den Tresen. »Sein Vater und sein Onkel waren Häuptlinge. Sie haben ihn als Geisel nach Rom geschickt. Er hat erst den neuen Namen angenommen und wurde dann Offizier der Kavallerie. Angeblich ein verdammt guter Soldat. Naja, Varus glaubt jedenfalls, dass diesem Germanen die Sonne aus dem Arsch scheint. Außerdem hat Arminius mit den anderen Stämmen noch ein paar Hühnchen zu rupfen.«
»Behauptet wer?«
»Die Gerüchteküche.« Der Koloss zuckte mit den Schultern. »Aber ich denke, da ist was dran. Dafür habe ich die Geschichte zu oft gehört.« Er betrachtete den Stapel vor sich und ließ sich schließlich dazu herab, mich mit seiner Aufmerksamkeit zu beehren. »Hier quittieren.«
Er schob mir ein Register hin, und ich überflog die einzelnen Posten: schwerer Wurfspeer, Kurzschwert, Dolch, Helm, Ledertornister, Umhängetasche und Tragstange. Dies alles fand auf dem leicht gekrümmten Schild Platz. Der Preis, der neben dem Gegenstand aufgeführt war, wurde von meinem Sold abgezogen. Von mir aus. Ich hatte nicht die Absicht, lange hierzubleiben.
Ich tat so, als könnte ich nicht schreiben, und markierte jeden Posten mit einem Kreuz. Es war immer von Vorteil, so wenig wie möglich von sich preiszugeben, insbesondere seinen Vorgesetzten gegenüber. Wenn sie mich für einen dummen Bauern hielten, hatten sie keine Hemmungen, so frei vor mir zu sprechen wie vor einem Maultier.
Pavo grunzte zum Abschied. Ich hob den Schild samt Inhalt vom Tresen. Sofort spürte ich das Gewicht von über siebzig Pfund schmerzhaft in Armen und Schultern, doch ich konnte es mir nicht leisten, mit einem Schwächeanfall Aufmerksamkeit zu erregen.
»Und sag diesem Arschloch Titus, dass ich ihn sprechen will!«, rief uns der Quartiersmeister hinterher.
Zum Glück war es bis zur Truppe des Zenturios nicht weit. Trotzdem tat mir der Rücken weh, als wäre ein Pferd darüber getrampelt.
Pavo befehligte die zweite Zenturie der dritten Kohorte, deren Position im Lager mit einer Tuchstandarte am Ende der Zeltreihen markiert war. Das gewachste Ziegenleder der großen Zelte war von der Sommersonne gebleicht. Die Zenturie verfügte über zwölf Zelte – zehn beherbergten jeweils ein Contubernium von acht Mann, Pavo sowie sein Optio hatten ein eigenes Zelt.
Pavo führte mich zu dem Zelt, das am weitesten von seinem eigenen entfernt war. Davor saßen zwei Soldaten, die kaum dem Jünglingsalter entwachsen waren, und polierten ihre Rüstung. Sobald sich Pavo näherte, nahmen sie Haltung an, doch der Zenturio beachtete sie gar nicht. Seit der Unterhaltung mit dem Quartiermeister hatte er kein Wort mehr gesprochen. Anscheinend hatte ihm der bevorstehende Krieg zu denken gegeben.
»Da hinein«, sagte er. Dann wandte er sich ab und verschwand.
Unter den Augen der beiden jungen Soldaten legte ich meine Last auf den Boden. Ich war vor Jahren schon einmal in einer ähnlichen Situation gewesen und hatte damals auf schmerzhafte Weise lernen müssen, dass man nicht einfach so müde und erschöpft ins Zelt taumelte. Stattdessen holte ich tief Luft und ließ die Schultern kreisen. Die beiden jungen Legionäre starrten mich unverwandt an.
Natürlich hatten sie inzwischen begriffen, dass ich neu im Contubernium war, aber mein Alter und mein Aussehen gaben ihnen Rätsel auf. Obwohl es nicht ungewöhnlich war, dass auch ältere Männer verpflichtet wurden, wenn Mangel an jungen Rekruten herrschte. Mit meiner Ankunft waren sie in der Hackordnung nach oben gerutscht, und wahrscheinlich überlegten sie, ob sie mir dieselbe raue Behandlung angedeihen lassen sollten, die sie in ihren Anfangstagen ertragen hatten. Der eine der beiden öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch ein Blick aus meinen müden Augen genügte, und er klappte den Mund wieder zu. Die Männer im Zelt würden allerdings nicht so einfach einzuschüchtern sein.
Ich hob meine Sachen auf und trat ein.
4
Das Ziegenleder war so ausgebleicht, dass die Spätsommersonne beinahe ungehindert ins Zelt fiel. Es war fast taghell im Innern.
Ein Contubernium bestand aus acht Männern. Zwei waren vor dem Zelt, also hätten sich fünf darin befinden müssen. Doch ich zählte nur vier.
Zwei lagen ausgestreckt auf ihrem Lager, einer davon schnarchte leise. Die beiden anderen würfelten und schoben kleine Münzstapel hin und her – harmlose Einsätze unter Freunden, um sich die Zeit zu vertreiben. Es waren ausnahmslos Veteranen, wie an den Silberplättchen auf ihren Gürteln zu erkennen war.
Zunächst bemerkten sie mich nicht, sondern hielten mich für einen der jüngeren Soldaten. Erst als ich keine Anstalten machte, das Zelt sofort wieder zu verlassen, hoben sie die Köpfe und glotzten mich an.
Ich stand mit meiner Ausrüstung in den schmerzenden Armen da und erwiderte ihren Blick. Nach einigen Augenblicken der neugierigen Feindseligkeit sah ich mich wie beiläufig nach einem Platz für meine Sachen um und entdeckte einen in der gegenüberliegenden Ecke. Dazu musste ich an den Veteranen vorbei. Ich beachtete sie kaum, spürte aber ihre Blicke auf mir und rechnete jeden Moment mit irgendeiner Schikane. Doch nichts geschah. Das konnte nur eins bedeuten: Ihr Anführer – der sogenannte Contuberniumskommandant – war nicht anwesend.
Ich legte den Schild so vorsichtig in der Zeltecke ab, als wäre er ein kleines Kind. Dann breitete ich übertrieben sorgfältig meine Decke auf dem gestampften Boden aus, legte mich darauf und zwang mich, die Augen zu schließen und so unbekümmert wie möglich dazuliegen.
Ich spürte ihre bösen Blicke, aber niemand sagte etwas. Was mich beinahe enttäuschte – schließlich wollte ich es so schnell wie möglich hinter mich bringen.
Ich stellte mich schlafend, was ziemlich anstrengend war. Angespannt erwartete ich das Unvermeidliche. Drei der Männer kamen und gingen, der vierte schnarchte weiter friedlich vor sich hin. Vor dem Zelt waren die Bürsten der jungen Soldaten zu hören, die über die Rüstungen kratzten. Der Gestank der Holzasche, die sie als Politur benutzten, waberte ins Zelt.
Schließlich fiel ein Schatten auf mich. Für einen Moment hoffte ich, dass es nur eine vor der Sonne vorbeiziehende Wolke und nicht die Silhouette eines riesigen Mannes wäre. Doch diese Hoffnung verpuffte in dem Moment, als ich seine Stimme hörte. Wie Stahl auf Kies.
»Wer zum Henker bist du?«
Ich ließ mich dazu herab, die Augen zu öffnen und möglichst unbeteiligt dreinzublicken. Das war nicht leicht.
Sein Kopf berührte die Decke des Zeltes, seine Schultern waren so breit wie eine Zenturie in Schlachtformation. Zu meiner Überraschung hatte dieser Muskelberg ein recht hübsches Gesicht, wenn es auch momentan zu einer Grimasse der Verachtung verzerrt war. Tiefe Krähenfüße umgaben seine wachen Augen. Seine Haut war olivfarbenen. Dieser Hüne war ein Veteran der Wüstenlegionen. Wie war er in dieses Land der Wälder und Sümpfe geraten?
Schnell verscheuchte ich diesen müßigen Gedanken. Sein Werdegang konnte mir herzlich egal sein. Ich musste mich darauf konzentrieren, diese erste Begegnung mit ihm zu überleben.
»Wer zum Henker bist du?«, wiederholte er und trat näher.
Die Veteranen hinter ihm warteten ab, was er als Nächstes tat. Die beiden jungen Soldaten standen im Zelteingang, um diese wichtige Lektion nicht zu verpassen. Außer mir lag nur noch ein weiterer Mann auf dem Boden, der schlafende Soldat, der inzwischen aufgewacht war, den Kopf auf die Hand stützte und das Ganze mit einem belustigten Lächeln auf den Lippen beobachtete.
Es war Zeit zu handeln.
Ich stand auf. Langsam, um die Zeltgenossen nicht zu einer unbedachten Handlung hinzureißen. Zweifellos hatten die Frischlinge berichtet, dass mich der Zenturio selbst zum Zelt gebracht hatte. Allein diesem Umstand hatte ich wohl zu verdanken, dass er mich noch nicht ungespitzt in den Boden gerammt hatte.
»Du liegst in meinem Zelt.« Seine Stimme war so tief wie ein Donnergrollen am Horizont. »Antworte mir gefälligst.«
Das tat ich, aber anders, als er erwartete.
Ich rammte ihm meinen Schädel ins Gesicht. Seine Lippe platzte auf. Seine Nase hatte ich leider verfehlt. In derselben Bewegung griff ich nach meinem Eisenhelm, um ihn als Waffe zu benutzen. Wenn ich ihren Anführer mit einem unerwarteten, zügigen Angriff außer Gefecht setzte, würden die anderen womöglich klein beigeben. Leider war er schneller und härter im Nehmen als gedacht. Ich hatte mit dem Helm erst halb ausgeholt, als er sich berappelte und die rechte Faust zu einem Aufwärtshaken ballte.
Ich trat einen halben Schritt nach links, sodass mich der Schlag nur streifte. Doch selbst das reichte, um mich fast zu Boden zu schicken. Ein fauler Zahn lockerte sich, ein Blutstrahl schoss aus meinem Mund.
Damit hatte auch mein Hieb seine Wucht verloren, sodass der Helm harmlos gegen seine Schulter prallte. Dann ging er auf mich los.
Wir wälzten uns auf dem Boden. Seine Kameraden, die offenbar ihren Mut wiedergefunden hatten, warfen sich ebenfalls auf mich. In diesem Wirbelwind aus Schlägen, Tritten und Bissen war es unmöglich zu sagen, wer wen erwischte. Ein Ellenbogen in den Rippen schmerzte auch dann, wenn er von einem Freund stammte. Jedenfalls bekam ich ordentlich mein Fett weg. Es gelang mir noch, die Zähne in ein Ohr zu schlagen, doch bevor ich es abbeißen konnte, krachte etwas gegen mein Jochbein, und alles um mich herum wurde schwarz.
Lange blieb ich nicht bewusstlos. Als ich zu mir kam, hörte ich noch das Keuchen der Männer, die mit mir gerungen hatten. Es war ein wundervoller Augenblick – ich fühlte mich leicht, der Schmerz hatte noch nicht eingesetzt. Ich behielt die Augen geschlossen und kostete den Kupfergeschmack des Blutes, das über meine Zähne in meine Kehle rann. Anscheinend hatte auch der Hüne die rote Flüssigkeit bemerkt und hielt es für weiser, mich nicht sterben zu lassen.
»Dreht den Drecksack auf die Seite, bevor er erstickt.« Grobe Hände ergriffen mich und rollten mich herum. Meine Nase wurde auf den Boden gedrückt. Ich registrierte erleichtert, dass sie die Rauferei offensichtlich unbeschadet überstanden hatte.
Dann öffnete sich der Eingang des Zelts, es wurde heller und ich hörte eine vertraute Stimme. Zenturio Pavo.
»Titus, was hast du mit ihm angestellt, verdammte Scheiße?«
Titus. Der Hüne war also jener Soldat, den der Quartiersmeister so unbedingt hatte sprechen wollen.
Der Mann zuckte mit den Schultern. »Ich kann das erklären.«
»Nur zu.«
»Er ist auf mich losgegangen. Die anderen können es bezeugen.«
Ich hörte, wie die Männer ihm beipflichteten.
»Ist er tot?«, fragte Pavo.
»Nein«, meinte Titus. Er klang beinahe enttäuscht.
»Also weiß er noch, wie man kämpft«, sagte Pavo. Dann hob er die Stimme, damit ihn alle Anwesenden hören konnten. »Er gehört jetzt zu eurem Contubernium, also macht das Beste draus. Titus, in mein Zelt. Ihr anderen, kümmert euch um ihn.«
Pavo entfernte sich. Titus folgte ihm, die anderen Veteranen hoben mich auf meine Decke. Ich wollte etwas sagen, brachte aber kein Wort zustande. Ich war ziemlich mitgenommen. Helle Punkte tanzten vor meinen Augen. Wie gerne wäre ich wieder ohnmächtig geworden, denn inzwischen hatte der Schmerz eingesetzt und brannte wie eine Feuersäule in meinem Körper.
Die Schmerzen verließen mich auch in den nächsten beiden Tagen nicht. Immer wieder schlief ich ein und wurde kurz darauf von heftigem Kopfweh geweckt. Mein linkes Auge war blutverkrustet und verschwollen. Ich konnte es nicht öffnen. Gelegentlich hörte ich, wie sich meine »Kameraden« über mich unterhielten.
»Der ist wahnsinnig. Ein ganz harter Bursche. Das ist ein schlechtes Omen.«
Anscheinend hatten sie herausgefunden, wo und wie man mich gefunden hatte. Das konnte ich unter Umständen zu meinem Vorteil nutzen. Wenn sie abergläubisch waren, würden sie mich zufriedenlassen und auch nicht nach meiner Vergangenheit befragen.
Am zweiten Tag im Zelt platzte an meinem verwundeten Auge eine Eiterblase auf. Ein Veteran – ein potthässlicher Kerl mit Pockennarben und einer vom Kinn herabhängenden Hautwulst, die an den Kehllappen eines Gockels erinnerte – wischte die austretende Flüssigkeit ab. Dabei ging er ziemlich grob vor. Er erfüllte eine Pflicht, keinen Akt der Barmherzigkeit.
»Wird er das Auge verlieren?«, fragte Titus.
»Ich bin kein Arzt«, murmelte der Veteran.
»Wäre das Beste«, fügte Titus an. »Ein Einäugiger hat im Gefecht nichts zu suchen. Pavo wird ihn beim Tross oder sonst wo unterbringen müssen.«
»Wenn er es verliert, dann verliert er es«, entgegnete der Veteran. Seinem Tonfall nach zu schließen war er nicht gewillt, meiner Blindheit nachzuhelfen.
Während jener Tage, die ich auf meinem Lager zubrachte, lernte ich viel über meine neuen Kameraden.
Titus, der Anführer des Contuberniums, war die meiste Zeit abwesend, ohne dass die anderen wussten, wo er steckte. Irgendwann kam er mit einem Haufen Münzen zurück, von denen er ein paar an diejenigen verteilte, die seine Pflichten im Lager übernommen hatten. Pavo rief ihn des Öfteren zu sich in sein Zelt, doch worüber sich die beiden dort unterhielten, war den anderen ein Rätsel. Wahrscheinlich ging es um besagte Münzen.
Als die Schwellung an meinem Auge nachließ, konnte ich den inzwischen vertrauten Namen und Stimmen auch Gesichter zuordnen. Titus’ vier engste Freunde und Vertraute waren allesamt Veteranen. Der vorlauteste von ihnen war ein Soldat in den Zwanzigern, den alle nur »Stummel« nannten. Wie alle Spaßvögel war auch er insgeheim von einer tiefen Traurigkeit erfüllt. Er hatte im vergangenen Sommer bei einem Scharmützel mit einem germanischen Stamm ein paar Finger verloren – daher der Spitzname – und ließ keine Gelegenheit aus, sich darüber zu beklagen.
Rufus stammte aus Gallien. Der rothaarige Kelte hatte eine Familie außerhalb des Lagers. Er redete nicht viel, woraus ich schloss, dass er auch nicht besonders glücklich war. Außerdem war er ein duplicarius, was bedeutete, dass er den doppelten Sold erhielt. Um diesen Status zu erlangen, musste man schon eine Heldentat vollbracht haben.
Einer der jüngeren Veteranen war ein heilloser Schwärmer, der nicht nur mit Eifer die römischen Götter anbetete, sondern auch die Legion. Wenn er sich lang und breit über die herrlichen kulturellen Errungenschaften ausließ, die Rom den barbarischen Völkern brachte, fragte ich mich, warum man mir aufs Auge und nicht auf die Ohren geschlagen hatte. Diesen Blödsinn hatte ich mir in der Vergangenheit oft genug anhören müssen und wusste, wohin er führte. Aufgrund seiner blassen Haut und der platten Visage hatten ihn seine Kameraden »Mondgesicht« getauft.
Der Veteran, der mir den Eiter aus den Augen gewischt hatte, war bei seinen Kumpanen wegen seines verkniffenen Gesichtsausdrucks und des schlaffen Hautlappens an seinem Hals als »Hühnerkopf« bekannt. In acht Monaten hatte er seine zwanzigjährige Dienstzeit beendet, weshalb ihm die lästigsten Pflichten erspart blieben. Er war genug marschiert und hatte genug gekämpft. Pavo sorgte dafür, dass er seine letzten Tage in der Armee in der relativen Bequemlichkeit des Zelts absitzen durfte.
Die beiden jüngeren Soldaten hießen Micon und Cnaeus. Von ihnen sah und hörte ich wenig. Sie waren die Sklaven des Contuberniums, die putzen, kochen und alle anderen unangenehmen Aufgaben erledigen mussten. Wie alle Rekruten waren sie schwierig einzuschätzen, da sie sich in der Anwesenheit der Veteranen, zu denen sie wie zu Halbgöttern aufsahen, kaum etwas zu sagen trauten.
Das letzte Mitglied war zwar kein ausgebildeter Legionär, aber dennoch nicht aus dem Contubernium wegzudenken: Lupus, ein Kater mit grauem Fell, um den sich insbesondere Hühnerkopf kümmerte. Sobald der hässliche Veteran eines seiner häufigen Nickerchen machte, rollte sich die Katze neben ihm oder in seinem Helm zusammen. Abends fütterte Hühnerkopf Lupus mit Fleischstücken, die er aus eigener Tasche bezahlt hatte.
»Sobald ich entlassen werde, geht’s zurück nach Italien«, sagte er, während er mein Auge abwischte. »Und Lupus kommt mit. Dann bekommst du einen ganzen Bauernhof, auf dem du dich austoben kannst, nicht wahr, Lupus?« Hühnerkopf grinste breit. Jeder Soldat erhielt bei seiner Entlassung ein Stück Land, üblicherweise irgendwo am Rand des Imperiums. »Denk nur an die vielen Mäuse!«, sagte der Soldat. »Denk nur an die vielen Mäuse!«
Am dritten Tag konnte ich mich zum ersten Mal auf einen Ellbogen aufstützen. Die Schmerzen hatten nachgelassen, und das Auge eiterte nicht mehr.
Die Veteranen würfelten gerade, als Titus eintrat. Er warf mir einen verwirrten Blick zu, bevor er sich mit ebenso aufgeregter wie ängstlicher Miene den Veteranen zuwandte.
»Scheiße«, murmelte Hühnerkopf, der ahnte, was dieser Gesichtsausdruck bedeutete.
»Was denn?«, fragte Stummel.
»Krieg«, sagte Titus nur. Offensichtlich wusste er selbst nicht so genau, wie er auf die Neuigkeit reagieren sollte. »Es gibt Krieg.«
5
Zumindest in meiner Gegenwart wollte Titus nicht preisgeben, woher er dies wusste, doch es schien mehr als ein Gerücht zu sein, denn in den nächsten beiden Tagen ließ Pavo die Zenturie zum Exerzieren antreten.
Da ich immer noch unter meinen Verletzungen litt, war ich am ersten Tag entschuldigt. Am zweiten kam Pavo jedoch im Zelt vorbei, um nach mir zu sehen.
»Kannst du laufen?«, fragte er vorsichtig. Anscheinend wusste er immer noch nicht genau, wie gut ich mit dem offenbar so mächtigen Arminius stand.
Trotz der Schmerzen richtete ich mich auf und zeigte es ihm. Ich tat es nicht aus Heldenmut, im Gegenteil. Im Feld konnte ich am leichtesten desertieren, und um ins Feld zu kommen, musste ich mich gefechtsfähig präsentieren.
»Ich kann laufen, Herr.«
Er gab ein nicht besonders überzeugtes Grunzen von sich. »Zieh nur die Tunika an. Keine Rüstung. Dann werden wir sehen.«
Ich kam einigermaßen zurecht. Der Zweck des Exerzierens besteht darin, dass die Manöver den Soldaten in Fleisch und Blut übergehen. Und selbst wenn meine Muskeln noch arg in Mitleidenschaft gezogen waren, so vollführte ich die Bewegungen mit schlafwandlerischer Sicherheit wie alle anderen Soldaten. In Zenturienstärke übten wir einfache Formationswechsel wie den Übergang von der Marschkolonne zur Gefechtslinie oder die Verteidigung der Flanken.
Die Hälfte der achtzig Männer zählenden Zenturie waren erfahrene, um die dreißig Jahre alte Veteranen, die seit mindestens zehn Jahren Dienst taten. Viele wiesen die entsprechenden Embleme auf ihren Rüstungen auf, darunter auch Titus, Hühnerkopf und Rufus. Der rothaarige Gallier hatte sogar die corona muralis verliehen bekommen. Das erklärte natürlich seinen Status als duplicarius.
Etwa zwei Dutzend Soldaten in unseren Reihen waren so jung, dass ihnen kaum der erste Bart wuchs. Diese Frischlinge sorgten mit schöner Regelmäßigkeit dafür, dass Pavo und sein Stellvertreter, Optio Cato, vor Wut aus der Haut fuhren.
Für gewöhnlich war Micon aus unserem Contubernium Ziel ihres Zorns. Das Pickelgesicht konnte kaum links und rechts auseinanderhalten, was in unseren Reihen dasselbe Chaos veranstaltete wie Hannibals Elefanten in den Armeen unserer Vorfahren.
»Micon, du Rindvieh!«, brüllte Pavo. »Wenn du meine Formation noch mal durcheinanderbringst, werde ich die Hure suchen, die dich geworfen hat, und dich zurückstopfen, woher du geschlüpft bist!«
In den Pausen blieb ich für mich, aber ich merkte, wie ich aus der Ferne beobachtet wurde. Titus war in der Zenturie allgemein bekannt und beliebt. Die anderen Veteranen wandten sich daher mit ihren Fragen über mich an ihn. Sie wussten offensichtlich nicht so recht, was sie mit mir anfangen sollten. Ich für meinen Teil war zufrieden damit, in Ruhe gelassen zu werden. Anscheinend hatte ich die Prügel nicht umsonst kassiert. Jetzt wussten sie, dass ich mich nicht so leicht herumschubsen ließ. Nach einer Weile verloren sie das Interesse an mir und wandten sich wieder anderen Themen zu.
Mit halbem Ohr lauschte ich ihren Erzählungen über militärische und sexuelle Eroberungen. Detailliert beschrieben sie schöne Frauen oder machten sich über frühere Kameraden lustig. Wenn das Gespräch auf eine Schlacht kam, kniffen sie die Augen zusammen und starrten ins Nichts. Dieses Ritual wurde täglich in jeder Legion des Imperiums wiederholt und diente nicht allein dazu, sich die Zeit zu vertreiben. Solche Unterhaltungen waren der Leim, der die Truppe zusammenhielt. Und irgendwo hatte ich sie sogar vermisst.
Am zweiten Tag ließ uns Pavo nach dem Drill in zwei Reihen zu jeweils vierzig Männern aufstellen. Die erste Reihe musste sich hinknien, da er seinen Soldaten gerne in die Augen sah. Vielleicht, weil er ihnen den Eindruck vermitteln wollte, von Mann zu Mann zu ihnen zu sprechen. Vielleicht auch nur, weil er sich vergewissern wollte, dass sie ihm überhaupt zuhörten.
»Wird es Krieg geben?«, platzte Hühnerkopf heraus, bevor Pavo überhaupt etwas sagen konnte. Der Zenturio verbiss sich seinen Ärger. Ganz offensichtlich wurde er von den Veteranen in seiner Einheit nur geduldet, war aber viel zu jung, um eine wahre Autorität darzustellen.