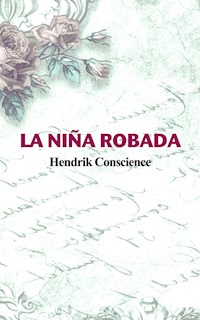Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kuebler
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Klassiker der historischen Romane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman über den Freiheitskampf der Flamen gegen die Franzosen unter Philipp dem Schönen Ende des 13. Jahrhunderts und die „Schlacht der goldenen Sporen". Nach der Ausbeutung des Landes und der willkürlichen Gefangennahme des flämischen Grafen Gwijde erheben sich ein Teil des Adels und die Handwerkerzünfte in Antwerpen und Brügge und kämpfen gegen einen militärisch weit überlegenen Feind. Pieter de Coninc und Jan Breidel, die Dekane der Weber und Schlachter und Graf Robrecht van Bethune (der „Löwe von Flandern") müssen nicht nur gegen die Besatzer, sondern auch gegen die Feinde im eigenen Land kämpfen. Conscience schuf mit Fantasie ein realistisches, idealisierendes und spannendes Werk, das in Flandern ein Klassiker ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hendrik Conscience
Der Löwe von Flandern
Reihe: Klassiker der historischen Romane
Kuebler Verlag
Das Buch
Historischer Roman über den Freiheitskampf der Flamen gegen die Franzosen unter Philipp dem Schönen Ende des 13. Jahrhunderts und die „Schlacht der goldenen Sporen“.
Nach der Ausbeutung des Landes und der willkürlichen Gefangennahme des flämischen Grafen Gwijde erheben sich ein Teil des Adels und die Handwerkerzünfte in Antwerpen und Brügge und kämpfen gegen einen militärisch weit überlegenen Feind. Pieter de Coninc und Jan Breidel, die Dekane der Weber und Schlachter und Graf Robrecht müssen nicht nur gegen die Besatzer, sondern auch gegen die Feinde im eigenen Land kämpfen. Conscience schuf mit Fantasie und Idealisierung ein realistisches und spannendes Werk, das in Flandern ein Klassiker ist.
Der Autor
Hendrik Conscience (1812-1883) war ein flämischer Erzähler und Mitbegründer der flämischen Literatur.
Er diente in der belgischen Armee und nahm danach für das Flamentum Stellung. Neben dem „Löwen von Flandern“ schrieb er mehrere erfolgreiche Romane und übte damit einen zunehmenden Einfluss auf die niederländischsprachige Literatur in Belgien aus. Seine Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Er gilt nicht nur als der volkstümlichste Autor Flanderns, sondern hatte auch einen hohen Stellenwert in der europäischen Literatur.
Diese Ausgabe
Diese Ausgabe folgt der ersten deutschen Ausgabe von 1916. Der Text ist sprachlich überarbeitet und weitgehend der aktuellen Rechtschreibung angepasst. Die blumige Ausdrucksweise wurde in der direkten Rede nur wenig abgemildert.
Hendrik Conscience
Der Löwe von Flandern
Bearbeitung von Maximilian Vonderheidt
Weitere Informationen: www.kueblerverlag.de
Impressum
Neu überarbeitete Ausgabe
Copyright © 2016 by Kuebler Verlag GmbH, Lampertheim
Bearbeitung durch Maximilian Vonderheidt
Alle Rechte vorbehalten
ISBN Printausgabe 978-3-942270-22-9
ISBN Digitalbuch 978-3-86346-304-5
An den Stamm der Vlaemen[1]
Suche nicht das Heil im Westen!
In der Fremde wohnt kein Glück:
Suchst du deines Glückes Festen,
Kehre in Dich selbst zurück!
Aus der Tugend Deiner Ahnen
Musst Du Deine Burgen bau'n,
Und der Löw' auf Deinen Fahnen
Lehre Dich, Dir selbst vertrau'n.
Treu bewahr' in Deiner Mitte
Vor dem welschen[2] Übermut
Deine Sprach' und Deine Sitte,
Deiner Väter Gut und Blut.
Dann erst kannst Du rühmend sagen,
Dass Du lebst in unsrer Zeit,
Dass erblüht in unsern Tagen
Deine alte Herrlichkeit.
Hoffmann von Fallersleben
***
[1] Flamen
[2] französischen
Kapitel 1
Langsam ließ die rote Morgensonne ihr Nachtwolkengewand fallen und jeder Tautropfen strahlte ihr leuchtendes Bild zurück. Blaue Dunstwolken stiegen von der Erde auf, ruhten zögernd in den Baumwipfeln, und zaghaft erschlossen sich taufeuchte Blumenkelche den ersten Strahlen des jungen Tages. Immer wieder hatte die Nachtigall ihr sanftes Lied erklingen lassen, aber das verworrene Zwitschern der anderen Waldsänger ließ ihre schmelzenden Töne verstummen.
Ein kleiner Trupp Ritter zog schweigend nach Rousselare.[3] Ihre Rosse stampfen und Waffengeklirr störte den schweigenden Waldfrieden. Ein Hirsch wurde aus seiner Einsamkeit aufgeschreckt, schoss aus dem Buschholz hervor und floh vor der drohenden Gefahr.
Gewänder und Waffen der Ritter waren so kostbar, dass man beim ersten Blick darauf schließen konnte, dass man Grafen oder noch höhere Herren vor sich hatte.
Ein seidener Waffenrock fiel in wallenden Falten von ihren Schultern, und ein versilberter Helm mit purpurnen und blauen Federn schmückte ihr Haupt. Die Stahlschuppen ihrer Panzerhandschuhe und die Goldmaschen ihrer Knieplatten blitzten in der flammenden Morgensonne. Die Schlachtrosse waren mit weißem Schaum bedeckt und ließen sich nur schwer bändigen. Bei ihren heftigen Bewegungen funkelten Silberknöpfe und Seidentroddeln ihres reichen Zaumzeuges in glitzerndem Farbenspiel.
Obwohl die Ritter keine Harnische angelegt hatten, waren sie doch vor feindliche Überfälle auf der Hut.
Die gepanzerten Arme sahen aus dem Wams hervor. Gewaltige Schlachtschwerter hingen an ihren Sätteln. Knappen folgten mit mächtigen Schilden. Auf der Brustseite des Gewandes trug jeder Ritter sein gesticktes Wappen, so dass man auf den ersten Blick Geschlecht und Familie erkennen konnte.
Die Morgenfrische hatte ihnen die Lust zum Sprechen genommen. Dämmerung lag schwer auf ihren Augenlidern; nur mit Mühe kämpften sie gegen den Schlummer, der sie einhüllen wollte.
Ein junger Führer schritt der edlen Schar voraus. Langes, blondes Haar wallte auf seine breiten Schultern herab. Feurige blaue Augen sprühten unter dichten Brauen hervor. Leichter Flaum beschattete sein Kinn. Um sein wollenes Gewand hatte er einen Gürtel geschlungen, und als Waffe trug er ein „Kreuzmesser“ in einer ledernen Scheide.
In seinem Gesicht konnte man leicht lesen, dass die Gesellschaft, die er führte, ihm keineswegs angenehm war. Man konnte sogar glauben, dass er einen geheimen Plan gegen sie im Schilde führte; denn von Zeit zu Zeit warf er einen Seitenblick auf die ihm folgenden Ritter. Er war von hoher, ungewöhnlich kräftiger Gestalt. Sein fester Schritt war so schnell, dass die Pferde nur mit Mühe folgen konnten.
So trabte der kleine Tross vorwärts, als plötzlich das Pferd eines Ritters über einen Baumstumpf strauchelte und stürzte, so dass der Ritter mit der Brust auf den Nacken seines Pferdes fiel und beinahe aus dem Sattel fiel.
„Was soll das bedeuten?“, rief er in französischer Sprache. „Ich glaube, mein Gaul ist im Trab eingeschlafen!“
„Herr von Châtillon“, rief ihm sein Begleiter lachend zu, „einer von beiden hat sicher geträumt.“
„Lache nur, soviel du willst, du Spötter“, entgegnete ihm der Graf von Châtillon, „es ist darum nicht weniger wahr, dass ich nicht schlief. Denn schon seit zwei Stunden blicke ich nach jenen Türmen, die sich anscheinend immer weiter entfernen, je mehr wir ihnen näher kommen wollen. Aber es ist leichter, an den Galgen zu kommen, als einmal von dir ein freundliches Wort zu erhalten.“
Während die beiden Ritter spöttisch miteinander scherzten, machten sich ihre Begleiter vergnügt auf Kosten des Grafen lustig, und der leichte Unfall hatte die Müdigkeit des ganzen Trupps verjagt.
Herr von Châtillon, der sein Ross wieder emporgerissen hatte, konnte die Anzüglichkeiten, die auf ihn gemünzt waren, nicht länger ruhig mit anhören, und in seinem plötzlich aufwallenden Zorn stieß er seinem Pferd den scharfen Sporn tief in die Weichen. Der Schmerz machte das Tier wild, es bäumte sich hoch auf und schoss dann wie ein Pfeil zwischen den Bäumen dahin. Aber nach einigen hundert Schritten stürmte es gegen den Stamm einer alten Eiche und stürzte, schwer verletzt, zu Boden.
Glücklicherweise war der Graf beim Aufprall aus dem Sattel gesprungen oder geschleudert worden; nichtsdestoweniger musste er sich ernstlich verletzt haben, denn er blieb einige Augenblicke regungslos liegen.
Als ihn seine Begleiter eingeholt hatten, stiegen sie alle von ihren Pferden, richteten ihn auf und zeigten ihm das wärmste Mitgefühl.
Der Ritter, der mit den Spötteleien begonnen hatte, schien jetzt am meisten beunruhigt zu sein, und tiefe Trauer lag auf seinem Gesicht.
„Lieber Châtillon, ich bedauere dich von ganzem Herzen. Verzeih' mir meine unbesonnenen Reden“, bat er, „ich wollte dich nicht beleidigen.“
„Lasst mich in Ruh'!“, rief Châtillon aus und riss sich aus den Armen seiner Begleiter los; „meine Herren, ich bin noch nicht gestorben. Glaubt Ihr denn, die Sarazenen hätten mich geschont, damit ich später wie ein Hund im Wald verrecken könnte! Nein, bei Gott, noch lebe ich, und du würdest deine Spötteleien auf der Stelle büßen, Saint-Pol, wenn ich mich an dir rächen dürfte.“
„Aber, beruhige dich doch“, entgegnete Saint-Pol. „Du bist verwundet, lieber Bruder; das Blut rinnt ja durch Dein Panzerhemd.“
Châtillon streifte den rechten Panzerärmel hoch und sah, dass ein Zweig die Haut geritzt hatte.
„Es ist nicht der Rede wert“, sagte er, „nur eine kleine Schramme. Aber ohne Absicht hat uns dieser verdammte Flame nicht diesen widerlichen Weg geführt. Ich werde es schon herausbekommen. Und ich will nicht mehr Châtillon heißen, wenn ich den Schurken nicht an einem Ast dieser verwünschten Eiche aufhängen lasse.“
Der Flame tat, als verstände er die französische Sprache nicht; doch sah er auf und blickte Châtillon kühn ins Auge.
„Meine Herren“, rief da der Ritter aus, „seht nur den unverschämten Blick dieses Bauernlümmels. Hierher, Schurke!“
Langsam kam der junge Mann näher. Sein Haupt war stolz erhoben; aber in seinen Augen lag ein sonderbarer Zug, ein Ausdruck, der Wut mit List vereinigte und eine so düstere Drohungen enthielt, dass sich Châtillon von einer beklemmenden Unruhe ergriffen fühlte.
In diesem Augenblick brachte plötzlich einer der Ritter, der diesem Auftritt beigewohnt hatte, sein Pferd in Trab, verschwand bald hinter den mächtigen Bäumen und gab dadurch deutlich genug seinen Unwillen zu erkennen.
„Nun also!“, herrschte Châtillon den Führer an. „Sage mir, weshalb hast du uns auf diesen Weg geführt, und warum hast du uns nicht auf den Baumstamm aufmerksam gemacht, der da im Wege lag?“
„Herr“, antwortete der Flame in gebrochenem Französisch, „ich kenne keinen anderen Weg nach Schloss Wijnendaal, und ich wusste nicht, dass Eure Durchlaucht die Gewohnheit haben, zu dieser Tageszeit auf dem Pferd zu schlafen.“
Als der Führer diese Worte aussprach, huschte ein Lächeln über sein Gesicht, das zugleich Hochmut und Ironie verriet. Man hätte meinen können, er wolle den Zorn des Grafen reizen, um ihm dann zu trotzen.
„Unverschämter Lümmel!“, schrie ihn Châtillon an, „wagst du es etwa, dich über mich lustig zu machen! Holla! Leute! Hängt mir diesen Burschen. Die Raben sollen ihn fressen.“
Das spöttische Lächeln des jungen Mannes wurde unverhohlener. Seine Mundwinkel zuckten immer verräterischer, und seine Wangen entfärbten sich.
„Einen Flamen wollt ihr hängen?“, stieß er leise hervor. „Da wartet nur, meine Herren!“
Er sprang einige Schritte zurück, stemmte sich gegen einen Baumstamm, streifte die Ärmel seines Wamses bis zu den Schultern auf und zog seinen blitzenden Dolch aus der Scheide. Die Muskeln seines nackten Armes spannten sich, und sein Gesichtsausdruck erinnerte an den eines Löwen. „Weh dem, der mich anrührt!“, rief er ihnen zu. „Flanderns Raben fressen keinen Flamen! Sie fressen lieber Franzosenfleisch!“
„Ergreift ihn!“, rief Châtillon, „ergreift den Lumpen! Seht die Feiglinge! Ihr fürchtet euch wohl vor seinem Messer? Meine Hände kann ich mit seinem Blut nicht besudeln, denn ich bin aus edlem Haus. Das ist eure Aufgabe. Pack gegen Pack! Werft euch auf ihn!“
Einige Ritter suchten Châtillon zu beruhigen. Aber den meisten wäre es nur recht gewesen, wenn man den Flamen gehängt hätte. Die Waffenträger, die durch ihren Herrn aufgereizt waren, hatten sich gerade auf den jungen Mann stürzen wollen, als unvermutet der Ritter hinzukam, der, in Gedanken versunken, vorausgeritten war. Die Kostbarkeit seines Gewandes und seiner Rüstung übertraf die der anderen Ritter bedeutend. Das gestickte Wappen auf seiner Brust enthielt drei goldene Lilien in blauem Felde unter einer Grafenkrone. Das war ein Zeichen dafür, dass königliches Blut in seinen Adern rollte.[4]
„Halt!“, rief er den Waffenträgern streng zu, und dann wandte er sich an den Grafen von Châtillon: „Herr von Châtillon, Ihr scheint zu vergessen, dass ich Flandern von meinem königlichen Bruder Philipp von Frankreich zu Lehen erhalten habe. Der Flame ist mein Vasall, und nur mir allein gehört sein Leben.“
„Dieser verächtliche Kerl soll mich also ungestraft beleidigen dürfen!“, entgegnete Châtillon voll Zorn. „Graf, es ist tatsächlich unglaublich, dass Ihr das niedere Volk immer gegen den Adel verteidigt. Dieser Flame soll sich rühmen dürfen, ungestraft einen französischen Ritter verhöhnt zu haben? Hat er den Tod nicht verdient?“
„Herr von Valois“, sagte Saint-Pol, „gönnt meinem Bruder die kleine Freude, diesen Flamen hängen zu sehen. Was kümmert Eure Königliche Hoheit das Leben dieses starrköpfigen Burschen?“
„Meine Herren“, rief Karl von Valois mit zorniger Stimme, „versteht mich recht, ich untersage es euch, in meiner Gegenwart derart zu sprechen. Ich schätze das Leben meiner Untertanen hoch ein. Lassen Sie den jungen Mann gehen. Zu den Pferden, meine Herren. Wir verlieren sonst zu viel Zeit.“
„Steig auf“, flüsterte Saint-Pol seinem Bruder zu, „antworte nicht, nimm das Pferd deines Schildknappen und komm. Herr von Valois ist ein unverbesserlicher Volksfreund.“
Inzwischen hatten die Schildknappen ihre Schwerter in die Scheiden gesteckt und führten nun ihrem Gebietern ein Pferd vor.
„Seid ihr fertig, meine Herren?“, fragte Graf von Valois, „dann beeilt euch, bitte, sonst werden wir zu spät zur Jagd kommen. Und Du, Vasall, bleib' an unserer Seite und entferne dich nicht vom Weg! Wie weit ist es noch bis Wijnendaal?“
Der junge Mann nahm höflich die Mütze ab, verbeugte sich vor seinem Retter und erwiderte: „Noch eine knappe Stunde, gnädiger Herr.“
„Der Bursche ist mir verdächtig!“, sagte Saint-Pol. „Ein Wolf in Schafskleidern.“
„Das habe ich mir schon lange gedacht“, fügte der Kanzler Pierre Flotte hinzu. „Er beobachtet uns tatsächlich wie ein Wolf und spitzt die Ohren wie ein Hase, wenn wir sprechen.“
„Aha! nun weiß ich, wer das ist!“, rief Châtillon aus. „Meine Herren, habt ihr nicht von einem Weber gehört, der Peter de Coninck heißt und in Brügge wohnt?“
„Das ist ein Irrtum“, warf Raoul de Nesle ein, „ich habe in Brügge persönlich mit dem berüchtigten Weber gesprochen, und obwohl er diesen hier an Schlauheit und Arglist weit übertrifft, muss ich Ihnen sagen, dass er nur ein Auge hat, während unser Führer zwei sehr schöne besitzt. Ohne Zweifel liebt er den alten Grafen von Flandern und sieht uns als die Sieger scheel an. Das ist's! Nehmt ihm die Treue nicht übel, die er seinem unglücklichen Fürsten hält.“
„Jetzt haben wir dieses Thema aber zur Genüge erörtert!“, sagte Châtillon. „Gibt's denn gar keinen anderen Gesprächsstoff? Halt“, fügte er hinzu, „wisst ihr übrigens, was unser allergnädigster König Philipp mit diesem edlen Flandern vorhat? Auf mein Wort: hält unser erhabener Herrscher seine Schatzkammern ebenso verschlossen wie Herr von Valois seinen Mund, so wird man uns am Hofe magere Kost reichen.“
„Das sagt Ihr so“, antwortete Pierre Flotte, „aber der König spricht auch, wenn's ihm gefällt. Reitet etwas langsamer, meine Herren, und ich will euch etwas mitteilen, wovon ihr euch nichts träumen lasst.“
Neugierig kamen die Ritter dicht an ihn heran und ließen den Grafen von Valois etwas vorausreiten. Als er weit genug entfernt war, so dass er sie nicht mehr hören konnte, ergriff der Kanzler wieder das Wort:
„Also hört: die Beutel unseres allergnädigsten Königs Philipp des Schönen sind leer. Enguerrand von Marigny hat ihn wissen lassen, dass Flandern eine wahre Goldgrube sei. Und er hat gar nicht so unrecht. Denn dies Ländchen hier besitzt allein mehr Gold und Silber als ganz Frankreich.“
Die Ritter lächelten und nickten wiederholt zustimmend.
„Hört weiter! Unsere Königin Johanna ist gegen die Flamen sehr erbittert. Sie hasst dieses hochmütige Volk unaussprechlich. Sie sagte vor einiger Zeit in meiner Gegenwart, dass sie den letzten Flamen am Galgen sehen wollte.“
„So spricht nur eine Königin“, rief Châtillon aus, „sollte ich je Statthalter dieses Landes werden – was mir ja meine hochherzige Nichte versprochen hat –, so gelobe ich euch, meine Herren, dass die Landeskasse Geld spucken wird, und dass es mir schon gelingen wird, mich dieses Peters de Coninck mitsamt seiner Gilden zu entledigen und die Plunderwirtschaft der Volksregierung abzuschaffen. Aber warum lauscht denn dieser dreiste Lump unserer Unterhaltung!“
Der Flame, der ihnen als Führer diente, hatte sich unbemerkt näher herangeschlichen und gespannt die Äußerungen, die die Ritter fallen ließen, verfolgt. Als er sah, dass man es entdeckt hatte, schoss er pfeilschnell in den Wald zurück. Ein unbeschreiblicher Ausdruck lag auf seinem Gesicht. In einiger Entfernung blieb er stehen und zog den Dolch aus der Scheide.
„Herr von Châtillon“, rief er diesem drohend zu, „seht Euch diese Klinge genau an, damit Ihr sie wiedererkennen könnt, wenn sie Euch zwischen Hals und Nacken fährt!“
„Ist denn kein einziger unter meinen Leuten, der mich rächt?“, schrie Châtillon wutentbrannt.
Kaum hatte er das gesagt, als ein gewaltiger Krieger vom Pferd sprang und sich mit bloßem Schwert auf den jungen Mann warf. Dieser steckte in aller Ruhe seinen Dolch, anstatt sich mit ihm zu verteidigen, in die Scheide zurück, ballte die Fäuste und erwartete seinen Feind.
„Stirb, verfluchter Flame!“, schrie der Waffenträger und stieß die Klinge nach dem Führer.
Der Jüngling antwortete nicht; aber er heftete seine großen Augen fest auf seinen Gegner. Dieser, dem der Blick durch und durch ging, senkte die Waffe, als versagte ihm der Mut.
„Hau ihn nieder!“, schrie ihm Châtillon zu.
Aber der Flame wartete nicht, bis der Feind sich ihm genähert hatte. Mit einem Satz hatte er den Waffenträger erreicht und ihm sein Schwert entrissen. Nun presste er ihn mit starken Armen an sich und schleuderte ihn mit dem Kopf so unbarmherzig gegen den Baumstamm, dass der Unglückliche entseelt zu Boden sank.
Sein Todesschrei hallte durch den Wald und die Augen des Franzosen schlossen sich für immer.
Ein triumphierendes Lachen entrang sich dem Flamen. Er näherte die Lippen dem Ohr des Toten, und mit beißendem Spott sagte er: „Bestelle deinem Gebieter, dass Jan Breydels[5] Fleisch nicht für die Raben gedacht ist: das Blut der Fremdlinge ist viel geeigneter für sie.“
Mit diesen Worten lief er durch das Buschholz und verschwand im Dunkel des Waldes.
Voll gespannter Furcht hatten die Ritter diesen schrecklichen Kampf mit angesehen. Aber er war so kurz gewesen, dass sie nicht ein einziges Wort hatten wechseln können. Kaum waren sie aus ihrer Bestürzung wieder zu sich gekommen, als Graf Saint-Pol ausrief: „Bruder, ich glaube tatsächlich, dass du es mit einem Zauberer zu tun gehabt hast. Bei diesem Kampf ist's nicht mit rechten Dingen zugegangen.“
„Ein verfluchtes Land!“, antwortete Châtillon zerknirscht. „Mein Pferd bricht den Hals; mein Diener bezahlt seine Treue mit dem Leben. Heute ist ein Unglückstag. Nun, Leute, nehmt euren Kameraden auf und bringt ihn, so gut es geht, zum nächsten Dorf, damit er bestattet wird. Bitte, meine Herren, sagt dem Grafen von Valois nichts von dem, was hier geschehen ist.“
„Das versteht sich von selbst“, gab Pierre de Flotte zur Antwort. „Aber, meine Herren, wir müssen unseren Pferden die Sporen geben und vorwärts kommen. Sehen Sie, Herr von Valois verschwindet schon hinter den Bäumen.“
Sie ließen ihren Rossen die Zügel schießen und waren bald bei dem Grafen, ihrem Feldherrn. Dieser ritt langsam weiter, ohne ihre Anwesenheit zur Kenntnis zu nehmen. In tiefem Nachsinnen saß er weit vorgebeugt im Sattel und sein eiserner Panzerhandschuh ruhte achtlos mit dem Zügel auf der Mähne seines Pferdes. Die andere Hand umfasste den Griff seines Schlachtschwertes, das am Sattel hing. Während ihn so seine Gedanken beschäftigten und sich die anderen Ritter wegen seiner düsteren Stimmung spöttische Blicke zuwarfen, tauchte plötzlich vor ihnen Schloss Wijnendaal mit seinen himmelhohen Türmen und riesigen Wällen auf.
„Noël!“, rief Raoul de Nesle voll Freude, „dort ist das Ziel unserer Reise. Das ist Wijnendaal, trotz Teufel und Hexerei!“
„Ich möchte es in Brand setzen“, murrte Châtillon, „es kostet mich ein Pferd und einen treuen Diener.“
Nun wandte sich der Ritter, der die Lilien auf der Brust trug, um und sprach: „Meine Herren, dort wohnt der unglückliche Landesherr Gwijde von Flandern, ein Vater, dem man sein Kind entrissen hat, und dessen Land wir durch Waffenglück gewonnen haben. Ich bitte euch, zeigt ihm nicht, dass ihr als Sieger kommt, und vergrößert sein Leid nicht durch übermütige Worte.“
„Aber, Graf von Valois“, fiel Châtillon gekränkt ein, „glaubt Ihr etwa, dass wir nicht wissen, was man von einem Ritter verlangt. Wissen wir denn nicht, dass ein französischer Ritter sich nach dem Siege edelmütig zeigen soll?“
„Ich sehe, dass Ihr's wisst“, erwiderte Graf von Valois mit Nachdruck, „ich ersuche Euch, nun auch danach zu handeln! Die Ehre besteht nicht in eitlen Worten, Herr von Châtillon. Was nützt es, die Gesetze der Ritterschaft auf der Zunge zu tragen, wenn sie Euch nicht von Herzen kommen. Wer sich aber seinen Untergebenen gegenüber nicht edelmütig erweist, wird es auch nicht im Umgang mit seinesgleichen sein.“
Dieser Vorwurf rief Châtillons Zorn wieder wach, und er wäre sicher in wütende Reden ausgebrochen, hätte ihn sein Bruder Saint-Pol nicht zurückgehalten und ihm zugeflüstert: „Schweig, Châtillon, denn unser Feldherr hat recht. Es gehört sich auch so, dass wir dem alten Grafen von Flandern kein Leid mehr zufügen. Er ist unglücklich genug.“
„Der untreue Vasall hat unserem König den Krieg erklärt und den Groll unserer Nichte Johanna von Navarra so heftig erregt, dass sie beinahe dadurch erkrankt wäre – und da sollen wir ihm noch schonend entgegenkommen.“
„Meine Herren“, rief Graf von Valois ihnen nochmals zu, „ihr kennt meine Bitte. Ich glaube nicht, dass es euch an Edelmut fehlen wird. Nun, vorwärts, ich höre die Meute bellen. Man hat uns bereits bemerkt, denn die Brücke fällt, und die Sturmegge[6] wird aufgezogen!“
Schloss Wijnendaal,[7] das der Graf Gwijde von Flandern erbaut hatte, war eins der schönsten und stärksten Schlösser jener Zeit. Aus den breiten Gräben, von denen es umgeben war, stiegen gewaltige Mauern auf, an denen eine Anzahl Wachthäuschen hing. Durch die Schießscharten konnte man die Ausschau haltenden Armbrustschützen und ihre stählernen Pfeilspitzen sehen. Innerhalb der Wälle erhoben sich die Dächer des gräflichen Hauses mit den wehenden Wetterfahnen. Sechs runde Türme standen an den Mauerecken und in der Mitte des Vorhofes. Von hier aus konnte man mit Wurfgeschossen den heranziehenden Feind treffen und ihm so die Annäherung ans Schloss erschweren. Eine einzige Brücke verband diese befestigte Insel mit den umliegenden Tälern.
Sobald die Ritter ankamen, gab der Turmwächter der inneren Wache ein Zeichen, und sogleich kreischten die schweren Tore in ihren Angeln.
Unterdes erdröhnte hallendes Stampfen der Pferde auf der Brücke, und die französischen Ritter zogen zwischen zwei Reihen flämischer Fußsoldaten in die Burg ein. Die Tore wurden hinter ihnen geschlossen. Die „Sturmegge“ mit ihren eisernen Spitzen rasselte nieder, und die Brücke ging langsam in die Höhe.
***
[3]Eine kleine Stadt in Westflandern
[4] Karl, der zweite Sohn Philipps des Kühnen, war Graf von Valois, von Alençon und von Perche. Er empfing von seinem Bruder Philipp dem Schönen, König von Frankreich, den Oberbefehl über die französische Armee und eroberte Flandern.
[5] Breydel war Anführer (Obmann) der Schlächter-Gilde in Brügge.
[6] Fallgitter
[7] Schloss Wijnendaal ist heute verfallen. Es liegt in der Nähe eines Dorfes gleichen Namens bei Thourout in Westflandern.
Kapitel 2
Die Luft war so klar und blau, dass das Auge vergeblich ihre unmessbare Tiefe zu ergründen suchte. Strahlend stieg die Sonne am Horizont auf und eine girrende Turteltaube trank die letzten Tautropfen von den grünen Blättern der Bäume. Aus Schloss Wijnendaal erklang unaufhörlich das Kläffen der Meute. Das Wiehern der Pferde mischte sich mit den Tönen des Jagdhorns. Aber die Zugbrücke war noch hochgezogen und vorübergehende Landleute konnten nur raten, was da im Gange war. Zahllose Wachen mit Armbrust und Schild schritten auf den äußeren Wällen auf und ab und durch die Schießscharten hindurch konnte man sehen, dass viele Waffenknechte innerhalb der Mauern geschäftig hin und her liefen.
Endlich erschienen einige Leute über dem Tor und ließen die Brücke herab. Da wurde es auch schon geöffnet, um die Jagdgesellschaft hinauszulassen. In dem stattlichen Zug, der langsam über die Brücke ritt, sah man folgende Damen und Herren:
Voran ritt der achtzigjährige Graf Gwijde[8] von Flandern auf einem Fuchs. Seine Haltung trug den Stempel stiller Ergebenheit. Alter und Unglück hatten sein stolzes Haupt schwer gebeugt. Seine schmalen Wangen waren tief gefurcht. Ein purpurnes Wams fiel von seinen Schultern bis auf den Sattel herab, und sein schneeweißes Haar war von einem gelbseidenen Tuche umwunden. Durch diese Hülle glich sein Haupt einem Silbergefäße mit goldenem Reif. Auf der Brust trug er in einem herzförmigen Schild den schwarzen springenden Löwen in goldenem Felde.
Der unglückliche Fürst sah sich an seinem Lebensabend, wo ihm die Ruhe als Lohn für seine Arbeit zu gönnen gewesen wäre, seiner Krone beraubt. Seine Kinder hatten durch das Los der Waffen ihr Erbe verloren, und Armut erwartete sie, die eigentlich die reichsten Fürsten Europas hätten sein müssen. Siegestrunkene Feinde umringten den unglücklichen Landesherrn, und doch gab er der Verzweiflung in seinem Herzen nicht Raum.
Neben ihm ritt Karl von Valois, der Bruder des französischen Königs. Er unterhielt sich eifrig mit dem alten Gwijde; doch es schien, als wären sie nicht einer Meinung.
Jetzt hing kein Schlachtschwert mehr am Sattel des französischen Feldherrn; ein langer Degen ersetzte die schwere Waffe; auch die blitzenden Stahlplatten hatte er von den Beinen geschnallt.
Ihnen folgte ein Ritter von ungemein wildem und trotzigem Aussehen. Seine Augen rollten, und wenn sein Blick auf einen Franzosen fiel, presste er seine Lippen ingrimmig aufeinander und knirschte mit den Zähnen.
Er war etwa fünfzig Jahre alt; aber noch beseelte ihn volle Lebenskraft, und man musste ihn mit seiner starken Brust und seinem gewaltigen Körperbau für einen starken Ritter halten. Auch sein Ross war größer als die anderen, und so überragte er den ganzen Zug um Haupteslänge. Ihn schützten sein blinkender Helm mit blauem und gelbem Federbusch, ein schwerer Waffenrock und das gebogene Schwert. Sein Koller, das von seinem Rücken bis auf das Pferd nieder wallte, trug auch den flämischen Löwen im goldenen Feld. Die Ritter jener Zeit hätten unter tausend anderen in diesem trotzigen Reiter Robrecht van Bethune,[9] den ältesten Sohn von Gwijde, erkannt.
Seit einigen Jahren hatte ihm sein gräflicher Vater die innere Regierung von Flandern übertragen. In allen Feldzügen hatte er die flämischen Heere angeführt und sich in der Fremde einen gefürchteten Namen erworben. Während des sizilianischen Krieges hatte er im Lager der Franzosen so erstaunliche Waffentaten vollführt, dass er von der Zeit an der Löwe von Flandern genannt wurde. Das Volk, das seine Helden immer liebt und bewundert, besang die Unerschrockenheit des Löwen in seinen Sagen und verherrlichte den, der einst die Krone von Flandern tragen sollte. Da Gwijde wegen seines hohen Alters Schloss Wijnendaal selten verließ und auch von den Flamen nicht sehr geliebt wurde, erhielt auch Robrecht den Grafentitel, wurde im ganzen Land als der Herr angesehen, und als solchem wurde ihm Gehorsam geleistet.
An seiner rechten Seite ritt Wilhelm, sein jüngster Bruder, dessen bleiche Wangen und schwermütigen Züge wie die eines kranken Mädchens neben dem gebräunten Antlitz von Robrecht erschienen. Seine Kleidung unterschied sich von der des Bruders nur durch das gebogene Schwert, das nur Robrecht trug.
Darauf folgten viele andere Herren, sowohl Franzosen wie Flamen. Hierunter waren die vornehmsten: Walter, Herr van Maldeghem, Karl, Herr van Knesselare, Roegaert, Herr van Axpoele, Jan, Herr van Gavere, Rase Mulaert, Dietrich der Fuchs und Gerhard der Mohr.
Die Ritter Jacques de Châtillon, Guy de Saint-Pol, Raoul de Nesle und ihre Begleiter ritten ungeordnet, liebenswürdig plaudernd, zwischen den flämischen Herren.
Ihnen folgte der junge Adolf van Nieuwland, der Sprössling eines der edelsten Geschlechter der reichen Stadt Brügge. Sein Antlitz bestach nicht durch weibische Schönheit. Das war keiner jener Männer mit rosenfarbigen Wangen und lächelndem Munde, denen zum Weib nur die Frauenkleidung fehlt. So hatte sich die Natur nicht an ihm vergangen. Die Sonne hatte seine ernsten Wangen leicht gebräunt. Durch seine Stirn zogen sich zwei Falten, die frühzeitige Klugheit ankündigten. Sein Antlitz war scharf und männlich geschnitten, und die Linien seines Körpers erinnerten an eine griechische Statue. Aus seinen Augen, die halb von den Brauen beschattet waren, leuchtete eine weiche, aber einsame Seele.
Obwohl er den anderen Rittern an Geburt nicht nachstand, blieb er doch zurück und ließ die, die geringerer Herkunft waren, vorausreiten. Mehrmals hatte man ihm Platz gemacht, um ihn nach vorn reiten zu lassen, aber er achtete nicht auf diese Liebenswürdigkeit und schien in tiefes Nachdenken versunken zu sein.
Auf den ersten Blick hätte man Adolf für einen Sohn Robrechts van Bethune halten können. Denn bis auf den großen Altersunterschied glichen sich die beiden Ritter auffallend. Die gleiche Gestalt, die gleiche Haltung, die gleichen Bewegungen! Doch war die Kleidung von anderer Farbe, und das gestickte Wappen auf Adolfs Brust zeigte drei goldblonde Mädchen auf rotem Grunde. Darüber stand sein Wahlspruch: Pulchrum pro patria mori.[10]
Dieser Jüngling war von seiner Kindheit an in Robrechts Haus aufgewachsen. Jetzt war er sein vertrauter Freund und wurde von ihm wie ein geliebter Sohn behandelt. Er schätzte seinen Wohltäter als Vater und Fürst und liebte ihn und seine Kinder von ganzem Herzen.
Dicht hinter ihm ritten die Frauen, die so prächtig geschmückt waren, dass das reiche Gold und Silber ihrer Kleidung die Augen blendete. Alle saßen auf leichten Zeltern. Ein langes Reitkleid fiel an der Seite des Pferdes über ihre Füße bis zur Erde herab. Golddurchwirkte, eng anliegende Mieder bedeckten ihre Brust, und von ihren hohen, mit Perlen geschmückten Hauben flatterten zierliche Bänder. Die meisten trugen einen Raubvogel auf der Hand.
Unter diesen Edelfrauen war eine, die durch Pracht und Schönheit alle anderen in Schatten setzte. Es war Machteld, Robrechts jüngste Tochter.
Die Maid war sehr jung. Sie war kaum älter als fünfzehn Jahre; aber ihre hohe, schlanke Gestalt, ein Erbteil ihrer edlen, mächtigen Vorfahren, die Strenge ihrer feinen Züge, die Ruhe ihrer Haltung gaben ihr etwas Königliches, Ehrfurchtgebietendes.
Obwohl die Ritter darin wetteiferten, ihr zu gefallen und ihr jede erdenkliche Höflichkeit erwiesen, entbrannte doch keiner in Liebe zu ihr. Das wäre vermessen gewesen, denn nur ein Fürst durfte Machteld von Flandern heimführen.
Traumhaft schön saß die schlanke, junge Maid lieblich in der Seide und trug ihr Haupt stolz erhoben. Während die linke Hand leicht den Zügel hielt, saß auf der Rechten ein Habicht mit roter Kappe, an der goldene Glöckchen läuteten.
Unmittelbar nach der schönen Tochter des Landesfürsten ritten zahlreiche Schild- und Hofknappen, alle in zweifarbige Seide gekleidet. Die Knechte, die zum Hause des Grafen Gwijde gehörten, konnte man leicht von den anderen unterscheiden, denn die rechte Seite ihrer Kleidung war aus schwarzem, die linke aus goldgelbem Moiré. Einige waren in Purpur und Grün, andere in Rot und Blau gekleidet, je nach den Wappenfarben ihrer Gebieter.
Endlich kamen Jäger und Falkenträger. Vor den ersteren lief die Meute von etwa fünfzig Hunden an ledernen Koppeln; darunter waren Windhunde, Bracken und Spürhunde aller Art.
Die Tiere waren von sonderbarem Ungestüm; sie zogen so stark an den Koppeln, dass die Jäger sich rückwärts stemmend ziehen lassen mussten.
Die Falkner trugen auf Querstangen allerlei Falken und Jagdvögel: Habichte, Steinfalken, Geier und Sperber. Die Vögel hatten rote, mit Glöckchen besetzte Kappen auf dem Kopf und dünne Lederhöschen an den Beinen.
Außerdem trugen die Falkner noch künstliche, scharlachrote Lockvögel mit Flügeln; die sollten die Falken nach der Jagd zurückrufen.
Sobald der Zug sich etwas von der Brücke entfernt hatte und auf einen breiteren Weg gekommen war, mischten sich die Herren, ohne auf die Standesunterschiede zu achten, untereinander. Jeder suchte sich einen Freund oder Kameraden, um die Reise durch Gespräch zu verkürzen. Sogar viele Frauen waren zu ihnen herangeritten. Doch blieben Gwijde von Flandern und Karl von Valois noch an der Spitze des Zuges, denn niemand wäre so unhöflich gewesen, an ihnen vorbei zu reiten. Robrecht van Bethune und Wilhelm hatten ihre Rosse neben das ihres Vaters geführt, und auch Raoul de Nesle war mit Châtillon zu ihrem Feldherrn geritten. Dieser blickte traurig auf das weiße Haupt Gwijdes und in Wilhelms schwermütiges Antlitz und sagte: „Ich bitt' Euch, edler Graf, glaubt mir, dass mir Euer trauriges Los sehr zu Herzen geht. Es ist mir, als hätte mich selbst Euer Unglück getroffen. Doch noch ist alle Hoffnung nicht verloren. Auf meine Bitte wird mein königlicher Bruder alles vergeben und vergessen.“
„Herr von Valois“, entgegnete Gwijde, „da täuscht Ihr Euch, Euer Fürst hat es deutlich bewiesen, dass Flanderns Untergang sein größter Wunsch ist; hat er nicht meine Untertanen gegen mich aufgestachelt? Hat er mir nicht mit unmenschlicher Grausamkeit meine Tochter Philippa geraubt und in einen Kerker geworfen? Und erwartet Ihr etwa, dass er alles wieder aufrichtet, was er so blutig zerstört hat? Fürwahr, Ihr täuscht Euch sehr, Philippe-le-Bel, Euer Bruder und König wird mir das Land, das er mir entrissen hat, nie zurückgeben. Euern Edelmut, Herr von Valois, werde ich nie vergessen, doch ich bin zu alt, um mich noch mit einer trügerischen Hoffnung trösten zu können. Meine Herrschaft ist aus. Das war Gottes Wille!“
„Ihr kennt meinen königlichen Bruder Philipp nicht“, erwiderte Valois, „seine Taten sprechen zwar gegen ihn, aber ich versichere Euch, er hat ein edles, ritterliches Herz.“
Da unterbrach Robrecht van Bethune Valois voll Ungeduld: „Was sagt Ihr – ein edles, ritterliches Herz! Bricht ein edler Ritter sein gegebenes Wort, seine Treue? Als wir mit unserer unglücklichen Philippa arglos nach Corbeil kamen, hat Euer König das Gastrecht verletzt und uns alle eingekerkert. Ist das etwa eines edlen Ritters wert?“
„Herr van Bethune“, antwortete Valois ernst, „Eure Worte sind sehr scharf. Ich hoffe, dass Ihr nicht die Absicht hattet, mich zu kränken.“
„Oh nein, auf Ehre nicht“, gab Robrecht zur Antwort, „Eure Großmut hat Euch meine Freundschaft gewonnen. Aber Ihr könnt doch nicht mit voller Überzeugung behaupten, dass Euer König ein ehrenwerter Ritter ist?“
„Hört mich an“, entgegnete da Valois, „glaubt mir, dass in der Brust Philipps des Schönen das beste Herz schlägt; aber feige Schleicher aus seiner Umgebung beraten ihn. Enguerrand de Marigny[11] ist ein eingefleischter Teufel, der ihn zum Bösen verleitet, und noch jemand treibt ihn zu unerhörten Scheußlichkeiten. Doch hier verbietet mir die Ehrfurcht, Namen zu nennen; doch gerade hier liegt die Schuld an Eurem Unglück.“
„Wen meint Ihr denn“, fragte Châtillon, obwohl er es sich denken konnte.
„Da fragt Ihr nach einer allbekannten Sache, Herr von Châtillon“, rief ihm Robrecht van Bethune zu, „hört zu, ich will's Euch sagen, es ist Eure Nichte, Johanna von Navarra,[12] die meine unglückliche Schwester gefangen hält; es ist Eure Nichte, Johanna von Navarra, die Frankreichs Geld verfälschen ließ; es ist Eure Nichte, Johanna von Navarra, die Flandern den Untergang geschworen hat!“
Châtillon wurde rot vor Zorn. Er ritt dicht an Robrecht heran und rief ihm zu: „Das ist schmählich erlogen!“
Diese Beschuldigung verletzte Robrechts Ehre. Schnell riss er sein Pferd zurück und zog sein gebogenes Schwert aus der Scheide. Schon wollte er sich auf Châtillon stürzen – da sah er, dass sein Feind keine Waffen bei sich trug. Mit sichtlichem Unmut steckte er sein Schwert in die Scheide zurück, ritt wieder auf Châtillon zu und sprach mit verhaltener Erregung: „Ich halte es nicht mehr für nötig, mein Herr, Euch meinen Handschuh zuzuwerfen. Ihr wisst, dass der Vorwurf der Lüge ein Flecken ist, der nur durch Blut abgewaschen werden kann. Noch vor Sonnenuntergang fordere ich Genugtuung für diesen Schimpf!“
„Es sei“, entgegnete ihm Châtillon, „ich bin bereit, die Ehre meiner königlichen Nichte gegen jeden Ritter der Welt zu verteidigen.“
Nun schwiegen beide und ritten wieder auf ihre vorigen Plätze zurück. Während des kurzen Streites hatten die anderen Ritter mit sehr verschiedenen Gefühlen die Worte Robrechts mit angehört. Manchen Franzosen erbitterte die Äußerung des Flamen tief; doch Ritterehre untersagte es ihnen, sich in den Streit zweier Feinde einzumischen. Karl von Valois schüttelte ungeduldig sein Haupt, und deutlich konnte man in seinem Gesicht den Unwillen lesen, den dieser Streit hervorgerufen hatte. Dagegen huschte über das Antlitz des Grafen Gwijde ein zufriedenes Lächeln, und leise sagte er zu Valois: „Mein Sohn Robrecht ist ein mutiger Ritter. Das hat Euer König Philipp bei der Belagerung von Rijssel erfahren müssen. Da hat Robrechts Schwert so manchen Franzosen erschlagen. Die Brügger, die ihn mehr als mich lieben, nennen ihn den Löwen von Flandern, und diesen ehrenvollen Beinamen hat er sich in der Schlacht bei Benevent[13] gegen Manfred wohl verdient.“
„Ich kenne Herrn Robrecht seit langer Zeit“, war die Antwort. „Jeder weiß, mit welcher Kühnheit er dem Tyrannen Manfred das Schwert entwand? Die Ritter meines Landes rühmen seine Waffentaten. Der Löwe von Flandern gilt als unüberwindlich – und mit Recht.“
Ein stolzes Lächeln erhellte das Antlitz des alten Vaters; aber plötzlich verdüsterte es sich, er beugte in tiefem Schmerze sein Haupt: „Herr von Valois, ist das nicht doppelt schmerzvoll für mich, gerade einem solchen Sohn kein Erbe hinterlassen zu können? Ihm, der dem Haus von Flandern soviel Ruhm und Ehre erworben hätte. Ach, das und die Gefangenschaft meiner unglücklichen Tochter sind zwei Schicksalsschläge, die mich gebrochen haben.“
Karl von Valois antwortete nicht auf Gwijdes Klagen. Lange Zeit hüllte er sich in tiefes Nachdenken und ließ den Zügel seines Trabers am Sattelknopf hängen. Gwijde betrachtete voll Bewunderung den edlen Freund, denn er erkannte, wie schmerzlich das Unglück des Hauses von Flandern den ritterlichen Franzosen betrübte.
Da richtete sich plötzlich Karl von Valois glückstrahlend im Sattel auf, und erfreut rief er aus: „Eine Eingebung Gottes!“
Gespannt sah Gwijde ihn an.
„Graf von Flandern“, sagte Valois, „ich will, dass mein königlicher Bruder Euch wieder auf den Thron Eurer Väter setze!“
„Und welches Mittel haltet Ihr für stark genug, dieses Wunderwerk zu vollbringen; denn er hat doch mein Land schon Euch übertragen?“
„Hört zu, edler Graf, Eure Tochter weint trostlos in den Kerkern des Louvre. Euer Erbe ist verloren. Euern Kindern blieb kein Lehen. Ich weiß nun ein Mittel, das Eurer Tochter die Freiheit und Euch Euer Land wiedergeben soll.“
„Wirklich“, rief Gwijde zweifelnd, „ich kann's nicht glauben, Herr von Valois; oder Eure Königin Johanna von Navarra dürfte nicht mehr am Leben sein.“
„Nein, das nicht! Unser König Philipp der Schöne hält in Compiègne offenen Hof. Meine Schwägerin Johanna weilt gerade in Paris, und dort hält sich auch Enguerrand de Marigny auf. Begleitet mich nach Compiègne, und lasst auch die edelsten Ritter Eures Landes mitziehen, tut Fußfall vor meinem Bruder und huldigt ihm als reumütiger Vasall.“
„Und dann?“, fragte Gwijde verwundert.
„Er wird Euch gnädig empfangen und Flandern und auch Eure Tochter freigeben. Verlasst Euch auf mein Wort, denn mein Bruder ist in der Abwesenheit der Königin der großmütigste Fürst.“
„Von Herzen danke ich Eurem guten Engel für diese glückliche Eingebung und, Herr von Valois, für Euern großen Edelmut“, rief Gwijde hocherfreut. „Oh, möge Gott mir vergönnen, dass ich durch dieses Mittel die Tränen meines unglücklichen Kindes trocknen kann! Aber wer weiß, ob in diesem gefährlichen Frankreich mir nicht auch der Kerker bevorsteht?“
„Fürchtet nichts, Graf, fürchtet nichts“, entgegnete ihm Valois, „ich selbst will Euch verteidigen und Euch treu zur Seite stehen. Und sollten unsere Bemühungen fruchtlos bleiben, so werden Euch mein Siegel und meine Ehre freies Geleit nach Rupelmonde zurück sichern.“
Gwijde ließ die Zügel los, ergriff die Hand des französischen Ritters und drückte sie in tiefer Dankbarkeit. „Ihr seid ein edler Feind“, sagte er schmerzlich.
Während dieses Zwiegespräches war der ganze Zug in eine weite Ebene gekommen, durch welche der Krekelbach rauschte. Jeder machte sich zur Jagd bereit.
Die flämischen Ritter setzten sich ihre Falken auf die Faust. Die Hunde wurden verteilt, und die Leitbänder der Jagdvögel gelöst.
Die Frauen hatten sich unter die Ritter gemischt, und es traf sich, dass Karl von Valois nun neben der schönen Machteld ritt.
„Ich glaube, anmutiges Edelfräulein“, sagte er, „dass Ihr den Preis der Jagd erringen werdet; denn einen schöneren Vogel als den Euren habe ich nie gesehen. Er hat so gleichmäßiges Gefieder, so starke Schwingen, so gelb geschuppte Klauen. Er ist wohl recht schwer auf der Hand?“
„Oh ja – sehr schwer, edler Herr“, gab Machteld zur Antwort. „Und obwohl er nur für den tiefen Flug abgerichtet ist, kann er doch Reihern und Kranichen hoch in der Luft nachjagen.“
„Es scheint mir“, bemerkte Valois, „dass Euer Wohledeln ihn zu reichlich füttern. Es wäre besser, ihm etwas schmalere Kost zu geben.“
„Oh nein, verzeiht, Herr von Valois“, rief die Maid hoheitsvoll, „aber da täuscht Ihr Euch sicherlich: mein Falke ist so gerade recht. Ich bin in der Falkenzucht nicht unkundig. Ich selbst habe diesen schönen Habicht aufgezogen, zur Jagd abgerichtet und habe nachts bei Kerzenschein bei ihm gewacht. Aus dem Weg, Herr von Valois, aus dem Weg, über dem Sumpf steigt eben eine Schnepfe auf.“
Als Herr von Valois nach der angedeuteten Stelle sah, zog Machteld ihrem Falken die Kappe ab und warf ihn hoch.
„Steig auf, mein lieber Falke!“, rief ihm Machteld nach.
Der Vogel flog himmelwärts. Das Auge konnte ihm kaum folgen. Einige Zeit ruhte er bewegungslos auf seinen Fittichen in der Luft, und seine durchdringenden Augen suchten nach dem ihm bestimmten Wild. Bald sah er die Schnepfe in der Ferne fliegen. Schneller als ein niederstürzender Stein stieß der Falke auf den armen Vogel und packte ihn mit seinen scharfen Klauen.
„Seht Ihr, Herr von Valois“, rief Machteld erfreut aus, „dass Frauenhand auch gut Falken abrichten kann. Da kommt mein treuer Vogel mit seiner Beute zurück.“
Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, als sich der Habicht mit der Schnepfe auf ihre Hand niederließ.
„Gönnt ihr mir die Ehre, das Wild aus Euern schönen Händen zu empfangen?“, bat Karl von Valois.
Bei dieser Frage wurde das Antlitz der Jungfrau traurig. Sie blickte den Ritter flehend an und sagte: „Ach, Herr von Valois, nehmt es mir nicht übel, ich habe meine erste Beute schon meinem Bruder Adolf, der da neben meinem Vater steht, versprochen.“
„Euerm Ohm Wilhelm, wollt Ihr sagen, mein edles Fräulein.“
„Nein, unserem Bruder Adolf van Nieuwland. Er ist so gut, so gefällig zu mir. Er hilft mir beim Abrichten meines Falken. Er lehrt mich Lieder und Sagen und spielt mir auf der Harfe vor. Wir haben ihn alle sehr lieb.“
Während dieser Worte hatte Karl von Valois seinen durchdringenden Blick forschend auf Machteld geheftet, doch er erkannte, dass nur Freundschaft im Herzen der Jungfrau wohnte.
„Da hat er sich diese Gunst redlich verdient“, sagte er lächelnd, „lasst Euch nur nicht durch meine Bitte länger zurückhalten.“
Ohne sich um die Gegenwart der anderen Ritter zu kümmern, rief Machteld so laut sie konnte: „Adolf, Herr Adolf!“ Und ausgelassen wie ein Kind schwang sie ihre Schnepfe durch die Luft.
Auf ihren Ruf ritt der Jüngling zu ihr heran.
„Adolf“, rief sie, „das ist Eure Belohnung für die schönen Sprüche, die Ihr mich gelehrt habt.“
Der junge Ritter verbeugte sich ehrerbietig vor ihr und nahm die Schnepfe in Empfang. Die Ritter betrachteten ihn mit neidischer Neugierde, und mehr als einer suchte auf seinem Antlitz heimliche Liebe zu entdecken – aber vergeblich! Plötzlich wurden sie aus ihrem neugierigen Forschen aufgeschreckt.
„Schnell, Herr van Bethune“, rief der Hauptfalkner, „nehmt Euerm Geierfalken die Kappe ab und werft ihn auf; denn da läuft ein Hase!“
Einen Augenblick später schwebte der Vogel bereits hoch in den Wolken und stieß dann senkrecht auf das fliehende Wild. Es war ein sonderbarer Anblick. Denn als der Falke seine Krallen in den Rücken des flüchtigen Hasen geschlagen hatte, klammerte er sich dort fest, und so stürzten beide windschnell vorwärts; doch dauerte es nicht lange. Gerade als sie an einem Buschholz vorbeiliefen, krallte sich der Falke mit der einen Klaue daran fest und hielt mit der anderen das Wild, dass es nicht fort kam, soviel es auch zappelte und sich wand. Schnell wurden einige Hunde von der Koppel gelöst. Sie stürzten sich auf den Hasen und nahmen ihn dem Falken ab.
Siegesfroh kreiste der mutige Vogel über den Hunden und flog über ihnen her bis zu den Jagdknechten; dann stieg er hoch auf und brachte seine Freude in eigenartigen Wendungen zum Ausdruck.
„Herr van Bethune“, rief Valois aus, „das ist ein Vogel, der seine Beute tapfer verfolgt. Ein herrlicher Geierfalke!“
„Ja, edler Graf, er ist der allerprächtigste“, antwortete Robrecht. „Ihr solltet einmal seine Adlerklauen bewundern.“
Mit diesen Worten warf er den Lockvogel hoch. Der Falke, der dies sah, kehrte sofort auf die Faust seines Herrn zurück.
„Seht nur“, sagte Robrecht und zeigte Valois den Vogel, „seht nur das schöne Blond seines Gefieders, die silberweiße Brust und seine hohen, bläulich glänzenden Krallen!“
„Ja, Herr Robrecht, das ist allerdings ein Vogel, der keinen Adler zu fürchten braucht“, antwortete Valois, „aber sein Bein blutet anscheinend.“
Robrecht, der seinen Falken genauer untersucht hatte, rief nun ungeduldig: „Falkenträger, komm schnell her zu mir, mein Vogel hat sich verletzt. Ach Gott, das arme Tier hat seine Klauen zu sehr angestrengt. Pflege ihn gut, mein treuer Steven. Sein Tod würde mich sehr traurig machen.“
Er reichte den verletzten Falken zu Steven hinunter, der fast über den Vorfall weinte, denn da sein Amt darin bestand, die Falken zu lehren und abzurichten, so lagen ihm diese Tiere wie Kinder am Herzen.
Kaum hatten die vornehmsten Herren ihre Falken aufgeworfen, so durften auch alle anderen mit der Jagd anfangen.
Innerhalb von zwei Stunden fing man allerlei hochfliegendes Wild, wie Enten, Möwen, Reiher und Kraniche und auch die tiefer streichenden Rebhühner, Drosseln und Brachvögel.
Als die Sonne im Zenit stand, hallten die klaren Jagdhörner durch die Ebene. Der ganze Zug sammelte sich wieder, und in langsamem Schritt ging's zurück nach Wijnendaal.
Unterwegs nahm Karl von Valois sein Gespräch mit dem alten Gwijde wieder auf. Obwohl der Graf von Flandern nicht ohne Misstrauen an eine Reise nach Frankreich dachte, wollte er sie doch aus Liebe zu seinen Kindern trotz aller Gefahren unternehmen. Er beschloss, auf Anraten des französischen Feldherrn, sich mit allen Edeln, die ihm geblieben waren, Philipp dem Schönen zu Füßen zu werfen, um durch diese demütige Huldigung sein Mitleid zu erwecken. Die Abwesenheit der Königin ließ ihn hoffen, dass Philipp der Schöne nicht unerbittlich sein würde.
*
Robrecht van Bethune kam nicht mehr mit Châtillon in Kontakt; sie vermieden es, sich zu begegnen, und keiner von beiden sprach ein Wort. Adolf van Nieuwland ritt jetzt neben Machteld und ihrem Oheim Wilhelm. Die Jungfrau war allem Augenschein nach damit beschäftigt, ein Lied oder einen Spruch auswendig zu lernen, den ihr Adolf vorsprach; denn von Zeit zu Zeit riefen die verwunderten Edelfrauen: „Wie schön er das sagt! Was ist doch Herr van Nieuwland für ein kluger Minnesänger.“
So erreichten sie endlich Wijnendaal. Der ganze Zug ritt ins Schloss. Hinter ihm zog man die Brücke nicht auf, und auch das Fallgatter wurde nicht herabgelassen.
Einige Augenblicke später verließen die französischen Ritter in voller Rüstung wieder die Burg. Als sie über die Brücke ritten, sagte Châtillon zu seinem Bruder: „Du weißt, dass ich heute Abend die Ehre unserer Nichte verteidigen muss, und ich rechne damit, dass du mein Sekundant sein wirst.“
„Geht's etwa gegen den kühnen Robrecht van Bethune?“, fragte Saint-Pol. „Ich weiß nicht, mich dünkt, du wirst schlecht dabei wegkommen; denn der Löwe von Flandern ist kein Kätzchen, das man ohne Handschuhe anfassen kann. Das sollte dir auch bekannt sein!“
„Was geht's mich an!“, unterbrach ihn Châtillon zornig. „Ein Ritter vertraut seiner Geschicklichkeit und seinem Mut und nicht roher Körperkraft!“
„Du hast recht, Bruder, ein Ritter darf vor keinem Feind weichen, aber er soll sich auch nicht unbesonnen einer Gefahr aussetzen. Ich hätte an Eurer Stelle den finsteren Robrecht reden lassen, soviel er wollte. Was kümmern dich seine Worte, wo er ja doch unser Gefangener ist.“
„Schweig, Saint-Pol, solche Reden stehen einem Ritter nicht wohl an! Fehlt es dir etwa an Mut?“
Als sie diese Worte wechselten, verschwanden sie mit den anderen Rittern zwischen den Bäumen des Waldes.
Jetzt ließen die Waffenknechte das Fallgatter herab, zogen die Brücke auf und waren nicht mehr zu sehen.
***
[8]Guy van Dampyere, der Sohn des alten Wilhelm van Dampyere, war der vierundzwanzigste Graf von Flandern. (Dits die excellente Cronike van Flandern.)
[9] „Robrecht van Nyvers (auch van Bethune) hat der heiligen Kirche große Dienste erwiesen; so hat er in Apoelghen Meinfoort, den Feind der heiligen Kirche, erschlagen.“ (Die excellente Cronike). Die Tatsache, auf die dieser Satz anspielt, ist folgende: Karl von Anjou, König von Sizilien, wollte gegen Manfred, der dieses Königreich gegen den Willen des Papstes besaß, in den Krieg ziehen. Er bildete ein französisches Heer aus etwa 20.000 auserlesenen Kriegern und übergab den Oberbefehl an Robrecht van Bethune, der damals achtzehn Jahre alt war. Bald darauf nahm Karl von Anjou den jungen Konradin, den Enkel des deutschen Kaisers Friedrich, gefangen. Karl, der sich von einem so hochgestellten Feind befreien wollte, beschloss, ihn zum Tode verurteilen zu lassen. Sismonde von Sismondi (Histoire des républiques italiennes) sagt darüber: „Ein einziger Richter sprach das Todesurteil, und der junge Konradin wurde auf das Schafott gebracht, um enthauptet zu werden. Der Richter, der Konradin zum Tode verurteilt hatte, las das Urteil gegen ihn vor, das ihn als Verräter der Krone und Feind der Kirche bezeichnete. Er war gerade damit zu Ende und sprach das Todesurteil aus, als Robrecht von Flandern, der eigene Schwager von Karl von Anjou, auf den falschen Richter zustürzte, ihm sein Schwert in die Brust stieß und rief: „Es steht Euch nicht zu, Elender, einen so edlen und schönen Herrn zum Tode zu verurteilen.“ Der Richter starb in Gegenwart des Königs und dieser durfte seinen Günstling nicht rächen. Noch andere Taten beweisen, dass Robrecht von einem starken Mut beseelt war, so dass man von ihm sagen konnte: ein Löwenherz schlägt in seiner eisernen Brust.
[10]Schön ist es, für das Vaterland zu sterben.
[11] Enguerrand de Marigny, ein normannischer Edelmann, wurde unter Philipp dem Schönen Palastleiter vom Louvre und den öffentlichen Bauten und Finanzminister. Er missbrauchte seine Gewalt, verschwendete die Gelder des Reiches, verfälschte die Münzen und verarmte das Volk durch Auferlegung willkürlicher Steuern und Lasten.
[12]Johanna war die einzige Tochter Heinrichs I., Königs von Navarra; sie erbte dieses Königreich von ihrem Vater und wurde dadurch eine der reichsten Fürstinnen ihrer Zeit. Sie vermählte sich mit Philipp dem Schönen und vereinigte durch diese Heirat zwei Kronen auf ihrem Haupt.
[13]Die Schlacht wurde am Freitag, dem 26. Februar 1266, geschlagen. Manfred verlor in ihr Krone und Leben. (Sismonde de Sismondi.)
Kapitel 3
Der befreundete Ritter oder der bedürftige Minnesänger, dem sich das gastliche Tor des Schlosses Wijnendaal geöffnet hatte, befand sich zuerst auf einem kleinen, viereckigen freien Platz. Ihm zur Rechten lagen die Stallungen, in denen wohl hundert Pferde ohne jede Schwierigkeit untergebracht werden konnten; davor lagen die Dunghaufen, auf denen zahllose Enten und Tauben herumliefen. Zu seiner Linken lag ein Gebäude, das die Wohnungen der Waffenknechte und Trossknappen enthielt. Weiter hinten standen die Belagerungsgeschütze für Zeiten des Krieges. Da waren große Rammen und Sturmböcke mit ihren Stützbalken und Wagen, dann Wurfmaschinen, die Geschosse in die belagerte Stadt schleudern sollten, und auch solche, mit denen man große Steine gegen die feindlichen Tore oder Wälle senden konnte.
Endlich waren dort noch allerlei Sturmbrücken, Fußangeln, Feuertonnen und unzählige andere Kriegswerkzeuge aufgestellt.
Dicht vor den ankommenden Reisigen erhob sich der stattliche gräfliche Palast mit seinen Türmen über die niederen Gebäude, die ihn umringten. Eine steinerne Treppe, an deren Fuß zwei schwarze Löwen ruhten, führte zum ersten Stockwerk hinauf und in eine lange Flucht viereckiger Säle. In vielen stand ein Bett für den jeweiligen Gast, während andere mit den alten Waffenrüstungen verstorbener Grafen oder mit eroberten Bannern und Standarten geschmückt waren.
Auf der rechten Seite, in einer Ecke des Gebäudes, lag ein kleiner Saal, der sich von den übrigen in allem unterschied. Seine Wandbekleidung zeigte die ganze Geschichte der Kreuzzüge in lebensgroßen Bildern.
Auf dem einen Bild stand Gwijde, von Kopf zu Fuß mit einer eisernen Rüstung bedeckt, und hielt den Rittern, die ihn umgaben, das Kreuz entgegen.[14]
Im Hintergrund waren mehrere Kriegsknechte, die sich schon auf den Weg gemacht hatten. Das nächste Bild stellte die Schlacht von Massura dar; hier hatten die Christen 1250 den Sieg errungen. Der heilige Ludwig, König von Frankreich, und Graf Gwijde waren unter den anderen durch ihre Banner kenntlich. Das dritte Bild zeigte ein grausiges Schauspiel. Viele christliche Ritter lagen pestkrank, mit dem Tode ringend, in einer öden Steppe zwischen schrecklichen Leichen und Pferdekadavern. Schwarze Raben kreisten über dieser Unglücksstätte und warteten auf den Tod eines Ritters, um dann sein Fleisch fressen zu können.
Das vierte Bild stellte die glückliche Rückkehr des Grafen von Flandern dar. Seine erste Gemahlin, Fogaats van Bethune, lag weinend an seiner Brust, und seine Söhne Robrecht und Balduin drückten mit inniger Liebe seine Hände. Das war das letzte Gemälde.
Vor dem Marmorkamin, in dem ein kleines Feuer brannte, saß der alte Graf von Flandern in einem mächtigen Armstuhl. Das gedankenschwere Haupt hatte er auf seine rechte Hand gestützt. Unbewusst blickte er auf seinen Sohn Wilhelm, der emsig aus einem Buch mit silbernem Schloss Gebete las. Machteld, die junge Tochter von Robrecht van Bethune, stand mit ihrem Falken auf der anderen Seite des Raumes. Sie streichelte den Vogel, ohne auf den alten Gwijde und seinen Sohn zu achten. Während der Graf mit tiefem Schmerz an seine überstandenen Leiden dachte und Wilhelm die himmlische Gnade anflehte, spielte Machteld mit ihrem geliebten Falken und dachte gar nicht daran, dass das Erbe ihres Vaters von den Franzosen erobert war. Und dennoch war die kindliche Maid nicht gefühllos; aber ihre Trauer dauerte selten länger als der unglückliche Vorfall selbst, der sie erschütterte. Als man ihr gesagt hatte, dass alle Städte Flanderns vom Feinde erobert wären, brach sie in eine Flut von Tränen aus und weinte bitterlich; aber schon am Abend desselben Tages wurde der Falke von neuem liebkost, und die Tränen waren getrocknet und vergessen.
Nachdem Gwijde lange seinen Sohn unsicher angestarrt hatte, ließ er plötzlich die Hand, die sein Haupt stützte, sinken und fragte:
„Wilhelm, um was flehst du Gott so eifrig an?“
„Ich bete für meine arme Schwester Philippa“, gab der Jüngling zur Antwort. „Weiß Gott, vielleicht hat Königin Johanna sie schon ins Grab gestoßen; aber dann gelten meine Gebete ihrem Seelenheil!“
Bei diesen Worten beugte er sein Haupt tief, als wollte er die beiden Tränen verbergen, die ihm über die Wange liefen.
Der alte Vater seufzte tief. Er ahnte, dass die düstere Prophezeiung Wilhelms sich verwirklichen konnte; denn Johanna von Navarra war eine boshafte Frau. Doch ließ er seine Trostlosigkeit nicht merken und sagte:
„Wilhelm, man darf sich nicht mit düsteren Vorahnungen betrüben. Die Hoffnung ist den irdischen Sterblichen als Trost gegeben. Und weshalb solltest du auch nicht hoffen? Seit der Gefangenschaft deiner Schwester grämst du dich und siechst hin, und nicht ein einziges Lächeln hat seither Dein Antlitz erhellt. Es ist recht, dass du das Schicksal deiner Schwester nicht gefühllos mit ansiehst; aber reiße dich um Gottes willen aus deiner düsteren Verzweiflung heraus!“
„Du sprichst von einem Lächeln, Vater? Lächeln sollte ich, derweil meine arme Schwester im Kerker schmachtet? Nein, das kann ich nicht. Einsam rinnen ihre Tränen auf den kalten Boden ihres Gefängnisses. Dem Himmel klagt sie ihr Unglück, sie ruft dich, mein Vater! Sie ruft uns alle, denn wir sollen ihr Labsal bringen. Und wer gibt ihr Antwort? Das grausige Echoh der unterirdischen Gewölbe des Louvre. Seht Ihr sie nicht, wie sie totenbleich, schwach und welk wie eine hinsterbende Blume ihre Arme Gott entgegenstreckt. Hört Ihr nicht, wie sie ruft: „Oh mein Vater, meine Brüder, erlöst mich, ich schmachte in Ketten.“ Das sieht und hört mein Herz. Das fühlt meine Seele! – Und da sollte ich lächeln?“
Machteld, die nur einen Teil dieser schmerzlichen Worte mit angehört hatte, setzte ihren Falken hastig auf die Lehne eines Sessels und fiel ungestüm weinend und heftig schluchzend ihrem Großvater zu Füßen. Sie lehnte ihr Haupt auf seinen Schoß und rief: „Ist meine geliebte Muhme tot? Oh Gott, welch' Unglück! Ist sie wirklich tot? Werde ich sie niemals wiedersehen?“ Der Graf hob sie zärtlich auf und sprach voll Güte zu ihr: „Sei ruhig, meine liebe Machteld, weine nicht, Philippa ist nicht tot.“
„Nicht tot?“, fragte die Maid erstaunt. „Aber weshalb sprach denn Herr Wilhelm vom Sterben?“
„Du hast ihn nicht richtig verstanden“, antwortete der Graf. „Philippas Lage ist unverändert geblieben.“
Während die junge Machteld ihre Tränen trocknete, blickte sie Wilhelm vorwurfsvoll an und sagte schluchzend:
„Immer betrübt Ihr mich grundlos. Fast könnte man glauben, Ihr hättet alle trostreichen Worte vergessen; denn stets sprecht Ihr von so grausigen Dingen, dass mich ein Zittern überfällt; meinem Falken ist bang vor Eurer Stimme, – sie klingt so hohl! Das ist gar nicht nett von Euch, und Ihr kränkt mich damit!“
Wilhelm sah die Maid an, und sein Blick flehte um Mitleid für seinen Schmerz. Als Machteld ihm in die traurigen Augen sah, lief sie auf ihn zu und drückte ihm die Hand.
„Ach, verzeiht mir, lieber Wilhelm“, bat sie, „ich habe Euch sehr lieb; aber Ihr müsst mich auch nicht mehr mit dem schrecklichen Worte ‚Sterben‘ kränken; das klingt noch lange in meinen Ohren nach! Seid mir, bitte, nicht mehr böse!“
Noch ehe Wilhelm ihr antworten konnte, lief sie zu ihrem Falken zurück und begann ihren Zeitvertreib von neuem, während die Tränen noch über ihre Wangen liefen.
„Mein Sohn“, sagte Gwijde, „tragt der Jungfrau die Worte nicht nach. Du weißt, dass sie nicht böse gemeint waren!“
„Ich vergebe ihr von ganzem Herzen; denn ich liebe sie wie eine Schwester. Der Schmerz, den sie um Philippas vermeintlichen Tod empfand, hat mir sehr wohlgetan.“
Mit diesen Worten öffnete Wilhelm wieder sein Buch und las jetzt mit lauter Stimme:
„Jesus Christus, Seligmacher, erbarm dich meiner Schwester. Um deiner bitteren Leiden willen erlöse sie, oh Herr!“
Bei dem Namen des Herren entblößte der alte Gwijde sein Haupt, faltete die Hände und betete mit Wilhelm zusammen. Machteld ließ ihren Falken auf dem Stuhl stehen, kniete in der einen Ecke des Zimmers nieder, in der ein Kissen vor einem großen Kruzifix lag.
Wilhelm fuhr fort:
„Sancta Maria, Mutter Gottes, ich bitte dich, hör mich an, tröste sie in dem dunklen Kerker, oh heilige Magd.“
„Oh Jesus, süßer Jesus, Barmherziger, erbarm dich meiner armen Schwester.“
Gwijde wartete, bis das Gebet zu Ende war, ohne auf Machteld zu achten, die wieder zu ihrem Falken gegangen war:
„Aber sag mir nur, Wilhelm, dünkt es dich nicht, dass wir Herrn von Valois großen Dank schulden?“
„Herr von Valois ist der würdigste Ritter, den ich kenne“, antwortete der Jüngling. „Hat er uns nicht mit größtem Edelmut behandelt? Er hat Euerm grauen Haupt Ehrerbietung erwiesen und Euch sogar getröstet. Ich weiß bestimmt, dass er unserem Unglück und der Gefangenschaft meiner Schwester ein Ende gemacht haben würde, wenn das in seiner Macht stände. Gott lohne ihm seinen Edelmut mit der ewigen Seligkeit!“
„Ja, Gott sei ihm in seiner letzten Stunde gnädig“, fügte Graf Gwijde hinzu. „Kannst du das glauben, mein Sohn, dass er, unser Feind, so edelmütig sein will, sich um unsertwillen in Gefahr zu begeben und sich den Hass Johannas von Navarra zuzuziehen.“
„Ja, da Ihr von Karl von Valois sprecht, glaube ich das gern. Aber was kann er für uns und unsere Schwester tun?“
„Höre, Wilhelm! Als er heute morgen mit uns zur Jagd ritt, hat er mir ein Mittel geraten, durch welches wir mit Gottes Hilfe König Philipp den Schönen versöhnen können.“
Außer sich vor Freude schlug der Jüngling die Hände zusammen und rief:
„Oh Himmel, sein guter Engel hat durch seinen Mund gesprochen. Und was sollt Ihr tun, Vater?“
„Zu Compiègne mit meinen Edeln den König aufsuchen und ihm zu Füßen fallen.“
„Und Königin Johanna?“
„Die ungnädige Johanna von Navarra ist mit Enguerrand de Marigny in Paris. Jetzt ist der günstigste Augenblick!“
„Gebe Gott, dass Eure Hoffnung Euch nicht täuscht! Wann wollt Ihr denn die gefahrvolle Reise unternehmen, Vater?“
„Übermorgen wird Herr von Valois mit seinem Gefolge nach Wijnendaal kommen, um uns das Geleite zu geben. Ich habe die Edeln, die mir noch treu geblieben sind, zu mir entbieten lassen, um sie davon in Kenntnis zu setzen. Aber Dein Bruder Robrecht kommt gar nicht. Weshalb bleibt er solange dem Schloss fern?“
„Habt Ihr seinen Streit von heut morgen bereits vergessen, Vater? Er hat eine Beleidigung von sich abzuwaschen. Jetzt kämpft er wohl gerade mit Châtillon.“
„Du hast recht, Wilhelm. Das hatte ich vergessen. Dieser Zwist kann uns schädlich sein; denn Herr von Châtillon besitzt am Hofe Philipps des Schönen großen Einfluss.“
Zu jener Zeit waren Ehre und Ruhm das kostbarste Gut des Ritters. Er durfte keinen Verdacht der Verleumdung auf sich fallen lassen, ohne Rechenschaft dafür zu fordern. Deshalb waren Zweikämpfe etwas Alltägliches, und sie fanden keine besondere Beachtung.
Plötzlich erhob sich Gwijde und sagte:
„Da höre ich die Brücke fallen. Sicher sind meine Lehnsleute schon da. Komm, wir gehen in den großen Saal.“
Sie gingen aus dem Gemach und ließen die junge Machteld allein.
Bald kamen in den Saal zu dem alten Grafen die Herren van Waldeghem, van Roode, van Kortrijk, van Oudenaarde, van Heyle, van Nevele, van Roubais, der Herr Walter van Lovendeghem mit seinen beiden Brüdern und mehreren anderen, zweiundfünfzig an der Zahl. Einige hielten sich gerade im Schloss auf. Andere hatten ihre Herrschaftssitze in der umliegenden Ebene. Sie warteten alle voll Neugierde auf den Befehl oder die Nachricht des Grafen und standen mit entblößtem Haupt vor ihrem Gebieter.
Dieser hielt ihnen bald darauf folgende Ansprache:
„Meine Herren, Ew. Edeln wissen, dass die Treue, die ich meinem Lehnsherren, König Philipp, geschworen habe, die Ursache zu meinem Unglück ist. Als er mich aufforderte, Rechenschaft über die Besteuerung der Gemeinden abzulegen, habe ich als untertäniger Vasall seinem Wunsche willfahren. Brügge hat mir den Gehorsam verweigert, und meine Untertanen haben sich gegen mich erhoben. Als ich mit meiner Tochter nach Frankreich gereist bin, um dem König zu huldigen, hat er uns alle gefangen genommen. Mein unglückliches Kind trauert noch im Kerker des Louvre. Das alles wisst ihr; denn ihr steht eurem Fürsten treu zur Seite. Ich habe, wie es meiner Würde ziemte, mir mein Recht erkämpfen wollen, aber das Waffenglück war gegen uns. Der meineidige Eduard von England brach das Bündnis, das wir mit ihm geschlossen hatten, und ließ uns in der Not im Stich. Mein Land ist verloren, ich bin zum Geringsten unter euch geworden, und mein graues Haupt kann die Grafenkrone nicht mehr tragen. Ihr habt einen anderen Herren.“