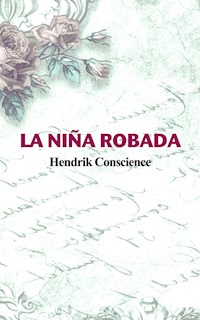2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
“Der Löwe von Flandern” von Hendrik Conscience spielt im mittelalterlichen Flandern und handelt vom Französisch-Flämischen Krieg (1297-1305). Im Mittelpunkt steht die Schlacht von Kortrijk im Jahr 1302, allgemein bekannt als die Schlacht der Goldenen Sporen, in der eine kleine flämische Streitmacht aus lokalen Milizen unerwartet eine überlegene Invasionsarmee des Königreichs Frankreich besiegt. In den Wirren dieser Ereignisse entwickelt sich eine Romanze zwischen Machteld, der Tochter des Grafen von Flandern, und dem Ritter Adolf van Nieuwlandt. Conscience recherchierte die historischen Ereignisse aus zeitgenössischen Chroniken, seine Erzählung weicht jedoch häufig von den historischen Fakten ab, was zur Mythologisierung der Ereignisse als Zusammenstoß zwischen flämischen und französischsprachigen Invasoren beiträgt. Die Encyclopædia Britannica beschreibt das Buch als „leidenschaftliches Epos” und vergleicht es mit der historischen Fiktion des schottischen Schriftstellers Sir Walter Scott (1771-1832).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
HENDRIK CONSCIENCE
DER LÖWE VON FLANDERN
HISTORISCHER
ROMAN
DER LÖWE VON FLANDERN wurde zuerst 1838 veröffentlicht.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
2024
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-642-8
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
ROMANE von JANE AUSTEN
im apebook Verlag
Verstand und Gefühl
Stolz und Vorurteil
Mansfield Park
Northanger Abbey
Emma
*
* *
HISTORISCHE ROMANREIHEN
im apebook Verlag
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
Die Geheimnisse von Paris. Band 1
Mit Feuer und Schwert. Band 1: Der Aufstand
Quo Vadis? Band 1
Bleak House. Band 1
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Der Löwe von Flandern
Impressum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Historische Fortsetzung bis zur Befreiung Robrechts van Bethune XIII., Grafen von Flandern.
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
ApePoints sammeln
Links
Zu guter Letzt
1.
Im Osten stieg mit roter Glut die noch von nächtlichen Wolken halb verhüllte Sonne auf, während ihr Bild sich in den sieben Farben des Regenbogens in jedem Tautropfen widerspiegelte. Die dem Erdboden entsteigenden bläulichen Dünste umhüllten wie ein zartes Gewebe die Wipfel der Bäume, und die Kelche der Blumen öffneten sich liebevoll, um den ersten Strahl des Tageslichtes zu empfangen. Die Nachtigall hatte ihre süßen Lieder schon während der Dämmerung erschallen lassen; jetzt aber überstimmte das Geschmetter minderbegabter Sänger ihre verführerischen Töne.
Ein Trupp Ritter ritt stumm durch die Felder von Rousselaere. Das Klirren ihrer Rüstung und der schwere Tritt ihrer Rosse erschreckte die friedlichen Bewohner der Wälder; denn von Zeit zu Zeit stürzte ein Hirsch aus dem Dickicht und flüchtete wie der Wind vor der bloßen Gefahr.
Kleidung und Bewaffnung der Ritter waren so kostbar, daß man auf den ersten Blick Grafen und noch höhere Herren in ihnen vermuten konnte. Ein faltenreicher seidener Koller umhüllte ihren Oberkörper, von ihren Helmen nickten purpurfarbige und blaue Federn. Ihre mit eisernen Schuppen bedeckten Handschuhe und ihre mit Gold plattierten Kniespangen funkelten im Morgenlichte. Die schäumenden und unruhigen Rosse zerrten heftig an dem Gebiß, so daß die seidenen Troddeln an ihrem Zaumzeug ständig in starker Bewegung waren.
Obwohl die Ausrüstung der Ritter nicht für den Krieg geeignet war, da sie keine Harnische trugen, so konnte man doch sehr deutlich sehen, daß sie sich gegen etwaige Feinde vorgesehen hatten, denn an ihren Handgelenken schauten unter dem Koller die Ärmel ihrer Panzerhemden hervor. An den Sätteln hingen große Schlachtschwerter, und die Schildknappen trugen hinter ihren Herren große Schilde einher. Auf der Brust trug jeder Ritter sein gesticktes Wappenzeichen, an dem man sogleich seine Herkunft erkennen konnte.
Die Morgenkühle hatte ihnen die Lust zum Sprechen genommen, die nächtlichen Dünste beschwerten ihre Augenlider; sie kämpften mühsam die Schlafsucht nieder und bewegten sich teilnahmlos dahin.
Vor ihnen schritt ein Jüngling einher. Langes wallendes Haar fiel auf seine breiten Schultern herab; blaue Augen blitzten unter seinen Brauen hervor, ein weicher gekräuselter Bart umrahmte sein Gesicht. Ein wollener Koller mit einem Gürtel war seine Kleidung und ein in lederner Scheide steckender Dolch mit kreuzförmigem Griff seine Waffe. Sein Gesicht verriet, daß die Gesellschaft, der er als Führer diente, ihm nicht angenehm war. Offenbar hing er geheimen Gedanken nach, denn er wendete oft die Augen mit einem schielenden Blick nach den Rittern. Von hoher Gestalt und außergewöhnlich starkem Gliederbau, schritt der Jüngling so schnell dahin, daß die Pferde Mühe hatten, mit ihm gleichen Schritt zu halten.
Als der Zug sich so einige Zeit fortbewegt hatte, strauchelte das Pferd eines der Ritter über einen Baumstrunk und neigte sich unversehens bis zum Boden. Dadurch fiel der Ritter mit der Brust auf den Nacken seines Rosses und wurde beinahe aus dem Sattel geworfen.
»Was ist das?« rief er auf Französisch. »Mein Pferd schläft unter mir!«
»Herr de Chatillon,« antwortete sein Begleiter lachend, »daß eines von euch beiden schlief, glaube ich bestimmt.«
»Freut Ihr Euch über meinen Unfall, Spötter!« schnaubte de Chatillon. »Ich schlief nicht. Seit zwei Stunden richte ich meine Blicke auf jene bezaubernden Türme, die sich immer weiter entfernen. Aber man würde sich eher am Galgen sehen, als ein gutes Wort aus Eurem Munde hören.«
Während die beiden Ritter sich also neckten, lachten die anderen lustig über das Ereignis, und der ganze Zug erwachte plötzlich aus einem schlaftrunkenen Zustand.
De Chatillon, der sein Pferd wieder auf die Beine gebracht hatte, ward, als das Lachen kein Ende nehmen wollte, von solchem Grimm gepackt, daß er das Tier mit dem Sporn heftig in die Weiche stieß. Dadurch bäumte es sich wütend und flog schließlich wie ein Pfeil zwischen den Bäumen dahin. Kaum hundert Schritte entfernt prallte es gegen den Stamm einer mächtigen Eiche und stürzte ernstlich verletzt zu Boden.
Für de Chatillon war es ein Glück, daß er bei dem Anprall seitwärts aus dem Sattel gefallen oder gesprungen war. Trotzdem schien er sich dabei erheblich an den Lenden verletzt zu haben, denn er blieb eine Weile regungslos liegen.
Als die anderen ihn erreicht hatten, stiegen sie von ihren Pferden und hoben ihn teilnahmsvoll von der Erde auf. Derjenige, der ihn erst vorhin geneckt hatte, schien nun am meisten für ihn besorgt, denn aufrichtige Trauer prägte sich auf seinem Gesicht aus.
»Mein lieber Chatillon,« sagte er, »ich beklage Euch von ganzem Herzen. Vergebt mir meine leichtfertigen Worte; ich wollte Euch nicht verhöhnen.«
»Laßt mich in Ruhe!« rief de Chatillon, sich aus den Armen seiner Kameraden windend. »Ich bin noch nicht tot, ihr Herren! Glaubt ihr, die Sarazenen hätten mich verschont, um mich wie einen Hund im Walde sterben zu lassen? Nein, ich lebe noch, Gott sei Dank! Hört, de St. Pol, Ihr würdet mir für diese Spötterei büßen müssen, wenn ich mich an Euch rächen wollte.«
»Beruhigt Euch doch, ich bitte Euch,« versetzte de St. Pol. »Ihr seid verwundet, mein Bruder? Unter Eurem Panzerhemd dringt das Blut hervor.«
De Chatillon zog seinen rechten Ärmel ein wenig in die Höhe und bemerkte, daß ein Ast ihm die Haut zerkratzt hatte.
»Da seht!« sagte er. »Es ist nichts – nur eine Schramme ... Aber ich glaube, daß der Flaming uns absichtlich diese verhexten Wege führt! – Das werde ich erfahren – und ich will meinen Namen verlieren, wenn ich ihn nicht an der verfluchten Eiche aufhängen lasse.«
Der Flaming, der bei dieser Äußerung zugegen war, stellte sich, als ob er die französische Sprache nicht verstünde, und sah de Chatillon kühn in die Augen.
»Ihr Herren,« rief der Ritter, »seht nur, wie dieser Laat F1 mich anschaut ... Komm mal her, Halunke! Näher heran zu mir!«
Der Jüngling näherte sich langsam und hielt dabei seine Augen fest auf den Ritter gerichtet. Auf seinen Gesichtszügen lag ein seltsamer Ausdruck – ein Ausdruck, der Zorn und Verschlagenheit zugleich verriet, ein Ausdruck so drohend und geheimnisvoll, daß de Chatillon von einer gewissen Beklemmung ergriffen wurde.
Einer der anwesenden Ritter kehrte sich um und verließ den Schauplatz; er wich einige Schritte in das Dickicht zurück und ließ sich deutlich genug anmerken, daß dieser Auftritt ihm nicht gefiel.
»Willst du mir sagen,« fragte de Chatillon den Führer, »warum du uns auf solchen Wegen führst, und warum du uns nicht gewarnt hast, daß ein abgehackter Baum im Wege lag?«
»Herr,« entgegnete der Fläming in schlechtem Französisch, »ich kenne keinen anderen Weg nach dem Schloß Wynendaal, und wußte nicht, daß es Euer Gnaden beliebte, zu dieser Stunde zu schlafen.«
»Vermessener!« rief de Chatillon ihm zu. »Du lachst – du spottest meiner ... Holla, meine Knappen, man hänge diesen Laat an die Luft, damit er den Raben zur Speise werde!«
Nun lächelte der Jüngling noch mehr; seine Mundwinkel verzogen sich, und eine starke Blässe überzog seine Wangen.
»Einen Flaming aufhängen?« murrte er. »Wartet ein wenig!«
Er trat einige Schritte rückwärts, stellte sich mit dem Rücken gegen einen Baum, streifte die Ärmel seines Kollers bis zu den Schultern zurück und zog den funkelnden Dolch aus der Scheide. Die roten Muskeln seiner bloßen Arme waren gespannt, und sein Gesicht nahm einen Ausdruck an, der dem Löwen eigen ist.
»Wehe dem, der mich anrührt!« rief er mit kräftiger Stimme. »Die Raben von Flandern werden mich nicht fressen; sie fressen lieber französisches Fleisch!«
»Drauf, Feiglinge!« rief de Chatillon seinen Knappen zu. »Drauf! Seht doch die Hasenfüße! – Fürchtet ihr euch vor einem Messer? Soll ich selber meine Hände an diesem Laat beschmutzen? Aber ich bin edel. Grau gegen Grau, es ist eure Sache. Also drauf!«
Einige der Ritter suchten de Chatillon zu besänftigen, aber die meisten stimmten ihm bei und hätten den Flaming gerne baumeln gesehen. Zweifellos würden die von ihrem Herrn angefeuerten Knappen über den Jüngling hergefallen sein und ihn überwunden haben; aber nun näherte sich der Ritter, der einige Schritte weiter in tiefen Gedanken herumgegangen war. Seine Kleidung und Ausrüstung übertraf die der anderen Ritter an Pracht; das Wappen auf seiner Brust trug drei goldene Lilien in blauem Felde unter einer Grafenkrone. Dies zeigte an, daß er von königlichem Blute war.
»Haltet ein!« rief er mit strengem Gesicht den Knappen zu. Dann wendete er sich an de Chatillon: »Herr, Ihr scheint zu vergessen, daß ich Flandern vom König Philipp, meinem Bruder, zu Lehen habe. Der Flaming ist mein Vasall. Ihr habt kein Recht auf sein Leben, da es mir allein gehört.«
»Soll ich mich denn von einem elenden Bauer verhöhnen lassen?« grollte de Chatillon. »Wahrlich, Graf, ich verstehe nicht, wie Ihr immer das geringe Volk gegenüber den Edlen begünstigen möget. Soll dieser Flaming sich rühmen dürfen, daß er ungestraft einen französischen Ritter schmähte? Und sagt ihr es, ihr Herren, hat er nicht den Tod verdient?«
»Herr de Valois F2,« antwortete de St. Pol, »gewährt meinem Bruder den kleinen Trost, diesen Flaming hängen zu sehen. Was kann Eurer Hoheit an dem Leben dieses störrischen Bauers liegen?«
»Hört, ihr Herren,« rief Charles de Valois zornig, »eure Sprache ist mir äußerst unangenehm. Das Leben eines Untertanen ist von großem Gewicht, und ich begehre, daß man den Jüngling unbehelligt lasse. Zu Pferde, ihr Herren! Schon ist zuviel Zeit verschwendet.«
»Kommt, de Chatillon,« brummte de St. Pol, »steigt auf das Roß Eures Schildknappen und laßt uns weiterziehen. Herr de Valois ist dem Pack unglaublich gut gesinnt.«
Inzwischen hatten die Knappen ihre Waffen wieder in die Scheide gesteckt und die Rosse ihrer Herren herangebracht.
»Seid ihr fertig, ihr Herren?« fragte de Valois. »Nun, denn rasch weiter, also bitt' ich euch; denn sonst kommen wir zu spät zur Jagd. Du, Vasall, gehe zur Seite; künde uns, wenn wir wenden müssen. – Wie weit sind wir noch von Wynendaal?«
Der Jüngling zog seine Kappe, verneigte sich vor seinem Retter und antwortete:
»Noch eine kurze Stunde, Euer Gnaden.«
»Dem Mann trau' ich nicht!« sprach de St. Pol. »Ich glaube, hier steckt ein Wolf im Schafspelz.«
»Das habe ich schon lange gedacht,« antwortete der Kanzler Pierre Flotte; »er betrachtet uns wie ein Wolf und horcht wie ein Hase.«
»Ha, ha, nun weiß ich, wer er ist,« rief de Chatillon. »Habt ihr noch nichts von einem Weber gehört namens Pieter de Coninck, der in Brügge wohnt?«
»Meine Herren, ihr täuschet euch fürwahr,« bemerkte Raoul de Nesle. »Ich habe den berüchtigten Weber zu Brügge selbst gesprochen; wenn er diesen auch an Verschmitztheit übertrifft, so hat er doch nur ein Auge, und dieser hat deren zwei von der allergrößesten Art. Zweifellos hängt er an dem alten Grafen von Flandern und sieht er unser Kommen als Sieger mit scheelem Auge; das ist es. Verzeiht ihm die Treue, die er seinem unglücklichen Fürsten bewahrt.«
»Es ist lange genug darüber gesprochen, ihr Herren,« fiel de Chatillon ein. »Gehen wir zu etwas anderem über. Wißt ihr, was unser gnädiger König Philipp mit diesem Flandern tun wird? Denn auf mein Wort, wenn unser Fürst seine Schatzkammern so fest verschlossen hielte, wie de Valois seinen Mund, wäre am Hofe ein armseliges Leben.«
»Dies sagt Ihr wohl,« entgegnete Pierre Flotte, »aber er schweigt nicht gegen jedermann. Reitet ein wenig langsamer, ihr Herren, und ich werde euch Dinge sagen, die ihr nicht wißt.«
Die Ritter kamen neugierig näher zusammen und ließen den Grafen de Valois ein wenig vorausreiten. Als er weit genug von ihnen entfernt war, um ihre Worte nicht mehr verstehen zu können, sprach der Kanzler:
»Höret! – Unser gnädiger König Philipp der Schöne hat kein Geld mehr. Enguerrand de Marigny hat ihn glauben gemacht, daß Flandern eine Goldquelle sei, und dies ist nicht so schlecht gemeint; denn in dem Lande, wo wir jetzt sind, ist mehr Gold und Silber, als in ganz Frankreich.«
Die Ritter lächelten und nickten zum Zeichen der Zustimmung wiederholt mit dem Kopfe.
»Höret weiter,« nahm Pierre Flotte wieder das Wort; »unsere Königin Johanna ist höchlichst auf die Flamen erbittert; sie haßt dieses hochmütige Volk in einer Weise, die nicht zu schildern ist. Aus ihrem eigenen Munde habe ich gehört, daß sie den letzten Flaming am Galgen sehen möchte.«
»Das heißt gesprochen wie eine Königin!« rief de Chatillon. »Wenn ich einmal Herr über dieses Land werde, wie meine gnädige Nichte mir versprochen hat, werde ich ihre Schatzkammern tüchtig speisen und Pieter de Coninck mit Gewerken und Gilden und der ganzen Volksregierung vernichten. – Aber was horcht der vermessene Laat auf unsere Rede?«
Der Flaming hatte sich unmerklich genähert und mit gierigem Ohr die Worte des Ritters aufgefangen. Sobald man ihn bemerkte, lief er mit einem unverständlichen Lächeln zwischen die Bäume des Waldes, blieb in einiger Entfernung stehen und zog seinen Dolch aus der Scheide.
»Herr de Chatillon!« rief er drohend, »betrachtet Euch dieses Messer wohl, damit Ihr es erkennen möget, wenn es sich Euch in den Hals bohren wird!«
»Ist denn keiner meiner Diener da, der mich rächen wird!« schrie de Chatillon in höchster Wut.
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so sprang ein schwerer Leibknecht von seinem Roß und ging mit gezogenem Degen auf den Jüngling zu. Dieser steckte seinen Dolch, anstatt sich mit ihm zu wehren, in die Scheide zurück und erwartete mit geballten Fäusten seinen Feind.
»Du mußt sterben, verfluchter Flaming!« rief der Leibknecht, indem er die Waffe gegen ihn erhob.
Der Jüngling antwortete nicht, sondern richtete nur seine großen Augen wie zwei flammende Blitze auf den Leibknecht. Dieser blieb, durch die Macht dieses Blickes bis in die Seele getroffen, einen Augenblick stehen, als entsänke ihm der Mut.
»Vorwärts, stich ihn tot, stich ihn tot!« rief de Chatillon ihm zu.
Aber der Flaming wartete nicht, bis sein Feind ihm näher kam: er sprang mit einem Satz unter dem gezückten Degen hinweg, packte mit seinen beiden starken Händen den Leibknecht um die Mitte und schleuderte ihn mit dem Kopfe so heftig gegen einen Baum, daß er regungslos niederstürzte. Ein letzter Todesschrei klang durch den Wald, und der Franzose schloß unter krampfhaftem Zucken seiner Glieder die Augen für immer. Mit einem höhnischen Lachen brachte der Flaming seinen Mund an das Ohr des leblosen Körpers und sagte spöttisch:
»Geh und sag' deinem Herrn, daß Jan Breydels F3 Fleisch keine Nahrung für die Raben ist. – Das Fleisch der Fremden ist für sie ein besseres Aas!«
Und dann eilte er durch das Dickicht weiter und verschwand in der Tiefe des Waldes.
Die Ritter, die auf dem Wege hielten und mit Entsetzen dieses Schauspiel sahen, hatten keine Zeit gehabt, sich einander auch nur einige Worte zuzurufen; aber als sie sich von ihrer Verblüffung erholt hatten, sprach de St. Pol:
»Wahrlich, ich glaube, mein Bruder, Ihr hattet es mit einem Zauberer zu tun; denn dies ist doch nicht natürlich.«
»Verhextes Land!« erwiderte de Chatillon mißgestimmt. »Mein Pferd bricht den Hals, und mein getreuer Leibknecht bezahlt es mit seinem Leben! – Es ist ein unglücklicher Tag ... Knappen, nehmt den Leichnam eures Genossen; tragt ihn, so gut ihr könnt, nach dem nächsten Dorfe, damit man ihn heile oder begrabe ... Ich bitt' euch, ihr Herren, laßt den Grafen de Valois nichts von dem Vorfall erfahren.«
»O, das verstehen wir!« fiel Pierre Flotte ein. »Aber, meine Herren, nun gebt euren Rossen die Sporen und sputet euch, denn dort sehe ich Herrn de Valois zwischen den Bäumen verschwinden.«
Sie ließen ihren Rossen die Zügel und erreichten bald den Grafen, ihren Feldherrn. Dieser ritt sachte weiter, ohne auf ihr Näherkommen zu achten. Er hatte den mit einem versilberten Helm bedeckten Kopf nachdenklich geneigt, und sein eiserner Handschuh ruhte mit dem Zügel lässig auf der Mähne seines Pferdes, seine andere Hand umfaßte den Griff des Schlachtschwertes, das am Sattel hing.
Während er also in tiefes Sinnen versunken war und die anderen Ritter sich durch gegenseitiges Augenzwinkern über seine Schwermut lustig machten, erhob sich vor ihnen Schloß Wynendaal mit seinen himmelhohen Türmen und riesigen Wällen.
»Noël!« rief Raoul de Nesle freudig, »dort ist das Ziel unserer Fahrt. Wir sehen Wynendaal trotz des Teufels und der Hexerei!«
»Ich möchte es lieber in Brand sehen,« murrte de Chatillon; »es kostet mich ein Pferd und einen treuen Diener.«
Nun kehrte der Ritter, der die Lilien auf der Brust trug, sich um und sprach:
»Meine Herren, dieses Schloß ist der Aufenthalt des unglücklichen Landesherrn Gwijde von Flandern – eines Vaters, dem man sein Kind entrissen hat und dessen Land wir durch das Glück der Waffen gewonnen haben. Ich bitte euch, zeigt ihm nicht, daß ihr als Sieger kommt, und vermehrt nicht sein Leiden durch stolze Worte.«
»Aber Graf de Valois,« fiel de Chatillon spitzig ein, »glaubt Ihr, daß wir die Gesetze der Ritterlichkeit nicht kennen? Wisset Ihr nicht, daß es einem französischen Ritter geziemt, sich nach dem Siege edelmütig zu zeigen?«
»Ich höre wohl, daß Ihr es wißt,« antwortete de Valois mit Nachdruck. »Ich bitte Euch denn auch, also zu tun. Die Ehre besteht nicht in eitlen Worten, Herr de Chatillon! Was hilft es, wenn die Gesetze der Ritterlichkeit nur auf der Zunge liegen, nicht aber ins Herz geschrieben sind? Wer gegen Mindere nicht edelmütig ist, kann es auch nicht gegen seinesgleichen sein.«
De Chatillon wurde bei diesem Vorwurf von grimmiger Wut erfaßt und hätte ihr wohl in ungestümen Worten Luft gemacht, aber sein Bruder de St. Pol hielt ihn zurück und flüsterte:
»Schweigt, de Chatillon, schweigt doch, denn unser Graf hat recht. Ist es denn nicht vernünftig, daß wir dem alten Grafen von Flandern nicht noch mehr Leiden zufügen? – Er ist unglücklich genug.«
»Dieser ungetreue Lehensmann hat es gewagt, unserem König den Krieg zu erklären, und unsere Base Johanna von Navarra derart gekränkt, daß sie beinahe krank dadurch wurde. Und da sollten wir ihn noch schonen müssen?«
»Meine Herren,« rief de Valois noch einmal, »ihr kennt meine Bitte. Ich glaube nicht, daß es euch an Edelmut fehlen wird. Nun vorwärts, ich höre die Hunde bellen, man hat uns schon gesehen, denn die Zugbrücke geht nieder, und die Sturmegge F4 wird in die Höhe gelassen.«
Das Schloß Wynendaal F5, von dem edlen Grafen Gwijde von Flandern errichtet, war eine der schönsten und stärksten Burgen, die es zu jener Zeit gab. Aus den breiten Gräben, von denen es umgeben war, erhoben sich dicke Mauern, an denen zahlreiche Wachthäuschen hingen. Hinter den Schießscharten sah man die Augen der Bogenschützen und die Spitzen der eisernen Pfeile. Innerhalb der Mauern erhoben sich die Dächer des gräflichen Hauses mit ihren knarrenden Wetterfahnen. Sechs runde Türme standen auf den Ecken der Mauer und in der Mitte des Vorhofs; aus ihnen konnte man mit allerlei Wurfgeschossen den angreifenden Feind treffen und ihm die Annäherung an das Schloß verwehren. Eine einzige Brücke verband diese starke Insel mit den umgebenden Tälern.
Sobald die Ritter ankamen, gab der Wächter über dem Tor der Innenwache das Zeichen, und bald kreischten die schweren Türen in ihren Angeln. Unterdessen dröhnten auf der Brücke die Huftritte der Rosse, und die Ritter zogen zwischen zwei Reihen flämischer Fußknechte in das Schloß. Die Tore wurden hinter ihnen geschlossen, die Egge mit den eisernen Spitzen fiel wieder herab, und die Zugbrücke ging langsam in die Höhe.
*
Der Himmel zeigte ein so reines Blau, daß das Auge seine Tiefe nicht messen konnte. Die Sonne stieg glänzend am Horizont empor, und die verliebte Turteltaube trank die letzten Tautropfen von den grünen Blättern der Bäume. Aus dem Schlosse Wynendaal erscholl ununterbrochen das Gebell der Hunde. Das Wiehern der Pferde mischte sich mit dem lieblichen Klang der Jagdhörner; doch war die Zugbrücke immer noch nicht niedergelassen, und die vorübergehenden Landleute konnten nur raten, was im Werke war. Zahlreiche Wachen mit Bogen und Schild wandelten auf den äußeren Wällen; durch die Schießscharten konnte man bemerken, daß viele Waffenknechte zwischen den Mauern auf und ab gingen.
Endlich erschienen einige Männer über dem Tor und ließen die Brücke nieder; zu gleicher Zeit wurden die Tore geöffnet, um den Jagdzug hinauszulassen, der langsam über die Brücke kam und aus folgenden Herren und Frauen bestand:
Voran ritt der achtzigjährige Gwijde, Graf von Flandern, auf einem braunen Traber. Sein Gesicht drückte stille Ergebung aus; von Alter und Mißgeschick niedergedrückt, trug er den Kopf tief nach vorn gesenkt; seine Wangen waren von langen und tiefen Furchen durchzogen. Ein purpurner Koller sank ihm von den Schultern bis auf den Sattel hinab, und seine schneeweißen Haare waren von einem gelben seidenen Tuch umhüllt; diese Hülle nahm sich aus wie ein goldenes Band um ein silbernes Gefäß. Auf seiner Brust prangte in einem herzförmigen Schilde der schwarze Löwe von Flandern in goldenem Felde.
Der unglückliche Fürst sah sich jetzt am Ende seines Lebens, wo die Ruhe als Belohnung der Arbeit kommen soll, seiner Krone beraubt. Seine Kinder waren durch das Los der Waffen ihres Erbes verlustig, und die Armut wartete auf sie, die unter den europäischen Fürsten die reichsten sein sollten. Siegreiche Feinde umgaben den unglückseligen Landesherrn, und dennoch fand die Verzweiflung in seinem Herzen keine Stätte.
Neben ihm ritt Charles de Valois, der Bruder des französischen Königs. Er disputierte lebhaft mit dem alten Gwijde, und es schien, daß dieser seinen Ansichten nicht beistimmte. Jetzt hing kein Schlachtschwert mehr am Sattel des französischen Feldherrn; ein langer Degen hatte die schwere Waffe ersetzt; auch funkelten die eisernen Platten nicht mehr an seinen Beinen.
Hinter ihm ritt ein Ritter, der ein ungemein mürrisches und grimmiges Aussehen hatte. Seine Augen gingen unstet umher, und wenn sein Blick auf einen Franzosen fiel, preßten sich seine Lippen so stark zusammen, daß seine Zähne knirschten. Gegen fünfzig Jahre alt, aber noch in der vollen Kraft seines Lebens, mit breiter Brust und von schwerem Körperbau, mußte er als der stärkste Ritter betrachtet werden. Auch das Pferd, das er ritt, war viel größer als die anderen, so daß er mit dem Kopf weit über den Zug hinausragte. Ein blinkender Helm mit blauen und gelben Federn, ein schwerer Waffenrock und ein gebogenes Schwert waren die Hauptstücke seiner Rüstung; der Koller, der hinter seinem Rücken auf das Pferd niederfiel, trug ebenfalls den flämischen Löwen auf goldenem Felde. Die Edelleute der damaligen Zeit hätten unter tausend anderen diesen mürrischen Reiter als Robrecht van Bethune F6 erkannt.
Seit einigen Jahren war er von dem Grafen, seinem Vater, mit der inneren Verwaltung Flanderns beauftragt gewesen. In allen Feldzügen hatte er die flämischen Heere geführt und sich bei den Fremden einen gewaltigen Ruf erworben. Im sizilianischen Kriege, wo er mit seinem Heere sich im Lager der Franzosen befand, führte er so wunderbare Waffentaten aus, daß man ihn seit dieser Zeit den »Löwen von Flandern« zu nennen begann. Das Volk, das stets die Helden liebt und bewundert, besang die Unerschrockenheit des Löwen in seinen Sagen und verehrte ihn als den, der einst die Krone Flanderns tragen würde. Da Gwijde seines Alters wegen das Schloß Wynendaal selten verließ und bei den Flamen nicht sonderlich beliebt war, erhielt Robrecht den Grafentitel, und wurde er im ganzen Lande als Herr und Meister angesehen.
Zu seiner Rechten ritt Willem, sein jüngster Bruder, der mit seinen bleichen Wangen und seinem schwermütigen Gesicht sich neben dem gebräunten Antlitz Robrechts wie ein krankes Mägdlein ausnahm. Seine Kleidung unterschied sich nicht von der seines Bruders, ausgenommen das krumme Schwert, das man bei niemandem als bei Robrecht bemerkte.
Hierauf folgten verschiedene andere Herren, sowohl französische als flämische. Die Vornehmsten unter ihnen waren:
Walter, Herr van Maldeghem; Karl, Herr van Knesselare; Roegaert, Herr van Expoele; Jan, Herr van Gavere; Rase Mulaert; Diederik die Vos und Geeraert die Moor.
Die Ritter Jacques de Chatillon, Gui de St. Pol, Raoul de Nesle und ihre Kameraden ritten ohne Ordnung zwischen den flämischen Herren und unterhielten sich verbindlich mit ihren nächsten Nachbarn.
Der letzte war Adolf van Nieuwland, ein junger Ritter aus einem der edelsten Geschlechter der reichen Stadt Brügge. Sein Gesicht bezauberte nicht durch weibische Schönheit; er war keiner von den Männern mit rosigen Wangen und lachendem Munde, die nichts weiter nötig haben, als eine Simarre, um sich in ein Weib zu verwandeln. – Nein, die Natur war nicht so mit ihm umgesprungen. Die Sonne hatte seine Wangen ein wenig versengt und mit einem ernsten Ton gefärbt; seine Stirne trug schon die zwei tiefen Furchen, die das Denkvermögen frühzeitig ankündigen. Sein Antlitz war charakteristisch und männlich, und seine scharfen Linien gaben ihm das Aussehen eines gemeißelten griechischen Bildwerkes. Seine Augen, die halb unter den Brauen verborgen waren, trugen das Kennzeichen einer warmen und einsamen Seele. Obwohl er an Rang den anderen Rittern nicht nachstand, blieb er dennoch zurück und ließ Mindere vorangehen. Schon mehrmals hatte man ihm Platz gemacht, um ihn durchzulassen, aber er achtete nicht auf diese Höflichkeit und schien in tiefes Sinnen versunken.
Beim ersten Anblick hätte man diesen Adolf für einen Sohn Robrechts van Bethune halten können; denn abgesehen von dem Alter, das bei beiden sehr verschieden war, war er Robrecht wunderbar ähnlich: die gleiche Gestalt, die gleiche Haltung, die gleichen Gesichtszüge. Ihre Kleidung unterschied sich in der Farbe, und das Wappen, das Adolf auf der Brust trug, zeigte drei Jungfrauen mit goldenem Haar auf rotem Feld. Über dem Schild las man den Wahrspruch: » Pulchrum pro patria mori« F7.
Dieser junge Edelmann war von seinen Kinderjahren an in der Familie Robrechts erzogen worden. Jetzt war er sein Vertrauter und ward von ihm behandelt wie ein geliebter Sohn. Er achtete seinen Wohltäter wie einen Vater und Fürsten, und war ihm und seinen Kindern in grenzenloser Liebe ergeben.
Gleich nach ihm folgten die Frauen. Das Gold und Silber ihrer Kleider blendete die Augen. Alle saßen auf leichten Rossen; ein langes Reitkleid fiel über ihre Füße bis zur Erde hinab. Goldgestickte Mieder umschlossen ihre Brüste, von ihren hohen, mit Perlen geschmückten Hauben flatterten lange Bänder. Die meisten trugen einen Stoßvogel auf der Hand.
Unter den Edelfrauen war eine, die durch Prunk und Schönheit alle anderen in den Schatten stellte. Sie hieß Machteld, und Robrecht nannte sie seine jüngste Tochter.
Diese Jungfrau war sehr jung, sie zählte kaum fünfzehn Jahre; aber die hohe und schlanke Gestalt, die das Erbteil ihrer Eltern war, die Strenge ihrer feinen Gesichtszüge, die Eleganz ihrer Haltung gaben ihrem Auftreten etwas Königliches und zwangen die Männer zur Ehrfurcht. Obwohl die Ritter ihr alle mögliche Reverenz erwiesen und dahin wetteiferten, ihr zu gefallen, kam doch keine vermessene Neigung in ihnen auf. Sie wußten: nur ein Fürst konnte Machteld von Flandern als Gemahlin erhoffen.
Die junge Dame saß majestätisch auf ihrem Pferde und hielt stolz den Kopf erhoben. Während ihre Linke lässig die Zügel hielt, saß auf ihrer Rechten ein Habicht mit roter Kappe und goldenen Schellen.
Gleich hinter dem schönen Edelfräulein kamen zahlreiche Schildknappen und Pagen, die alle in zweifarbige Seide gekleidet waren. Die Knechte, die zu dem Hause des Grafen Gwijde gehörten, konnte man leicht aus den anderen heraus erkennen, denn sie waren auf der rechten Seite schwarz und auf der linken goldgelb gekleidet. Die anderen waren purpurn und grün, andere rot und blau, je nach den Farben ihrer Herrschaft.
Zum Schluß folgten die Jäger und Falkeniere. Vor den ersten gingen an die fünfzig Hunde an ledernen Leitseilen; es waren Windspiele, Bracken und Rüden aller Art.
Verwunderlich war die Ungeduld dieser Tiere; sie zerrten so heftig an den Leitseilen, daß die Jäger sich gewaltig entgegen stemmen mußten.
Die Jäger trugen auf Querleisten allerlei Stoßvögel, wie Habichte, Steinfalken, Geier, Sperber. Diese Vögel hatten rote Kappen mit Schellen auf dem Kopf und Hosen von weichem Leder an den Beinen. Weiterhin trugen die Falkeniere falsche Lockvögel von Scharlach, um damit während der Jagd die Falken zurückzurufen.
Sobald der Zug eine gewisse Strecke von der Brücke entfernt und auf einer breiteren Bahn angelangt war, mischten sich die Herren ohne Unterschied des Ranges durcheinander. Jeder suchte einen Freund oder einen Kameraden, um sich den Ritt durch Unterhaltung zu kürzen; auch viele Frauen hatten sich den Rittern genähert.
Trotzdem war Gwijde von Flandern mit Charles de Valois noch voran, denn niemand wäre unhöflich genug gewesen, an ihnen vorbeizusprengen. Robrecht van Bethune und Willem, sein Bruder, hatten ihre Rosse an die Seite ihres Vaters gelenkt; Raoul de Nesle und de Chatillon waren ebenfalls neben Charles de Valois, ihrem Feldherrn. Dieser heftete seine Blicke teilnahmsvoll auf die weißen Haare Gwijdes und auf das niedergeschlagene Gesicht seines Sohnes Willem und sprach:
»Ich bitt' Euch, edler Graf, glaubet mir, daß Euer schmerzliches Los mir zu Herzen geht. Ich empfinde Eure Traurigkeit, als ob Euer Unglück mich selbst getroffen hätte. Noch ist nicht alle Hoffnung verloren; mein königlicher Bruder wird auf meine Bitte das Vergangene vergeben und vergessen.«
»Herr de Valois,« entgegnete Gwijde, »Ihr täuschet Euch: Euer Fürst hat gezeigt, daß Flanderns Untergang sein höchster Wunsch ist. Hat er nicht meine Untertanen gegen mich aufgebracht? Hat er nicht meine Tochter Philippa unmenschlich von mir gerissen und in den Kerker geworfen? Und wie wollt Ihr denn, daß er den Bau, den er um den Preis so vielen Blutes umgestürzt, wieder aufrichte? Fürwahr, Ihr täuschet Euch, Philipp der Schöne, Euer Bruder und König, wird mir das Land, das er mir genommen hat, nicht wiedergeben. Euer Edelmut, Herr, wird mir bis an mein Lebensende ins Herz geschrieben sein, aber ich bin zu alt, um mich noch mit trügerischen Hoffnungen zu tragen. – Mein Reich ist dahin, so will es Gott.«
»Ihr kennt meinen königlichen Bruder nicht,« versetzte de Valois. »Es ist wahr, seine Taten zeugen gegen ihn; aber ich versichere Euch, daß sein Herz so edelmütig ist wie das des besten Ritters.«
Robrecht van Bethune fiel de Valois in die Rede und rief ungeduldig:
»Was sagt Ihr? – Edelmütig wie der beste Ritter! Bricht ein Ritter je sein gegebenes Wort, bricht er die Treue? Als wir mit unserer unglücklichen Philippa ohne Argwohn nach Corbeil kamen, hat Euer König das Gastrecht geschändet und uns alle eingekerkert. Saget mir, geziemt solch verräterische Tat einem aufrichtigen Ritter?«
»Herr van Bethune,« antwortete de Valois ärgerlich, »Ihr gebraucht sehr heftige Worte. Ich denke nicht, daß Ihr die Absicht habt, mich zu schmähen oder zu betrüben?«
»O nein, bei meiner Ehre nicht!« sprach Robrecht. »Eure Großmut hat mich Euch zum Freund gemacht; aber Ihr könnt doch nicht mit Überzeugung sagen, daß Euer König ein treuer Ritter sei?«
»Höret,« versetzte de Valois, »ich sage Euch, daß Philipp der Schöne die beste Gesinnung der Welt hat; aber feige Schmeichler umgeben und beraten ihn. Enguerrand de Marigny F8 ist ein leibhaftiger Teufel, der ihn zum Bösen treibt, und eine andere Person läßt ihn unerhörte Übeltaten vollführen. Die Ehrfurcht hindert mich, sie zu nennen; sie allein ist schuld an Eurem Unglück.«
»Wer mag das wohl sein?« fragte de Chatillon absichtlich.
»Ihr fragt nach einer bekannten Sache, Herr de Chatillon,« rief Robrecht van Bethune. »Achtet auf meine Worte, ich werde es Euch sagen: Eure Base Johanna von Navarra ist es, die meine unglückliche Schwester gefangen hält; Eure Base Johanna ist es, die die Münzen Frankreichs verschlechtert; Eure Base Johanna ist es, die Flandern den Untergang geschworen hat! ...« F9
De Chatillon wurde rot vor Grimm; er lenkte heftig sein Pferd vor Robrecht und schrie ihm ins Gesicht:
»Ihr lügt!«
Durch diese Schmähung in seiner Ehre gekränkt, zügelte Robrecht rasch sein Roß, ließ es einige Schritte rückwärts gehen und zog sein krummes Schwert aus der Scheide. In dem Augenblick, als er de Chatillon angreifen wollte, bemerkte er, daß sein Feind keine Waffe trug. Er steckte mit merklichem Mißvergnügen sein Schwert wieder ein, näherte sich de Chatillon und sagte mit dumpfer Stimme:
»Ich denke, es ist nicht nötig, Herr, Euch meinen Handschuh hinzuwerfen. Ihr wißt, daß Euer Vorwurf ein Flecken ist, der nur mit Blut abgewaschen werden kann. Ich werde vor Sonnenuntergang Rechenschaft von Euch fordern für diese Schmach.«
»Es sei,« antwortete de Chatillon. »Ich bin bereit, die Ehre meiner königlichen Base gegen alle Ritter der Welt zu verteidigen.«
Darauf schwiegen sie und nahmen ihre Plätze im Zuge wieder ein. Während dieses kurzen Zwistes hatten die anderen Ritter mit verschiedenartigen Gefühlen die kühnen Reden Robrechts angehört; viele von den Franzosen ärgerten sich über des Flamings Worte, aber die Ehrengesetze verhinderten sie, sich um zwei Feinde zu bekümmern. Charles de Valois schüttelte ungeduldig den Kopf, und seine Gesichtszüge verrieten, daß dieser Zank ihm höchlichst mißfiel. Ein frohes Lächeln schwebte auf dem Antlitz des Grafen Gwijde; er sprach leise zu de Valois:
»Mein Sohn Robrecht ist ein mutiger Ritter. Dies hat Euer König Philipp erfahren, als er Rijssel belagerte; denn dort ist manch tapferer Franzose dem Schwerte Robrechts erlegen. Die Leute von Brügge, die ihn mehr als mich lieben, nennen ihn den Löwen von Flandern – und diesen Ehrennamen hat er in der Schlacht von Benevent gegen Manfried wohlverdient.«
»Ich kenne Herrn Robrecht schon lange,« war die Antwort. »Weiß nicht jedermann, mit welcher Unverzagtheit er dieses Damaszenerschwert aus den Händen des Tyrannen Manfried riß? Seine Waffentaten werden unter den Rittern meines Landes hoch gerühmt. Der Löwe von Flandern wird bei uns als unüberwindlich geehrt – und er verdient es.«
Der alte Vater lächelte zuerst vor Vergnügen, aber plötzlich verdüsterte sich sein Gesicht; er ließ den Kopf sinken und seufzte wehmütig:
»Herr de Valois, ist es nicht ein Unglück, daß ich solchem Sohn nicht ein Erbe hinterlassen kann? Ihm, der dem Hause Flandern so viel Ruhm und Ehre gemacht hat? Ach, dies und die Gefangenschaft meines unglücklichen Kindes Philippa sind die beiden Spukgestalten, die mich zum Grabe zerren.«
Charles de Valois antwortete nicht auf Gwijdes Klagen. Lange blieb er in tiefes Nachdenken versunken und ließ den Zügel seines Rosses über dem Sattelknopf hängen. Gwijde betrachtete ihn und verwunderte sich über den Edelmut de Valois'; denn er bemerkte, daß das Unheil, das das Haus Flandern getroffen, den guten Franzosen betrübte.
Plötzlich reckte sich de Valois mit frohem Gesicht im Sattel, legte seine Hand auf die Hand Gwijdes und sprach:
»Eine Eingebung des Herrn!«
Gwijde sah ihn neugierig an.
»Ja,« fuhr de Valois fort, »ich will, daß mein königlicher Bruder Euch wieder auf den Thron Eurer Väter setze!«
»Und welches Mittel dünkt Euch stark genug, dieses Wunderwerk zu vollbringen, nachdem er mein Land Euch gegeben hat?«
»Höret, edler Graf, Eure Tochter sitzt trostlos in den Kerkern des Louvre; Euer Erbe ist verfallen; Eure Kinder haben keine Lehen mehr. Ich weiß ein Mittel, um Eure Tochter zu befreien und Eure Grafschaft wieder zu erlangen.«
»Ja!« rief Gwijde zweifelnd. »Ich glaube es nicht, Herr de Valois, es sei denn, daß Königin Johanna von Navarra gestorben wäre.«
»Nein, dieses nicht. Unser König Philipp der Schöne hält offenen Hof zu Compiègne. Meine Schwägerin Johanna ist in Paris und mit ihr Enguerrand de Marigny. Kommt mit mir nach Compiègne, laßt Euch von den besten Edeln Eures Landes begleiten und fallt meinem Bruder zu Füßen, um ihm als bußfertiger Lehensmann zu huldigen.«
»Und dann?« fragte Gwijde verwundert.
»Er wird Euch gnädig aufnehmen und Flandern und Eure Tochter befreien lassen. Baut auf meine Worte; denn mein Bruder ist in der Abwesenheit der Königin der großmütigste Fürst.«
»Dank sei Eurem guten Engel für diese glückliche Eingebung, und auch Euch, Herr de Valois, für Euren Edelmut,« sprach Gwijde freudig. »O Gott, könnte ich doch durch dieses Mittel die Tränen meines armen Kindes trocknen! Aber wer weiß, ob Kerker und Fesseln nicht auch meiner harren in dem gefährlichen Frankreich!«
»Fürchtet nichts, Graf, fürchtet nichts,« versetzte de Valois, »ich selbst werde Euch verteidigen und beistehen; freies Geleite, mit meinem Siegel und durch mein Ehrenwort bekräftigt, wird Euch nach Rupelmonde zurückbringen, wenn unsere Bemühungen vergeblich sein sollten.«
Gwijde ließ den Zügel seines Pferdes fahren, ergriff die Hand des französischen Ritters und drückte sie mit tiefer Dankbarkeit.
»Ihr seid ein edler Feind,« seufzte er.
Während sie ihre Zwiesprache fortsetzten, erreichte der Zug eine weite Ebene, durch die ein breiter Bach sich schlängelte. Alle machten sich zur Jagd fertig.
Jeder flämische Ritter nahm seinen Falken aus die Faust. Die Hunde wurden in mehrere Gruppen verteilt und die Leitbänder der Falken losgemacht.
Die Frauen hatten sich jetzt unter die Ritter gemischt, und es fügte sich, daß Charles de Valois sich neben der schönen Machteld befand.
»Ich glaube, edle Dame,« so sprach er, »daß der Preis der Jagd Euer sein wird; denn nimmer sah ich einen schöneren Vogel als diesen. So gleichmäßig gefiedert, so starke Schwingen, so schön geschuppte Klauen! Ist er für Eure Faust nicht zu schwer?«
»Ach ja, sehr schwer, Herr,« antwortete Machteld, »und obwohl er nur auf den niedrigen Flug abgerichtet ist, könnte er doch auch auf Reiher und Kraniche jagen.«
»Mir scheint, edle Dame,« bemerkte de Valois, »daß Ihr ihn ein wenig zu sehr ins Fleisch wachsen lasset. Ihr solltet ihm weichere Nahrung geben.«
»Nein, nein, Herr de Valois,« rief das Mädchen stolz, »Ihr täuschet Euch sicherlich, mein Falke ist gerade recht. Ich bin in der Falknerei nicht unerfahren. Ich selbst habe diesen schönen Vogel aufgezogen, zur Jagd abgerichtet und nachts bei Kerzenlicht bewacht ... Aus dem Wege, Herr de Valois, aus dem Wege! – Dort über dem Bach fliegt eine Schnepfe!«
Während de Valois die Blicke nach der bezeichneten Richtung wendete, zog Machteld die Kappe vom Kopfe des Habichts und schleuderte ihn fort.
»So gehe denn, mein lieber Habicht!« rief sie.
Auf diese Worte stieg der Vogel wie ein abgeschossener Pfeil himmelwärts; das Auge konnte ihm nicht folgen. Einige Zeit blieb er oben regungslos mit ausgebreiteten Schwingen stehen und suchte mit seinen durchdringenden Blicken nach dem Wilde. Bald sah er die Schnepfe in der Ferne fliegen. Schneller als ein Stein fällt, stürzte er sich auf den armen Vogel und packte ihn mit seinen scharfen Klauen.
»Seht Ihr, Herr de Valois!« rief Machteld freudig. »Seht Ihr wohl, daß die Hand einer Frau auch Falken abrichten kann? – Da kommt mein treuer Vogel mit seinem Fang zurück!«
Kaum waren diese Worte ausgesprochen, so saß auch schon der Habicht mit der Schnepfe auf ihrer Hand.
»Darf ich die Ehre haben, das Wild aus Euren schönen Händen zu empfangen?« fragte Charles de Valois.
Bei dieser Frage trübte sich das Gesicht der Jungfrau; sie sah den Ritter bittend an und sprach:
»Ach, Herr de Valois, deutet es mir nicht übel, ich habe meinen Fang meinem Bruder Adolf versprochen, der dort bei meinem Vater steht.«
»Eurem Onkel Willem wollt Ihr sagen, edle Dame?«
»Nein, unserem Bruder Adolf van Nieuwland. Er ist so gut, so diensteifrig gegen mich; er hilft mir beim Abrichten meiner Falken, er lehrt mich Lieder und Sagen und spielt mir auf der Harfe vor. Wir lieben ihn alle so sehr!«
De Valois hatte während dieser Worte einen durchdringenden Blick auf Machteld gerichtet, fand aber bei dieser Untersuchung, daß nur Freundschaft allein in dem Busen der Jungfrau wohnte.
»Dann verdient er sicherlich diese Gunst,« sprach er lächelnd. »Laßt Euch durch meine Bitte nicht länger zurückhalten, ich bitte Euch.«
Ohne auf die Anwesenheit der anderen Ritter zu achten, rief Machteld so laut sie konnte:
»Adolf! Herr Adolf!«
Und sie schwang freudig und aufgeregt wie ein Kind die Schnepfe.
Auf ihren Ruf kam der Junker herbei.
»Hier, Adolf,« rief sie, »das ist der Lohn für die schönen Märchen, die Ihr mich gelehrt habt.«
Der junge Ritter neigte sich ehrerbietig vor ihr und nahm erfreut die Schnepfe entgegen. Die Ritter betrachteten ihn mit neidischer Neugierde, und mehr als einer suchte auf seinem Gesicht den Ausdruck eines geheimen Gefühls zu entdecken, aber vergeblich. Plötzlich wurden sie aus ihrem Forschen aufgeschreckt.
»Rasch, Herr van Bethune!« rief der Oberfalkenier. »Nehmt Eurem Geierfalken die Kappe ab und werft ihn aus; denn da drüben läuft ein Hase!«
Einen Augenblick später schwebte der Vogel schon in den Wolken und fiel dann senkrecht auf das flüchtende Tier nieder. Das war seltsam anzusehen, denn da der Falke seine Klauen in den Rücken des laufenden Hasen geschlagen hatte, blieb er darauf stehen, und so rannten sie beide wie der Wind dahin. Doch dauerte die Fahrt nicht lange; als sie an einem Strauch vorbeikamen, klammerte sich der Falke mit der einen Klaue daran an und hielt mit der anderen das Wild so kräftig fest, daß es trotz allen Zappelns und Ringens nicht weiter konnte. Jetzt wurden einige Hunde losgelassen. Diese rannten auf den Hasen zu und nahmen ihn dem Falken ab. Der mutige Vogel schwebte triumphierend über den Hunden und begleitete sie zu den Jagdknechten; dann erhob er sich hoch in die Luft und gab durch seltsame Wendungen seine Freude zu erkennen.
»Herr van Bethune,« rief de Valois, »dies ist ein Vogel, der seine Sache tapfer macht; ein schöner Geierfalke.«
»Ja, Herr, der allerschönste,« antwortete Robrecht, »ich will Euch sogleich seine Adlerklauen bewundern lassen.«
Bei diesen Worten hob er den Lockvogel in die Höhe. Als der Falke dies sah, ließ er sich sofort auf die Hand seines Herrn herab.
»Seht Ihr,« versetzte Robrecht, indem er de Valois den Vogel zeigte, »seht die schönen blonden Federn, die reine weiße Brust und die hohen blaufarbigen Beine.«
»Ja, Herr Robrecht,« antwortete de Valois, »es ist in der Tat ein Vogel, der einem Adler nicht zu weichen braucht; aber mir scheint, es träufelt Blut aus seiner Hinterbacke.«
Robrecht rief, nachdem er die Beine des Geierfalken betrachtet, ungeduldig:
»Schnell hierher, Falkenier! Mein Vogel hat sich ernstlich verletzt! Man versorge ihn gut! Du, mein Abrichter Steven, pflegst ihn; sein Tod würde mich sehr betrüben!«
Er übergab den verletzten Falken Steven, der über den Unfall schier weinte, denn da sein Amt das Unterweisen und Abrichten der Falken war, lagen ihm diese Tiere wie Kinder am Herzen.
Als die vornehmsten Herren ihre Falken ausgeworfen hatten, begann die Jagd allgemein zu werden. In zwei Stunden fing man allerlei Wild von hohem Flug, wie Enten, Weihen, Reiher, Kraniche, und auch viel Wild von niederem Flug, wie Rebhühner, Krammetsvögel und Regenvögel. Als die Sonne im Zenith stand, schallten die Jagdhörner hell über die Ebene. Der ganze Zug versammelte sich und kehrte langsam nach Wynendaal zurück.
Unterwegs nahm Charles de Valois sein Gespräch mit dem alten Gwijde wieder auf. Obwohl der Graf von Flandern nicht ohne Mißtrauen an die Reise nach Frankreich dachte, wollte er dennoch aus Liebe zu seinen Kindern diesen gefährlichen Zug unternehmen. Er beschloß auf Andrängen des französischen Feldherrn, sich mit allen Edlen, die um ihn geblieben waren, Philipp dem Schönen zu Füßen zu werfen, um ihn durch diese demütige Huldigung zum Erbarmen zu bewegen. Die Abwesenheit der Königin Johanna gab ihm die frohe Hoffnung ein, daß Philipp der Schöne nicht unerbittlich sein werde.
Robrecht van Bethune und de Chatillon kamen nicht mehr zusammen; sie mieden alle Wege, die sie zusammenführen konnten, und keiner von beiden sprach mehr ein Wort. Adolf van Nieuwland ritt diesmal neben Machteld und ihrem Onkel Willem. Die Jungfrau war anscheinend damit beschäftigt, ein Lied oder ein Märchen zu lernen, das Adolf ihr vorsagte, denn von Zeit zu Zeit riefen die verwunderten Edelfrauen:
»Welch ein gelehrter Ministrel ist doch dieser Herr van Nieuwland F10!«
So kamen sie endlich wieder in Wynendaal an. Der ganze Zug ging ins Schloß. Man zog hinter ihnen nicht die Brücke hoch, und auch die Sturmegge fiel nicht nieder. Einige Augenblicke später kamen die französischen Herren mit ihren Waffen aus dem Schlosse. Als sie über die Brücke ritten, sagte de Chatillon zu seinem Bruder:
»Ihr wißt, daß ich heute abend die Ehre unserer Base zu verteidigen habe; ich zähle auf Euch als meinen Waffenträger.«
»Gegen diesen barschen Robrecht van Bethune?« fragte de St. Pol. »Ich weiß nicht, aber mich dünkt, daß Ihr schlecht wegkommen werdet. Denn der Löwe von Flandern ist keine Katze, die man ohne Handschuhe anfassen darf. Das wißt Ihr auch.«
»Was macht das aus!« rief de Chatillon ärgerlich. »Ein Ritter vertraut auf Geschicklichkeit und Mut und nicht auf die Stärke seines Körpers.«
»Ihr habt recht, mein Bruder: ein Ritter darf vor niemandem weichen, aber es ist besser, sich nicht unbesonnen bloßzustellen. Ich hätte an Eurer Stelle den wütenden Robrecht reden lassen. Was haben seine Worte zu bedeuten, nun er ohne Lehen und unser Gefangener ist?«
»Schweigt, de St. Pol, Ihr sprecht unziemlich. Fehlt es Euch an Mut?«
Während er diese Worte sagte, verschwanden sie mit den anderen Rittern hinter den Bäumen. Nun ließen die Waffenknechte die Egge fallen, zogen die Zugbrücke auf und verschwanden.
So hieß man die Landleute, die von einem Herrn abhängig waren. Die freien Laaten bezahlten gewisse Zölle und hatten Freiheiten und einige Schöffen. Lehenslaaten, die einen Pachthof von den Herren erhielten, mußten ihnen hierfür als Untertanen gehorchen und sich zur Fronarbeit und zur Abgabe gewisser Geldsummen verpflichten. Die Leiblaaten gehörten mit Leib und Habe dem Herrn und wurden mit den Ländereien verkauft und verhandelt. Sie bildeten den niedrigsten Stand des Volkes.
Karl, der zweite Sohn Philipps des Kühnen, war Graf von Valois, von Alençon und von Perche. Er empfing von seinem Bruder Philipp dem Schönen, König von Frankreich, den Oberbefehl über die französische Armee und eroberte Flandern.
Breydel war Hauptdekan der Fleischhauer zu Brügge.
Die Sturmegge war ein mit eisernen Spitzen versehenes Tor, das in einem Falz lief.
Schloß Wynendaal ist jetzt verfallen und liegt bei dem gleichnamigen Dorfe, in der Nähe von Thourout in Westflandern.
Um die Gemütsart dieses edlen Ritters kennen zu lernen, ist es nötig, an einen bezeichnenden Vorgang zu erinnern. Karl von Anjou, König von Sizilien, bildete, als er gegen Manfried, der dieses Königreich gegen den Willen des Papstes besaß, ziehen wollte, ein französisches Heer von zwanzigtausend auserlesenen Mannen und übergab den Oberbefehl an Robrecht van Bethune, der damals achtzehn Jahre alt war. Einige Zeit später besiegte Karl von Anjou den jungen Konradin, den Enkel des deutschen Kaisers Friedrich. Karl beschloß, um sich von solch einem erlauchten Feinde zu befreien, ihn zum Tode verurteilen zu lassen. Sismonde de Sismondi ( Histoire des républiques italiennes) sagt: »Ein einziger Ritter wagte das Todesurteil auszusprechen, und der junge Konradin ward auf das Schafott geführt, um enthauptet zu werden. Der Richter, der Konradin zum Tode verurteilt hatte, las ihm als einem Verräter gegen die Krone und als Feind der Kirche das Urteil vor. Er hatte eben geendigt und sprach das Urteil aus, als Robrecht von Flandern, Karls von Anjou eigener Schwager, sich auf diesen falschen Richter stürzte, ihn mit dem Schwert durchbohrte und rief: »Es geziemt dir nicht, Elender, solch edlen und schönen Herrn zum Tode zu verweisen!« Der Richter starb in Gegenwart des Königs, und dieser hatte nicht den Mut, seinen Günstling zu rächen. – Noch verschiedene andere Tatsachen beweisen, daß er von einem wunderbaren Mute beseelt war und daß man von ihm sagen konnte: er hatte ein Löwenherz in einem eisernen Körper.
Schön ist es, für das Vaterland zu sterben.
Enguerrand de Marigny, ein Edelmann aus der Normandie, wurde unter Philipp dem Schönen Kapitän des Louvrepalastes, Minister der Finanzen und der Gebäude. Er mißbrauchte seine Macht zu schlechten Taten, verschwendete die Gelder des Reiches, fälschte die Münzen und verarmte das Volk durch willkürliche Lasten.
Johanna, die einzige Tochter Heinrichs I., Königs von Navarra, erbte dieses Königreich von ihrem Vater und ward eine der reichsten Fürstinnen ihrer Zeit. Sie heiratete Philipp den Schönen und vereinigte dadurch zwei Kronen auf ihrem Haupte.
Ministrels waren Dichter und Sänger, die im Lande herumzogen und in Schlössern und Palästen ihre Gesänge hören ließen.
2.
Der Ritter oder der Ministrel, der von den Bewohnern von Wynendaal aus Höflichkeit oder Mitleid eingelassen wurde, befand sich zuerst auf einem viereckigen Platz unter freiem Himmel. Zur Rechten sah er die Ställe, in denen hundert Pferde bequem stehen konnten; daneben die Düngerhaufen, die mit zahllosen äsenden Tauben und Enten bedeckt waren. Zur Linken das Gebäude, in dem die Waffenknechte und Troßknappen hausten; weiter zurück lagen die Maschinen, die man im Kriege mitführte: zuerst die großen Ramm- und Sturmböcke mit ihren Schragen und Wagen, dann die Wurfzeuge, ferner noch allerlei Sturmbrücken, Fußangeln, Feuertonnen und unendlich viel anderes Kriegsgerät.
Gerade vor dem ankommenden Reisenden erhob sich stattlich der gräfliche Palast mit seinen Türmen über den niedrigen Gebäuden, die ihn umgaben. Eine steinerne Treppe, an deren Fuß zwei schwarze Löwen ruhten, führte zum ersten Stockwerk hinauf und gewährte Zugang zu einer langen Reihe viereckiger Säle. Viele davon waren mit einem Bett ausgestattet, um die zufälligen Gäste aufzunehmen; andere waren mit alten Waffen verstorbener Grafen oder mit eroberten Bannern und Wimpeln geschmückt.
Rechts in der Ecke dieses weiten Gebäudes war ein kleinerer Saal, der sich von den übrigen unterschied. Auf dem Teppich, der die Wand bedeckte, war ein Kreuzzug abgebildet. Auf der einen Seite stand Gwijde, vom Kopf bis zu den Füßen in Eisen gekleidet und von Rittern umgeben, denen er das Kreuz reichte. Im Hintergrund sah man eine Schar Kriegsknechte, die sich schon auf den Weg gemacht hatten. Die zweite Seite schilderte die Schlacht von Massura, die 1250 geschlagen wurde und in der die Christen den Sieg gewannen. Der heilige Ludwig, König von Frankreich, und der Graf Gwijde waren vor allen anderen an ihren Bannern zu erkennen. Die dritte Seite zeigte ein grauenvolles Bild. Zahlreiche Kreuzritter, die von der Pest ergriffen waren, lagen auf einem dürren Felde zwischen abscheulichen Leichen und Pferdekadavern im Sterben; schwarze Raben flatterten über diesem unglücklichen Heere und warteten darauf, bis einer stürbe, um sich dann an seinem Fleische zu sättigen. Die vierte Seite stellte die frohe Heimkehr des Grafen von Flandern dar. Seine erste Frau, Fogaats van Bethune, lag weinend an seiner Brust, während ihre Söhne Robrecht und Boudewijn ihm liebevoll die Hände drückten.
An dem marmornen Kamin, in dem ein kleines Feuer brannte, saß der alte Graf von Flandern in einem schwarzen Armstuhl. In tiefes Sinnen versunken, ließ er den Kopf auf seiner Rechten ruhen und betrachtete zerstreut seinen Sohn Willem, der in einem silberbeschlagenen Gebetbuch las. Machteld, die junge Tochter Robrechts van Bethune, stand mit ihrem Falken an der anderen Seite des Zimmers. Sie streichelte den Vogel, ohne auf den alten Gwijde und seinen Sohn zu achten. Während der Graf an seine vergangenen Leiden dachte und Willem den Himmel um Gnade anflehte, spielte Machteld mit ihrem geliebten Falken und dachte nicht einmal daran, daß das Erbe ihres Vaters von den Franzosen erobert und für verfallen erklärt war. Aber dennoch war die Jungfrau nicht unempfindlich; doch ihre Traurigkeit währte niemals länger als der Vorfall, der ihr Herz erschütterte. Als man ihr ankündigte, daß alle Städte Flanderns vom Feinde eingenommen waren, brach sie in eine Tränenflut aus; aber schon am Abend des gleichen Tages wurde der Falke aufs neue geliebkost und waren des Mädchens Tränen getrocknet und alles Leid vergessen.
Nachdem Gwijde lange mit unsicheren Blicken seinen Sohn angestarrt hatte, nahm er plötzlich die Hand von seinem Kopf und fragte:
»Willem, mein Sohn, was betest du immer so feurig zu Gott?«
»Ich bete für meine arme Schwester Philippa,« war die Antwort des Jünglings. »Gott weiß, o mein Vater, ob die Königin Johanna sie nicht schon ins Grab gestoßen hat ... aber dann sind meine Gebete für ihre Seele.«
Dabei senkte er tief das Haupt, als wollte er zwei Tränen, die ihm entfielen, verbergen.
Der alte Vater seufzte schmerzlich. Er fühlte, daß die unheimliche Ahnung Willems sich bewahrheiten könne, denn Johanna von Navarra war ein böses Weib; doch ließ er seine Trostlosigkeit nicht blicken und sprach:
»Es ist nicht vernünftig, Willem, daß man sich betrübe über schmerzliche Aussichten. Die Hoffnung ist dem Sterblichen von Gott als Trost gegeben; und warum solltest du nicht hoffen? Seit der Gefangenschaft deiner Schwester trauerst und siechst du, ohne daß jemals ein Lächeln dein Gesicht erhellt. Es ist löblich, daß dir das Los deiner Schwester nicht gleichgültig ist, aber in Gottes Namen erhebe dich aus deiner düsteren Verzweiflung!«
»Lächeln sagt Ihr, Vater? Lächeln, während unsere arme Philippa im Kerker schmachtet? Nein, das kann ich nicht. Ihre Tränen fließen auf den kalten Boden ihres Kerkers, sie klagt dem Himmel ihre Traurigkeit, sie ruft uns alle um Erlösung an – und wer antwortet ihr? Der unheimliche Widerhall der unterirdischen Grüfte des Louvre! Seht Ihr sie nicht, wie sie, bleich wie der Tod, schwach und matt, wie eine sterbende Blume, ihre Arme zu Gott emporstreckt? – Hört Ihr sie nicht rufen: O, mein Vater, meine Brüder, befreiet mich, ich sterbe in den Ketten! ... Dies sehe und höre ich in meinem Herzen – dies fühle ich in meiner Seele – und da sollte ich lächeln?«
Machteld, die nur halb nach dieser traurigen Rede gehört hatte, stellte ihren Falken auf den Rücken eines Sessels und fiel mit einer Flut von Tränen und heftigem Schluchzen ihrem Großvater zu Füßen. Sie legte ihren Kopf auf seine Knie und rief:
»Ist meine liebe Muhme tot? O Gott, wie traurig! Ist sie tot? Werde ich sie nimmer wiedersehen?«
Der Graf hob sie zärtlich vom Boden auf und sagte gütig:
»Beruhige dich, meine liebe Machteld – weine nicht; Philippa ist nicht tot.«
»Nicht tot?« fragte das Mädchen verwundert. »Warum spricht denn Herr Willem vom Sterben?«
»Du hast ihn nicht gut verstanden,« antwortete der Graf; »Philippas Zustand hat sich nicht verändert.«
Während die junge Machteld ihre Tränen trocknete, warf sie Willem einen vorwurfsvollen Blick zu und sagte schluchzend:
»Ihr betrübt mich immer unnötig, Herr! Man könnte schier denken, daß Ihr alle tröstenden Worte vergessen hättet; denn Ihr sprecht immer so unheimlich, daß Eure Reden mich zittern machen; mein Falke fürchtet Eure Stimme, sie klingt so hohl! Das ist nicht höflich von Euch, Herr, und es verstimmt mich sehr.« Willem betrachtete das Mädchen mit Blicken, die um Teilnahme an seinem Schmerz zu flehen schienen. Kaum hatte Machteld diesen Blick aufgefangen, so lief sie zu ihm und ergriff seine Hand.
»Ach, verzeiht mir, lieber Willem,« sagte sie, »ich liebe Euch so sehr; aber dann dürft Ihr mich auch nicht mehr plagen mit diesem schrecklichen Wort vom Sterben, das Ihr immer in meine Ohren klingen lasset. Verzeiht mir, dies bitte ich Euch!«
Noch ehe Willem antworten konnte, lief sie schon zu ihrem Falken zurück und nahm ihren Zeitvertreib wieder auf, wenn sie auch noch nicht aufhörte zu weinen.
»Mein Sohn,« sprach Gwijde, »laß dich die Worte der Jungfrau Machteld nicht anfechten. Du weißt, daß kein Arg in ihr steckt.«
»Ich vergebe ihr von Herzen, Herr Vater; denn ich liebe sie wie eine Schwester. Die Traurigkeit, die sie über Philippas vermeintlichen Tod gezeigt hat, ist für mich ein Trost gewesen.
Bei diesen Worten öffnete Willem aufs neue sein Buch und las jetzt mit lauter Stimme:
»Jesus Christus, unser Erlöser, erbarme dich meiner Schwester! Durch dein bitteres Leiden erlöse sie, o Herr!«
Der alte Gwijde entblößte das Haupt, faltete die Hände und vereinigte sein Gebet mit dem Willems. Machteld ließ ihren Falken auf dem Stuhl sitzen und kniete in einer Ecke des Saales nieder, wo ein Kissen vor einem großen Kruzifix lag.
Willem fuhr fort:
»Heilige Maria, Mutter Gottes, ich bitte dich, erhöre mich! Tröste sie in ihrem dunklen Kerker, o heilige Jungfrau! O Jesus, süßer Jesus, der du voller Barmherzigkeit bist, erbarme dich meiner armen Schwester!«
Gwijde wartete, bis das Gebet zu Ende war, dann fragte er, ohne auf Machteld zu achten, die wieder zu ihrem Falken gegangen war:
»Aber sage mir einmal, Willem, dünkt dich nicht, daß wir Herrn de Valois große Dankbarkeit schuldig sind?«
»Herr de Valois ist der würdigste Ritter, den ich kenne,« antwortete der Jüngling. »Hat er uns nicht mit Edelmut behandelt? Er hat Eure grauen Haare geachtet und Euch selbst getröstet. Ich weiß wohl, daß unser Unglück und die Gefangenschaft meiner Schwester endigen würden, wenn es in seiner Macht läge. Gott gebe ihm die ewige Seligkeit um seiner edlen Gefühle willen!«
»Ja, Gott sei ihm in seiner letzten Stunde gnädig!« versetzte Graf Gwijde. »Kannst du verstehen, mein Sohn, daß er, unser Feind, edelmütig genug sei, um sich selbst für uns in Gefahr zu begeben, und den Haß Johannas von Navarra auf sich zu laden?«
»Ja, das verstehe ich, Herr Vater, sobald Ihr von Charles de Valois sprecht. Aber was kann er für uns und unsere Schwester tun?«
»Höre, Willem. Als er diesen Morgen mit uns zur Jagd ritt, hat er mir ein Mittel gezeigt, durch das man mit Gottes Hilfe Philipp den Schönen versöhnen könnte.«
Der Jüngling schlug in freudiger Aufregung die Hände zusammen und rief:
»O Himmel, sein guter Engel hat aus ihm gesprochen! Und was müßt Ihr dabei tun, mein Vater?«
»Den König mit meinen Edeln in Compiègne aufsuchen und einen Fußfall vor ihm tun.«
»Und die Königin Johanna?«
»Die ungnädige Johanna von Navarra ist mit Enguerrand de Marigny in Paris. Niemals gab es einen günstigeren Augenblick als diesen.«
»Der Himmel gebe, daß Eure Hoffnung nicht trüge! Wann wollt Ihr diesen gefährlichen Zug unternehmen, mein Vater?«
»Übermorgen wird Herr de Valois mit seinem Gefolge nach Wynendaal kommen, um uns zu geleiten. Ich habe die Edeln, die mir in meinem Unglück treu geblieben sind, entbieten lassen, um ihnen hiervon Kenntnis zu geben. Aber dein Bruder Robrecht kommt nicht. Warum mag er solange außerhalb des Schlosses bleiben?«
»Habt Ihr seinen Zwist von heute morgen schon vergessen, mein Vater? Er hat sich von einer Schmähung zu reinigen; jetzt ist er sicherlich bei de Chatillon.«
»Du hast recht, Willem; es ist mir entgangen. Dieser Zank kann uns schädlich sein, denn Herr de Chatillon ist mächtig am Hofe Philipps des Schönen.«
Zu jenen Zeiten waren Ruf und Ehre die kostbarsten Pfänder des Ritters; er durfte sich auch nicht durch den geringsten Schein einer Lästerung berühren lassen, ohne Rechenschaft dafür zu verlangen. Daher waren die Zweikämpfe alltägliche Ereignisse, und man achtete wenig darauf.
Gwijde stand auf und sprach:
»Da höre ich die Brücke fallen. Sicherlich sind meine Lehensmannen schon da. Komm, wir gehen in den großen Saal.«
Sie gingen hinaus und ließen die junge Machteld allein.
Bald kamen die Herren van Maldeghem, van Roode, van Kortrijk, van Oudenaarde, van Heyle, van Nevele, van Roubais, der Herr Walter van Lovendeghem mit seinen beiden Brüdern und noch andere in der Zahl von zweiundzwanzig der Reihe nach in den Saal zu dem alten Grafen. Einige von ihnen hausten zeitweise im Schloß, andere hatten ihre Besitzungen in der nahen Ebene.
Sie warteten alle neugierig auf die Nachricht oder den Befehl, den der Graf ihnen mitteilen würde, und standen entblößten Hauptes vor ihrem Herrn.
Dieser begann nach einiger Zeit seine Anrede und sprach: