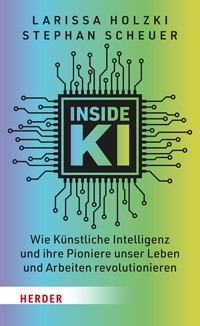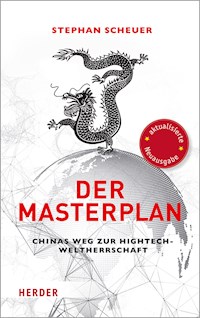
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Chinas Digitalkonzerne drängen nach Europa. Der Netzausrüster Huawei ist Patentkönig in der EU und stellt die Technik für den Echtzeitmobilfunk 5G in Deutschland. Die Smartphone-Marke Xiaomi baut in Düsseldorf ihre Europazentrale und ist Marktführer in Staaten wie Spanien, Polen oder Kroatien. Der Videokurzdienst Tiktok ist die beliebteste Plattform unter Jugendlichen in Europa. Anfangs wurden alle chinesischen Firmen begrüßt. Heute werden einige von ihnen mit Sorge betrachtet. Sicherheitsbehörden in den USA und Deutschland warnen, Huawei fungiere als Einfallstor für chinesische Spionage und Sabotage. Der Konzern widerspricht. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat chinesischen Tech-Konzernen bereits einen digitalen Kalten Krieg erklärt und sein Nachfolger Joe Biden knüpft daran an. Eine fundamentale Verschiebung des globalen Kräfteverhältnisses ist im Gange. China steigt zum internationalen Innovationstreiber auf. Die Hightech-Hersteller in Fernost blieben lange namenlos. Sie waren die billigen Auftragsfertiger. Heute beanspruchen sie selbst wichtige Märkte für sich – auch in Europa. Chinesische Automarken wie Byton, Nio oder BYD fordern deutsche Traditionsfirmen wie Volkswagen, Daimler und BMW heraus. Die Corona-Pandemie verstärkt den Trend. Während Europa von dem Virus gelähmt wurde, tüftelten Chinas Konzerne an den Zukunftstechnologien, die unsere Welt bestimmen werden. Deutschland ist auf diese Herausforderung nicht vorbereitet. In der Bundesrepublik fehlt es an Verständnis dafür, wer hinter den aufstrebenden Konzernen aus China steckt. Die erweiterte und aktualisierte Taschenbuchausgabe von "Der Masterplan" soll diese Lücke schließen. Autor Stephan Scheuer zeigt auf, welche Gründer hinter den chinesischen Tech-Firmen stehen und wie sie groß werden konnten. Dabei zeigt er, wie Peking gezielt internationale Wettbewerber ausgesperrt hat und wie der Staat die Firmen heute für seine Ziele einbindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephan Scheuer
Der Masterplan
Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft
Die Umschrift chinesischer Namen und Begriffe in diesem Buch basiert auf dem in Festlandchina geläufigen Pinyin-System. In einigen Fällen wird hingegen für ein einfacheres Verständnis auf die in Deutschland geläufigen Formen zurückgegriffen, wie etwa Peking statt Beijing oder Mao Tse-tung statt Mao Zedong. Für die Umrechnung der chinesischen Währung Renminbi (RMB) mit der Einheit Yuan in Euro wurde ein Umrechnungskurs von 1,29 Cent aus dem November 2020 verwendet.
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018
Erweiterte und aktualisierte Taschenbuchausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Judith Queins
Umschlagmotiv: © Keo/shutterstock; © Raevsky Lab/shutterstock
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
Karte: © Peter Palm, Berlin
ISBN E-Book (E-Pub): 978-3-451-82273-5
ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-82277-3
ISBN Print: 978-3-451-07383-0
Inhalt
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Vorwort: Digitalmacht China
1 Chinas Masterplan
2 Telekommunikation: Basis für die Digitalwirtschaft
3 Handel: Der digitale Warenkosmos
4 Kommunikation: Smartphones als Alleskönner
5 Finanzen: Eine Welt ohne Bargeld
6 Mobilität: Die neue Auto-Nation
7 Produktion: Innovation am Fließband
8 Der Staat: Big Brother trifft Big Data
9 Der Sprung in die Welt
10 Europas fehlende Antwort: Ein Schlusswort
Literaturverzeichnis
Karte
Der Autor
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Chinas Digitalkonzerne drängen nach Europa. Ob Netzausrüster Huawei, Online-Händler Alibaba oder Smartphone-Marke Xiaomi: Die Firmen weiten ihren Einfluss aus. Anfangs wurden sie begrüßt; heute werden manche von ihnen mit Sorge betrachtet. Die USA und deutsche Sicherheitsbehörden warnen, Huawei fungiere als Einfallstor für chinesische Spionage und Sabotage beim Echtzeitmobilfunk 5G. Der Konzern widerspricht. Die US-Regierung hat Huawei bereits einen digitalen Kalten Krieg erklärt.
Die globalen Kräfte verschieben sich. Über zwei Jahrzehnte sah es so aus, als würde die Welt – getrieben von Technologie – enger zusammenrücken. Der US-Konzern Apple perfektionierte das Prinzip globaler Wertschöpfungsketten. Auf den iPhones prangt der Schriftzug: »Designed by Apple in California. Assembled in China.”
Diese Arbeitsteilung wird heute infrage gestellt. Es drohen zwei Technologiewelten zu entstehen: eine von US-Konzernen wie Google, Amazon, Facebook und Apple geprägte auf der einen Seite und eine von chinesischen Firmen wie Huawei, Alibaba, Tencent und Xiaomi auf der anderen Seite.
Europa steht in der Mitte. Und wirkt planlos. In der Debatte um Huawei ringen viele Länder bis heute mit einem klaren Kurs – auch Deutschland.
Gleichzeitig haben einige chinesische Firmen lautlos ihren Einfluss in Deutschland und Europa massiv ausgebaut. Der Technologiekonzern Xiaomi hat in Düsseldorf eine Niederlassung und einen Flagship-Store eröffnet und bietet die neuste Technik an: vom Fitnessarmband über einen elektrischen Stehroller bis zur Flugdrohne. Der Smartphonehersteller Vivo hat in Düsseldorf seine Europazentrale eröffnet und will Verbraucher mit günstigen 5G-Smartphones gewinnen.
Diese Entwicklungen sind so weitreichend, dass dieses Buch für die Taschenbuchausgabe überarbeitet wurde. Quer durch das Werk wurden Zahlen und Fakten aktualisiert. Zusätzlich gibt es ein neues Kapitel, dass den Aufstieg von Huawei zu einem der wichtigsten Ausrüster der Telekommunikationsbranche weltweit beschreibt. In dem Kapitel wird auch die Verbindung zwischen dem Unternehmen und dem chinesischen Staat beleuchtet.
Stephan Scheuer, November 2020
Vorwort: Digitalmacht China
China hat Deutschland und die Weltwirtschaft durchdrungen – komplett und unumkehrbar. Fast jedes Smartphone, das in der Bundesrepublik verkauft wird, wurde in China hergestellt. Acht von zehn Computern stammen aus Fabriken in der Volksrepublik. Und auf weit mehr als der Hälfte der Fernseher prangt der Schriftzug »Made in China«.
Aber die Hersteller in Fernost blieben lange namenlos. Sie waren die billigen Auftragsfertiger. Dafür druckten globale Konzerne wie Apple, Samsung und Dell ihre Logos auf die Geräte. Doch Chinas Unternehmer haben gelernt. Sie haben sich abgeschaut, wie hochwertige Produkte entwickelt werden.
Über Jahre waren sie in Lauerstellung. Jetzt preschen sie vor. Chinas Unternehmen erleben eine Art Dauerrevolution. Zwölf Jahre hat die Volksrepublik gebraucht, um ihr Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu verdoppeln. Die USA brauchten dafür 40 Jahre. Die Briten 60. Stillstand gibt es in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht. Alles ist in Bewegung. Und alles geschieht aus europäischer Sicht wie im Zeitraffer.
Schon jetzt macht China knapp ein Fünftel der globalen Wirtschaftsleistung aus. Schon jetzt ist die Volksrepublik mit jährlichen Ausfuhren im Wert von mehr als 2,3 Billionen Dollar mit Abstand Exportweltmeister. Schon jetzt stammen 13 der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt aus der Volksrepublik.
Eine fundamentale Verschiebung des globalen Kräfteverhältnisses ist im Gange. China steigt zum internationalen Innovationstreiber auf. Und der Führungsanspruch der chinesischen Firmen ist schon lange nicht mehr auf die Volksrepublik begrenzt. Das wird alleine schon an Zahlen des Europäischen Patentamtes deutlich. Die chinesische Telekommunikationsfirma Huawei hat im vergangenen Jahr mehr Patente angemeldet als jedes andere Unternehmen in Europa. Damit steht sie noch vor der deutschen Industrieikone Siemens. Huawei meldete 3524 Patente an. Siemens war zwar im Vorjahr noch Patentkönig in Europa gewesen, landete mit 2619 Patenten im Jahr 2019 aber nur noch auf Platz fünf hinter Huawei, Samsung, LG sowie dem amerikanischen Technologie- und Rüstungskonglomerat United Technologies. Seit 2010 haben sich die Patentanträge aus China in Europa versechsfacht.
Die Patentanmeldungen sind ein Vorbote. Sie sind ein Indikator für künftige Marktentscheidungen. Die Zahl der Anmeldungen steht für den Vorstoß, den chinesische Firmen in Europa starten wollen. Insbesondere Chinas Internetkonzerne haben Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die besser sind als alles, was es international bislang gibt. Während sich die USA und Europa seit Jahren schwertun mit mobilen Bezahllösungen, haben Millionen von Chinesen ihr Portemonnaie gegen ihr Smartphone getauscht. Gerade in Chinas Großstädten sind immer mehr junge Menschen ohne Geldbörse unterwegs. Bargeld ist schlicht überflüssig geworden. Anbieter wie die Alibaba-Tochter Ant-Financial haben ein digitales Finanzsystem aufgebaut, das das bevölkerungsreichste Land der Welt tief durchdrungen hat.
Ausgerechnet in der Volksrepublik, wo träge Staatsbanken das Finanzsystem dominieren, ist ein Finanz-Paralleluniversum entstanden. Nahezu alles kann mittlerweile mit einem Wischen auf dem Smartphone-Display bezahlt werden: vom Online-Einkauf über den Snack an der Imbissbude bis hin zur Arztrechnung im Krankenhaus.
Das bequeme digitale Bezahlen hat einen ganzen Kosmos von zusätzlichen Dienstleistungen überhaupt erst möglich gemacht. Kein Wunder, dass die moderne Bezahltechnik entscheidend vom Online-Händler Alibaba vorangetrieben wurde. Den weitaus größten Teil seines Geschäftes wickelt der Konzern mittlerweile über Kunden ab, die mobil auf die Plattform der Firma zugreifen und Kleidung, Elektrogeräte oder sogar Obst und Gemüse direkt vom Smartphone aus bezahlen.
Die Begeisterung vieler Chinesen für das digitale Einkaufen geht so weit, dass etliche Händler mittlerweile deutlich seltener neue Geschäfte eröffnen wollen. Sie setzen gleich auf den digitalen Kontakt zu ihren Käufern. Im Laden wird ausprobiert, gekauft wird im Internet. Schließlich vergehen oft nur Stunden von der Bestellung auf dem Smartphone, bis der Bote die Produkte an die Haustür liefert.
Detailliert lässt sich der Weg der Bestellung nachverfolgen. Der Paketbote wird dem Käufer mit Namen und Handynummer präsentiert. Ist der Kunde nicht zu Hause, kann er den Lieferanten direkt auf seinem Handy anrufen und kurzfristig vereinbaren, dass er zum Beispiel das Päckchen ins Büro anstatt in die Wohnung liefert. Packstationen oder das lange Warten in einer Postfiliale gibt es in China nicht.
Alibaba und dessen wichtigster Konkurrent JD statten ihre Kunden bereits mit Videobrillen aus. Die Geräte sind der Einstieg in die virtuelle Realität. Über sie lassen sich digital neue Kleidungsstücke vor dem Kauf ausprobieren oder gleich eine simulierte Shoppingtour in Kaufhäuser in New York, London und Berlin unternehmen.
Nahezu täglich gründen Unternehmer neue Firmen, ständig auf der Suche nach der revolutionären Idee. Im bevölkerungsreichsten Land der Welt herrscht ein konstanter Konkurrenzkampf. Mehr als 1,4 Milliarden Menschen ringen um den schnellsten Aufstieg. Das erzeugt einen gewaltigen Druck und eine gewaltige Belastung. Es zwingt Firmengründer jedoch dazu, entschlossener und mit mehr Mut ihre Ideen voranzutreiben.
Chinas Unternehmer sind im Dauerrausch. Viele Firmen scheitern, aber einige wenige kommen durch. Die Volksrepublik bietet einen riesigen Binnenmarkt. Und der Erfolg in China dient als Blaupause für den internationalen Markt. Viele chinesische Firmen stehen an dieser Wachstumsschwelle.
Alibaba Gründer Jack Ma hat als Ziel ausgegeben, in den nächsten 20 Jahren weltweit zwei Milliarden Kunden mit Dienstleistungen zu versorgen, eine Zwei mit neun Nullen. Sein Online-Konzern wickelt schon jetzt mehr Transaktionen pro Jahr ab als eBay und Amazon zusammen. Im Januar 2018 ist der Konzern in den erlesenen Kreis der mit 500 Milliarden Dollar bewerteten Technologiekonzerne aufgestiegen. Neben Google, Amazon, Apple und Facebook trifft Jack Ma in dem exklusiven Klub auch auf einen heimischen Bekannten: den Internetkonzern Tencent.
Tencent ist ein echtes Multitalent. Mit dem Kurzmitteilungsdienst WeChat erreicht die Firma bereits die gewaltige Zahl von rund einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzern. Anfangs schaute sich Gründer Pony Ma die Ideen dafür im Ausland ab. Aber mittlerweile hat sich das Verhältnis komplett verschoben. Technologiefirmen aus dem Silicon Valley schauen sich innovative Ansätze bei ihren Rivalen aus China ab.
Schon 2012 konnten WeChat-Nutzer über die App Audio- und Video-Anrufe tätigen. Erst drei Jahre später führte auch WhatsApp diese Funktion ein. Mehr noch: Tencent ist es gelungen, einen ganzen Kosmos an Dienstleistungen um WeChat zu stricken: Ein Taxi lässt sich über die App bestellen, ein Termin beim Arzt reservieren, die nächste Reise buchen und die Steuer ans Finanzamt überweisen. Alle Funktionen werden auf der Plattform von Tencent gebündelt. Es gibt keinen Grund mehr, andere Programme zu nutzen. Diese Idee einer mächtigen Plattform versuchen mittlerweile auch Facebook und PayPal nachzubauen, aber Tencent ist weit voraus. Gleichzeitig ist Tencent auch das weltweit größte Unternehmen für Online-Spiele. Mit dem Rollenspiel Honour of Kings knackt Tencent alle Rekorde. Mehr als 200 Millionen Menschen auf der Welt sind von dem Programm begeistert, das auf Figuren der chinesischen Geschichte und Legenden beruht. Darin müssen Spieler ihre virtuellen Charaktere durch Fantasiewelten steuern, Aufgaben lösen und Gegner besiegen.
Neben Alibaba und Tencent gibt es ein drittes Technologieunternehmen, das die Innovation und Marktmacht der chinesischen Firmen treibt: den Suchmaschinenbetreiber Baidu. Hinter dem Konzern steht der in den USA ausgebildete Informatiker Robin Li, der es sich zum Ziel gesetzt hat, das weltweit führende Unternehmen für künstliche Intelligenz aufzubauen. Mit deutschen Firmen wie Bosch und Continental tüftelt Baidu an der besten Technik für selbstfahrende Autos.
Baidu, Alibaba und Tencent – in China auch kurz BAT genannt: Die drei Firmen sind die entscheidenden Treiber der technologischen Innovation in der Volksrepublik. Zu ihnen gesellt sich zudem eine neue Riege von Start-ups, wie der Hardware-Hersteller Xiaomi, die Elektroautomarke Byton oder der Drohnen-Produzent DJI. Über Jahre schienen fast alle bahnbrechenden Ideen in der Internetwirtschaft und dem Digitalsektor aus dem Silicon Valley in den USA zu kommen. Doch das ändert sich. Chinas Firmen sind auf dem Weg, den globalen Technologiesektor umzukrempeln. In Deutschland und Europa ist die Erkenntnis über diesen fundamentalen Wandel allerdings noch nicht richtig angekommen.
Ihr Erfolg gründet jedoch nicht nur auf exzellenten Ideen und guten Produkten. Auch der chinesische Staat hat von Anfang an mitgemischt. Peking schaffte die nötigen Voraussetzungen, um binnen weniger Jahre vom einstigen Entwicklungsland zur weltgrößten Online-Wirtschaft mit mehr als 800 Millionen Internetnutzern aufzusteigen. Mit einem systematischen Ausbau des schnellen mobilen Internets können selbst Chinesen im Hinterland mit Hochgeschwindigkeit auf ihren Smartphones surfen. Derzeit bereitet Peking alles vor, um den nächsten, noch schnelleren Mobilfunkstandard 5G landesweit auszurollen.
Gleichzeitig erschwert die chinesische Führung internationalen Firmen den Zugang zum chinesischen Markt. Informationen im Internet werden genau gefiltert. Mit der »Großen Firewall« hat Peking den ausgefeiltesten Zensurmechanismus der Welt geschaffen. Die autoritäre Staatsführung will die Informationen kontrollieren, die chinesische Bürger zu Gesicht bekommen, und gleichzeitig heimischen Firmen einen geschützten Bereich bieten. Einige ausländische Firmen und Plattformen sind komplett gesperrt, wie Facebook, Twitter und YouTube. Und den Zugriff auf andere internationale Seiten bremst Pekings Machtelite bewusst aus. Firmen wie Google, eBay und Uber zogen sich nach Jahren frustriert aus China zurück. Ihre chinesischen Rivalen boten Produkte, die besser auf chinesische Kunden zugeschnitten waren. Gleichzeitig fühlten sie sich immer wieder von chinesischen Behörden strukturell benachteiligt.
Die Volksrepublik ist ein Ein-Parteien-Staat. Die Führung um Staatspräsident Xi Jinping hat einen unbegrenzten Machtanspruch, der auch für die Wirtschaft gilt. Wer in China Geschäfte machen will, muss sich unterordnen. In jedem Land müssen sich Firmen an die Gesetze halten. Aber Peking treibt diese Regeln noch weiter. Die digitale Welt eröffnet der Regierung völlig neue Möglichkeiten der staatlichen Kontrolle und Überwachung.
Jede Handlung im Internet hinterlässt eine Datenspur. Die Computer der Regierung sollen alles aufzeichnen. Der Staat tritt an, möglichst lückenlose Profile über jede Firma und jeden Bürger anzulegen. Wer bei den Überprüfungen durchfällt, wird bestraft. Fast acht Millionen Menschen fielen etwa wegen nicht zurückgezahlter Kredite, aufgrund von Straftaten oder als besonders lautstarke Kritiker der Regierung auf. Prompt wurden sie mit einem Reiseverbot belegt. Sie dürfen nicht mehr fliegen oder die Schnellzüge in China benutzen.
Peking will den Erfolg der Technologiefirmen für seine Pläne nutzen. Seit dem Jahr 2020 wird landesweit ein Punktesystem eingeführt werden, das Bürger und Unternehmen bewertet. Wer sich an alle Gesetze hält und loyal der Partei gegenüber ist, wird belohnt. Wer durchfällt, wird als »Vertrauensbrecher« behandelt und sanktioniert. Dazu wollen die Polizeibehörden Zugriff auf möglichst alle Überwachungskameras im Land haben – nicht nur die ohnehin staatlich platzierten Kameras an den Straßenkreuzungen, sondern auch die an Privatgebäuden oder in Kaufhäusern. Mit modernster Software funktioniert die Gesichtserkennung selbst in großen Menschenmengen. Die Sicherheitsbehörden arbeiten auch an neuen Ansätzen, um Menschen anhand ihrer Stimme ausfindig machen zu können. Dann lassen sich auch Telefondaten effizienter auswerten.
Um mit diesen gewaltigen Datenmengen umzugehen, setzt Peking auf die Technologiefirmen im Lande. Baidu, Alibaba und Tencent sollen ihr Fachwissen einbringen, um eine möglichst effiziente staatliche Überwachung möglich zu machen. Baidu ist bereits direkt am Aufbau der Plattform für das Bewertungssystem beteiligt. Alibaba und Tencent haben Lizenzen, um eigene Bewertungssysteme auszuprobieren, aus denen der Staat später möglichst effiziente Ansätze ableiten können möchte.
Diese Entwicklungen stellen Europa und Deutschland vor völlig neue Herausforderungen. Dieses Buch spürt den innovativsten Ideen in China nach. Es zeigt, wo Firmen aus der Volksrepublik bereits ihre Konkurrenten in Europa und den USA überholt haben und weshalb Deutschland schleunigst daran arbeiten muss, den Anschluss nicht zu verpassen. Und es führt auf, welche Denker hinter den Konzepten stehen. Es veranschaulicht, was die chinesischen Unternehmerinnen und Unternehmer auszeichnet.
Gleichzeitig macht es auch die Risiken des chinesischen Siegeszuges deutlich. Peking ist dabei, eine völlig neue Form staatlicher Überwachung zu entwickeln. Dank der Errungenschaften der Technologiefirmen sind mehr und bessere Daten über jeden Menschen auf der Welt verfügbar als jemals zuvor. Und diese Daten will Peking nutzen, um das Milliardenreich China effizienter zu steuern. Es geht darum, die Umwelt besser zu schützen, Staus zu vermeiden, aber auch, dafür zu sorgen, dass sich alle Bürger und Firmen der Kontrolle der Partei unterordnen.
Auch das wird die Wirtschaftsordnung in Europa radikal verändern. Die Ideen von Jack Ma, Pony Ma, Robin Li und ihren Kollegen dürften vieles bequemer machen. Aber sie werfen auch elementare Fragen über die Sicherheit unserer Daten und die Bedeutung von Landesgrenzen in der digitalen Welt auf. Europa hat das nur noch nicht begriffen.
1 Chinas Masterplan
Die chinesische Hauptstadt ist im Ausnahmezustand. Das Leben der mehr als 24-Millionen Einwohner läuft langsamer als sonst. Viele Autos sind mit Fahrverboten belegt. Fabriken rund um die Hauptstadt müssen ihre Produktion einstellen, um den sonst üblichen Giftcocktail aus gefährlichem Feinstaub in der Luft zumindest etwas zu reduzieren. Die Militärpolizei hat das Stadtzentrum um den Platz am Tor des Himmlischen Friedens weiträumig abgeriegelt. Panzer blockieren die Zugänge zur großen Halle des Volkes.
Das Sicherheitsaufgebot gilt besonders einem Mann: Xi Jinping. Er ist die zentrale Führungsfigur des Landes. Der 65-Jährige vereint die Position des Staatschefs sowie das in der Volksrepublik viel mächtigere Amt des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Chinas auf sich. Doch trotz dieser schon bestehenden Fülle an Einfluss wird er an diesem Tag seine Stellung in ungekanntem Maße stärker ausweiten.
Alles ist vorbereitet in der Osthalle, dem Festsaal im ersten Stock der Großen Halle des Volkes. In dem goldverzierten Raum ist ein langer roter Teppich ausgerollt. Er führt zu einem langen Podest. Zur Linken steht ein Mast mit der Fahne der kommunistischen Partei: tiefes, chinesisches Rot mit gelbem Hammer und gelber Sichel. Die Rückseite der Empore ist mit einem Gemälde der Chinesischen Mauer ausgefüllt, dem Bauwerk, das wie kein anderes die Leistung und die Entschlossenheit Chinas widerspiegelt. Vor der Bühne sitzen etwa 100 ausgewählte Journalisten.
Dann geht die Tür auf. Xi Jinping schreitet weit ausholend herein. Mit versteinertem Lächeln hebt er die Hand zum Gruß. Routiniert ignoriert er das blendende Blitzlichtgewitter der Fotografen, die den fensterlosen Raum für einige Sekunden in gleißendes Licht tauchen. Dann bleibt Xi in der Mitte der Bühne stehen. Zu seiner Rechten und Linken bauen sich jeweils drei Männer auf. Sie sind es, die die Geschicke der Volksrepublik für fünf Jahre bestimmen werden. Doch allen ist klar: Eigentlich zählt nur, welche Linie Xi Jinping vorgibt. Es gibt niemanden mehr, der ihm gefährlich werden könnte.
Xi Jinpings Traum für China
Die abschließende Pressekonferenz des Parteikongresses im Oktober 2017macht das deutlich wie nichts sonst. Das Gedankengut von Xi Jinping wird in die Parteiverfassung aufgenommen. Damit wird er auf eine Stufe mit Revolutionsführer Mao Tse-tung gestellt. Mehr noch: Er hat das Grundgesetz der mehr als 90 Millionen Parteimitglieder gleich an 107 Stellen ändern lassen. Seine Slogans wie »der chinesische Traum« oder »Xi Jinpings Gedankengut für das neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung« müssen von nun an von Kadern im Milliardenreich auswendig gelernt werden.
Xi tritt an das Rednerpult. Er räuspert sich kurz. Dann spricht er mit entschlossener Stimme: »Ein neues Zeitalter hat begonnen.« Sein Land müsse sich nicht länger verstecken. Die fast 1,4 Milliarden Chinesen hätten Herausragendes geleistet. Und dann spricht er einen wegweisenden Satz: »Unsere chinesische Zivilisation erstrahlt in dauerhafter Pracht und Herrlichkeit.«
In diesen Worten schwingt Chinas neues Selbstbewusstsein mit. Das ist ein Bruch mit der alten Volksrepublik. Der Architekt von Chinas Reform- und Öffnungspolitik, Deng Xiaoping, hatte den Funktionären noch als Leitlinie diktiert: »Verbirg deine Stärke und warte ab.« Doch diese Zeiten sind mit Xi vorbei.
Ganz im Gegenteil lässt der Partei- und Staatschef eine neue globale Weltordnung entwickeln. Die Vereinigten Staaten von Amerika ziehen sich unter Präsident Donald Trump immer stärker aus der globalen Politik zurück. Xi Jinping füllt das Vakuum.
Unter seiner Anleitung haben die Diplomaten der Volksrepublik rund ein Dutzend internationaler Initiativen ausgearbeitet. Ihr erster großer Erfolg gelang ihnen sogar noch vor dem Amtsantritt von Donald Trump mit der Gründung der Asiatischen Infrastruktur-Investmentbank, kurz AIIB. Trotz erbitterter Widerstände der USA schlossen sich zum Start im Jahr 2015 insgesamt 57 Länder der chinesischen Führung an. Bundeskanzlerin Angela Merkel ignorierte die Drohungen aus Washington und positionierte Deutschland als wichtiges Gründungsmitglied der Bank. Die Bundesrepublik war damit von Anfang an viertgrößter Anteilseigner des Finanzinstitutes. Diese Sonderstellung ließ sich Berlin einiges kosten. Deutschland schießt der Bank bis zum Jahr 2019 rund 900 Millionen Dollar zu und übernimmt darüber hinaus 3,6 Milliarden Dollar an Gewährleistungen. Dafür besetzte die Bundesrepublik einen Posten im Aufsichtsrat der Bank und der Deutsche Joachim von Amsberg erhielt den zweitwichtigsten Posten bei der Bank. Er ist Vizepräsident für Strategie und Politik. Damit ist der ehemalige Manager der Weltbank dafür zuständig, dass sich die AIIB an internationale Standards hält. Die Bundesregierung hofft, dass künftig auch einige deutsche Firmen Aufträge bei den Ausschreibungen der AIIB ergattern können.
Doch in der großen Gesamtstrategie der chinesischen Führung ist die Bank allenfalls ein Randaspekt. Das wichtigste internationale Ziel des chinesischen Präsidenten ist es, eine »neue Seidenstraße« zu errichten.
Dahinter steckt die Verwirklichung eines jahrhundertealten Traums. Die Landmassen von Europa und Asien sollen besser miteinander verbunden werden. Das Reich der Mitte will an seine Tradition anknüpfen. Es geht um die Rückbesinnung auf die einst mächtige Handelsnation. Um die Karawanen, die durch die Wüste zwischen Zentralasien, dem Nahen Osten und Europa Waren transportierten.
Dazu bedienen sich die Chinesen dem von dem deutschen Geografen Ferdinand von Richthofen geprägten Begriff der Seidenstraße. In dem Wort schwingt bis heute ein Versprechen von Abenteuer mit. Er steht für die Sehnsucht nach Ruhm und Reichtum, für entbehrungsvolle Reisen. Und er steht für Veränderungen. Noch heute beschwören chinesische Diplomaten gerne die Geschichte von Marco Polo, der angeblich auf der Rückreise aus China die Nudel nach Italien mitbrachte.
Die neue, alte Seidenstraße
Doch zu dem sagenumwobenen Begriff haben sich Pekings Technokraten einen eigenen Slogan einfallen lassen: »Yidai Yilu«, auf Englisch »One Belt, One Road« oder in Kurzform nur OBOR. Ein Gürtel, eine Straße. Der sperrige Begriff ist zum alles dominierenden Schlagwort für nahezu jede Rede von chinesischen Politikern oder Geschäftsleuten geworden.
Anfangs belächelten europäische Politiker und Unternehmensvertreter das Vorhaben. Doch heute müssen sie die Dimensionen anerkennen. Peking will nicht mehr nur Straßen, Eisenbahntrassen, Häfen und Pipelines zwischen der Volksrepublik und der Europäischen Union errichten. Mittlerweile ist das Langzeitprojekt auf die ganze Welt ausgedehnt worden. Statt der zu Beginn geplanten 65 Länder konnte Xi Jinping für ein Gipfeltreffen in Peking Staats- und Regierungsvertreter aus mehr als 130 Ländern mobilisieren.
Chinesische Banken finanzieren Projekte von Firmen aus der Volksrepublik, um in Südamerika, Afrika, Europa oder Südostasien Infrastruktur zu errichten. Wo früher Porzellan, Seide, Gewürze, Tee, Gold und Silber getauscht wurden, sollen nach den Vorstellungen von Peking künftig Lastwagen und Hochgeschwindigkeitszüge rollen, Öl und Gas durch neue Pipelines fließen. Das Pekinger Handelsministerium beziffert die Megainitiative bereits mit einem Volumen von 900 Milliarden Dollar. Und täglich wird es mehr, weil chinesische Firmen sich mit Ankündigungen gegenseitig übertrumpfen, neue Projekte entlang der Seidenstraßen hochzuziehen. In Pakistan und Malaysia entstehen gigantische Tiefseehäfen, errichtet von chinesischen Ingenieuren, finanziert mit Krediten von Pekinger Staatsbanken.
Ein Vorzeigeprojekt ist der Wirtschaftskorridor, der die Volksrepublik mit der pakistanischen Hafenstadt Gwadar am Arabischen Meer verbinden soll. Gwadar ist nur ein Beispiel von vielen, überall auf der Welt wiederholt sich das Muster. Chinesische Firmen starten Megaprojekte, flankiert von politischer Unterstützung aus Peking und finanziert mit Krediten chinesischer Banken.
Die Unternehmer und Wirtschaftsstrategen haben längst Europa in den Blick genommen. In Griechenland hält der staatliche chinesische Logistikkonzern China Ocean Shipping Company (Cosco) die Mehrheit am Hafen von Piräus. Zwischen Belgrad und Budapest soll nach diesem Schema eine Schnellzugverbindung entstehen.
Chinas Aufstieg ist ein lang angelegtes Projekt. Die Strategen in Peking denken und planen in Jahrzehnten. Die epochale Verschiebung entzieht sich unseren kurzen Aufmerksamkeitsspannen. Sie taugen dafür, die jüngsten Peinlichkeiten im Weißen Haus wahrzunehmen. Sie taugen allerdings nicht, um die globale Machtverschiebung richtig zu erfassen.
Dabei lässt Xi Jinping die Ziele seines Landes klar ausformulieren. Das Jahr 2049 ist die entscheidende Zielmarke. Zum 100. Gründungstag der Volksrepublik will China wieder führend in der Welt sein. Aus Sicht von Peking ist dies kein Aufstieg, sondern ein Wiederaufstieg. Die Opiumkriege von Großbritannien und später auch Frankreich mit dem chinesischen Kaiserreich – der Qing-Dynastie – werden aus Sicht vieler Entscheider in Peking für den zwei Jahrhunderte dauernden Niedergang des Landes verantwortlich gemacht. Doch die Zeit der Schande und Demütigung soll jetzt endgültig vorbei sein.
Der Reformarchitekt Deng Xiaoping führte die Volksrepublik ab Ende der 1970er-Jahre aus ihrer wirtschaftlichen Rückständigkeit. Seit drei Jahrzehnten kennen die Chinesen nur eine Richtung: die nach oben. Wie mit einem Joystick scheinen die Funktionäre in Peking die Ökonomie des 1,4-Milliarden-Volkes steuern zu können. Nicht die »unsichtbare Hand«, beziehungsweise das egoistische Streben eines jeden Einzelnen, wie es Adam Smith formuliert, sondern der starke Arm der Partei gibt die Richtung vor.
Peking dirigiert, das Land floriert, die Welt staunt. Noch nie in der Weltgeschichte war ein Experiment mit Staatskapitalismus so erfolgreich wie im Fall von China. Der Pekinger Führung ist es gelungen, das Pro-Kopf-Einkommen der Chinesen seit Beginn der 1990er-Jahre um den Faktor 25 zu steigern. Erwirtschaftete das Land vor rund einem Vierteljahrhundert noch einen Anteil von 1,8 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung, sind es heute weit mehr als 15 Prozent.
Das chinesische Wundermittel baut auf regional begrenzten Experimenten auf. Überall im Land errichteten die Funktionäre Inseln der wirtschaftlichen Freiheit. Was florierte, wurde unterstützt. Was scheiterte, verschwand.
Stück für Stück arbeitete sich das unbedeutende Entwicklungsland so zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hoch. Ob Schwerindustrie, Elektrotechnik oder Infrastruktur: Überall machten Firmen innerhalb kürzester Zeit gewaltige Fortschritte.
Pekings digitale Agenda
Ein Bereich überragt alles: die Digitalisierung. Hier setzt China nicht zur Aufholjagd zu den führenden Industriestaaten wie den USA, Japan oder Deutschland an, sondern bringt in vielen Bereichen bereits die weltweit führenden Technologien hervor. China setzt Standards für die globale Unternehmenslandschaft.
Das Land geht vorweg. Diese Leistung ist vor allem einem konsequenten Plan der chinesischen Zentralregierung zu verdanken. Über Jahrzehnte war die Kommunistische Partei Chinas von ideologischen Grabenkämpfen geprägt. Doch Reformarchitekt Deng Xiaoping leitete eine Runderneuerung der Auswahl von Funktionären ein. Unter ihm wurden Kader viel stärker nach ihren fachlichen Qualifikationen statt nach ideologischen Gesichtspunkten ausgewählt. In den Jahren 1989 bis 2002 festigte sein Nachfolger Jiang Zemin die schrittweise Öffnung der chinesischen Volkswirtschaft und bereitete den Beitritt zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 vor.
Das alles war die Grundlage für den chinesischen Aufstieg. Der entscheidende Impuls kam jedoch mit der Führungsgeneration um Staats- und Parteichef Hu Jintao vom XVI. Parteitag im November 2002 an. Auch wenn Hu heute in China als ein schwacher Führer gesehen wird, der kaum eigene Akzente setzen konnte, sind seine Leistungen für die Digitalisierung der Volksrepublik kaum zu hoch anzusehen. Zusammen mit ihm gab eine Generation aus Technokraten die Leitlinien für die Entwicklung des Landes vor. Die höchsten Machtzirkel waren mit Männern besetzt, die fast alle technisch-naturwissenschaftliche Studienabschlüsse mitbrachten. Sie betrachteten das Land als eine komplexe Maschine, die eine Generalüberholung nötig hatte. Und ihnen ist es zu verdanken, dass in China schon seit dem Jahr 2006 die Bedeutung moderner Datenverarbeitungs- und Informationstechniken erkannt und deren Ausbau beharrlich umgesetzt wurde.
Gleich in mehreren Strategiepapieren wies die Parteiführung die Unternehmen und Forschungsinstitute des Landes an, konsequent die beste Nutzung der modernen Techniken für alle Wirtschaftsbereiche voranzutreiben. Die Weichen sollten gestellt werden, um China zu einem globalen Vorreiter bei der Digitalisierung zu machen. Zu den wegweisenden Dokumenten zählt die »Nationale Strategie für Informationsentwicklung 2006–2010«. Die Funktionäre gingen sogar so weit, den Fünfjahresplan der mächtigsten Planungsbehörde des Landes, der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), unter das Leitprinzip der »Informatisierung« zu stellen.
Mit Erfolg: In keinem anderen Land der Welt sind mehr Menschen online. Klar, China ist auch das bevölkerungsreichste Land der Erde. Doch selbst im Verhältnis zur schieren Zahl von fast 1,4 Milliarden Menschen ist es beeindruckend, dass mehr als 800 Millionen von ihnen das Internet nutzen, die meisten von ihnen mit ihrem Smartphone, wie der staatliche Branchendienst China Internet Network Information Center ermittelt hat. Das sind mehr Menschen, als in ganz Europa leben. In Japan, Südkorea oder auch europäischen Ländern wie Norwegen ist der prozentuale Anteil der Internetnutzer im Verhältnis zur Bevölkerung mit mehr als 90 Prozent zwar noch deutlich höher als in China, doch die Volksrepublik holt mit großen Schritten auf. Schon heute ist das schnelle 4G-Mobilfunknetz sogar auf mehr als 5000 Metern Höhe in der tibetischen Hochebene verfügbar, während es selbst im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen immer wieder große Funklöcher gibt. Und schon jetzt treibt China mit großer Macht den Ausbau der nächsten Technologie 5G voran. Während in Deutschland die Netzbetreiber vor allem ihr bestehendes 4G-Netz aufrüsten, wird in China eine komplett neue und leistungsstarke 5G-Infrastruktur aufgebaut. Alleine in der Südchinesischen Stadt Shenzhen gibt es derzeit laut Regierungsangaben mehr neu eingerichtete 5G-Basisstationen als in ganz Europa zusammen. Das chinesische Forschungsinstitut China Academy of Information and Communications Technology erwartet, dass die drei Mobilfunkfirmen dafür zwischen den Jahren 2020 und 2030 insgesamt rund 7,9 Billionen Yuan (rund eine Billion Euro) investieren werden.
Während Deutschland über eine gerechte Verteilung der Kosten für den Netzausbau diskutiert, schafft China Tatsachen. Die Planungsbehörde NDRC hat einen Plan für den landesweiten Ausbau von Breitband-Internetzugängen aufgelegt. In Chinas Metropolen sind Glasfaseranschlüsse für Hochgeschwindigkeit beim Zugriff auf das Internet bereits Standard. Künftig sollen auch noch mehr als bisher die ländlichen Regionen in den Genuss der besonders schnellen Zugänge kommen. Peking fackelt nicht lange, sondern weist im Zweifelsfall die Staatsbanken an, die nötigen Gelder bereitzustellen.
Damit stellt sich China für die Zukunft auf. Je mehr Wirtschaftsbereiche vernetzt werden, desto wichtiger wird die Infrastruktur für Daten. In Deutschland werden zwar viele Konzepte für intelligent vernetzte Fabriken erdacht. Der deutsche Begriff »Industrie 4.0« ist sogar zum internationalen Schlagwort für die Zukunft der Produktion geworden. Nach Dampfmaschine, Fließband und Computer sollen intelligente Fabriken entstehen, in denen Maschinen völlig automatisch die Produktion koordinieren und ihre eigene Reparatur veranlassen. Während es in Deutschland oft eher Absichtserklärungen oder Pläne für eine ferne Zukunft sind, tritt China entschlossen auf, um die Voraussetzungen für die vierte industrielle Revolution zu schaffen. Das Land will aufholen, überholen. In der Internetwirtschaft sind chinesische Firmen oft bereits an der Weltspitze. Alibaba, Tencent und Baidu setzen globale Standards. Diese Fähigkeiten will Peking auch auf die Industrie übertragen. Mithilfe modernster Computertechniken soll auch die klassische Fabrikproduktion auf ein internationales Spitzenniveau gehoben werden. Der deutsche Begriff »Industrie 4.0« ist für die Chinesen ein Leitgedanke.
Um vernetzte Produktion möglich zu machen, müssen innerhalb kürzester Zeit gewaltige Datenmengen transferiert werden. Ein schneller Zugang zum Internet könnte daher schon bald zu einem der wichtigsten Wettbewerbsvorteile werden.
Dafür macht sich China bereit. Als im Jahr 2007 die Blase auf dem Immobilienmarkt der Vereinigten Staaten platzte und die globalen Finanzmärkte in die Krise stürzten, waren die USA und Europa damit beschäftigt, ihr Bankensystem mit Notzahlungen zu retten. Auch Chinas Exportwirtschaft wurde hart von den Auswirkungen getroffen. Bei vielen Firmen drohten Massenentlassungen. Die Planer in Peking entschieden sich zu einer Rettungsaktion mit Weitblick. Sie überfluteten das Land nicht mit billigem Geld, sondern legten ein gewaltiges Konjunkturpaket mit klar definierten Zielen auf. Die gewaltige Summe von vier Billionen Yuan, was nach heutigem Umrechnungskurs etwa einer halben Billion Euro entspricht, wurde gezielt in den Ausbau der Infrastruktur investiert. Das Geld floss dabei nicht nur in die Ausweitung von Schnellzugverbindungen, Autobahnen und neuen Häfen, sondern auch in den flächendeckenden Zugang zu schnellem Internet. Der Schritt war zwar teuer, aber er brachte China die besten Bedingungen, um bei der Digitalisierung der Wirtschaft durchzustarten.
Seit die fünfte Führungsgeneration um Präsident Xi Jinping zum XVIII. Parteitag im Jahr 2012 erst die Spitzenposten der Partei und wenige Monate danach auch die staatlichen Führungsämter übernommen hat, wird die technologische Aufholjagd weiter vorangetrieben. Der Anteil der ingenieur- und naturwissenschaftlich gebildeten Politiker ist zwar zurückgegangen, Xi ist promovierter Jurist, Li ist promovierter Volkswirt. Doch auch ihnen ist sehr an der strategischen Ausrichtung ihres Landes für künftige Wachstumsfelder der Volkswirtschaft gelegen.
Pekings gesteuerte Aufholjagd »Made in China 2025«
Den Begriff der »Informatisierung« haben die staatlichen Wirtschaftsplaner in Peking mittlerweile durch neue Schlagworte ersetzt. Online zu Offline (O2O), Internet der Dinge (IoT) und Digitalwirtschaft gehören mittlerweile zu dem Standardrepertoire in den Reden chinesischer Politiker.
Es sind viele Strategiepapiere, die den Ausbau von neuen Spitzentechnologien dirigieren. Aber kein Papier ist so bedeutsam wie »Made in China 2025«. Das im Jahr 2015 beschlossene Papier sieht vor, dass China spätestens zum 100. Gründungstag der Volksrepublik im Jahr 2049 zur »Industriemacht« aufgestiegen ist.
Die wichtigste Behörde hinter dem Plan ist das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie. Die Beamten dort hatten bereits für Hu Jintao bis zum Jahr 2012 die Fortschrittspläne ausgearbeitet. Der Arbeitstitel ihrer Anstrengungen hieß »Integration von Industrialisierung und Informatisierung«, abgekürzt 3i. Aus diesen wirtschaftspolitischen Ansätzen speist sich der jüngste Fahrplan »Made in China 2025«. Doch er geht in allen entscheidenden Bereichen viel weiter. 2014 brachte das Industrieministerium 14 unterschiedliche Branchenverbände zusammen, um mit ihnen Standards für die weitere Digitalisierung auszuarbeiten und die Leitlinien für die digitale Aufholjagd zu definieren. Die 3i-Allianz trat öffentlich zwar kaum in Erscheinung, sie bildete jedoch die Grundlage für die gegenwärtigen Pläne.
Heute durchzieht die Strategie »Made in China 2025« alle wesentlichen wirtschaftspolitischen Entscheidungen der chinesischen Zentralregierung. Das Industrieministerium hatte mit dem Papier anfangs nur eine grobe Richtung für die kommenden Jahre vorgelegt. Doch die Beamten ließen ein Expertengremium einen konkreten Fahrplan für die Umsetzung der Strategie ausarbeiten. Dieses ergänzende Dokument ist das zentrale Papier, um Chinas Ansatz zu verstehen.
Im Vergleich dazu hat die Bundesregierung zwar mit der »Plattform Industrie 4.0« auch Anstrengungen unternommen, um sich mit den Bedingungen für eine erfolgreiche Digitalisierung der Industrie zu beschäftigen. Allerdings bleiben die Ergebnisse des Gremiums bislang sehr überschaubar. Die Plattform ist weitgehend ein Dialogforum für Unternehmen, Gewerkschaften und Wissenschaft. Konkrete Ziele, Ideen oder Vorschläge gibt es nicht.