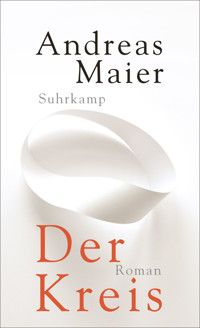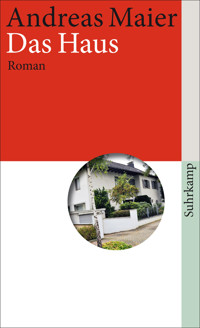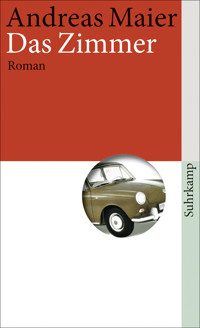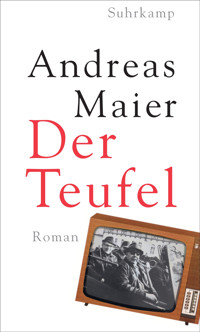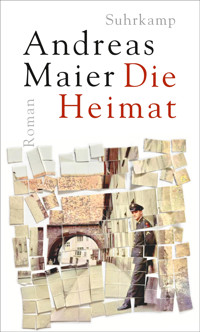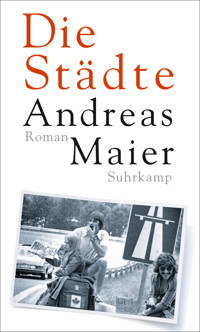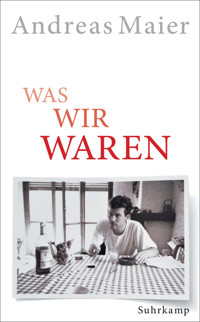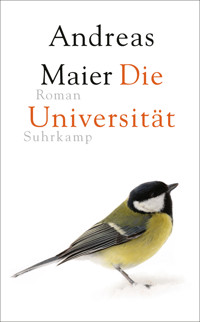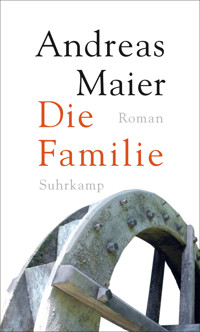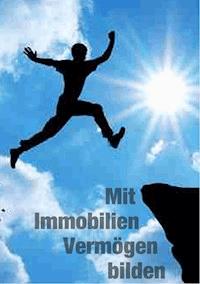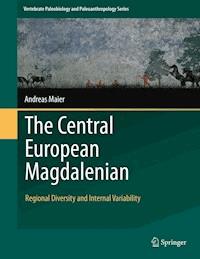9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ortsumgehung
- Sprache: Deutsch
Der Beginn der Liebe ist der Beginn der Macht. Die einen kommen in Frage, die anderen nicht. Selbst wenn sie, noch einmal wie Kinder, Gummitwist spielen, wissen sie doch bereits um ihre eigene Schönheit, denkt der Erzähler, der im Zimmer seines verstorbenen Onkels sitzt und an einer »Ortsumgehung« schreibt, während draußen die Ortsumgehung gebaut wird. Und er erinnert sich an einen Spaziergang, den er vor Jahrzehnten oft gegangen ist, als das steinerne Kreuz noch nicht mitten im Ort, sondern noch draußen auf dem Feld mitten in der Wetterau stand. Und als die Mädchen Gummitwist spielten. Er erinnert sich an die Liebe zu Katja Melchior und an die erste Nacht, die er mit dem Mädchen verbracht hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Andreas Maier
Der Ort
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Erste Auflage 2015
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
eISBN 978-3-518-74074-3
www.suhrkamp.de
in memoriam Mike Plaumann
»It’s what makes a rose want to be a rose, and want to grow like that. And a rock want to contain itself, and remain like that.«
(Ch. Chaplin)
Der Ort, die Straße, das Haus, das Zimmer, neulich sagte ich mir, du nimmst jetzt alles, deine Heimat, die ganze Wetterau, deine Familie, deine Geschichte zwischen Grabsteinen und Steinbrüchen, setzt dich ins Zimmer deines Onkels und machst daraus dein letztes Werk, ein Werk, das du so lange weiterschreibst, bis du tot bist, und dieses Werk wirst du Ortsumgehung nennen, benannt nach der Ortsumgehungsstraße, mit der sie deine Heimatstadt jetzt umgehen und auf der immer noch nicht gefahren wird, obgleich sie schon drei Jahre daran bauen und die Genehmigung, ein schönes deutsches Wort, sich über vierzig Jahre hingezogen und eigentlich mein ganzes Leben begleitet hat.
Als ich fünfzehn war, lief ich mit der Tochter des Besitzers der Bindernagelschen Buchhandlung auf der Kaiserstraße über das Feld von Friedberg nach Ockstadt und zur Hollarkapelle, und sie, die Tochter des Buchhändlers, sagte, es sei doch Wahnsinn, genau hier, wo wir gerade über die Wiese liefen, wollten die Verrückten eine Straße hinbauen, das war 1983. Stundenlang gingen wir damals spazieren, und oft nach Ockstadt, einen halben Frühling und noch einen halben Sommer danach. Die Ockstädter Hollarkapelle hat immer wieder eine Rolle in meinem Leben gespielt, an meinem achtzehnten Geburtstag sollte dort mein Selbstmord stattfinden, und später wollte ich in dieser Kapelle heiraten, zur Kirschblütenzeit, und meine Trauzeugin sollte jene Buchhändlertochter sein.
Die Planungen für die Ortsumgehungsstraße reichen in noch viel frühere Zeiten, mal überlegten sie, die Straße östlich um die Stadt herumzulegen, also über das Zuckerrübenfeld, an dessen Rand ich aufgewachsen bin, mal westlich, also über jene Felder meiner Spaziergänge mit der Tochter des Buchhändlers. Jahrzehnte später übernahm die Buchhändlertochter die Buchhandlung, redete plötzlich vom Einzelhandel und von Parkplätzen, dem Schwerlastverkehr und daß überhaupt die Kaiserstraße entlastet werden müsse, und seitdem ist sie selbst Befürworterin der Ortsumgehung über unser Feld von damals, das inzwischen nicht mehr existiert, weil es sich in eine Trasse verwandelt hat, wie alles um uns herum. Alle sind wir über dieses Feld gegangen, auch mein Onkel J. ist dort herumspaziert in seiner seltsamen Naturbegeisterung, die er für alles hegte, was mit Wald, Wild und Feld zu tun hatte. Meine Mutter ist dort entlanggelaufen, selbst der Dunkelwirt, der schon lange nicht mehr der Dunkelwirt ist, ist dort gelaufen. Der einzige, der vermutlich nie dort entlanggelaufen ist, ist mein Vater, der wird von Anfang an immer nur das Automobil benutzt haben, seinen Dienstwagen, zur Verfügung gestellt von der Henninger Bräu Aktiengesellschaft, die ebenfalls nicht mehr existiert. Mein Vater war der erste Autofahrer in meinem Leben. Jeden Morgen stieg er in den Dienstwagen und fuhr fünfunddreißig Kilometer nach Frankfurt am Main zu seiner Bierfirma, und jeden Abend fuhr er fünfunddreißig Kilometer zurück nach Friedberg in die Wetterau. Er war ja nie Wetterauer. Er kennt dieses Schicksal gar nicht.
Zwei Menschen gehen Hand in Hand an der Seebach entlang, das sind wir, die Buchhändlertochter und ich, es heißt bei uns die Bach und ist weiblich. Die Bach und das Ort. So reden wir. Hin und wieder landet eine Maschine auf dem kleinen amerikanischen Militärflugplatz, und wir laufen durch die Felder, das Wetterauer Blau über uns im Himmel, und dann erreichen wir Ockstadt, wo die Kirschen blühen, als blühten sie für uns. Hühner, Schafe, Ställe, die Ockstädter haben immer in Landwirtschaft gemacht und haben sich nach dem Krieg, als alle plötzlich arm waren, eine goldene Nase verdient. Kisten- und fuhrenweise brachten die Friedberger und Bad Nauheimer ihre Lampen, Sessel, Teppiche, Klaviere nach Ockstadt und kehrten mit Kirschen und Kartoffeln heim, oder mit Butter. Noch heute sind die Ockstädter auf unseren Wochenmärkten stets in der Überzahl. Zwischen den Kirschbäumen und den Hühnerställen blüht es rosablau, das ist das Wiesenschaumkraut, denn es ist Frühling, und wir blühen auch. Es ist sogar so, daß die Buchhändlertochter mich überhaupt zum ersten Mal nach Ockstadt über das Feld zur Hollarkapelle geführt hatte in meinem Leben. Schon als ich, bevor wir einen halben Frühling und noch einen halben Sommer gemeinsam verbrachten, in ihre beste Freundin verliebt war, erzählten sie von der Hollarkapelle und wie es sei, dort hinzulaufen, am besten nachts und vor allem bei Vollmond. Das hätten sie schon den ganzen letzten Sommer über gemacht. Eine Welteroberung. So hatten sich die beiden Mädchen ihre Welt erobert, und es war gleich die beste und schönste aller möglichen, natürlich sehr romanhaft und nicht ohne Abenteuercharakter. Wo meine Schulkameraden vor ihren damals sich überall ausbreitenden Videorecordern saßen oder Fußballtabellen ausrechneten, machten die beiden gar nichts, sondern gingen spazieren und lebten ein Leben, für das gar nichts nötig war, wie ihnen schien, abgesehen natürlich von den Eltern, die das alles finanzierten.
Ich wollte mit achtzehn Jahren dann ein letztes Mal zur Hollarkapelle, an meinem Geburtstag, dem Tag des Weltkriegbeginns, mit einer letzten Flasche Rotwein, die saufen, dann an der Kapelle zerschmettern und mir mit dem Flaschenhals die Adern aufschlitzen, so habe ich mir das damals vorgestellt. Am selben Tag, wenige Stunden zuvor, hatte ich, seelisch nahezu vollkommen betäubt, im Sanssouci gesessen, meiner Kneipe in der Friedberger Altstadt, und einem alten Lehrer von mir erzählt, wie es nachher an der Hollarkapelle zugehen werde. Ich glaube, er erhob nicht einmal Einspruch. Er hielt das alles für realistisch und wahrscheinlich sogar notwendig. Besonders schön fand er die Vorstellung, da erst einmal über das Ockstädter Feld hinlaufen zu müssen. Überhaupt zog es die Friedberger öfter nach Ockstadt, vor allem nachts und wenn die Kirschen reif waren. Oder wenn sie gerade blühten. Nach dem Diskothekenbesuch fuhren sie oft noch hin und hatten einen Kasten Bier im Auto, denn sie tranken schon damals kaum mehr Apfelwein.
Zu einer Zeit, als ich von der Buchhändlertochter längst getrennt war, lief ich immer wieder durch alle Gassen der Stadt, nachts suchte ich zwanghaft die Orte unserer gemeinsamen Vergangenheit auf, und stets war alles wie betäubt. Es waren jene Jahre, während deren die anderen auf ihre Ausbildung sannen und ihre Zukunft planten, und ich saß nachts um drei Uhr auf einer Parkbank und starrte eine Linde an, weil wieder Frühling und wieder Sommer war. Morgens hatte ich meist noch Alkohol im Blut, ich schlief immer bei offenem Fenster, auch im tiefsten Winter, dann zog ich mich in der klirrenden Kälte an, verließ kurz vor acht oder vielleicht auch erst danach das Haus und stapfte durch den Schnee zu meiner Schule hinauf in die Friedberger Burg, oder ich bog bereits vorher ab und ging ins Café, wo schon einige von uns saßen und rauchten. So taumelte man durch den Vormittag, es nannte sich Schule, bisweilen ging man auch hin, aber nur für ein paar Stunden. Am Nachmittag begann ich dann stets mit diesem unseligen Spazierengehen. Jeden Tag, kommt mir im nachhinein vor, mußte ich durch alle Straßen und Gassen Friedbergs, die etwas mit uns zu tun hatten, als müßte ich das alles auf Vollständigkeit überprüfen, und daß auch ja nichts davon verlorengehe, wenn denn schon sowieso alles verlorengegangen war zwei Jahre zuvor, nämlich als ich von der Buchhändlertochter fortgegangen war. Und natürlich führte mich jeder Tag immer wieder vor die Bindernagelsche Buchhandlung, in der ich zwanghaft Bücher kaufte, eines nach dem anderen, Frisch, Nietzsche, Mann, alles durcheinander, Benn, Kant, Dostojewski, den Malte Laurids Brigge. Damals lebte die Tochter des Buchhändlers gar nicht in Friedberg, sondern in Butzbach, deshalb war es für mich relativ gefahrlos, die Bindernagelsche Buchhandlung zu betreten, aber es bedeutete auch jedesmal einen Rausch. Keiner, dachte ich damals, kannte diese Geschichte, kein Angestellter, niemand. Ich spielte dort in der Buchhandlung immer Normalität. Ich tat so, als kaufte ich die Bücher um der Bücher willen, dabei war der Kaufakt in der Bindernagelschen Buchhandlung nichts anderes als Nervenreizung der ganz überdrehten Art. Es war wie mit einem Finger in einer Wunde herumzustochern – und dabei ein Gesicht zu machen, dem man nichts anmerkte, vergrößerte den Schmerz und die Sensation noch um ein Vielfaches.
Später, als die Buchhändlertochter wieder da war, suchte ich die Buchhandlung nicht mehr auf, ich ging seitdem immer zum Scriba, der Buchhandlung fünfzig Meter weiter. Der Bindernagel, der Scriba, zwei Welten. Heute, im Jahr 2009, ist der Bindernagel eine moderne Kleinstadtbuchhandlung unter Führung der Tochter mit breiten Auslagen und großem Beratungsliteraturbestand (Wie mache ich geschickt meine Steuererklärung?, Hundert einfache Rezepte für die einfache Küche), der Scriba ist genauso von oben bis unten und wieder hinauf bis an die Decke mit Büchern vollgestapelt wie ehedem. Ich mußte im Scriba damals auch nie etwas bestellen. Was ich wollte, war immer da. Für mich war im Scriba immer genug vorhanden. Der Scriba ist die Vergangenheit, neulich hat sich der uralte Besitzer in seiner Buchhandlung erhängt, samstags vormittags und kurz vor Eröffnung des Wochenmarkts; die Bindernagelsche Buchhandlung dagegen, mit der Tochter des ehemaligen Buchhändlers an der Spitze, ist die Zukunft. Damals führte mich jeder Tag dorthin, und dann lief ich mit dem neu gekauften Buch weiter durch die Straßen, um die Burg herum und an der Usa, unserem Fluß, entlang, dann fiel ich daheim in meinem Elternhaus erschöpft aufs Bett und trank Wein. Der Wein stand immer in meinem Schreibtisch. Ich mußte ihn mir praktischerweise nie kaufen, denn meine Eltern hatten stets größere Bestände im Keller und füllten sie so oft auf, daß ihnen Fehlmengen nicht auffielen.
Ich kann mich erinnern, wie ich ebenfalls in dieser Zeit den Zauberberg las, und zwar auf folgende Weise. Ich saß am Schreibtisch, trank Riesling aus Rheinhessen vom Weingut Erich Winter, schaute auf die Usa und die dahinter liegenden Schrebergärten, das Zuckerrübenfeld und die Linden, auf den Wetterauer Himmel, vielleicht auch einfach in die Schwärze, wenn es schon dunkel war, und las. Im hinteren Viertel des Buchs, dem epikureischen Viertel, wie ich es nannte, oder auch dem bacchantischen Viertel, wegen Peeperkorn, ging es so an meinem Schreibtisch vonstatten: Weil ich damals in einer Art von unkontrollierbarer Nachäfferei Literatur in meinem Leben nachstellte, so wie andere aus James-Bond-Filmen herauskommen und sich einige Minuten wie James Bond bewegen, kopierte ich die Peeperkorngelage ganz unmittelbar an meinem Schreibtisch, wenn auch mit beschränkten Mitteln und immer auf dieselbe Weise, eine Woche lang (ich lese ziemlich langsam). Ich kaufte mir beim HL (die Metzgerei Blum existierte damals nicht mehr) Weißbrot und ungarische Wurst, Kolbasz, möglichst scharf, keine Ahnung warum gerade Kolbasz, und dann stellte ich Wein, Wurst, Butter und Brot auf den Tisch und aß beim Lesen, den Wein öfter gegen die Leselampe haltend wie Peeperkorn, wenn er eine seiner Reden extemporiert und dabei ebenfalls sein Glas gegen das Licht hält. Ich tat das alles in großer Einsamkeit und als Weinparasit im eigenen Elternhaus, aber war doch froh, weil diese Gesellschaft im Buch für mich immerhin eine Gesellschaft war, meine einzige in diesen Wochen, und weil wir auf diese Weise sozusagen gemeinsam feierten. Daß das alles eine Krankheit war, war mir damals schon ziemlich klar. Daß ich aus der Entfernung zu allem, in die ich damals in den Jahren nach der Buchhändlertochter immer mehr hineingeriet, niemals mehr herauskommen würde, war mir vermutlich noch nicht klar. Ich dachte über all das nicht nach. Aus der Panik des Tages und der Atemnot, die mir das Alleinsein und die Einsamkeit machten, ging ich hinein in den Zauberberg, und er war wenigstens eine Weile meine Welt, ich konnte leben darin, wenn auch nur an meinem Schreibtisch und wenn auch nur mit Wein. Der Psychiater wollte schon damals, daß ich Tabletten schlucke, aber das tat ich nicht, ich hielt mich an das Weingut Winter und trank mit Mynheer Peeperkorn. Daß der Wein, die Wurst und die Butter meine Psyche auf ihre Weise balsamierten und sogar in Hochstimmung bringen konnten, verschlimmerte natürlich alles nur um so mehr. So war ich den Rausch- und Glücksmitteln verfallen und hielt deren Auswirkung, vom Wein bis zur Butter, fälschlicherweise für den Haushalt meiner eigenen Seele. Aber wie hätte ich das mit siebzehn verstehen können?
Was ich vor allem nicht verstand, war, warum nicht alle das gleiche taten wie ich, daß also alle anderen nicht an ihrem Tisch (oder an einem anderen Platz) saßen, nicht den Zauberberg (oder etwas anderes) lasen, nicht den ganzen Tag durch Friedberg (oder irgendwo sonst) liefen und also, kurz gesagt, nicht verzweifelt bzw. krank waren. Und dabei waren sie es doch, die krank waren, dachte ich damals stets. Mein Vater fuhr jeden Tag zu einer Arbeit, die er durchhielt, und er fuhr dafür jeden Tag mit seinem Auto hin und her und hin und her, was er durchhielt, über groteske Autobahnlandschaften, die die Menschen gebaut hatten und die er durchhielt, er setzte sich unter Menschen, die er durchhielt, unter einen Chef, den er aushielt, über seine Untergebenen, die ihn aushielten, dann fuhr er von Aufsichtsratssitzung zu Aufsichtsratssitzung, was er alles durchhielt, dann kam er nach Hause, begrüßte meine Mutter mit einem Kuß, roch den Alkohol aus ihrem Mund, durchwühlte sofort die ganze Küche und den ganzen Hausarbeitsraum, bis er die Schnapsflasche gefunden hatte, dann legte er sich ins Bett und bekam furchtbare Migräne, woraufhin er sich vier oder fünf Kopfschmerztabletten verabreichte, ohne daß sie etwas bewirkt hätten, und das war alles normal und ein Leben und war natürlich vollkommen krank und nannte sich gesund und Verantwortung. Unsere Lehrer ließen sich von uns anschreien und auf dem Kopf herumtanzen, und trotzdem erschienen sie am nächsten Tag wieder und ließen sich wieder anschreien und auf dem Kopf herumtanzen, und sie hielten es aus und blieben gesund, aber waren krank, und eigentlich wurden sie immer erst gesund, wenn sie endgültig krank wurden, das finanzierte dann der deutsche Staat als Beamtenpension, was mir damals in etwa als dasselbe erschien wie eine Kriegsversehrtenrente. Ein Lehrer begann sich plötzlich beide Handgelenke zu bandagieren, damit wollte er sich dem Korrigieren entziehen, schließlich schaffte er es aus dem Schuldienst, und was die anderen über ihn dachten, läßt sich denken. Sie hielten ihn gar nicht für krank. Dabei war er es. Wie sie. Aber sie nannten es Gesundheit. Alle diese Menschen konnten tun, was sie taten, und hielten es aus, es, dieses Zauberwort, in dem damals für mich etwa so viel steckte wie die ganze Welt. Ich war als einziger in unserem Haus eine Zauberbergexistenz, und bevor mir die Paprikawurst mitsamt der ganzen Butter auf den Magen schlug, ging ich hinaus, nahm unten meinen Mantel vom Garderobenhaken und unternahm meinen letzten Spaziergang an diesem Tag.