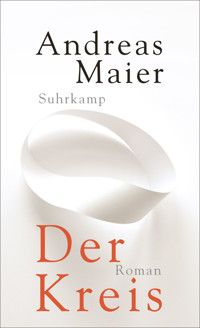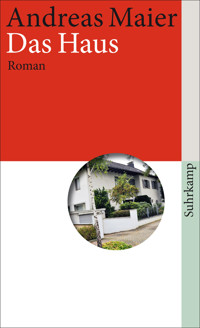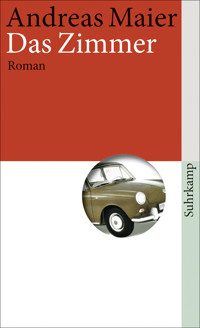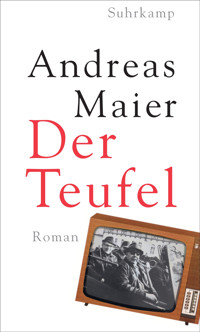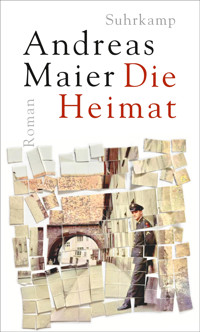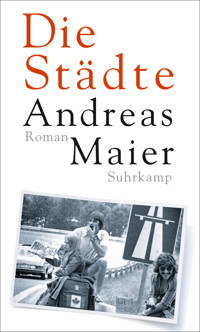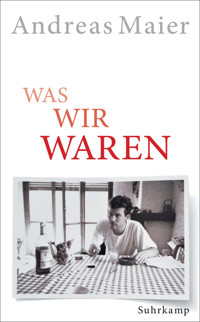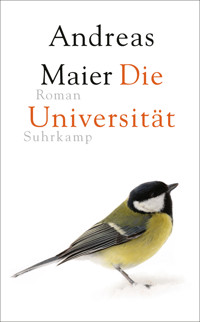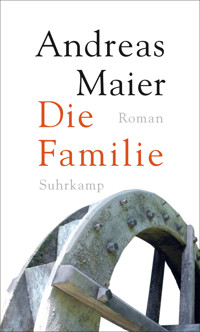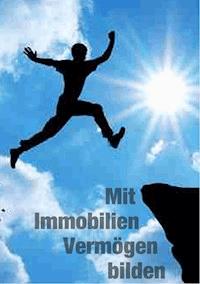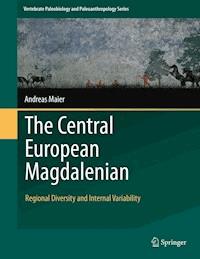7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit seinem Debüterfolg mit dem Roman "Wäldchestag" im Jahr 2000 ist Andreas Maier häufig unterwegs, um aus seinen Romanen zu lesen. Nur daß er in den letzten ein, zwei Jahren meist, wenn er eingeladen war, auch immer wieder schon aus dem kommenden Onkel J. las. Jedesmal hatte er damit das Publikum im Handumdrehen auf seiner Seite. Umstandslos fand man sich angeschlossen an Maiers Welt aus Wetterau, Familie, Fußball, Apfelwein, aus Thomas Bernhard und dem Evangelium nach Matthäus, aus Ängsten, Kneipenfreuden und -nöten, eingepackt in absurde Vorkommnisse und komische Erlebnisse. Jede Kolumne beginnt mit einem »Neulich«-Satz, die erste so: »Neulich war ich in Berlin. Das wird jetzt niemand weiter ungewöhnlich finden, aber ich bin Hesse, und mir ging in Berlin ein Wunsch in Erfüllung.« Dennoch handelt es sich um alles andere als ein Kolumnenbuch. Vielmehr nimmt Onkel J. – im Übergang von den ersten vier Romanen zu Maiers Projekt »Ortsumgehung« – eine zentrale Stelle ein. »Alles gehört zusammen, und für alles ist das Kolumnenbuch der Kern.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Andreas Maier
Onkel J. Heimatkunde
Suhrkamp
ebook Suhrkamp Verlag Berlin 2010
© Suhrkamp Verlag Berlin 2010
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung,
des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
www.suhrkamp.de
eISBN 978-3-518-73810-8
Neulich war ich in Berlin
Neulich war ich in Berlin. Das wird jetzt niemand weiter ungewöhnlich finden, aber ich bin Hesse, und mir ging in Berlin ein Wunsch in Erfüllung. Der Wunsch hat etwas mit früher zu tun, als ich viel jünger war.
Ich komme aus Frankfurt, nein, noch weniger, ich komme aus der Wetterau, die kennt fast niemand. Da spricht man schon wieder ganz anders als in Frankfurt. Wenn wir Wetterauer zum Beispiel »Wetterau« sagen wollen, dann versteht das keiner. (Wir reden von unserer Heimat, wir Wetterauer, und werden schon nicht verstanden!) Es klingt wie eine Mischung aus »Werra«, mit gaumigen Gutturalen, und »Wedra«, man darf das »d« nur ganz kurz antippen und muß dann sofort über das von der Zunge kaum bewältigte »r« stolpern, es klingt mehr wie ein sprachliches Hinfallen. »Ich habe« heißt bei uns manchmal schlicht »Eich hun«, also fast wie »Eichhorn«. Ein ländliches Volk. Man trinkt Apfelwein und viel Licher Bier, und Baumärkte sind ganz wichtig. Dort trifft man sich. Da bin ich aufgewachsen. Ein Bub in kurzen Hosen, der mit dem Fahrrad zwischen Orten wie Florstadt, Bauernheim und Ossenheim hin- und herfährt, passend in die Landschaft und doch vielleicht auf der Flucht vor allem, wer weiß, das geht ja immer in eins. Das waren so die Jahre 1979, 1980.
Dann gab es das Jugendzentrum in Friedberg in der Wetterau. Ich ging da hin, da war man links, kiffte, trank Bier und spielte Fußball im Hof. Das tat ich auch. Wurde irgendwann dichtgemacht. Die JUZ-Bevölkerung campierte dann noch ein Jahr widerrechtlich auf einer öffentlichen Wiese, kiffte, trank Bier und spielte Fußball, irgendwie waren plötzlich auch sehr viele Hunde dabei. Heute, ein Vierteljahrhundert danach, sieht man noch einige alte JUZler (sie heißen nach wie vor so) in der Stadt, gekleidet wie damals (Leder, Kapuzenpullis), im selben schlurfenden Gang, wie Monumente aus einer lang vergangenen Zeit.
Ich überstand die Friedensbewegung von der Polizei ungeschoren, legte mich in Schallers Festzelt auf der Seewiese in Friedberg in der Wetterau mit Helmut Kohl an, der hielt dort nämlich während des Herbstmarkts eine Wahlkampfrede (1983). Jahrelang zogen wir durch die Städte und setzten uns auf Böden und rauchten und machten Gackergeräusche, zumindest kommt es mir im nachhinein so vor. Immer so ein gackerndes Lachen über alles. Wir waren einfach total antispießig. So nannte man das damals.
Später zog ich nach Frankfurt und studierte. Heidegger und so weiter. Ich war nun neunzehn und irgendwie müde. Dieses permanente, dröhnende Antispießigsein die ganzen Jahre vorher war einfach sehr anstrengend gewesen, ich hatte es gar nicht bemerkt.
Anfang der neunziger Jahre fand ich mich in solchen Wirtschaften wie der »Schillerlinde« oder der »Dunkel« in Friedberg wieder, oder im »Deutschen Haus« in Bad Nauheim, und in Frankfurt ging ich in die »Germania« oder ins »Gemalte Haus«. Apfelwein, Handkäse, Rippchen, Kraut. Ich studierte Latein, saß am Fenster, ließ mir die Sonne auf die Stirn scheinen, dann nahm ich das Fahrrad wie früher in der Wetterau und radelte in die Gartenwirtschaft. Ich trug sogar wieder kurze Hosen. Herrlich! Und die Leute um mich herum. Dummbabbelnde Frankfurter. Herrlich! In Bad Nauheim im Deutschen Haus saß ich unter Kurgastpublikum, seit den neunziger Jahren ist Bad Nauheim ein Parkinsonzentrum, die Hälfte des Publikums war vergreist und zitterte, der Weg des Schoppens vom Tisch zum Mund war für manche kaum zu bewältigen im Deutschen Haus.
Dann wurde ich Schriftsteller. Alles zog nach Berlin. Wie in Panik sprang meine gesamte Umwelt plötzlich auf und war weg. Damals dichtete Tocotronic die berühmten Zeilen: Der da drüben ist jetzt DJ in Berlin / Überhaupt gehen jetzt einige da hin.
Ich kam in einen Verlag, der mehr für Bonner als für Berliner Republik stand (Suhrkamp), und mein Fußballverein stieg ab. Ich saß weiter in meinen Wirtschaften und kaufte mir ein Deckelchen, um es auf das Schoppenglas zu legen. Damit gehörte ich endgültig zu den Senioren.
Einmal lebte ich zwei Jahre in Brixen, das liegt in Südtirol. Berühmtester Satz über Brixen: »Das Stadtbild beherrschen Priester und Schafe« (Norbert C. Kaser). Eines Tages kam eine ziemlich junge, sehr hübsche RAI-Redakteurin mit dem Fernsehen zu mir und fragte mich, was ich den ganzen Tag in Brixen machen würde. Ich sagte, alles sei sehr angenehm hier, morgens arbeitete ich ein bißchen, ginge dann in die Stadt hinunter, läse in der Bibliothek Zeitung, tränke einen Kaffee, arbeitete dann wieder ein bißchen, und abends ginge ich zum Guggerhof, Nußler trinken und Speck essen. Das machte ich seit zwei Jahren Tag für Tag. Ich war damals einunddreißig. Die Frau von der RAI reiste fassungslos wieder ab.
Irgendwann war mir klar, daß ich für die meisten zum Bauern regrediert war. Ich saß unter einfachen Leuten (einfach wie ich) und führte einfache, belanglose Gespräche, die nichts wollten, niemanden bedrohten und vor allem nicht hip waren. Überhaupt nicht.
Als ich siebenunddreißig war, gründete ich mit einem Freund zusammen meinen ersten Stammtisch. Stammtisch mit Deckelchen. Im Gemalten Haus in Frankfurt am Main, Schweizer Straße. Der Traum eines gelungenen Lebens sah so aus: samstags erst zum Stammtisch, dann raus ins Stadion und Bundesligafußball sehen. Ansonsten vielleicht mal ein, zwei Tage in den Odenwald. In Frankfurt geht das. Wir Frankfurter! Aber dann kam die Eintracht (unsere Mannschaft) ins Pokalfinale, und neulich fuhren wir also nach Berlin. Dorthin, wohin alle vor Urzeiten aufgebrochen waren, um uns zurückzulassen in unserer Frankfurter Ländlichkeit, als hätten sie es eilig.
Wir besuchten Freunde in der Kastanienallee. Wir gingen in Kneipen, dort trug man so bestimmte Jacken, Kapuzenpullis, auf so bestimmte Weise kaputte Hosen, man trank Bier in einer bestimmten Haltung, die mich an etwas erinnerte, man ging auf ein Punkkonzert, das wie vor fünfundzwanzig Jahren klang, man saß auf dem Boden, gackerte, überhaupt sah alles und jeder absolut sozialkontrolliert aus, es war, wie mir plötzlich aufging, einfach alles genau wie damals im Friedberger JUZ. Selbst den etwas fiebrigen Gesichtsausdruck, diese fliegende Hitze, die man immer beim Hip-Sein hat, dieses leicht von sich selbst Berauschte, kannte ich noch.
Wie lange war das her! Was hatten wir uns verändert! Wir Frankfurter Bauern vom Land! Ja, zum ersten Mal kam ich mir wirklich wie ein Bauer vor. Ein Bauer in der großen Stadt.
In einem Fragebogen, ich glaube vom Börsenblatt, war ich einmal gefragt worden, wer oder was ich gern sein würde. Meine Antwort hatte gelautet: »Noch einmal ich vor fünfundzwanzig Jahren, aber bitte nur für einen Tag.« Ja, das hatte ich mir gewünscht; auf der Rückfahrt nach Frankfurt, dieser schönen Stadt in Hessen, dem Apfelweinprovinzschnarchnest, fiel es mir wieder ein. Und plötzlich wußte ich: da hat mir der liebe Gott also auch diesen Wunsch erfüllt, auf seine Weise. Nämlich durch die Stadt Berlin. Und grandioserweise tatsächlich nur für einen Tag.
Neulich lief ich über den Theaterplatz
Neulich lief ich über den Theaterplatz in Frankfurt am Main, der heutzutage Willy-Brandt-Platz heißt, weil er umbenannt wurde, als Willy Brandt starb. Damals standen Hunderte und Tausende vor der Frankfurter SPD-Zentrale und wollten sich unbedingt ins Willy-Brandt-Kondolenzbuch eintragen, um ihre Trauer kundzutun. Ich erinnere mich auch, wie mein eigener Vater, sämtlicher Unterhaltungstechnik gegenüber von jeher berührungsängstlich, stundenlang vor dem damals neu gekauften Videorecorder kniete, um möglichst bruchlos den unglaublich langen Beerdigungszug mitsamt Trauerfeier für Franz Josef Strauß mitzuschneiden. In seinem Schrank findet sich unter anderem auch sämtliche Berichterstattung über die Trauerfeierlichkeiten der letzten österreichischen Kaiserin Zita, Habsburgerin. Das Urbi et Orbi wird ebenfalls jedes Jahr mitgeschnitten, und selbstverständlich immer auch »Mainz, wie es singt und lacht«. Aber zurück zum Willy-Brandt-Platz, früher Theaterplatz. Das hatte Frankfurt damals aber gut gemeint! (Franz Josef Strauß wurden solche Ehren in Frankfurt nicht zuteil.) Jetzt hieß der Theaterplatz also nach dem Mann, der in Frankfurter Gastwirtschaften hier und da nach wie vor als Deutschlandverräter bezeichnet wird (im Gegensatz zu Franz Josef Strauß). Der Blick des Frankfurter Magistrats fiel daraufhin auf die U-Bahn-Pläne, die Busschilder, den gesamten Netzplan, und man mußte mit Schrecken feststellen, daß da überall, tausend- und abertausendfach, immer noch »Theaterplatz« stand. Also produzierte man paßgenaue Plastikfolienklebeteilchen mit dem Aufdruck des neuen Namens und klebte tausendfach. Die Folie war leider nicht dick genug, man sah immer noch »Theaterplatz« unter dem neuen Namen hervorschatten. Und Willy hatten sie überall mit »i« geschrieben: Willi. Den Trauerzug für Willy Brandt hat mein Vater meines Wissens nicht mitgeschnitten, da hält man eher auf die Parteizugehörigkeit. Mit der guten alten Zita dagegen war die Familie ja quasi bekannt, zumindest mit ihrem Beichtvater, und für die Beerdigung des Papstes steht schon der neue DVD-Apparat Gewehr bei Fuß. Wenn Johannes Paul II. stirbt, werden die Mediamärkte gewaltige Absätze verzeichnen. Das größte Ereignis aber wird die Beerdigung von Helmut Kohl sein. Davon wird keiner verschont bleiben. Und als Ignatz Bubis starb, hat man in Frankfurt auch gleich etwas umbenannt, nämlich eine Brücke. Ignatz Bubis war der Zentralratsvorsitzende der Juden in Deutschland. Ich habe im Gemalten Haus auf der Schweizer Straße in Frankfurt am Main mal einem besonders eigentümlichen Ignatz-Bubis-Anfall zuhören dürfen bzw. müssen. Der Mann an meinem Tisch war Mitte Vierzig, erzog sein dreijähriges Kind allein zu Hause »zweisprachig« (frankfurterisch und französisch), arbeitete an einem Ungeziefervertilgungsinstitut, bezeichnete sämtliche Frankfurter Radfahrer als »gesetzlich geschützte Militante« und prägte über Frankfurter Umbenennungen das Bonmot »solle se doch in Tel Aviv ihre Brügge umbenenne, awwer net hier«. Und dann kamen die üblichen Parallelisierungen: Wir benennen »dene ihre« Theaterplätze in Israel ja auch nicht in Willy-Brandt-Platz um et cetera (so der Mann). Der Mann hatte einen Hund unter dem Tisch, das kam dazu, und dieser Hund machte tatsächlich zwei Stunden lang keinen Mucks. Ich habe neulich infolge einer Stirnhöhlenvereiterung ein falsch verschriebenes Schmerzmittel genommen, das man nur Krebskranken im finalen Stadium gibt. Ich schwebte vierundzwanzig Stunden mindestens einen halben Meter über mir, und so ging es mir auch mit dem Ungeziefervertilger im Gemalten Haus: man hört zu, und man kann gar nicht rechtzeitig aufstehen, weil die Betäubung schon vorher erfolgt.
Neulich auf einer Lesung
Neulich war auf einer Lesung von mir jemand ziemlich betrunken. Es handelte sich um einen Mann Mitte Zwanzig, der ein braunes Mäntelchen trug und einen etwas wirren, nicht allzu langen Bart. Der Mann hatte wäßrig blaue Augen, ein leicht aufgeschwemmtes Gesicht, das Tolstoj sicherlich als »gesund« bezeichnet hätte, und er redete mich begeistert auf englisch an. Ich verstand allerdings kein Wort. Für den Mann war das kein Problem, denn er war überaus enthusiastisch und hieb mir sogar mehrfach die Hand auf die Schulter. Einige Minuten später hörte ich einen dumpfen Schlag, und wiederum zehn Minuten später erzählte man mir, der Mann sei der Länge nach auf die Dielen des Veranstaltungsortes hingeschlagen. Worauf man ihn hinausgeworfen habe. Anschließend versuchte der Mann eine ganze Weile, durch die verschiedensten Türen und auch durch das Toilettenfenster wieder in das Veranstaltungsgebäude (eine Buchhandlung mit Café) hineinzukommen, unter erheblichem Lärm. Schließlich hatte er es geschafft, stand in den hinteren Reihen, zwinkerte, winkte, zwinkerte wieder, prostete mir mit einem Weinglas zu und wurde zum zweiten Mal ergriffen und hinausgeworfen. Diese Lesung fand in Moskau statt. Später kam ein blonder Mann, sehr groß, ebenfalls mit diesen wäßrigen blauen Augen, stellte sich als artist, writer vor und zeigte mir, wie er im Spagat nur mit dem Mund (also ohne Hände) einen Stumpen mit Wodka vom Boden aufnimmt und leert. Das machte er dreimal, und vorher winkte er immer, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ja, auch in der U-Bahn sah ich ziemlich betrunkene Leute, in Rjasan sprach mich ein völlig betrunkener Soldat an, ob ich Zigaretten habe. Im russischen Fernsehen waren die Soldaten nie betrunken, ihre Kleidung war immer gebügelt, und überhaupt besteht das russische Fernsehen nur aus zwei Dingen: überall sieht man Militär und Miliz, und niemand trinkt einen Schluck. Im Fernsehen ist Rußland ein vollkommen antialkoholisches Land.
Ich schreibe das natürlich nur, um einerseits das typische Russenklischee zu bestätigen, denn jedes Klischee trifft immer zu und gehört deshalb unbedingt bestätigt. Aber zum anderen muß ich auch von einem gegenläufigen, ebenso zutreffenden Klischee berichten, und zwar von dem, das die Russen von uns, den Deutschen, haben. Warum glauben eigentlich gerade wir, uns umzubringen, wenn wir nach Rußland fahren müssen und dort glasweise Wodka aufgenötigt bekommen? (Übrigens: aufgenötigt wurde mir kein Glas, kein einziges, und die Trinksprüche sind gar nicht schlecht, und der dritte Toast ist immer auf die Frauen und die Liebe, selbst wenn man mit achtzigjährigen Großmütterchen trinkt.) Ein einfaches Rechenexempel nimmt der Sache den Schrecken. Fünfhundert Gramm Wodka sind etwa zwei Flaschen Wein, umgerechnet. Und jetzt denke man sich einen ganz normalen Abend im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Nehmen wir als Beispiel Leipzig, Buchmesse: erst Lesung, dann Sekt, dann Essen mit Wein, anschließend stundenlang ins Paulaner: Wein, irgendwann Schnaps. Dann macht das Paulaner zu, dann geht man Cocktails trinken bis sechs Uhr morgens, und mit wem man anschließend in welchem Hotelzimmer aufwacht, kann man sich da meistens noch gar nicht ausrechnen. Also, was sind dagegen fünfhundert Gramm Wodka? Und daher nun also das andere, das Deutschenklischee. Die Russen behaupten nämlich ihrerseits über uns, wir seien absolute Tottrinker. Die Russen sagen, die Deutschen fangen an zu trinken und haben nach zwei Stunden bereits die totale Besinnungslosigkeit erreicht. Die Russen sagen, die Deutschen sind Eimer, die sofort alles, was sie in die Hände bekommen können, in sich hineingießen. Und ich muß es leider bestätigen: Es stimmt. Die Russen trinken langsamer, sie mischen nicht, sie essen etwas dazu, und sie trinken nicht existentialistisch-vereinsamt wie wir, sondern sie trinken sozusagen kollegial: Sie warten auf dich, sie warten auf dein Glas, und man trinkt die Runden gemeinsam. Und der dritte Toast ist immer auf die Frauen und die Liebe. Während die Russen fröhlich am sich biegenden Tisch sitzen und gerade den dritten Liter Wodka aufschrauben, liegen die Deutschen bereits im Delirium auf dem Boden: Wein, Wodka, Bier, ach, lieber doch keinen Wodka mehr, also wieder Wein, und weil der Wein zu schwer wird, lieber Bier, und weil am Ende alles müßig ist, doch lieber wieder Schnaps, und seit Stunden keinen Bissen gegessen. Das sind wir. Ich habe einmal mit einem deutschen Verleger acht Flaschen Wein getrunken. Acht. Das sind umgerechnet zwei Liter Wodka. Es ist mir unverständlich, wieso wir so Angst vor diesen kleinen Wodkagläsern haben.