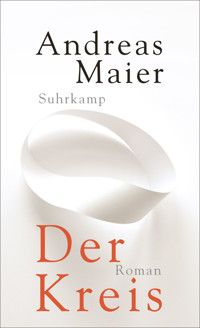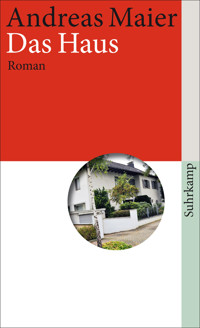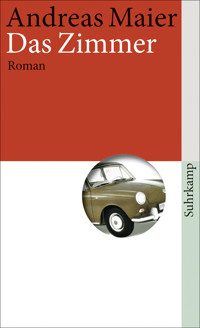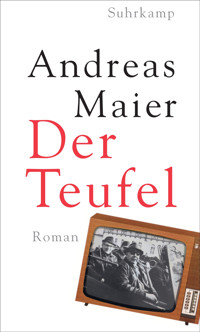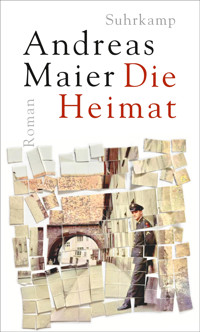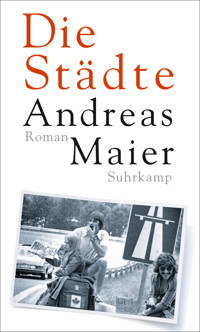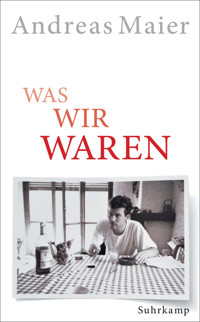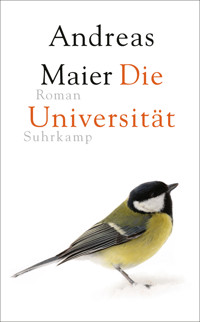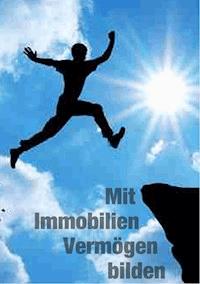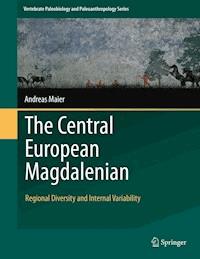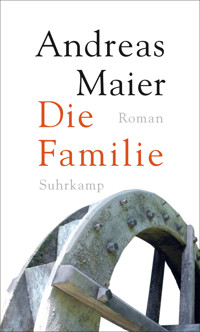
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ortsumgehung
- Sprache: Deutsch
Andreas Maier schildert in hochkomischer und abgründiger Weise die komplette Selbstzerstörung eines Familien-Idylls. Tranken die Vorfahren noch in scheinbar gemütlichster Weise familieneigenen Apfelwein miteinander, umgeben von Obstbäumen und Hühnern und Ziegen, geht es in den späteren Generationen – ebenso scheinbar – ständig um Erbfälle, ein riesiges Grundstück, ein böswilliges Denkmalschutzamt mitsamt Baggerführer, um schräge Kinder und chaotische Enkel. Irgendwann wird dem 1967 geborenen Erzähler stellvertretend für seine Generation klar: »Wir sind die Kinder der Schweigekinder.« Das Begreifen der eigenen Familiengeschichte setzt vor einem Grabstein ein, weit außerhalb der Stadt Friedberg in der Wetterau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andreas Maier
Die Familie
Roman
Suhrkamp
Prolog im alten Hallenbad
In meiner Kindheit hatte noch das alte Jugendstilbad in der Haagstraße geöffnet. Es wurde von Schulen für den Sportunterricht genutzt.
Mein Bruder war im achten Schuljahr nach wie vor Nichtschwimmer, wie auch ein paar andere in seiner Klasse. In diesem Schuljahr marschierte die Klasse öfter, Mädchen wie Jungen, von der Augustinerschule zur Bismarckstraße, am Adenauerplatz vorbei und dann in die Umkleidekabinen des alten Hallenbades hinein. Dort wurde sich der Kleidung entledigt, die Badehosen bzw. Badeanzüge wurden übergestreift, und dann versammelte sich der ganze Trupp in dem sparsam mit Jugendstilaccessoires versehenen Baderaum. Er hatte sich dort erst einmal in Reih und Glied aufzustellen, um auf Vollständigkeit überprüft zu werden. Der Lehrer schrie: Sollstärke? Die Gruppe gab einstimmig zurück, wie viele Mitglieder die Klasse zählte. Der Lehrer rief: Iststärke? Die Gruppe schrie, wie viele tatsächlich an diesem Tag erschienen waren.
In diesem Schuljahr hatte die Klasse einen neuen Sportlehrer. Mein Bruder und seine nicht schwimmfähigen Kameraden gaben zu Beginn des Schuljahrs bei der ersten Aufstellung am Beckenrand des alten Bades ordnungsgemäß an: Nichtschwimmer.
Der Lehrer kommandierte die Handvoll Schwimmunkundige in den Nichtschwimmerbereich und wies sie an, sich dort aufzuhalten.
Mein Bruder und seine Kollegen setzten sich in ironischer Laune ins Wasser und planschten dort ein wenig herum, obgleich keine kleinen Kinder mehr (manche der schon mal Sitzengebliebenen gingen in den Pausenstunden bereits in die Schillerlinde und tranken Apfelwein). Irgendwann würden sie aufgerufen, und dann würde der mühsame Prozeß des Schwimmenlernens beginnen, Übungen, Anweisungen, vielleicht Schwimmflügel, Ringe …
Der Lehrer führte eine Kohorte im Schwimmerbereich zu Sprints, unterwies sie in der richtigen Weise des Brustschwimmens und legte besondere Aufmerksamkeit auf die, die kraulen oder gar Schmetterling konnten (meistens Jungen). Sie durften gegeneinander antreten.
Mein Bruder, damals dreizehn, und seine Kollegen saßen in ihren Badehosen im Nichtschwimmerbereich und spritzten sich gegenseitig naß, was ihnen unverhohlen Spaß machte. Die Verrichtungen im Schwimmerbereich und die dortigen Hochleistungsanstrengungen der Sportlichen kommentierten sie mit Spott. Nach einer Stunde saßen sie immer noch da, fanden alles sehr lustig – besonders das Desinteresse des Lehrers an ihnen, der vor allem herausfinden wollte, wer unter den Schwimmern (und Schwimmerinnen) leistungsstark war. Am Ende der Doppelstunde kam die Anweisung zum Abrücken, die Nichtschwimmer verließen ihren Planschbereich, entledigten sich ihres Badezeugs, stiegen unter die Brause, bekleideten sich und liefen mit den anderen zusammen am Adenauerplatz vorbei und durch die Bismarckstraße zurück zur Augustinerschule.
Der Club der Nichtschwimmer hatte die folgende Woche kein anderes Thema als die eigenartige Planschstunde, die sie erlebt hatten.
Eine Woche später erfolgte derselbe Zug zum Hallenbad, und die Gruppe, zu der mein Bruder gehörte, setzte sich wieder in den Kinderbereich. Dort saßen sie, unterhielten sich, legten sich mit dem Rücken auf die Fliesen, ließen das Wasser ihre Körper umspülen, erzeugten kleine Wellen und erlebten erneut völlig entspannte zwei Stunden. Niemandem war unangenehm, daß es – bislang – abermals in keiner Weise darum ging, durch den Lehrer Schwimmen beigebracht zu bekommen.
Dieser seltsame Schwimmunterricht war Gesprächsthema, wenn mein Bruder von der Schule nach Hause kam und davon berichtete. Er erzählte damals immer witzige Anekdoten. Der Lehrer erschien als groteske Person, die Gruppe der gleichsam infantil Herumplanschenden als unfreiwillige Partizipanten eines absurden Geschehens, das in den Ausführungen meines Bruders stellvertretend für überhaupt alle Schulerlebnisse stand.
Nach einigen Wochen soll sich die Nichtschwimmergruppe dann allerdings aus eigenem Antrieb von dem Planschbereich aus zu dem Lehrer hinbewegt haben, um ihn zu fragen, worum genau es in diesem Unterricht für sie denn nun eigentlich gehen soll.
Den Lehrer habe das nicht interessiert.
So sei das Halbjahr weiter auf dieselbe Weise vergangen. Vorne hätten die Champions ihre Sprints abgezogen oder Lagenschwimmen absolviert, im hinteren Bereich sei weiter geplanscht worden, und immer wieder sei an den Lehrer der Hinweis herangetragen worden, daß das, was hier passiere, für einige nicht weiterführe. Der Planschgruppe tat das in ihrer ironischen Betrachtung der eigenen Lage keinen Abbruch. Es war zwar eine Einübung in Unsinn, aber dafür sehr entspannt, stets umsäuselt von kleinen, selbsterzeugten Chlorwasserwellen, und alles das in morbider, schon ziemlich verfallener Jugendstilatmosphäre (das Hallenbad wurde drei Jahre danach für immer geschlossen).
Dann gab es Zeugnisse. Die Nichtschwimmer hatten an keinem Sprint, keiner Langstrecke und keinem Lagenschwimmen teilgenommen. Sie hatten keine Leistung erbracht. Allesamt bekamen sie eine 5.
Mein Vater, Rechtsanwalt und damals CDU-Bürgermeisterkandidat, war Elternsprecher in dieser Klasse, sein Vertreter, ein SPD-Kommunalpolitiker, kam aus Florstadt. Der Sohn des SPDlers hatte ebenso wie der Sohn des CDUlers im Planschbereich gesessen und war wie dieser mit einer 5 in Sport in die Ferien verabschiedet worden.
Was folgte, war ein Krieg mit allen juristischen Mitteln. Auf der einen Seite die große Koalition aus CDU und SPD bzw. Friedberg und Florstadt, auf der anderen Seite das Direktorium der Augustinerschule, zwischen den Fronten der Sportlehrer und die gesamte »Sollstärke« der Klasse.
Mein Vater und sein Stellvertreter gewannen den Krieg. Jeder Schülerin und jedem Schüler wurde die Sportnote aus dem Klassenzeugnis gestrichen. Alle Sprints, alle Langstrecken und alle Lagen waren für die, die sich dafür mit einer 1 prämiert sahen, vergeblich gewesen, denn jetzt stand statt der 1 nur noch ein Strich im Zeugnis, versehen mit dem Hinweis, daß eine Benotung für die Leistungen in diesem Halbjahr aus pädagogischen Gründen entfällt.
Die Familie
1
Die Familie besaß das mit Abstand größte Grundstück am Usa-Ufer. Es war so riesig, daß auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Mühlweg mindestens zehn Häuser Platz hatten. Das Gelände maß über zweihundert Meter in der Länge und nahm fast die ganze Strecke von den Vierundzwanzig Hallen, unserem Eisenbahnviadukt, bis hin zur Barbarastraße ein. Von dem Viadukt waren wir in meiner Kindheit nur durch eine kleine Gerberei getrennt, die zwischen uns und der Bahnstrecke lag. Alles andere gehörte uns.
Die Familiensage lautete so: Die Bolls waren in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts aus dem Vogelsberg oder der Rhön in die Wetterau gekommen und hatten hier den Steinmetzbetrieb gegründet, der Gründer hieß Melchior Boll. Die Firma war am Usa-Ufer angesiedelt, an dem ich später aufgewachsen bin. Mein Urgroßvater Karl hatte auf dem Gelände einen großen Obstgarten, hielt dort Hühner und Ziegen, hatte zahlreiche Apfelbäume und ein riesiges Faß, aus dem er den Anwohnern Apfelwein ausschenkte. Die Nachbarn brachten ihre Gläser mit, und dann saßen sie auf Bänken im Schuppen neben dem Faß, aßen Walnüsse und tranken Süßen und im neuen Jahr den fertigen Apfelwein.
1970 zogen meine Eltern auf das Grundstück. Vorher hatten wir im Haus meiner Großeltern in Bad Nauheim gewohnt, woran ich mich allerdings nicht erinnern kann. Mein bewußtes Leben setzt mit der ersten Zeit auf dem Friedberger Grundstück ein.
Ich habe nur fragmentarische Erinnerungen an den Anfang. Die Steinwerkefirma meines Großvaters (Wilhelm), Urgroßvaters (Karl) und Ururgroßvaters (Melchior) war noch in Betrieb; unser Teil mit dem neuen Wohnhaus war von dem Firmengelände durch nichts abgegrenzt, es gab keinen Zaun, keine Mauer, nicht einmal eine optische Begrenzung, man konnte einfach über das Feld nach drüben zur Firma spazieren, ohne das Trottoir betreten zu müssen. Meistens sah ich meine Mutter in ihrem hellen Übergangsmantel hinüberlaufen, sie war zu der Zeit Direktorin der Firma, das Büro wurde von der alten Falkschen Mühle beherbergt, einem Fachwerkgebäude aus unvordenklichen Zeiten, das ebenfalls auf dem Grundstück stand und dem das Mühlrad fehlte. Es fehlte auch der Flußlauf, denn dieser war um die Jahrhundertwende verlegt worden. Die mühlradlose Mühle stand jetzt einfach an der Straße, fünf Meter von dieser entfernt. Sie war das älteste Gebäude im Viertel.
Um unser neues Haus herum befand sich ein freies Geländestück, das am Anfang noch fast unbepflanzt war, bis auf einige übriggebliebene Apfelbäume. Die Obst- und Gemüseplantagen, die laut der Familiensage Urgroßvater Karl dort gehabt haben soll, mußten offenbar alle im Zuge des Hausbaus verschwunden sein. Nun war überall bloß neuangelegte grüne Wiese.
Alles, was ich auf diesem Gelände erlebte, hatte für mich mythische Züge und kam mir vielfach vergrößert vor. Zum Beispiel grub mein Vater mit ein paar Leuten eines Tages eine Grube von vielleicht zwei oder drei Metern Länge, mehr als einem Meter Breite, und in die Tiefe ging es ebenfalls einen Meter. Wozu diese Grube diente, weiß ich nicht mehr, aber für uns Kinder war sie tagelang eine urtümliche Behausung, wir überdachten sie, legten Decken hinein, fantasierten Abenteuer … Wie andere ihre Baumhäuser bestiegen, kletterten wir in jene Grube hinab. Vor allem war es abenteuerlich, in diese Grube hinunterzugelangen, denn für mich war sie immens tief. Auch das Herauskommen war nicht einfach, ich mußte immer auf etwas hinaufklettern, und meistens zog mich irgendwer nach oben. Es muß die früheste Zeit im Mühlweg gewesen sein, bevor mich die große Angst befiel, die mich dann meine ganze Kindheit über weitgehend von meiner Umwelt (und solchen Grubenabenteuern) fernhielt.
Vielleicht war ich damals noch frei für Eindrücke, und der Grubenaufenthalt bedeutete für mich den ersten Eindruck von »unter der Erde sein«. Ich hatte mit Sicherheit keine Assoziation mit »Grab«, aber ich hatte mich noch nie zwischen »Wänden« aufgehalten, die ausschließlich aus Erde bestanden, und ich hatte auch noch nie ein Leben unterhalb der Grasnarbe erlebt.
Eine andere Situation, ebenfalls ganz früh: ein Zelt im Garten, eines ohne Zweck, nur für uns Kinder hingestellt, vermutlich am ehesten für meine Schwester, denn das Zelt (eine Art Partyzelt für Kinder) wurde hauptsächlich von den Freundinnen meiner Schwester und ihr frequentiert, es stand einige Tage, heute muß ich bei der Erinnerung an damals an das jüdische Laubhüttenfest denken. Es war ein rituelles Draußensein. Was da so alles passierte, weiß ich natürlich ebenfalls nicht mehr. Ich habe nur das Zelt vor Augen. Wie die Grube die erste in meinem Leben gewesen war, so war auch das Zelt das erste.
Dann: Feuer. In die Erde gerammte brennende Fackeln. Nacht, Sterne, vermutlich eine Gartengesellschaft meiner Eltern auf Plastikstühlen mit Salzstangen, Gervais-Dip und Bier, aber für mich waren es ausschließlich diese riechenden, schmauchenden, wie Geister emporwehenden und umherflackernden Fackeln. Vielleicht mein erstes bewegtes Feuer überhaupt, denn im Haus meiner Großmutter gab es keinen Kamin, und Gartenfackeln kannte ich ebenfalls nicht. So sammelten sich auf diesem Gelände Urbilder: Erde, Grube, Feuer, aber auch: Sterne, Mond, Nacht.
Von Anfang an gab es welche, die im Garten »mithalfen«. Einer ganz dunklen Erinnerung nach könnte eine Hilfe mein Onkel Heinz gewesen sein. Damals, als wir auf das Grundstück zogen, war das Verhältnis zu ihm noch unbelastet. Das kam mir zumindest so vor, ich spürte keine Dissonanzen oder Belastungen irgendeiner Art. Natürlich wurde mir, dem Kleinkind, die Welt und die Beziehungen der Familie untereinander immer als heil dargestellt.
Mein Onkel J., der geburtsbehinderte, dem seine an den Kopf angesetzte Zange zeitlebens die heile Welt verhindert hatte, auch wenn er sich zur Hälfte seines Wesens in einer solchen gefühlt haben mochte, half (wenn überhaupt) nur zwangsweise im Garten mit. Im Grunde habe ich nur eine Szene mit ihm vor Augen, nämlich wie er mit einem Spaten auf Maulwurfsjagd ging. Wir hatten manchmal zahllose Maulwurfshügel im Garten, und mein Vater erzählte mitunter etwas angegriffen davon, wie begeistert J. auf die Maulwürfe einschlug, um sie zu töten und anschließend in die Usa zu werfen. Sonst tötete er nie und neigte auch nicht dazu, Tiere zu quälen. Hier aber ging es um Jagd, Erfolg und Anerkennung. Ich selbst habe damals immer nur die Hügel gesehen, nie einen Maulwurf selbst. Meinen ersten Maulwurf sah ich überhaupt erst Jahrzehnte später, in der Pfalz, beim Joggen. (Kaum bemerkte er mich, da verschwand er unter die Grasnarbe in die Erde, wie wir damals in unserer temporären Gartengrube.)
Ich bin aber dennoch, auch wenn ich nur dieses solitäre Bild vor mir habe, felsenfest davon überzeugt, daß Onkel J. anfänglich im Garten geholfen hat. Ob sie das Gelände damals schon Garten nannten, offen wie es war gegen die ganze Umwelt, kann ich nicht sagen.
Seltsam nahm sich die Terrasse hinter dem Haus aus, eine Plattform aus Waschbeton, ohne jede Umrahmung, sie ging einfach in die weite Wiese hinein, wie eine Anlegeplattform in die offene See.
Dann kam der Zaun zur Straße, erste Rosenbeete wurden angelegt, Rhododendren um die Terrasse herum gesetzt, jeden Samstag der Geruch gemähten Rasens und um 17.15 Uhr stets die Frage meines Vaters, wie Eintracht Frankfurt gespielt habe. Für ihn war das Grundstück ein Idyll und eine Aufgabe zugleich.
Später wurde ein Plastikrohrsystem im Garten verlegt, damit man überall Sprengwasser zur Verfügung hatte und nicht fünfzig Meter lange Schläuche hinter sich herziehen mußte. Die Anlage war generalstabsmäßig geplant, Hunderte von Metern Strecke wurden rings um das Haus aufgegraben und wieder verschlossen. Eine Gartenlaube kam dazu, und im Sommer rieselten nun allerlei Sprenklergeräte im Garten, deren mechanisches Ticken und Tacken bei Dämmerungsbeginn mit dem Ticksen der Amseln konkurrierte.
Hier nun also wohnte meine Familie. Das war ihr Ziel gewesen.
Schon als Kind konnte ich die juristischen Verhältnisse um das Grundstück herum auswendig aufsagen, denn sie sorgten für Streit und waren das vorherrschende Thema bei uns. Das Grundstück meines Urgroßvaters, vom eigentlichen Firmengebiet über das inzwischen von uns bewohnte Stück bis hin zum Ende des Obstgrundstücks, war nach dem Tod meines Großvaters in vier Parzellen unterteilt worden. Eine Parzelle gehörte meiner Mutter: Darauf stand unser Haus, sie umfaßte auch das erwähnte Apfelgrundstück. Eine Parzelle gehörte meinem Onkel Heinz: Sie befand sich zwischen unserem Haus und dem ehemaligen Firmengelände, auf dem damals noch die Hallen und Kräne standen. Eine Parzelle gehörte meinem Onkel J.: ein Birkenwäldchen hinter den Hallen bis hin zur Usa. Die letzte Parzelle, das eigentliche Firmengrundstück, gehörte meiner Mutter, Onkel J. und Onkel Heinz »zur gemeinsamen Hand«.
Mein Vater fuhr in den ersten Jahren nach dem Hausbau öfter zu Gesprächen mit meinem Onkel Heinz und seiner als Unsicherheitsfaktor geltenden Frau Dörte, einer Dänin. Es ging um die vierte Parzelle »zur gemeinsamen Hand«. Mein Vater stieg unter Anspannung in seinen Mercedes-Dienstwagen, meine Mutter stand sorgenvoll in der Ausfahrt, schaute ihm beim Wegfahren zu, dann ging sie ins Haus zurück und war in den nächsten Stunden selbst so nervös, daß sie die ganze Zeit im Keller bügelte oder mangelte, um sich abzulenken. Wenn mein Vater dann wieder in die Einfahrt fuhr, mußte ihm meine Mutter aus dem Wagen helfen. Anschließend saß mein Vater in der Küche oder im Wohnzimmer, hielt sich den Kopf, konnte lange nichts sprechen, war völlig aus der Fassung und murmelte nur vor sich hin, daß mein Onkel Heinz verrückt sei. Er mußte dann ins Schlafzimmer geführt werden, in dem er seiner Migräne Herr zu werden versuchte. Bevor Heinz, sagten meine Eltern damals, über irgend etwas mit sich reden lasse, was den Verkauf der gemeinsamen vierten Parzelle angehe, wolle er aus völlig unverständlichen Gründen – er war ja verrückt – einhunderttausend Mark haben. Mein Onkel Heinz war auf diese Weise längere Zeit meines Lebens jemand (unterstützt oder verführt von Tante Dörte), der einfach so und ohne jeden Grund einhunderttausend Mark haben wollte, eine Summe, die mir als Kind so gewaltig wie ein Lebenskapital vorkam.
Samstags wurde bei offener Gartentür in der Küche gegessen. Dann war Herr Giebel anwesend, unsere Gartenhilfe, die wir inzwischen hatten. Das Grundstück war viel zu groß, als daß mein Vater die Gartenarbeit hätte allein bewältigen können.
Die Männer kamen von der Gartenarbeit und saßen verschwitzt in Unterhemden da. Die geöffnete Gartentür machte die Küche zu einem Limbus, einem halböffentlichen Bereich zwischen draußen und drinnen, sie war der einzige Raum im Haus, zu dem Herr Giebel Zutritt hatte.
Von uns Kindern aß dasjenige mit, das gerade zufällig anwesend war. Es gab Hausmannskost, Frikadellen, Schnitzel oder Suppenfleisch mit grüner Soße. Das Gespräch zwischen meinem Vater und Herrn Giebel drehte sich um das Grundstück bzw. um Gartenthemen. Giebel hatte eine undeutliche Aussprache, er knurrte und roch meistens stark nach Bier. Manchmal sprachen sie auch über Giebels persönliche Lage und über die Bedingungen, die im Karl-Wagner-Haus herrschten. Das war das Sozialhaus, in dem er sein Bett und seinen Spind hatte. Giebel war ein alleinstehender Ostflüchtling und nach dem Krieg nach Friedberg gekommen.