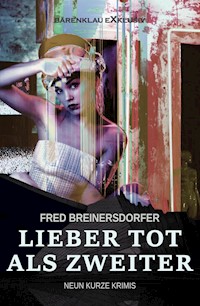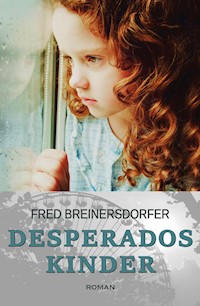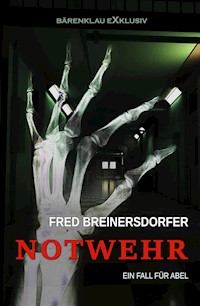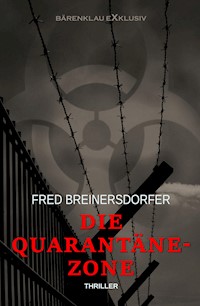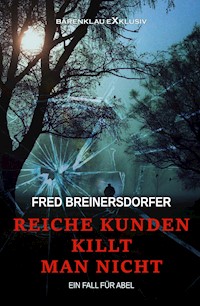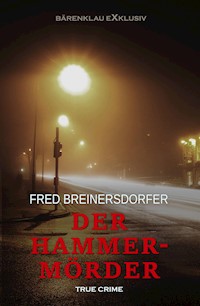3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eduard Hablik ist ein gnadenloser Richter und hat so manche Schwierigkeiten mit Frauen. Er liest eines Abends eine verletzte und verwirrte junge Frau auf, Stella, äußerst aufregend und ebenso rätselhaft. Sie lebt seit Jahren entmündigt in einer Nervenheilanstalt und ist anscheinend entflohen. Hablik verfällt sofort ihrem Charme und will ihr helfen, die Entmündigung aufzuheben. Die beiden bitten den Rechtsanwalt Abel um Hilfe. Doch offenbar verschweigt Stella so einiges:
Weshalb flieht sie vor ihrem amtlichen Betreuer? Warum sucht der undurchsichtige Leiter der Klinik nach ihr? Und stimmt das, was Menschen, die sie näher kennen, über sie sagen? »Sie ist böse und von Natur aus gefährlich. Sie verstellt sich, sie wickelt jeden um den Finger, den sie um den Finger wickeln will.«
Jemand wird ermordet, die Ereignisse beginnen sich zu überschlagen und auch Jean Abel gerät plötzlich in Lebensgefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Fred Breinersdorfer
Der Richter und das Biest
Ein Fall für Abel
Ein Kriminalroman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Christian Dörge mit Bärenklau Exklusiv, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Der Richter und das Biest
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Montag
Dienstag
Freitag
Dienstag
Freitag
Der Autor Fred Breinersdorfer
Folgende Romane des Autors Fred Breinersdorfer sind ebenfalls erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Eduard Hablik ist ein gnadenloser Richter und hat so manche Schwierigkeiten mit Frauen. Er liest eines Abends eine verletzte und verwirrte junge Frau auf, Stella, äußerst aufregend und ebenso rätselhaft. Sie lebt seit Jahren entmündigt in einer Nervenheilanstalt und ist anscheinend entflohen. Hablik verfällt sofort ihrem Charme und will ihr helfen, die Entmündigung aufzuheben. Die beiden bitten den Rechtsanwalt Abel um Hilfe. Doch offenbar verschweigt Stella so einiges: Weshalb flieht sie vor ihrem amtlichen Betreuer? Warum sucht der undurchsichtige Leiter der Klinik nach ihr? Und stimmt das, was Menschen, die sie näher kennen, über sie sagen? »Sie ist böse und von Natur aus gefährlich. Sie verstellt sich, sie wickelt jeden um den Finger, den sie um den Finger wickeln will.« Jemand wird ermordet, die Ereignisse beginnen sich zu überschlagen und auch Jean Abel gerät plötzlich in Lebensgefahr …
***
Der Richter und das Biest
Donnerstag
»Im Namen des Volkes«, sagte der Richter am Amtsgericht Dr. Eduard Hablik und blickte streng in den stickigen Saal. Er trug eine schwarze Richterrobe aus Schurwolle mit aufgenähtem schwarzen Samtschal. Ein langer Mensch, blonde kurze Haare über einem älter gewordenen Lausbubengesicht. Er sah sich um. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Nur der Verteidiger starrte aus dem Fenster. Er war so um die fünfzig Jahre, lässig, Lesebrillenträger, Geheimratsecken, kurze, nach vorne gekämmte Haare unbestimmbarer Farbe. Er trug seine Robe offen und hatte die Hände in den Taschen eines verknautschten Sommeranzugs aus Leinen, die gedeckte Krawatte hing auf Halbmast.
Im Westen wuchsen weiße Wolkentürme, die vom Licht der Nachmittagssonne grell ausgeleuchtet wurden. Unter den Bäuchen der Wolken lagen finstere Schatten. Die Hitze drückte seit dem Wochenende auf München. Die »Süddeutsche« brachten im Lokalteil Fotos aus dem Englischen Garten und von übermütigen jungen Touristen in den Wasserfontänen am Stachus im Gegenlicht. Die Todesanzeigen, zwei Seiten weiter, belegten nun schon fast anderthalb Blatt. Viele alte Leute. Kreislauf. »Nach einem langen, erfüllten Leben hat Gott in seiner unendlichen Weisheit unseren Opa, Vater, Onkel und Freund unerwartet zu sich gerufen.« Wissenschaftler diskutierten schon wieder die fortschreitende Versteppung in Europa. Und gestern noch mal ein halbes Grad im Schatten mehr! Heißester Sommer seit Jahren. Und auf der Wetterkarte überall Hochdruck. Und örtliche Gewitter vor den Alpen.
Während der Verhandlung des Jugendgerichts war der Straßenlärm durch die ausgeklappten Fenster nur gedämpft zu hören. Es roch nach Menschen und Fußbodenversiegelung. Der Richter machte immer noch keine Anstalten weiterzusprechen.
Der Angeklagte starrte zu ihm hinauf und murmelte auf Italienisch »mach doch endlich«. Er presste seine Daumen, bis es schmerzte.
Habliks Blick blieb verärgert am Verteidiger hängen. Dass ein Rechtsanwalt in einer Strafverhandlung lässig die Hände in den Anzugtaschen vergräbt und mit dem Rücken an der Wand lehnt und aus dem Fenster sieht, wenn ein Urteil verkündet werden soll, fand er einfach ungehörig. Der Blonde in der Richterrobe räusperte sich wütend, um die Aufmerksamkeit des Anwalts auf sich zu lenken. Jean Abel registrierte nicht. Er veränderte weder Haltung noch Blick. Abel mochte Hablik nicht und Hablik mochte keine Anwälte. Und diesen Herrn Abel schon gar nicht.
Hablik gab sich einen Ruck. »Im Namen des Volkes«, wiederholte er. »Der Angeklagte Franco Geali wird freigesprochen.« Danach ganz schnell und haspelnd: »Der Haftbefehl wird aufgehoben. Für die zu Unrecht erlittene Untersuchungshaft wird dem Angeklagten eine Entschädigung zugebilligt, seine Auslagen fallen der Landeskasse zur Last.«
»Bellissimo!« Jubel auf der Anklagebank.
Raunen im stickig heißen Zuschauerraum. Die Ehefrau des Angeklagten, so um die fünfzig, schlug mit undurchsichtigem Gesicht ein Kreuz. Zwei Männer wandten sich ab und setzten helle Strohhüte auf, noch bevor sie den Raum verließen. Eine junge Frau mit stark geschminktem Madonnengesicht, der man ihre gerade mal sechzehn Jahre nicht ansah, die Tochter des Freigesprochenen, Greta-Maria, senkte die Mundwinkel, reckte verstohlen den Mittelfinger der linken Hand zu einer obszönen Geste und murmelte »un cordiale va fan culo«.
Der Freigesprochene schrie immer wieder »Bellissimo!« wie auf dem Fußballplatz und ballte die Faust. Seine Stimme hallte durch den Gerichtssaal. Der Staatsanwalt rief tadelnd: »Ich darf doch bitten!« Der Freigesprochene jubelte weiter.
»Ruhe«, bellte der Richter. »Ruhe.«
Raunen, dann Zwischenrufe aus dem Publikum. Hablik brüllte noch lauter: »Ruhe.« Kasernenhofton, der nicht zu dem Sommersprossengesicht des Mannes in der schwarzen Robe passte. Er setzte sich mit seinem Ton und einer gebieterischen Geste durch und brauchte keine Ordnungsstrafe anzudrohen. Geali schwieg endlich, atmete in Stößen und sah strahlend zu, wie der Richter sich nach kurzer Pause auf seinem Stuhl niederließ und mit der Urteilsbegründung begann.
»Der in Castel San Giovanni, Italien, am 26.4.1955 geborene Angeklagte wuchs in geordneten Verhältnissen auf.«
Abel schniefte und hielt den Mund. Als alles Platz nahm, blieb er stehen und betrachtete ebenso ungerührt wie demonstrativ die sich auftürmenden Wolkengebirge, die langsam ihre Schatten über die Innenstadt schoben. Das grelle Licht war plötzlich wie abgeschaltet. Ein Windstoß trieb den Geruch von Straßenstaub durch die Fenster herein.
Hablik blickte für eine Sekunde von seinem Notizblatt auf, bevor er fortfuhr und die magere Biographie des Angeklagten referierte, um dann auf den Tatvorwurf einzugehen.
Die Ausführungen des Jugendgerichts, vor dem sich Erwachsene verantworten müssen, wenn Jugendliche die Opfer einer Straftat sind, blieben knapp. Der freigesprochene Franco Geali hatte im Verdacht gestanden, sich seiner minderjährigen Tochter Greta-Maria sexuell genähert zu haben. Keine Vergewaltigung, aber eine massive sexuelle Nötigung, immerhin ein Tatbestand, der zu einer empfindlichen Strafe geführt hätte – wenn Geali zweifelsfrei überführt worden wäre.
Der Richter sprach in der Begründung seiner Entscheidung nicht von »mutmaßlichen Tatbeständen«, er relativierte nicht. Von »sexuellen Handlungen« war die Rede, ohne Wenn und Aber. Obwohl dieses in Habliks Augen lächerliche Strafprozessrecht ihn dazu zwang, einen Freispruch zu verkünden, sollte jeder wissen, was er als Richter wirklich dachte. Er wollte sich nicht irgendwann vorwerfen lassen müssen, die Augen verschlossen zu haben. Ganz abgesehen von seinem Gewissen! Außerdem presste eine unbestimmte Wut seinen Magen zusammen. Nicht Wut auf diesen schmierigen Wurm von Angeklagten, nein, vielmehr Ärger über den Verteidiger, der doch auch Augen und Ohren hatte und trotzdem so tat, als sei Geali ein rechtschaffener Mann und eine Anklage gegen diesen Ganoven wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit versuchtem Inzest eine absurde Ungerechtigkeit. Und dann noch als Organ der Rechtspflege bei der Urteilsbegründung blasiert herumstehen und zum Fenster hinaussehen! Für Hablik war dieser Geali schuldig. Einschlägige Vorstrafen des Inhabers eines Getränkehandels befanden sich in den Akten. Versuchte Vergewaltigung zweier Mitarbeiterinnen. Hablik ließ sich so lang und breit darüber aus, als würde er einen Schuldspruch begründen.
Der Richter hatte die Blicke zwischen Vater und Tochter genau registriert. Keiner konnte Hablik erzählen, dass da nichts gelaufen war. Nur das seiner Meinung nach übergenaue Beweisrecht erlaubte ihm nicht, seine Eindrücke in eine Verurteilung einfließen zu lassen. Und Hablik war zu sehr Jurist, zu korrekt, um das Recht nicht zu respektieren, aber er hasste es, wenn es ihn zu Resultaten zwang, die ihm gegen den Strich gingen.
Hablik redete nun beinahe nur noch in Stichworten. Dann sagte er etwas für einen Richter in dieser Situation Ungeheures: »Das Gericht ist trotz allem der Überzeugung, dass es zu einem massiven sexuellen Vorfall zwischen dem Angeklagten und seiner Tochter kam.« Abel hob den Kopf, er runzelte die Stirn. Trotzig, wie ein zorniges Eingeständnis der Schuld, folgten dann die Worte des Richters: »Der Vorwurf lässt sich dem Angeklagten leider nicht zweifelsfrei nachweisen.«
Abel sagte mit ruhiger Stimme, die Urteilsbegründung unterbrechend: »Leider? Herr Vorsitzender, das hör’ ich mir nicht an.«
Hablik wurde bleich.
Abel nickte knapp zuerst dem Mandanten, dann dem Staatsanwalt und schließlich dem Richter zu. Dann wandte er sich zum Gehen. Als er die Tür öffnete, fegte ein Windstoß Staub und abgestandene Luft aus dem Raum.
*
Wenig später ging Abel einen Seitenflur entlang und bemerkte dabei nicht, dass die Tür zu Habliks Dienstzimmer einen Spalt offenstand. Kaum war der Verteidiger vorbei, stürzte Hablik heraus. Er packte Abel voller Zorn an der Schulter und schrie: »Alle haben plötzlich gemauert. Alle! Keiner wollte aussagen. Die ganze Familie nicht.
Wie bei der Mafia. Wenn die Kleine sogar von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch …«
»Ich war auch im Gerichtssaal, Herr Hablik«, sagte Abel kühl und schüttelte die auffällig schmalen Hände des Richters von seiner Schulter.
»O ja«, rief Hablik in höhnischem Ton, »das war ja nicht zu übersehen.« Wieder packte er zu. Sein Griff war erstaunlich hart.
Abel genoss, wie der Richter die Fassung verlor. Betont langsam griff er noch einmal nach den Händen auf seinen Schultern und entfernte sie mit einem kurzen Ruck. Er wollte weitergehen, doch Hablik versperrte ihm den Weg, schob sein Gesicht nahe heran. Sein Atem roch nach Spearmintkaugummi. Abel bemerkte, wie die Lippen des blassen, langen Mannes bläulich anliefen. Hablik zischte: »Sie haben diesen Prozess manipuliert, Herr Rechtsanwalt. Der Staatsanwalt hatte alles, eine Anzeige, die Aussage der Tochter und der Mutter. Aber es legitimiert sich der einschlägig bekannte Rechtsanwalt Abel, und plötzlich schweigt dieses Pack. Dann folgt der Gipfel: Alles wird sogar noch widerrufen.« Hablik brüllte plötzlich so, dass sich am Ende des Flurs ein Geschäftsstellenbeamter erschrocken umdrehte, der mit Besteck und Stoffserviette in der Hand auf dem Weg in die Kantine war.
Abel fing sich und entgegnete kalt: »Nur gut, dass Sie immer alles so genau wissen, Hablik.«
»Ich verbitte mir … Das ist doch ein Früchtchen. Da weiß man doch …«
Abel lächelte. »Sonst schlägt Ihr richterliches Herz doch auch eher für die Damenwelt!«
Hablik schnaubte. »Zwei Maßregeln des Jugendgerichts wegen Betrugs. Und einmal Falschaussage. Stattliche Liste für eine Sechzehnjährige. – Und dass sie Druck auf ihren Vater ausgeübt hat, bloß weil er sie gezwungen hat, jeden Abend um neun Uhr zu Hause zu sein, was der jungen Dame nicht passt, das hat sie selbst zugegeben. – Außerdem sind das alles doch juristische Laien, Italiener, woher wissen die denn etwas von unserem Aussageverweigerungsrecht?«
»Von mir«, sagte Abel in verbindlichem Ton. »Und von Ihnen. Sie haben jeden Zeugen darauf hingewiesen, das steht so im Gesetz.«
Klar, das stand außer Zweifel. Hablik trat den Rückzug an. »Aber solche Leute kennen doch die juristischen Konsequenzen nicht!«
»Mag sein, aber sie kennen die persönlichen Konsequenzen. Sie haben durchgemacht, was in einer Familie nach so einer Anzeige abläuft, und jeder von ihnen kann sich lebhaft vorstellen, was los ist, wenn der Vater ins Gefängnis muss, statt mit Bier und Limo zu handeln.«
Abel hasste es, wenn ein Richter aggressiv wurde. Er verachtete Hablik nicht, wie viele Kollegen, besonders solche, die selbst keine Einserjuristen waren wie Hablik. Aber Abel mochte ihn nicht. Er nickte dem Richter zu und machte sich auf den Weg.
*
Abel ging in eine Cafébar in der Nachbarschaft, um einen Espresso zu trinken und die Zeitung zu lesen. Die Windböen des nahenden Gewitters verscheuchten bald die Menschen von den Tischen im Freien. Abel bändigte die raschelnde Zeitung, kippte den Espresso wie einen Schnaps, zahlte und ging knurrend Richtung Lehel, wo seine Kanzlei lag.
Auf seinem Schreibtisch häuften sich die gelben Rückruf-Notizzettel, die ihm seine Assistentin Jane Münster wie ein Kartenspiel vor dem Telefon aufzufächern pflegte. Jane war weg. Wahrscheinlich die paar Schritte nach Hause gelaufen, um dort die Fenster zu schließen, ehe der erwartete Regenguss kam.
Abel ließ sich in den Sessel fallen, faltete die Hände vor dem Gesicht und schloss die Augen.
Er war ein großer, schlanker Mann mit eleganten Bewegungen. Oft huschte ein ironisches Lächeln über sein schmales Gesicht. Und weil er sich noch nie gerne rasiert hatte, schmückten die Schatten eines Dreitagebartes Kinn und Wangen. Pfeffer und Salz, wie die Farbe seiner Haare. Graugrüne, lebhafte Augen mit einer Korona tiefer Lachfalten.
Meist trug Abel Anzüge, eine Nummer zu groß, weil er jede Einengung hasste. Wenn er mit einer Freundin oder mit Jane einkaufen ging, versuchten sie ihn zu guten Krawatten zu überreden. Er kaufte brav, zog sie aber nie zu dem Anzug an, für den sie gedacht waren. Jane verzieh ihm diese Unachtsamkeit. Die eine oder andere Freundin meckerte manchmal deswegen. Frauen, die Abel nicht so gut kannten wie Jane, glaubten, dass sie ihn ändern könnten.
Tja.
Abel mochte die Frauen so wie sie waren und seine wechselnden Frauen mochten seine Augen und seine Hände und die Art, wie er zärtlich gewisse Dinge sagen konnte.
Jean Abel zeigte im Allgemeinen ein enormes Desinteresse an Geld. Das war noch viel schlimmer als mit den Krawatten. Erstaunlich, denn er stammte aus der Kohlenkiste. Der Vater Jakob Abel war ein Deserteur der Wehrmacht gewesen. Alle, die ihn gekannt hatten, sagten, dass sein Sohn ein ganz ähnliches Lächeln hatte. Vielleicht hatte es was mit diesem Lächeln zu tun, dass Jakob im Gasthaus »Ours d’ Or« bei seiner Yvonne unterschlüpfen konnte.
Als Jean am 1. Dezember desselben Jahres geboren wurde, war das Leben nicht leicht für die Eltern in dem einsamen Flecken am Fuße der Vogesen. Ein deutscher Deserteur war in den Augen der Dörfler damals fast so schlimm wie ein Kollaborateur, selbst wenn er ein Deutscher war.
Die Familie zog in die französische Zone nach Ludwigshafen, wo es in der Industrie Arbeitsplätze geben sollte. Für Deserteure gab es nichts. In Bochum schließlich kannte keiner den geflüchteten Infanteristen Jakob Abel. Er schlug sich mit seiner Yvonne und dem Balg durch. Sie lebten in Baracken und warteten auf die Zuteilung einer Wohnung. Bis ein alter Kamerad wieder auftauchte.
In München fand Jakob Abel einen Job bei Daimler. Dort entlarvte er einen Gestapomann, der in Reims die standrechtlichen Erschießungen von zwei Résistance-Leuten befohlen hatte. Der Gestapomann wurde abgeführt und Abel kurz darauf aus betrieblichen Gründen entlassen. Als Jakob vom Hof der Firma schlich, kam der Gestapomann zurück.
Weshalb sich Jakob Abel nach Weihnachten 1949 erhängte, blieb unklar. Ein Abschiedsbrief existierte nicht. Jeder sagte, dass ein Mann, tüchtig wie er, in der jungen Republik eigentlich große Chancen gehabt hätte. Aber vielleicht war Jean Abels Vater in dieser jungen Republik nie angekommen, schlimmer noch, nirgends zu Hause. Die Mutter lebte fortan allein mit dem Sohn in einer Siedlung im Osten der Stadt und verdiente den Lebensunterhalt als Putzfrau in den Villen oben auf der Gänsheide.
Kurz bevor Abel dreißig wurde, starb seine Mutter, die schon Jahre zuvor in ihre Heimat zurückgegangen war. Jean hatte unter dem Tod der kleinen, trotz eines harten Lebens so heiteren Frau sehr gelitten.
Seine Kanzlei lag im Halbdunkel. Die Läden waren vorgeklappt und die Fenster geschlossen, um Reste der Morgenkühle zu erhalten. Doch von Morgenkühle war längst keine Spur mehr. Abel war froh, dass er saß, und ließ die Fenster wegen des Windes geschlossen. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und entfernte die Krawatte.
Er hatte einen jener Freisprüche hinunterzuwürgen, die er nicht mochte. Nicht, dass er ein Freund des Abstrafens war, Strafverteidiger sind das nie, nicht dass er glaubte, für die Familie Geali wäre es besser gewesen, wenn der Vater in den Knast gewandert wäre. Nein, Abel hasste diese Schieflage, dieses Gefühl, dass einer davongekommen ist, dem mindestens ein dicker Denkzettel gehört hätte – davongekommen mit seiner, Abels, Hilfe. Wäre er nur wirklich sicher gewesen, dass das Ganze nicht eine Inszenierung der Madonna mit den feuerroten Lippen war, ein Familienkrach um die Frage, wann eine Minderjährige zu Hause zu sein hat. Und dann musst du Idiot dich noch mit diesem Hablik anlegen, sagte er zu sich.
Endlich sah Abel die Post durch. Nachdem er drei Briefe überflogen hatte, gab er auf. Warum in drei Teufels Namen ging er nicht eine Runde Billard spielen? Oder Boule? Aber wenn es gleich anfing zu schütten …
Franco Geali … Oder hatte sie ihn halb gezogen, und war er halb gesunken? Wenn schon in der Bravo steht, wie die Hauptverhandlung ergeben hat, dass Fummeln zwischen älteren Männern und jungen Nymphchen eine Art großes sexuelles Abenteuer für mutige Mädchen sein kann. Konnte so eine Sechzehnjährige überhaupt einschätzen, was sie im Hirn und im Schwanz ihres Vaters auslöste, wenn sie Abend für Abend nackt, geschminkt und mit verwegenen Frisuren in der Wohnung herumlief, wie in der gerichtlich nicht verwertbaren, weil widerrufenen polizeilichen Aussage der Mutter zu lesen war? Muss so ein alter Bock, Vater zumal, sich nicht trotz allem beherrschen?
Draußen flackerten die ersten Blitze über den Himmel. Es roch nach Stempelfarbe und kaltem Rauch von Mandanten, die auch beim Anwalt die Zigaretten nicht in der Tasche lassen konnten. Abel stemmte sich aus dem Sessel und holte aus dem Wartezimmer einen Krimi. Dort lagen etwa fünfzig zerlesene Taschenbücher. Pro Band zwischen fünfzehn und zwanzig Kurzgeschichten. Das machte so zwischen siebenhundert und tausend Fälle erfundener Kriminalität. Abel hatte sie aus dem modernen Antiquariat in Schwabing, das einer seiner Freunde betrieb. Die Mandanten blätterten selten in den Büchern. Abel umso häufiger.
Donner rumpelte über die Stadt. Nebenan spuckte der Drucker den Rest der täglichen Schriftsatzproduktion aus. Jane würde gleich zurück sein, mit den Unterschriftenmappen kommen und von ihren Plänen fürs Wochenende reden. Vielleicht war sie auch überhaupt nicht zu Hause, sondern saß bei ihrem Angebeteten im Auto um die Ecke, solange der Drucker lief.
Abel zog sich mit dem Krimiband in einen tiefen Ledersessel zurück, den er in die Nähe einer Stehlampe rückte. Er überflog eine Dreiseitenstory, ohne sich den Inhalt zu merken. Es war nicht einfach, diesen Scheißprozess im Kopf unter Erfahrung abzulegen. Ein langer Donner wummerte, und die Scheiben klirrten leise.
Die Tür flog auf und Jane trat ein. Sie hatte ihre blonde Mähne nach hinten gebunden und blies mit vorgeschobener Unterlippe ein paar Ponysträhnen aus dem Gesicht. Jane roch auch bei brütender Hitze nach acht Stunden im Büro nicht nach Schweiß.
»Signierstunde«, sagte sie, nahm Abel den Krimi ab, legte ihm zwei Pappmappen mit Schriftverkehr auf den Schoß und drückte ihm einen Kuli mit Werbeaufschrift in die Hand. Dazu musste sie sich bücken.
»Warum trägst du an so einem heißen Tag eigentlich einen BH?«, fragte Abel nach einem kurzen Blick in ihren Ausschnitt und begann zu unterschreiben, ohne zu lesen.
»Im Büro bekommt man mit Stielaugen in den Ausschnitt geglotzt«, antwortete Jane.
»Babyjane, wenn du dich auch so runterbückst.«
Jane deutete auf einen Brief. »Das hier würde ich noch mal durchlesen.«
»Und warum einen schwarzen unter einem Sommerkleid?« Er signierte auch dieses Schreiben, ohne zu lesen. Jane hatte einen flüssigen, manchmal ganz schön bissigen Briefstil. Warum daran herumkorrigieren? Zumal, wenn es so heiß war.
»Weil alle weißen auf der Wäscheleine hängen. – Lies ihn doch noch mal vorsichtshalber.«
Abel nickte und las. Ein eindeutig formuliertes Schreiben an einen ehemaligen Mandanten, der immer noch Geld schuldete.
Abel kamen nun Bedenken: »Der kommt nie mehr wieder zu uns, wenn er diesen Brief gelesen hat.«
»Der braucht nicht noch mal zu kommen; es reicht, wenn er zahlt.«
Abels Kanzlei ging nicht so gut, dass er es sich leisten konnte, Mandanten zu vergraulen. Er grübelte.
»Komm, mach hin«, sagte Jane, »ich will noch zum Bäcker gehen, bevor die Welt untergeht.« Es blitzte, und wie zur Bestätigung folgte unmittelbar ein Donner.
»Macht ihr heute Picknick?«
Jane fragte scheinheilig: »Wer?«
»Der Neue und du?«
»Es gibt keinen Neuen.«
»So?«
»Noch nicht richtig jedenfalls.«
Abel nickte, unterschrieb die nächsten Schriftstücke, und Jane rannte hinaus, bevor der Himmel platzte.
*
Hablik saß schon seit drei Stunden in einem Caféhaus in der Nähe des Gärtnerplatzes. Das postmodern-helle Lokal führte Biobackwaren, mit Lebensmittelfarben schrill kolorierte Pralinés und eingematschten Salat aus kontrolliertem ökologischem Anbau. Die Hitze des Tages hing im Raum, obwohl die Fenster geöffnet waren und draußen die letzten Reste des heftigen Sommergewitters herunterplatschten. Feuerwehrsirenen hallten noch immer durch München. In den Gullys gurgelte braunes Wasser.
Hablik sah sich verstohlen um. Das Lokal wurde überwiegend von jungen Leuten, meist Studenten, besucht. Kaum einer der Gäste trank Alkohol, nur das Mädchen in pechschwarzem Top und Minirock in der Ecke süffelte an einem Sektorange, rauchte und hustete und las. Hablik, nicht so jung wie die anderen Gäste, hatte in den drei Stunden seiner Anwesenheit, während das Gewitter sich draußen austobte, sechs Fläschchen Pils und sechs Asbach getrunken. Er war ein wenig in dem kunstlederbespannten Caféhaussessel zusammengesunken, faltete die Hände über dem Bauch und legte den Kopf schräg.
Er schaute verstohlen hinüber auf die Knie des lesenden Minirockmädchens. Ihre Beine waren schlank und überzogen von schwarzem Nylon, was Hablik wegen der Hitze ziemlich unappetitlich fand, aber doch so interessant, dass er immer wieder hinübersah. Das Mädchen war allein. Die Blicke der beiden trafen sich. Hablik sah weg, dann wieder vorsichtig hin. Er befürchtete, sein Blick könnte noch einmal den des Mädchens streifen, wenn es beim Umblättern aufsah. Weil der Mann sie irritierte, würde sie den Saum ihres Rocks runter zu zerren versuchen und die Knie zusammendrücken.
Hablik sah nicht so aus, wie man in diesem Lokal üblicherweise aussah, weil er wie immer sein Cordjackett trug, sandbraun oder oliv, inzwischen schwer zu sagen. Auch die Hitze konnte ihn nicht dazu bringen, es auszuziehen. Wegen der Sitzung heute Mittag hatte er noch den weißen Langbinder um, der sich jetzt unordentlich vom geöffneten Kragen zu den gefalteten Händen hinunterschlängelte.
Die Bedienung vermied den Blickkontakt zu dem Gast, der alle vier oder fünf Monate hereinkam, um sich mit billigem Weinbrand und Pils volllaufen zu lassen. So weit wäre das auch in Ordnung, dachte die junge Frau. Bloß die Blicke des Gastes gefielen ihr nicht. Immer wenn er etwas wollte, rief er sie zu sich, murmelte die Bestellung und sah verstohlen auf ihren Busen, so von unten her, unheimlich wäre zu viel gesagt, aber doch komisch. Anders als die meisten Männer.
Aus dem Augenwinkel sah sie, wie der Mann den Rest Bier austrank und das Glas wieder ganz vorsichtig auf den kleinen Marmortisch setzte. Er winkte ihr zu. Sie schaute kurz nach oben und folgte. »Zahlen«, murmelte Hablik, er räusperte sich und sagte noch einmal lauter: »Zahlen.«
Die Serviererin hörte das gerne, weil sie sich freute, den Kerl loszuwerden. Sie rechnete an der Kasse zusammen und legte den Zettel vor dem Typ auf den Tisch, um nicht seine Hand berühren zu müssen, wenn er nach dem Stück Papier greifen würde. Hablik drehte mit seinen langen schmalen Fingern das Zettelchen zurecht, las, nickte, kramte aus seiner Geldbörse einen Schein und legte ihn auf den Tisch. Er strich ihn glatt, und als die Serviererin schnell in ihrem Beutel nach Kleingeld wühlte, räusperte er sich wieder und sagte: »Gut so.«
Das waren fast fünf Euro Trinkgeld. Weil sie Hablik für einen Geschäftsmann hielt, fragte sie freundlich, ob es ein Steuerbeleg sein sollte.
»Nein, nein«, sagte er, winkte ab und stand auf.
Er hatte breite Schultern, war groß, schlank und trotzdem ein Bär von Mann. Der Blick der Serviererin streifte noch einmal das Gesicht: kindlich und glatt, fast ohne Bartwuchs. In den Augenwinkeln saßen Fältchen. Mit einer hilflosen Geste strich sich Hablik die blonden Haare seiner Collegeboyfrisur zurecht. Er tat einen ersten Schritt, stieß an einen Stuhl und schwankte fast unmerklich. Sein Sommersprossengesicht wirkte verdutzt. Er lächelte und wurde wieder ernst. Die Biere und die Asbachs! Er ging vorsichtig zum Ausgang, öffnete die Tür, trat hinaus und warf sie unabsichtlich ins Schloss. Im Caféhaus verstummten für einen Augenblick die Gespräche.
Draußen war die Luft kühl und feucht. Gott sei Dank, es regnete nicht mehr. Auf den Autos standen glänzende Wasserperlen. Der Himmel war anthrazitfarben, angestrahlt von den Lichtern der Stadt. Aus einer Tiefgarage um die Ecke rollte ein weißer Ford mit breiten Reifen. Musik dröhnte aus offenen Scheiben. Hablik lehnte sich durchatmend an die Mauer und starrte dem Fahrzeug hinterher. Er schüttelte missbilligend den Kopf, ordnete wieder die Haare, stieß sich schließlich von der Häuserwand ab und machte sich daran, sein Auto zu suchen, das er ein paar Blocks weiter im Halteverbot stehen hatte.
Die abgekühlte Nachtluft bekam seinem Kopf ganz gut. Hablik gewann an Standfestigkeit, wurde wacher, sicherer, sodass er, falls sie ihn beim Autofahren schnappen sollten, eine gute Chance hatte, ohne Probleme durchzukommen, weil er einen Richterausweis vorzeigen konnte.
Da fiel ihm diese junge Frau ins Auge, die kurz vorher um die Ecke am Gärtnerplatz gebogen war. Hablik glaubte, dass sie vielleicht zu dem verrückten Ford-Fahrer gehörte, der gerade davongerast war. Er stellte sich ein kleines nächtliches Liebesdrama vor, mit Ohrfeigen und Tränen nach einem Geschlechtsverkehr im Auto, irgendwo bei Gewitter. Und dann, eine junge Frau nachts allein auf der Straße! Hablik blieb stehen und beobachtete sie.
Sie tastete sich ganz dicht an den Mauern und Schaufenstern entlang, unsicher und mit langsamen Schritten, ähnlich wie Hablik eben noch aus dem Lokal getappt war. Die hat aber einen sitzen, stellte Hablik plötzlich fest und grinste voller Kameraderie, Mitgefühl und auch Spott. Er konnte sich nicht von ihrem Anblick losreißen.
Die junge Frau setzte einen Fuß vor den anderen, abwägend, unsicher. Damit erreichte sie den Lichtkreis der Auslage eines Einrichtungsgeschäftes, ganz nahe der Stelle, wo Hablik in einem Hauseingang wartete. Ihr Gesicht wirkte erschöpft, doch die Müdigkeit entstellte es nicht. Ihre ebenmäßigen Züge und die kleine Nase mit einem winzigen Kick nach oben gefielen ihm. Die blonden Haare trug sie als Pagenschnitt mit Pony, der freilich ein wenig in Unordnung war. Hohe Stirn, hohe Backenknochen und ein kleines Grübchen im Kinn.
Nun war sie nur noch wenige Meter von Hablik entfernt. Sie schien ihn nicht wahrzunehmen.
Hablik trat aus seinem Versteck, tat, als schließe er eine Tür hinter sich, und versperrte ihr den Weg. Sie blieb stehen. Sie hätte sich von der Schaufensterscheibe lösen können und einen Bogen um ihn machen. Hablik wäre ihr nicht nachgegangen. Er schaute sie nur an. Die Blonde verharrte regungslos. Sie sah ihm nun ins Gesicht. Völlig ohne Ausdruck, ohne Neugier. Hablik neigte den Kopf, bückte sich ein wenig, weil er sie um eine Haupteslänge überragte. Er wollte etwas sagen und schluckte. Er traute sich nicht, alle Formulierungen, die sein Kopf in rasender Eile ausspuckte, schienen nur platt und unpassend.
Er trat zurück in den Hauseingang und gab ihr den Weg frei. Hablik sah weg. Wartete mit unsicherer Spannung, bis die Gestalt an ihm vorbeischweben würde.
Nichts schwebte. Sie blieb, wo sie war. Sie sah ihn auch nicht mehr an. Sie stand ganz einfach nur zwischen Hablik und der Hausmauer und blickte geradeaus, wie eine Laufpuppe, die man gestoppt hat. Du musst was sagen, sag irgendwas. Ein Wörterkarussell jagte in seinem Kopf herum. Hablik schluckte. Räusperte sich.
»Blue Eyes«, sagte er.
Ihre Mundwinkel bewegten sich, vielleicht war es so etwas wie ein Lächeln.
»Die sind doch grau«, sagte sie.
*
Rechtsanwalt Jean Abel saß in dem Liegestuhl, den er vor dem Gewitter vom Garten in den Teil seiner Gemächer getragen hatte, den er als Küche bezeichnete.
Abel trennte nicht so scharf wie andere zwischen Büro und Wohnung. Die Kanzlei war in einer ehemaligen Papierhandlung untergebracht, die früher zur Straße hin zwei große Schaufenster gehabt hatte. In der Rezession der 70er waren Ladenlokale billig geworden wie nie zuvor. Nach Jahren hatte sich der Hauswirt dazu herabgelassen, die ehemalige Auslage auf Fensterformat zu verkleinern und die Leuchtschrift an der Fassade abzunehmen, weil Abel einen Zehnjahresvertrag unterschrieb und im Großen und Ganzen die Miete pünktlich bezahlte.
Zwei Büroräume, möbliert wie Wohnzimmer, eines für Jane, eines für Abel, und ein kleines Wartezimmer lagen zur Straße raus und waren über drei Stufen zu erreichen.
Durch Janes Büro kam man in das ehemalige Lager, einen loftartigen Raum von mehr als hundert Quadratmetern, der Abel als Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer diente. Noch vor der Papierhandlung war in diesem flachen Anbau eine Schreinerei. Die Wand zum Hinterhof bestand fast nur aus Glas. Herrlich im Sommer, zugig im Winter. Ein verhältnismäßig luxuriöses Bad hatte Abel vor Jahren auf eigene Kosten in einer Art Wintergarten angebaut.
Hinter dem Haus erstreckte sich eine winzige, für Münchener Verhältnisse ungepflegte Grünzone. Sie sah aus wie ein verwilderter Schrebergarten mit geschossenen Bäumen und Sträuchern, die von Häusern mit Backsteinfassaden umgeben war. Die Hauseigentümer konnten sich auf eine in ihrem Sinne vernünftige Nutzung des kleinen und selbst in Sommer schattigen Areals nicht einigen, was den Kindern, Igeln, Spechten, Katzen, Kötern und Jean Abel recht war.
Die Hausbesitzer hatten jahrelang um den »Schandfleck« prozessiert und schließlich die Lust daran verloren. Dass Abel, der eine ältliche Erbin in dem Gefecht anwaltlich vertreten hatte, an dem Stillstand der Sanierungsbemühungen eine erhebliche Teilschuld trug, wurde behauptet, konnte aber nicht bewiesen werden. Es kursierten auch Gerüchte, dass Abel gegen die Pläne einer anthroposophischen Nachbarin mit bündnisgrünem Parteibuch Wühlarbeit leistete, weil sie ein Feuchtbiotop anlegen und die Wildnis biologisch-dynamisch ordnen wollte. Abel mochte keine Schnaken im Sommer und sowieso keine Ordnung im Hinterhof.
Die Bündnisgrüne giftete hinter dem Rücken des Anwalts herum, dass er nur seinen verdammten Köter überall hinscheißen lassen wolle, weil er zu faul sei, ihn richtig mit Schippchen und Plastikbeutel in der Hand auszuführen. Das war korrekt beobachtet, aber nicht der einzige Grund, weshalb Abel gegen die Sanierungspläne war. Wenn die Anthroposophin Abel traf, grüßte sie freundlich, denn sie wollte für den Stadtrat kandidieren und hielt Abel fälschlicherweise für einen potentiellen Grünenwähler. Abel stimmte aber aus Sentimentalität grundsätzlich für trotzkistische Kommunisten, wenn sie denn antraten. Wenn keine Trotzkisten kandidierten, wählte Abel die Sozis, falls er überhaupt zur Wahl ging.
Abel saß in seinem Liegestuhl, hatte die Fenster offenstehen, sodass der Regenduft hereindringen konnte, und starrte hinaus in die grüngraue Dämmerung. Der Hund lag neben ihm wie abgeschossen und schnarchte leise. Sein Name war Paul Schmitz, weil Abel alle seine Hunde der Einfachheit halber so nannte. Dieser hier war Paul Schmitz der Vierte.
Überall im Hinterhofgrün triefte und glitzerte es nass. Abel genoss die Stimmung und blätterte nach der Lektüre zweier Krimikurzgeschichten in Akten und Post herum, die er in den letzten beiden Tagen hatte liegenlassen. So viel Zeit musste sein. Ladungen, eine Mandatszuweisung als Pflichtverteidiger, versuchte Brandstiftung; die Mahnung des Finanzamtes München-Körperschaften, die Mehrwertsteuererklärung abzugeben, die er bereits vor Tagen eingeworfen hatte; der Brief eines angeblichen Justizopfers aus der Justizvollzugsanstalt in Stadelheim mit Schmeicheleien und der Bitte, der »beherzte Strafverteidiger« Abel möge sich bei der Vollstreckungskammer oder dem Bundesverfassungsgericht für die Rehabilitation des Verfassers einsetzen. Abel erhielt oft solche Briefe und hatte gelernt, sich diesen Fällen immer vorsichtiger zu nähern.
»Blöd, nichts Erfreuliches«, sagte Abel zu seinem Hund. Als ob die Kanzleipost je etwas Erfreuliches enthalten hätte. Seine Privatpost übrigens auch nie. Abel schrieb sowieso weder Briefe noch Postkarten, also konnte er nicht erwarten, dass er auf schriftlichem Wege erfreuliche Antworten bekam. Der Hund wachte auf und sah seinen Herrn aufmerksam an.
Kühl fächelte die Abendluft herein. Urplötzlich schwebte eine Arie durch das Haus. Ein Tenor ließ die Stimmbänder schwingen. Abel versuchte das Geräusch zu ignorieren und studierte mit skeptischem Gesicht eine Verfügung des Landgerichtspräsidenten. Dabei kraulte er seinen Hund hinter dem Ohr. Der streckte sich und gähnte. Gleich darauf drehte der Hund den Kopf und leckte seinem Herrn die Hand.
»Pfui«, sagte Abel. Der Hund hörte nicht auf zu lecken. Abel zog die Hand weg und nahm die Landgerichtspräsidentenverfügung, um sie gegen das Licht zu halten. Sollte sich jemand einen Scherz erlaubt haben? Ihm eine Referendarin zur Ausbildung zuzuweisen! Abel hatte noch nie Referendare ausgebildet. Die Referendarausbildung beim Anwalt war nämlich ein schlechter Witz. Und Abel hatte sich immer schon geweigert, bei schlechten Witzen mitzuwirken. Jedenfalls im beruflichen Bereich.
Die jungen Kollegen kamen, um sich vorzustellen, stahlen einem die Zeit, nahmen ein, zwei Akten mit, die sie nicht rechtzeitig zurückbrachten, hatten keine Ahnung, standen nur im Weg herum, bestanden aber auf guten Zeugnissen. Der Grund für das Verhalten des Nachwuchses lag darin, dass die Väter der Juristischen Prüfungsordnung die Ausbildungsetappe beim Anwalt genau in die Monate vor dem Zweiten Staatsexamen gelegt hatten, in denen der zukünftige Volljurist von morgens bis abends paukt und nicht das geringste Interesse daran hat, beim Anwalt etwas zu lernen.
Auch bei Licht besehen erwies sich die Verfügung des Präsidenten nicht als Scherz. Stempel und Unterschrift schienen echt zu sein. Und an einen qualifizierten Fall von Urkundenfälschung, nur um ihn zum Narren zu halten, glaubte Abel nicht.
»Referendarin Georgina C. Porcius«, las er seinem Hund vor, der sich nicht beeindruckt zeigte. Uncharmanter Weise hatte man auch noch das Geburtsdatum der Referendarin mitgeteilt, sodass sich Abel ausrechnen konnte, dass Frau Porcius zarte vierundzwanzig Jahre alt war. Schmitz schniefte und nieste.
»Weißt du, was wir immer gesagt haben?«, fragte er Schmitz und gab gleich die Antwort: »Studentin des Rechts, neutralen Geschlechts«, Abel grinste bei der Vorstellung, wie ein wissensdurstiges, mageres Wesen, pickelig, Brille, vierundzwanzig, sehr ernst und sehr tugendhaft und ziemlich erfüllt von dem Wunsch nach Gerechtigkeit, mit hochgezogenen Augenbrauen versuchen würde, sich in seinem Laden zurechtzufinden. Und wie Jane auf weibliche Konkurrenz in der Kanzlei reagieren würde?
»Na, so weit kommt’s noch, das werden wir abbiegen.« Abel legte die Verfügung und die beiden Mahnungen zur Seite und streichelte seinen Hund.
*
»Sie haben so schöne Lippen«, sagte Hablik und stützte sich mit ausgestrecktem Arm an die Mauer, das schien ihm lässig genug, sein leises Schwanken aber nahm seiner Haltung die beabsichtigte Schwerelosigkeit.
Die Lippen der jungen Frau hatten einen feinen Schwung, doch als das Lächeln erlosch, zeigten die Mundwinkel traurig nach unten. Warum hört sie auf zu lächeln, fragte sich Hablik.
»Sie sehen aber auch sonst gut aus«, fügte er hinzu.
Sein Gegenüber reagierte nicht. Die junge Frau verharrte und betastete mit den Fingerspitzen den rohen Putz der Mauer neben sich, als wollte sie sich vergewissern, dass sie noch am selben Ort war. Hablik hüstelte, sein Bubengesicht strahlte plötzlich.
»Und jetzt?«
Doch sie blieb stumm und sah auf seine Schuhspitzen. Hablik schluckte, sein Kehlkopf hüpfte. Umdrehen und weggehen? Was denkt sie dann?
»Grey eyes.«
So was muss eine Frau doch mögen, hämmerte er sich ein. Kein Schmus, nur schlicht ansprechen, wo bei einem Menschen der Reiz liegt. War da eine Bewegung, ein etwas wacher wirkender Blick …? Hablik stand plötzlich für einen Augenblick neben sich und beobachtete, wie der andere Hablik die Schöne ganz einfach unterhakte und sie mit erstaunlich sanfter Hand die wenigen Schritte zurückführte, die er gerade vom Caféhaus gekommen war.
»Trinken wir noch ein Viertele«, brummte er. Hablik hatte einen deutlichen schwäbischen Akzent. Normalerweise klingt dieser Akzent gemütlich und ganz harmlos. Als wäre es für Hablik etwas völlig Normales, dass er mit einer unbekannten schönen Frau ein Viertele trinken ging. Er stieß die Tür so weit auf, dass er und seine Begleiterin hindurchpassten. Wieder flog die Tür hinter ihm knallend ins Schloss. Ein paar Besucher schauten erschrocken hoch, und die Kellnerin war verdutzt, fragte sich, wo dieser Typ innerhalb von vier oder fünf Minuten dieses elegante Geschöpf in seinem Arm aufgegabelt hatte.
Sie musterte die Kleidung der Frau. Teuer, geschmacklich alles aufeinander abgestimmt. Sehr streng, so, wie höhere Töchter gekleidet waren. Ein schwarzweiß kariertes Leinenjackett. Eine schlichte weite Bluse mit langem spitzem Kragen. Alle Knöpfe geschlossen. Der Rock aus schwarzer Naturseide war lang und faltenreich, er berührte fast die Knöchel. Schwarze Strümpfe, dazu zierliche schwarze Lackschuhe mit einer Schleife an der Seite.
Neugier und natürlich auch das gute Trinkgeld von vorhin ließen die Serviererin schnell nähertreten.
»Champagner, zwei Glas«, bestellte Hablik und würdigte der Bluse der Bedienung keines Blickes. Er grinste seine Begleiterin an und fügte hinzu: »Zwei Glas Schampus gibt ein Viertele.«
Champagner statt Pils und Asbach, so sind wir jetzt drauf, dachte die Bedienung und notierte die Bestellung. Da läuft vielleicht heute Nacht noch was. Sie musterte noch einmal ziemlich unverhohlen die junge Frau, die regungslos vor sich hin starrend aufrecht dasaß, als habe sie gerade mit ihrem Begleiter eine Auseinandersetzung gehabt. Die Kellnerin entdeckte Blutstropfen auf dem gestärkten weißen Blusenstoff.
Mit einer herrischen Handbewegung scheuchte Hablik die Kellnerin weg und dreht sich der Fremden zu. Er versuchte ihr wieder in die Augen zu sehen, was nicht gelang. Dann wollte er wissen, wo sie herkam und was sie so spät auf der Straße allein machte.
»Ich weiß nicht.« Sie hatte eine seltsam dunkle Stimme.
»Also, man weiß doch, was man macht und wo man herkommt.« Hablik lächelte. »Normalerweise jedenfalls«, setzte er hinzu.
Schweigen.
Ob es ihr lästig war, wenn er Fragen stellte?
Die Getränke wurden gebracht. Hablik nahm ein Glas, reichte ihr das andere und stieß an. Dabei glaubte er nicht, dass die schöne Fremde überhaupt etwas trinken würde. Sie wirkte so unnahbar. Doch, sie hob das Glas, genauso wie Hablik, und während dieser nur nippte und sich über den Mund schleckte, anschließend die Backen aufblies und mit den Schneidezähnen die Unterlippe hochzog, nahm sie zwei kräftige Schlucke, ließ die prickelnde Flüssigkeit im Mund kreisen und schmeckte, bevor sie sie hinunterrinnen ließ. Hablik lachte und lehnte sich zurück. Burschikos tätschelte er ihre rechte Schulter. Sie reagierte nicht auf diese Vertraulichkeit.
Er nahm einen Schluck, ließ seinen Blick durch das Lokal schweifen und stellte fest, dass ihn offenbar keiner mehr genauer musterte. Gut so; er wusste, warum er, wenn er seinen Rappel kriegte und nachts raus musste, um einen Zug durch die Gemeinde zu machen, sich Lokale aussuchte, wo man keinen Kollegen begegnete.
In der Magengrube wurde es warm, und sein in der kühlen Nachtluft fast verflogener Rausch kam zurück. Auf einmal lächelte er breit. »He, ich hab’ noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Ich bin vielleicht ein Typ.«
Erst nach einigen Sekunden sprach sie fast flüsternd: »Ich weiß nicht.« Es klang ängstlich. Jetzt sah sie Hablik an. Hatte diese Frau schöne Augen! Er hielt den Blick nicht aus, verlegen drehte er den Kopf, gleich darauf schaute er ihr wieder ins Gesicht, doch nun wich sie ihm aus.
»Ich heiße Eduard Hablik und bin Richter.« Jetzt kicherte er. »Eigentlich sollte man eine fremde junge Frau nicht duzen, aber wenn wir schon dabei sind, mir soll’s recht sein. Meinen richtigen Vornamen kann ich nicht leiden, weil jeder früher Eddy oder Ede gesagt hat. Seit ich zwölf bin, bin ich der Sonny, wie Sonny Liston. Den habe ich bewundert. Sonny Liston – kennst du den? Ein Boxer! Ich hab’ nämlich auch mal geboxt.« Habliks schmale linke Hand bildete eine Faust.
Er bekam nicht heraus, ob sie ihm zugehört hatte. Deshalb nahm er sie am Kinn, drehte ihren Kopf langsam zu sich her. Er betrachtete sie. Auch das ließ sie geschehen, ohne jeden Widerstand. Ihr Blick traf ihn. Sie war ungeschminkt.
Sein Sommersprossengesicht zeigte Verlegenheit, er nagte an den Lippen. Augenblicke später griff er schnell wieder zu seinem Glas, lachte zu laut und trank aus.
Weil nun beide Gläser leer waren und Hablik immer noch nicht wusste, wie seine Begleiterin mit dem ernsten Gesicht und der ein wenig zerzausten Ponyfrisur hieß und sie auf nichts reagierte, beschloss er zu zahlen und zu gehen. Er winkte der Kellnerin, die sofort kam und gleich den Preis für zweimal Champagner sagte: vierzehn Euro. Diesmal gab es nur ein Euro Trinkgeld. Hablik verstaute umständlich seinen Geldbeutel, half der jungen Frau von der Bank hoch, nahm sie am Arm und ging mit ihr steif, fast würdevoll, zwischen den Stühlen und Tischen des Lokals hindurch zur Tür.
*
Abel spielte in der Stadt eine Runde Poolbillard gegen sich selbst. Er war gerade dabei, das Tuch leerzuräumen. Endlich klappte was an diesem Scheißtag.
Aber sein milder Seelenzustand hielt nicht lange. Als er in die Knie ging, das Queue wie ein Speer in der Linken, um knapp über die Tischkante zu peilen, ob er es schaffen würde, mit der weißen die rote Kugel an der schwarzen vorbei direkt ins linke hintere Eck zu bugsieren oder Bande zu spielen, was bei der aufliegenden Konstellation ein echtes Problem darstellte, schweifte sein Blick ab. Hablik! Ist das zu fassen, fuhr es ihm durch den Kopf. Noch nicht mal spätabends kann man … Abel fand, dass der Richter wie ein Statist aus Pulp Fiction aussah, wie er so schräg am Tresen hängend mit einer – zumindest auf die Distanz und bei der vorherrschenden Beleuchtung – sehr ansehnlichen Frau anstieß.
Sarah, die junge Aushilfe des Bistros, stellte ein Sektglas direkt vor Abel aufs grüne Tuch. »Für dich, Elsässer, von dem Typ«, sagte sie und deutete in Habliks Richtung.
»Nimm es wieder mit«, knurrte Abel.
Aus den Augenwinkeln sah er Hablik grinsen und herüberprosten. Abel erschien die Geste des Mannes überheblich und unsicher zugleich. Er versuchte, sich auf die Kugeln zu konzentrieren. Hablik sprach nun offensichtlich mit der Frau über ihn.
»Das ist Champagner.«
»Trotzdem. Sag dem Typ, er soll’s selber saufen.«
»Isn das fürn Heini?«, fragte Sarah.
»Ein besonderes Exemplar von uns Justizneurotikern«, sagte Abel und lächelte Sarah ins Gesicht. »Sieh dich vor, er hat Glück bei Frauen.«
Sarah seufzte. Das Champagnerglas verschwand, und Abel lehnte sich weit vor, um den Stoß anzusetzen. Die Kugeln klackerten. Wieder eine eingelocht. Jetzt nur noch die schwarze. Die musste immer links hinten rein, wenn Abel mit sich selber spielte. Er traf. Die Kugel trudelte. Bande. Und schließlich fiel sie doch noch ins richtige Loch. Das Spiel war zu Ende. Abel hatte gegen sich selbst gewonnen. Er stellte das Queue weg und ging. Zu zahlen brauchte er nicht, weil der Wirt anschrieb und ihm monatlich die Rechnung vom Konto abbuchte.
Hablik kommentierte den zurückgewiesenen Champagner nicht weiter und bestellte noch eine Runde. Nichts an seinem Verhalten deutete auf einen Neurotiker hin, fand Sarah. Er steckte die Zurückweisung emotionslos weg und kümmerte sich sehr liebevoll um die Frau, die scheinbar Kummer hatte. Er redete begütigend auf sie ein, prostete ihr zu und nahm sie von Zeit zu Zeit in den Arm. Das sollte Sarah mal passieren.
*
Kaum war Hablik mit dieser merkwürdigen Frau wieder draußen in der kühlen Nachtluft, schon blieb er stehen und drückte sie an sich. Er spürte ihre Brüste, und es gefiel ihm, dass diese Frau einen großen Busen hatte. Auch bei weiblichen Angeklagten gefiel ihm das sehr. Frauen mit stattlichem Busen kamen bei ihm immer ein ganz klein wenig besser im Strafmaß davon. Hablik wusste um seine kleine Schwäche, und er gab ihr gerne nach – wenn er sicher sein konnte, dass niemand wegen dieser heimlichen Begünstigung Verdacht schöpfte.
Hablik hielt die junge Frau fest, und er genoss ihren Körper und ihren Atem auf seinem Hemd. Langsam, ganz langsam ließ sie die Stirn auf seine Brust sinken. Da stand er nun, ratlos und glücklich zugleich.
Als sie endlich den Kopf wieder von seiner Brust hob, war er enttäuscht und zog sie wie beschwörend noch fester an sich. Nun war ihr Blick klarer, wirkte prüfend, abschätzend. Hablik nahm seinen ganzen Mut zusammen. Die Luft anhaltend, berührte er mit seinen Lippen die ihren, die sich nun bereitwillig öffneten. Nicht nur das, sie legte die Hand in seinen Nacken und zog ihn zu sich. Hablik fühlte ihre Zunge, die warme Feuchtigkeit ihres Mundes; er roch ihren Atem und war wie betäubt.
Sie ließ den Kuss langsam zu Ende gehen. Hablik war ernst, wie nach der Erledigung einer wichtigen Aufgabe. Er streichelte mit der linken Hand ihre Haare und spürte etwas an ihrem Hinterkopf. Eine Beule oder eine Geschwulst? Die Fremde zuckte zusammen, und er nahm die Finger sofort von der Stelle.
Wie wäre es, wenn dieses bezaubernde Wesen bei ihm bleiben würde? Wenigstens für diese Nacht. Vielleicht sogar länger? Was würden die Kollegen – und vor allem die Kolleginnen – sagen, wenn Hablik mit so einer Frau erschiene? Neid schien ihm aus der Zurückweisung des Champagners durch Abel zu sprechen. Neid muss man sich hart erarbeiten. Hablik grinste innerlich. Er und dieses Zaubergeschöpf zum Beispiel beim traditionellen Bierabend der Richter und Staatsanwälte im Sommer? Oder gar beim Juristenball im März? – Oder war diese Frau in Wirklichkeit ganz anders, als Hablik sie im Augenblick sah? Nicht so faszinierend, so zerbrechlich-schön. Wie war sie menschlich gesehen? Warum ließ sie sich von einem fremden Mann einfach auf den Mund küssen? Aus der Gerichtspraxis kannte Hablik die haarsträubendsten Geschichten von Frauen, die nachts alleine in der Stadt umherwanderten und bereitwillig mit unbekannten Männern gingen und sich sofort küssen ließen.
Die Schöne löste sich von ihm, trat einen Schritt zurück und musterte ihn von Kopf bis Fuß. Hablik, plötzlich um die körperliche Nähe gebracht, reagierte nervös.
Er musste sich räuspern und schluckte. Schließlich sagte er trotz der Zweifel, die ihn befallen hatten:
»Komm mit zu mir. Wenn du willst, dann kriegst du ein eigenes Bett. Ich hab’ noch eins, bestimmt, ich versprech’, dass ich brav bin.«
*
Abel hatte sich wieder nach Hause in den Liegestuhl zurückgezogen und ein kleines Glas Kaviar aus dem Kühlschrank geholt. Dazu Knäckebrot mit frischer Butter und einen leichten Weißen. Abel las weitere Kurzgeschichten. Er mochte Shortstorys mehr als Romane. Nicht weil sie kürzer waren, sondern weil sie selten gut ausgingen. Das schien ihm realistischer.
Paul Schmitz schoss plötzlich hoch. Aufgeregtes Freudengebell. Abel zuckte zusammen und rief: »Schmitz, kusch.« Der Hund schwieg.
Eine ältliche Stimme flötete: »Da, mein Lieber, gell, das schmeckt!« Der Hund schmatzte. Knochenknacken drang an Abels Ohr.
Ohne sich umzudrehen brummte Abel: »Fräulein Gautinger, der Hund hat schon gefressen. Er wird sowieso viel zu fett.«
»Ja, so ist’s brav«, sagte die Stimme.
Eine kleine, faltige Hand legte sich auf die Armlehne des Liegestuhls. Schmitz verschwand wedelnd und mit mahlenden Kiefern im dunklen Raum. Abel blickte hoch und sah in das freundlich lächelnde Gesicht einer alten Dame, auf deren Nase eine schmale Lesebrille mit goldener Fassung saß. Fräulein Gautinger.
Sie bestand auf der Anrede »Fräulein«. Zu ihrer Zeit hatte das etwas ausgesagt. Sie wohnte seit einem halben Jahr über dem Anwalt und hatte sich wenige Stunden nach dem Einzug in Abels Köter verliebt. Schmitz hatte den Kopf eines Bernhardiners und das Fell eines Setters, war fünf Jahre und tatsächlich etwas zu fett. Aber nicht viel. Abel hätte das in den Griff bekommen. Wenn in letzter Zeit Fräulein Gautinger nicht gewesen wäre. Sie ging regelmäßig zum Metzger und kaufte für das Tier ein. Schmitz war bestechlich. Da war nichts zu machen. Einen Hund in seinem Alter ändert niemand mehr.
Die Gautinger schlurfte jetzt hinüber zum Tisch und schnickte mit dem Zeigefinger die Kaviarbüchse an, sodass sie an eine von Abels gebrauchten Espressotassen klapperte. »Kaviar ist schlecht für den Cholesterinwert, Herr Rechtsanwalt«, krächzte sie, »Sie müssen auf sich aufpassen. Mein seliger Herr Bruder hat auch Kaviar gemocht. Das hat er davon gehabt: Er ist nur vierundsechzig geworden.«
»Schöne Leistung, mancher schafft noch nicht mal das«, knurrte Abel.
»Männer sind wie das liebe Vieh. Keine Beherrschung«, fuhr Fräulein Gautinger fort. »Wissen Sie, wie viele meiner Gedichte ich Männern gewidmet habe?«, fragte sie und beugte sich weit hinunter, um Abel mit ihren verwaschenen braunen Augen anzustarren. »Zweiunddreißig!« Sie ließ diese Zahl auf ihren Gesprächspartner wirken.
»Und? Lassen Sie mich raten! Alles für die Katz?«
Das Fräulein Gautinger verzog voller Verachtung den Mund. Sie war Poetin aus Leidenschaft und außerdem die von den Enkeln ausbezahlte Mitinhaberin eines Bettengeschäfts in der Innenstadt von Dachau. Ihr Lebtag hatte sie versucht, ihre Verse unter die Leute zu bringen. Abel hatte im Hof gerüchteweise gehört, sie habe mit ihrer Kunst zwei engagierte Kleinverlage ruiniert. In Wirklichkeit war die Dichterin, obwohl ihr der große Durchbruch bisher versagt geblieben war, mit ihrer Kurzprosa in zwei Schulbüchern vertreten; sie hatte auch drei kleine Literaturpreise bekommen, zahlreiche Lesungen absolviert, in den USA an einem College gelehrt und war Mitglied in Förderkreisen und im Schriftstellerverband.
Sie redete gern über ihr Schaffen, wie Dichter im Allgemeinen es lieben, über ihr Werk und ihr Schaffen zu sprechen. Wenn die alte Dame nur nicht immer den Hund bestechen würde. »Stellen Sie sich vor, ich habe mich heute Mittag noch etwas anderes gefragt. Wissen Sie was? Ich habe mich gefragt, warum ich noch nie ein Gedicht über Hunde geschrieben habe.«
»Wollen Sie ’n Schnaps?«, fragte Abel. Er wusste, dass die Gautinger Schnaps verabscheute. Wenn schon Alkohol, dann trank sie gerne mal ’nen Roten. In letzter Zeit nicht nur aus Burgund und Bordeaux, sondern auch aus dem Friaul, seit sie dort für eine Dichterlesung – finanziert aus Mitteln der EU – eine Woche in einem Castello verbracht hatte.
»Hä?«
»Schnaps?« Abel machte die Geste des Hinunterkippens.
»Sie wollen kein wirklich kultiviertes Gespräch führen, nicht wahr? So was nennt sich Akademiker! Aber ich lasse mich von Ihnen nicht täuschen. In Wirklichkeit, tief in der Seele drinnen, da sind Sie ganz anders«, grummelte die Alte. »Wissen Sie, was ich neulich bei Pablo Neruda gelesen habe? Ich bin sozusagen auf Pablos Spuren gewandelt, als ich in der Nähe von Prag …«
Abel war in die Küche gegangen, hatte ein Glas geholt und Roten eingeschenkt, den er ihr wortlos in die Hand drückte. Sie nippte und nickte. Abels Weine waren immer gut. Das Fräulein erzählte die Geschichte von Pablo und Prag zu Ende. Abel hörte ihr zu. Sie trank das Glas aus und hielt es ihm auffordernd hin. »Aber jetzt muss ich lesen«, sagte Abel und hob den Krimi hoch.
»Krimi.« Fräulein Gautinger tätschelte seinen Arm, murmelte etwas von ihren Vorlieben auf diesem Sektor, besonders für Geschichten mit Frauenmördern, lächelte dem Hund zu und schlurfte mit ihrer Metzgertüte voller Gurgeln, Knochen und Pansen hinaus in den Garten, begleitet von den sehnsuchtsvollen Blicken von Schmitz, den Abel am Halsband festhielt. Wenig später schwebte schon wieder von oben eine Arie durch das Haus. Belcanto. Eine schöne Stimme zwar, aber Abel kam sich vor wie in der Pizzeria Bellissimo am Sankt Anna Platz, wo er gelegentlich verkehrte.
Er beschloss autistisch zu werden, holte seinen iPod heraus und wählte ein Musikstück aus, in dem John Coltrane mit McCoy Tyner und Jimmy Garrison zu hören war.
*
»Stella«, sagte die Schöne. »Ich heiße Stella.«
Sie saß auf der Kante der breiten, hellbraunen Couch, die in Habliks Einzimmerapartment auch als Nachtlager diente. Sie sah nun wirklich wacher aus, ihre Augen verrieten plötzlich so etwas wie Energie. Oh, wie sie Betäubungen hasste, diese Vernebelungen des Bewusstseins, das Sich-nicht-selbst-finden-können. Schwer, nicht gefesselt und dennoch bewegungsunfähig, als stecke man in einer Wanne voll trocknendem Gips, kurz bevor er abbindet.
»Ein schöner Name«, sagte Hablik.
»Eigentlich Gerlinde. Aber irgendwie hat mir Stella besser gefallen. Und alle haben Stella zu mir gesagt. Stella heißt Stern! Ganz weit weg und voller Glanz. Aber nur in der Nacht …« Sie überlegte kurz. »Naja, egal, Stella ist nicht schlecht.«
Hablik stand auf, um Tee nachzugießen. Der Name Stella gefiel ihm auch besser als Gerlinde. Stella ist ausgefallen und passt zu so einer Frau, dachte er.
»Mein Vater war arm dran«, sagte Stella leise. Sie starrte vor sich hin, ohne auf Hablik zu achten, der verblüfft zu ihr hinübersah. »Und meine Mutter … naja.« In Stellas Kopf entstanden Bilder: Ein Mann, um die vierzig, mager und grau im Bett liegend. Die Augen geschlossen wie ein Toter. Töne aus der Symphonie Nr. 7 in E-Dur von Anton Bruckner schwangen bei der Erinnerung mit. Und eine Frau, die diesen Mann nie geliebt hatte, aber so tat, als würde sie sich um ihn sorgen, die Wirkung ihrer Schauspielerei auf die Tochter aus den Augenwinkeln kontrollierend.
»Ja, ja«, sagte Hablik, der es etwas distanzlos fand, dass diese völlig fremde Frau plötzlich von ihrem Vater redete. Sie wirkte auf einmal wieder abwesend und verwirrt und hing irgendwelchen Erinnerungen nach.
»Mein Vater«, Stella lächelte, »war ein Mann, der immer getanzt hat. Am offenen Fenster, wenn es Sommer war wie jetzt, dann hat er oft Schallplatten aufgelegt und alleine getanzt. Auch als er schwächer geworden war. Mit niemand als mit sich selbst. Walzer von Strauß und Lehàr. Welch elegante Bewegungen! Obwohl es nicht die Musik war, an der er gearbeitet hat, hat er immer zu Walzern getanzt.« Stella brach ab und versank wieder in sich selbst.
Hablik fühlte sich zu Bemerkungen über seine Mutter veranlasst, die wenig lebenslustige Frau des Oberlandesgerichtsrats Friedrich Hablik. Ihre Stellung in seinem Leben schien der des Vaters von Stella zu entsprechen. »Meine Mutter hat nie getanzt. Nur beim Juristenball. Aber dort ist ja nur ausgesuchtes Publikum.« Dass Friedrich Hablik, der Vater, je getanzt haben könnte, war ausgeschlossen. Nicht weil er ein konservativer Jurist gewesen war, sondern weil Habliks Vater im Rollstuhl gesessen hatte.
»Sind deine Eltern tot?«, fragte er.
»Mein Vater liegt auf dem Friedhof, und meine Mutter ist für mich gestorben.«
Hablik, der eine Chance sah, die Kurve weg von dem düsteren Thema Tod zu kriegen, fragte mit einem Lächeln: »Aber deine Mutter lebt doch noch?« Er erhielt keine Antwort. Die Gedanken der jungen Frau waren ganz woanders.
Stella schwieg ziemlich lange und widmete sich nun ihrer Umgebung. Ein großes Zimmer, dessen Wände mit schwarzen Regalen zugestellt waren. Bücher, überall Bücher. Jedes von ihnen trug einen roten, beschrifteten Aufkleber auf dem Rücken. Auf einem Ehrenplatz, mitten im größten Regal, standen vier billige Pokale. Verchromt mit Marmorimitation als Fuß. Über die Trophäen war eine rot-weiße Schärpe dekoriert. Daneben lagen zwei Boxhandschuhe, dicke Dinger, wie sie Amateure im Kampf benutzen. Sie waren braun mit roten Trefferflächen und hatten gelbe Bünde und altmodische Schnürsenkel. Dunkle Spuren von altem Blut auf dem Linken der beiden. An der Seite stand die Euroe »Berg«. Das Zimmer war spartanisch eingerichtet. Schreibtisch, Sessel, Fernseher, DVD-Recorder. Ein billiger Teppichboden in diffusem Grün. Nichts passte in Farbe und Stil richtig zueinander. Aber Stella war das egal. Sie dachte an Dieter.
»Könnte ich mal telefonieren?«, fragte sie. »Ich muss den Dieter anrufen. Damit er sich keine Sorgen macht.«
Dieter? Klar, dass es im Leben einer solchen Frau einen Mann gibt! Habliks Illusionen stürzten zusammen.
»Dort steht das Telefon.«
»Nein, das ist doch keine gute Idee«, sagte sie. Der Stimmungsumschwung kam plötzlich. Hablik schaute irritiert. »Ich bräuchte jetzt was zu trinken. Irgendetwas für den Kreislauf«, setzte sie hinzu.
»Bleib’ besser beim Tee, Tee ist auch gut für den Kreislauf«, sagte Hablik, der an die Beule an ihrem Kopf dachte.
»Du bist verletzt. Das muss man in einer Klinik untersuchen.«
Bei dem Wort Klinik schrak Stella zusammen. »Nein«, sagte sie tonlos und schüttelte sich.
Verlegenes Schweigen herrschte zwischen beiden.