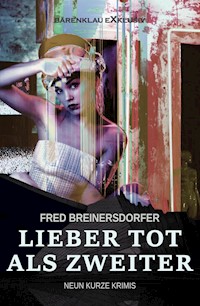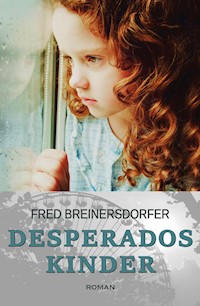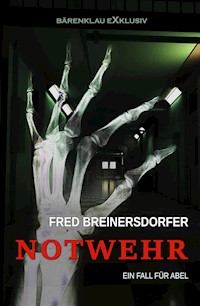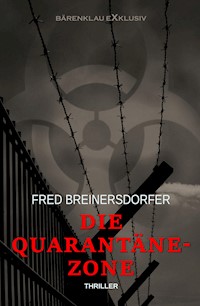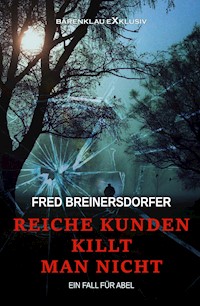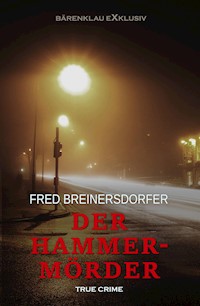3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts ist Vincent Horn ein deutscher Spitzenmanager in der Medienbranche – und so hoch oben ist die Luft verdammt dünn.
Ehrgeiz, Intrigen und emotionale Kälte prägen das gehetzte Leben des Workaholic, und hätte er nicht seine Liebe zur Kunst, er wüsste gar nicht, was Glück ist. Jedoch ist es gerade diese Liebe – er sammelt wie besessen teure Gemälde – die ihn gefährliche finanzielle Wagnisse eingehen lässt.
In Horns Ehe kriselt es, und der 45-jährige Vater zweier Teenager findet eine junge Geliebte, aber sie erwidert seine Gefühle nicht. Den täglichen Kampf als Vorstandsvorsitzender empfindet Horn als extrem hart, wobei er gleichzeitig Ruhm und Erfolg maßlos genießt. Als das neue, aggressive Boulevardblatt STAR – Horns Idee – mit schwindelerregenden Verkaufszahlen ein Durchbruch wird, feiert man auch ihn, doch im Hintergrund lauert bereits der Absturz. Man sägt an seinem Stuhl.
Es kommt, wie es kommen muss – zur absoluten Katastrophe. Mitten in der angespannten Situation, da ihn Gegner innerhalb wie außerhalb der Firma piesacken, hat der erschöpfte Vincent alles satt und fliegt auf Geschäftskosten nach Australien, um dort Urlaub zu machen. Ein großer Fehler!
Das Desaster ist offenbar nicht mehr aufzuhalten; nach und nach wird auch klar, dass der Manager, gefangen in Ängsten, drohendem Burn-out und zwanghaften Gewohnheiten, seine familiären Traumata nie bearbeitet hat.
Wird die Katastrophe ein heilsamer Wendepunkt in seinem getriebenen Leben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Fred Breinersdorfer
Höhenfluch
Absturz eines Managers
Thriller
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Bärenklau Exklusiv, 2023
Korrektorat: Antje Ippensen
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Höhenfluch
Band eins, erste Seite
1. Befunde
1.1 Befunde, allgemein-körperliche
1.2 Befunde, allgemein-neurologische
Band eins, zweite Seite
1.3 Befunde, allgemein-psychische
2. Zum Gutachten
3. Zustand zu Beginn der Untersuchung
4. Zur Lebensgeschichte
4.1 Kindheit und Jugend
Band zwei, erste Seite
4.2 Abitur und Studium
Band zwei, zweite Seite
5. Neigungen und persönliche Vorlieben
Band drei, erste Seite
6. Beziehungen
6.1 Beziehungen zur Mutter
Band drei, zweite Seite
6.2 Beziehungen zum Vater
6.3 Beziehungen zum Bruder
Band vier, erste Seite
6.4 Beziehungen zur Ehefrau und den Kindern
6.5 Beziehungen zum Fall Dittberner
6.6 Beziehungen zum Unternehmen
Band vier, zweite Seite
6.7 Beziehungen zu Prof. h.c. Bellow
6.8 Beziehungen zu Conradi
Band fünf, erste Seite
6.9 Beziehungen zu Dr. David Lentz
6.10 Beziehung zur Geliebten
7. Zu den Tonbandprotokollen
Band fünf, zweite Seite
8. Zusammenfassung und Beurteilung
Der Autor Fred Breinersdorfer
Folgende Romane des Autors Fred Breinersdorfer sind ebenfalls erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts ist Vincent Horn ein deutscher Spitzenmanager in der Medienbranche – und so hoch oben ist die Luft verdammt dünn.
Ehrgeiz, Intrigen und emotionale Kälte prägen das gehetzte Leben des Workaholic, und hätte er nicht seine Liebe zur Kunst, er wüsste gar nicht, was Glück ist. Jedoch ist es gerade diese Liebe – er sammelt wie besessen teure Gemälde – die ihn gefährliche finanzielle Wagnisse eingehen lässt.
In Horns Ehe kriselt es, und der 45-jährige Vater zweier Teenager findet eine junge Geliebte, aber sie erwidert seine Gefühle nicht.
Den täglichen Kampf als Vorstandsvorsitzender empfindet Horn als extrem hart, wobei er gleichzeitig Ruhm und Erfolg maßlos genießt. Als das neue, aggressive Boulevardblatt STAR – Horns Idee – mit schwindelerregenden Verkaufszahlen ein Durchbruch wird, feiert man auch ihn, doch im Hintergrund lauert bereits der Absturz. Man sägt an seinem Stuhl.
Es kommt, wie es kommen muss – zur absoluten Katastrophe.
Mitten in der angespannten Situation, da ihn Gegner innerhalb wie außerhalb der Firma piesacken, hat der erschöpfte Vincent alles satt und fliegt auf Geschäftskosten nach Australien, um dort Urlaub zu machen. Ein großer Fehler!
Das Desaster ist offenbar nicht mehr aufzuhalten; nach und nach wird auch klar, dass der Manager, gefangen in Ängsten, drohendem Burn-out und zwanghaften Gewohnheiten, seine familiären Traumata nie bearbeitet hat.
Wird die Katastrophe ein heilsamer Wendepunkt in seinem getriebenen Leben?
»Dieser Roman«, so liest man gelegentlich zu Beginn eines Buches, »ist frei erfunden. Seine Personen und die Handlung haben nichts mit der Realität zu tun.« Bei dem folgenden Text ist es anders, er hat sehr viel mit der Realität in Deutschland zu tun. Seine handelnden Personen sind keineswegs nur frei erfunden, sie haben zusammengefügte, übereinander geblendete Biographien, gleichsam Collagen aus prominenten deutschen Managerschicksalen, einige davon betreffen sogar Personen, die wegen gravierender Vergehen vor Gericht gestellt wurden. Bitte suchen Sie, verehrte Leserin, geneigter Leser, deshalb nicht eine vermeintlich wahre Identität des Helden meiner Geschichte oder seines Gegenspielers oder anderer Charaktere, die ich auftreten lasse. Sie sind, so wie ich sie schildere, das Produkt meiner Phantasie, sie hätten aber durchaus existieren können. dasselbe gilt für die Handlung. Auf diese Weise entstand eine Erzählung aus der Realität, Fiktion auf der Basis von Fakten, ein dokumentarischer Roman.
Ich war für die Ausformung von Charakteren und Handlung auf eine sorgfältige Materialsammlung von Biographien, aber auch von Berichten über kriminelle Machenschaften deutscher Manager angewiesen, um die Tonbandprotokolle meines Helden, das Gutachten, die Dokumente zu schreiben und die verwendeten Zitate aus Zeitschriften und Zeitungen auszuwählen.
Ich danke Giesela Friedrichsen, der Gerichtsreporterin des SPIEGEL, für die Zusammenstellung einer exzellenten Dokumentation über die bekannten Wirtschaftsstrafprozesse der letzten zwanzig Jahre und deren Hintergründe, die sich alleine schon wie ein Thriller aus dem deutschen Business gelesen hat.
F. B.
Stuttgart, im Januar 1992
Höhenfluch
Absturz eines Managers
Hier spricht Vincent Horn. Diese Tonbandcassette ist ausschließlich für meinen persönlichen Gebrauch bestimmt. Sie geht niemanden etwas an. Sollte das Band gefunden werden, bitte, schicken Sie es an die Adresse, die auf der Cassette steht. Ich bezahle eine Belohnung von 100 US-$ für die Rücksendung. Wer immer dieses Tonband bis jetzt abgehört hat, möge abschalten. Ich will auch nicht, dass Mitglieder meiner Familie sich anhören, was ich hier sprechen werde. Dies gilt ganz besonders für meinen Vater, aber auch für meine Frau, meinen Bruder und meine Kinder. Ich verfüge, dass diese Weisung auch nach meinem Tod respektiert werden muss.
Band eins, erste Seite
Standortbestimmung. Suche nach dem Selbst. Aussagen des Zeugen Vincent Horn über den Vorsitzenden des Vorstandes der MediaGlobal AG, Dr. jur. Vincent Horn, und damit zugleich die Suche nach dem, was dieser Job überhaupt von ihm übriglässt. Zur Erinnerung, zur Schärfung des Bildes von sich selbst.
Lange habe ich überlegt, ob es richtig ist, Protokolle für mich allein zu sprechen. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen.
Die Zeit ist auch reif dafür, denn heute am späten Nachmittag habe ich zum ersten Mal in meinem Leben dieses Büro des Vorstandsvorsitzenden betreten. Es ist nun mein eigenes Büro. Alles in ihm ist neu. Keiner der Gegenstände hat eine eigene Geschichte außer der seiner Erzeugung.
Der Büroturm, in dessen 38stem Stockwerk ich sitze, ist noch nicht einmal fertig ausgestattet. Nichts hier hat Tradition.
Vieles ist noch halb verpackt. Was zum Vorschein kommt, funkelt und glänzt. Die Klimaanlage fördert mit leisem Rauschen Luft, die selbst nach dem Filtern nach frischer Farbe riecht und dem Lösungsmittel der versiegelten Parkettböden.
Mein Büro ist ein weißer Kubus, dessen eine Seite aus grünlichem Glas besteht. Zu meinen Füßen die weißen und orangefarbenen Lichter der Großstadt. Jede Bewegung wirkt langsam von hier gesehen. Eine Perspektive, die mir Gelassenheit gibt. Ich arbeite losgelöst von jeglicher Hektik und halte mich über den Dingen auf.
Ich befinde mich im Machtzentrum eines der größten Medienkonzerne in Deutschland. Es liegt exakt hier in meinem Büro. Morgen beginne ich meine Arbeit. Ich werde diesem Unternehmen meine Kraft verleihen. Es muss wachsen. Der Wettbewerb zwingt uns dazu: Wachsen oder von anderen übernommen werden, das sind die Alternativen. Wir werden die Stärksten werden.
Unsere Meinung wird zählen. Wir werden mächtiger und mächtiger werden. Und weil ich weiß, wie gefährlich Macht ist, werde ich sie mit Behutsamkeit handhaben. Ich werde diese Menschen, mit denen ich arbeite, im skrupulösen Gebrauch der Macht trainieren.
Für meinen Aufsichtsrat zählt der Erfolg, nichts als der in Profit messbare Erfolg des Konzerns. Deswegen haben sie mich gewählt und keinen anderen. Sie halten mich für den Besten, den Garanten für Umsatz, Geld, Gewinn.
Ich weiß, wie man Erfolg produziert.
Genauso wie ich dieses Büro, diesen Kubus mit seinen weißlackierten Wänden und Böden und seiner gläsernen Front in jedem Detail gestalten werde, genauso werde ich meinem neuen Konzern eine klare, dynamische und funktionale Form geben.
Schreibtisch, Halogenleuchten und Sessel im Büro sind schwarz. Die Platte des Tisches ist mit chinesischem Lack behandelt. Sie glänzt und wirkt verletzlich wie Bakelit. Die Wände sind noch leer, weiß, kalt. Ich habe mir Vorschläge des Innenarchitekten verbeten. Ich kann nicht die minderwertige Graphik aus den Suiten amerikanischer Großhotels in meinem Umfeld ertragen. So etwas quält mich physisch. Aber ich weiß noch nicht, welches Exponat aus meiner Sammlung expressionistischer Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen ich hierher bringe. Ich habe im Augenblick nur eine vage Vorstellung von den Sujets und den Farben, in deren Nachbarschaft ich so arbeiten kann, dass ich uns so bedeutend mache, wie wir sein müssen, um die Konkurrenz zu schlagen. Deswegen sind die Wände noch leer und weiß.
Als ich heute Nachmittag zum ersten Mal diesen Raum betreten habe, bin ich vorsichtig an den Schreibtisch gegangen und habe meine beiden Handflächen flach auf die Lackoberfläche gelegt. Ich habe die angenehme Kühle, die makellose Glätte des Materials gespürt. Meine begreifliche Erregung angesichts der neuen Lebenssituation ist nur langsam gewichen. Ich habe mir die Geduld genommen zu warten. Und dann habe ich einen Versuch durchgeführt, spontan: Ich habe angeordnet, dass man den Chefredakteur des Wall Street Journals anruft und mich mit ihm verbindet. Mein Vorstandsassistent war drei Jahre in den USA, er kennt sich aus. Und er hat nicht lange reden müssen, dann war ich verbunden. Wir müssen uns also auch in den Staaten nicht mehr vorstellen, man weiß, wer wir sind. Ich habe mich kurz gefasst und ein Interview verabredet. Morgen, am ersten Arbeitstag. Ich habe noch ein paar Floskeln aufgelegt, bin an mein Fenster getreten und habe durch die grünlichen Scheiben, die wie das Glas eines Aquariums wirken, auf die Stadt hinuntergesehen. Die Zeit bis zu dem kleinen Empfang, den ich für meine Kollegen im Vorstand geben wollte, ließ ich langsam zusammenschmelzen und versuchte, dieses Gefühl der Ruhe am Anfang eines wichtigen neuen Abschnitts in meiner Biographie festzuhalten, zu einer verlässlichen Erinnerung werden zu lassen.
Ich habe in meinem Leben mehrfach eine solche Schnittstelle passiert, ohne es mit Bedacht zu registrieren, genauso wie man auf einem Nachtflug den Äquator überquert, ohne in der Schläfrigkeit der Reise daran zu denken. Als ich mit 19 Jahren die Schule verließ mit dem Abitur in der Tasche: eine Raserei, wildes Besäufnis, ohnmächtige Trunkenheit. Als ich mein Studium abschloss: unruhig und gespannt; die Sicherheit, meinem Vater bewiesen zu haben, dass ich in der Lage war, schneller als er das Examen zu machen – und die nagende Gewissheit, das erträumte Spitzenergebnis verfehlt zu haben. Die nächsten Zäsuren waren in meiner Erinnerung entweder zu feierlich (die Eheschließung) oder zu dramatisch (die Geburt der Kinder, bei der ich in einem grünen Kittel wie ein Trottel danebenstand), um bewusst erlebt zu werden. Der später folgende Wechsel von Unternehmen zu Unternehmen – vor allem der Sprung hinein in die teilweise Selbständigkeit eines Unternehmensberaters – bleibt heute hinter Schleiern des Gedächtnisses zurück, verwischt von Hektik, wie ein unscharfes Foto wirkend.
Doch, da fällt mir noch ein: der Tod meiner Mutter. Die Lähmung, die davon ausging, die Angst, die er erzeugte. Diese Nächte voller Unruhe, das Gefühl plötzlicher Wurzellosigkeit; das spüre ich noch fast physisch. Die räumliche Trennung von meinem Vater ist bei weitem nicht so präsent: obwohl meine Wut auf ihn so viel Kraft gekostet hat und immer noch kostet!
Ich habe noch kein System gefunden, wie ich mit meinem Gefühlschaos klarkomme. Erinnerungen, Begebenheiten, Sentimentalitäten rauschen auch jetzt durch meinen Kopf wie Wasser durch ein Gewirr großer Pumpstationen. Und immer wieder mit großer Aufdringlichkeit: Die Überlegungen, die um dieses Unternehmen hier kreisen, um ›uns‹, wie ich schon zu mir selbst sage. Bis ich schließlich feststelle, dass ich nicht mehr wie ein selbständiges Individuum denke, sondern wie ein Teil des Konzerns. Notwendige Identifikation. Jetzt bin ich sein Kopf, sein Nervenzentrum und nicht mehr nur eine Schaltstelle im Organisationsplan. Ich denke – das Unternehmen handelt, und es zwingt mir seine Gedanken auf.
Genau das war der Punkt, den ich gesucht habe, die Klarheit, um die es mir gegangen ist. Man muss sich einmal den Tatbestand vor Augen führen, dann kann man mit ihm umgehen, dann weiß man, wo man steht. Damit ich vor lauter Tageskram diese Dollpunkte nicht aus dem Auge verliere, habe ich begonnen, für mich, und zwar ganz für mich alleine, auf dieses Band zu sprechen.
Also erzähle ich mir selbst von diesem Augenblick des Triumphes, als meine neue Sekretärin, eine Frau Aberbusch, die Tür öffnete und schweigend zurücktrat. Vielleicht war es Zufall, vielleicht war es Absicht, mein schärfster Konkurrent um meine Position betrat als erster nach mir dieses neue Büro des Vorstandsvorsitzenden, um zu gratulieren: David Lentz. Er hatte sich beworben, war schon praktisch designiert und musste, so glaube ich, am Ende noch froh sein, dass er mein Stellvertreter wurde. Dass ich über einen Kopf größer bin als er, versucht er stets durch besonders aufrechte Haltung zu kompensieren. Hoch aufgerichtet und straff schritt er zu mir her, mit einem Lächeln auf zusammengepressten Lippen, die Hände flach in die Außentaschen seines dunkelblauen Anzugjacketts geschoben. Bevor er mir die Hand gab, rückte er seine Nickelbrille zurecht. Unsicherheit! Sein Händedruck war kühl, nicht hart, nicht weich. Wegen einer Allergie schuppt die Haut seiner Hand. Sie fühlt sich rau an.
»Glückwunsch, mein Lieber«, sagte Lentz, bevor er an das Fenster trat und hinzufügte, »ein wenig wie in einem Aquarium, nicht wahr?« Dann zeigte er auf die weißen Wände, »da kommen doch sicher ein, zwei Expressionisten hin«, sagte er. Sein Mund verzog sich schräg. Seine Augen hatten das Grau eines Kieselsteins.
Was gehen den meine Expressionisten an?
Nach seiner nächsten Bemerkung wusste ich, dass er mich bekämpfen wird. Die Bemerkung lautete wörtlich: »Viel Glück, mein Lieber. Und Sie werden viel Glück brauchen. Aber keine Angst, ich werde Sie begleiten, seien Sie meiner kritischen Freundschaft sicher. Es ist manchmal besser, einen harten, ehrlichen Partner als einen opportunistischen Freund zu haben. Ich erwähne das, um die Claims abzustecken.«
Ich bin ziemlich nahe an ihn herangetreten, nicht um sein beliebtes Spiel zu spielen, sich gegenseitig in die Augen zu starren, um herauszubekommen, wer es länger aushält. Nein, aber ich wollte ihn meine physische Präsenz spüren lassen. Ihn, David Lentz, Vorstandsmitglied Bereich Finanzen, 51, ledig, Nichtraucher, angeblich Nichttrinker, die Pflicht in Person. Wir standen uns gegenüber wie zwei Duellanten, bevor sie sich umdrehen und auf Schussdistanz gehen, als wie auf ein Stichwort die anderen Herren erschienen. Ich hasse diese Inaugurations-Feierlichkeiten und habe mir jede Form von Ansprache verbeten. Wir salbadern nicht, wir kämpfen um einen Markt.
Ich hob das Glas. Wir stießen an. Allein Lentz mit Mineralwasser.
Wir anderen mit meinem Champagner, weil das Vorzimmer so aufmerksam war, meine Lieblingsmarke zu bestellen (ein kleineres Weingut in der Banlieue von Reims). Der Rosé ist am besten.
»Auf eine förderliche Zusammenarbeit auf dem Weg zum Erfolg«, sagte ich. »Fangen wir an.«
Eine kleine Feier habe ich mir gegönnt. In einem schönen traditionellen Wirtshaus im Taunus, ohne Schmiedeeisenschnickschnack, wo man herzhaft zu kochen versteht. Man belästigt die Gäste nicht mit handgeschriebenen Speisekarten in Gourmet-Prosa (»Lendenscheibe an grüner Soße auf Prinzessbohnen«, »Dialog von Kaviar und Lachs« und so weiter), man reicht vorzügliches Essen in angemessenen Portionen.
Sibille hat sich für den Abend neu eingekleidet. Schwarze Stilettos mit faszinierender Linie, ein sehr kurzes bordeauxrotes Kleid, schwarze Nylons. Eine lange Kette echter Perlen. Sie kann das alles tragen, denn sie ist die Schönste unter den noch 40-Jährigen, sehr schlank, sehr mondän. Mein Gott, wir beide, groß gewachsen, eloquent und charmant, beide blond, wir konnten schon immer hinkommen, wo wir wollten, wir wurden bewundert – oder beneidet.
Die Kinder waren aus dem Internat gekommen. Olivia-Louise ist ein verteufelt hübsches Mädchen. Kleiner als ihre Mutter zwar, aber sie hat die grünlich changierenden Augen meines Großvaters geerbt. Ich liebe sie. Und ich zeige es ihr. Das ist pädagogisch zwar Unfug (Vater kauft und schenkt dem Kind schon nach kurzem Zögern, was es sich wünscht), ich bin aber stolz darauf, dass ich es mir leisten kann, meine schöne Tochter mit Luxus auszustatten.
Und Carl-Frederic? Ein Lausbub. Frech, respektlos, intelligent und ungeheuer mutig. Ein Sportler, dessen Hausaufgaben immer zu kurz kommen. Seine Mutter ängstigt sich oft um ihn. Seinen Mut nennt sie Tollkühnheit. Mich fasziniert seine wilde Jugend.
KAHO, mein Bruder, gab uns schließlich auch die Ehre. Er kam wie immer zu spät. Mein Gott, wir haben uns vielleicht ein Jahr schon nicht mehr gesehen. Ich legte die Serviette auf die Seite. Wir umarmten uns. »Junge, du bekommst graue Haare«, sagte ich. (Und, unter uns gesagt, Speckwülste im Nacken, obwohl er schlanker ist als ich. Sein fast rasierter Haarschopf gibt den Blick ungehindert darauf frei.) Er gab Sibille die Hand, er hat sie noch nie auf die Wangen geküsst. Die Kinder umarmte er herzlich.
Wir aßen, plauderten. Mein Brüderchen, der große Künstler, gab sich freundlich und wortkarg. Wir hörten wenig aus der Szene. Dafür gab Sibille ununterbrochen Berichte von der gesellschaftlichen Front, in die durch die neue Aufgabe des Ehegatten, na wie soll ich sagen, ein wenig Bewegung gekommen war. Gleich zweimal wurde Sibille von Ehepaaren, die auch den Geheimtipp für diese Wirtschaft bekommen hatten, während wir aßen, stürmisch begrüßt. Ich kenne diese Leute nicht. Mir gab man höflich die Hand mit prüfendem Blick, ob ich genauso aussehe wie auf den Fotos, die heute in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen abgedruckt waren. Ich verhielt mich zurückhaltend. KAHO hing schräg auf dem Stuhl und spielte ganz den Künstler, ein wenig entrückt, schwarz gekleidet, mit einer Comicfigur aus Silber am Revers.
Die Kinder waren sehr wohlerzogen, hörten dem Unfug, den die Erwachsenen erzählten, aufmerksam zu und speisten mit Manieren.
Alles um mich herum ist perfekt inszeniert und macht Spaß. Ja, Vincent, jetzt bist du oben. Da gehörst du hin.
Der Konzern, den ich jetzt übernommen habe und dem ich bereits früher einmal versucht habe, neue Impulse zu geben, ist eigentlich in seiner Geschichte nie mehr gewesen als die verschlafene Hofdruckerei berühmter Verlage, die er bei der Gründung 1923 war. Der Geist in der Firma ist so, wie man es vermutet: unfrei und muffig und von einer verschrobenen Intellektualität, auf die man zu allem Überfluss in den mittleren Etagen des Hauses noch stolz ist. Diese Manager haben sich in den vergangenen Jahren kaum von Gewerkschaftsfunktionären in ihrer Kleinlichkeit und Engstirnigkeit unterschieden. Daran änderte wenig, dass man in den 50er und 60er Jahren begonnen hatte, Zeitungen dazuzukaufen – wohl gemerkt, nicht zu gründen, denn Initiativen und Innovationen dieser Art lagen dem Unternehmen nicht. Als man sich, dem Zeitgeist hinterherlaufend, eine Filmproduktionsfirma und – endlich – einen der Traditionsverlage, für die man schon seit Jahrzehnten druckte, leistete, waren dies Schritte von ungeheurer Tragweite im Bewusstsein meines Vorgängers. Ich erinnere mich noch an die nächtelangen Sitzungen der versammelten Bedenkenträger. Sie führten sich auf, als müssten sie über den Zukauf von Disney Productions und Penguin Books im Zweierpack entscheiden. Und damals war weiß Gott noch genügend Geld in den Kassen des Hauses. Inzwischen setzen wir knapp mehr als 2 Milliarden DM um – allerdings bei beängstigend sinkenden Gewinnen.
Der Konzern mutet an wie ein schönes altes Haus, das von verschrobenen alten Leuten bewohnt und heruntergewirtschaftet wurde. Nun muss man renovieren, modernisieren, dem Haus ein neues Gesicht geben. Die hilflosen Versuche, eine CI für alle Unternehmensteile zu bilden und damit zu werben, hat bestenfalls zu einer Verwirrung des Marktes geführt. Man hat nicht durchgehalten, frühzeitig abgebrochen. Es ist ein Jammer, was hier geschludert und versäumt wurde. Aber die Renovierungsarbeiten sind eine großartige Aufgabe für einen jungen Manager. Hier habe ich die Spielräume für Innovation und Dynamik, die ich brauche, um mich und damit die Firma zu entfalten.
Ein erster Schritt in Richtung Zukunft war der Entschluss meines ausgeschiedenen Vorgängers, drei Etagen in diesem Büroturm zu leasen, in dem ich jetzt mit der engeren Unternehmensleitung sitze. Früher verzettelte sich die Führungsebene auf drei Anbauten zu Druckereihallen im Außenbezirk. Mein altes Büro bei meinem ersten Gastspiel als Bereichsleiter war eine feuchte Gruft, in der das Gehechelt und Rollen der Druckmaschinen zu hören war; man schämte sich vor Besuchern.
»Die Zahlen stimmen«, sagte mein Vorgänger in vielen Meetings, als sei das alles. Er war selbstgefällig und alt. Er hat nie verstehen wollen (ganz abgesehen davon, ob er es hätte können), dass die Unternehmensrendite nicht der einzige Faktor für den Erfolg einer Firma ist. Die Unternehmenskultur, das Image sind genauso wichtig und fördern ordentliche schwarze Zahlen. Es muss den Mitarbeitern Spaß machen zu produzieren, die Leute müssen wild darauf sein zu verkaufen, was wir in die Welt setzen. Produktion und Distribution sind Abenteuer und Herausforderung und nicht eine Funktion in einer Buchhaltungsaufgabe für Betriebswirtschaftsstudenten. Wir müssen modern handeln.
Wenn ich mir zum Beispiel diese Zeitungen ansehe, die wir betreiben. Sie atmen von der ersten bis zur letzten Seite den muffigen, konservativ-ängstlichen Geist der späten 50er Jahre. Die Blätter der Hofdrucker machen Hofberichterstattung für die jeweilige Regierung, egal ob schwarz oder rot. Bloß bei den Schwarzen fallen ihnen die staatstragenden Vokabeln flüssiger ein. Das ist alles durchsichtig und platt. Es fehlt die Spannung, die Überraschung, die sich so prima als Unabhängigkeit verkaufen lässt. So kann es doch nicht weitergehen!
Die Filmfirma werkelt an unterklassigen Industrieproduktionen. Ein Auftrag für das ZDF für zwei Filmchen aus der Reihe »Das kleine Fernsehspiel« wird in der Produktion mit deutschem Sekt und in einem hektographierten Memo an den Vorstand mit kläglichen Orthographiefehlern als ›Durchbruch der Firma in das neue Medienzeitalter‹ gefeiert. Wenn gerade mal 1,5 Millionen Zuschauer kurz vor oder nach Mitternacht im Abspann das Logo der Media Global Film für drei Sekunden zu sehen bekommen, dann ist die Vokabel ›Durchbruch‹ deplatziert und lächerlich. Der gute alte Atze Brauner macht in seinem 50er-Jahre-Bungalow in Berlin mit einer Haushälterin, einer Praktikantin und seiner Familie Mediengeschichte, Filmpreise und Reibach. Bei uns feiern abgehalfterte Oberlehrer und Möchtegerndramaturginnen, ausgestattet mit ansehnlichen Mitteln und trotzdem in den roten Zahlen, das ›Kleine Fernsehspiel‹ als Durchbruch, mein Gott! Bürokraten, Stümper, wir befinden uns auch in der Filmfirma in einem nahezu gänzlich innovationsfreien Raum. Ich bin ein Gegner von Kündigungen, aber hier werde ich ein Revirement veranstalten.
Und unsere Illustrierte! Auch hier hat man ein eingeführtes Blatt gekauft, auch hier hat man herumgedoktert, ohne Konzeption, ohne Ziel. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal zur Firma gekommen bin, wie die Parole ausgegeben wurde: Nun wird das politische Magazin gemacht. – Und das war damals, als der Stern noch nicht auf die Hitler-Tagebücher reingefallen war, und auch der Rest der Illustriertenlandschaft noch wenigstens einigermaßen von herkömmlichen Blättern dieser Art hat leben können. Gegen Stern und Spiegel anzugehen, das war wie die Geschichte von dem kleinen Hund, der mit den großen pinkeln gehen wollte und das Bein nicht heben konnte. Unbeirrbar: Das politische Magazin musste her, koste es, was es wolle. Und es hat viel gekostet.
Politische Journalisten mit Profil kann man nicht finden, wenn man ausschließlich darauf achtet, dass sie nicht gewerkschaftlich orientiert sind und außerdem stockkonservativ, und wenn man Revisoren beschäftigt, die mit breitem Hintern auf dem Spesenetat sitzen. Immer war die Philosophie des Hauses: beherzt sparen statt investieren.
Dann versuchte man es mit Sex and Crime, dann mit Tratsch und Klatsch. Doch die anderen Blätter waren immer schneller, und wir liefen hinter dem Trend her. Man bohrte das Fernsehprogramm auf (Medienkonzern!), druckte es vierfarbig, als das bei der Hörzu schon seit zwei Jahren in Color lief.
Und ich sitze nun auf diesem Blatt.
Unser Buchverlag, ein Renommierstück der Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts, ist in Wirklichkeit eine armselige intellektuelle Bretterbude. Eine Reihe mit aufsässiger Literatur und eine zweite mit aufklärerisch polemischen Sachbüchern hat mein Vorgänger nach dem Kauf eingestellt, weil man sie wie ein eigenes Profitcenter geführt hatte und es an Gewinnen mangelte. Aber diese verdammten Reihen, die ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, hasste, weil sie genau diesen intellektuellen Anspruch, dieses Alleinvertretungsrecht für die richtige moralische Entscheidung einforderten wie mein Herr Vater, sie waren es, wenn man die Sache objektiv betrachtet, die immer für eine Pressemeldung gut waren – unbezahlte Imagekampagnen für diesen Verlag. Davon lebten populärere Reihen. Nach der Einstellung der linken Buchreihen gab es das zu erwartende Pressehallo, damit war ein Teil der Reputation des Verlages verspielt.
Moderne Zeiten: Man spuckt aus unserer Bücherbaracke schlecht redigierte Übersetzungen amerikanischer Thriller, eine Unzahl Ratgeber der einfacheren Machart, eine noch größere Zahl an Reiseführern auf einen immer enger werdenden Markt – nicht zuletzt, um unsere Druckereien auszulasten. Masse statt Klasse, Hektik statt Spaß.
Der ganze Konzern mutet an wie ein Drehorgelhersteller und gibt sich als Mediengigant. Vom Umsatz her weit oben in Deutschland, und trotzdem ein Laden aus der tiefsten kulturellen Provinz. Hofdruckerei! Schade eigentlich.
Dieses Unternehmen schläft tief, es wacht gelegentlich auf – aber immer zu spät. Mit Sparen statt Investieren kann man keine Unternehmenskultur und keine Zukunft schaffen.
Deswegen bin ich auch gegangen, habe meine Gruft neben der rumorenden Druckerei (immerhin als Bereichsleiter und stellvertretendes Vorstandsmitglied) aufgegeben und bin hinüber zu Nummer 1, A number one, endlich wenigstens unternehmensmäßig top of the list sein! Ich wollte Zeitungen machen, hautnah, lebendig, schnell, erfolgreich. Deswegen habe ich gewechselt.
Hier, Moment. Ich habe da gerade aus meiner Sammlung ein Zitat von Hubert Burda aus einem Spiegel-Gespräch:
»Bei der Zeitschrift ist jede Woche, bei der Zeitung jeden Tag ein Match, ein Kampf um den Leser. Auch der ganze Personaltransfer gehört dazu. Da sind journalistische Profis von der Konkurrenz gekommen und wieder zurückgegangen und umgekehrt, und so wird es weitergehen.«
Ich bin den Weg des Personaltransfers gegangen, welch eine Befreiung! – aber damals, das war auch so ein Augenblick ohne das geringste Bewusstsein für den biographischen Schnitt. Alles lief glatt, übergangslos. Ich starrte nur nach vorne. Dort war ich – up up and away – nach einem halben Jahr im Vorstand und zuständig für die Boulevardpresse, die ich immer geliebt und gehasst habe. Geliebt wegen der schnellen und griffigen Information, gehasst wegen der Stigmatisierung der Journalisten und der Verantwortlichen bei uns hier in Deutschland. Das erzeugt Komplexe, und diese wiederum erzeugen Eitelkeiten, Aggressionen und eine schlechte Atmosphäre.
Und ich glaube, dass ich meine Sache gut gemacht habe beim Konkurrenten. Ich bin gewachsen, bis ich eines Tages auch bei A number one mit dem Kopf an die Decke reichte. Dann war ich dessen plötzlich überdrüssig. Auch bei mir erzeugten die Balkenüberschriften auf einmal Aggressionen, diese rote Farbe machte mich magensauer. Ein Tropfen brachte das Fass zum Überlaufen. Ein paar Gespräche mit einem Headhunter, ein vertrauliches Treffen mit Rudolf Bellow, meinem jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden in einem dieser prächtigen Alpenhotels, die er zu frequentieren pflegt, die lange Klage der Eigner größerer Unternehmensanteile unserer Gruppe über mangelndes Profil und fehlende Innovation, mein geduldiges Zuhören bei den endlosen Tiraden über Probleme, die ich schon lange kannte – und endlich nach Mitternacht war herausgekommen, was sie dazu getrieben hat, alle meine Bedingungen bezüglich Gehalt und Tantiemen und Extras zu akzeptieren:
Ein Boulevardblatt.
Eines, das im Osten und hier funktioniert, eines mit neuem Gesicht. Eines, das das Zeug zum Flaggschiff des Konzerns hat, eines, vor dem Politiker und kulturelle Prominenz gleichermaßen zittern. Sie wollen von mir das ›geile Blatt‹! Ja, es ist nicht zu glauben, man benutzte diese beiden Worte – bei meinen Kindern ist das Alltagssprache, bei einem Unternehmer der alten Schule eine Ungeheuerlichkeit. Ja, Bellow sagte zu mir: »Wir wollen ein geiles Blatt«, um sich gleich danach mit beiden Händen den Mund zu verschließen. Aber die Anteilseigner, alle drei alte Herren, fanden den Begriff gut gewählt und nickten beifällig. Wer weiß, vielleicht träumen sie insgeheim in ihren Altmännerträumen davon, dass sie unter geschäftlichem Vorwand einmal zugegen sein können, wenn diese jungen Mädchen für unser Blatt ihre nackten Brüste fotografieren lassen? Also das geile Blatt soll es sein. Und meine Magensäfte? Und meine Ruhe? Aber andererseits: Wann kommt eine solche Chance wieder?
Es gehört zum Ritual, um Bedenkzeit zu bitten. Das stört einen Mann wie Rudolf Bellow nicht. Er hielt mein Zögern für Geplänkel. Aber ich habe mir drei Tage lang überlegt, ob ich wirklich eine Boulevardzeitung aufziehen will neben dem ganzen strategischen und konzeptionellen Aufwand, den der Konzern verlangt (dass ich es kann, davon bin ich überzeugt). Dann habe ich mich dazu entschlossen, diese Kröte zu schlucken. Ich sah die Chance, mit meiner Führungskreativität dieses Konglomerat von Firmen zu einer gut geölten Maschine zusammenzusetzen, einem Gerät, das die Schubkraft hat, dass wir in der Branche in fünf Jahren (so lange läuft mein Vertrag) ein gutes Stück weiter auf dem Weg nach ganz oben sind: Top of the list. Warum nicht eine schrille, freche, schnelle Zeitung als Zugnummer? Kann ja nach einer kreativen Pause durchaus auch Spaß machen, so etwas.
1. Befunde
1.1 Befunde, allgemein-körperliche
Der Explorand Gustav, später Vincent Horn, Dr. jur., ist 45 Jahre alt, 1,87 m groß und wiegt 112,5 kg.
Er befindet sich in gutem AZ und EZ.
Normal konfigurierter Thorax, seitengleiche Beatmung, reguläres Vesikuläratmen auskultierbar. Sonorer Klopfschall bei der Perkussion feststellbar. Lungenbefund insgesamt auskultatorisch und perkutorisch regelrecht. Abdominalorgane auskultatorisch und perkutorisch unauffällig.
Es befindet sich im Bereich des linken Kniegelenks eine etwa fünf Zentimeter lange, vertikal verlaufende reizlose Narbe. Es findet sich ein Blutdruck von 160/110 mmHg. Die Pulsfrequenz liegt bei 78/min. Bei einer internistischen Untersuchung in der Inneren Klinik der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität wurde eine leichte Angina pectoris festgestellt, die medikamentös behandelt wird.
Der Explorand gibt an, die ›gängigen‹ Kinderkrankheiten durchgemacht zu haben, wobei er sich besonders an die Masern erinnern könne, die bei ihm einen schweren, fiebrigen Verlauf genommen haben, so dass er zwei Wochen lang wegen der Gefahr einer Erblindung, die die Eltern befürchteten, in einem verdunkelten Zimmer gelegen habe. Den Blinddarm habe man bei ihm als Student entfernt, er kann das genaue Jahr der Operation nicht mehr angeben. Aus einem Verkehrsunfall zu Beginn seiner Managerlaufbahn resultiert ein Bruch des Wadenbeins, der folgenlos verheilt ist. Ein Gallenstein wird ihm im 37. Lebensjahr entfernt.
In gewissen Abständen versucht er mit diätetischen Maßnahmen das Gewicht zu reduzieren, was jeweils nur vorübergehend gelingt. Psychopharmaka nehme er keine ein, wie er besonders betont. Gelegentlich, vor allem bei überlastungsbedingten Kopfschmerzen, nehme er Aspirin in ›vernünftigen Dosen‹, worunter er ein bis sechs Tabletten täglich versteht. Diese Gaben betrachte er auch als Prophylaxe gegen koronare Herzbeschwerden. Trotz ungewöhnlich hoher Arbeitsbelastung als Führungskraft habe er sich ausgeglichen gefühlt und regelmäßig geschlafen. Ausnahmen nur bei Interkontinentalreisen, weil er anfällig für zeitumstellungsbedingte Änderungen des Lebensrhythmus sei.
*
Ich spreche wieder in meinem Aquarium – ja, ich habe diesen Begriff von Lentz übernommen, weil er irgendwie passt – auf dieses Tonband, denn unser Haus ist in ein lärmendes Inferno verwandelt worden, das vor der Tür meines Arbeitszimmers nicht haltmacht. Jeder in der Familie, eingeschlossen meine Frau, respektiert üblicherweise mein Arbeitszimmer als eine Art innere Zone meiner Persönlichkeit, wo ich nicht gestört werden will. Heute ist es anders; die Kinder sind für wenige Tage nach Hause gekommen. Olivia hat darauf bestanden, eine Party zu feiern (besser gesagt, ein Chaos zu inszenieren), was meine Frau ihr versprochen haben soll. Sibille hat das Versprechen wenig später dementiert und mit diversen Gründen versucht, das aus ihrer Sicht dem Kind nicht zuträgliche Festchen zu verhindern. Sie fürchtet Exzesse, sie glaubt, dass die 20-jährigen Knaben, die teilweise vom Internat kommen, teilweise aus der Stadt, sich bei uns betrinken, die Wohnung verwüsten und die anwesenden Töchter aus der besseren Gesellschaft, der sich Sibille so verpflichtet sieht, schänden. Eine Frau, die nicht geringe Probleme mit der eigenen Sexualität hat, kann naturgemäß kein Verständnis für die eher harmlosen Entdeckungstouren der eigenen Tochter auf diesem Sektor haben. Würde ich dies meiner Frau ins Gesicht sagen, sie lachte mich offen aus. Nein, Sibille findet ihre eigene Einstellung zum Sex ganz in Ordnung. Sie trägt doch diese kurzen Röcke und verzichtet am Strand in der Sonne auf ein Oberteil, da muss das mit der Sexualität doch stimmen, glaubt sie, da bin ich sicher. Aber heute noch schaltet sie bei Anwesenheit der Kinder im Fernseher auf einen anderen Kanal, wenn Leute auf dem Bildschirm bumsen. Sind wir alleine, geht sie hinaus.
Ich habe wegen der Party deshalb praktisch argumentiert, um Olivia zu helfen. Gott sei Dank habe ich mich durchsetzen können. Die Kids haben im Internat doch sonst keinen Spaß, wo sollen sie ihn denn haben, wenn nicht zu Hause. Olivia durfte also (mit Sicherheitsauflagen) ihre Fete geben. Meine Bilder habe ich – in Vollzug der innerfamiliären Vereinbarungen – persönlich in den Tresor im Keller gebracht, damit keine Werte beschädigt werden. Wir haben veranlasst, dass das kleine Büfett, das geliefert wird, nicht mit stark schmutzenden Lebensmitteln oder Garnituren bestückt ist. Rotwein gibt es nicht. Die Kinder können, wenn sie schon etwas trinken wollen, Bier und Sekt zu sich nehmen. Und im Übrigen glaube ich, was die Kopulationsfreudigkeit der Jugend auf solchen Festen angeht, dass meine Frau zu viel Produkte der Regenbogenpresse unserer verehrten Wettbewerber liest. Unsere Kids sind braver und anständiger, als wir selbst waren. Und alle wissen, wie gefährlich Rauschgift ist, im Internat bläuen sie es in die Pennälerköpfe. Rauschgiftkonsum in besseren Kreisen, zu denen wir ja nun einmal gehören, ist statistisch sehr selten und beruht meist darauf, dass die Eltern den Kindern keine Zuwendung zuteilwerden lassen. Wenn sie 17 sind, wie unsere Olivia, setzen sie sich nicht mehr beim Vater auf den Schoß, um gestreichelt zu werden. Da besteht die Zuwendung aber darin, dass das Kind auch einmal die Chance erhält, sich im Elternhaus ein bisschen Spaß zu machen. Das gehört zum Abnabeln und hält die Seele gesund. Es kommen außerdem nur Jungen aus guter Familie und keine Vorstadtrüpel, wie meine Frau selbst festgestellt hat.
Deswegen der Krach, das dröhnende Inferno! Ich bin geflohen. Im Garten habe ich nur Bäume mit Lampions und Girlanden, ein händchenhaltendes Pärchen und niemand beim Knutschen gesehen. Ehrlich gesagt, mich interessiert es auch nicht, ob Olivia mit einem Schwarzen knutscht oder mit Till, der bei ihr gerade en vogue ist, solange der Schwarze von einer guten Schule kommt. Mein Gott, dieser Krach, mir pfeifen jetzt noch die Ohren.
Diese New kids on the block-Generation hat uns gegenüber noch ein paar Dezibel draufgelegt. Mir persönlich sagt diese Musik nichts, aber sie hat was, irgendwas hat sie, doch der Krach stört mich beim Arbeiten. Dabei hätte ich ganz gerne mit einigen von den Kids geplaudert, die ich immerhin schon kenne, seit sie in den Windeln gesteckt haben. Erstaunlich, wie hübsch einige Mädchen geworden sind, nachdem sie ihre Zahnspangen nicht mehr benutzen. Ich weiß nicht, wie diese Schulmeister in den Internaten das aushalten, täglich diese immer verrückteren Frisuren, diese frischen Parfüms, diese offenen Gesichter mit ihrer weichen Haut. Schade, ich hätte mich gerne mit ein paar von ihnen unterhalten, denn man hat ja sonst keine Gelegenheit, dieser Generation einmal auf den Zahn zu fühlen. Aus Marktanalysen wissen wir zwar viel über die Lese- und Konsumgewohnheiten, doch der persönliche Eindruck wäre auch wichtig. Ich bin außerdem sicher, es plaudert sich netter mit einer 17-Jährigen als mit dem Psychologen, der die Marktanalyse vorträgt. Eine sorglose Gesellschaft, fröhlich, ein stürmisches Lebensgefühl, junge Menschen voll wilder Schönheit. Ich glaube, dass die jeunesse dorée sehr elitär ist und dieses Bewusstsein auch mitbringt. Wir werden erfahren, ob sie diesem Anspruch gerecht wird.
Zum Job: das Montagsmeeting. Ich habe den Kreis vergrößert, die Bereichsleiter zu ›Direktoren‹ ernannt, und ich hole sogar deren Stellvertreter mit dazu. Ich habe das Meeting auf 8.30 Uhr vorgezogen. Ich ließ die Manager und ihre Arbeitsbienen nicht warten, wie mein Vorgänger, der manche Unhöflichkeit für eine Prestigefrage hielt. Nein, ich ging sehr früh in die Konferenz, war als Erster da, begrüßte jeden mit einem Handschlag und einer persönlichen Bemerkung. Auch David Lentz.
Ich habe schon vor Beginn der Sitzung mitteilen lassen, dass ich Konzentration und Engagement verlange. Ich muss klare Akzente setzen, damit alle bereit sind für die Innovationen, die ich verlangen werde. Ein Zitat über eines meiner Vorbilder:
»Von denen, die von der ›Passion‹ des Führens durchdrungen sind, verlangt der Manager Merkle in seinem Prozess vor dem Landgericht Stuttgart eine innere Haltung, die den Führenden im Erfolg zügelt und vor Übermut bewahrt, im Misserfolg zum Durchhalten befähigt, und vor allem aber befähigt, der unteilbaren Verantwortung gerecht zu werden.«
Das sind Worte, dieser Mann bringt auf den Punkt, was wir wissen müssen. Ich habe dieses Zitat in meine Ansprache an die Teilnehmer des Meetings eingeflochten.
Der Alltag kann beginnen. Wir sind startklar. Der Vorstand und die Arbeitsbienen. Ich habe mich gesetzt und Lentz um ein Referat über die notwendigen Kreditaufnahmen gebeten, mich zurückgelehnt und zum Fenster hinaus gestarrt. Wieder ein sehr bewusster Moment!
Ein frühlingshafter Apriltag mit greller Sonne, die ein fast provencalisches Licht über die Stadt gießt. Aus dem Konferenzraum sehen wir in den Nordosten hinüber, blicken also mit der Morgensonne bis hinüber zum schmuddelig grünlichgrauen Dunst der Chemiefabriken. Die Atmosphäre in unserem Konferenzraum ist sonnendurchflutet und trotzdem kühl. Die Stadt zu unseren Füßen wirkt wie ein hyperrealistisches Panoramabild. Die Menschen, deren Gedanken und Meinungen wir von hier oben durch unsere Medien ein wenig beeinflussen und lenken, sehen wir nicht. Sie sind zu klein und als Individuum zu unwichtig. Das zum Beispiel verkennt mein Vater, aber er hat noch nie so hoch oben gesessen, buchstäblich und im übertragenen Sinne meine ich das. Er nimmt die Leute zu wichtig. Ich respektiere sie, das ist weniger anspruchsvoll, weniger wichtigtuerisch, dafür ehrlich. Die Menschen haben Gewaltiges geschaffen, deshalb muss man sie respektieren, nicht wegen ihrer Individualität. Als Einzelne langweilen sie mich meistens. Mir gelingt es aber, es mir nicht anmerken zu lassen.
Da saßen sie also, keiner wusste offiziell etwas von dem Plan für eine neue Zeitung. Ich hatte das mit Bellow so abgesprochen, ich wollte das Projekt im Führungskreis bekanntgeben. Aber natürlich sickern Gerüchte über das künftige Flaggschiff durch – so muss es auch sein. Ich habe der Präsentation meiner Ideen eine eigene Dramaturgie gegeben, die ich mit einer gewissen Lust, geradezu mit Genuss in ihrer Wirkung kontrolliert habe. Genauso wie man, eigentlich schon gesättigt, ein Dessert von der Löffelspitze nippt, genauso wie man eine Frau sehr langsam und genießerisch auszieht, um in erotische Stimmung zu kommen, genauso habe ich Schicht um Schicht meiner Pläne für einen großen Gesamtorganismus unserer Gruppe in der Tagesordnung abgearbeitet, bevor ich die Forderung nach dem Führungsanspruch in der Boulevardpresse formuliert habe. Ich habe ihnen wörtlich das Folgende gesagt:
»Ein Massenmedium an der Schwelle zum dritten Jahrtausend in einem der politisch mächtigsten, wirtschaftlich potentesten und kulturell traditionsreichsten Staaten dieser Erde muss anders aussehen als die Blätter der Konkurrenz, die ihr Gesicht, ihre redaktionelle Konzeption und ihre Philosophie auf die Nachkriegszeit, die 50er Jahre, zurückführen. Wir dürfen nicht den Fehler begehen, von Bestehendem auszugehen und weiterzuentwickeln. Ich weiß, das ist die Stärke der Japaner. Und die Japaner sind äußerst erfolgreich, weil sie nie versuchen, das Rad neu zu erfinden. Aber wenn es sein muss, erfinden sie das Rad noch einmal. Ich bin trotzdem sicher, die Japaner würden niemals ein altes Konzept aus den 50er Jahren weiterentwickeln; es gibt Grenzen für Vorbilder. Deswegen belasten wir dieses Projekt nicht mit Vergleichen und Traditionen. Wir dürfen die Entwicklung nicht mit Vorgaben stören, die wir aus dem Bauch heraus formulieren, weil wir sie gewohnt sind und Gewohntes für richtig erachten, weil wir (zumindest theoretisch) glauben zu wissen, wie ein solches Blatt aussehen soll. Ich schlage vor, die notwendige Entwicklungsredaktion durch nichts zu determinieren als durch den Auftrag, eine grundsätzlich neue Konzeption eines Boulevardblatts zu entwerfen. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns in diesem Meeting den Kopf darüber zu zerbrechen. Das ist Aufgabe der Entwicklungsredakteure. Unsere Pflicht ist es aber sehr wohl, diese Redakteure sorgfältig auszusuchen. Das ist es auch, was wir aufgrund unserer Kompetenz leisten können, meine Herren. Ich bitte um Vorschläge.«
Da kam Enttäuschung auf. Ich sah es ihren Gesichtern förmlich an. Jeder hatte angenommen, ich hätte ein fertiges Konzept von der Konkurrenz in der Tasche. Jeder, einschließlich Bellow war davon ausgegangen, ich brächte mehr als nur allgemeines Knowhow mit, wenn ich in dieses Haus hier zurückwechsle. Keiner hat diese Erwartung offen ausgesprochen, denn ohne Zweifel wäre es in einem solch konservativen Unternehmen als unfein empfunden worden, den neuen Vorsitzenden direkt danach zu fragen, ob er denn etwas über die Pläne der Konkurrenz weiß, oder gar so zu tun, als erwarte man ein Plagiat. Aber wie es so ist unter Menschen, sie sind menschlicher, als sie sich selbst eingestehen wollen. Jeder hat natürlich das Gerücht gehört, dass Horn bei der Konkurrenz ein tolles Boulevardblatt bis zur Nullnummer hat entwickeln lassen, das nur in der Schublade verschwunden ist, weil die übervorsichtigen Gesellschafter es für zu hart, zu aggressiv hielten. Erwartet man ein Plagiat? Natürlich!
Ich weidete mich an den forschenden Blicken.
Ich werde einen Teufel tun und auch nur ein Wort fallen lassen, das mit dem Eingemachten in Verbindung gebracht werden könnte. Ich ginge ein nicht unerhebliches Risiko ein, aber ich halte hier und heute auf diesem Tonband fest, dass ich der unerschütterlichen Überzeugung bin, dass dieses Risiko kalkulierbar ist, wenn ich nicht selbst die Stichworte für die konkrete Form des neuen Blattes liefere, sondern so lange entwickeln lasse, bis die Entwicklungsredaktion auf die richtige Konzeption gekommen ist. Ich bin geduldig. Ich beabsichtige nicht, mich kreuzigen zu lassen.
Das Problem mit der Verschwiegenheitsklausel werde ich im Griff behalten. Ich habe diese Vertragsbestimmung in meinem Vertrag mit der Konkurrenz damals blindlings unterschrieben, als ich in den Vorstand berufen wurde. Für mich war das damals kein Problem, weil ich nicht im Traum daran dachte, einmal in die Hofdruckerei zurückzukehren, um dort ein Boulevardblatt aufzumachen. Was ich unterschrieben habe, lautet wörtlich:
Herr Dr. Horn verpflichtet sich, über alle betrieblichen Vorgänge, die das Unternehmen betreffen, während seiner Tätigkeit im Vorstand sowie danach Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt insbesondere für Analysen und Strategien, für Projekte und Projektentwicklungen und den gesamten Bereich des Personalwesens.
Die Parteien dieser Vereinbarung sind sich darüber einig, dass es kein Wettbewerbsverbot darstellt, wenn Herr Dr. Horn sich zusätzlich verpflichtet, sich nach seinem Ausscheiden aus seiner Position bei Wettbewerbern des Vertragspartners nicht persönlich an der Entwicklungen von Projekten mit dem Knowhow zu beteiligen, das er sich in einem Unternehmen seines jetzigen Vertragspartners erworben hat, auch wenn das Projekt nicht geeignet ist, mit einem Produkt des Unternehmens in Konkurrenz zu treten.
Diese nicht ganz gebräuchliche Vertragsklausel wird aber, so hat mir mein Headhunter damals versichert, im Medienbereich gerne verwendet, um Streitereien über späteren Urheberschutz von Konzeptionen, an denen man mitgearbeitet hat, zu vermeiden. Jeder bei der Konkurrenz hatte damals diese Klausel akzeptiert, sogar der Vorstandsvorsitzende Zubahn, wie er mir einmal andeutete, warum nicht auch ich?
Selbstverständlich hatte ich mich vor meiner Zusage bei der MediaGlobal mit der erkennbaren Erwartungshaltung der Aktionäre und des Aufsichtsrats auseinandergesetzt. Ich schwankte. Logischerweise habe ich mich deshalb bei einem auf Medienrecht spezialisierten Anwalt beraten lassen, denn die Vertragsklausel hat noch einen kleinen Zusatz, der nicht ohne Delikatesse ist:
Herr Dr. Horn verpflichtet sich im Falle der Zuwiderhandlung zum Ersatz des dem Unternehmen entstehenden Schadens. Zur Beilegung evtl. Streitigkeiten in diesem Punkt unterwerfen sich die Parteien dem Schiedsgerichtsverfahren gemäß anliegender Schiedsgerichtsvereinbarung.
Kein Zweifel, so ein Schadensersatzprozess kann einen Mann ruinieren.
Der Anwalt bestätigte mir aber, dass ich als Manager jederzeit eine Boulevardzeitung herausbringen könne, juristische Probleme gäbe es allenfalls dann, wenn ich mich an der Entwicklung persönlich mit meinen konzeptionellen Erfahrungen von der Konkurrenz beteilige. Immerhin haben wir unter meiner Leitung dort zwei Projekte sehr konkret, das heißt bis zur Nullnummer entwickelt. Jenes, das ich schon erwähnte, war besonders attraktiv, noch wilder, noch peppiger und stark regionalisiert, Skandalorientiert, aggressiv. Daran hängt mein Herz immer noch. Ich habe nie begriffen, warum es im Tresor endete. Meine Spielräume für eine solche Konzeption bei MediaGlobal sind folglich beschränkt, wenn ich mich strikt an den Vertrag halte.
Aber ich sah Spielräume, die ich bei uns nutzen werde. Ich wollte die Grenzen austesten, wenn ich ehrlich bin. Deshalb habe ich das Angebot der MediaGlobal akzeptiert.
Ich habe nichts von dem kopiert und mitgenommen, was in den Stahlschränken meiner bisherigen Firma lagert, weil jedes Element in meinem Kopf reproduzierbar und abrufbar ist. Denn alles an dem geplanten Blatt war meine Kreation, die anderen haben nichts wirklich Substantielles beigesteuert. Deswegen ist es auch ungerecht, dass das Konzept für eine Zeitung des dritten Jahrtausends in einem Tresor verkommt. Das neue Blatt, das wir bei MediaGlobal herausbringen, wird dem entsprechen, oder es wird nicht erscheinen. Den Titel habe ich schon – seit langem übrigens:
STAR
Dieser Titel wäre meine Morgengabe gewesen, wenn die Konkurrenz das Blatt gebracht hätte, als ich noch im Vorstand saß. So ist er das Einzige geblieben, was ich völlig legal bei der MediaGlobal einbringe.
1.2 Befunde, allgemein-neurologische
Die Armneigereflexe sind seitengleich lebhaft auslösbar. Bauchhaut und Bauchdeckenreflexe bds. auslösbar. Beinneigereflexe sind seitengleich. Die Motorik ist allseits intakt. Kraftentwicklung seitengleich. Sensibilität orientierend seitengleich ohne reproduzierbare Ausfälle. Pallästhesie von 8/8 an beiden Vorfüßen. Sämtliche Koordinationsprüfungen sind auch mit geschlossenen Augen sicher. Finger-Nase- und Finger-Finger-Versuch sicher.
Insgesamt findet sich auf allgemein internistischem und orientierend neurologischem Gebiet kein Hinweis für gravierende Pathologika.
Nach seinen Angaben raucht der Explorand nicht und trinkt Alkohol nur in mäßigen Mengen.
*
Meine Frau hat Zweifel, Zweifel, Zweifel. Ich verstehe das nicht. Natürlich meint jede Mutter, sie verliert ihr Kind und damit eine wichtige Beziehung, wenn sie die eigene Tochter im Auto mit einem Jungen knutschen sieht. Aber man muss da durch.
Für Sibille ist das alles nicht so einfach, ich glaube, die Vorstellung, ihre Tochter läge mit einem dieser jungen Männer im Bett, bereitet Sibille physisches Unbehagen. Sie behauptet zwar, es sei kein Problem für sie, wenn unsere Tochter auf Streifzüge geht, um ihre sexuellen Erfahrungen zu machen. Sie insistiert sogar darauf, auch in diesem Punkt eine moderne Frau zu sein. Doch dazu spricht sie zu häufig und zu abfällig mit unserer Tochter über die Sexualität und umschlingt sich dabei gleichsam fröstelnd mit den Armen.
Olivia ist bisher den drängenden Fragen ihrer Mutter ausgewichen. Sibille rechtfertigt Nachforschungen geschickt, indem sie immer und immer wieder Sexualhygiene, Aids, Kondome, den ganzen Problemberg aus den Frauenillustrierten zum Anlass nimmt, Schnüffelfragen zu stellen und spießige Verhaltenskodizes aufzustellen – als ob die Kids nicht längst selbst mit allem besser umgehen könnten als unsere eigene Generation. Wo ist sie nur geblieben, unsere Wildheit von früher?
Dass Olivia mich ins Vertrauen zieht, dass wir, wenn wir uns schon irgendwann einmal sehen, konspirativ wie Geschwister darüber reden, wie es im Bett so zugeht, das weiß Sibille nicht. Das würde auch ihr Selbstbild zerstören; denn sie glaubt, sie sei eine verständnisvolle Mutter. In Wirklichkeit ist sie eifersüchtig wie ein Schulmädchen. Sie will durch ihre Affenliebe nur Abhängigkeit bei den Kindern erzeugen. Aber das funktioniert nicht. Man muss sie respektieren, die Kids, das stellt Bindungen her, allerdings von anderer Qualität als die zwischen der stillenden Mutter und ihrem Baby.
Natürlich hat Olivia ihre sexuellen Erfahrungen gemacht. Das muss so sein. Das muss auch unbelastet ablaufen. Lässt man den Kindern nicht den Freiraum, so paaren sie sich zur Not auch noch im Stehen hinter einem Busch an einer Autobahntankstelle. Ich habe schon sehr, sehr früh Olivia geraten, ihre erste Nacht mit einem Mann bewusst zu inszenieren, damit sie dieses wichtige Erlebnis auskosten und ihre Gefühle genießen kann. Sie ist rot geworden, wollte das Thema wechseln, aber ich habe insistiert und ihr doch ganz gut erklären können, warum es notwendig ist, mit mir über die erste Nacht mit einem Mann zu sprechen. Mein Beitrag zur Erziehung kann schließlich nicht im Bemuttern und Überwachen liegen, diesen Job führt Sibille mit Engagement aus, nein, mein Beitrag liegt im Raten und Beraten, im Steuern – und natürlich im Bezahlen. Ich fühle mich aber nicht als Vater, der sich mit Geld von familiären Verpflichtungen freikauft. Ich versuche nur, großzügig zu sein und nicht so geizig, wie mein Vater zu uns Jungen war. Er hat seinen hohen moralischen Anspruch immer mit finanzieller Kleinlichkeit gepaart, eine groteske Kombination. Ich will nicht solche lächerlichen Fehler bei der Erziehung machen.
Weil mein Bruder und ich die Schallplatten, die man damals unbedingt haben musste, nicht kaufen konnten, haben wir sie gestohlen. Weil wir es einigermaßen schlau einfädelten und Glück hatten, wurden wir nie erwischt. Insgeheim habe ich mir aber manchmal gewünscht, man würde uns verhaften und auf die Polizeiwache schleppen, damit uns der Alte auslösen müsste. Man muss sich das vorstellen: Der große Moraliker, zeitgenössische Philosoph und bedeutende linksliberale Intellektuelle, der sich so gerne in Zeitungen und in den Medien das ›Gewissen der Nation‹ nennen lässt, hat zwei Ladendiebe in die Welt gesetzt, besser: durch seine Erziehung dazu gebracht, kleine Defizite im Professorenhaushalt zu vermeiden und lieber klauen zu gehen.
Diese Ausflüge (ich glaube, es waren drei) waren nicht ohne eine seltsame innere Spannung, ohne Aufregung vor sich gegangen. Denn mein Bruder und ich waren uns nicht einig, wo wir die Platten klauen sollten. Dass wir stehlen würden, war gleich beschlossene Sache. Es gehört aber zu den abstrusen Ergebnissen der Erziehung durch unseren Vater, dass wir zwei Jungen uns Gedanken darüber machten, wer es im Grunde verdiente – ideologisch gesehen beklaut zu werden, ein großer, moderner Laden mit glänzender Fassade oder ein kleines Geschäft in der Altstadt. Wir entschlossen uns dann doch für einen kleinen Laden, dessen Besitzer auch so ein »Gewissen der Nation«-Typ war (bloß dabei nicht so erfolgreich wie mein Vater). Aber der große Händler, der eigentlich ›bestraft‹ werden sollte, beschäftigte effizient arbeitende Ladendetektive, die eine Freundin von uns kurz vor unserem ersten Coup erwischt hatten. Das schreckte ab. Es gelang uns in dem kleinen Geschäft mühelos, insgesamt acht Platten zu stehlen, die wir brüderlich geteilt haben. Ich habe mir die Jazzplatten genommen, mein Bruder die Rockplatten. Was wir nicht wissen konnten, als wir zum Stehlen ausrückten: Dem ›Gewissen der Nation‹-Mann haben wir persönlich keinen wirtschaftlichen Schaden zugefügt, weil er ohnehin drei Wochen nach unserem letzten unfreundlichen Besuch in Konkurs gegangen ist. Es klingt zynisch, ist aber so, wie ich sage.
Wieso soll ich mit einem jährlichen Gesamteinkommen (vor Steuern) von 1,3 Millionen Mark meine Kinder zum Diebstahl treiben? Dann zahle ich doch lieber das Büfett und setze es auf mein Spesenkonto in der Firma, denn unter den Jugendlichen sind genügend Kinder von Führungskräften, sie sind sogar selbst potentielle Führungskräfte, wenn man es genau nimmt, so dass der betriebliche Anlass klar ist.
Es ist gerade dieses Spesenkonto, das auf meine Frau eine gewisse Anziehungskraft ausübt. Sie stammt nicht aus reichem Hause, aber ihre Familie ist durchaus wohlhabend. Natürlich besitzt sie eine kleine Apanage, die Miete für eine größere Eigentumswohnung, die sie von ihren Eltern geschenkt bekommen hat. Ihr Einkommen behandelt sie sehr sorgfältig. Sie teilt es genau ein, um für die Kinder oder für mich oder für eine Freundin Geschenke zu kaufen. Vielleicht legt sie auch einen Teil an. Ich weiß das nicht. Ich nehme an, dass sie auch noch einige Papiere von ihren Eltern bekommen hat. Sie behandelt ihr kleines Vermögen wie ein großes Geheimnis. Dass sie gelegentlich, zumindest in Gedanken, mit einer Umschichtung ihrer Geldanlage spielt, weiß ich, weil sie mich schon ein paar Mal unter einem Vorwand nach einer vernünftigen Strategie gefragt hat.
Mein Geld ist für sie tabu. Sie erhält, was sie für den Haushalt und persönliche Ausgaben braucht. Ich halte Sibille finanziell keineswegs knapp (wie käme ich dazu?), aber sie hat einen fast schwäbischen Sinn für Sparsamkeit, gepaart mit dem Blick für Qualität, für die sich eine große Ausgabe lohnt. Sie ist immer sehr elegant gekleidet und bevorzugt nicht jenen konservativen Schick, der bei Managergattinen so verbreitet ist und diese älter macht, als sie sind. Belustigt habe ich neulich am Sonntagnachmittag eine Diskussion zwischen Mutter und Tochter über das Thema Rocklänge verfolgt. Die Positionen sind klar abgesteckt. Eine Einigung ist nicht möglich. Es war wie bei einer Tarifverhandlung, bei der kein Schlichter in Sicht ist. Ich werde mich natürlich nicht in solche Diskussionen einmischen, weil ich die jungen Mädchen mit den superkurzen knallengen Röcken und den schwarzen Nylons einfach frischer und sportlicher finde als die etwas weniger freizügige Linie.
Es gibt keine ausdrückliche Regelung für die Verwendung des Spesenkontos des Vorstandsvorsitzenden, und wegen der nun absehbar weiter steigenden Zahl von Repräsentationsterminen denke ich, dass es richtig war, meiner Frau einen Scheck für den Partyservice und den Einkauf zu geben, wenngleich ich ein schlechtes Gewissen dabei habe. Für sie ist die neue Rolle (wie sie verräterischerweise sagt, einer ›First Lady‹) sehr wichtig. Da die Kinder im Internat sind und wir jetzt ein Hausmädchen eingestellt haben, sucht sie sich eine Aufgabe; mehr denn je stürzt sie sich auf die gesellschaftlichen Verpflichtungen und verschafft mir dadurch den Freiraum, den ich für meine Arbeit brauche.
Lapidar: Je mehr Sibille mit Einladungen und Gästelisten beschäftigt ist, umso kürzer fasst sie sich bei ihren Telefonaten mit mir.
Die meisten gesellschaftlichen Termine sind ohnehin Unfug. Wenn ich nur auf dem Kalender vor mir die letzten beiden Wochen Revue passieren lasse! Alleine drei Empfänge mit politischem Hintergrund – das sind meistens die uninteressantesten Ereignisse, weil die Politiker für jeden ersichtlich nur vom Ehrgeiz getrieben sind, so dass sie über nichts anderes reden als über sich und das Management ihrer Macht. Sie nehmen für ihren Erfolg Torturen unglaublicher Art auf sich. Sie sitzen nächtelang in Hinterzimmern von Gaststätten bei Nominierungsversammlungen, reden stundenlang in Begegnungsstätten und Altenheimen, um ein paar Stimmen mehr zu bekommen. Sie sind für jeden Querulanten der ideale Ansprechpartner, sie stehen jederzeit zur Verfügung für die Diskussion eingebildeter Probleme. Hauptsache Wählerstimmen. Sind keine Wählerstimmen einzufangen, schlafen sie fast ein. Allenfalls die Aussicht auf eine Parteispende hält sie dann noch wach. Das alles färbt ab auf ihre Psyche und ihre Persönlichkeit.
Privat sind die meisten schlichte, einfältige Charaktere, Schwätzer zumal. Besondere Neigungen sind fast nicht erkennbar. Dazu sind sie zu ausgebrannt, wenn sie nicht im Rampenlicht stehen. Sie klagen über Wehwehchen und Gebrechen und darüber, dass sie nie Zeit haben, einmal richtig Urlaub zu machen. Einige saufen ganz ordentlich, fast alle hadern mit ihrem Leben. Und trotzdem treten sie nicht zurück und suchen sich was anderes.
Aber dann gibt es davorgeschoben jenes Bild in der Öffentlichkeit, jene Maske, die wir Medienhersteller ihnen verleihen. Zu oft hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich kenne einen Minister der Landesregierung, der Tag und Nacht an nichts anderes denkt als an seine Briefmarkensammlung und eigentlich Bundespostminister werden möchte (was er nie schaffen wird, weil er politisch zu qualifiziert ist für diesen Posten), wir feiern ihn als Kronprinzen des Ministerpräsidenten. Ich kenne eine Abgeordnete, die ihre Midlifecrisis nicht mit sporadischen Verhältnissen zu interessanten Männern bewältigt (was der normale Weg wäre), sondern in die Politik geraten ist, weil sie frigide ist. In der Presse gilt sie als aufopfernde Samariterin für Ausländerkinder. Und da sind noch die zahllosen Reihenhausbesitzer in den Parlamenten und Gemeinderäten, die Kleingewerbetreibenden, die vielen Lehrer und Juristen aus dem Beamtenstand, alle getrieben von der Gier nach Geltung und Macht, fast alle sind und bleiben Mittelmaß, obwohl die Zeitungen sie zu Helden der Nation stilisieren. Politiker sind grässlich, aber ich muss mit ihnen leben, deshalb erdulde ich die Termine mit ihnen.
Dann sehe ich in meinem Kalender, mit der steilen, sehr klaren Handschrift meiner Frau eingetragen, bis zu drei Verabredungen nach 19 Uhr an ein und demselben Abend, zu Geburtstagen und kleinen Essen mit Leuten, die mich kaum interessieren, da sie persönlich und geschäftlich zu unwichtig sind. Ich werde (wenn überhaupt) nur die späteren Termine wahrnehmen, weil ich vorher arbeiten muss. Nicht ohne Genugtuung hat mir meine Frau erzählt, dass unsere ›Freunde‹ (so nennt sie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf dem Parkett der Society) neuerdings deswegen dazu übergehen, einen späteren Zeitpunkt für Einladungen an uns zu bevorzugen.
Dann soll ich noch zu einem Bundesligaspiel und zu einer Buchpremiere, weil das Buch in unserem Verlag erscheint und der Autor ein prominenter Politiker ist. Und hier ist noch ein Vortrag bei der IHK (das Manuskript, das mein Assistent verfasst hat, habe ich noch gar nicht gelesen), – nur zwei der Termine, die ich jetzt beim Blättern sehe, würde ich wahrnehmen, wenn ich in meiner Entscheidung frei wäre. Ich würde mir im Kino (und nicht auf Kassette) ›Das Schweigen der Lämmer‹ ansehen, und natürlich muss ich zu der Eröffnung der Heckel-Retrospektive nach Berlin. Zwei Termine von, ich zähle gerade, von 34 in drei Wochen. Ich werde so viele wie möglich absagen lassen, denn davon lasse ich mich gewiss nicht auffressen.
Band eins, zweite Seite
Die Entwicklungsredaktion für das neue Blatt schleppt sich in endlosen Meetings dahin, wie ich es mir früher von Plan-Debatten in Sitzungen eines kommunistischen Zentralkomitees vorgestellt habe. Weil ich mich sehr zurückhalte, habe ich auch fast keinen Einfluss auf die Personalentscheidungen genommen. Ich habe aber gemahnt und habe vor Schöngeistern gewarnt. Die Boulevardpresse ist ein hartes und schnelles Geschäft. Für Opernliebhaber ist da kein Platz. Ich gebe zu, Schöngeister sind mir suspekt, weil sie mich zu oft an meinen Vater erinnern mit seiner Doppelzüngigkeit und seiner aufgesetzten moralinsauren Haltung.
Sie haben Renato Kaim, den abgehalfterten Chefredakteur einer Frauenpostille, berufen, der mit seiner norddeutschen Bierruhe und seinem bedächtigen »jo, jo, jo« jeden Impuls abtötet. Stolz hat er mir erzählt, er schreibe heimlich an einem Opernführer. Hat man ihn einmal in einer Konferenz erlebt, will man nur noch schlafen oder sich betrinken. Wenn der Mann wirklich ein Profil in seinem konservativkulturellen Umfeld entwickelt hätte, hätte er dort Karriere gemacht und nicht bei einer stinklangweiligen Modezeitschrift. Und dann gibt es noch ein funktionales Argument: Ein solcher Mann würde sich doch nicht mit seinem ganzen Engagement in die Arbeit bei einer Frauenillustrierten gestürzt haben, wenn seine Interessen beim Opernführer liegen. Ein Arzt, der musiziert, ein Ingenieur, der malt, das geht in meinen Augen vielleicht gerade noch so zusammen. Beruf und Hobby sind grundverschieden. Aber der Chefredakteur einer Frauenpostille muss sich doch eigentlich verheizt vorkommen, wenn er ein »Editorial« über die neue Linie der Herbstmode verfassen soll und dabei an seinen Opernführer denkt. Der falsche Mann am falschen Platz.
Um diese ›Führungsfigur‹ gruppieren sich Josef Herbach (Chefgraphiker unserer Blätter, kurz vor dem Pensionsalter), Hansjürgen Welder (Inhaber eines Redaktionsbüros, ich werde das Büro kaufen und ihn feuern), Renate Huller-Behrends (Vorzeigefrau des Konzerns, Gruppenleiterin Elektronische Medien, genauso egoistisch borniert, wie Vorzeigefrauen sein müssen, lebt im kompromissfreien Raum) und Otto Küstner (der ehemalige Ghostwriter unseres Ministerpräsidenten). Aber, wie gesagt, auch bei den Personalentscheidungen habe ich nicht hineingeredet. Dass das Boulevardblatt, das ich mir vorstelle, nichts mit den gängigen Vorbildern zu tun haben darf, hat niemand in dieser Redaktion verstanden. Sie beraten mehr über das Layout als über die Fragen der Konzeption, weil (Herr Originalgenie) Herbach die Gruppe mit seiner Geschwätzigkeit rücksichtslos dominiert.
Schiefer, unser Medienvorstand, der für das Projekt verantwortlich ist, muss mit diesen Leuten, die er sich ausgesucht hat, in fünf Wochen, gerechnet von heute, ein Ergebnis präsentieren. Das ist das Resultat eines Montagsmeetings, in dem ein anderer Wind wehte als bisher. Ich habe mir die Freiheit genommen, jeden der Anwesenden einer kurzen, aber pointierten Kritik zu unterwerfen. Lange Gesichter, feindselige Anspielungen, gegenseitige Beschuldigungen. Ich bin nicht der Chef geworden, um von allen geliebt zu werden. Ich habe die Aufgaben präzisiert. Lentz muss seinen Finanzplan für die zusammengefassten Imagekampagnen der Gruppe straffen und ausbauen, die Technik muss die Sanierungsvorschläge für den Rotationsdruck drei Wochen früher abliefern und Schiefer muss endlich mit dem Blatt überkommen. Es wird ihm schwerfallen. Denn langsam erkennt auch er, dass er keinen genuinen Boulevardpressemann in seiner Redaktion sitzen hat. Der Markt sei wie leergefegt, hat er geklagt. Nur mühselig hat sich Schiefer übrigens davon abbringen lassen, beim Headhunting nach Leuten fahnden zu lassen, die genau dem Klischee entsprechen, das Böll in seiner ›Katharina Blum‹ gezeichnet und Wallraff mit seinem Skandalreporter ›Esser‹ dem gierigen Publikum vorexerziert hat.
Wir brauchen Profis und keine Charakterschweine. Hoffentlich kapiert man das endlich! Und ich kann nicht persönlich eingreifen! Wie es mich juckt, sinnfällig zu demonstrieren, wie man bei der Konkurrenz ein Blatt macht!
Disput mit Lentz: Der Oberbuchhalter bemängelt die Kosten für die Entwicklungsredaktion. Es geht um Kleinigkeiten, die für ihn zum Hobby werden. Natürlich Reisespesen, natürlich Bewirtungskosten, natürlich – und ganz besonders – der Aufwand für zusätzliche Marktanalysen und Gutachten. dass dieser Mann es nicht verwunden hat, dass ich hier, wie man so schön sagt, der Boss bin, ist menschlich verständlich. Als Manager muss er aber die Entscheidung akzeptieren und wegstecken. Ich habe ihm dies in einem Vieraugengespräch gesagt, bevor er anfing zu rechnen.