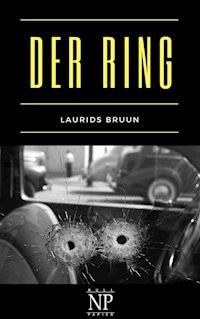
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Viktor Heller will eine junge Frau vor dem Leben in der Kriminalität bewahren, doch ihr "Onkel" hat etwas dagegen. Heller, bisher ein mustergültiger Bürger nutzt die gefundene Plakette eines Polizisten, um die Welt ein kleines Stück gerechter zu machen. Und immer wieder stellt sich die Frage: »Was ist ein Menschenleben?« Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laurids Bruun
Der Ring
Kriminalroman
Laurids Bruun
Der Ring
Kriminalroman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: n .n. EV: J. Engelhorns Nachf., Stuttgart, 1929 (286 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962813-98-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Krimis bei Null Papier
Der Frauenmörder
Eine Detektivin
Hemmungslos
Der Mann, der zu viel wusste
Noch mehr Detektivgeschichten
Sherlock Holmes – Sammlung
Eine Kriminalgeschichte & Das graue Haus in der Rue Richelieu
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Indische Kriminalerzählungen
Kriminalgeschichten
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
I
Drüben auf der Fensterreihe verlöscht die Glut. Die Sonne ist untergegangen.
Die Pappeln längs des Hügelkammes, wo die Chaussee läuft, ducken sich vor dem kalten Luftzug aus Osten. In der dünnen Luft blitzt ein Stern auf.
Der Spiegel des Flusses verblasst, die Ufer werden fahl. Der letzte Tagesschimmer verliert sich auf der Mitte des Stromes.
Der Mann, der auf dem Brückenkopf steht und ins Wasser hinunterstarrt, knöpft seinen Rock fester, denn von dem Wasserspiegel beginnen jetzt die Nebel aufzusteigen. Die Wirbel tief unten an den Brückenpfeilern sind bereits von Dunkelheit erfüllt, doch scheinen sie lauter zu rauschen, seit man sie nicht mehr sehen kann.
Der Mann geht längs des Kais auf die Stadt zu.
Die Laternen blitzen auf, zuerst die großen, fernen im Zentrum, dann die kleinen aus den Gassen und längs des Hafens.
Dort weiter hinten, wo der Kai in eine Straße übergeht, leuchtet über einer Tür ein rotes Schild. Ein Seidel, dessen Konturen von roten elektrischen Flammen gebildet werden, wirft seinen Schimmer auf einen vergoldeten Engel über der Tür.
Er erkennt den Ort wieder. Hier war er gestern Abend, hier, wo die Häuserreihen aufhören und Biergärten, kleinen Villen und Schuppen Platz machen. Gegen elf Uhr war es gewesen. – –
Es war ein merkwürdiger Abend, den er dort hinter dem Seidel und vergoldeten Engel verbrachte – der erste eindrucksvolle seit seiner Abreise aus Kopenhagen.
An dem alten verstimmten Klavier hatte ein blutjunges Mädchen gesessen – freimütig und aufrecht – mit einer spitzen roten Mütze auf dem Kopf.
Was hatte das Zigeunermädchen, wie sie genannt wurde, gespielt? Keine bekannte Melodie, keine Noten – von Frühjahr – Blätterrauschen – Vogelgezwitscher zwischen aufbrechenden Knospen – Geklingel von Straßenbahnen hatte sie gespielt, und mitten durch den Lärm ein dünner Diskant, eine hervorbrechende Träne – Erinnerungen eines Kindergemütes.
Hier blickte einer von seinem Bierkrug auf, als habe jemand hinter der Tür ihm zugerufen – dort drehte einer sich breit um und starrte mit offenem Munde –
Es war brechend voll gewesen. Rauch und Speisedunst hingen in Säcken unter den Kronleuchtern.
Im Nebel hinter dem Schenktisch eine dicke Büfettdame, Hals und Kragen entblößt. Seidel und Flaschen – Dunst aus der Küchenluke – der fette, weiße Hals und der Bierschaum die einzigen Lichtflecke im Nebel. Die Gläser warfen den Schein des Kronleuchters zurück.
Ein Oberkellner, mager, schmalschultrig, mit strammem Rücken und schlenkernden Gliedern, lief von Loge zu Loge, mit einem karierten Tuch über der Schulter. Lebhafte Rattenaugen in einem langen, gelblichen Gesicht, ein Nussknackerlächeln, dreckig liebenswürdig, ehrerbietig grimassierend –
»Sehr wohl, Herr! – Herrr – Herrrr!«
Er sah alles, hörte alles, tätschelte im Vorbeieilen das Rotkäppchen, das beim Anschlagen auf ihrem Taburett hüpfte.
Jemand rief »Valencia«.
Das Mädchen drehte den Kopf um – das dichte, kurze Haar flog bei der schnellen Bewegung – und was sah der Fremde?
Der Atem stockte ihm vor Verwunderung – er sah große erstaunte Kinderaugen, so leuchtend blau, wie er sie noch nie gesehen hatte, Wangen von weicher, unschuldiger Rundung – einen weißen Hals und ein rotes Seidenband, das irgend etwas Verborgenes unter dem Ausschnitt der salatgrünen Bluse trug. Die Brust noch kaum gerundet, auch der Arm unter dem Halbärmel noch ein Kinderarm, ohne Geschichte –
Und dieses Kind nickte mit unschuldsoffenem Blick all den Augen zu, die sie begehrlich anstarrten, Augen, die sich erfahren in die Tiefe des Kindergemütes einzuschleichen versuchten.
Ein Kriegsinvalide mit einem grünen Augenschirm legte den Kopf in den Nacken, schob den Schirm zurück, um ihr Augen zu machen, hob sein Seidel und bewegte die plumpen Lippen, feucht und rot, zu einer lüsternen Bitte.
Sie lachte, machte ihm auch Augen, ohne zu ahnen, um was er bat, noch was er begehrte.
In der Pause lud der Fremde sie zu einem Glase Bier in seiner Loge ein.
»Mein Onkel erlaubt es nicht!«
Ernst, mit treuherzigen Augen – ein artiges Mädchen – Konfirmandin mit einer Zigeunermütze auf dem dunklen, weichen Kinderhaar.
Jubel – Faustschläge auf den Tischen –
»Der Onkel erlaubt es nicht!«
Das Mädchen lachte mit. Sie warf den Kopf in den Nacken, dass das Haar ihr um die Ohren flog. Ein klingendes Lachen, das dem erstaunten Beobachter ans Herz griff.
Ein Kind mit der Haltung einer Erwachsenen. Das Leben klopfte stark und munter in ihr – das war das Geheimnis.
Der Mann mit dem Augenschirm kam aus seiner Loge, das Seidel in der Hand. Er wollte auf sie zugehen –
Im selben Augenblick aber war der Ober da. Ein Tablett in jeder Hand, das verzerrte Gesicht in komisch keusche Falten gelegt, einen Schelm in seinen Rattenaugen –
»Die ausgestellten Waren dürfen nicht berührt werden! Keine Flecke auf den weißen Decken, wenn ich bitten darf! Wollten Sie einen Foxtrott bestellen, mein Herr? – Fräulein Teresa, einen Foxtrott für den Herrn mit dem Augenschirm!«
Die Finger hüpfen über die Tasten, das Haar um die Ohren. Ihr Mund lächelte, während sie spielte, als ob die Luft rein, der Mensch gut und die Decke voller Lerchengezwitscher sei.
Lange saß der fremde Herr in seiner Loge. Man sah, dass er hier nicht hergehörte.
Einer blickte seine Schlipsnadel verstohlen an, ein andrer taxierte seinen Covercoatmantel –
Rheinländer war er jedenfalls nicht. Berliner? – Ausgeschlossen. Zivilist – Polizist in neuer Einkleidung? Während der Besatzung konnte man seiner Sache nie sicher sein. Die Engländer hatten ihre eigenen Lokale, ihre eigenen Methoden – hier durften ihre Soldaten nicht verkehren – und dort durften die Bürger der Stadt nicht verkehren. Doch kam es vor, dass in Zivil – hm, ja, vielleicht ein Engländer. Was ging’s einen an, man trank und schwatzte weiter.
Auch dem Mädchen auf dem Taburett war der Fremde aufgefallen, neugierig betrachtete sie ihn von der Seite – den feinen, weichen Hut – die Schlipsnadel –
Als die Uhr an der Wand elf schlug, erschien der dicknackige, kahlköpfige Onkel hinter dem Schenktisch.
Im Vorbeigehen strich er dem Zigeunermädchen mit seiner kleinen fetten Hand über die Mütze – wurde des Fremden ansichtig und machte dem Covercoatmantel und der Schlipsnadel eine Verbeugung, mit zusammengeklappten Hacken; beendete seine Runde und kehrte mit Nackenfalten hinter den Schenktisch zurück, sagte ein paar Worte zur Mamsell,1 die ehrerbietig und vertraulich nickte, und verschwand durch eine Seitentür.
*
Obgleich der Onkel es verboten hatte, gelang es dem Fremden dennoch, einige Worte mit dem Mädchen zu wechseln.
Die Musik war zu Ende. Sie stand auf, nahm die Mütze ab, ordnete das Haar, glättete ihre Schürze, zog die Bluse herunter –
»Schönen guten Abend!« sagte sie und knickste.
»Guten Abend!« wurde aus den Logen geantwortet, aber keine Zurufe, keine Vertraulichkeiten – die ehrbare Runde des Wirtes hatte Ordnung und Anstand bewirkt. Es war ein anständiges Haus, man kannte seine Leute. Ein Haus mit Justiz –
Als das Klavier geschlossen und der Bock beiseite gerückt war, trat das Rotkäppchen ans Fenster und guckte durch die Scheibengardinen auf die Straße.
Auf dem Rückwege zögerte sie vor der Loge des Fremden. Nestelte an ihrem roten Halsband, hob die feinen Brauen und spitzte die Lippen, als ob sie eine Frage stellen wollte –
Er bot ihr einen Platz an. Sie setzte sich auf die Kante des Stuhles.
Trinken wollte sie nichts – des Onkels wegen – nein, danke!
»Was tragen Sie an dem schönen Band, kleines Fräulein?« sagte er aufs Geratewohl.
Die runden, spitz zulaufenden Finger zupften an dem Band.
»Meinen Perlenring!« sagte sie lächelnd, über die Anrede »kleines Fräulein« erfreut.
Auch er lächelte.
»Von wem haben Sie ihn bekommen?«
»Von meiner Mutter – meiner ersten Mutter« – sie sah ihn ernst an, ohne Scheu, »er ist von einem Bischof gesegnet worden.«
Was sollte er noch sagen –?
»Darf ich ihn mal sehen?«
Sie schüttelte den Kopf und guckte auf das Band herab, ob es auch an seinem Platze säße.
»Warum nicht?«
»Ich muss gut auf ihn achtgeben – darf ihn niemandem zeigen.«
»Sie heißen Teresa?« Der Ober hatte ja gesagt: Fräulein Teresa, einen Foxtrott.
Sie hob die Brauen und nickte erstaunt. Strich darauf glättend über die Bluse, schob die Brust vor und sagte stolz: »Ich bin sechzehn Jahre alt.«
Er hatte gedacht vierzehn, und zeitig entwickelt. Statt dessen war es umgekehrt: sechzehn, aber Augen und Gemüt eines Kindes.
Er musterte sie noch einmal. Nur die Hände schienen erwachsen: Klavierhände.
»Wer hat Sie so spielen gelehrt? Ohne Noten – aus freier Fantasie?«
»Ich selbst.« Sie lachte mit ihrem klingenden, offenen Lachen. Darauf setzte sie sich bequemer zurecht, rückte ihm etwas näher.
»Ich bin in Italien geboren«, erzählte sie, »aber ich war immer krank, als ich klein war.«
Eine Lektion, die sie auswendig gelernt hat, dachte er bei sich.
Sie merkte ihm die Veränderung an, betrachtete ihn fest und fügte in einem klagenden Ton hinzu: »Ach, ich war so lange, lange krank –«
Sie entfernte erklärend die Hände voneinander, als ob sie an einem Gummiband zöge.
»Und als ich krank war, verlernte ich das Sprechen. Erst als ich vier Jahre alt war, konnte ich wieder sprechen. Darum –«
Sie zögerte und sah ihn an, die Augenbrauen aufmerksam zusammengezogen –
»Darum? – Was darum?«
Er versuchte ihre erklärenden Hände zu greifen, aber sie entschlüpften ihm.
Sie beugte sich ihm zu und sagte eifrig, mit gedämpfter Stimme: »Ich bin nicht so dumm und klein, wie Sie glauben. Wenn ich siebzehn Jahre alt werde, und das werde ich bald, dann komme ich in ein feines Lokal –«
Ihr Blick glitt über Logen und Wände, zu einem strahlend erleuchteten Saal mit vielen Spiegeln –
»Mit lauter kleinen Tischen und roten Lämpchen darauf – Herren mit ganz weißen Westen –« ihre Hände glitten erklärend über Brust und Bluse – »und Damen mit nackten Armen und gar nichts auf dem Halse außer Perlen, und Steine im Haar, die von selbst leuchten.«
Sie hüpfte auf ihrem Stuhl, während die großen Augen in den strahlenden Saal blickten.
Ihre Wangen glühten, die Lippen waren geöffnet –
»Ich soll auch so aussehen und mit den feinen weißen Herren essen, und dann darf ich auch trinken. Denn wenn man siebzehn Jahre alt ist, dann ist man erwachsen, und dann darf man trinken und sich amüsieren. Das sagt Walther.«
»Wer ist Walther?«
»Das ist ja unser Ober. Und der wird mit Wein und Gläsern herumgehen und uns bedienen.«
Sie zeigte, wie er das große Tablett auf gespreizten Fingern balancieren würde.
Dabei lachte sie vor sich hin, als ob sie allein sei. Strahlend schweifte ihr Blick hierhin und dorthin –
»Und ich soll bei Walther wohnen, und er will so gut, so gut zu mir sein, ich kann alles zu essen bekommen, was ich haben will, und morgens so lange schlafen, wie ich mag –«
Sie hielt inne, indem ihr das Blut in die Wangen stieg, griff sich an den Mund und sah sich ängstlich um.
»Himmel, ich hab’ mich verplappert. Sie dürfen es nicht weitersagen«, bat sie erschrocken.
Er versprach es. Als er den Ober mit dem verzerrten Gesicht suchte, traf ihn der Blick der funkelnden Augen.
»Was aber sagt Ihr Onkel dazu?«
Sie richtete sich auf und sagte mit einer Stimme, aus der ein andrer sprach: »Ach, der ist so alt. Es ist Sünde, ihm etwas davon zu sagen.«
»Und der Perlenring, den Sie niemandem zeigen dürfen? Wie wollen Sie den verbergen, wenn Sie einen entblößten Hals haben, wie die feinen Damen?«
Sie zögerte und warf ihm einen prüfenden Blick zu.
»Wir werden uns wohl nie wiedersehen?«
Er schüttelte den Kopf, erstaunt, zögernd –
»Na, dann will ich es Ihnen sagen. Ich werde ihn in meinem linken Strumpf verstecken«, flüsterte sie.
Erstaunt, prüfend beugte er sich vor und sagte flüsternd wie sie: »Das hat Walther Ihnen wohl geraten?«
»Woher wissen Sie das?« fragte sie erstaunt.
»Als Sie ihm den Ring gezeigt haben – nicht?«
Sie schüttelte energisch den Kopf und flüsterte: »Aber ich habe versprochen, ihm den Ring zu zeigen, wenn ich siebzehn Jahre alt geworden bin, weil er so gut zu mir sein will. Und wenn es im Strumpf nicht geht, dann will er ihn für mich aufbewahren.«
In einer plötzlichen Eingebung beugte der Fremde sich vor, legte seine Hand über die ihre und flüsterte: »Zeigen Sie ihm Ihren Ring nicht – vertrauen Sie ihn ihm nicht an, und gehen Sie nicht allein mit ihm aus!«
Erst hinterher war er sich klar darüber, was er gesagt hatte. Im selben Augenblick fühlte er sich beobachtet, und als er aufblickte, sah er den Ober in der nächsten Loge; er wischte den Tisch ab, wo die Gäste soeben aufgebrochen waren.
Der Fremde rief ihn, er wollte bezahlen.
»Sehr wohl, Herr!«
Walther erschien, blinzelnd, lärmend.
Er bekam einen größeren Schein und ging damit zur Kasse, um ihn zu wechseln.
Der Fremde beugte sich vor und sah dem Mädchen fest in die Augen, damit seine Worte auf ihr einfältiges Gemüt Eindruck machten: »Wenn er fragt, wovon wir gesprochen haben, dann sage: von Musik, von nichts anderm. Hast du verstanden?«
Das Du war ihm entschlüpft – er wollte es berichtigen, unterließ es aber.
Sie nickte mit großen Augen – tief, blau, verständnislos.
»Do you speak English?« fragte er den Ober, als er mit dem gewechselten Geld kam.
»Yes, Sir, a bit.«
Der Ober wurde mitteilsam, er habe Englisch gelernt, als er vor dem Kriege in London Kellner gewesen sei.
Dann sprach der Fremde von dem Mädchen, es sei ein Wunderkind! Wenn sie etwas lernte, könnte sie es weit bringen. Er verstehe sich darauf. Er sei Musiker von Fach.
Schließlich gab er ein gutes Trinkgeld.
»Geben Sie gut auf das Mädchen acht!« sagte er und sah dem Ober fest ins Auge, als er sich erhob.
»Der Onkel wird schon auf sie achtgeben!« sagte der Ober, verzog seine tiefen Backenfalten und blinzelte mit den Rattenaugen.
»Good night, Sir!« Eine tiefe Verbeugung in der Tür.
Ein Erlebnis – das erste auf seiner Wallfahrt.
»Die Perle im Schweinetrog«, wollte er es in seinem Tagebuch nennen.
Der Fremde auf dem Kai überlegte.
Sollte er heute Abend wieder hingehen? Vielleicht mehr erfahren – zum Beispiel, warum sie Zigeunermädchen genannt wurde?
Im selben Augenblick wurde die Tür unter dem vergoldeten Engel von drinnen geöffnet.
Zwei biedere Bürger traten auf die menschenleere Straße. Der Wirt öffnete ihnen selbst die Tür. Bevor sie gingen, wechselten sie noch einige hastige Worte mit ihm.
Der Onkel blieb in der Tür stehen und blickte ihnen nach, bis die kalte Abendluft ihn hineintrieb.
Biedere Leute mit breitkrempigen Hüten, Schnurrbärten.
Plötzlich trat der eine in einen Torweg, ohne den Hut zu lüften oder sich zu verabschieden, während der andre über die menschenleere Landstraße blickte, die dem Flusse folgte, so weit das Auge reichte.
Seltsames Benehmen – Viktor Heller wurde aufmerksam –
Während der eine sich der Brücke näherte, wo er auf dem Kai stand, fasste der andre im Tor Posten und behielt die Straße, die auf die Stadt zuführte, im Auge.
Der erstere hatte Viktor Heller erreicht –
»Entschuldigen Sie, mein Herr«, sagte er, »sind Sie soeben über die Brücke gegangen?«
»Ja.«
»Ist Ihnen vielleicht zufällig dieser Herr hier begegnet?«
Ohne seinen Blick von der Landstraße zu wenden, zog er eine Fotografie aus der Tasche, die einen Herrn im dunklen Ulster2 mit einer Sportmütze zeigte, einem langen, bartlosen Gesicht mit tiefen Falten.
»Hugo Walther« stand unter der Fotografie, mit vielen überflüssigen Schwängen.
»Polizei!« fügte er diskret hinzu und zog mit der anderen Hand ein kleines rundes Messingschild aus seiner Futtertasche.
Viktor sah gleich, wen das Bild vorstellte.
»Das ist der Ober aus dem ›Goldenen Engel‹ drüben. Ich war gestern Abend da.«
»Ich weiß«, sagte der Beamte freundlich, »wir sind ihm auf der Spur – es handelt sich um eine Falschspielerbande.«
»Dort im Wirtshaus?« sagte Viktor erstaunt.
Der Polizist schüttelte lächelnd den Kopf.
»Dort nicht, im Wirtshaus ›Zum Kuckuck‹ im Martin-Viertel, nach der Polizeistunde. Er hätte schon vor einer Stunde auf seinem Posten sein müssen, hat aber wohl Fährte gerochen und sich unsichtbar gemacht. Und das Mädchen – hübsches Ding, die Nichte des Wirts, ist auch nirgends zu finden.«
Viktor fuhr zusammen. Er wollte erzählen, was er gestern erfahren hatte –
Der Beamte aber berührte abwesend seinen Arm: »Einen Augenblick.«
Er war einen Schritt beiseite getreten und streckte den Kopf spähend vor, wie ein Jagdhund, der Fährte hat.
Der Fremde folgte der Richtung seines Blickes und entdeckte in der blassen Dämmerung, weit hinten, aber auf demselben Fußsteig, einen Mann und eine Frau, die im eifrigen Gespräch auf sie zukamen. Der Mann gestikulierte erklärend mit dem rechten Arm, mit dem linken schien er die Frau zurückhalten zu wollen. Ihre hellen Strümpfe guckten unter dem dunklen Mantel hervor, der ihr etwas über die Knie reichte, und sie trippelte wie ein Kind, das sich sträubt.
Viktor konnte das Paar kaum unterscheiden; an dem Profil des Jägers aber sah er, dass es das Wild sei –
Nach der Tasche tastend, steckte der Polizist Bild und Schild wieder zu sich, während er auf jede Bewegung des Wildes, des Paares dort hinten, achtete und es näher herankommen ließ.
Plötzlich wandte er sich Viktor Heller zu, fasste ihn am Mantelknopf, redete irgend etwas, schlug den Kragen hoch – die Abendluft sei kalt – machte eine Bewegung, als ob er ihn zu einem Abendspaziergang unterm Arm fassen wollte; aus den Augenwinkeln aber beobachtete er das Paar unausgesetzt –
»Der Kerl hat Wind von mir bekommen«, erklärte er, beugte sich herab und legte seine Hände auf Hellers Schultern, als ob sie im vertraulichen Gespräch stünden, und flüsterte: »Es kommt darauf an, wer die schärfsten Augen hat. – Sehen Sie nicht dorthin!« kommandierte er plötzlich, sprungbereit –
Ein Angstschrei – der eines Kindes –
Heller sah nur noch einen Schimmer von den hellen Beinen – dann war das Paar hinter der Pappelreihe verschwunden.
Der Pfiff aus einer Polizeipfeife, gedämpft, aber durchdringend – und in der nächsten Sekunde, als der Beamte bereits hinter ihnen her war, kam auch der Kamerad aus dem Torweg an Heller vorbei.
Unwillkürlich begann auch Heller sich in Bewegung zu setzen. Dann aber fasste er sich. Was ging’s ihn an?
Der Beamte lief den Abhang bis zum Flussufer hinab, ganz bis ans Wasser –
Hatte er nicht das Paar unten am Flussufer gesehen, dort, wo ein leerer Sandprahm lag –?
Viktor sah den Polizisten nach – der Mann aus dem Torweg setzte mit einem flotten Sprung über eine Barriere, der andre kroch unten durch. Sie liefen wie Wettläufer, blieben einen Augenblick spähend stehen und liefen wieder weiter.
Das Paar war nicht mehr zu sehen. Auch die beiden Beamten waren plötzlich wie von der Erde verschwunden.
Ein Tunnel scheint unter der Landstraße durchzuführen, dachte Heller, denn der Abhang zog sich ohne Biegung hin, so weit das Auge reichte.
Er verharrte noch eine Weile und betrachtete die Leute, die, durch Polizeiflöte und Laufschritte herbeigerufen, aus kleinen Häusern und Schuppen kamen.
Sie reckten die Hälse, ließen einige grobe Worte fallen und gingen wieder hinein.
»Arme kleine Zigeunerin!« seufzte er, während er zu der Brücke zurückkehrte, wo der Polizist ihn angeredet hatte, »wie wird es der einfältigen Seele mit ihrem Perlenring ergehen?«
Er atmete schwer und ballte die Hände in der Tasche.
Wie konnte er den Schurken fassen? Nicht durch die Polizei: Verhör und Urteil – bitte, so und so viele Tage Gefängnis, und wenn sie überstanden waren, fing die Geschichte von vorn an. Was kümmerte die Polizei die Zukunft eines armen kleinen einfältigen Mädchens, wenn nur die Paragrafen nicht übertreten wurden. Siebzehn Jahre, bitte, Herr Verführer, freier Zutritt für jeden – geht uns nichts an.
Nein, den Kerl persönlich beim Kragen fassen und das Tier unschädlich machen!
Er beugte den Kopf in dem Gefühl seiner Ohnmacht und stieß den Stock hart zur Erde –
Da sind die Strafgesetze, die Vorschriften – das übrige geht niemanden etwas an.
Sein Blick wurde von etwas Blitzendem auf der Erde angezogen –
Das Polizeischild – das kleine, runde Messingschild mit dem Stempel lag auf der Erde und blitzte.
Er bückte sich und nahm es auf.
Wahrscheinlich war es daneben geglitten, als der Beamte es in die Tasche stecken wollte, während er auf das Wild achtgab.
Heller wendete und drehte es in der Hand und blickte dann die Landstraße hinab. Von den Beamten war keine Spur zu sehen noch zu hören – und dunkel war es inzwischen auch geworden.
Er musste sich also mit seinem Fund zur nächsten Polizeiwache begeben. Und während er das Schild in die Tasche steckte, machte er sich auf den Weg zur Stadt.
Er war noch nicht weit gegangen, als er plötzlich stehen blieb. Eine Eingebung war ihm gekommen, die sein Herz schneller schlagen machte. Das Messingschild brannte ihm unter der Hand, die er darauf gepresst hielt. Wahrhaftig, die Versuchung war groß –
Welche –?
Nun, er wollte versuchen, ein kleines einfältiges und hilfloses Mädchen mit ihrem Perlenring, der von einem Bischof gesegnet war, zu retten.
War es nicht nur eine Frage von Zeit und Geld, Spürsinn und – ja eben, von einem Polizeischild?
Er war bis heutigen Tages ein Stubengelehrter, ein Bücherwurm, ein Akademiker gewesen, der sich einen Professortitel erwerben wollte auf dem Gebiet der Wechselwirkung zwischen den ethischen Kategorien und der historisch entwickelten, modernen Kultur. Er war in die Welt hinausgereist, um das Leben aus nächster Nähe kennenzulernen.
War ihm hier nun nicht ein typischer Fall in den Weg gekommen, ein Spiel zwischen Staatsgewalt und Verbrechertum, bei dem die bürgerliche Gesetzesübertretung in keinem Verhältnis zu der Nichtachtung ethischer Werte stand?
Wie oft hatte er in Machtlosigkeit den Kopf gebeugt, weil er nicht die Möglichkeit besaß, mit dem Stoff in persönliche Berührung zu kommen, weil für ihn die Tür des Laboratoriums verschlossen war – und plötzlich lag der Schlüssel zu seinen Füßen und blitzte zu ihm auf!
»Dies Schild habe ich bis auf weiteres nötig«, sagte er sich selbst, fest entschlossen, und knöpfte seinen Mantel fester.
Seit seinem zehnten Jahre hatte er beinahe täglich Deutsch gesprochen, die Sprache würde ihm keine Schwierigkeiten machen. Die schwierigste Aufgabe lag darin, den Handhabern des Gesetzes aus dem Wege zu gehen.
»Denn ich begehe hiermit ein Verbrechen, eine bürgerliche Gesetzesübertretung, deren Folgen ich im Augenblick nicht zu übersehen vermag.«
Auf eigene Gefahr, dachte er schließlich, und erleichtert, froh über seinen Entschluss, kehrte er zur Stadt zurück.
Berufsbezeichnung; meist Hausgehilfin <<<
eine Form von Mänteln <<<
II
Viktor Heller hatte das Licht der Welt in Kopenhagen erblickt.
Arnold, ein junger Dichter ohne Publikum, und Nanna, seine Geliebte, nicht aber seine angetraute Frau, trugen die Verantwortung für seinen Eintritt in die Welt.
Ein freudiges Ereignis war es just nicht gewesen, obgleich er in Liebe gezeugt worden war, Liebe aber genügt nicht immer, jedenfalls genügte sie nicht der Familie der jungen Leute. Und da sie kein Paar werden konnten, jedenfalls nicht rechtzeitig, betrachtete man das Ereignis als einen Skandal und das Kind als ein Zeichen des Ärgernisses.
Es war noch in alten Zeiten, lange vor dem Kriege, und zu verwundern wäre es nicht gewesen, wenn der Junge nicht gedeihen wollte oder auf andre Weise von seiner Herkunft gedrückt worden wäre. Aber im Gegenteil, das Kind wog acht und ein halbes Pfund bei seiner Geburt, gedieh vortrefflich, hatte schöne blaue Augen und war überhaupt so selbstherrlich wie nur irgend ein legitimer Sprößling; ein Triumph der Liebe durch und durch.
Ehrbare Leute konnten gar nicht anders, sie mussten ihm verzeihen; und die Entrüstung wäre höchstwahrscheinlich in Vergessenheit geraten, wenn die Eltern sich nicht ganz unerhört benommen hätten. Sie wollten nichts davon wissen, dass seine Existenz mit Diskretion behandelt wurde. Im Gegenteil, sie zeigten ihn bei helligem Tage auf Straßen und Gassen, prahlten mit ihm – sie ertrotzten ihm geradezu einen Platz in der Sonne.
Leben aber mussten sie alle drei; und da die Einnahmen für Arnolds Verse und Prosa sehr spärlich flossen, sahen sie sich gezwungen, bei der Familie Hilfe zu suchen.
Es wurde ein harter, bitterer, demütigender Kampf, der damit endete, dass Arnold, als er das Honorar für seinen ersten großen Roman ausbezahlt bekam, sich kopfüber zu einer Luft- und Landveränderung entschloss.
Mit so wenig Vorbereitungen wie möglich verließen sie die heimatlichen Gefilde und ruhten nicht, bevor sie das Zimmer in der Ripetta von Rom in Besitz genommen hatten, das ein Freund und Bruder in Apoll ihnen ausgesucht hatte.
Damals war Viktor zwei und ein halbes Jahr alt. Seiner Mutter erinnerte er sich nur dunkel.
Was bewahrt ein Kind von derjenigen, die ihn getragen hat, wenn es schon in seinem sechsten Lebensjahr ihren Armen entrissen wird?
So lange, nicht länger – für sie vielleicht lange genug – hatte die Liebe zu Arnold in ihrem Herzen Raum gehabt.
Der Dichter hatte es versäumt, ihre Liebe zu nähren – Kinder seines Gehirns, unter seinem Herzen ausgetragen, ohne Hände, die greifen konnten, doch stark genug, um die Lebenden zu verdrängen, hatten ihren Platz eingenommen.
Eifersucht, Streit und Jammer, Versöhnung und Trotz.
Viktor hatte nie recht begriffen, was eigentlich geschehen war. Er erinnerte sich nur, dass seine Mutter eines Tages nicht zu Hause war. Sein Vater hatte ihm, mit Tränen im Auge, eine undeutliche Erklärung gegeben, von einer langen Reise oder dergleichen, genug, er begriff, dass nicht mehr von ihr gesprochen werden sollte. Sie war und blieb fort – und, nachdem der erste tiefe Schmerz sich gegeben hatte, war sie auch aus seinem Leben verschwunden.
In den hinterlassenen Tagebuchblättern seines Vaters, die sein Pflegevater ihm an seinem achtzehnten Geburtstag übergeben hatte, stand unter dem Datum 2. Februar: Heute hat Nanna mich und den Jungen verlassen, um zu … zu gehen. Ich trage die Schuld.
Hans Marquard – so hieß sein Pflegevater – war ein Maler aus dem Rheinland, gleichen Alters wie sein Vater und zur selben Zeit nach Rom gekommen. Sie lernten sich in der deutschen Künstlerkolonie kennen und waren vom ersten Tage an, bis der Tod sie trennte, Freunde.
Arnold füllte seinen Freund mit Dichterfantasien, als wäre er ein Heft mit unbeschriebenen Seiten, machte ihn trunken von der Begeisterung, die in ihm selbst glühte, bis die ehrlichen Augen des Malers sich in dem rotbäckigen, kerngesunden Gesicht weiteten und kugelrund wurden und er gestikulierend, mit linkischen Bewegungen, die Träume des Freundes, die noch in ihm lebten, wenn Arnold sie schon längst, andrer Himmelsflüge wegen, vergessen hatte – stümpernd in die Wirklichkeit umsetzen wollte.
Arnold pflegte ihn dann spöttisch von den Höhen, zu denen er ihn selbst hinaufgetrieben hatte, herunterzuholen, bis der Maler, des Wortes ungewandt, mit geschwollenem Kamm wie ein Puter sich körperlich zur Wehr setzte, groß und stark, wie er war.
Denn es war ihm nicht gegeben, zwei gereimte Zeilen nebeneinander zu setzen, geschweige Himmel und Erde miteinander zu vermählen. Seine Begabung bestand darin, treu wiederzugeben, was das Auge sah. Seine Bilder von dem Makkaroniesser und seiner Familie aus dem ländlichen Trattorie, von den Bokkaspielern im Schutze ehrwürdiger Ruinen – damals gab es noch Bokkaspieler und noch unberührte Ruinen in der ewigen Stadt – waren Kleinkunst von einer Glaubwürdigkeit, die keiner ihm streitig machte.
*
Onkel Hansi war stolz auf seine Pflegevaterwürde und nahm die Aufgabe sehr ernst. Manchen Nachmittag saßen sie, bis geschlossen wurde, an einem kühlen Ort auf dem Pincio und berieten über irgend ein schwieriges Aufsatzthema.
Vik – wie Onkel Hansi ihn nannte, »bis du ein ganzer Viktor1 geworden bist« – sprach drei Sprachen: seine Vater- und Muttersprache Dänisch, in der Schule und außer dem Hause sprach er wie ein Eingeborener Italienisch und mit seinem Pflegevater Deutsch, allerdings kein richtiges Hochdeutsch, denn Onkel Hansi hing noch immer etwas »Platt« aus seiner alten, gemütlichen Vaterstadt an, obgleich er im Umgang mit deutschen und skandinavischen Freunden sein Bestes getan hatte, es abzustreifen.
Wenn er zu Hause mit sich selbst sprach oder in Erregung geriet, entschlüpften ihm unversehens die possierlichsten Worte, über die der Junge sich totlachte und die er sich sofort aneignete.
Dann kam es wohl vor, dass Onkel Hansi, geehrt und mit einem Lächeln in den Augenwinkeln ihn fragte, was das für ein Kauderwelsch sei? – Er bäte um das richtige, herrliche Hochdeutsch, mit dem man weit kommen könnte, wenn man auch in einer anderen Sprache geboren sei.
Gewissenhaft, wie Onkel Hansi war, sorgte er dafür, dass Vik seine Muttersprache nicht vergaß. Denn es durfte nicht geschehen, dass der Junge die Bücher seines armen Vaters nicht lesen konnte! In ihnen könne man mehr Gold finden, behauptete er, als in den meisten Büchern, die in den Bücherschränken der guten Bürger ständen, und oft nicht mehr Gold enthielten, als auf dem Schnitt zu finden war.
Die dänische Zeitung, auf die Arnold abonniert gewesen war, ließ er weiter kommen, hielt den Knaben zum Lesen an und verschaffte ihm dänische Klassiker aus dem skandinavischen Verein. Hin und wieder versuchte er sich auch selbst durch ein Buch hindurchzuarbeiten, weil es dem Knaben Spaß machte, dabei sein Lehrer zu sein.
Marietta, die Tochter des Gemüsehändlers, bei dem sie schon zu Lebzeiten seiner Eltern gekauft hatten, war jetzt erwachsen.
Eines Tages, als er aus der Schule kam, stand sie in der Küche und lächelte: »Buon giorno, signorino!«
Die alte Dienerin, »Dolcissima – die sehr Sanfte«, in deren eingeschrumpften Brust die Stimme eines Mannes wohnte, war plötzlich erkrankt und einige Tage darauf nach einer Operation im Krankenhaus San Giacomo gestorben.
Mehrere Tage hatte Onkel Hansi selbst die Einkäufe gemacht, hatte beim Gemüsehändler Marietta gesehen und sich gewundert, wie groß und erwachsen sie geworden war; und im Handumdrehen hatte er sie gemietet, damit sie »die Sanfte« vertreten sollte.
Marietta war ein hübsches Mädchen. Die dunklen Augen lagen tief in dem schmalen Gesicht mit dem reinen, scharfgeschnittenen Profil. Der Blick war schelmisch und gleichzeitig scheu, sie hatte runde Schultern und eine zarte Brust. Sanft war sie, treu und fleißig.
Als Viktor einmal aus der Schule kam, saß sie in der Hucke, den Rücken gegen die Wand gelehnt, ein blaues Madonnentuch über dem schwarzen Haar, das Weiß des Gesichtes leuchtete und die Hände lagen flach im Schoß.
Onkel Hansi malte sie. »Madonna«, sagte er und winkte Viktor, dass er nicht stören sollte.
Als Mariettas Augen Viktors Blick begegneten, errötete sie.
Diese kleine lebensvolle Skizze hing noch über Marquards Bett, als er starb. Da Viktor sich auf die Reise begab, hatte er sie mitgenommen, zusammen mit dem Medaillon, das seiner Mutter Bild enthielt und das er von seinem Vater geerbt hatte.
Seit Marietta ins Haus gekommen, war eine Veränderung mit Onkel Hansi vorgegangen. Der unverbesserliche Junggeselle rasierte sich jeden Morgen, wusch sich die Hände zu allen Tageszeiten und interessierte sich für Schlipse.
Schließlich bestimmte er, dass Marietta nicht allein in der Küche essen sollte. Eines Tages sah Viktor zu seiner Verwunderung, dass sie sich nicht wie gewöhnlich entfernte, nachdem sie das Essen aufgetragen hatte, sondern fein angezogen an dem runden Tisch Platz nahm, wo für sie gedeckt war.
Was ihn aber mehr als die Veränderung wunderte, war die Tatsache, dass sie ganz ohne vorherige Rücksprache mit ihm vorgenommen war, denn Onkel Hansi pflegte nichts zu unternehmen, ohne es vorher lang und breit mit seinem Pflegesohn zu besprechen.
Marietta war nicht mehr so heiter wie sonst. Viktor neckte sie und fragte sie nach ihrem Bräutigam. Er wusste, dass der Gemüsehändler mit einem wohlhabenden Krugwirt draußen in der Kampagna, in der Nähe von Torre Spaccata, befreundet war und von ihm seine Waren bezog. Er sei wahrscheinlich von ihm abhängig, meinte Marquard, der sich mehr für das Leben ihrer Umgebung interessierte als Viktor.
Mariettas Eltern und der Krugwirt hatten, als sie noch klein war, verabredet, dass das hübsche Mädchen und ein Neffe des Krugwirtes sich heiraten sollten. Der Bruder des Wirtes war nach Korsika ausgewandert, wie so viele andre Luccheser, die von Livorno dorthin zogen, um die von den Korsikanern verachtete Landarbeit zu verrichten, und war auf der Insel geblieben. Einer von seinen Jungen war dem kinderlosen Onkel in der Kampagna zur Pflege überlassen und mit den Jahren ein wilder, sittenloser Bursche geworden. Marquard hatte sich mehrmals beim Essen, sogar in Mariettas Gegenwart, abfällig über ihn geäußert.
Nun meinte Viktor, dass der Bräutigam ihr Sorge machte, und er hatte sie in seiner Gedankenlosigkeit geneckt, bereute es aber gleich, als er merkte, wie nah es ihr ging.
Den nächsten Tag beim Mittagessen sah er zufällig, dass Onkel Hansis Hand wie tröstend über ihren Arm strich. Er sah sie unter der Berührung erbeben, und eine Ahnung stieg in ihm auf. Er schob sie von sich, wollte nichts davon wissen. Doch kehrten Gedanken wie: weißt du noch damals? Und was geschah doch an jenem Abend? häufiger und häufiger wieder. Viktor aber wollte nichts sehen, nichts wissen. Wenn Onkel Hansi nichts sagte, sollte er wohl nichts erfahren.
Eines Morgens war Marietta nicht da. Viktor musste um neun Uhr im Lyzeum sein, war abends vorher bei einem Kameraden gewesen, spät nach Hause gekommen und erwachte erst im letzten Augenblick. Seine Stiefel waren nicht geputzt, die Küche leer. Er kleidete sich schnell an, machte Kaffee, und nachdem er ihn eilig getrunken hatte, klopfte er bei Onkel Hansi an, um ihm zu sagen, dass Marietta nicht gekommen sei, dass aber der fertige Kaffee auf dem Ofenloch für ihn bereit stehe.
Marquard lag wach im Bette. Er antwortete nicht, sah Viktor nur von der Seite an; in seinem Blick aber hatte Viktor im Davoneilen gelesen, dass Mariettas Ausbleiben ihm nicht überraschend gekommen sei und dass er darauf vorbereitet war, dass sie nicht wiederkommen würde.
Und Marietta kam nicht.
Einige Monate verstrichen. Der Sommer verging, schwer, trocken, bis er schließlich seinen brennenden Griff lockerte.
Die Ferien waren zu Ende, wieder musste an die Zukunft gedacht werden; diesmal handelte es sich darum, wo er studieren sollte.
Sie überlegten es zusammen. Schnell wurde der Entschluss gefasst, und Viktor war bereits bei der Universität in Rom immatrikuliert, als Onkel Hansi einige Tage später zu ihm ins Zimmer trat und kurz und bündig erklärte, dass Viktor als Däne in Dänemark und nicht in Rom studieren sollte. Er sei überzeugt, wenn sein Vater gelebt hätte, wäre dies auch seine Auffassung gewesen.
Viktor sah erstaunt auf, und während er noch grübelte, was er darauf antworten sollte, sank Marquard müde auf den Sessel, der Arnold gehört hatte.
»Außerdem«, fuhr Marquard fort, ohne ihn anzusehen, »bin ich Roms müde – und –«
»Du bist doch nicht krank?« Viktors Hand strich weich über seinen Ärmel.
Marquard wandte sich ihm zu, legte seine große Hand auf Viktors, schwieg einen Augenblick, bis er seiner Bewegung Herr geworden war, und sagte dann auf seinem heimatlichen Platt: »Nein, nein, Vik, krank bin ich nicht. Aber du weißt, dass ich mich immer nach der Stadt gesehnt habe, woher dein Vater stammte. Es soll solch schöne Stadt sein, und es ist auch deine Vaterstadt. Hast du nicht auch Lust, sie zu sehen?«
Viktor nickte nachdenklich. Er begriff, dass Kopenhagen nur ein Vorwand sei – aber –
Marquard streichelte seine Hand, während er fortfuhr: »Siehst du«, er senkte Kopf und Stimme – »ich muss fort von hier, ich muss mal in eine ganz andre Umgebung, sonst verliere ich mich selbst. So steht es um mich, Vik. Frage nicht, ich habe meine Gründe.«
*
Zwei Jahre später wurde Viktor als Student an der Universität in Kopenhagen immatrikuliert.





























