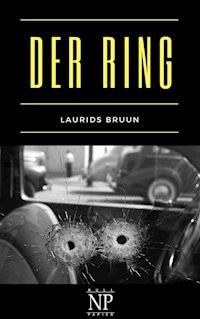Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Van-Zanten-Zyklus, eine Reihe von Abenteuerromanen und -erzählungen aus der Südsee, wurden inspiriert von der Zeit, die der Autor selbst als Einkäufer für das Handelshaus seines Onkels in Jakarta verbrachte. Dieser Sammelband enthält die folgenden Werke: Van Zantens glückliche Zeit Van Zantens Insel der Verheißung Van Zantens törichte Liebe Van Zantens wundersame Reise
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 907
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Van Zantens Erlebnisse
Laurids Bruun
Inhalt:
Laurids Bruun – Biografie und Bibliografie
Van Zantens glückliche Zeit
Vorwort
Beim König
Die Stadt erwacht
Die fliegenden Hunde
In der fremden Stadt
Ein Kawa-Rausch
Der Festtanz
Freie Liebe
Die Jungfraueinweihung
Eifersucht und Heiratsgedanken
Der weise Wahuja und die Freierei
Glückliche Tage
Der erste Kummer
Winawas böse Augen
Bei Kabua-Kenka im Hause der Geister
Ein Kind in Erwartung
Die freudlose Witwe und die Niederkunft
Eine glückliche Familie
Beim Wirbelsturm
Van Zantens Insel der Verheißung
Vorwort
Daniel und seine Freunde
Das große Tier
Für des Reeders Geld
Die Insel der Verheißung
Die Sonnenbrüder
Dem Unbekannten entgegen
Jakob Beer
Hendrik Koort
Daniel Hooch
Pieter Goy
Die erste Zusammenkunft
Eine herrliche Insel
Fleischesser
Räuber im Wald
Ums Wachtfeuer
»Die Natur«
Das Auge der Einsamkeit
Eine gemütliche Häuslichkeit
Das Genie Koort
Die poetischen Kristalle
Eva aus dem Meer
Pieter Goys Seelenstärke
Ein gutes und rechtdenkendes Weib
Der Segen der Einsamkeit
Das Fell des Bären
Heimweh
Pieter Goys mütterliches Erbe
Die Affen
Zu Hause
Van Zantens törichte Liebe
Vorwort
Pieter Adrian van Zantens Tagebuch vom 5. Oktober 1860 bis zum 23. August 1861
Van Zantens Abreise aus Amsterdam Ankunft und Erlebnisse in Batavia
Madan Blanchards Abenteuer
Van Zantens wundersame Reise
Die weite Reise
1. ›Kleine Sonne‹
2. Tokos Trost
3. Nadi-Nados Lehre von den höchsten Dingen
4. Die Hand und das Licht
5. Aussteuer und Abreise
Die Insel der Dämmerung
1. Am Strande der Chimären
2. Der Wald der Wahnschöpfung und die Dahingegangenen
3. Still – der Herrscher kommt!
4. Die Wespe mit der menschlichen Stimme
5. Das Fohlen in der Felsenhöhle
6. Der Giftstich und die Flucht
7. Die Höhle mit den lebenden Wänden
8. Im Zeichen der Entstellung
Die Zinneninsel im Nebelmeer
1. In der Gewalt der flackernden Winde
2. Der unterirdische Strom
3. Die Wache, der Turm und die wandernde Straße
4. Im Gemach der Königin
5. Nichts anderes in der Welt –
6. Die Gefängniszelle im Nebel
7. Das Kind und der Tod
8. Er, der sich ›Zünder‹ nannte
9. Durch den Berg, den unfruchtbaren und öden
10. Unter dem lebendigen Licht
11. Wirf Berg und Insel ins Meer!
Die Insel der schimmernden Höhen
1. Der Sternschnuppenregen und die verborgenen Riffe
2. Die Insel, die aus dem Meer emporstieg
3. Die Schar der Lichtgeister, ihr Wesen und ihr Schutz
4. Verirrte Schatten
5. Neuer Tag
Van Zantens Erlebnisse, L. Bruun
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849606428
www.jazzybee-verlag.de
Laurids Bruun – Biografie und Bibliografie
Dänischer Schriftsteller, geboren am 25. Juni 1864 in Odense, verstorben am 6. November 1935 in Kopenhagen. Begann 1881 ein Studium der Politik, das er 1887 abschloss. Bereits 1884 erscheint eine erste Novelle in der Zeitung "Morgenbladet", 1886 das Buch "Historier". Später zieht Bruun nach Jakarta (damals Batavia) in Indonesien, wo er für seinen Onkel als Einkäufer arbeitet. Seine vielen Reisen durch die ganze Welt waren die Grundlage für seine vielen erfolgreichen Abenteuer- und Reiseromane wie z.B. die Van Zanten-Reihe.
Wichtige Werke:
Die Krone, 1904
Der König aller Sünder, 1904
Die Mitternachtssonne, 1908
Van Zantens glückliche Zeit, 1911
Aus dem Geschlecht der Byge, 1918
Der unbekannte Gott, 1920
Eine seltsame Nacht, 1928
Van Zantens glückliche Zeit
Ein Liebesroman von der Insel Pelli
Vorwort
»Van Zantens glückliche Zeit, ein Liebesroman von der Insel Pelli«, so heißt in der Übersetzung der Titel eines Buches, das den Holländer Pieter Adrian van Zanten zum Verfasser hat, der am 3. Januar 1846 in Amsterdam geboren wurde und am 15. November 1904 an Lungenentzündung in einem Hotel in Paris, in der stillen Collegien- und Pensionsstraße Rue Notre-Dame-des-Champs, hinter dem Luxembourg-Garten, verstarb.
Das hinterlassene Manuskript ist teils auf holländisch, teils (von Kapitel X an) auf englisch geschrieben; und diese beiden Abschnitte bezeichnen, zufolge eines ebenfalls hinterlassenen Tagebuches, zwei verschiedene Zeitabschnitte, zwischen denen mindestens zehn Jahre liegen. Wahrscheinlich ist das letzte Kapitel als Abschluß abermals ein oder zwei Jahre später geschrieben worden, zu einem Zeitpunkt, wo der Verfasser eine Veröffentlichung des Manuskriptes als Buch plante, – eine Absicht, die er aus unbekannten Gründen später wieder aufgegeben hat.
Da sich in dem Tagebuche Andeutungen finden, daß der vorliegende Roman die einzige von van Zantens hinterlassenen Arbeiten ist, die er zu Lebzeiten bereits einmal herauszugeben gedachte, und da sie mit diesem Zweck vor Augen abgerundet und mit einem Titel versehen ist, so habe ich sie dazu ausersehen, van Zantens Debüt-Buch zu sein.
Ich will im nachfolgenden – teils durch Mitteilungen, die van Zanten mir persönlich gemacht hat, teils durch seine im Tagebuch niedergeschriebenen Aufzeichnungen – Rechenschaft davon ablegen, wer van Zanten war und wie ich, ein dänischer Schriftsteller, dazu komme, ihn in die Literatur einzuführen.
Ich schicke voraus, daß es sich hier weder um eine literarische Porträtzeichnung noch um meine subjektiven Eindrücke von seiner Persönlichkeit handeln soll – das gehört auf ein anderes Gebiet und wird vielleicht ein anderes Mal berührt werden –, sondern nur um positive Aufklärungen zur Einführung in ein seltenes und eigenartiges Buch, dessen Verfasser ein seltenes und eigenartiges Lebensschicksal gehabt hat.
Van Zantens Vater war ein wohlsituierter Instrumentenhändler in Amsterdam, dessen Frau frühzeitig starb, so daß der Sohn sich ihrer nur dunkel erinnerte.
Da der Vater fast den ganzen Tag in seinem Geschäft war, lag die Erziehung des Sohnes ganz und gar in den Händen der Haushälterin, einer strengen und wortkargen Person, die er nicht leiden konnte. Er hielt sich meistens für sich und streifte in seinen Freistunden am Hafen umher.
Als Adrian zwölf Jahre alt war, heiratete sein Vater die Haushälterin. Der Knabe nahm sich dies sehr zu Herzen und wurde auf seinen eigenen Wunsch gleich nach seiner Konfirmation zu einem Vetter seines Vaters geschickt, der eine große Faktorei in Batavia hatte, wo er im Kolonialhandel ausgebildet werden sollte.
Von seinen Lehrjahren in Batavia sind keine Aufzeichnungen vorhanden. Ich erinnere mich, daß van Zanten mir in Paris erzählte, daß er als junger Kommis ganz der Gesellschaft seiner Kameraden überlassen gewesen sei und daß sie ihn als erstes Kartenspielen und Whiskytrinken lehrten, daß er darauf einen heftigen Anfall von Klimafieber bekam und im Hause seiner Verwandten verpflegt wurde; und daß er nach seiner Genesung erst viele Jahre später in Europa wieder Whisky anrührte.
Ferner hat er einmal angedeutet, daß er seine erste tiefgehende Enttäuschung in ganz jungen Jahren erlebte, als eine sehr hübsche und gewandte Kusine (wahrscheinlich die Tochter seines Chefs), in die er hoffnungslos verliebt war, seine jugendlichen Gefühle zum besten hielt. Von dieser Enttäuschung rührt wahrscheinlich sein Widerwille gegen den Begriff »Dame« her, der in all seinen Arbeiten zu Worte kommt und dessen ich mich deutlich aus unseren Gesprächen erinnere. Es war eine seiner Lieblingsbehauptungen, daß die »wilde« Frau sowohl körperlich wie geistig weit höher stehe als die zivilisierte Europäerin, jedenfalls was die Frau der guten Gesellschaft in den Kolonien betrifft.
Van Zanten zeigte bereits in jungen Jahren die seltene Anlage, die Eingeborenen zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden. Er wollte nicht einsehen, daß sie geringer seien als er, und verkehrte darum auf gleichem Fuß mit ihnen, obgleich ihm dadurch manche Unannehmlichkeiten im Zusammenleben mit der von den Europäern verdorbenen Mischrasse erwuchsen, auf die er im Geschäftsleben hauptsächlich angewiesen war.
Um diese wertvolle Fähigkeit auszunutzen, die in der Stadt und im Hauptkontor eher Schaden anrichtete, wurde er von der Faktorei, noch bevor er die Zwanzig erreicht hatte, als selbständiger Einkäufer nach den Südsee-Inseln geschickt. Der Hauptversand der Faktorei bestand aus Kaffee und Gewürzen, und als Einkaufsorte wurden vorzugsweise solche Inseln gewählt, wo die Europäer den Eingeborenen noch keinen Begriff von dem Wert ihrer Naturprodukte gegeben und darum den Markt noch nicht »verdorben« hatten.
Van Zanten, dem die derbe Natürlichkeit der Holländer im Blut lag, kam während dieser Jahre der tropischen Inselnatur so nah, wie wohl kaum ein Europäer es vor oder nach ihm erreicht hat. Er erwarb sich eine genaue Kenntnis von dem Leben und der Denkweise der Mikronesier und Polynesier. Er hat mir oft gesagt, daß die Jahre, die er als einziger Weißer unter den Eingeborenen, hauptsächlich bei den Mikronesiern auf den Karolinen und Ladronen, verbrachte, die glücklichsten seines Lebens gewesen seien. Bezeichnend dafür ist der Titel des vorliegenden Buches.
Aus dem Tagebuch, das hin und wieder sehr kurz gefaßt ist und große Lücken aufweist, ist nicht deutlich zu ersehen, auf welchen Inseln und wie lange er auf jeder gelebt hat. Die Lücken im Tagebuch haben offenbar darin ihren Grund, daß es ihm in dem vollkommenen Naturdasein, das er jedesmal führte, wenn er allein zwischen den Eingeborenen lebte, an Schreibmaterial fehlte.
In den Aufzeichnungen wimmelt es von den Namen kleiner Inseln, die er mehr oder weniger flüchtig von einem festen Depot auf einer der größeren, bekannteren Inseln aus besucht hat. Es ist leider unmöglich gewesen, diese kleinen Inseln zu identifizieren, weil die Namen offenbar nach dem Laut der Benennung der Eingeborenen niedergeschrieben sind.
Nach Art von Tagebuchschreibern setzt er immer die Gegend als bekannt voraus. Auch die Daten sind sehr mangelhaft. An einigen Stellen sind sie ganz nach Art der Berechnung der Eingeborenen niedergeschrieben, unverständlich für den, der die Sprache nicht kennt. Er beschränkt sich darauf, wenn ihm kein Kalender zu Gebote steht, mit Monsum- oder Mondwechsel zu rechnen, wie die Eingeborenen es tun. Bisweilen steht sehr genau in längerer Reihenfolge zum Beispiel: Montag, den 3., Dienstag, den 4. und so weiter; aber sowohl den Monat wie die Jahreszahl muß man erraten.
Auf der Insel Yap, die zu den Karolinen gehört, hat er sich fünf Jahre als Depotchef aufgehalten. Im Januar 1872 schließt ein Abschnitt seines Tagebuches mit der Bemerkung, daß er Anweisung bekommen hat, nach Batavia zurückzukehren; da er aber nicht zurück will, beschließt er, seinen Abschied zu nehmen und die Pension zu verlangen, die ihm nach zehnjähriger Dienstzeit zukommt. Er will Tongu (siehe erstes Kapitel in dem vorliegenden Buch) nach seiner Heimatinsel begleiten, die – so schreibt er – ein wahres Paradies sein soll.
Daß er diesen Plan verwirklicht hat, geht aus dem vorliegenden Buch hervor, das von Tongus Insel handelt, die von den Eingeborenen Pelli genannt wird und wahrscheinlich zu den Pelew-Inseln gehört, die südöstlich von den Philippinen liegen, unter 6-8° nördlicher Breite. Auf dieser Insel verbrachte er, wenn man sich auf die Angaben in diesem Buch verlassen kann, über zwei Jahre, – eine glückliche Zeit, die mit der im letzten Kapitel des Buches geschilderten Katastrophe endigte, worauf er die Insel verließ. Mit Tongus und Tokos Hilfe glückte es ihm, nach Yap zu kommen, von wo er mit der ersten Schiffsgelegenheit nach Batavia zurückkehrte; aus dem Tagebuch ersieht man, daß er dann von neuem in den Dienst der Faktorei eintrat.
Während der Jahre, die er in Ruhe in Batavia verlebte, scheint der erste (der holländische) Teil dieser Erzählung geschrieben zu sein, in seiner »ästhetischen Periode«, von der er mir in Paris erzählte. Er führte ein Klubleben, las viel und begann zu schreiben mit der Absicht, als Schriftsteller aufzutreten. Aus unbekannten Gründen wurde diese Absicht wieder aufgegeben. Das Tagebuch zeigt, daß er sich von neuem aussenden ließ. Er wirkte als Depotchef und Einkäufer auf den Marschall- und Salomoninseln, war aber im Jahre 1880 abermals auf Java.
Da erhielt er 1882 einen Brief von seinem Vater, in dem er ihn bittet, nach Holland zurückzukehren. Der alte van Zanten hatte einen Anfall von Apoplexie gehabt, fühlte sein Ende herannahen und wollte seinen Sohn gern noch einmal sehen.
Van Zanten ordnete alles für seinen Aufbruch und reiste nach Europa. Bevor er aber Amsterdam erreichte, starb sein Vater.
Nach der Erbteilung mit der Witwe, die er nicht persönlich gesprochen zu haben scheint – das Tagebuch spricht nur von Briefen, die zwischen ihnen gewechselt wurden – verblieb ihm eine Erbschaft, die groß genug war, daß er den Rest seines Lebens sorglos als Rentier verbringen konnte.
Da er keine Erben hatte, kaufte er sich eine Leibrente und ließ sich in London nieder, wo er bis 1892 ein einsames und regelmäßiges Klubleben führte. In dieser Periode wurde der englische Teil des Romans geschrieben; und hier war es, wo er eine Zeitlang abermals den Gedanken erwog, als Schriftsteller aufzutreten.
Welche neuen Betrachtungen oder Erlebnisse diesen Plan abermals zu Wasser werden ließen, ist aus dem Tagebuch nicht zu ersehen. Kurze Zeit darauf aber befindet er sich in Paris; und nun beginnt ein unstetes Reiseleben, das, unterbrochen von jahrelangen Aufenthalten in Paris, London und Neapel, bis zu seinem Tode währte.
Ich traf van Zanten zum erstenmal in einem Pensionat in Bern im Winter 1895.
Drei Wochen lang wohnten wir Tür an Tür und aßen täglich am selben Tisch. Mein erster Eindruck von ihm war nicht günstig. Er war groß und stark, mit dichtem, rotblondem Haar und Vollbart; etwas träge in seinen Bewegungen und mit großen, blauen Augen, die – um einen Ausdruck von ihm selbst zu gebrauchen – einen eigenartig »entblößten« Ausdruck hatten.
Er erschien kalt und blasiert. Es belustigte ihn, seine Umgebung mit seiner Verachtung für europäische Zivilisation und europäische Frauen zu reizen.
Als er zufällig erfuhr, daß ich Schriftsteller sei, faßte er Interesse für mich; ohne mich damals ahnen zu lassen, daß er selbst schrieb, öffnete er mir sein Herz und erzählte zu meiner großen Freude unumwunden von seinem Leben auf den Südseeinseln.
Trotz seiner fünfzig Jahre erzählte er, wenn er in Schwung kam, außerordentlich jugendlich, und sein Zuhörer saß still lauschend dabei, ohne ihn durch Fragen zu unterbrechen. Munter, derb und gleichzeitig voll Gemüt erzählte er von seinen glücklichen Jahren, wie er sie nannte. Frisch und innig durchlebte er alles noch einmal in Gedanken, während er erzählte; oft mußte er innehalten, um seiner Bewegung Herr zu werden.
Vieles von dem, was er erzählte, war so neu und so erstaunlich, daß ich im stillen, trotz meines Interesses, die Hälfte für Reiseaufschneiderei hielt. Später aber, als ich ihn näher kennen lernte, sah ich ein, daß ich ihm unrecht getan hatte. Wahrheitsliebe und Widerwillen gegen alles Gemachte war tatsächlich ein tiefwurzelnder Charakterzug bei ihm. Später, in Paris, lernte ich in ihm einen der ursprünglichsten, in seiner Natürlichkeit ungebundensten Menschen kennen, der mir jemals in Dänemark und im Auslande begegnet ist.
Trotz des Altersunterschiedes wurden wir gute Freunde. Als ich Bern verließ, bat er mich um meine Adresse, benutzte sie aber nicht.
Es vergingen einige Jahre, und ich sah ihn an einem Januarabend im Jahre 1899 vor dem Café d'Harcourt auf dem Boulevard St. Michel im Quartier Latin wieder, wo er sich an dem munteren Nachtleben der Studenten ergötzte.
Wir musterten einander lange. Dann hob er sein Glas und nickte mir wiedererkennend zu; und ich eilte an seinen Tisch.
Von da an trafen wir uns jeden Abend bei Harcourt. Wie allen einsam lebenden Menschen, fiel es ihm schwer, sich zu begrenzen, wenn er erst einmal angefangen hatte zu erzählen. So sind wir viele Nachtstunden auf dem Boule-Miche hin und her gewandert, während er von den Südseeinseln erzählte, auf die er immer wieder zurückkam.
Er fühle sich nicht wohl in Europa, sagte er. Und wenn er seinem tiefen Heimweh nach den Inseln nicht Folge gab, so lag es wahrscheinlich daran, daß er eine Enttäuschung fürchtete, wenn er die Resultate der »Kulturarbeit« zu sehen bekäme, die seit seinen glücklichen Tagen durch die Europäer solch ungeheuren Aufschwung genommen hatte, besonders seit die Deutschen drüben festen Fuß gefaßt hatten.
Als ich ihn eines Abends auf seinem einsamen und tristen Hotelzimmer in der Rue Jacob besuchte, kamen wir auf Literatur zu sprechen, und ich redete ihm eindringlich zu, seine Erinnerungen niederzuschreiben. Da war es, daß er mir seine früheren literarischen Anfechtungen gestand, und mir seine ästhetische Periode in Batavia verriet, wo er »sowohl Verse wie Prosa fabrizierte«, und halb verlegen, halb selbstbewußt erzählte er von seinem Tagebuch und von Manuskripten, die er liegen hätte.
Ich fragte ihn, ob ich nicht einiges davon lesen dürfte. »Ja, nach meinem Tode!« sagte er und ging zu etwas anderem über.
Einige Abende danach erzählte er mir zum erstenmal von Ali, die die Hauptperson in dem vorliegenden Roman ist. Gedämpft und vorsichtig erzählte er, wie man eine Sache berührt, von der man eigentlich nicht hatte sprechen wollen.
Bevor ich ging, versuchte ich noch einmal ihn zu bewegen, mir etwas von seinem Manuskript zu zeigen.
»Ja, das wäre so was für einen Schriftsteller!« sagte er neckend und zwinkerte mit den Augen.
»Sie sollen das Ganze bekommen, wenn ich tot bin!« – Das war sein letztes Wort in dieser Angelegenheit. Ich nahm es für Scherz; und einige Abende danach befand ich mich auf der Heimreise.
Diesmal wechselten wir einige Briefe. Seine wurden kürzer und kürzer. Zuletzt hörte ich von ihm aus Neapel, auf meinen letzten Brief aber bekam ich keine Antwort.
Als ich im Herbst 1903 wieder nach Paris kam, suchte ich van Zanten vergeblich in unserem Stammcafé und in seinem Hotel. Man wußte hier nichts von seiner Adresse. Auf dem holländischen Konsulat, wo ich mich zuletzt erkundigte, wußte man dagegen, daß er sein ganzes Mobiliar in einem Mietszimmer in Paris untergebracht habe und sich selbst auf Reisen befände, wahrscheinlich in den Kolonien.
Ich dachte an sein Heimweh nach den Inseln und gab die Hoffnung auf, ihn jemals wieder zu Gesicht zu bekommen. Für alle Fälle hinterließ ich auf dem Konsulat einen Brief zur eventuellen Weitersendung, in dem ich ihm mitteilte, daß ich ihn vergeblich aufgesucht hätte und gern etwas von ihm hören würde.
Ob dieser Brief ihn jemals erreicht hat, weiß ich nicht; jedenfalls erhielt ich nie eine Antwort darauf; und die Erinnerung an unsere Begegnung kam in die Rumpelkammer meines Gehirns.
Da empfing ich im Februar vorigen Jahres, während ich mich in Nizza aufhielt, einen Brief mit dem Wappen des holländischen Konsulats und mit vielen Poststempeln. Er war mir durch eine Reihe wechselnder Adressen nachgeschickt worden.
Der Brief enthielt eine Mitteilung über van Zantens Tod samt einer Abschrift seines Testamentes, worin er »Mijnheer Laurids Bruun van Denemarken« eine Sammlung Manuskripte und Tagebücher zu Erb und Eigen vermacht, »und soll er frei verfügen, was von dem Hinterlassenen wert ist, der Öffentlichkeit vorgelegt zu werden, und wo es erscheinen soll«.
Indem ich nun also Pieter Adrian van Zantens Debütbuch in die Welt sende, erfülle ich damit nicht allein eine liebe persönliche Pflicht, sondern ich glaube, daß ich gleichzeitig die Literatur mit einer interessanten und eigenartigen Arbeit bereichere, die Einblick in ein neues und fruchtbares Dichterland gewährt. Ich brauche kaum hinzuzufügen, daß ich es mir habe angelegen sein lassen, die in van Zantens Buch herrschenden natürlichen und ethnographischen Verhältnisse womöglich durch die vorhandene Literatur zu verifizieren; es ist mir also gelungen, in den meisten Fällen genaue Übereinstimmung mit zuverlässigen Berichten anderer über Volksleben, Sitte und Aberglaube zu konstatieren.
Es ist betrübend zu denken, wie wenig dazu gehört, um das Schicksal eines Menschen zu verändern. Wenn van Zanten seinem ursprünglichen Plan gefolgt wäre und dieses Buch veröffentlicht hätte, so wäre es aller Wahrscheinlichkeit nach in der Mitte der siebziger Jahre erschienen, in seiner ästhetischen Batavia-Periode, also bevor noch Kipling, der 1865 geboren ist, daran dachte, das indische Festland für die Literatur zu erobern. Jetzt ist Kipling mit Recht weltberühmt; van Zanten aber, dessen Buch mit Hinsicht auf die Originalität des Stoffes, auf die Ursprünglichkeit und Anschaulichkeit der Darstellung so sehr an Kiplings Bücher erinnert – ist unbekannt und ohne Namen gestorben.
Nach und nach, soweit meine eigene Produktion mir Zeit dazu läßt, werde ich auch die übrigen van Zantenschen Manuskripte, sofern sie sich dazu eignen, in Dänemark erscheinen lassen.
Was das Ausland betrifft, so werden Schritte getan werden, damit der vorliegende Roman in einer deutschen, englischen und holländischen Ausgabe erscheint, ebenso wie es mir auch hoffentlich gelingen wird, die übrigen Manuskripte in kritischer Ausgabe nach und nach in einer oder mehreren Weltsprachen herauszugeben.
Ich möchte noch hinzufügen, daß ich mich in meiner Übersetzung dem Original genau angepaßt habe, ebenso wie ich es mit Absicht unterlassen habe, sprachliche und literarische Ungeschicklichkeiten, die den Anfänger verraten, zu verbessern (z. B. die Benutzung der Gegenwarts- und Vergangenheitsform in derselben Satzperiode); dennoch habe ich mich hin und wieder gezwungen gesehen, ein Wort oder einen Ausdruck zu dämpfen oder ganz auszulassen, dessen allzu große »Natürlichkeit« nach dänischen Begriffen eine direkte Widergabe unmöglich gemacht hätte. Ich nehme an, daß van Zanten, wenn er das Buch der Öffentlichkeit übergeben hätte, selbst geändert haben würde, was die Geschmacksgrenze des gedruckten Wortes überschreitet. Dennoch werden vielleicht einige Leser finden, daß ich in dieser Beziehung nicht streng genug gewesen bin.
Kopenhagen, im Mai 1903
Laurids Bruun
Erstes Kapitel
Beim König
Mein Wirt und ich waren mit unserem Kanu zum Riff hinüber gerudert, um nach den Fischnetzen zu sehen.
Da hörten wir jemand nach uns rufen und sahen einen alten, zitternden Kerl am Ufer stehen, der auf dem Korallenboden herumhüpfte, als hätte er Feuer unter den Fußsohlen.
Ich kannte ihn nicht. Tongu aber hatte kaum den Kopf gewandt, als er die Bambusstange auf den Boden warf und nach den Rudern griff.
»Wahuja!« sagte er und machte mir mit dem Kopf Zeichen zu, daß ich mich beeilen solle.
Ich ordnete das Netz, das von der Stange geglitten war.
»Das weiße Langohr!« sagte Tongu und puffte mich ungeduldig mit dem Ruderschaft in den Rücken.
Da wußte ich Bescheid. »Das weiße Langohr« ist der erste Mann des Königs – Minister und Oberkämmerer und alles derartige unter einer Haut vereinigt. Den Spitznamen »das weiße Langohr« rufen die Jungens hinter ihm her, wenn er von Amts wegen unterwegs ist. Seine Ohren sind sicher zwölf Zentimeter lang und mit Haaren bewachsen, die ebenso weiß sind wie sein dichtes, krauses Haupthaar.
Wir wendeten das Boot und machten Wahuja Zeichen zu, der die Handflächen gegen seine zitternden Knie stemmte und nach uns ausspähte.
»Es ist der Abgabe wegen«, dachte ich. Denn ich hatte seit dem vorigen Monsumwechsel bei Tongu auf der Insel gewohnt und keine Abgabe bezahlt, weder an Fischen, Vögeln noch an Früchten. Wenn ich für Tongu fische und sein Pensionär bin, muß er eigentlich für uns beide Steuern bezahlen. Aber natürlich ging das auf die Dauer für einen so seltenen Mann, wie ich es auf der Insel bin, nicht an.
»Was will er von uns?«
»Der König!«
Mehr sagte Tongu nicht, aber er ruderte, was er nur konnte.
Der alte Wahuja begann wieder hin und her zu trippeln, als wir landeten.
Ich begrüßte ihn auf eingeborene Art und untertänig, was er gnädig aufnahm. Seine Hände zitterten und seine Kiefer bewegten sich unaufhörlich; seine kleinen, lebhaften Augen musterten mich stechend von Kopf bis zu Fuß, während er seine Amtsrede hielt.
»Die Augen des Königs sind groß,« begann er und schüttelte bedenklich seinen knochendürren Kopf, »sehr groß!«
Auf europäisch: Der König wundert sich sehr!
Dachte ich mir's doch.
Ich hütete mich wohl, ihn zu unterbrechen, und brachte alle Unschuld, die mir zu Gebote stand, in meinem offenen Gesicht und in meinen blauen Augen zum Ausdruck.
»Des Königs Herz ist im Begriff einzuschrumpfen!« fuhr er fort, durch meine Schuldlosigkeit gereizt.
Tongu schlug sich untertänigst auf die Schenkel und begann vorwurfsvoll mit dem Kopf zu wackeln.
Daß des König« Herz einschrumpft, bedeutet, daß seine Gnade flöten gegangen ist.
Ich schwieg noch immer.
»Der König wünscht, daß der reiche Geber sofort erscheint und seine Augen verbessert!«
»Der reiche Geber« ist ein verdammter Spitzname, den ich gleich bei meiner Ankunft wegen meiner Schießwaffen und meiner inhaltsreichen Schiffskiste bekommen habe. Ich weiß wohl, was es bedeutet, wenn er angewendet wird.
»Schön!« sagte ich.
Ich wollte der Sache gleich ein Ende machen. Wir standen hier auf dem steinharten, unebenen Korallenboden mitten in der Sonne. Es war schon nach zehn Uhr und fast kein Wind.
Ich ging voran zu Tongus Haus.
Tongu beugte ehrerbietig seine Knie, ließ den spindeldürren, wundfüßigen Alten aufsitzen und ritt ihn über den Korallenstrand, bis der lose Sand begann.
Als wir das Haus erreichten, wollte der Alte nicht mit hinter den Bambuszaun. Dazu war er zu vornehm und Tongu zu gering. Darum setzte mein Wirt ihn vorsichtig unter der Kokospalme nieder, wo er die Beine von sich streckte und sich gegen den Stamm lehnte.
Ich wollte ins Haus gehen, um ein Antrittsgeschenk auszusuchen.
»Ich bin ein alter, schwacher Mann!« jammerte der Minister hinter mir her und trocknete sich den Mund mit dem Rücken seiner zitternden Hand.
»Sitz ein Schläfchen!« bat Tongu einschmeichelnd.
»Ich bin ein alter, schwacher Mann!« krähte der Alte wieder und streckte seine schlimmen Zehen von sich, die ganz geschwollen und blauschwarz waren.
Jetzt begriff ich. Ich holte meinen Java-Rum, dessen Ruf offenbar bis zum Hofe gedrungen war, und schenkte ihm einen Schnaps ein.
Der Alte nahm den Schnaps, ließ ihn im Munde hin und her laufen und gurgelte sich den Hals damit, bevor er ihn herunterschluckte. Dann beleckte er das Glas sowohl von innen wie von außen und schielte nach der Flasche, die ich eiligst in meine Tasche steckte.
Während Tongu und ich über die Schiffskiste gebeugt standen, um etwas Passendes auszusuchen, wurde die niedrige Tür hinter uns plötzlich verdunkelt. Der Alte war uns dennoch nachgeschlichen.
»Ich bin ein armer Mann!« sagte er kläglich und streckte die Hand aus. Im selben Augenblick entdeckte er eine große, gesprenkelte Wanze in einer Bambusritze. Er ergriff sie mit zwei Fingern und aß sie, ohne seine Augen einen Augenblick von meiner Kiste zu verwenden.
Wahuja ist der reichste Mann auf der Insel. Man sagt, daß er sich einen reichen Tabu verdient, indem er die Gnade des Königs verwaltet.
Ich suchte einen Taschenbleistift mit einem silbernen Knopf hervor. Er biß darauf, roch daran und steckte ihn schließlich mit einem tiefen Seufzer ins Haar. Die Gabe war anscheinend zu gering, aber ich konnte seine Fratze nicht leiden.
Ich wählte ein rotes Seidentuch aus meiner Batavia-Zeit für die Königin und für den König ein altes Opernglas, das ich beim letzten Weihnachtsfest, das ich auf Java verlebte, von der Frau meines Chefs bekommen hatte.
Als wir zusammen über die Landstraße trabten, die vom Strande bis zum Königshause führt und mit flachen Steinen gepflastert ist, hingen Talaos Jungen, die damals noch nicht im Gemeinschaftshause waren, über einen Bambuszaun.
»Weißes Langohr!« schrie der eine und duckte sich. Der Alte tat, als höre er nichts; Tongu aber warf einen Stein nach ihm und traf den Zaun, so daß er krachte und der weiße Staub aufwirbelte. Die Jungen aber lachten laut aus sicherem Versteck.
Als wir an der Biegung standen, die zum Hause des Königs führt, sahen wir eine Reihe neugieriger Frauenköpfe in der offenen Wand hinter der Veranda. Sie verschwanden, als sie sich entdeckt sahen.
Wir stiegen die Hühnertreppe hinauf und von Wahuja geführt krochen wir durch die niedrige Öffnung unter dem tiefhängenden Blätterdach.
Der König saß mitten im Raum auf einer gemusterten Pisangmatte. Das Zimmer hatte an der einen Seite die Verandaöffnung, Fensteröffnungen an zwei andern und eine Bambusscheidewand mit einer breiten Türöffnung an der vierten Seite, der Veranda gegenüber.
Hinter ihm saß die Königin auf einer Matte für sich allein.
Wahuja legte sich auf seine steifen Knie und flüsterte dem König etwas zu, das wir nicht verstehen konnten. Dann winkte er mich heran, während Tongu am Eingang stehen bleiben mußte.
Wahuja schlich zu seiner Matte zur Rechten der Königin. Längs der Bambuswand saß der Hof, das heißt die Männer mit ihren Speeren und Keulen. Die Damen – die übrigen Frauen des Königs – und die Kinder drängten sich neugierig murmelnd in der Türöffnung.
Der König ist ein ältlicher, fetter Mann mit einem Bauch, der blank und straff ist und ein gutes Stück über das dunkelrote tapa herabhängt. Er hat eine Brust wie ein Weib und dichtes graues Haar auch in den Armhöhlen. Um den Arm trägt er ein Band von kleinen blendendweißen Knochen, und das Haar ist vorn hochgekämmt und wird von Kämmen, die aus Schildpatt zu sein scheinen, gehalten.
Er erhob sich mit Beschwer und gab mir auf europäisch die Hand.
»Shanku Sar!« sagte er und zeigte seine weißen Zähne.
Das ist das einzige, was er auf englisch sagen kann. Er ist sehr stolz darauf und gebraucht es bei allen offiziellen Gelegenheiten.
Ich begrüßte ihn eingeboren und wünschte ihm, auf meinen flachen Händen liegend, ein langes Leben und Fruchtbarkeit für seine Frauen. Das gefiel ihm. Er gab mir durch einen Schubs zu verstehen, daß ich neben ihm hocken solle. Ich war also garnicht in Ungnade. Es war eine Lüge, daß das Herz des Königs im Begriff war einzuschrumpfen. Wahuja hatte übertrieben, um mich bange zu machen und einen Schnaps zu verdienen.
Der König hat große Augen, gierig und gleichzeitig melancholisch. Er fraß mich mit seinen Blicken, ebenso wie Wahuja es getan hatte.
Die Königin war vornehmer. Sie hatte rote Blumen im Haar und in beiden Ohren; zwei Ketten von Muschelperlen hingen ihr um den Hals, zu denen sie jeden Augenblick hinabschielte; auch um die Handgelenke trug sie Perlen. Sie war vom Hals bis über die Brust, die nicht viel größer, aber hängender war als die des Königs, mit schwarzen und grünen, parallel laufenden Zickzacklinien tätowiert.
Sie saß unbeweglich auf ihrer Matte, die offenen Handflächen von sich gestreckt, und starrte mich unter den schläfrigen Augenlidern unverwandt an. Wenn aber mein Blick den ihren traf, wandte sie den Kopf zur Seite und gab einen Laut von sich wie eine Katze, der man gegen das Fell streicht.
Es ging nach allen Regeln der Zeremonie zu. Der König suchte mir eigenhändig aus seinem Armkorb die beste Betelnuß heraus, knackte selbst die weiße Schale auf, durchschnitt den Kern mit seiner Paradeaxt, streute aus einem Kürbis mit feinen Löchern, wie aus einer Zuckerdose, gestoßenen Kalk darauf, suchte ein extra saftiges Pfefferbaumblatt hervor, worin er das Ganze einwickelte, und reichte mir den leckeren Bissen.
Es war eine absolut erstklassige Portion Kautabak, wie man sie auch auf Yap nicht besser bekommt, das wegen seines Betels berühmt ist. Dann machte er sich selbst eine Portion zurecht, worauf wir eine Weile unter feierlichem Schweigen kauten und im weitem Bogen auf den Bambusboden spuckten.
Wenn der König nicht so stramm aus den Armhöhlen gerochen hätte, wäre es ein recht angenehmer Besuch gewesen. Man sagt, daß er schwach ist. Die Sache aber ist die, daß er auf Grund seiner Stellung nicht genügend Bewegung bekommt, und das beeinträchtigt den Stoffwechsel.
Wir sprachen vom Wetter und vom Fischfang nach dem Monsumwechsel. Der König machte eine feine Andeutung, daß es ihm bekannt sei, daß Tongu die besten Fischnetze in der Gegend habe. Der Hof bekäme nur selten Fische. Die Abgaben beständen meistens in Früchten, Vögeln und hin und wieder Ferkeln. Ich versprach ihm einen ganzen Korb mit Fischen zu schicken und versicherte ihm, daß ich bis jetzt noch keine Abgabe gezahlt hätte, weil ich etwas sammeln wollte, was des Königs Augen recht groß machen und sein Herz erweitern könne.
Das gefiel ihm sehr. Er zeigte seine Zähne; und als seine melancholischen Augen sich jetzt auf meine Tasche hefteten, hinter der die Flasche und das Opernglas sich wölbten, ergriff ich die Gelegenheit, ihm meine Geschenke zu überreichen. Als der Hof der Flasche ansichtig wurde, grunzte und raschelte und murmelte es die ganze Wand entlang. Auch die Weiber und Kinder gaben ihrer Freude im Namen des Königs Ausdruck.
Er nahm sich gleich einen ordentlichen Schluck, bot mir die Flasche aus Höflichkeit, zog sie aber zurück, bevor ich noch Zeit gefunden hatte, abzulehnen.
Das Opernglas interessierte ihn nicht so sehr. Das war ja nur etwas fürs Auge.
Die Königin klatschte ihre Hände vor Freude über das Seidentuch gegen ihre fetten Beine. Ein einziges Mal. Dann war sie gleich wieder würdevoll. Sie probierte es erst um den Hals, darauf über der Brust, dann vorn über dem Rock, vom Gürtel abwärts, und schließlich um den Arm. Jedesmal wandte sie sich zu den Frauen im Hintergrunde um, die ihren Beifall so lebhaft zu erkennen gaben, daß der König sich umwenden und »Mund halten!« rufen mußte.
Da war ein süßes Ding, ein Mädel von ungefähr zwölf Jahren, gerade reif fürs Gemeinschaftshaus. Sie saß in der Tür und betrachtete meine Herrlichkeiten mit großen blanken Augen. Ich konnte es nicht lassen, ihr auf europäisch zuzunicken. Sie nickte wieder und lachte über ihr ganzes unschuldiges Gesicht. Aber da kam eine ältliche Madame – wahrscheinlich ihre Mutter – packte sie im Nacken, schubste sie zur Seite, setzte sich selbst an ihre Stelle und begann mir zuzunicken und ihre Zähne zu zeigen. Das war ein übler Tausch.
Der König erhob sich. Der Rum begann zu wirken. Er versetzte mir in höchster Gnade einen Fußtritt aufs Schienbein und lud mich zum Mittagessen ein.
Jetzt verschwanden alle, ausgenommen der Kronprinz – ein geschmeidiger Bursche von siebzehn Jahren, mit einem stolzen Nacken und unruhigen Augen – und dann Wahuja, der uns auf den Hacken folgte und mit seinen langen Ohren belauerte.
Der König zeigte mir seine Veranda und seine einzigartigen Kokospalmen. Einige davon waren höher als ein vierstöckiges Haus. Der Kronprinz bekam einen Wink, kletterte mit gestreckten Armen und Beinen am Stamm hinauf und warf einige frische Nüsse herab. Eins, zwei, drei war er wieder unten, schnitt das Dreieck heraus, und wir tranken aus derselben Nuß, der König und ich, – eine sehr große Ehre.
Dann kehrten wir in den Saal zurück und besahen die Kostbarkeiten. Da war eine verrostete Schiffskanone, die ich auf ihre Schwere hin prüfen mußte. An der Wand hing an einem Bastfaden eine Klystierspritze. Der König zeigte mir, wie sie spritzen konnte. Er strahlte eine Wanze damit von der Wand herunter. Mitten an der Wand hing ein koloriertes Madonnenbild, ein Öldruck aus einer Zeitschrift. Der König erzählte mir, daß es »Sha Quwin« (the Queen) sei – die große Königin der Weißen und ihr kleiner Sohn.
Das Mittagessen war ausgezeichnet.
Wir bekamen Brotfrucht mit Yams zusammengebacken; dann Palmenkohl von jungen Kokosschossen; er ist etwas grob, aber außerordentlich frisch und schmackhaft. Darauf gab es wilde Fruchttauben, die mit allen Eingeweiden geröstet waren. Dann bekamen wir Rücken von fliegenden Fischen mit Pisangmark zu Klößen geknetet. Fliegende Fische ähneln Makrelen, sind aber feiner im Geschmack.
Wir tranken reichlich Toddy dazu, und der König führte sich hin und wieder einen Schluck Rum zu Gemüte.
Alles wurde nett und reinlich auf jungen, frischen Pisangblättern serviert. Man ißt viel besser mit den Fingern als mit Messer und Gabel, wenn man sich erst daran gewöhnt hat. Zum Dessert bekamen wir Taffa – eine dicke Grütze aus geschabtem Bananenfleisch und Kokossaft.
Während wir aßen, hatten sowohl der König wie ich ein Mädchen hinter uns mit einem Blattfächer, der unablässig in Bewegung war. Selbst als der König zwischen dem Vogel und dem Fisch zur Verandaöffnung mußte, um ein kleines Geschäft zu verrichten, folgte sie ihm mit dem Fächer.
Das Essen schmeckte uns großartig. Der König stieß einmal nach dem anderen mit großer Befriedigung auf. Schließlich wurde er so froh, daß er sich längelang ausstreckte und sagte, jetzt solle ich mir eine Gegengabe wählen, jeder Wunsch würde mir erfüllt werden.
Ich dachte gleich an die Kleine von vorhin. Wagte aber nicht es auszusprechen. Vielleicht war sie eines seiner Lieblingskinder.
Während ich noch saß und überlegte, kam der Hof zurück, um die Reste der Mahlzeit zu verzehren, die ihm zufallen.
Dazwischen war ein junger, breitschulteriger Bursche, der mir vorhin durch seine warmen, treuherzigen Hundeaugen aufgefallen war.
Ich fragte den König, ob er ihn mir überlassen wolle.
Er richtete sich halb auf seinem Ellenbogen auf und sah sich um. Dann winkte er den Mann heran.
Der Bursche sprang vor Freude in die Höhe und warf sich dann platt vor mir auf den Magen. Man glaubt gewiß, daß ich zu Hause in meiner Kiste Unmassen von Rum habe. Denn alle anderen schielten sauer und neidisch zu ihm hin.
Dann wollte der König schlafen; Wahuja kam herangeschlichen und bedeutete mir, daß ich verduften solle. Er flüsterte dem König etwas zu, der sich schleunigst wieder aufrichtete. Während ich ihn auf eingeborene Art grüßte und mich bedankte, glückte es ihm, wieder etwas Königswürde in seinen betrunkenen Zügen zum Ausdruck zu bringen, und er lallte in einem halb drohenden Ton, daß ich die Abgabe nicht vergessen solle.
Als ich hinaus kam, sah ich Tongu, der sich über die Kokosnüsse des Königs hergemacht hatte. Er war hungrig und schlechtgelaunt und knuffte meinen neuen Jäger in den Rücken, der mir folgte, so wie er ging und stand.
Er hieße Tokozikasa, sagte er. Das ist mir zu lang. Ich nenne ihn Toko.
Zweites Kapitel
Die Stadt erwacht
Tongu hatte mir häufig von »den Steinen unserer Väter« im westlichen Walde erzählt. Darum beschlossen wir, am folgenden Tage mit Sonnenaufgang einen Ausflug dorthin zu machen. Toko sagte, daß ein Wald von Brotfruchtbäumen in der Nähe sei, der von »fliegenden Hunden« wimmele. Diese wollte ich bei selber Gelegenheit jagen.
Abends machte Toko seinen Bogen in Ordnung. Ich reinigte meine Büchse. Tongu sah das Kanu nach und versah es auf alle Fälle mit Kokos, Bananen und Yamsbrot.
Toko war der erste, der erwachte und mit Geheul in die Höhe fuhr. Er muß sich hin und wieder durch unartikulierte Laute Luft verschaffen, sonst wird er schwerfällig und schlaff und schwül wie ein Gewitter, bevor der erste Blitz niedergeht.
Der östliche Himmel war wie eine ungeheure Perlmuttermuschel mit silbernen Flecken darin. Die Flecken wurden nach und nach rot und verwandelten sich schließlich ganz unten am Horizont zu goldenen Pünktchen. Plötzlich glühte der äußerste Rand der Sonnenkugel aus dem Wasser hervor und färbte den ganzen Spiegel rot, während das Perlmutter sich zu lichten, roten Flocken zusammenballte. Als die glühende Kugel zur Hälfte da war, wurden die Flocken plötzlich auf eine eigene Weise von dem tiefen Blau aufgesogen. Man kann den Sonnenaufgang wieder und wieder sehen, seit mehr als zwanzig Jahren habe ich ihn auf den Inseln genossen, und wird des Anblickes doch nie müde.
Es wehte ein kühles Lüftchen aus Nordost, obgleich wir bereits im Anfang vom April waren und gerade vor der Zeit der Windstille beim Monsumwechsel standen. Als die Sonne aber ganz aufgegangen war, verschlang sie die Brise.
Nachdem wir uns den Schlaf aus den Augen gerieben hatten, konnte Toko nicht länger an sich halten. Er rannte mit ein paar Sätzen über den Hof, daß Tongus Hühner flügelschlagend nach allen Seiten stoben, umfaßte zwei Pfähle und schwang sich mit Triumphgeschrei rückwärts über Tongus Rohrzaun.
Tongu stürzte wütend durch die Zauntür, vor der Toko in dem weißen Sand stand, die Hände auf die Knie stützte und ihn auslachte. Er hat das Kunststück schon mal gemacht; Tongu aber faßt es wie eine Beleidigung auf, »als ob sein Zaun nicht hoch genug sei«. Tongu beugte sich herab, raffte mit beiden Händen Sand zusammen und wollte Tokos Augen treffen; Toko aber war bereits halbwegs unten am Strand und ließ nur noch seinen Rücken sehen.
»Warum willst du dich über den tollen Burschen ärgern«, sagte ich; und nachdem Tongu alles Böse auf Tokos noch ungeborene Kinder herabgewünscht hatte, wurde er wieder gut und fing an zu flöten.
Toko war bereits im Kanu, das er so weit auf den Korallengrund hinausgeschaukelt hatte, bis der Schwimmkiel festlag. Er trampelte ungeduldig aus dem Boden herum und schwang beide Ruder über seinem Kopf, um seine überflüssigen Kräfte wenigstens zu etwas zu gebrauchen.
Tongu und ich wateten zu dem jungen Blut hinaus. Obgleich er den gesetzten, backenbärtigen Tongu von Morgen bis Abend reizt, kann auch er sein vergnügtes Gesicht mit den warmen Hundeaugen nicht entbehren.
Es ist verflucht wenig Platz in so einem Kanu. Ich sitze vorn mit dem Schieber zwischen den Armen und habe meine Knie bis ans Kinn hinaufgezogen. Dann kommen Tongu und Toko mit je einem Ruder, in derselben zusammengezogenen Stellung wie ich.
So gleiten wir in das flache Binnenwasser hinaus, das von dem toten, weißen Korallengrund hellblau gefärbt wird.
Toko läßt sich an seinem Ruder nicht genügen. Er schmettert und jodelt, so daß es in seiner Kehle bebt, er wirft den Kopf in den Nacken, genau wie ein Singvogel. Er schwatzt sinnloses Zeug, sitzt in der Morgensonne und lacht aus vollem Halse.
Es dauert nicht lange, da sang ich mit. Einen alten, europäischen Liederrefrain, dessen ich mich gar nicht mehr zu erinnern glaubte. Tongu konnte schließlich auch nicht widerstehen. Das beschleunigte unsere Fahrt; wir schossen so schnell dahin, daß das Wasser über den Schwimmkiel schäumte.
Draußen auf der Klippe lärmte die Brandung. Hin und wieder wurde die rote, lebende Korallmasse bloßgelegt. Es sah aus, als würde eine ungeheure blutige Wunde mit Seifenschaum ausgewaschen.
Seevögel flogen schreiend und flügelschlagend über die Wunde, und Strandläufer strichen im niedrigen Flug über das Binnenwasser.
Es war ein gesegneter Morgen. Der Himmel schimmerte wie das reinste Feuer eines einzigen dunkelblauen Diamanten. Die Küste leuchtete so weiß von dem feinen Korallensand, daß es in den Augen schmerzte, obgleich die Sonne noch niedrig stand.
Hinter dem Sand, gleich jenseits des Strandweges, winkten die schlanken, saftiggrünen Bananen-Pisangs mit ihren mächtigen Blättern. Die Luft war so durchsichtig, daß man die Purpurflecke auf den Stämmen und die violette Decke der Fruchtblätter unterscheiden konnte. Die Fruchtbündel waren noch klein und grün.
Die Kokospalmen hoben ihre gelblichen Kronen über den Pisanghain. Die empfindlichen Blätterzipfel zittern in der schimmernden Luft, obgleich es fast windstill ist. Dicht am Stamm leuchteten die rundlichen Kolben mit ihren faserigen Nüssen wie eine kleine gelbe Wolke unter den Blättern hervor. Das ist der Kokoshain des Königs, von dem alle Jungens der Stadt stehlen.
Hinter den Palmen wieder erheben einige alte Brotfruchtbäume ihre wagerechten Äste mit dem mächtigen, dunkelgrünen Laub, zwischen denen die langen Zäpfchen hängen. Die kugelrunden Fruchtblumen, so groß wie Kinderköpfe, sind grün und reif zum Pflücken.
Jetzt kommen wir an der letzten Hütte unserer Stadt vorbei. Unsere Stadt ist die größte auf der Insel und darum Residenz. Die anderen Städte haben allerdings auch je einen König, aber unser König erkennt sie nicht an und behauptet, daß die ganze Insel ihm gehöre.
Längs der Strandlinie zieht sich ein dichtes, dunkles Gehölz hin. Das sind wilde Pisangs; sie sind kleiner als die angepflanzten und drängen sich zwischen mächtigen Pandangbüschen, deren lange, schmale Blätter sich ineinanderfilzen.
Die Küste macht eine Biegung nach Nordost. Noch ein gutes Stück Fahrt, dann können wir schon die gelben Pandangdächer unseres Nachbardorfes zwischen den Bäumen unterscheiden.
Es ist ein wohlhabendes Dorf. Es besteht allerdings nur aus ungefähr zwanzig Hütten, aber sie sind alle gut gedeckt und auf Balken errichtet. Ihre Rohrzäune sind hoch und fast ganz von den fruchtbaren Herzblättern der Yamswurzel, die sich an den Stangen hinaufschlingen, überwachsen.
Die Stadt ist gerade erwacht und fängt an sich zu rühren.
Hinter den Hütten ist ein dichtes Dunkel von niedrigen Tarosträuchern, zwischen denen einige Kinder bereits Verstecken spielen. Als sie uns gewahr werden, stürzen sie an den Strand, um zu glotzen.
Da steht ein Mann vor seiner Hüttentür und reckt sich den Schlaf aus den Gliedern. Sein Weib hockt neben ihm mit einem Kind im Gürtel, das ihre hängende Brust mit beiden Händchen hebt und den Morgentrank herausdrückt.
Einige junge Dinger tollen im Wasser. Sie kreischen wie frohe Papageien und spritzen sich gegenseitig beim Morgenbade das lauwarme Wasser ins Gesicht.
Jeden Augenblick tauchen sie nach etwas, das sie mit Begehrlichkeit verschlingen und sich gegenseitig zu entreißen suchen. Entweder sind es Meerwalzen oder die kleinen hellroten Muscheln, deren Namen ich nicht kenne. Die Eingeborenen nennen sie Muamua und ziehen sie allen anderen Schaltieren vor.
Sie beschatten die Augen mit den Händen und starren zu uns hinüber. Einige machen sich augenscheinlich über uns lustig. Und Toko schreit aus vollem Halse, daß sie sich hüten sollen.
Dort liegt das Kanuhaus der Stadt. Es ist kleiner als unseres und kaum mehr als ein Bambusschuppen, mit einigen lose darüberhängenden Kokosblättern.
Auf dem Giebel ist nur eine flammende Sonne gemalt. Wir haben nicht nur eine Sonne, sondern auch eine sitzende Frau, Frösche, Vögel und eine Kokospalme, und unser Dach ist viel höher und dichter.
Zwei Männer sind damit beschäftigt, den Stamm eines Brotfruchtbaumes mit ihren kleinen Äxten auszuhöhlen. Als sie uns sehen, schwingen sie die Äxte und rufen uns etwas zu. Wir rufen wieder, während die Frauen mit gespreizten Beinen in dem weißen Sand stehen und uns anglotzen.
Toko macht ihnen ein unanständiges Angebot, was er nie den Frauen seiner eigenen Stadt gegenüber gewagt hätte. Sie können gar nicht hören, was er sagt; aber Tongu, der ebenso flachhändig wie backenbärtig ist, schilt ihn dennoch aus.
Jetzt sind wir an ihnen vorbeigeglitten.
Dort – ein Stück von den anderen entfernt – liegt noch eine Hütte mitten in einem Pisanggarten.
Der Mann ist emsig mit den reifen Schußstämmen beschäftigt. Er fällt den einen nach dem anderen mit seiner weißen Axt, die in der Sonne blinkt, wenn er sie schwingt. Die Kinder laufen ihm zwischen den Beinen; wenn der Stamm fallen soll, bringt er sie in Sicherheit.
Der Pisang seufzt im Fallen wie ein lebendes Wesen, was er ja auch ist. Sein Weib pflückt die Bananen von dem gefällten Stamm und wirft die überreifen den Kindern hin, die sich wie kleine hitzige Hunde darum balgen. Darauf spaltet sie den Blattstamm und schabt sorgfältig das Mark heraus. Keiner von ihnen hat Zeit gehabt, uns zu entdecken.
Jetzt ist nichts weiter zu sehen als das wilde, dichte Gehölz, aus dem wir die kleinen grünen Papageien schreien hören können.
Was ist das? – Noch ein Mensch. Ach, es ist ein junges Mädchen. Sie ist ganz nackt, kommt wohl gerade aus dem Wasser. Sie sucht sich lange Gräser zu einem neuen Rock. Sie hat schon ein Bündel davon in der Hand. Jedesmal wenn sie einer Blume ansichtig wird, pflückt sie sie und steckt sie sich mit ihrem schlanken, hellbraunen Arm in das dichte Haar. Sie hat einen prächtigen Körper mit runden, starken Hüften.
Ich kann es bald nicht mehr aushalten. Man ist doch noch jung. Auch Toko streckt den Hals und macht große Augen; und er ist doch daran gewöhnt.
Drittes Kapitel
Die fliegenden Hunde
Das Gehölz hört auf. Der Boden scheint sumpfig zu sein. Dichtes Schilf steht am Ufer. Je weiter wir kommen, desto höher wird es. Jetzt ist es gewiß schon über Mannshöhe. Es macht den Eindruck von Dschungeln.
»Dort müssen wir hinein!« sagte Tongu.
Ein kleiner Fjord schneidet in das Schilf hinein, von langen, lotrechten Leuchterwurzeln mit dunklen Kronen begrenzt.
Das sind die Mangroven.
Wir rudern mit langen Schlägen hinein. Das Wasser ist hier still und blank, aber auch dunkel. Eine feierliche Einsamkeit lauscht uns entgegen.
Ich begreife nicht, was er hier will. Man kann ja nirgends landen. Das Ufer unter den Mangroven ist wie ein einziges schwarzblaues Schlammloch.
Noch ein Stück. Da sehe ich, wie die Mangroven sich links teilen und einem schmalen Wasserarm Platz machen, der kaum zehn Fuß breit ist. Die Bäume schließen sich über unseren Köpfen zusammen, nur hin und wieder ist ein blauer Himmelsfetzen zu erspähen.
Uralte Bäume, deren Kronen ganz oben grün und dicht sind, schließen Licht und Luft aus; die unteren, dicken, recht hervorstehenden Äste, die an den Stamm festgezimmert zu sein scheinen, sind halbtot und von einer dicken Morastschicht bedeckt. Im Moose wachsen Blattpflanzen, die große rote Blumen haben; Schlinggewächse spinnen sich dazwischen hin und her und verfilzen sich zu einem undurchdringlichen Netz, das sogar den Laut aufhält. Und unterhalb der halbtoten, mächtigen Zweige – lotrecht in den Morast hinein – stehen die Leuchterwurzeln, die das Leben in dem alten Stamm aufrechterhalten, indem sie ihn stützen und Nahrung für ihn aufsaugen. Zwischen den Leuchtern schlingen sich Lianen hin und her, als ob kunstfertige Strickleitern zu den Kronen hinaufführten.
Hier drinnen ist es kühl und dunkel. Ein durchsichtiges, tiefgrünes Kristalldunkel, still und gedämpft. Das Vogelgeschrei und das Plätschern der Ruder ruft keinen Widerhall hervor, es ist, als hingen von allen Seiten dicke Portieren von der Decke herab.
Hin und wieder ertönt ein Vogelschrei, aber Vögel kann ich nicht erspähen. Nur ein hastiges Aufblitzen von Grün oder Rot, das sofort wieder verschwindet.
Ich spanne den Hahn; mein Auge aber verliert wieder und wieder die Spur.
Ich kann fortwährend Tauben girren hören. Die grauen Fruchttauben mit dem roten Knoten auf dem Schnabel. Solange sie stillsitzen, ist es aber unmöglich sie zu entdecken. Selbst Toko kann es nicht.
Schließlich ist da ein Paar, das auf einer der äußersten Luftröhren sitzt und trinkt; sie erheben sich und fliegen flügelschlagend quer über den Wasserarm.
Ich schoß die eine von ihnen. Wir mußten in die Wurzeln hineinrudern, damit Toko sie mit seinem Ruder erreichen konnte.
Späterhin schoß ich noch ein paar. Sie schmecken ausgezeichnet und sind so groß wie ein gutes Küken.
Auch einige grüne Papageien, die die Neugierde auf die äußersten Zweige gelockt hatte, knallte ich herunter.
Jeden Augenblick blitzte etwas pfeilschnell und dunkelrot zwischen den Zweigen auf; bevor ich aber die Büchse an die Backe gelegt hatte, war es weg. Es war der Honigvogel. Er ist klein und behende und lebt von Blumenhonig. Selbst wenn ich ihn vor den Schuß bekommen hätte, so würden wir ihn doch nicht erreichen können. Er hält sich zu tief drinnen zwischen den Bäumen auf. Da wo er hinfiele, hätten wir doch nicht hingelangen können; und wahrscheinlich wäre er im Lianennetz hängen geblieben.
Der Wasserarm wird schmäler, die Stille tiefer. Jetzt hört auch das Vogelgeschrei auf. Der wilde Wirrwarr von Zweigen, Blättern und Schlingfäden hängt still und starr wie Theaterdekorationen in der Luft. Es wirkt unheimlich auf den, der es zum erstenmal sieht. Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß der Tod oder anderer Unrat hinter der unnatürlichen, tückischen Stille lauert. Es ist, als starre ein ungeheurer Schlangenblick aus unbeweglichen Pupillen einen an. Ich erinnere mich dieses ersten Eindruckes noch deutlich aus meinen ersten Javajahren.
Die Eingeborenen überwinden diese Furcht niemals ganz. Sie wagen sich nicht allein hinein. Sie glauben, daß die Seelen böser Menschen vorübergehend Aufenthalt in dem tiefen Schlamm unter den Mangroven nehmen. Ihre Seufzer und ihr Atem sind es, die alle anderen Laute töten.
Sowohl Tongu wie Toko kennen das Fahrwasser. Dort, wo der Wasserarm plötzlich nach rechts abbog, ruderten sie ans linke Ufer und geradeswegs ins Schilf hinein.
Ein ungeheurer Mangrovebaum lag dort vom Alter gefällt. Er hatte seine Luftwurzeln gesprengt, die wie die Rippenstummel eines zerquetschten Brustkastens um ihn herumragten. Die Lianen hingen schlaff von den Nachbarbäumen herab und drehten sich frei in der Luft wie mächtige, zerrissene Spinnenfäden; andere hatten gehalten, aber waren bis zum Zerreißen gestrammt, als wären sie von Menschenhand zur Vertäuung des Riesen ausgespannt, bei dessen Fall ein Lichtloch in die blaue Luft gerissen worden war – ein Loch, das die Nachbarbäume erst nach langer Zeit wieder ausfüllen konnten.
Während Tongu das Kanu festhielt, kletterten Toko und ich auf den Stamm hinauf, der bereits an mehreren Stellen morsch war und unter uns zusammenbrach. Jeden Augenblick dachte ich: jetzt kracht die ganze Geschichte zusammen und versinkt mit dir in die schwarze Lauge, die sauer und verfault zu uns hinaufstinkt.
Als wir das grüne Ende des Stammes erreicht hatten, das zerschmettert zwischen zwei anderen Mangroven lag, ruderte Tongu weiter. Toko beruhigte mich. Wir würden ihn schon wiederfinden.
Der gestürzte Stamm hatte uns über das Schlimmste hinweggeholfen; aber wir mußten uns doch noch ein gutes Stück von Ast zu Ast schwingen, bevor wir auf einem Boden Fuß fassen konnten, der wenigstens nur sumpfig war.
Hier war besser Platz. Wir befanden uns am Eingang zu einer Lichtung, der wir folgten. Und plötzlich standen wir auf einem offenen Stück mit Farnen, die uns bis an die Brust reichten; und als wir sie durchschritten hatten, kamen wir in hohes Alang-Alanggras und hatten den Himmel frei und blau über unseren Köpfen.
Drüben, auf der anderen Seite der Lichtung, lag der Brotfruchtbaumwald, von dem Toko gesprochen hatte. Strahlende, dunkelgrüne Kronen, die sich ihre Zweigarme entgegenbreiteten, mit großen, breiten Blättern, die fast die Brust eines Mannes decken konnten.
Zwei Vögel mit Schwingen wie große Eulen schwebten über den Baumkronen.
Ich wollte schießen, Toko aber packte mich am Arm.
»Das sind fliegende Hunde!« flüsterte er. »Warte, bis sie sich setzen. Sie haben jetzt Schlafenszeit. Der Schwarm sitzt bereits in den Bäumen.«
Sie kreisten ein paarmal herum, als suchten sie sich einen bequemen Baum aus. Dann sanken sie herab, fielen durch ihre eigene Schwere, indem sie plötzlich ihre Flughaut an den Körper legten. Als sie die Baumkrone erreicht hatten, breiteten sie die Flügel wieder einen Augenblick aus, bis sie Fuß gefaßt hatten. Mit einem leisen Aufklatschen schlugen sie einen Purzelbaum auf den Blättern. Ein gedämpftes Pfeifen und Knurren erklang von dem Schwarm, der bereits zur Ruhe gekommen war und jetzt in seinem Schlaf gestört wurde. An dem Zittern der Blätter konnten wir sehen, wie die Zweige von ihrer Last niedergedrückt wurden.
Wir blieben stehen, bis alles ruhig geworden war. Dann schlichen wir hinüber.
Hoch oben unter den Kronen, in dem kühlen, dunklen, kristallklaren Blätterschatten hingen sie Reihe neben Reihe und in Etagen längs der Zweige. Sie hingen dort zu Hunderten, wie Schinken auf einem Rauchboden, die Köpfe nach unten, in ihre Flughaut eingehüllt, ohne Bewegung. Nicht das geringste Zittern war zu spüren. Wer nicht wußte, was es war, hätte diese Dinger nie für Tiere gehalten. Vielleicht für die Nester der Töpfervögel oder für eine andere kunstfertige Tierindustrie, aber nicht für lebende Wesen.
Ich zielte mit Behutsamkeit, schoß, aber das Tier blieb unberührt hängen. Nicht einmal angeschossen schien es mir zu sein. Ich schoß wieder. Dasselbe Resultat.
So fehlgeschossen hatte ich nicht, seit ich als grüner Junge in Amsterdam Dachratten herunterzuknallen versuchte.
Ich wollte noch einmal schießen. Aber da kam Bewegung in den Schwarm. Die Köpfe mit den spitzen Ohren wurden von der Flughaut befreit. Eins, zwei, drei, waren sie oberhalb der Äste, wobei sie wie kleine Affen schrien, durch die Blätter, und fort. Nur einer blieb hängen. Plötzlich aber ließ er den Zweig los und fiel, ohne seine Flügel auszuspannen, zur Erde, als hätte er an einer Schnur gehangen, die plötzlich gerissen war.
Toko, der seine Pfeile aufsparte, bis er Tiere fand, die weniger hoch hingen, lachte über mein Erstaunen, als ich das Tier mausetot auf der Erde liegen sah. Er wußte, daß es noch ganze fünf Minuten nach dem Tode an seiner großen Zehe hängen bleiben kann. Erst wenn die Sehne ganz schlaff geworden ist, wird das Glied durch die eigene Schwere des Tieres geöffnet.
Das war die Erklärung für die Fehlschüsse.
Jetzt gingen wir suchend von Baum zu Baum. Die Tiere waren aus ihrem Mittagsschlaf aufgescheucht worden. Schließlich, ein Stück weiter fort, fanden wir wieder einen Schwarm. Ich schoß einige. Aus Neugierde, denn es ist ja das reine Scheibenschießen. Ich muß außerdem sparsam mit meiner Munition umgehen, denn die Zeit ist nicht mehr fern, wo ich mich mit Pfeil und Bogen begnügen muß.
Die Eingeborenen töten auch nicht viele. Die Männer dürfen sie nicht essen. Und in der Regel hängen sie zu hoch für die Pfeile der Eingeborenen. Nur diejenigen, die sich in die angepflanzten Brotfruchtbäume setzen, werden ohne Gnade getötet, weil sie die Frucht fressen. Das wissen die klugen Tiere und kommen darum erst in der Nacht.
Der letzte, den ich traf, breitete zitternd im Fallen seine behaarte Flughaut aus und schlug schlaff gegen Zweige und Blätter. Als ich ihn fand, waren seine Augen gebrochen. Unter der Flughaut aber, die sich im Tode wieder zusammengezogen hatte, spürte ich eine Bewegung, und als ich die Flügel mit Gewalt zurückgebogen hatte, sah ich ein Junges, das sich mit gespreizten Armen und Beinen an den Bauch geklammert hielt. Die dünnen Flughäute des Jungen klebten so fest an dem noch warmen Körper der Mutter, den sie fast verdeckten, daß ich es nicht loslösen konnte. Es war fast neugeboren und nicht viel mehr als ein Skelett mit einem seltsamen Greisenkopf. Es kümmerte sich gar nicht um mich; sein ganzes Leben saß in seiner Schnauze, die fortfuhr, aus dem Euter der toten Mutter zu saugen. Das Junge selbst war nicht getroffen.
Wir wanderten weiter durch Gras und mannshohe Farne, bis wieder eine Lichtung kam.
»Die Steine unserer Väter!« rief Toko und zeigte geradeaus.
Und dann waren wir da.
Die Steine unserer Väter sind eine Ruine. Große, längliche Basaltblöcke liegen in einem länglichen Viereck lose übereinander und bilden einen Hof. Es war auch etwas da, das wie ein Tor aussah.
In einem kleinen Steinbassin, das tief im Schatten von Farnen fast ganz überwachsen dalag, war Wasser, das irgendwo aus dem Erdboden hervorsprudelte. Das Wasser war ganz frisch und in gleicher Höhe mit dem Steinrand. Es muß also eine Quelle sein.
Toto wußte nichts weiter, als daß diese Steine einst zur Verteidigung von »unseren Vätern« errichtet worden waren, einem großen und mächtigen Volk, das mit den anderen Inseln Krieg geführt und mit Kanus, die viel größer waren als unsere, zu fernen Inseln gefahren war, die niemand mehr kannte.
Viertes Kapitel
In der fremden Stadt
Es war weit über Mittag geworden. Wir mußten uns nach Tongu umsehen.
Toko orientierte sich nach dem Stand der Sonne, blieb jeden Augenblick stehen und schnupperte wie ein Jagdhund.
»Wonach schnupperst du?« fragte ich.
»Der Mangrovesumpf!« antwortete er.
Nachdem er aber die Fährte gefunden hatte, schritt er sicher voran.
Bald sahen wir das Mangrovegehölz. Toko orientierte sich genau, bevor er weiterging.
Wir mußten wieder klettern und uns mit den Schlinggewächsen herumschlagen. Das Gras verschwand, und der Boden fing an sumpfig zu werden.
Wir balancierten auf halbverfaulten Stämmen vorwärts, die häufig unter unseren Füßen zusammenkrachten, so daß wir in den Zweigen hängen blieben und nicht loslassen durften, bevor wir von neuem festen Fuß fassen konnten.
Nur gut, dachte ich, während ich auf diese Weise wehrlos mit den Armen um einen Ast hing, den Büchsenriemen fest um den Leib geschnallt, um die Waffe nicht zu verlieren, daß es hier auf den Inseln weder Affen noch große Raubtiere gibt, von giftigen Schlangen gar nicht zu reden. Hier findet man nur die kleine Liguaganti, und sie ist unschädlich wie eine Schnecke.
Endlich erreichten wir den Wasserarm. Wir waren so dicht bei seiner Mündung, daß wir den Fjord sehen konnten, der ebenso dschungelbewachsen war wie der, in den wir vor einigen Stunden hineingerudert waren. Der Wasserarm schneidet also eine Ecke der Insel ab.
»Dies ist nicht derselbe Fluß wie vorhin,« erklärte Toko, »es ist seine Tochter.«
Toko gab das gewohnte Flötensignal, das wie die jodelnden Kehllaute der Nachtigall klingt, nur viel lauter.
Es dauerte eine Weile. Dann antwortete Tongu draußen von der Bucht. Und bald darauf sahen wir das Kanu von der Mündung des Wasserarmes auf uns zukommen.
Nachdem wir eine Vespermahlzeit gehalten hatten, ruderten wir durch den Meerbusen hinaus, der ein großes Stück auf beiden Seiten von Dschungeln eingefaßt war.
Als wir schließlich das Binnenwasser erreichten, war es still und blank wie ein Spiegel. Auch die Brandung beim Riff hatte sich beruhigt. Es war nur noch ein hellschäumender Streifen zu sehen.
Ich nahm Tongu, der ununterbrochen seit dem Morgen gearbeitet hatte, das Ruder ab. Wir ruderten eine ganze Weile unter Stillschweigen. Tongu schlief ein, den Kopf zwischen seinen hochgezogenen Knien, und Toko dachte an die Luft und an sich selbst.
Ich fragte ihn mal, woran er dächte, wenn er so dasäße und mit halbgeschlossenen Augenlidern vor sich hinstarrte.
»An die Luft!« antwortete er; und als er mein Erstaunen über diese Antwort sah, fügte er hinzu: »An mich selbst und die Luft!«
Das Binnenwasser wurde breiter. Die Küste zog sich mehr zurück und wurde von einem Gehölz verdeckt, dessen Büsche ich nicht zu unterscheiden vermochte.