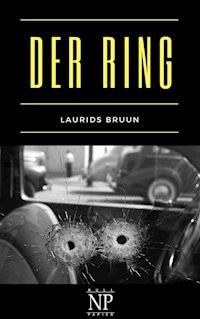Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman aus dem Dänemark des vorvergangenen Jahrhundertwechsels.
Das E-Book Aus dem Geschlecht der Byge wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem Geschlecht der Byge
Laurids Bruun
Inhalt:
Laurids Bruun – Biografie und Bibliografie
Aus dem Geschlecht der Byge
Erster Band
Erstes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Zweites Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Zweiter Band
Drittes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Viertes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Aus dem Geschlecht der Byge, L. Bruun
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849606466
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Laurids Bruun – Biografie und Bibliografie
Dänischer Schriftsteller, geboren am 25. Juni 1864 in Odense, verstorben am 6. November 1935 in Kopenhagen. Begann 1881 ein Studium der Politik, das er 1887 abschloss. Bereits 1884 erscheint eine erste Novelle in der Zeitung "Morgenbladet", 1886 das Buch "Historier". Später zieht Bruun nach Jakarta (damals Batavia) in Indonesien, wo er für seinen Onkel als Einkäufer arbeitet. Seine vielen Reisen durch die ganze Welt waren die Grundlage für seine vielen erfolgreichen Abenteuer- und Reiseromane wie z.B. die Van Zanten-Reihe.
Wichtige Werke:
Die Krone, 1904
Der König aller Sünder, 1904
Die Mitternachtssonne, 1908
Van Zantens glückliche Zeit, 1911
Aus dem Geschlecht der Byge, 1918
Der unbekannte Gott, 1920
Eine seltsame Nacht, 1928
Aus dem Geschlecht der Byge
Roman vom Jahrhundertwechsel
Erster Band
Erstes Buch
1
Das Geschlecht der Byge reicht bis in die graue Urzeit zurück. Es ist ein Bauerngeschlecht, aber von jener alten nordschleswigschen Rasse, die nie Leibeigenschaft und Pacht gekannt hat. Seit undenkbaren Zeiten lebten sie als Herren auf eigenem Grund und Boden und gehorchten nur dem eigenen Willen.
Es war Angelnblut, das zuerst in ihren Adern rollte. Es war Angelnblut, das auf den meilenweiten, flachen Wiesen graste. Aber sowohl das Blut des Geschlechtes wie das des Viehs wurde im Lauf der Zeiten mit anderem vermischt.
Hanseaten kamen und trieben Handel und wurden auf dem fetten Boden ansässig. Kriegsleute, die mit fremden Kriegszügen gekommen waren, ließen sich im Lande nieder, als die trägen Zeiten des Friedens sie brotlos machten. Sie verdingten sich auf Höfen, rückten vom Knecht zum Schwiegersohn auf und vom Schwiegersohn zum Gutsherrn.
Zähe, betriebsame Nordjüten kamen mit Herdenzügen von Pferden und Ochsen zum Verkauf. Auch sie blieben in dem fetten Weideland. Und es kamen Inselbewohner mit dünnem Blut und leichtem Sinn, der wie Wind und Flut wechselte.
Da kam die Zeit, wo die Byges zahlreich und stark wurden und es mit dem Adel und mit feindlichen Mächten aufnahmen, das Band aber wurde gelöst, das das Geschlecht an das Meer und die fetten Wiesen geknüpft hatte.
Neue Schößlinge zogen in die Städte, wurden Mitglieder des Rats, der Gilden und der Zünfte.
Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts wohnte in einer der größten Handelsstädte des Landes ein junger Kaufmann namens Jens Byge.
Er heiratete eine reiche Bauerntochter, Abkömmling eines Geschlechts, das nicht, wie das der Byges, das Land und die fetten Wiesen verlassen hatte.
Sie war von kräftiger Rasse und gebar ihm sechs Söhne, die sie zusammen in Zucht und Genügsamkeit erzogen.
Er hatte als Kaufmann jene feine Nase, die auf weite Entfernungen wittert. Auf die Kunst der Regierung verstand er sich nicht, wohl aber auf deren Grundlage, auf die Werte. Und als der Landesvater in seinem Absolutismus die Mißgeschicke eines neuen Krieges über das Land heraufbeschwor, da gehörte er zu den Wenigen, die das Unwetter des Reichsbankerotts, das am Horizont heraufzog, witterten.
Er und andere taten, was sie konnten, um zur rechten Zeit und an rechter Stelle vorzubeugen; aber es war schon zu spät.
In Byges Kontor, in dem großen Handelshause, stand ein alter Schrank, klotzig und wuchtig. Keiner durfte daran rühren. Erst als er merkte, daß der Tod in sein Haus einzog, ließ er ihn öffnen. Er enthielt für jeden seiner Söhne fünfzigtausend blanke Reichstaler.
Er hatte, solange es noch Zeit gewesen war, die Staatsobligationen und Wertpapiere gegen klingendes Silber eingetauscht. Da man sein Geld nirgends mehr mit Sicherheit anlegen konnte, so legte er es im Geldschrank an – ohne Zinsen, aber auch ohne Verlust. Und vor seinem Tode ermahnte er seine Söhne, das Geld wohl zu hüten.
Der älteste seiner sechs Söhne wurde Richter und gereichte dem Namen des Geschlechtes im öffentlichen Leben des Landes zur Ehre.
Der zweite reiste mit seinem Gelde außer Landes, weil er über das schmähliche Schicksal seines Vaterlandes bis ins Innerste verwundet war.
Der dritte kaufte sich Hof und Gut, brachte aber alles durch und endete als Verwalter auf seinem früheren Grund und Boden.
Der vierte wurde Geistlicher und starb jung.
Der fünfte, der Kasper hieß, übernahm den Kaufmannsberuf des Geschlechtes, obgleich er ursprünglich Jurist war. Als aber die Zeiten von neuem schlecht wurden, ließ er Handel Handel sein, widmete sich der Politik und war mit unter den ersten, die die Freiheit aufbauten, nachdem der Absolutismus seine letzten Atemzüge getan hatte.
Der sechste und jüngste hatte keinen festen Beruf erwählt. Er war nur der Sohn seines Vaters und der Bruder seiner Brüder. Sein Hang ging zur Natur; die alte Sehnsucht nach den fetten Wiesen regte sich in ihm. Sein Gemüt war schwer, sein Gedankengang einfach und erdgebunden.
Er brachte für sein Erbteil den alten Stammhof des Geschlechtes wieder in seinen Besitz. Von den Fenstern des Gutshofes aus konnte er die Wiesen überblicken und das offene Meer sehen. Als Großbauer füllte er seinen Platz zwischen den Leuten der Gegend aus, wurde einer ihrer Vertrauensmänner, aber nichts weiter.
Er hatte eine Pfarrerstochter geheiratet, die ihrem Hauswesen flink und tüchtig vorstand. Sie wurde im eigentlichen Sinne der Herr des Hauses; und als sie einen Sohn bekamen, war sie es, die seine Fähigkeiten erkannte.
Es war der Wunsch des Vaters gewesen, den Sohn für das Geschlecht zu gewinnen, indem er ihn zum Ursprung desselben zurückführen und ihn zum Landmann, zum Großbauer machen wollte.
Der Knabe hieß Jörgen, war lernbegierig, scharfblickend und klardenkend, hatte Talent zum Zeichnen und wälzte in Gedanken Pläne zu Häusern, die er bauen wollte – große und schöne.
Streng und einfach war sein Geist. Er lernte zeitig sich selbst erziehen. Doch gelangte er erst in einem vorgeschrittenen Alter zu seinem eigentlichen Beruf; als er ihn aber erreicht hatte, war er zuverlässig wie wenige; sein Name als Architekt wurde unter den besten des Landes genannt.
Als Jörgen Byge Kirsten Folcke heiratete, kam wieder Inselblut in das Geschlecht. Es war altes Blut, das ebenso wie das der Byges stark mit anderem vermischt worden war.
Das Geschlecht der Folckes stammte von einem böhmischen Abenteurer ab, der in den Tagen des Dreißigjährigen Krieges mit einem Heer, das geschlagen zurückkehrte, in Seeland eingewandert war. Er gründete ein Geschlecht, das in den Fußspuren des Krieges weiterging. Sie lebten vom Krieg, er war ihr Handwerk, ihre Kunst. Sie taten, was in ihrer Macht stand, um ihn nicht in Frieden hinsterben zu lassen. Bald waren sie oben, bald unten. Großvater General, Enkelkind Korporal, und das Kind des Enkelkindes wurde wiederum für Kriegerruhm geehrt und geadelt.
Dieses Kind des Enkelkindes war es, das dem Geschlecht den Namen Folcke gegeben hatte.
Als es schließlich mehr Friedensjahre als Kriegszeiten im Lande gab, wurden auch die Folckes stetige Leute und begnügten sich mit dem tatenlosen Garnisonleben des Offiziers.
Das Abenteurerblut verdünnte sich. In den späteren Generationen gab es Geistliche und andere gelehrte Leute, denen man Sanftmut und unbeugsamen Rechtssinn nachsagte.
2
Svend besuchte in den Schulferien seine Großeltern auf dem alten Stammhof der Byges bei dem Städtchen Fjordby, dicht an der deutschen Grenze.
Es waren erst wenige Jahre seit dem Kriege mit Deutschland vergangen; die Haut, die über die Wunden gewachsen war, war noch dünn und empfindlich.
Sein Großvater, ein kleiner, gebückter Mann mit milden, blauen Augen, ging mit dem Knaben an der Hand durch das Gehölz, das den großen Obstgarten von den Wiesen trennte.
Hier blieb er bei den Weiden stehen, die über die Anpflanzung hinausragten, und erzählte dem Knaben von jenem Abend, als er von der Patrouille des Feindes ergriffen wurde, die ihn beschuldigte, den Kanonenbooten, die draußen im Fahrwasser kreuzten, signalisiert zu haben.
Während er so stand und auf den Belt hinausstarrte, bemerkte Svend, wie seine milden Augen hart wurden. Plötzlich legte sich eine dünne, klare Haut darüber, und eine Träne schlich sich über die tiefe Furche in der Wange.
Erst viele Jahre später verstand Svend, was sein Großvater empfunden hatte. Damals wunderte er sich nur über die Träne, denn es war das erstemal, daß er einen erwachsenen Mann weinen sah.
Eine halbe Meile von der Küste und dem Hauptgutshof entfernt – am Rande des Waldes – lag »das alte Haus«.
So wurde es genannt, weil sein Urgroßvater – »der mit dem vielen Geld«, wie Mamsell Andersen sagte, er hing im blauen Frack, mit Halskrause und großem Ordensband über Großvaters Schreibtisch – es als Wohnsitz für seine Witwe gebaut hatte. Urgroßmutter hatte dort bis zu ihrem Tode gewohnt, aber jetzt stand das Haus leer; und Großmutter wollte dort nicht wohnen, wenn sie Witwe würde, das hatte sie häufig erklärt.
Es war Svends größtes Vergnügen, mit dem Großknecht nach dem Moor zu fahren, dem äußersten Zubehör des Gutshofes.
Dort, auf der anderen Seite der Landstraße mit den tiefen, lehmigen Wagenspuren, lag »das alte Haus« in dem wildverwachsenen Garten.
Das Haus war unbewohnt, aber vollständig möbliert, alte, steile, gebrechliche, stumme Möbel, die alles gesehen und miterlebt zu haben schienen.
Das hohe Ziegeldach mit der weißen Giebelkante und den beiden verfallenen Schornsteinen hing tief über die niedrige Mauer mit den kleinen Fenstern herab. Es war, als ob ein schwerer Hut über Augen und Ohren herabgeglitten war.
Dicht an der Gartentür standen zwei alte Kastanienbäume. Sie reckten sich über die Schornsteine und ihre Zweige ruhten auf dem Dach. In beiden waren Starkästen, die auch so alt aussahen, als wären sie mit den Bäumen aufgewachsen.
Der Grasplatz mitten im Garten war von einem prächtigen Flor von Butterblumen überwachsen. Alte Kirsch- und Pflaumenbäume drängten sich, um ans Licht zu kommen.
Auf beiden Seiten des Grasplatzes lief ein Gartenweg, der so von Grün überwuchert war, daß man ihn nur sah, weil er tiefer lag als der Rand des Rasens.
Er schlängelte sich ganz bis zur Landstraße hin, mit einer wildwachsenden Buchsbaumhecke auf der rechten Seite. Zur Linken lag eine undurchdringliche Wildnis von Johannis- und Stachelbeerbüschen, deren Beeren klein und verkrüppelt waren.
Viele der Büsche waren vor Alter abgestorben, so daß der holzige Hauptstamm nackt in die Höhe ragte und seine armseligen Äste wie Totengebein mitten in der Fruchtbarkeit des Lebens durch die Wildnis streckte.
Der Sauerampfer, der einst das Stachelbeerbeet eingehegt hatte, war riesenhaft groß geworden, zu reinen Sträuchern, die sich über den ganzen Garten verbreitet hatten; wo man ging, watete man in Sauerampfer.
Oh, es war ein herrlicher, ein geradezu göttlicher Garten! Und etwas Ähnliches an Vogelgezwitscher konnte man lange suchen.
In diesem alten Garten ging Svend eines Sommernachmittags mit seinem Vater und seinem Großvater.
Von dem Grasplatz unter den halbwilden Obstbäumen zeigte Großvater durch das offene Fenster in die alte Stube hinein.
»Kannst du das Bild dort in dem vergoldeten Rahmen sehen?« fragte er.
Svend konnte einen Mann mit gebogener Nase, blauen Augen, einem roten Uniformfrack und einem breiten, blauen Seidenband über der Brust erkennen.
»Das ist der König – der alte König! Dieses Bild hat dein Urgroßvater von ihm selbst geschenkt bekommen, weil er ihm Geld geliehen hatte, damit er dafür Schiffe bauen konnte, als das Land in Not war.«
Svends Herz schwoll. Er trat ans Fenster, um den vornehmen Mann genau zu betrachten.
»Weshalb hängt er nicht zu Hause im Wohnzimmer?« fragte er.
»Weil Urgroßmutter wollte, daß er in Urgroßvaters Zimmer hängen bleiben sollte.«
»Ist dies denn Urgroßvaters Zimmer?« fragte Svend und sah durch das Fenster zu der alten Schatulle und den zierlichen Stühlen mit den steifen Beinen hinein.
»Ja, so sah es aus, als er starb.«
Svends Phantasie arbeitete. Wahrend Großvater mit seinem Vater von dem Dach sprach, das ausgebessert werden mußte, dachte er an Urgroßvaters Bild zu Hause an der Wohnzimmerwand. Er nahm ihn aus dem Rahmen und führte ihn zum Bilde des Königs. Er ließ sie sich voreinander verneigen, wie er es auf einem Bilde von zwei alten Herren mit Perücken und Kniehosen gesehen hatte. Er ließ sie sich die Hand geben, und der König bot Urgroßvater eine Prise aus seiner Schnupftabakdose an, klopfte ihm auf die Schulter und sprach vom Vaterland.
»Woran denkst du, Svend?« fragte Großvater.
»An Urgroßvater!« sagte Svend und nahm seine Hand.
»Ja, ja, er war einer der besten Söhne des Vaterlandes.«
Großvater wurden die Augen feucht, und er richtete den Blick fest geradeaus, wie es seine Gewohnheit war. »Mögest du ihm einst ähnlich werden und deinem Vaterlande Dienste leisten wie er es tat!«
Und dann begann Großvater zu erzählen.
Er sprach still wie zu sich selbst vom Urgroßvater und wieder von dessen Vater – was dieser gesagt und was jener getan habe. Er sprach, wie alte Leute zu sprechen pflegen, die von alten Erinnerungen plaudern, wobei die eine immer die andere ablöst.
Svends Vater ging vor ihnen her in seinem weißen Sommeranzug und sah zum Dach hinauf, bald von der einen und bald von der anderen Seite.
Hin und wieder sah er sich mit seinem scharfen Blick zu dem Alten und dem Knaben um; es schimmerte wie ein Lächeln in seinem Bart.
Dann blieb er vor dem Giebel stehen, wo sich einige Mauersteine gelöst hatten.
»Gibt es hier eine Leiter?« fragte er.
Nun mußte Großvater sich unterbrechen, um über die Leiter nachzudenken.
Er seufzte dabei und versuchte so schnell wie möglich zu den alten Zeiten zurückzukehren.
Svends Vater aber sagte erst, während er die Leiter anlegte:
»Ich glaube, man soll sich hüten, Kinder zu fest an das Geschlecht zu knüpfen. Knaben müssen vor allen Dingen lernen, auf sich selbst zu stehen.«
Svend bekam einen roten Kopf vor Widerspruchslust. Er verstand sehr wohl, daß Großvater ihm nicht so viele alte Geschichten erzählen sollte. Aber er wagte nichts zu sagen. Als Großvater sich aber mit der flachen Hand über die Stirn strich, nickte und, nachdem er einen Augenblick nachgedacht hatte, sagte: »Ja, ja, du magst recht haben; ich bin ja noch aus der alten Zeit, als das Wohl des Geschlechtes dem der Persönlichkeit voranging,« – da nahm Svend seine Hand, zog ihn mit sich über den Rasen, wo Vater ihn nicht hören konnte, und flüsterte ihm zu:
»Die alte Zeit war viel besser!«
Großvater sah zu ihm herab und lächelte mit all seinen Runzeln. Dann strich er ihm mit der Hand übers Haar, wurde wieder ernst und sagte:
»Ja, Gott segne dich, mein Junge!«
3
In Hörweite von dem alten Garten lag ein strohgedecktes Haus hinter einem Wall, der mit Weißdorn und Flieder bewachsen war.
Hier wohnte der Schütze und seine Frau.
Er war in seinen jungen Tagen Kutscher auf dem Gutshof gewesen; nachdem er aber einen Huftritt von einem Hengst in die Hüfte bekommen hatte, taugte er nur noch zu leichter Arbeit.
Es war eine Art Invalidenpension, die er in dem kleinen Waldhaus mit seinen drei Tonnen Ackerland genoß. Er hinkte an seinem Stock umher, sägte Brennholz, reinigte seinen Garten von Unkraut und öffnete die Waldpforte, wenn die Herrschaft oder sonst jemand, der im Walde angestellt war, angefahren kam.
Damit er sich auf seine alten Tage nicht zu gering fühlen sollte, hatte er den Titel eines Schützen bekommen, und da seine Frau, die Stubenmädchen auf dem Gutshof gewesen war, die Wäsche der Gutswirtschaft reparierte und ein hübsches Stück Geld damit verdiente, so stand das alternde Ehepaar sich gut.
Da sie keine Kinder hatten, nahmen sie ein kleines Mädchen in Pflege, das man der Hebamme des Dorfes zum Unterbringen übergeben hatte.
Es war ein Zwilling; das andere Kind, ein Knabe, war gleich nach der Geburt gestorben. Das war alles, was ihre Pflegeeltern von ihr wußten. Das Geld aber für den Unterhalt des Kindes wurde ihnen prompt jedes Vierteljahr von einem Rechtsanwalt aus der Handelsstadt zugestellt.
Es war ein kräftiges, gesundes Kind mit großen dunkelgrauen Augen, vollem blonden Haar, das sich in der Sonne wellte, einer kleinen kecken Nase und feiner, flaumiger, durchsichtiger Haut.
Ihr Pflegevater hatte ihr ein Zicklein geschenkt, das frei umhersprang, mit einem Zigarrenband um den Hals. Wenn sie es rief, kam es auf sie zugehüpft und meckerte mit seiner dünnen Stimme.
Svend stand eines Tages vor dem Wall und sah durch eine Öffnung in der Hecke wie Lisbeth dem Zicklein Milch zu trinken gab.
Da fragte er.
»Was willst du für die Ziege haben?«
Sie sah ihn erstaunt mit ihren runden Augen an.
Dann warf sie den Kopf zurück und sagte mürrisch:
»Ich werde Jens doch nicht verkaufen!«
Svend war gekränkt und sagte:
»Wie bist du dumm, daß du nicht weißt, daß alle Ziegen Mads heißen.«
Sie sah ihn wieder erstaunt an; dann sagte sie sanft:
»Du kannst gern hereinkommen und mit uns spielen.«
Svend fühlte sich überwunden. Er wußte nicht, was er antworten sollte; nachdem er es sich aber eine Weile überlegt hatte, kletterte er über die Hecke.
Svend und Lisbeth wurden schnell gute Freunde. Sie war ein Jahr jünger als er, war aber fast ebenso groß und mit viel dickeren Armen.
Jedesmal, wenn er mit dem Leiterwagen nach dem Moor fahren durfte, besuchte er Lisbeth und das Zicklein.
Wenn sie den schweren Wagen rattern hörte und Svend auf dem Wagenbrett neben dem Knecht entdeckte, vergaß sie Zicklein und Hühner und Küchlein und stürmte ihm entgegen.
Er winkte ihr mit der Mütze; und kaum war er vom Wagen heruntergesprungen, so hatte sie ihm schon alles berichtet, was sich seit dem letztenmal an merkwürdigen Dingen zugetragen hatte.
»Ihr seid wohl Brautleute!« sagte der Knecht und lachte ihnen zu.
»Ja!« sagten sie und lachten.
Sie glaubten, er wolle damit sagen, daß sie so schön zusammen spielten. Dann nahm Lisbeth Svend bei der Hand und lief mit ihm davon. Als sie ein Stück gelaufen waren, drehte sie sich um und rief dem Knecht zu:
»Und Jens auch. Jens ist auch mit Brautleute.«
Ihre Freundschaft hielt über die ganze Ferienzeit an, sie war stark und echt.
Als aber Svend in seine eigene Stadt zurückkehrte, zu Mutter und Schwester und zur Schule, da vergaß er nach und nach seinen Spielkameraden.
Um die Weihnachtszeit desselben Jahres starb Svends Großvater.
Großmutter, die den Hof nicht allein weiterbewirtschaften wollte, übergab ihn mit Einwilligung ihres Sohnes dem Bruder des Verstorbenen, Onkel Kasper, welcher vom Erbteil des Urgroßvaters eine große Hypothek darauf stehen hatte.
Onkel Kasper war ein alter, schwerreicher, aber knauseriger Sonderling, der, nachdem er seinen vielen Ehrenämtern entsagt hatte, den größten Teil des Jahres zurückgezogen in der Hauptstadt lebte.
Als es wieder Sommerferien gab, wohnte ein fremder Pächter auf dem Gutshof. Großmutter war in die Stadt gezogen; Svend hatte niemanden mehr, den er in der Gegend besuchen konnte.
Das alte Haus war noch immer unbewohnt. Lisbeth stand oft und guckte mit Jens zusammen in den Garten hinein. Sie gedachte des vergangenen Sommers und sehnte sich in ihrer Einsamkeit nach dem Spielkameraden.
Ein besonderer Lichtglanz lag für Svend über der Erinnerung an den Sommer, den er einige Jahre später an der Nordsee verlebte.
Sein Vater hatte den Auftrag bekommen, einen Herrenhof, der abgebrannt war, wieder aufzubauen.
Sie wohnten in einem kleinen Haus, das am Fjord lag, dort, wo der Deich, der die ausgedehnten Ländereien, die zum Herrenhof gehörten, einfaßte, ins Land einbog.
Während der Vater auf dem Bauplatz beschäftigt war, streifte Svend allein umher.
Er lag in dem warmen Sand auf der Grenze zur Heide, in der dichten, bräunlichgrünen Decke, die weder Heidekraut noch Gras ist, aber etwas von beiden. Er lag und starrte in das feierliche, übermächtige Blau hinauf und füllte es mit Hoffnungen und Erwartungen.
Aus der Welt, die er kannte, formte er sich eine neue, größere und abenteuerlichere. Sie war nach seinem eigenen Bilde geschaffen. Er war ihr Mittelpunkt; und sie versprach ihm die Erfüllung alles dessen, was er sich wünschte.
Er dachte an das, was Großvater ihm vom Geschlecht der Byge erzählt hatte; er sah sie vor sich wie eine Reihe stattlicher Herren, die alle seinem Urgroßvater und dem alten König glichen.
Er war jetzt dem Bild mit den sich verneigenden Höflingen und der Schnupftabakdose entwachsen. Er sah sie jetzt in großen Handelshäusern, zwischen vielen geschäftigen Arbeitern, die ihrem Wink gehorchten und Tonnen zu ihrem Reichtum schleppten.
Er träumte davon, »Urgroßvater ähnlich zu werden«. Er füllte das Meer mit großen Schiffen unter vollen Segeln und mit weißen Galionsfiguren. Er träumte davon, wie er alle diese Schiffe dem König schenken wollte, wenn das Land in Not käme. Er gab sich Mühe, sich die Namen der Gutshöfe, die das Geschlecht besessen, ins Gedächtnis zurückzurufen. Er hatte sie in Großvaters Bibel mit den Silberspangen gelesen. Auf vergilbten Seiten hinten im Buche standen alle Familienmitglieder mit ihren Jahreszahlen aufgeführt, auf welchem Hof sie geboren, was sie erworben und was sie verkauft hatten. An einer Stelle stand – es las sich schon wie ein tiefer Seufzer – »wieder ein Hof, der dem Geschlechte verloren geht«.
Niemals empfand er die Einsamkeit wie eine Entbehrung. Im Gegenteil. In der Einsamkeit war er der Herr, der mächtige, der einzige, dessen Wille geschah. Für ihn allein erstreckte sich das Meer blank und blau; für ihn allein segelten die Wolken fernen Zielen zu.
4
Architekt Byge wunderte sich, daß er, der sonst so ungewöhnlich fest auf seinen Beinen gestanden hatte, in der letzten Zeit an Schwindel litt.
Seine Frau bat ihn, einen Arzt zu Rate zu ziehen, aber davon wollte er nichts hören. Er tat seine Arbeit wie gewöhnlich, ging von seinem Zeichenbüro, wo er zwei Assistenten beschäftigte, zu den Häusern, die er im Bau hatte, und wo er die Arbeit selbst beaufsichtigte.
Die Gewissenhaftigkeit, mit der er sich persönlich von der Güte des Materials und der Arbeitsausführung überzeugte, hatte zu seinem Ruhm, den er als Künstler für die reinen und einfachen Linien seiner Arbeit genoß, noch den eines ungewöhnlich tüchtigen Bauleiters hinzugefügt. Aber ein wohlhabender Mann war er nicht geworden. Er konnte nicht mit dem smarten Geschäftssinn der neuen Generation konkurrieren. Er lieferte nie einen Plan ab, ohne daß er organisch aus seinem Innern hervorgewachsen war, während viele junge Architekten nach der Schablone arbeiteten, so daß ein einigermaßen tüchtiger Assistent eine Arbeit, von der ihm Stil und Etikette angewiesen worden war, fertigmachen konnte.
Das langsame Tempo, das eine notwendige Folge dieser persönlichen Arbeitsweise war, bewirkte, daß Aufträge, bei denen es sich um Schnelligkeit handelte, an seinem Hause vorbeigingen. Da er sich nie darauf verstanden hatte, sich bei Autoritäten beliebt zu machen, weil er ihnen bei seiner ausgesprochenen Selbständigkeit ein unwillkürliches Mißtrauen entgegenbrachte, so wurden ihm nur selten öffentliche Bauaufträge übergeben. Zeitig hatte er darum der Hauptstadt den Rücken gekehrt und sich in der nächstgrößten Stadt des Landes niedergelassen.
Architekt Byge war auf das Gerüst gestiegen, um ein in Sandstein ausgeführtes Ornament, das hoch saß, zu begutachten.
In seinem Eifer trat er, um besser zu sehen, ganz an den Rand des schmalen Balkens, wie er es schon so oft getan hatte. Er mußte den Kopf weit zurücklegen; in dieser angestrengten Stellung, die ihn in seinen jüngeren Jahren nie geniert hatte, wurde er vom Schwindel ergriffen.
Arbeiter, die unten standen, hörten ihn einen Schrei ausstoßen. Sie sahen ihn nach einem Halt durch die Luft greifen; seine linke Hand streifte einen Pfosten, ohne zuzufassen.
Dann fiel er hintenüber, stürzte herab und schlug im Fallen mit dem Nacken gegen die Kante der hohen Planke, die den Bauplatz einfaßte.
Als die Arbeiter herbeieilten, sahen sie gleich, daß er tot war. Es war kein Blut und keine Quetschung zu sehen; aber aus der Schlaffheit des Kopfes, als sie ihn aufhoben, sahen sie, daß der Nackenwirbel gebrochen war.
Die Leute trugen ihn nach seiner Wohnung. Der Kopf fiel auf die Brust herab, und die fleißige, feste Hand, die während des letzten Jahres so mager geworden war, hing schlaff am Handgelenk.
Dies geschah am selben Tage, als Svend sein Abiturientenexamen machte.
Munter singend sprang er die Treppe hinauf und konnte es kaum erwarten, seine Studentenmütze zu zeigen, die er sich gekauft hatte.
Er sah die Etagentür weit offenstehen, und während sein Herz stillzustehen schien, wußte er mit der Kraft einer plötzlichen Eingebung, daß ein Unglück geschehen sei.
Als er durch die offenstehende Tür ins Schlafzimmer kam, sah er seine Mutter über das Kopfkissen gebeugt liegen. Ihr Rücken bebte unter einem lautlosen Schluchzen. Er sah, wie der eine Arm seines Vaters über den Bettrand herabhing, während seine Beine in lebloser Ruhe auf der Bettdecke ausgestreckt lagen. Kopf und Brust wurden von seiner Mutter verdeckt.
Die alte Ane stand an der Tür und weinte mit gebeugtem Kopf. Als sie ihm ihr tränenüberströmtes Gesicht zukehrte, das vor Schmerz und Mitleid bebte, war es mit seiner Fassung vorbei; und noch lange nachher erinnerte er sich des erbitterten, gegenstandslosen Zornes, der sich in den ersten Augenblicken mit dem Schmerz vermischte, ja, denselben fast noch überwog.
Nach dem Begräbnis zeigte es sich, daß Svends Vater, nachdem alles bezahlt war, nicht viel mehr als die Lebensversicherung hinterlassen hatte, die er in jungen Jahren für seine Frau gekauft hatte.
Svend begriff bald, daß er seiner Mutter nicht zur Last fallen durfte; seine Schwester Gerda war ja noch ein halbes Kind; er mußte sich seinen Unterhalt selbst verdienen und seiner Mutter eine Hilfe und Stütze sein.
Solange er lebte, sollte niemand, der zu ihm gehörte, Not leiden, das stand fest.
Er wollte, wenn er zum Semesteranfang nach Kopenhagen kam, gleich Nachhilfestunden und Schulstunden suchen, und was sich sonst einem achtzehnjährigen jungen Mann mit gutbestandenem Examen bieten mochte.
Mit einem tiefen Seufzer dachte er an all das, worauf er sich nach beendigtem Schulzwang hatte stürzen wollen.
Ach, es gab ja kaum eine Vorlesung, die in dem Halbjahrsprogramm der Universität aufgeführt war, die er nicht hatte hören wollen, von den Anfangsgründen des Sanskrit bis zu der Integral- und Differentialrechnung für Fortgeschrittenere.
Nein, nein! Er wollte nichts von alledem aufgeben.
Wer einen starken Willen besaß und warten konnte, der ging nicht einigen Schwierigkeiten aus dem Wege. Tagsüber wollte er für seinen Unterhalt arbeiten; des Nachts aber, wenn alles im Hause schlief, sollten die teuren Bücher hervorgeholt werden. So würde er schließlich alles erreichen, was er sich vorgenommen hatte. Diese Überlegungen erfuhren plötzlich und unerwartet eine Wendung durch ein Ereignis, das ungefähr einen Monat nach dem Tode seines Vaters eintrat.
Eines Tages empfing seine Mutter ihn, als er nach Hause kam, mit einem freudestrahlenden Gesicht. Es war ein langer Brief von Onkel Kasper gekommen.
Der Konferenzrat schrieb, daß er gehört habe, wie bescheiden sie nach dem Tode ihres Mannes leben müßten, und da er von anderer Seite in Erfahrung gebracht habe, daß ihr Sohn Svend ein begabter junger Mensch sei, der dem Namen der Familie Ehre machen könne, so habe er beschlossen, ihn in seinem Studium zu unterstützen, damit seine Laufbahn durch den plötzlichen Tod keine Verschiebung erleide. Er wolle sie darum bitten, ihm ihren Sohn auf einen kurzen Besuch zu schicken, damit sie gemeinsam die Wahl eines Brotstudiums treffen könnten.
Svends Mutter hatte den Konferenzrat nur bei vereinzelten großen Familienfestlichkeiten getroffen.
Sie kannte ihn als einen sonderbaren, etwas mürrischen Herrn, der sehr zurückhaltend war; ihr Mann aber hatte stets seine vornehme Persönlichkeit gelobt und auf seine unbeugsame politische Überzeugung hingewiesen, die dem Lande noch nutzbringender gewesen wäre, wenn man Charakterfestigkeit in Dänemark besser zu schätzen gewußt hätte. Denn als Onkel Kasper merkte, was die neue Zeit mit sich brachte, daß mit dem, was früher für Männer unantastbar gewesen war, gelost und gehandelt und geschachert wurde, da zog er sich tief enttäuscht zurück und wurde Zuschauer wie so viele der Besten.
Auch an das, was man von seiner Kleinlichkeit und seiner Knauserigkeit erzählte, hatte Architekt Byge nie recht glauben wollen. Er pflegte mit dem ihm eigenen warmen Lächeln hinter dem blonden Bart zu sagen:
»Wer zusammenhält, was er besitzt, pflegt immer in den Augen desjenigen, der sein Eigentum verschwendet hat und nun das des anderen begehrt, für geizig ausgeschrien zu werden.«
So wurde Svend denn ausgerüstet und mit seinem besten Anzug und den besten Ermahnungen seiner Mutter in die Hauptstadt geschickt.
5
Der alte Konferenzrat Byge lag auf seinem Roßhaarsofa, mit einer karierten Schlummerdecke über dem Leib, und hielt sein Mittagsschläfchen.
Das Fenster stand halb offen und klapperte mit seinem Sturmhaken bei dem milden Sommerwind, der vom Kalkbrennereihafen über das niedrige Stallgebäude herüberwehte.
Der Stallknecht fegte mit langen Besenstrichen vor der Wagenremise; aber der Konferenzrat hatte diese Geräusche schon so viele Jahre gehört, daß sie ihn nicht mehr zu wecken vermochten.
Da hörte das Fegen auf. Der Konferenzrat hatte durch seinen Mittagsschlummer die dunkle Empfindung, als ob zwischen Lars und einer fremden, hellen und offenen Stimme einige Worte gewechselt würden.
Kurz darauf erklangen feste Schritte auf der alten Treppe, und der alte gebrechliche Glockenstrang fing plötzlich an zu seufzen und zu keifen, wie es seine Gewohnheit war, bevor er sich richtig in Gang setzte. Wenn er aber erst einmal angefangen hatte, konnte er nicht wieder aufhören; noch lange nachher scharrte und gluckste es in der alten Glocke.
Der Konferenzrat erhob sich ärgerlich vom Sofa, hinkte zur Tür, öffnete die Tür zum Vorzimmer und rief mürrisch: »Herein!«
Er mußte noch einmal rufen. Da wurde an den Drücker gegriffen und gleichzeitig fiel draußen etwas rasselnd auf den Fußboden.
Der Konferenzrat schob die Brille auf die Nase und sah gereizt zum Schloß hin.
Was war denn das für ein Tölpel!
»Sie haben mein Schloß entzwei gemacht, Sie!« rief er zornig.
Er ging zur Tür und drehte von drinnen den Schlüssel um. Schließlich gelang es ihm, die Tür zu öffnen. Bevor er denjenigen, der mit der Mütze in der Hand draußen stand, näher ins Auge faßte, sagte er mit seiner mürrischen Greisenstimme:
»Geben Sie den Drücker her!«
Als er ihn bekommen hatte, trat er an das offene Fenster und rief in den Hof hinab: »Lars!«
»Jawohl!« klang es bedächtig zurück, während die Holzpantoffel über das Steinpflaster klapperten.
»Jemand hat meinen Drücker entzwei gemacht – komm herauf und sieh zu, ob du ihn wieder heil machen kannst.«
»Jawohl!«
Lars hatte schon häufig das alte, gebrechliche Schloß reparieren müssen, das der Konferenzrat um keinen Preis erneut haben wollte.
»Es wird schon bis zu meinem Tode aushalten!« pflegte er zu sagen.
Während Lars über den Hof klapperte, um Werkzeug zu holen, erinnerte der Konferenzrat sich des Fremden, der noch draußen stand.
Der kleine rundrückige Mann trippelte wieder ins Vorzimmer und sagte »Bitte!«, während seine kleinen scharfen Augen den Fremden über die Brille hinweg musterten.
Indem der junge Mann ins Zimmer trat und die Tür mit dem lädierten Schloß zu schließen versuchte, ohne dem Konferenzrat den Rücken zuzukehren, wies der Alte ihn in das nächste Zimmer hinein.
»Lassen Sie das Schloß nur,« sagte er in einem milderen Ton, »und kommen Sie herein!«
Im selben Augenblick hörte man Lars' schwere Schritte auf der Treppe. Der Alte ging hinaus und gab ihm den Drücker. Als er zurückkam, sagte er, indem er den jungen Mann mit dem hellblonden, hochgekämmten Haar, der aufrechten Haltung, den mageren Händen, die die Mütze nervös zerdrückten, betrachtete:
»Wer sind Sie denn eigentlich?«
»Ich bin Studiosus Svend Byge!« kam es hastig.
»Gottchen, Gottchen!« seufzte der Alte, und Svend sah, wie ihm die Augen hinter der Brille feucht wurden.
»Also das ist Jörgens Sohn – Svend Byge!« wiederholte er, indem er bei dem Namen verweilte, als ob jedes der Worte einen Schwarm von Erinnerungen in ihm hervorrief.
Dann klopfte er ihn auf die Schulter, nahm ihm seine Studentenmütze ab, die er einen Augenblick mit einem wehmütigen Lächeln betrachtete und legte sie auf einen Tisch am Fenster.
»Setz dich!« sagte er mit plötzlichem Eifer. »Setz dich hierher, Svend!«
Er führte ihn bei der Hand zu dem großen viereckigen Arbeitstisch vor dem Sofa, wies ihm einen Stuhl an, wo ihm das Licht voll ins Gesicht fiel und nahm selbst ihm gegenüber auf dem Roßhaarsofa Platz.
Es entstand eine Pause. Die Anrede war es, die Svend Schwierigkeiten bereitete. Er fand, daß er Großvaters Bruder nicht mit »Herr Konferenzrat« anreden konnte; aber »Onkel Kasper«, wie seine Mutter es ihm ans Herz gelegt hatte, konnte er auch nicht über die Lippen bringen.
»Wie geht es deiner Mutter?« fragte der Konferenzrat und zog sich die Schlummerdecke über den Leib.
»Danke, gut!«
Jetzt nahm er allen Mut zusammen:
»Ich sollte vielmals grüßen, Herr Konferenzrat, und für den Brief danken.«
»Nenn mich nur ›Onkel Kasper‹, Freundchen,« sagte der Alte mit einem freundlichen Lächeln in den blauen Augen, die ganz milde geworden waren, während sie nach den bekannten Familienzügen in Svends Gesicht suchten.
Der unwillkürliche nervöse Zug über dem rechten Auge, den hatte sein Bruder, Svends Großvater, auch gehabt, als sie Knaben waren.
Da die Schwierigkeit der Anrede nun glücklich aus der Welt war, verlor Svends Verlegenheit sich, und er gab frische, schnelle und präzise Antworten.
»Ja, ja, das war ein harter Schlag!« sagte Onkel Kasper, nahm die Brille ab und trocknete sich die Augen.
Svend mußte schnell zur Seite sehen, um die Augen nicht voller Tränen zu bekommen. Der Schmerz um seinen Vater war noch so frisch.
»Welchen Weg willst du denn gehen, Freundchen,« fragte der Konferenzrat und forschte über die Brille hinweg scharf in Svends großen hellen Augen.
Jetzt waren sie dort angelangt, wo Svend mit bangen Ahnungen einen Kampf voraussah.
Die Sache lag ja nämlich so, daß Svend noch keinen Weg gewählt hatte – jedenfalls keinen von den gebahnten, ausgetretenen, an die der Konferenzrat sicher dachte. Das lag ja schon in dem Wort »Brotstudium«, das der Alte in seinem Brief gebraucht hatte.
Svend Byge wollte gern arbeiten. Er wünschte nichts sehnlicher, als sich seinen Unterhalt selbst zu verdienen. Onkel Kasper sollte nur ahnen, was es seinen Stolz gekostet hatte, bis er sich dem Wunsch der Mutter gefügt und den Bettelsack auf die Schultern genommen hatte; denn etwas anderes war dieser Besuch eigentlich nicht.
Aber einen Vorteil dadurch erkaufen, daß er seinen Geist einengte, daß er sich von vornherein all dem Großen in der Welt verschloß, zu dem ihm das freie Schöpfen in der Wissenschaft, die unendliche und hohe Welt der Bücher, den Weg bahnen sollte – nein, davon konnte keine Rede sein.
Darüber war er sich klar geworden, lange bevor er an der gebrechlichen Glocke des Konferenzrats läutete.
Die ganze weite Welt, die jetzt offen und verheißungsvoll vor ihm lag, alles was man von ihr wußte und noch mehr dazu, das wollte er durchdringen und sich zu eigen machen.
Wenn der Konferenzrat ihn mit dem Eigensinn eines alten Mannes in Fesseln legen wollte, dann würde er antworten:
»Behalten Sie Ihr Geld! – Ich ziehe es vor, mich selbst zu ernähren. Dann habe ich meine Freiheit zum Studieren; und wenn die nicht ausreicht, so nehme ich die Nächte zu Hilfe.
Svend nahm seinen ganzen Mut zusammen. Ohne es zu wissen, warf er den Kopf in den Nacken und sah dem Konferenzrat offen ins Auge. »Ich habe noch keinen Weg gewählt!« sagte er. »Onkel Kasper« blieb ihm im Halse stecken.
Der Alte betrachtete ihn eine Weile stillschweigend.
Wie gut er diese hochmütige Haltung und das Zurückwerfen des Kopfes kannte! – Er selbst war in seiner Jugend so gewesen. Und Svends Vater erst! – Ja, ja, es war ein echter Byge, der da vor ihm auf dein Stuhl saß und dem Leben voll trotziger Erwartung entgegenblickte! – Ach ja, mit viel größeren Ansprüchen an das Leben, als es selbst im günstigsten Fall gewähren würde.
Wie hatte sein Vater darunter leiden müssen, wie hatte diese Unbeugsamkeit des Geschlechtes ihn in seiner Tätigkeit gehemmt und ihn um viele große architektonische Aufgaben gebracht. Diese Unbeugsamkeit hing mit vielem vom Besten im Menschen zusammen. Aber man brachte es zu nichts, bevor man nicht lernte, sie zu überwinden.
Dem Alten wurden die Augen feucht, er seufzte. Aber was half es? Was der Vater nie gelernt hatte, das mußte man versuchen, den Sohn zu lehren.
Der Konferenzrat rieb sich die mageren, eckigen Hände; Svend dachte, daß sie denen seines Vaters glichen, nur waren sie kleiner und zierlicher. Da sagte der Alte und wandte das Gesicht zum Fenster:
»Ich dachte, du wolltest weiter studieren?«
»Das will ich auch,« beeilte Svend sich zu erwidern. Dann stürzte er sich kopfüber in das Peinliche der Sache.
»Aber kein Brotstudium!« Svend hatte eine überraschte und scharfe Antwort erwartet. Der Alte aber wendete nur wieder den Kopf zu ihm um; und indem er sich im Sofa zurechtsetzte, als ob er dachte: »nun, diese Sache scheint ja langwierig zu werden«, sagte er sanftmütig und wie selbstverständlich:
»Wovon willst du denn leben, Freundchen?«
Svend ärgerte sich über die Sanftmut und über das »Freundchen«. Es verwirrte ihn und entwaffnete seine kriegerische Haltung.
»Ach, es gibt ja so viele Erwerbszweige!« sagte er mit einer flotten Handbewegung, als brauche er nur zu wählen.
»Da sind Schulstunden und – Nachhilfestunden – und – und Korrekturlesen – und so weiter!«
»Ja, schön. Ich spreche aber von einem Beruf. Denn du hast doch dein Abiturium nicht gemacht, um Korrekturen zu lesen, Freundchen?«
Der Konferenzrat machte sich in einem kleinen heiseren Lachen Luft, das ihn ins Husten brachte.
Svend bekam einen dunkelroten Kopf. Er fühlte sich bis ins tiefste verletzt. Dieser alte Zittergreis sollte nur wissen, was sich in seinem Innern bewegte, was Svend Byge alles in der Welt ausrichten wollte!
Da erinnerte er sich der inständigen Ermahnungen seiner Mutter: »Sei nur nicht großspurig, Svend; das kränkt alte Leute; er kennt dich ja nicht; und bedenke, daß er aus einer anderen Zeit ist als du.«
Er bezwang sich und sagte ausweichend: »Wie kann ich zwischen etwas wählen, was ich gar nicht kenne.«
»Hast du denn nicht Lust zu einem bestimmten Beruf?«
Was sollte er antworten? Die Wahrheit würde der Alte, der ja schon längst mit dem Leben abgeschlossen hatte, doch nicht verstehen.
Er wußte nur zu genau, daß der Konferenzrat lächeln würde, wenn er antwortete, daß sein Wahlspruch sei: nichts Menschliches soll mir fremd sein! – daß er sich eine Wissenschaft und Kunst umfassende Erkenntnis erwerben, von deren Zinnen er dann die Gebrechen des Daseins überschauen und sein Leben für deren Abhilfe opfern wolle.
Nach kurzer Überlegung beschloß er, die Wahrheit zu umschreiben:
»Ich wollte gern Sprachen und deren Entwicklung studieren – und Philosophie und Mathematik – und Ästhetik – und –«
»Also Humaniora mit anderen Worten!« unterbrach der Alte ihn; und nun lächelte er unumwunden.
»Ach ja, das ist ja sehr schön, Freundchen! – Aber man kann nicht alles auf einmal; und das sind brotlose Künste. Vor allen Dingen muß man leben, und dazu gehört ein Fach, das zu einer praktischen Tätigkeit führt. Wenn man nun aber Jurist oder Arzt oder vielleicht Geistlicher werden will, so sind das alles Fächer, die eine bestimmte Summe von theoretischem Wissen verlangen – eine abgerundete wissenschaftliche Erkenntnis, die auch an und für sich – ich meine, für die – äh – für die persönliche Lebensanschauung von großem Wert ist. Überleg dir das, Freundchen! – Hat man erst ein Fach und eine Tätigkeit – ›Lebensunterhalt‹ ist scheinbar ein Wort, das dir nicht gefällt, wie? – hi, hi! – hat man also erst festen Grund unter den Füßen und – äh – sein gutes, vernünftiges Auskommen, dann ist es Zeit, seinen Geist weiter auszubilden, wenn es einen dazu drängt. Man studiert Humaniora–man hat seine Passion, die man in seinem Otium pflegt. So hatte ich zum Beispiel einen guten Freund, der Oberlandesgerichtsrat war; außerdem aber war er ein großer Mathematiker. – Ach ja, der Wissensdrang ist eine schöne Sache, Freundchen, vergiß das nicht! – aber zuerst eine praktische Tätigkeit, die einen durchs Leben tragen kann. Man kann Frau und Kinder – denn du willst doch wohl auch mal eine Familie gründen, was? – hi, hi – man kann Frau und Kinder nicht mit Ästhetik ernähren! Das ist keine Tätigkeit, Freundchen – das ist eine Passion. Oder wie sagtest du vorhin – die Entwicklung der Sprachen? – Nun, das ist ein Fach, das es zu meiner Zeit nicht gab.«
Der Ton, in dem der Alte seine lange Rede gehalten hatte, war so freundlich, so väterlich, daß Svend trotz dem lebhaften Widerspruch, der sich in ihm regte, sich nicht gereizt fühlte.
Nur als der Konferenzrat davon sprach, daß er einst eine Familie gründen werde, hatte er kaum an sich halten können. Die Annahme, daß er – Svend – auf dem soviel Größeres ruhte – eine Familie gründen solle, war so komisch, daß er sich auf die Lippe beißen mußte, um nicht zu lächeln. Durch diese Munterkeit aber schlug seine Stimmung um. Er fühlte jetzt, daß er für das ganze schwere Geschütz von Argumenten und Energie, mit dem er sich gewappnet hatte, gar keine Verwendung haben würde. Auf einmal gefiel der Alte ihm recht gut; und er mußte immerwährend dessen Hände ansehen, die denen seines Vaters so ähnlich waren.
Es war klar, daß Onkel Kasper nur sein Bestes wollte, und man konnte ja nicht verlangen, daß er die Sache mit anderen Augen als mit seinen eigenen betrachtete. Er sprach aus seinen eigenen Erfahrungen heraus, und er konnte ja nicht wissen, daß er, Svend Byge, mit besonderen Augen betrachtet sein wollte.
Keiner, nicht einmal der leibliche Vater, konnte mit Sicherheit erkennen, daß man etwas Besonderes war. Andere mochten daran glauben, aber wissen, wissen konnte man es nur selbst.
Als der Konferenzrat sah, daß der junge Mann anfing, nachzudenken, meinte er, daß es das beste sei, die Sache nicht zu forcieren. Er kannte den Familienstarrsinn und wußte aus Erfahrung, daß man mit einem vernünftigen Wort am weitesten kam, wenn man es sich in der Stille seinen eigenen Weg suchen ließ.
»Ja, ja, Freundchen – ich verlange nicht – ich erwarte nicht, wollte ich sagen, daß du dich sofort entscheidest. Vielleicht ziehst du es vor, anderer Hilfe zu entbehren – hm! – das ist auch ein Standpunkt, der sich hören laßt. Aber darüber mußt du wohl lieber mit deiner Mutter beratschlagen.« Sie weiß den Wert des Geldes zu schätzen – dachte der Konferenzrat –, und kann die Mutter ihn nicht auf andere Gedanken bringen, so sind auch meine Worte umsonst.
In der kurzen Zeit, die sie miteinander gesprochen hatten, hatte der Konferenzrat selbst eine andere Anschauung bekommen.
Das ursprüngliche Motiv zu seinem Angebot war, außer dem Mitgefühl mit der Witwe, ein allgemeines Verantwortungsgefühl als Oberhaupt der Familie. Da er selbst kinderlos war, so wollte er das Seinige dazu beitragen, jungen, kräftigen Schößlingen an dem alten Stamm so gute Entwicklungsbedingungen wie möglich zu verschaffen.
Jetzt, als er Svend Byge kennen gelernt und so viele typische Familienzüge an ihm gefunden hatte, faßte er ein warmes persönliches Interesse für den jungen Mann.
Von neuem erwachte der Kummer in ihm, daß er selbst keine Kinder hatte. Da tauchte der Gedanke in ihm auf, den Vaterlosen zu seinem Sohn zu machen; erst aber wollte er ihn prüfen; er wollte genau wissen, was in ihm steckte; und entsprach er seinen Erwartungen, so konnte man weiter sehen. –
Es war nicht mehr eine Wohltätigkeits- und Familienangelegenheit für den Konferenzrat. Jetzt hatte sie ein persönliches Interesse für ihn bekommen. Svends Sache war auch zu der seinen geworden,
6
Svend und seine Mutter hatten den Brief des Konferenzrates so verstanden, daß Svend sein Gast sein sollte. Er war deshalb sehr erstaunt, als der Alte fragte, wo er eingekehrt sei. Etwas verlegen beeilte er sich zu sagen, daß er seinen Koffer vorläufig am Bahnhof gelassen habe, bis er ein billiges Hotel gefunden hätte.
»Meine Frau ist leidend, wie du wohl weißt; ihre Nerven sind angegriffen!« sagte der Konferenzrat gleichsam entschuldigend, mit einem forschenden Seitenblick. »Sie verträgt keine Abweichung vom Täglichen. Sonst hätte ich dich ja gern – äh – für einige Tage als unseren Gast behalten. Aber kehre im Hotel ›Skandinavien‹ ein, dort ist es gut und billig und sage dem Wirt, daß er mir die Rechnung schicken soll. – Mach jetzt einen Spaziergang, Freundchen! sieh dir die Stadt an, und komm zu Mittag zu uns; wir essen präzise sechs Uhr.«
In dem großen, altmodisch möblierten Salon war alles steif, korrekt, langweilig – von den langen, dunklen Gardinen vor den Fenstern, durch die man über den Garten auf einen großen Zimmerplatz blickte, bis zu den alten holländischen Stilleben, die in düsteren Rahmen symmetrisch an der Wand hingen.
Die Konferenzrätin war viel jünger als ihr Mann, kaum fünfzig. Sie war gewiß einmal schön gewesen. Die Züge waren regelmäßig, die Haltung vornehm. Als der Konferenzrat Svend hereinführte und ihn ihr mit einer gewissen Vorsicht vorstellte:
»Sieh, das ist Jörgens Sohn, von dem ich dir erzählt habe!« – da erhob die Dame sich mit Beschwer aus dem Sofa und reichte ihm eine kühle Hand, während sie ihn scharf mit braunen, stechenden Augen musterte.
Svend machte eine Verbeugung und wußte nicht, was er sagen sollte. Er fühlte, wie er unter ihrem Blick errötete.
Es war, als verbreite sie Kälte um sich her.
Onkel Kasper trippelte sichtbar nervös durchs Zimmer, während er unablässig seine kleinen Hände rieb. Wiederholt klopfte er Svend auf die Schulter. Es war, als empfinde er selbst die Kälte im Zimmer, und wolle Svend dafür schadlos halten.
Niemand sagte etwas. Der einzige Laut, der zu hören war, kam von zwei Filierstöcken, die mit regelmäßigen Zwischenräumen gegeneinander klapperten. Eine ältliche, soldatengerade Gesellschaftsdame saß mit einer großen Brille auf ihrer spitzen Nase am Fenster und filierte mit erstaunlicher, beleidigter Hast.
Onkel Kasper hatte gerade ihren Namen genannt – Fräulein so und so. Svend hatte ihn in seiner Verlegenheit nicht verstanden. Er sah nur, daß die lange Gestalt am Fenster wie auf Kommando in die Höhe schoß, als die Konferenzrätin sich im Sofa erhob.
»Hu,« dachte Svend und ihm schauderte – »der Alte hat es nicht sonderlich gemütlich!« Da meldete ein blitzsauberes Stubenmädchen, das ebenso vornehm aussah wie die anderen, daß angerichtet sei.
Etwas so Steifes und Furchteinflößendes wie dieses Mittagessen hatte Svend noch nie mitgemacht.
Es war fast wie im Examen, nur daß Svend sich damals im Gefühl seines Wissens freimütiger gefühlt hatte. Selbst Onkel Kasper verzichtete auf jegliche Konversation und wurde ganz still und fremd an dem großen, vornehmen, eiskalten Tisch mit der Konferenzrätin und dem Gesellschaftssoldaten.
Jedesmal wenn er von seinem Teller aufzublicken wagte, begegnete er dem prüfenden Blick aus den braunen, stechenden Augen der Konferenzrätin; weder ein Engel noch ein Teufel hätte ihn dazu vermocht, sie Tante zu nennen.
Noch lange, lange nachher erinnerte er sich dieses Mittags und dieses Blickes; und wenn er sich zu erklären versuchte, was dieser Blick eigentlich enthielt, so schien es ihm, als hätte er bei ihm nach Berechnung und Hintergedanken gesucht; und als er später begriff, welche Demütigung er enthalten hatte, da geriet er jedesmal bei dem Gedanken daran in Wut.
Das arme Familienmitglied, das es auf das Geld des reichen Onkels abgesehen hatte! – Jawohl, das hatte in ihrem Blick gelegen.
Noch zweimal besuchte Svend den Konferenzrat, der mit jedem Mal milder und freundlicher gegen ihn wurde, und schließlich rang Svend sich zu einem Entschluß durch, nachdem er auch von seiner Mutter, die Unrat witterte, einen langen, eindringlichen Brief bekommen hatte, mehr an die Zukunft als an den Augenblick zu denken, mehr auf das Urteil des Alters und der Erfahrung als auf sein eigenes zu bauen. Als er zum letztenmal in Onkel Kaspers Kontor stand und ihm mitteilte, daß er Jura studieren wolle, um nach beendigtem Examen sich ganz seinen Studien zu widmen – da rieb der Alte, der selbst ein hervorragender Jurist gewesen war, bevor er sich als Agrarier und Patriot für die Politik seines Landes opferte, vergnügt die kleinen Hände und sagte:
»Das ist eine gute Wahl, Freundchen!« Und er fügte mit einem warmen Glanz in den Augen jene Worte hinzu, die in Svends späterem Leben noch eine große Bedeutung bekommen sollten:
»Du sollst es nicht bereuen – wenn du Wort hältst und ein gutes Examen machst!«
Er wandte sich ab, und Svend schien es, daß er dadurch seine plötzliche Rührung verbergen wolle.
Dann beredeten sie, wie Svend sich am besten für den ziemlich beschränkten Betrag, den er sich monatlich bei Onkel Kaspers Bankier abholen sollte, einzurichten habe. Der Alte ermahnte ihn zur Sparsamkeit, und als spräche er von einer Familienerfahrung, die er einst auf eigene oder anderer Kosten teuer zu bezahlen gehabt hatte, fügte er hinzu:
»Vergleiche dich nie mit denen, die mehr haben als du. Glaube nicht, daß sie darum glücklicher sind als du; das kann man niemandem vom Gesicht ablesen, und jeder hat seine Sorgen. Versuche nicht mit denen zu wetteifern, sondern halte dich an das Deine. Du weißt wohl, Freundchen, solange man nicht schwimmen kann, soll man sich nicht ins tiefe Wasser wagen. Und eines will ich dir vor allen Dingen ans Herz legen: Mache nie Schulden und stürze dich nicht in eine Ausgabe, die du später vom Notwendigen abziehen mußt.«
Noch eines wollte Onkel Kasper ihm sagen. Es schien ihm schwer zu fallen; – er räusperte sich mehrere Male, aber erst als Svend bereits im Vorzimmer stand, mit dem Drücker in der Hand, den Lars repariert hatte, brachte er es heraus.
Während er seine Brille abnahm, die er umständlich putzte, sagte er:
»Siehst du, Svend, ich bin ja ein alter Mann, und mit meiner Gesundheit ist es nicht weit her. Darum wollte ich dir nur zu deiner Beruhigung sagen – äh – daß ich meine Frau von dem zwischen uns Vereinbarten in Kenntnis setzen werde, damit du meinen Tod nicht zu fürchten brauchst. Der soll nichts an der – äh – Unterstützung ändern.«
Svend war gerührt. Er wußte nicht, was er antworten sollte. Er meinte, daß es der Gedanke an den eigenen Tod sei, weshalb der Alte so vorsichtig, so gleichsam jedes Wort wägend, sprach.
Als er zum letztenmal des Onkels Hand drückte und sich zum Gehen wandte, wurde an der hinfälligen Glocke geläutet.
Svend beeilte sich zu öffnen; ein graubärtiger, munter aussehender Herr, mit einer sehr kräftigen Stimme, begrüßte den Konferenzrat aufs herzlichste, der sichtlich durch den Besuch belebt wurde.
Der Konferenzrat zog Svend wieder ins Zimmer herein und sagte mit einem Familienstolz, der Svend schmeichelte und ihn veranlaßte, sein artiges Wesen recht zu zeigen:
»Sehen Sie her, General – wissen Sie, wer dieser junge Mann ist?«
Der General musterte Svend mit wohlwollend zwinkernden Augen.
»Das ist ein Sohn von Jörgen – Jörgen Byge, dem Architekten, der auf so traurige Weise ums Leben kam. Sie haben ihn doch in früheren Jahren bei mir getroffen?«
»Ob ich Jörgen Byge gekannt habe!« Der General warf den Kopf zurück, sein Gesicht war ernst geworden. Er drückte Svend die Hand, indem er ihm fest ins Auge sah:
»Sie haben einen ausgezeichneten Vater gehabt, junger Mann. Werden Sie ihm ein würdiger Sohn.«
Svend bekam einen dunkelroten Kopf, und die aufsteigende Rührung übermannte ihn fast. Onkel Kasper klopfte ihm liebevoll die Schulter:
»Wir haben eben eine längere Unterredung wegen unserer Zukunft gehabt. Wir haben uns entschlossen, Jura zu studieren und nach fünf Jahren ein gutes Examen zu machen.«
Der General war jetzt wieder heiter. Er kniff das eine Auge zu und fragte schelmisch: »Und dann?«
»Das wird die Zukunft zeigen!« sagte Onkel Kasper kurz, gleichsam zurechtweisend.
Dann wandte er sich zu Svend, drückte noch einmal seine Hand und sagte:
»Also lebe wohl, lieber Svend! – Grüße deine Mutter – und Gott mit dir!«
Svend dankte noch einmal. Dann verabschiedete er sich vom General und ging hinaus.
Er sah Onkel Kasper nie wieder. Einen Monat nach Svends Besuch siedelte der Konferenzrat nach dem Familiengut in Jütland über. Seine Frau hatte das Stadtleben und die geselligen Verpflichtungen satt, und Onkel Kasper, der das Land liebte und sich nur notgedrungen in der Hauptstadt aufhielt, hoffte, daß die frische Herbstluft seinem geschwächten Stoffwechsel gut sein würde.
Als die Erntezeit vorbei war und die Luft anfing rauh zu werden, erkältete Onkel Kasper sich bei einem Ritt. Die Erkältung artete in eine heftige Nierenentzündung aus, und eine Woche später war er tot.
7
Gleich nach dem Begräbnis erhielt Svend ein Schreiben von einer altmodischen, steifen Hand, die er nicht kannte. Es war von der Konferenzrätin. Es lautete:
Herr stud. jur. Svend Byge!
Ich bestätige Ihnen hierdurch dieselbe Unterstützung, die mein Gatte Ihnen zu seinen Lebzeiten zukommen ließ, indem ich von der Voraussetzung ausgehe, daß Sie Ihre Studien nach Verlauf der festgesetzten fünf Jahre beendigt haben werden.
Mit freundlichem Gruß M. Byge.
P.S. Wollen Sie mich bitte wissen lassen, ob Sie den Frack Ihres verstorbenen Onkels haben wollen und seine juridischen Bücher.«
Dieser Brief von der Witwe seines Onkels kränkte Svend aufs tiefste. Dieselbe mißtrauische, ja fast beleidigende Kälte, die sie ihm damals bei seinem Besuch bewiesen hatte, sprach daraus.
Wofür hielt sie ihn? – Wie konnte sie es wagen, einem Byge, dessen Namen sie selbst trug, eine Unterstützung auf so kränkende Weise anzubieten?
Sie erfüllte ja nur ganz einfach eine Pflicht. Onkel Kasper hatte ihm selbst ausdrücklich gelobt, daß er durch seinen Tod keinen Verlust erleiden sollte.
Sein verletztes Ehrgefühl ließ ihn in der Nachschrift eine vorsätzliche Demütigung erkennen.
So arm waren weder Architekt Byges Witwe noch ihr Sohn, daß er darauf angewiesen war, die abgelegten Kleider seiner reichen Verwandten aufzutragen. Oh, das hätte Onkel Kasper ahnen sollen! – Aber es war ja klar, daß sie wie Hund und Katze zusammengelebt hatten. Möglich, daß Onkel Kasper knauserig und mürrisch gewesen war; aber er hatte das Herz auf dem rechten Fleck gehabt; er hatte einen noblen Charakter – das hatte sein verstorbener Vater auch immer gesagt.
Svend arbeitete sich schließlich in solche Wut hinein, daß er, ohne mit seiner Mutter zu beratschlagen, folgendes Antwortschreiben aufsetzte:
»Frau Konferenzrat Byge!
Indem ich Ihnen für Ihre geehrte Mitteilung danke, will ich nicht unterlassen zu bemerken, daß ich meinem lieben verstorbenen Onkel, der es mir möglich machte, meine Studien fortzusetzen, stets eine tiefempfundene Dankbarkeit bewahren werde.
Ergebenst
Svend Byge.
P.S. Es wird mir eine teure Erinnerung an Onkel Kasper sein, seine juridischen Bücher zu empfangen.«
Von dem Frack erwähnte er kein Wort. Er fand, daß es so am vornehmsten sei.
Als Svend kurz darauf seine Mutter von dem Geschehenen in Kenntnis setzte, bekam er einen sehr bekümmerten Brief von ihr.
So könne man älteren Leuten, die einem noch dazu helfen wollten, nicht schreiben. Jetzt habe er die Konferenzrätin wahrscheinlich gekränkt. Wer weiß, vielleicht habe Onkel Kasper selbst bestimmt, daß er seinen Frack erben solle. Vielleicht sei es gerade als eine Ehre gemeint.
Sein unseliger Stolz sei wieder einmal mit ihm durchgegangen. Wenn er es nicht lernen könne, sich vor denen zu beugen, die an Alter, Erfahrung, Reichtum oder Klugheit über ihm standen, so würde es ihm schlecht ergehen im Leben.
Außerdem erzählte seine Mutter, sie habe von Großmutter gehört, daß ein Testament von Onkel Kasper vorliege, daß aber keine Veränderung geschehen würde, solange Tante Mathilde lebe, auf deren Mitgift ein Teil des gemeinsamen Vermögens basiere.
Svend war zu Anfang von dem größten Eifer erfüllt gewesen, so schnell wie möglich mit seinen Studien fertig zu werden, um sich wieder als ein freier Mann zu fühlen.
Als er aber das Studentenleben näher kennen lernte und sah, wie verschwenderisch die anderen Studenten mit ihrer Zeit umgingen, da machte seine lebhafte Natur, sein Drang, das Leben kennen zu lernen, sich so heftig geltend, daß er nicht länger widerstehen konnte.
Ging er da des Vormittags von einer schematischen Vorlesung zur anderen und begrub sich, wenn er zu Mittag gegessen hatte, in große dickleibige Bücher, die die verwickeltsten Lebensverhältnisse behandelten, als seien es schematische Aufgaben, während der Lärm des lebendigen Lebens zu seiner Dachkammer herauftönte, und die Wolken am bleichen Herbsthimmel, der sich rein und hoch über schmutzige Dächer und verfallene Schornsteine wölbte, dahinjagten.
Nein, das konnte er auf die Dauer nicht aushalten. Er war doch ein Mensch wie die anderen. Was er während der ersten Zeit versäumte, würde er leicht einholen können, wenn er sich erst richtig ins Zeug legte.
Man konnte doch nicht von ihm verlangen – und das war auch sicher nicht Onkel Kaspers Meinung gewesen –, daß er Abend für Abend in seinem Dachstübchen sitzen und zusehen sollte, wie das Leben und die Jugend dort unten in dem Menschenstrom vorbei fluteten.
Zu Anfang bestand sein Lebensgenuß nun freilich nur darin, daß er nach dem Mittagessen mit seinen Studiengenossen im Restaurant sitzen blieb. Es wurde Domino gespielt, über brennende Zeitfragen diskutiert, Grog getrunken, und das Ende war schließlich, wenn die Kellner das Licht löschten, daß man sich gegenseitig nach Hause begleitete, bis die Straßen öde wurden und der Tag zu dämmern begann.
Wie trunken taumelte er dann am Vormittage aus dem Bett. Die Folge war, daß er die Vorlesungen versäumte. Er mußte sich die Kolleghefte bei einem fleißigen Studiengenossen leihen. Doch währte es nicht lange, bis er die ewige Schreiberei satt bekam und es aufgab.
Am Sonntag aber, wenn er verabredetermaßen nach Hause schreiben sollte, warf er sich seine Säumigkeit vor; doch brachte er sich nicht dazu, einen festen Vorsatz zur Besserung zu fassen. Denn sein zweites Ich – das, das sich nicht gebeugt hatte, als er die Verpflichtung gegen Onkel Kasper übernahm –, dieses Ich, das die Welt kennen lernen und dem nichts Menschliches fremd sein sollte, das setzte sich trotzig und heftig zur Wehr und pochte auf sein ursprüngliches Recht.
8
Svend hatte mit Mutter und Schwester zusammen eine Einladung von der Großmutter erhalten, die mit einer unverheirateten Tochter in der kleinen Grenzstadt Fjordby, in der Nähe ihres früheren Gutes, wohnte.
Er schwankte sehr, bevor er sich zur Reise entschloß. Seine Gedanken waren so weit von Familie und Heim abgeschweift. Er war fast blind geworden vom beständigen in die Zukunft Starren. Und doch fühlte er sich von so vielen Kleinigkeiten zurückgezogen.
Immer beim Wechsel der Jahreszeiten, zu Weihnachten oder Ostern, wenn die Tage lang und warm wurden und es in den Gärten und Anlagen von Syringen und Goldregen zu duften begann, stiegen die Erinnerungen aus seiner Kindheit in der Provinz in ihm auf.
Er dachte häufiger an seinen Vater als an seine Mutter, obgleich er fand, daß er ihr mehr ähnelte. Vielleicht lag es daran, daß sein Vater tot war und nur noch das Recht der Erinnerung besaß. Aber es war soviel Kleinliches und Unbedeutendes, so viel Mahnendes mit Hinblick auf unbedeutende Ziele in den bekümmerten Briefen der Mutter, daß er sich darüber ärgerte.
Obgleich die stets lebendige Mutterliebe aus jeder Zeile sprach, konnte er doch nicht darüber hinweg, daß die Briefe so an der Erde klebten.
Nur selten steckte die Laune plötzlich ihren Kopf hervor. Dann sah er das schelmische Lächeln in den warmen blauen Augen seiner Mutter, wie er es aus früheren Jahren kannte, und hörte ihr munteres, klingendes Lachen.
Das war eine andere Mutter gewesen als die, die diese langen bekümmerten Briefe schrieb – eine hoffnungsfroh lachende, das Leben und alles Gute und Schöne liebende Frau. So konnte Schmerz und Kummer den Charakter eines Menschen ändern.