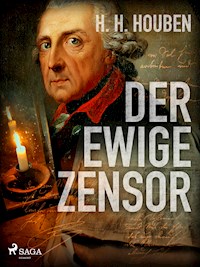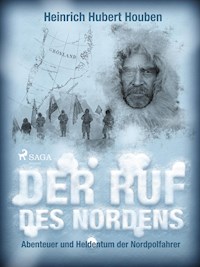
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Spannend und anschaulich wird in zahlreichen Kapiteln die Geschichte der Nordpolexpeditionen erzählt. Angefangen von den Normannen und den Missionaren, die Grönland besuchten, über Parry, Franklin, John Ross bis hin zu Nansen mit seiner "Fram" und Robert Peary, der neben Frederick Cook in Anspruch nahm, den Nordpol entdeckt zu haben. Biografische Anmerkung Heinrich Hubert Houben (1875–1935) war ein deutscher Literaturwissenschaftler und Publizist. Als Herausgeber mehrerer Einzel- und Werkausgaben mit biographischen Monographien, Aufsätzen und Quellenwerken hat Houben ein vielfältiges literaturwissenschaftliches Lebenswerk hinterlassen. In späteren Jahren hat Houben Reiseberichte bearbeitet (u. a. Werke von Sven Hedin) und geschrieben, die hohe Auflagen erreichten und in mehrere Sprachen übersetzt wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
H. H. Houben
Der Ruf des Nordens
Abenteuer und Heldentum der Nordpolfahrer
Saga
Nordpoldämmerung
Reisen — Entdecken — was ist es weiter als die große Sehnsucht des Menschen, hinter das Wesen aller Dinge zu schauen! Wir wissen nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht, wohin wir gehen. Um so stärker der Drang, das zu kennen, was um uns ist und unsern wachsenden Kräften erreichbar scheint. Wir wollen das Endliche begreifen, um davon auf das Unendliche, das Unerforschliche, das ewige Geheimnis zu schließen.
Je höher die Intelligenz, die Kultur eines Volkes, desto unwiderstehlicher wird ihr die Anziehungskraft nie betretener Räume unseres Planeten. Ein weißer, unentdeckter Fleck auf der Landkarte verfolgt den Forscher in seine Träume und läßt ihm keine Ruhe, bis er eine Lösung des Rätsels versucht hat. Aber welche Schwierigkeiten stemmen sich der Verwirklichung solcher Pläne entgegen, besonders für uns Deutsche! Im Kessel Mitteleuropas eingepfercht, ringsum an allen Grenzen gebunden, ohne Freiheit nach den Weltmeeren, in jahrhundertelangen inneren Kämpfen erst zu einer Einheit zusammengeschweißt, mußten wir die Aufteilung der übrigen Welt andern Nationen überlassen, die schon durch ihre Lage am Rande des kleinsten aller fünf Erdteile den Blick von Kind auf in die Ferne richteten und die Küsten und Länder jenseits der großen Wasser als herrenloses Gut betrachteten, wo es nur galt, rechtzeitig seine Fahne aufzupflanzen. Wir kamen zu spät und sollten nur Gast sein auf der übrigen Erde — und nicht einmal gern gesehener. „Dem Tüchtigen freie Bahn!“ bleibt immer nur der Wahlspruch des — Tüchtigen. Aber wie der Gefangene die kahlen Wände seiner Zelle mit Bildern von der Welt da draußen schmückt, so lebt auch in uns nur um so stärker die Neigung, unbekannten Fernen nachzusinnen in Buch und Bild.
Von jeher haben den Bewohner der gemäßigten Zone zwei Weltgegenden besonders angelockt: die heißen Länder um den Äquator und das Reich des ewigen Eises an beiden Polen. Die Pole, gedachte Punkte, die durch nautische Instrumente errechnet werden, die Endpunkte einer mathematischen Linie, der die sich drehende Erde durchbohrenden Achse, diese märchenhaften Regionen, wo das Jahr nur einen Tag von sechs Monaten und nur eine ebenso lange Nacht zählt, haben die Phantasie der Menschheit am meisten beschäftigt; man erhoffte von dort ungeahnte Aufschlüsse über die Natur unsers Erdballs, und nirgends in der Welt war der Zugang mit größeren Gefahren und Entbehrungen verknüpft. War? — Er ist es noch heute, und das Wort des alten Griechen Äschylos: „Nichts ist gewaltiger als der Mensch“, wird da, wo die Natur gleichsam alle ihre Kräfte zusammenrafft, zuschanden. Nur ganz vereinzelten Sterblichen ist es bisher gelungen, durch die sich immer wandelnde, immer neu wachsende Barriere des ewigen Eises einen Durchschlupf zu finden und bis zu den Mittelpunkten der Polfestungen vorzudringen. Den Südpol erreichten Roald Amundsen und, einen Monat nach ihm, Robert Scott; der letztere mußte den schwer errungenen Sieg mit dem Leben bezahlen. In die unmittelbare Region des Nordpols gelangten bisher ebenfalls nur zwei wagemutige Männer: Robert Peary und Frederick Cook — zwei unter Tausenden, die im Lauf der Jahrhunderte den Kampf mit dem Nordpol aufnahmen, in diesem Kampfe blieben oder im glücklichen Fall als ruhmvoll Besiegte den Heimweg in die südliche Welt zurückfanden. Die ersten Pfade zu den Polen sind also gefunden, die undurchdringliche Finsternis weicht einer matten Dämmerung, aber die Rätsel des Pols sind damit nicht gelöst; die schmalen Nebelwege jener ersten Pioniere gaben kaum einen Ausblick auf diese geheimnisvolle Welt, die sich weit und breit in ungeheure Ferne dehnt.
Nicht immer war es am Nordpol so kalt und unwirtlich. Dieser Angelpunkt der Erde, der sich alle 24 Stunden einmal um sich selbst dreht, muß früher anderswo gelegen haben — vielleicht im östlichen Europa. Mit dieser vor Jahrmillionen erfolgten Umlagerung der Erde waren Wandlungen der Erdoberfläche, Katastrophen der Erdkruste verbunden, die aller menschlichen Vorstellungskraft spotten. Sie schufen die zerklüfteten Gebirge Europas und die norddeutsche Tiefebene mit ihrem Sandboden, der ehemals Meeresboden war. Die Spuren der Vergangenheit konnten sie dennoch nicht verwischen — sie setzten ihr vielmehr eine Art steinernen Denkmals. Die reichen Kohlenfelder auf Grönland und Spitzbergen, wo heute nur niedriges Krüppelholz und armselige Kriechweiden gedeihen, sind der unwiderlegliche Beweis dafür, daß auch der Nordpol seine „gute alte Zeit“ hatte, in der eine reiche, südliche Vegetation ihn überwucherte. Gewaltige Baumriesen schlossen sich mit üppigem Rankenwerk zu Urwäldern zusammen und gaben ungeheuren pflanzenfressenden Säugetieren überreiche Nahrung. Daher der berühmte steinerne Wald auf Grönland in einer von Gletschern umgebenen Bergschlucht am Waigatsund; versteinerte Stämme und Äste liegen da in chaotischen Massen, und das rostbraune, eisenhaltige Gestein ist ganz mit ausgezackten Blättern, gleich denen unserer Eichen, durchsetzt. Auf Nowaja Semlja und an den Nordküsten Sibiriens, in grauenhaft öden Moorgegenden, wo heute kaum das Renntier seine karge Nahrung hat, fanden sich, tief im Moor versunken, riesige Skelette vorsintflutlicher Tiere, Mammute und Nashörner. Das sogenannte fossile Elfenbein — ihre langen Stoßzähne — ist in der baumlosen Wüstenei dieser „Tundren“ derart häufig, daß es Hügel ausfüllt; das Suchen danach und der Handel damit ist das einträglichste Gewerbe der Samojeden und Tschuktschen. Solche riesigen, pflanzenfressenden Tiere, die zum Frühstück gewiß eine stattliche Baumkrone entlaubten, hätten nie in einer Eiswüste leben können; sie brauchten eine üppige Sumpfvegetation wie die der indischen Dschungeln. Auch muß die vernichtende Erdkatastrophe urplötzlich über die Bewohner dieses vorsintflutlichen Paradieses hereingebrochen sein; dafür sprechen jene Skeletthügel, die Grabmäler ganzer Tierherden, die in Todesangst zusammenliefen und gemeinsam untergingen. Aus dem Sumpfeis der sibirischen Flußmündungen hat man sogar Tiere gegraben, die noch mit Haut und Haaren bedeckt waren. Auch das sogenannte „Noahholz“, steinhartes Holz aus unvordenklicher Zeit, fischt man häufig an diesen Küsten. Vielleicht war die Sintflut, von der die Bibel berichtet, von der in verschiedenster Form die meisten Ursagen erzählen — auch die der Eskimos — der letzte Ausläufer jener elementaren Katastrophen unseres Erdballs.
Betrachten wir einmal den Globus, wie er heute aussieht, so finden wir um den gedachten Endpunkt der Erdachse ein Meer angedeutet, oder eigentlich nur einen leeren Fleck, aus dem rundum nach Süden hin gewaltige Inselmassen sich vorschieben. Diese zerfallen in vier Hauptgruppen: Grönland, die größte Insel der Welt — mindestens viermal so groß wie Deutschland! —, östlich davon die weitverstreuten Inselgruppen Spitzbergen und Franz-Joseph-Land; weiter östlich die russischen Inselgruppen Nowaja Semlja und Wrangel-Land, und schließlich, von letzteren weit entfernt und näher an Grönland, der nordamerikanische Inselarchipel. Aber noch sind längst nicht die letzten Inseln des Eismeeres entdeckt; noch harren viele der auf unserm Globus nur angedeuteten Grenzlinien zwischen Meer und Land ihrer Ergänzung und Berichtigung.
Bis in die neuere Zeit hinein nahm man an, um den Nordpol gruppiere sich ein Kontinent, eine Landmasse, und die Phantasie nicht zu ferner Jahrhunderte noch dachte sich dort ein Wunderland mit milderem Klima und märchenhafter, nirgend sonst auf Erden zu findender Pflanzenwelt; hinter undurchdringlichen Eismauern sollte eine selige Insel träumen mit seltsamen Gewächsen und fabelhaften Tieren. Wie nahe kamen sich auch hier Ahnung des Dichters und unvordenkliche Wirklichkeit! Heute weiß man, daß dort seit Jahrtausenden das Eis sich auftürmt in starrer Einsamkeit. Bläulich weiß und glitzernd dehnen sich unendliche Gefilde; nirgends organisches Leben, nur die Stürme heulen durch die dunkle, kalte Halbjahrsnacht. Dicke Nebel oder das Gewirr eisiger Schneeflocken erfüllen die Luft. Manchmal in klaren Nächten strahlt das überirdische Wunder des Nordlichts auf: weißgrünlich glitzernde Lichtschlangen zucken von Osten und Westen zum Zenit empor und verbinden sich zu einer hehren Lichtkrone, die lange Bänder phantastisch über das schwarze Himmelsgewölbe flattern läßt. Nur wenige Stunden dauert das Schauspiel; langsam verrinnen die Lichtquellen wieder und verlieren sich im dunkeln All. Dann wandeln wieder die Gestirne über der schwarzen Nacht; der Mond gleitet seine leuchtende Bahn von Osten nach Westen und wieder nach Osten, am Firmament kreisend, ohne unter dem Horizont zu verschwinden. Gespenstisch gießt er sein Silberlicht über Schneefelder und Eisberge. Ist aber der Himmel bedeckt, sind vom Nebel alle Gestirne ausgelöscht, dann begräbt grausige Finsternis, wie ein ungeheures Gewölbe, die erstarrte Welt. Dann heulen die rasenden Stürme — das berstende Eis donnert und kracht — und das gebrechliche Schifflein der Polfahrer knarrt und krümmt sich stöhnend zwischen den andrängenden Eisschollen. Wie sehnt man sich da nach der Sonne!
Und endlich wird es wieder Tag — je weiter vom Pol entfernt, desto früher im Jahr. Anfang Februar lugt auf Spitzbergen die Sonne um Mittag über den Rand des Horizonts. Bald steigt sie sieghaft empor, bis sie die Nacht völlig verdrängt, und auf ein halbes Jahr ist nun sie die unumschränkte Herrscherin. Sie glitzert und funkelt in Milliarden Eiskristallen. Um Mitternacht läuft ihre glührote Kugel am Horizont entlang, ohne zu verschwinden. Der Glanz des Gestirns und die bläuliche Weiße der Eis- und Schneegefilde sind fast unerträglich für das Menschenauge, und es sehnt sich wieder nach der Nacht, wie ehemals nach dem fernen Tag.
Grüne Flächen, wo das Auge ausruhen könnte, gibt es nur wenige auf der arktischen Inselwelt. Meist starrt auch hier alles von Eis und Schnee; steile, wildgezackte Klüfte und Bergkegel erheben sich hier und da; nur selten ein geschütztes Tal, dessen Sohle sich mit grünem Moos und saftigem Gras bedeckt, in dem sogar eine bescheidene Blumenflora um ihr Eintagsdasein ringt.
Dennoch ist die Tierwelt der Arktis sehr mannigfaltig. Die größten Säugetiere der Erde scheinen sich aus vorsintflutlicher Zeit dort hinübergerettet zu haben. In den sich plötzlich bildenden Spalten des Meereises tummelt sich der riesige Wal; der kleinere Finnwal kommt bis an Norwegens Küsten herunter. Der Narwal mit seinem mächtigen Stoßzahn jagt in der Meerestiefe. Das häßliche Walroß mit seinem bärtigen Gesicht, aus dem zwei gekrümmte, gelbliche Hauer nach unten ragen, sonnt sich auf dem Packeis und schnauft vor Behagen; es findet sich meist im Kreis einer großen Familie. Auf dem Neueis sammeln sich die Seehunde mit ihren Jungen, rekeln sich in der Sonne und kratzen sich mit der tölpischen Finne, der Vorderflosse, die Seiten. An ihre unbehilflichen Jungen pirscht sich der Eisbär heran, der König der Arktis. In ungeheuren Schwärmen ziehen Eidergänse, Möwen und Lummen zu den einsamsten Klippen der Inseln, um dort zu brüten, und der Polarfuchs holt sich die frischesten Eier aus den für kurze Pause verlassenen Nestern.
Diese eigenartige, grausame Schönheit der arktischen Natur hat ihre dämonische Anziehungskraft seit Jahrhunderten auf die Menschheit ausgeübt, und der trotzige Widerstand der Naturkraft hat den Ehrgeiz tollkühner Abenteurer und wissensdurstiger Forscher fast bis zur Leidenschaft erhitzt. Wieviel Menschenopfer wurden dem Moloch Nordpol gebracht! Wieviel Widerstandskraft und Geistesgegenwart, Mut und Entbehrungsfähigkeit steckte schon in den mittelalterlichen Draufgängern, die über den Nordpol hin den Weg zu den Goldländern China und Indien suchten. Und heute, im Zeitalter der Wissenschaft: welch eiserner Fleiß, wieviel Scharfsinn und Kenntnis, wieviel hartnäckige Selbsterziehung gehört dazu, um, nach dem großen Vorbild Fridtjof Nansens, das bloße Abenteuer oder die Sportleistung zu einer Kulturtat zu erheben, an deren Ergebnissen die Wissenschaft der ganzen Welt teilhat. Wahrlich, ein großer Teil menschlichen Heldentums hat die Polarregion zum Schauplatz, und von diesem Heldentum sollen die folgenden Blätter erzählen.
Die erste deutsche Polfahrt
Mittelalterliche Reisebeschreibungen erzählen von den Ländern und Meeren des Nordens märchenhafte Geschichten. Die Inseln da oben seien von Waldmenschen bewohnt und bärtigen Weibern; in Sibirien, in der Gegend des Weißen Meeres, hausten Drachen, denen Menschenopfer gebracht würden. Uralte Saga berichtet von Amazonen, deren Töchter weißen Antlitzes und von schöner Gestalt seien; die Knaben dagegen hätten Hundsköpfe, die säßen ihnen auf der Brust; sie bellten statt zu sprechen; auf den Märkten Rußlands seien diese Mißgeburten zu kaufen. Auch Menschenfresser, die „Wizzis“, weißhaarige Wilde, lebten da irgendwo; ihre Hunde seien auf Menschenfang dressiert. In Fabeln von Riesen und von Zwergen, die wie Tiere behaart seien, kann sich die Phantasie des Mittelalters nicht genug tun.
Diese wilde Phantastik spukt auch noch in einer Erzählung, die auf den gelehrten Domscholastikus Adam von Bremen zurückgeht, der im übrigen mancherlei zutreffende Kunde aus dem Norden gehabt haben muß. Sie ist dadurch bemerkenswert, daß sie eine erste Polfahrt schildert, die von deutschen Seefahrern um das Jahr 1040 unternommen wurde, die erste deutsche Entdeckungsfahrt überhaupt, und sei, treuherzig wie der Chronist sie bietet, hier eingeschaltet:
„So erzählte mir auch der Erzbischof Adalbert seligen Andenkens, daß in den Tagen seines Vorgängers im Amte einige edle Männer aus Friesland nach Norden gesegelt seien, um das Meer zu erforschen, weil nach der Meinung ihrer Leute von der Mündung des Flusses Weser in direkter Linie nach Norden kein Land mehr zu finden sei, sondern nur das Meer, welches man die Liber-See nennt. Um über diesen interessanten Punkt die Wahrheit zu erforschen, setzten die verbündeten Genossen mit fröhlichem Jubelgeschrei vom friesischen Ufer aus. Indem sie auf der einen Seite Dänemark, auf der andern Britannien hinter sich ließen, gelangten sie zu den Orkadischen Inseln (wohl den Orkneyinseln). Diese ließen sie bei der Weiterfahrt zur Linken, während sie Norwegen zur Rechten hatten, und kamen so nach einer langen Überfahrt zu dem eisigen Island. Von hier durchschifften sie die Meere noch weiter bis zum äußersten Ende, indem sie dabei alle die obengenannten Inseln hinter sich ließen und ihr kühnes Wagstück und ihre Weiterreise dem allmächtigen Gott und dem heiligen Willebaldus empfahlen. Sie gerieten dabei aber plötzlich in jenen finstern Nebel des erstarrten Ozeans, den sie kaum mit den Augen zu durchdringen vermochten. Und siehe, da zog die unstete Strömung des Meeres, die dort zu den geheimen Anfängen ihrer Quelle zurückläuft, die bedrängten und schon verzweifelnden Schiffer, welche nur noch an ihren Tod dachten, mit heftiger Gewalt in ein Chaos hinein. Dort, so meint man, sei der Wirbel des Abgrunds, jene unergründliche Tiefe, in welcher der Sage nach alle Meeresströmungen verschlungen und aus der sie wieder hervorgespien werden, was man Ebbe und Flut zu nennen pflegt. Nachdem sie darauf die Barmherzigkeit Gottes angefleht, daß er sich ihrer Seelen annehmen möchte, riß die Gewalt des zurücklaufenden Meeres einige Schiffe der Gefährten ganz mit sich fort, andere aber warf sie auf einem langen Umwege wieder zurück. Diese halfen sich mit angestrengtem Rudern und wurden aus der Gefahr, die sie vor Augen hatten, mit Gottes rechtzeitigem Beistande gerettet. Nachdem sie jedoch so den Nebeln und der kalten Eisregion glücklich entronnen waren, bekamen sie unverhofft eine gewisse Insel in Sicht, die von hohen Klippen wie eine Stadt von Mauern ringsumher umgeben war. Sie gingen daselbst, um die Ortsgelegenheit zu beschauen, ans Land und fanden Menschen, die um die Mittagszeit in unterirdischen Höhlen verborgen waren. Vor den Eingängen dieser Höhlen lagen zahllose Gefäße von Gold oder von solchen Metallen, welche von den Leuten für kostbar und selten gehalten werden. Nachdem sie von diesem Schatze, soviel als sie schleppen konnten, zu sich genommen, wollten die Ruderer froh zu ihren Schiffen eilen. Plötzlich aber sehen sie rückblickend Männer von wunderbarer Länge, welche man bei uns Zyklopen nennt, hinter sich herkommen, denen Hunde von außerordentlicher Größe voranliefen. Einer der Gefährten wurde alsbald von ihnen gepackt und sofort vor ihren Augen zerrissen. Die übrigen entkamen jedoch zu ihren Schiffen, indem die Riesen sie noch, als sie schon auf hoher See waren, mit Geschrei verfolgten. Nach solchen Abenteuern und Schicksalen gelangten diese Friesen nach Bremen, wo sie dem Erzbischof Alebrand alles der Ordnung gemäß erzählten und darauf Christo und seinem Bekenner Willebaldus für ihre Rückkehr und Rettung Dank- und Sühneopfer darbrachten.“
Diese edlen Männer aus Friesland, die in fremdem Lande Kostbarkeiten, die unbeschützt am Wege lagen, einfach mitgehen hießen, waren offenbar an die Unrechten geraten! Wahrscheinlich waren sie an der Küste Grönlands zu einer Kolonie Normannen gekommen, deren hoher Wuchs, durch die Brille der Angst gesehen, Riesengestalt annahm. Tatsächlich hat man in den Überbleibseln solch alter Normannensiedelungen auf Grönland Bronzearbeiten gefunden.
Etwa 20 Jahre später sandte ein nordischer König Harald Hardrade (der Hartwaltende) eine Expedition zum Nordpol aus. Sie sollte, erzählt ebenfalls Adam von Bremen, das Meer jenseits Thules erforschen, aber auch sie kam, wie Pytheas, nicht weiter als bis zu dem mit finsterm Nebel bedeckten Ende der Welt und entging „nur mit genauer Not den entsetzlichen Abgründen“.
Schlimmer erging es in den folgenden Jahrhunderten vereinzelten ähnlichen Unternehmungen, von denen keine weitere Überlieferung zu uns gedrungen ist. Man weiß von einer Reise eines Prinzen von Wales, von den Fahrten der Gebrüder Viviani aus Genua, von Raubzügen der Araber, der „umherirrenden Brüder“, wie man sie nannte. Aber von all diesen Expeditionen meldet kein Lied, kein Heldenbuch; sie gingen sämtlich zugrunde. Erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts setzen die Entdeckungsreisen nach dem Norden mit neuer und größerer Tatkraft ein.
Normannen auf Grönland
Der erste, der Grönland, den arktischen Kontinent, erblickte, war ein Normanne, den im Anfang des 10. Jahrhunderts ein Sturm dorthin verschlug. Sein Nachfolger war Erik Rauda, der Rote, von Island, der normannischen Kolonie; eines Mordes wegen wurde er des Landes verwiesen und mußte sich eine neue Heimat suchen. Aufs Geratewohl segelte er nach Norden und erreichte Anno 982 eine fremde Küste, hinter deren Inseln und Vorgebirgen grünes Land schimmerte. Drei Jahre blieb er hier, dann trieb ihn Heimweh oder Grauen vor der Einsamkeit nach Island zurück. Hier erzählte er seinen Stammesgenossen so viel von dem neuentdeckten grünen Land, daß sich die Auswanderungslust regte und im nächsten Jahr gleich 25 Schiffe unter seiner Führung dorthin in See stachen. Die Hälfte von ihnen aber kam in den Stürmen um; die übrigen mit Erik Rauda gelangten glücklich ans Ziel. Nun begann eine regelrechte Siedlungsarbeit; Steine und Treibholz gab es in Menge, und so wuchsen die „steinernen Häuser“ aus der Erde, so daß die neue Kolonie bald ein stattliches Aussehen hatte. Eriks Sohn, Leif, machte eine Bildungsreise nach dem Stammland Norwegen und brachte das Christentum mit, das unterdessen dort Wurzel gefaßt hatte; er selbst taufte die grönländischen Ansiedler; nur sein Vater, Erik Rauda, wollte davon nichts wissen und blieb den alten Göttern Thor und Odin bis zum Tode treu.
Daß die Auswanderer von Island auf ihren leichtgebauten Schiffen überhaupt bis an die Küste Grönlands herankamen, ist nur so zu erklären, daß in jenen Jahren die Eisverhältnisse ungewöhnlich günstig waren; sonst wären die normannischen Segelschiffe gegen das Packeis völlig machtlos gewesen. Zwischen Island und Norwegen dagegen bestand damals schon eine Art regelmäßigen Schiffsverkehrs; fast alle Lebensmittel wurden aus dem Mutterland eingeführt, besonders auch Haustiere. Auf den Schiffen Erik Raudas kamen diese nun auch nach Grönland, und die dortigen Ansiedler lebten von Jagd und Viehzucht. Das Packeis schob den altgewohnten Wikingerfahrten einen Riegel vor, und bei den Ureinwohnern Grönlands, den Eskimos, war wenig zu holen. Diese Ureinwohner wurden von den großen, breitschultrigen Normannen Skrälingjar, d. i. Zwerge, genannt und wegen ihrer Kleinheit und ihres Schmutzes verachtet.
Es mag nicht eben die beste Auslese der Isländer gewesen sein, die dem Ruf Erik Raudas nach Grönland gefolgt war, und auch später noch erhielt die neue Ansiedlung durch solche Elemente, die Ursache haben mochten, sich dem heimatlichen Gesetz zu entziehen, manchen Zuzug. Aber die schwere Not des Lebens machte auch den Verbrecher zum Menschen, der sich in die Gemeinschaft zu schicken lernte. Eigentlich bewohnbar ist nur die Westküste Grönlands; in den kurzen Sommern überziehen sich die Täler dort schnell mit Gras, Kräutern, sogar mit zierlichen Blumen von prächtiger Farbe; aber der holde Zauber verschwindet ebenso schnell wieder, und eine Viehzucht in größerem Umfang kann bei der spärlichen Heuernte nicht gedeihen; der Winter dauert zehn Monate. Die weite Hochebene im Innern des Landes ist von Inlandeis bedeckt, das in riesigen Gletschern an der Ostküste zum Meere abstürzt und allem weiteren Vordringen unüberwindliche Hindernisse entgegenstellt. Trotz dieser unsäglich schweren Lebensbedingungen vergrößerte sich die Normannenkolonie sehr schnell. Als die Brüder Nikolo und Antonio Zeno aus Venedig im Jahre 1389 nach Grönland kamen, fanden sie dort in zwei Bezirken, dem Ostamt und dem Westamt, beide an der Westküste Grönlands, nicht weniger als 280 Höfe, 2 stadtartige Siedlungen mit einer Kathedrale und 15 Kirchen, dazu 3 Klöster. Ein Bischof, von Norwegen herübergesandt, residierte in Gardar; vom Jahre 900 bis zu seinem Verfall zählte das Bistum Grönland 16 Bischöfe. Die Gemeinde zahlte ihren Peterspfennig und sonstige Abgaben in Fellen, Tran und Lederriemen vom Walroß, ein Zeichen, daß die Jagd ihre Haupteinnahmequelle war. Vom Kloster zum heiligen Thomas berichteten die Venetianer, seine Zellen würden durch eine warme Quelle geheizt, an der die Mönche auch ihre Speisen kochten. Bei den Thermen von Unartok liegen noch heute die Ruinen dieses Klosters. Nordwärts sind die Normannen sehr weit an der Küste vorgedrungen; noch auf dem 72. Breitegrad fand man Runensteine, die auch lateinische Inschriften trugen. Im Süden sind die Ruinen jener alten Ansiedelungen sehr zahlreich; der Missionar Hans Egede fand dort sogar Reste einer bronzenen Kirchenglocke.
Die Pest, der Schwarze Tod, der im 14. Jahrhundert in ganz Europa wütete, wurde auch in diese nördlichen Regionen eingeschleppt; dadurch zerfielen die Kolonien in kurzer Zeit. Was noch am Leben blieb, rieb sich in den Kämpfen mit den feindlichen Ureinwohnern, den Skrälingern, auf und wurde schließlich von diesen ganz ausgerottet. Die alten Sagen der Eskimos singen noch heute von diesem Krieg gegen die „Kablunaken“, die Weißen. Daneben hat sich eine andere Sage von weißen Eskimos erhalten, die ganz im Norden wohnen und die letzten Nachkommen der alten Normannen sein sollen; bis heute aber hat sie noch kein Entdeckungsreisender zu Gesicht bekommen, und außer jenen Ruinen hat sich von alter normannischer Kultur auf Grönland und bei den Eskimos keine Spur mehr erhalten.
Im 14. Jahrhundert geriet dann Grönland zeitweilig ganz in Vergessenheit. Norwegen kam damals nach schweren Kämpfen unter dänische Herrschaft. Dänische Könige sandten auch Schiffe ab, um von der alten Kolonie in Grönland Kunde zu erhalten und sie tributpflichtig zu machen. So fuhr der „berühmte Seehahn“ Magnus Heinsen im Auftrag König Friedrichs II. von Dänemark nach Grönland; die Küste bekam er, wie er wenigstens glaubte, zu Gesicht, aber nur aus weitester Ferne; das Packeis versperrte ihm den Weg. Er aber versicherte nach seiner Rückkehr, daß unterseeische Gewalten oder ein „Magnetberg“ ihn festgehalten haben müsse. So sank das grüne Eiland wieder zurück in die Dämmerung mittelalterlicher Sage.
Am Nordpol vorbei nach Indien
Das Zeitalter der Kreuzzüge (1096—1291) setzte nicht nur die Christenheere des Abendlandes, sondern mit ihnen endlose Scharen unruhiger Geister und Abenteurer nach Osten in Bewegung. Märchenländer des Orients, Indien, China, Japan stiegen als eine wunderbare Fata Morgana am Horizont auf, und die drei Könige des Morgenlands, die dem Christuskinde in Bethlehem Gold und kostbare Gewürze dargebracht hatten, wiesen der Phantasie und der Habsucht des Abendlandes den Weg immer weiter nach Osten. Wenn aber die Erde eine Kugel war — von ihrer Größe ahnte man damals noch nichts —, mußte man das ersehnte Paradies, wo das Gold nur so auf der Straße lag, nicht auch von Europas Westküste aus jenseits des großen Wassers erreichen? Und gewiß viel leichter als auf dem unsäglich beschwerlichen Landwege, wo nur ein Heer wie das Alexanders des Großen sich hätte durchschlagen können. Erzählte die Sage nicht von Wikingerzügen, die der Sturm weit im Westen Grönlands an unbekannte Küsten verschlagen hatte? Das waren gewiß nur Inseln, die der andern Seite Asiens vorgelagert waren. Gelang es, in ihrem Schutz sich weiter durchzufinden, dann war das Rätsel des zaubervollen Ostens gelöst. Den Weg nach China durch die nördlichen Breiten suchte schon Giovanni Caboto, ein Italiener in englischen Diensten; 1497 betrat er, ein Jahr vor Kolumbus, das Festland Amerika, wahrscheinlich in Labrador. Sein Sohn Sebastian Cabot, der Begründer der englischen Flottenmacht, begleitete ihn auf dieser Fahrt. Um Indien zu finden, wagte es Kolumbus (1492), mit seinen drei Schiffen geradeaus über den Atlantischen Ozean zu segeln; erst 1504, zwei Jahre vor dem Tode des großen Entdeckers, kam ein Geograph Amerigo Vespucci in Florenz auf den Gedanken: das Festland, das Kolumbus auf seiner dritten Reise (1498) betreten habe, sei ein bisher unbekannter vierter Weltteil. Als dann Vasco de Gama 1497 den Seeweg nach Indien um die Südspitze Afrikas herum entdeckte und 1523 Magelhaes sogar einen Weg südlich um den amerikanischen Kontinent fand, im Süden also nach Osten und Westen hin die Fahrstraße frei lag, befestigte sich immer mehr die Überzeugung, daß solch eine Durchfahrt auch im Norden zu finden und dieser Weg nach Indien, am Nordpol vorbei, weit kürzer sein müsse. „Wenn die Natur eine gewisse Symmetrie beim Aufbau der Welt beobachtet habe,“ meinten die Gelehrten, „muß im Norden so gut eine Straße ins Stille Meer (den Großen Ozean) gehen wie im Süden, besonders wenn Gott in seinem Schöpfungsplan ein bißchen Rücksicht auf die Bedürfnisse des europäischen Handels genommen hat!“
Giovanni Cabot und sein Sohn Sebastian waren 1498 nicht weiter als bis zum 58. Breitengrad gekommen; hier zwang das Eis sie zur Umkehr, und die ersten Ansiedler, die sie in Neufundland, der „Kabeljauinsel“, aussetzten, fielen alle dem harten Klima zum Opfer. Auch auf seinen späteren Fahrten, 1517 an der Spitze eines großen Geschwaders, kam Sebastian Cabot zwar bis an die später so benannte Hudson-Bai, fand aber den nordwestlichen Durchweg nach Indien nicht, dafür eine andere Goldquelle, indem er die englischen Seeleute mit dem Walfischfang vertraut machte. Der unerhörte Fischreichtum dieser Gewässer lockte auch die andern Nationen an, und dieser Wettstreit klärte alsbald die Karte Nordamerikas nach allen Richtungen hin auf. In der Hoffnung, die nordwestliche Durchfahrt zu gewinnen, entdeckte der Franzose Jacques Cartier 1535 den Lorenzstrom und drang bis zum heutigen Montreal vor.
Da Sebastian Cabot im Nordwesten nicht durchgekommen war, richtete er sein Auge auf den Nordosten. Eine „Gesellschaft der Abenteuerfahrer“ wurde gegründet, und 1553 machten sich drei kleine Schiffe auf, um über Norwegen nach Osten China zu erreichen und dort und in Rußland neue Märkte für den englischen Handel zu gewinnen. Gelang es, vom Eismeer aus in die Mündung des Ob einzulaufen, dann konnte man, das lehrten die damals vorhandenen Karten, ganz Rußland durchsegeln und weiter auf dem Nebenfluß Irtysch bis an die Westgrenze Chinas kommen. Schon an der Küste Norwegens wurde das kleine Geschwader durch Sturm zerstreut, und von den drei Schiffen kehrte nur eines in die Heimat zurück. Die beiden andern froren in der Mündung des Warsinaflusses ein, und die gesamte Mannschaft kam in dem harten sibirischen Winter um. Nach Jahren fand man ihr Schiffstagebuch und ersah daraus, daß ihr Befehlshaber zum erstenmal die Küste Nowaja Semljas gesichtet hatte. Der erste, der diese Insel 1555 betrat, war der englische Generalpilot Bourrough; er entdeckte auch die Waigatsch-Insel; ins Karische Meer drang er aber nicht, „wegen der großen und furchtbaren Menge Eis, die wir vor unsern Augen sahen“; doch war für die Erschließung des Polargebiets die Feststellung einer so gewaltigen Insel wie Nowaja Semlja von größter Bedeutung. Spätere englische Versuche, die Nordostdurchfahrt zu erzwingen, waren ebenso erfolglos.
Ende des 16. Jahrhunderts nahmen die Holländer mit hartnäckiger Energie diese Versuche auf. Die ungeheure Hitze am Äquator, die furchtbaren Stürme im Indischen Meer und die lange Dauer der Reise von neun bis zehn Monaten schreckten sie, ebenso wie die Engländer, ab. Über den Norden hinweg hoffte man, das Ziel Indien schon in zwei Monaten erreichen zu können. Obendrein stieß der Handel der erst kürzlich vereinigten „Generalstaaten“ auf rücksichtslose Gegnerschaft bei andern Nationen; Spanier und Portugiesen, damals auf der Höhe ihrer Macht, behandelten den neuen Konkurrenten wie einen Seeräuber, kaperten die holländischen Schiffe und überlieferten die Mannschaft dem Inquisitionsgericht. Da oben im Norden lief kein Schiff Gefahr, die willkommene Beute dieser übermächtigen Feinde zu werden, und wenn sich der nordöstliche Weg nach China fand, boten sich dem holländischen Handel ungeahnte Möglichkeiten. 1594, 1595 und 1596 folgten einander drei Expeditionen zur Erkundung einer nordöstlichen Durchfahrt; ihr Führer war ein Seefahrer Wilhelm Barents aus Amsterdam, dessen Name die Reihe der Helden der Polarforschung verdientermaßen eröffnet.
Wilhelm Barents
Am 6. Juni 1594 stach die erste der drei holländischen Polarexpeditionen in See. Befehlshaber der vier Schiffe war der Admiral Cornelis Naij, die eigentliche Seele des Unternehmens der Steuermann Barents. Der Kurs sollte nördlich um Nowaja Semlja herumgehen. Am 15. Juni kreuzte das Geschwader vor der russischen Küste Lapplands. Von hier ging Barents mit zwei Segelschiffen nordwärts und erreichte auf dem 73. Breitengrad Nowaja Semlja, das er fast bis zur Nordspitze erkundete. Die Namen, mit denen er seine Entdeckungen bezeichnete, die Oranieninseln, Kap Nassau usw., führt unsere Landkarte noch heute. Schon gleich als sie festes Land betraten, hatten sie eines jener Abenteuer, die nun in den Berichten über Polarforschung alltägliche Begebenheiten werden, ohne dadurch aber an Gefahr, Aufregung und Spannung zu verlieren. Ein riesiger Eisbär, der die nie gesehenen Ankömmlinge für eine Abart der Seehunde halten mochte, die seine tägliche Mahlzeit bildeten, empfing sie mit erhobenen Pranken. Die Holländer gaben Feuer, und als das angeschossene Tier sich ins Meer warf, folgten sie ihm, um es lebendig zu fangen und wenn möglich mit nach Holland zu nehmen. Vom Boot aus warfen sie ihm eine Schlinge um den Hals und ruderten nun mit der Beute ihrem Schiff zu. Die Bestie brüllte, stemmte sich mit allen Vieren gegen diesen ungewohnten Transport und wühlte das Wasser so gewaltig auf, „daß man es kaum schildern kann“, wie ein Augenzeuge berichtet. „Wir müssen ihm mehr Leine lassen, damit er müde wird“, meinte ein Matrose. Man ließ das Seil lockerer und ruderte weiter, das schnaubende Tier im Kielwasser; Barents stand am Steuer und wehrte es vom Bootsrand ab. Plötzlich erhob sich der Bär hoch aus dem Wasser und klammerte sich an das Boot an. „Laßt ihn, er will sich nur ausruhen“, scherzte Barents — aber schon hatte sich der Bär mit einer gewaltigen Anstrengung emporgeschwungen, und die Männer wichen entsetzt in das andere Ende des Bootes zurück. Der Bär wollte ihnen folgen, aber die Schlinge saß glücklicherweise fest, und das Seil war stark und kurz. Ein beherzter Mann sprang hinzu und schlug ihn mit der Axt nieder. Auf die damaligen Feuerwaffen war noch wenig Verlaß; nicht einmal den Walrossen, die in riesigen Herden auf dem Packeis sich sonnten, konnte man damit beikommen.
Barents wäre gern noch weiter nach Norden vorgedrungen, aber das Eis war in drohender Bewegung, und seine Leute forderten murrend, zu den beiden andern Schiffen zurückzukehren. Bei der Insel Dalgey trafen sie auch glücklich die Kameraden, die unterdes eine nicht weniger abenteuerliche Fahrt gemacht hatten. Cornelis Naij war mit seinen beiden Schiffen an der Waigatsch-Insel gelandet und hatte hier Menschenspuren gefunden: Opferhügel, kunstvoll aus Bärenschädeln und Renntiergeweihen aufgetürmt, von Stangen überragt, deren Spitze ein roh geschnitztes Menschenangesicht zeigte, Augen und Mund mit Blut beschmiert, ein grausiges Wahrzeichen. Doch fanden sich in der Asche der Opferfeuer nur Renntier- und Bärenknochen. Bald stießen die Fremden auf Samojeden, die hier zu Hause waren und den Eindringlingen zuerst drohend mit Pfeil und Bogen entgegentraten. Es kam aber nicht zum Kampf, sondern man schloß Frieden und Freundschaft, die Samojeden besuchten die Holländer auf ihren Schiffen, und durch sie erfuhr Naij, daß die Karische oder Waigatsch-Straße fahrbar sei. Wirklich gelangte er in das Karische Meer, das er die neue Nordsee nannte, und wenn er auch bald vom Packeis aufgehalten wurde, gewann er doch die Überzeugung, daß zu guter Jahreszeit hier nach Osten durchzukommen, die Aufgabe der Expedition also gelöst sei. Im Karischen Meer entdeckte er eine kleine Insel, die er Staaten-Eiland nannte; sie war gebirgig und völlig unbewohnt, der Strand aber besät von einem gold- und silberglitzernden Gestein, das den Holländern als eine unschätzbare Kostbarkeit erschien und von dem sie Proben mitnahmen. Auf der Rückkehr trafen sie die beiden andern Schiffe, und alle vier kehrten nach Hause zurück, wo sie mit großem Jubel empfangen wurden.
Gleich im nächsten Jahr sandte die holländische Regierung eine zweite Expedition aus, um den Seeweg durch das Karische Meer nach Indien weiter zu verfolgen. Die geschäftstüchtigen Mijnheers beluden gleich 16 Schiffe mit kostbarem Tuch und Sammet, zum Austausch gegen die Schätze Indiens. Am 29. August landete diese Flotte in einer Bucht der Waigatsch-Insel. Die samojedischen Freunde belehrten sie über die diesjährigen Eisverhältnisse, und nun ging es weiter ins Karische Meer hinaus. Bei Staaten-Eiland warf man Anker, um zunächst eine tüchtige Ladung des kostbaren Gesteins, über dessen Art und Wert die heimatlichen Chemiker noch uneins waren, an Bord zu nehmen. Hier hatten Barents und seine Leute ein furchtbares Erlebnis, das ein alter Chronist nach den Berichten der Augenzeugen wirksam erzählt:
„Den 6. September 1595 kehrten einige Matrosen nach Staaten-Eiland zurück, um dort noch eine Tracht Kristallsteine zu holen, von denen sie bereits viel gesammelt hatten. Während die andern umhersuchten, legten sich zwei beisammen auf die Erde, um zu schlafen. Da schlich sich ein magerer Eisbär heran und packte den einen im Genick. Der Matrose, der sich nichts versah, schrie laut: ‚Wer faßt mich von hinten?‘ Sein Kamerad wandte sich um, erblickte das Tier, sprang auf und rief im Forteilen: ‚Ein Bär!‘ Die Bestie zermalmte ihrem Opfer den Kopf und leckte begierig sein Blut. Die übrigen Matrosen, etwa ihrer zwanzig, eilten mit Spießen und Flinten herbei. Als der Bär, der eifrig bei der Mahlzeit war, sie kommen sah, ging er mit unglaublicher Wut auf sie los, kriegte noch einen zu packen und zerriß ihn augenblicks in Stücke. Entsetzen faßte die übrigen, und sie rannten mit Angstgeschrei davon.
Als man an Bord das Schreien hörte, stießen sogleich Kähne ab, um die Flüchtigen aufzunehmen und ihnen zu Hilfe zu kommen. Die Matrosen vom Schiff, die nun ans Ufer kamen und das Unglück vernahmen, munterten die übrigen auf, nochmals mit vereinten Kräften auf das Untier loszugehen, aber die wenigsten wollten es wagen. ‚Unsere Kameraden‘, erklärten sie, ‚sind zerrissen; wir können sie nicht mehr retten.‘ Endlich wagten sich doch drei Mann vor. Der Bär verzehrte mit Ruhe seinen Raub und achtete gar nicht auf die drei Menschen, die nicht allzu fern von ihm standen. Zwei Matrosen schossen auf das Tier, verfehlten es aber; da ging der dritte, der Schiffsschreiber, vor und traf den Bären mit der Kugel in den Kopf oberhalb des Auges. Trotz dieser tödlichen Wunde ließ der Bär seinen Raub nicht fahren, faßte den Körper des Toten am Genick und hob ihn in die Höhe. Dann aber schwankte er; nun stürzten zwei Matrosen mit Säbeln auf ihn zu und hieben ihn in Stücke, ohne daß er auch jetzt seine Beute fallen ließ. Endlich erhielt er mit dem Flintenkolben einen Schlag auf die Schnauze, so daß er auf die Seite fiel, worauf der Schiffsschreiber ihm auf den Bauch trat und ihm die Gurgel abschnitt. Die beiden halb gefressenen Matrosen wurden auf der Insel begraben und die Bärenhaut später der Amsterdamer Handelskompagnie übergeben.“
Dieser Vorfall hatte die Teilnehmer der Expedition sehr niedergeschlagen, und da sich schon die Anzeichen des Winters bemerkbar machten, das Eis sich im Osten haushoch übereinander schob, glaubte Barents, die kostbare Ladung der 16 Schiffe nicht aufs Spiel setzen zu dürfen. Auch hatte man so viel von dem goldglimmernden Gestein, dessen Suchen zwei Menschenopfer gekostet hatte, eingeladen, daß die Expedition nicht mit leeren Händen nach Hause kam. Sie kehrte also um. Die kostbaren Gold- und Silbersteine aber erwiesen sich später als wertloser Bergkristall.
Die holländische Regierung hatte nach diesem Mißerfolg das Zutrauen zu dem Unternehmen verloren; sie begnügte sich damit, einen hohen Preis auf die Entdeckung der nordöstlichen Durchfahrt auszusetzen und überließ die Ausrüstung einer dritten Expedition der Amsterdamer Kaufmannschaft. Diese setzte zwei Fahrzeuge zu einem neuen Versuch in Bereitschaft. Das eine befehligten Barents und Jakob van Heemskerk, das andere Jan Cornelis Rijp. Zur Besatzung wählte man nur junge, unverheiratete Leute, die die Sehnsucht nach Frau und Kind nicht vorzeitig in die Heimat trieb, und am 20. Mai 1596, diesmal früher im Jahr, brach die dritte Expedition auf.
Am 9. Juli ging sie oberhalb des Nordkaps bei einer kleinen Insel vor Anker. Am übernächsten Tag, berichtet der Chronist, „gingen einige Freiwillige dort an Land und fanden viele Möweneier. Dort erstiegen sie den Gipfel eines sehr steilen Berges, kamen aber nur mit äußerster Lebensgefahr wieder herunter, indem überall unter ihnen hoch emporstehende Felsspitzen ihnen beim kleinsten Fehltritt mit unvermeidlichem Tod drohten. Sie mußten sich daher auf den Bauch legen und so die steilsten Stellen herunter rutschen. Barents, der von seinem Schiff aus sie beobachtete und sie schon für verloren hielt, warf ihnen, als sie zurückkamen, ihre unzeitige Verwegenheit in den bittersten Ausdrücken vor. Hierauf erlegten sie nach zweistündigem Kampf einen weißen Bären, dessen abgezogene Haut 12 Fuß in der Länge hatte. Davon erhielt die Insel den Namen Bäreneiland“. Diesen Namen hat die Insel behalten.
Von hier nahmen die beiden Schiffe ihren Kurs genau nach Norden; Rijp, der Befehlshaber des einen Schiffes, bestand hartnäckig darauf. Barents wollte sich nach Osten wenden, um Nowaja Semlja zu erreichen, wurde aber überstimmt. Vier Tage später entdeckten sie vor sich Land, eine völlig unbekannte Inselgruppe, die sie für den Ostzipfel Grönlands hielten. Von den Abhängen und Tälern der schroffen Uferfelsen und spitzen Berge lachte ihnen frisches Grün entgegen, Gras und saftige Kräuter, Sauerampfer und Löffelkraut, das ihnen als Medikament gegen den schon ausgebrochenen Skorbut hoch willkommen war. In den Felsritzen nisteten unzählige Vögel, die ein gewaltiges Getöse machten. Unter ihnen erkannten die Holländer die Rotgans, die auf ihrem Flug nach Süden auch in Holland einkehrt; sie hatten also hier deren Brutort festgestellt. „Wir gaben dem Land den Namen Spitzbergen wegen der vielen und hohen darauf befindlichen Spitzen“, gab Rijk nach seiner Heimkehr vor dem Delfter Magistrat zu Protokoll.
Um Spitzbergen herumzukommen, erwies sich aber als unmöglich. Beide Schiffe kehrten nach der Bäreninsel zurück, und hier kam es zwischen den zwei Befehlshabern zum Bruch. Der eigensinnige Rijp wollte noch immer nordwärts. Sie trennten sich daher, und Barents fuhr gegen Osten davon, auf Nowaja Semlja zu. Von dieser Fahrt sollte er nicht mehr heimkehren; das Eis verlegte ihm den Rückweg, und er wurde der erste Polarfahrer, der eine Überwinterung in der Arktis durchmachte.
Die erste Überwinterung im Polareis
Die nordsibirischen Samojeden, das wußte schon jeder Walfischfänger, pflegten am Ende des kurzen Sommers in ihre weit südlicher gelegene Heimat zurückzukehren. Auch die Eingeborenen des Nordens flüchteten also vor dem Grauen des Polarwinters. Ob überhaupt ein Mensch imstande sei, die ungeheure Kälte dort oben, die Schöpferin von Rieseneisbergen, die auch im Sommer nicht wegtauten, zu ertragen, in dieser Temperatur auch nur zu atmen und die lange Winternacht zu überstehen, ohne von Sinnen zu kommen, das hatte noch kein Europäer ausprobiert. Barents und seine Gefährten waren die ersten, die diese Probe bestanden.
Ende August 1596 waren sie um die Nordspitze Nowaja Semljas herumgekommen. Der Sommer war jedoch schon zu weit vorgeschritten, der Eiswall im Osten veränderte sich von Tag zu Tag, blieb aber undurchdringlich, die Aufgabe der Expedition erwies sich auch diesmal als undurchführbar. Zurück? Auch dazu war es nun zu spät. Die Eisschollen schraubten das Schiff hoch empor, das Steuer zerbrach, und die 16 Köpfe zählende Bemannung konnte noch von Glück sagen, daß sie in einer geschützten Bucht an der Ostküste (auf dem 76. Breitengrad) eine Zuflucht fand. Auf dem Schiff zu bleiben war unmöglich, es barst an mehreren Stellen, jede neue Bewegung des Eises konnte es in Stücke brechen. Man mußte also auf festem Land eine Unterkunft suchen, sich zunächst einmal ein Dach über dem Kopfe schaffen. Wo aber Brenn- und Bauholz hernehmen an dieser völlig baumlosen Küste?
Auf diese angstvolle Frage fand sich eine überraschende Antwort. Die Meeresströmung hatte massenhaft Treibholz, ja ganze Baumstämme auf den Strand geworfen. Renntierspuren zeigten sich, landeinwärts entdeckte man sogar einen Fluß mit süßem Wasser. Das nackte Leben schien fürs erste gerettet. Alle Hände griffen zu, um schleunigst eine Winterhütte zu errichten, denn die Tage wurden schon unheimlich kurz und die Kälte so heftig, daß, wenn die Arbeiter einen Nagel in den Mund nahmen, die Haut der Lippen daran hängen blieb. Am 2. Oktober war die erste Winterhütte im Polareis unter Dach: 10 Meter lang, 6 Meter breit; drei Türen, keine Fenster, in der Mitte des stallartigen Raumes die Feuerstelle, im Dach darüber ein breiter Kamin zum Abzug des Rauches. An der einen Längswand wurden die Schlafkojen angebracht; eine große Weintonne mußte sich in ein Dampfbad verwandeln lassen und wurde nach Vorschrift des Schiffsarztes allwöchentlich benutzt. Einrichtungsgegenstände wurden auf schnell gebauten Schlitten vom Schiff herübergeholt, die Wände der Kajüte abgerissen und zum Ausbau der Hütte verwandt. Mit am Strand gesammeltem Seegras dichtete man die Ritzen. Brennholz wurde in nächster Reichweite aufgestapelt, die Lebensmittel barg man in Holzschuppen. Die Schaluppe zog man auf den Strand; wenn das Schiff, wie zu befürchten stand, verlorenging, war sie ja im nächsten Sommer das letzte Rettungsmittel. Als Merkzeichen errichtete man bei der Hütte einen Baum aus Schnee, damit sich niemand auf dem Weg zum Schiff oder zum Fluß verirrte. Oft brach der Schneesturm so schnell herein, daß die Matrosen auf dem Eis draußen alles stehen und liegen lassen mußten, um sich in Sicherheit zu bringen. Der Boden um die Hütte herum war so durchfroren, daß kein Feuer ihn erweichte; und doch war ein Erdwall ringsum unentbehrlich, vor allem als Schutzwehr gegen die immer zudringlicher werdenden Bären, die fast täglich Schiff und Hütte in Belagerungszustand versetzten. Anfangs hatte lautes Geschrei sie verscheucht; aber bald ließen sie sich dadurch nicht mehr beirren. Wenn die Mannschaft bei Einholung der Schiffsvorräte alle Hände voll zu tun hatte und die brennende Lunte für die noch höchst unvollkommenen Flinten nicht zur Hand war, mußte man sich mit Spießen und Äxten der hungrigen Raubtiere erwehren. Einmal hing das Leben von Barents selbst an einem Haar. Alle Mann waren beim Schiff beschäftigt, als plötzlich drei Bären herankamen. Die Leute retteten sich Hals über Kopf auf das Schiff; zwei Spieße waren ihre einzige Waffe. Barents nahm den einen, le Veer den andern. Einer der Matrosen war bei der Flucht in eine Eisspalte geraten; aber die Tiere liefen an ihm vorüber und begannen das Schiff zu erklettern. Was an Gegenständen zu greifen war, warfen die geängstigten Leute den Bestien an den Schädel; diese fielen über jedes Scheit Holz mit Wut her, ließen sich aber nicht abschrecken. Barents befahl, eine Handvoll Pulver anzuzünden, aber in der Verwirrung kam man damit nicht zustande. Da warf er seinen Spieß, die einzige Waffe, auf das größte der andringenden Untiere und — traf es so glücklich in die empfindliche Schnauzenspitze, daß es laut auf heulte und alle drei Reißaus nahmen. Daß alle diese Begegnungen mit Bären glücklich abliefen, ist erstaunlich genug. Das Fett erlegter Bären diente als Öl für die Hüttenlampe; gegen das Fleisch der Tiere aber hatten alle eine unüberwindliche Abneigung.
Am 20. Oktober hatte sich die ganze Mannschaft in der Hütte häuslich eingerichtet. Am 3. November blickte die Sonne zum letztenmal über den Horizont; dann blieb sie verschwunden, und am klaren Himmel stand Wochen hindurch ohne unterzugehen der Mond. Bei schlechtem Wetter war es so finster, daß Tag und Nacht nicht zu unterscheiden waren.
Ein Gutes aber hatte auch die Finsternis: die Bären waren verschwunden. Dafür zeigte sich eine Menge Füchse; man fing sie in Fallen und gewann damit eine unschätzbare Bereicherung der Speisekammer. Die vorhandenen Vorräte reichten für den ganzen Winter unmöglich aus; Dörrfisch und -fleisch, Speck und Grütze waren noch einigermaßen da; die bisherige Tagesration Schiffszwieback aber mußte schon eine Woche vorhalten. Als Getränk diente geschmolzenes Schneewasser, das mancherlei Krankheiten verursachte. Bis zu dem Süßwasserfluß konnte man sich in der Dunkelheit nicht mehr zurechtfinden. Kleidungsstücke waren reichlich da, aber Hemden und Bettlaken mußten schließlich auch einmal gewaschen werden. Sobald aber die Wäsche aus dem heißen Wasser kam, fror sie im Nu hart wie ein Brett und ließ sich nur mit äußerster Sorgfalt unmittelbar am Feuer wieder auftauen und trocknen. Ins Freie konnte man tagelang nicht, denn ungeheure Schneemassen bedeckten lawinenartig die Hütte; der Kamin verstopfte sich immer aufs neue; von den Türen aus mußte man Stollen durch den Schnee graben. Am 6. Dezember fror es so ungeheuer, daß die Mehrzahl der Matrosen die Hoffnung aufgab, jemals lebendig aus dieser Eisgrube herauszukommen. Am nächsten Tag holten sie vom Schiff einen Vorrat Steinkohle, die kräftiger einheizte als Holz; in der Nacht aber wäre beinah die ganze Mannschaft im Kohlendunst erstickt; die meisten lagen schon in schwerer Betäubung, nur einige hatten noch die Kraft, zur Tür zu taumeln, und retteten sich und ihre Kameraden. Das Leder der Schuhe fror steinhart an den Füßen und war nicht mehr zu brauchen; die Leute machten sich aus mitgebrachten Hammelfellen und den frisch erbeuteten Fuchsbälgen so etwas wie Wasserstiefel und zogen noch drei, vier Paar Strümpfe darüber. Das Feuer schien alle Wärme verloren zu haben. Wasserwrasen und Ausdünstung bedeckten als Reif die Wände und bildeten Eiszapfen an den Dachbalken. Auch die Kleider waren wie mit Glatteis überzogen; wer einige Zeit im Freien verweilte, bekam an Gesicht, Lippen und Ohren Eiterbeulen, die sofort gefroren. Aber Barents verstand es, trotz aller dieser Leiden keinerlei Verzagtheit oder gar Verzweiflung aufkommen zu lassen. War die Arbeit getan, machte Schnee und Sturm jeden Aufenthalt draußen unmöglich, dann vertrieb man sich die langen Stunden mit Unterhaltung und Spiel. Das Dreikönigsfest zu Anfang des neuen Jahres wurde sogar mit einer solennen Feier begangen. Man war so vergnügt, daß man dem Eisstaat Nowaja Semlja eine königliche Verfassung gab; das Los wurde gezogen, wer Fürst dieser Einöde sein sollte, und der Feuerwerker als glücklicher Gewinner zum König von Nowaja Semlja gekrönt.
Der 13. Januar war ein besonders denkwürdiger Tag. Das Wetter war ruhig und klar, der Neumond aber noch nicht sichtbar, und einige Leute trieben sich im Freien herum. Da erscholl plötzlich lauter Jubel: wenn man eine Kugel über die eisharte Erde warf, sah man sie rollen! Das war ein Anblick, den man seit zweieinhalb Monaten nicht mehr gehabt hatte! Ein erster Schimmer von Tageslicht machte sich also bemerkbar.
Als am 24. zwei Mann am Strand entlang wanderten, erblickten sie ganz unvermutet am Horizont auf einen Augenblick einen schmalen Randstrich der Sonnenscheibe. Barents zwar lachte sie aus, denn nach seinen Berechnungen war die Sonne erst in zwei Wochen zu erwarten. Darüber gab es einen erregten Wortwechsel; Wetten wurden geschlossen, und Barents verlor sie! Denn als sich nach zwei düstern Nebeltagen das Wetter aufklärte, stand die Sonne in ihrer ganzen Größe am Himmel. Durch das Stillstehen der Uhr infolge der Kälte und durch die unaufhörliche Nacht war die Zeitrechnung so durcheinander gekommen, daß zwei Wochen unterderhand verschwunden waren. Die Gefangenschaft der Holländer schien dadurch wundervoll abgekürzt, und mit der Wiederkehr der Sonne glaubte jeder, das Schlimmste überstanden zu haben.
Immer drohender aber wurde jetzt die Lebensmittelfrage. Die Zeit der frischen Fuchsbraten war mit Wiederkehr der Sonne vorbei, dafür zeigten sich wieder die Bären. Am 13. Februar wurden Barents und seine Leute unangenehm genug an sie erinnert. Die Matrosen waren eben mit Reinigung der Fuchsfallen beschäftigt, als ein ungeheurer Bär erschien und geradewegs auf die Hütte losging, als wenn er dort zu Hause wäre. Ein glücklicher Schuß streckte ihn nieder. Das Tier lieferte über 100 Pfund Fett; nach langer Pause brannte endlich wieder die Tranlampe im gemeinsamen Wohn- und Schlafzimmer.
Mitte April ließ die Kälte nach. Der erste Ausgang galt dem Schiff. Mit welcher Spannung kletterten die Leute über das Meereis, das sich wie eine Stadt mit Häusern und Zinnen, Türmen und Wällen vor ihnen erhob! War ihr Schiff von der Eispressung zertrümmert und überhaupt noch eine Spur davon zu entdecken? — Es lag wirklich noch da, wie ein Pfand sicherer Rettung, anscheinend in dem alten Zustand, nur völlig vereist außen und innen und eingefroren in unergründlich tiefe Eismassen. Andern Tags zeigte sich in der Ferne schon blinkendes, offenes Wasser. Die Leute waren nicht sonderlich mehr bei Kräften, die Tagesrationen waren immer schmäler geworden, aber bei diesem wunderbaren Ausblick waren etliche nicht mehr zu halten, sie wagten ihr Leben, um über das gefährliche Eisbollwerk bis zum offenen Wasser vorzudringen — die rauschende Welle war Erlösung, Freiheit, neues Leben! Am folgenden Tag trieb ein heftiger Südwest gewaltige Eismassen vor sich her. Wenn er nur immerzu blasen und bald auch das Schiff aus seinem Eispanzer befreien möchte!
Diese kostbarste Beute schien aber das Eis nicht wieder herausgeben zu wollen. Die Massen waren in gewaltiger Bewegung, nur noch 70 Schritt vom Schiff bis zum offenen Wasser! Über Nacht aber setzte sich das Treibeis wieder fest, nun waren es wieder 500 Schritt! Neue Schneefälle hielten tagelang die Besatzung in der Hütte eingeschlossen, der Sturm brauste — vielleicht trieb er die ganze Eisdecke mit Schiff und allem ins Meer hinaus! Das Schiff aber lag unbeweglich, wie für die Ewigkeit verankert — überall brach die Eisdecke, setzten sich die Berge und Bänke in Bewegung —, nur die Masse um das Schiff schien bis auf den Grund hinunter ein einziger, unauflösbarer Kristall geworden zu sein. Und wer konnte wissen, ob das Fahrzeug, vom Eise befreit, nicht im ersten offenen Wasser sank? Noch einmal die kurze Sommerzeit versäumen? Das war das sichere Todesurteil für alle.
Der Mannschaft bemächtigte sich quälende Unruhe. Fort von hier, sobald wie möglich, auf irgendeine Weise! Wenn nicht mit dem Schiff, dann in der offenen Schaluppe! Es kostete Barents schwere Mühe, die Ungeduld der Leute zu zügeln, um diesmal nicht durch ein „Zu früh!“ neue Gefahr heraufzubeschwören. Um Zeit zu gewinnen, verlangte er, daß neben der Schaluppe auch ein Boot segelfertig gemacht werden müsse; es lag unter vereisten Schneewehen, und seine Freilegung war für die schlaffgewordenen Muskeln der ausgehungerten Mannschaft ein schweres Stück Arbeit. Die Leute murrten — lieber heute als morgen mit der Schaluppe los! „Wollt Ihr nicht,“ rief ihnen Hemskerk zu, „dann bleibt nur freie Bürger von Nowaja Semlja, seht aber ja zu, daß Ihr wenigstens rechtzeitig Euer Grab fertig macht. Mit der Schaluppe allein ist’s nicht zu wagen, wir brauchen das Boot, wenn es uns überhaupt gelingen soll, wieder nach Hause zu kommen.“ Die Leute sahen das ein und griffen zu Äxten und Spaten. Mitten in der Arbeit erschien plötzlich ein Bär. Alles stürzte zur Hütte, die besten Schützen verteilten sich an den drei Eingängen, ein vierter postierte sich aufs Dach. Das Tier war aber so schnell hinter ihnen her, daß dem Schützen, auf den es zunächst losging, kaum noch Zeit und Raum blieb, die Flinte zu erheben. Versagte der Schuß, dann war der Mann verloren, der Bär drang in die Hütte, und es blieb nicht bei dem einen Opfer. Aber der Schuß saß, die Bestie prallte zurück und brach zusammen. Wenige Tage später wurde ein zweiter Bär zur Strecke gebracht, und diesmal überwand der Hunger das bisherige Vorurteil gegen Bärenfleisch; man briet die Leber des Tieres und ließ sie sich schmecken. Unglücklicherweise war man dies eine Mal an ein offenbar krankes Tier geraten, die Mahlzeit bekam den Leuten so schlecht, daß sie sich für vergiftet hielten; doch erholten sich alle wieder; nur schälte sich ihre Haut ab vom Kopf bis zu den Füßen.
Am 7. Juni waren beide Fahrzeuge segelfertig. Ein heftiger Südweststurm mit Schnee und Hagel verzögerte noch die Abreise. Zur Ausbesserung der Schaluppe hatte man die Wandverschalung der Hütte abgenommen und konnte sich nun kaum mehr vor der eindringenden Nässe schützen. Am 12. konnte man sich endlich wieder hinauswagen. Zwei schwere Arbeitstage kostete es, bis die beiden offenen Boote mit Proviant, Tauwerk usw. beladen waren; dabei durfte zu Schaufel und Spitzhacke die Waffe nicht fehlen, denn die Bären schienen es sich in den Kopf gesetzt zu haben, die Flüchtlinge keinesfalls ohne blutigen Tribut davonkommen zu lassen.
Barents, der seit einiger Zeit kränkelte, benutzte die letzten Tage dazu, einen ausführlichen Bericht über seine Reise und über den auf Nowaja Semlja verbrachten Winter niederzuschreiben. Das Papier wurde in ein Pulverhorn verschlossen und am Kamin aufgehängt, damit Polarfahrer, die ein Zufall vielleicht nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten hierhin verschlug, erführen, was in dieser trostlosen Einöde die Ruinen eines Hauses bedeuteten. Zwei ähnliche Berichte verfaßte auch Hemskerk, ließ sie von allen Matrosen unterschreiben und in die beiden Fahrzeuge niederlegen, damit, wenn sie getrennt würden und vielleicht nur eines die bevorstehende Fahrt überstände, wenigstens die Überlebenden eine beglaubigte Urkunde über ihre abenteuerlichen Erlebnisse vorzuweisen hätten und nicht als Märchenerzähler daständen.