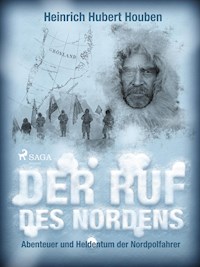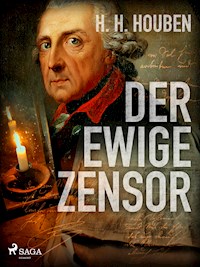
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es hätte alles so gut werden können. "Gazetten müssen nicht geniret werden", befand König Friedrich II., der spätere Friedrich der Große, wenige Tage nach seinem Amtsantritt 1740 und kündigte damit an, den Berliner Zeitungsschreibern nicht ins Handwerk pfuschen zu wollen. Kaum dass dieses Jahr zu Ende ging, konnte davon aber nicht mehr die Rede sein. Und daran änderte sich wenig in den folgenden 175 Jahren in Preußen. Der Zensur, der Zeitungen, Bücher und Theaterstücke und -aufführungen in Preußen unterzogen wurden, widmet sich diese Buch in detailreichen, oft auch amüsanten Ausführungen und Anekdoten.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. H. Houben
Der ewige Zensor
Mit einem NachwortvonClaus Richter und Wolfgang Labuhn
Saga
Vorwort.
Eine Geschichte der Zensur ist eine Kulturgeschichte für sich. Auf einem so engen Raum, wie er hier zur Verfügung steht, lassen sich nicht mehr als etliche Längs- und Querstriche geben: Längsstriche, die gewisse charakteristische Entwicklungslinien andeuten, und Querstriche, die bestimmte bemerkenswerte Episoden dieser Entwicklung genauer umreißen. Dieses Schriftchen, zu dem aus Anlaß der „Großen Polizeiausstellung 1926“ Herr Ministerialdirektor Dr. Abegg die Anregung gab, ist demnach der Vorläufer größerer Arbeiten, mit denen meine schon bekannten Studien über die Geschichte der Zensur und Preßgesetzgebung („Hier Zensur — wer dort?“ — „Der gefesselte Biedermeier“ — „Verbotene Literatur“) ihren Abschluß finden sollen.
Die zahlreichen neuen Ergebnisse, die ich auf den folgenden Blättern mitteilen darf, schöpfte ich aus den Akten des Preußischen Ministeriums des Innern, des Polizeipräsidiums Berlin, des Geheimen Preußischen Staatsarchivs und der Intendanz der Preußischen Staatstheater. Zu den Bildvorlagen steuerten bei: das Geheime Preußische Staatsarchiv, die Preußische Staatsbibliothek, das Kupferstichkabinett, das Märkische Museum, das Polizeipräsidium — alle in Perlin — und das Stadtgeschichtliche Museum in Leipzig. Den Verwaltungen der genannten Institute und allen ihren Mitarbeitern, die meine Forschungen bereitwilligst unterstützten, gebührt mein herzlichster Dank.
Berlin, im Juni 1926.
Prof. Dr. H. H. Houben.
1. „Gazetten müssen nicht geniret werden“.
Dieses vielzitierte Wort Friedrichs des Großen findet sich in einem Brief seines Kabinettministers Grafen von Podewils vom 5. Juni 1740, der seinem ministeriellen Kollegen, Herrn von Thulemeyer, den „nach aufgehobener Tafel“, also bei guter Laune, gegebenen Befehl des Königs übermittelt, „daß dem hiesigen Berlinschen Zeitungs-Schreiber eine unumbschränkte Freyheit gelassen werden soll, in dem articul von Berlin von demjenigen was anizo hieselbst vorgehet zu schreiben was er will“. Der König, fügt Podewils hinzu, habe ausdrücklich erklärt, daß er selbst Spaß daran finde; außerdem könnten sich dann auswärtige Regierungen nicht mehr über alles, was ihnen mißfällig sei, beschweren. Als Podewils einwarf, der russische Hof sei über Zeitungsnotizen „sehr pointilleux“, erwiderte ihm der König, „daß Gazetten wenn sie interessant seyn solten nicht geniret werden müsten“. Gegen diese Liberalität des neuen Herrn, der sechs Tage vorher seine Regierung angetreten hatte, hegte Herr von Podewils selbst gewichtige Bedenken, und auch Herr von Thulemeyer machte dazu die vorsichtige Randbemerkung: „‚Wegen des articuls Berlin ist dieses indistincte zu observiren, wegen auswärtiger Puissancen aber cum grano salis und mit guter Behuetsamkeit“. (Vgl. das Faksimile S. 8.)
Damals gab es in der preußischen Hauptstadt nur die seit 1721 dreimal wöchentlich erscheinende „Berlinische Privilegirte (später Vossische) Zeitung“, und die ihr gewährte Zensurfreiheit bezog sich nur auf den lokalen Teil. Das war immerhin ein Fortschritt gegen früher, wo keine Zeitungsnotiz gedruckt werden durfte, ohne daß ein dazu bestellter Zensurbeamter sie vorher gesehen und genehmigt hatte. Zur Zeit der Kabinettjustiz war aber jede Zensurfreiheit ein sehr gefährliches Danaergeschenk, denn sie befreite nicht von Repressivmaßregeln, dem nachträglichen Verbot mit anschließender Bestrafung, die den verbrecherischen Zeitungsschreiber, wenn er sich nicht hohen Schutzes zu erfreuen hatte, der berüchtigten „Carolina“ in die Hände liefern konnte, der „Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V.“ von anno 1532, deren Geltung in einzelnen deutschen Staaten wie Mecklenburg erst 1871 völlig aufgehoben wurde. Solche nachträgliche „Ahndung“ war peinlicher als die strengste Präventivzensur, denn diese befreite Verfasser und Verleger wenigstens vor jeder weiteren Verantwortlichkeit für die richtig zensierten Artikel. Dieselbe „Behuetsamkeit“ war es, die bis zum Jahre 1918 allen Theaterdirektoren mit wenigen Ausnahmen eine dankbare Liebe für die Theaterpräventivzensur eingeflößt hat.
Mit der „unumbschränkten Freyheit“ des lokalen Teils der Berliner Zeitung war es aber nicht weit her, und als der Verleger Haude im selben Jahr die „Berlinischen Nachrichten“ (die spätere „Spenersche Zeitung“) gründete und sich dabei auf das Privilegium völliger Zensurfreiheit berief, das der ihm gewogene junge König ihm bewilligt habe, wurde ihm schon am 31. Dezember befohlen, „von Seiner Königlichen Majestät höchsten affairen und Angelegenheiten, von nun an, weiter nicht das geringste, es habe Nahmen wie es immer wolle“, ohne Zensur drucken zu lassen. In diesem Monat war der erste schlesische Krieg ausgebrochen. Jetzt regierte Mars die Stunde, und von den Kriegsereignissen durften die Zeitungen nichts melden, ohne den ausdrücklichen Auftrag des Ministeriums. Die Berichte der Berliner Zeitungen über die beiden ersten schlesischen Kriege stammten fast nur aus dem Hauptquartier, besonders die „Schreiben eines Preußischen Offiziers“; meist hatte der König selbst sie verfaßt oder wenigstens durchgesehen. Durch diese königliche Berichterstattung wurden die Berliner Zeitungen zum erstenmal wichtige Quellen für die gesamte europäische Presse. 1743 nahm Friedrich die verliehene Zensurfreiheit auch für den lokalen Teil völlig wieder zurück, von nun an durften die Gazetten nicht eher gedruckt werden, „bis selbige vorher durch einen vernünftigen Mann censiret und approbiret worden seynd“, und der Zensor, Kriegsrat von Ilgen, „genirte“ die „Spenersche Zeitung“ sogar in ihrem damals erst neu eingeführten Feuilletonteil „Von gelehrten Sachen“ so, daß sich der Verleger Haude bitter beschwerte. Im übrigen aber berichtet die Geschichte nichts von Zensurgefechten der Zeitungsschreiber, woraus zu entnehmen ist, daß sich das Fähnlein der damaligen Journalisten nicht sonderlich herausfordernd, angriffslustig und neuerungssüchtig erwies. Das wäre ihm unter dem „alten Fritzen“ auch übel bekommen.
So lange nicht die Kriegszensur einen Ausnahmezustand schuf, gehörte die Zensur der Zeitungen zum Ressort des auswärtigen Departements, dem durch das erste Zensuredikt Friedrichs von 1749 alle Schriften zugewiesen waren, die den „Statum publicum“ betrafen oder bei denen „auswärtige Puissancen und Reichsstände interessiret“ waren. In diese Klasse von Schriften wurden die Zeitungen durch Friedrichs zweites Zensuredikt 1772 auch offiziell eingeordnet. Die Zensur der Provinzblätter war Aufgabe der Regierung oder der Justizkollegien; waren diese Behörden nicht am Orte, so hatten sie einen Vertreter zu stellen. Da, abgesehen vom lokalen Teil, der politische Inhalt der Provinzpresse noch ganz von dem der Berliner abhing, war also durch die Berliner Zensur auch die preußische Provinzpresse besorgt und aufgehoben.
Das berüchtigte Wöllnersche Zensuredikt von 1788 änderte nichts an der Zeitungszensur, und das Departement des Auswärtigen ließ sich von dem bigotten Justizminister nichts drein reden, so daß die Gazetten in der Tat wenig geniert wurden. Das änderte sich aber plötzlich, als die französische Revolution auf ihren Höhepunkt stieg und der annoch bestehende deutsche Kaiser, Leopold II., der Bruder der am 21. Januar 1793 hingerichteten Königin Maria Antoinette, aufgeregte Alarmrufe über den drohenden allgemeinen Umsturz ertönen ließ und am 3. Dezember 1791 vor allem eine schärfere Handhabung der Zensur forderte. Noch am 17. Februar 1792 beantworteten die preußischen Minister erregte Vorwürfe des Königs über die Laxheit der Zensur gegenüber den massenhaften aufrührerischen Schriften mit der Erklärung, sie hätten in seinem Staate von derlei Gesinnungen „noch nicht die mindeste Spur oder Neigung bemerkt“ und das „Exempel der in Aufruhr befangenen Völker“ werde auf die preußische Nation daher „nie die geringste Würkung haben“. Als Friedrich Wilhelm II. sie darauf beschuldigte, daß sie den „Aufklärern“ das Wort redeten, entschlossen sie sich am 28. Februar zu einem nachdrücklichen Befehl an die Berliner Blätter, „mit größter Schärfe alle aufrührerischen Artikel zu unterdrücken und die Verbreitung aller revolutionären Grundsätze zu verhindern“. Das hatte für die Berliner Verleger zunächst eine finanzielle Folge. Dem Geh. Legationsrat Renfner, der seit Juli 1791 die Zeitungszensur übte, wuchs jetzt die Arbeit über den Kopf; er mußte den ganzen Tag bis spät am Abend zur Verfügung stehen, wenn er, wie das Ministerium von ihm verlangte, „bei eigener schwerer Verantwortung“ für den Inhalt der Zeitungen bürgen sollte. Ohne eine Entschädigung, meinte er, sei das nicht zu machen. Die beiden Berliner Zeitungsverleger, die Vossische und die Haude-Spenersche Buchhandlung, sahen auch die „Billigkeit“ seines Anspruchs ein und bewilligten dem vielgeplagten Zensor ein jährliches Honorar von 100 Talern, aber nur dem jetzigen Zensor unter den „gegenwärtigen Zeitläuften“, wie sie ausdrücklich erklärten. Das Ministerium aber nahm statt des kleinen Fingers die ganze Hand und erwiderte: die Verleger allein zögen den Gewinn aus ihren Zeitungen, sie hätten deshalb auch in Zukunft die somit neueingeführte Zensurgebühr zu entrichten.
Waren denn die Berliner Zeitungen so stark mit „aufrührerischen Artikeln“ gefüllt, daß die Mahnung des Ministeriums begründet war? Etwas Farbe hatte sie unterdes tatsächlich angenommen. Die Weltgeschichte mußte sich ja doch in ihnen widerspiegeln, und wenn der Horizont in Flammen stand, mußte schließlich ein roter Widerschein auch auf Preußen fallen. Wie konnte der dabei gleichgültiger, trockener Chronist bleiben, der am ersten dazu veranlaßt ist, den elektrischen Strom neuen Lebens zu empfinden, der werdende Journalist? Der eine wollte löschen helfen, der andere auch schüren, und wenn die deutsche Presse auch noch nichts von Leitartikeln wußte, in denen sich eine öffentliche Meinung kundgab oder auch nur die private des Redakteurs, die sich für die öffentliche hielt, so konnte es doch nicht fehlen, daß die Art der Berichterstattung besonders über die Pariser Ereignisse allmählich einen eigenen Ton annahm, der in der Tat die Musik machte. Über die Berichterstattung im alten Nachrichtenstil ging man noch nicht hinaus, aber der Zensor Renfner hatte schon seine liebe Not mit allerhand versteckten „Anspielungen“ und „Seitenblicken“, die sich der Zeitungsschreiber von ehedem nie herausgenommen. So entfesselte der Geist der Revolution eigentlich erst den selbständigen Journalismus, und unter der Regierung Friedrich Wilhelms II. gewannen die Zeitungen trotz aller dämpfenden Bestimmungen eine Bedeutung, die sie unter Friedrich dem Großen, auch bei geringerer Unfreiheit, nie hätten erringen können, es sei denn, daß der König, in Voraussicht der Zukunft, sie als Pioniere einer großzügigen nationalen Politik hätte brauchen wollen, was seinem unnahbaren und selbstsichern Souveränitätsgefühl aber ganz fern lag.
Von den Berliner Zeitungen nahm die „Spenersche“ am stärksten jenen Ton an, und schon am 24. Februar 1793 mußte sie sich darüber von dem nun aufmerksamer und strenger werdenden Ministerium energisch den Text lesen lassen. Der Ton der Pariser Artikel, hieß es, lasse sich besonders seit der „schrecklichen Verurteilungsepoche des Königs von Frankreich“ mit den „Gesinnungen eines treuen Preußischen Untertans schwer vereinigen“ und steche auffallend ab von dem „wärmeren, biederen Ton, durch den sich die Vossische Zeitung bei den jetzigen Umständen auszeichne“. Zensurstriche allein könnten daran nichts ändern, die Redaktion habe deshalb streng darauf zu sehen, daß „von nun an die ganze Stimmung jener Artikel umgeändert werde“. Sonst werde man das Privilegium „sichereren Händen“ anvertrauen. Um den Berlinern zu zeigen, wie man solche „Stimmung“ erzeuge, gründete die Regierung auf den Rat des Geh. Legationsrats Le Coq, des spätern Polizeipräsidenten (1812—1821), die erste ministerielle preußische Zeitung, und zwar in französischer Sprache, die „Gazette françoise de Berlin“, die aber schon nach vier Jahren an Abonnentenschwund einging. Der Verfügungen gegen die Presse kamen nun immer neue. Nicht weniger als 26 Freiexemplare mußten die Berliner Verleger von ihren Blättern liefern, selbst die Provinzzeitungen mußten regelmäßig zur Kontrolle in Berlin eingereicht werden. Die Ministerialbeamten lasen sich an all dem schlechten Druck auf Löschpapier fast die Augen blind, und besonders der alte Graf Finckenstein, der noch ganz in friderizianisch-absolutistischer Weltanschauung lebte, überbot sich in strengen Maßregeln. Die Inserate unterstanden seit 1788 noch einer besonderen Zensur der Polizei, die bis 1809 noch städtisch war; der „Stadtpräsident“ oder Bürgermeister Berlins war zugleich Polizeidirektor. Durch die Gründung der „Gazette“ war ein regelrechtes Preßbüro entstanden, das die Berliner mit wichtigen politischen Mitteilungen versorgte. So lieferte es alle Nachrichten über den Aufstand in Polen nach dessen zweiter Teilung, dafür durfte aber der Zensor nichts Selbständiges aus andern Quellen darüber durchlassen. In den Pariser Artikeln wurden unermüdlich alle „Nebenreflexionen und Raisonnements“ gestrichen, und die Zeitungen mußten sich durchaus auf die Darstellung bloßer Tatsachen beschränken. Die „General- und Spezialpardons“, die das Ausland preußischen Deserteuren zusicherte, durften nicht mitgeteilt werden, ebensowenig die Beschreibungen republikanischer Feste, bei denen „im Namen der Weltgeschichte die Verdienste der französischen Nation um die Menschheit“ gefeiert wurden. Alle Notizen über Aufstände, besonders über militärische Revolten, waren strengstens verboten, ebenso die über Ankunft oder Abreise der Kuriere, und selbst fremde Gesandten durften nichts mehr in die Zeitungen setzen lassen ohne besondere Genehmigung der Ministerien. Und doch mußten diese erleben, daß im Oktober 1797 alle Berliner Blätter, einschließlich der offiziellen „Gazette“, in Rußland verboten wurden! Die ganze „Stimmung“ der Berliner Presse hatte man auch in Rußland als aufrührerisch empfunden. Je mehr man aber die preußischen Gazetten genierte, um so besser florierten die viel gefährlicheren „Bulletins“, die geschriebenen Zeitungen, mit deren Anfertigung sich kleine und mittlere Beamte, die an der Quelle der offiziellen Neuigkeiten saßen, einen stattlichen Nebenverdienst verschafften und gegen die sich alle Treibjagd, die man mit Hilfe der Postverwaltung organisierte, vergeblich erwies. Damals fiel das nachdenkliche und nachdenkenswerte Wort des preußischen Generaldirektoriums: „Überhaupt glauben wir nicht, daß in einer solchen weit getriebenen Einschränkung der Preßfreiheit das wahre Mittel liege, um revolutionäre Bewegungen und gefährliche Nachfolge der darunter gegebenen üblen Beispiele benachbarter Nationen zu hintertreiben.“ Und als ein Jahr später Graf von der Schulenburg von dem Thronfolger Friedrich Wilhelm III. mit der Leitung der geheimen Polizei betraut wurde und davon fabelte, den revolutionären Skribenten durch Bestechung einen goldenen Maulkorb umhängen zu wollen, bekannte sich das preußische Ministerium zu der Einsicht, daß all sein Bemühen nur dann Erfolg verspreche, „wenn Männer von anerkannten Talenten, von bewährter Moral, aus eigener inniger Überzeugung, als Schriftsteller wider Revolutionen und wider revolutionäre Greuel aufträten“. Man vergaß nur eine Kleinigkeit: diese guten Elemente, die gewiß vorhanden waren, freizumachen und durch soziale Reformen von Staats wegen die „gute Stimmung“ zu erzeugen, die man gern der Presse als Schminke auferlegt hätte.
Denselben Fehler machte man zwei Jahrzehnte später, als man die aus den Fugen geratene Weltgeschichte wieder eingerenkt zu haben glaubte und die Neuorganisation des preußischen Staates dadurch diskreditierte, daß man nach dem Vorbild Österreichs auch in Preußen die zwar noch rechtsgültigen, aber in der Praxis vielfach abhanden gekommenen Zensurgesetze des 18. Jahrhunderts wieder ausgrub und diese verrosteten Waffen vor allem gegen die Tagespresse scharf machte. An dringenden Warnungen einsichtiger Männer fehlte es keineswegs; in dem törichten Kampf der preußischen Regierung gegen den „Rheinischen Merkur“ von Joseph Görres erklärte Geheimrat Sack, der Generalgouverneur der wiedereroberten Rheinlande, vordem Vertreter des Innenministers Grafen Dohna in Berlin: „Der Begriff der sogenannten Preßfrechheit ist offenbar so schwankend und unbestimmt, daß unter ihm alles und jedes mißfällige subsumirt werden kann, und, wo es verboten ist, öffentlich zu sagen, was diesem und jenem mißfällt, durch das, was dann noch von öffentlicher Schreib- und Redefreiheit übrig bleibt, die Wahrheit und das Recht nicht immer sonderlich gefördert werden dürfte.“ Was Sack und mit ihm die öffentliche Meinung gerade auch der „Patrioten“ verlangte, war eine Preßfreiheit nach englischem Muster, unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers oder seines Verlegers. Ein Preßgesetz dieser Art würde auch den ausschweifendsten Liberalismus jener Tage auf lange hin völlig befriedigt haben, beseitigte es doch die schlimmste Fessel, die Präventivzensur. Was statt eines solchen Gesetzes gegeben wurde, erhellt blitzartig aus dem artigen Zensurerlebnis des liebenswürdigen Dichters der Müller- und Wanderlieder, Wilhelm Müller. Als er 1816 seine lyrische Sammlung „Bundesblüten“ mit einigen Versen in den Berliner Zeitungen ankündigen wollte, verwehrte ihm das der Zensor Renfner mit der Begründung: „Das Wort Freiheit komme zu oft in diesen Versen vor!“ Als Müller darauf entgegnete, der König habe doch selbst dazu aufgerufen, für die Freiheit zu kämpfen, erhielt er die Antwort: „Ja, damals!“
Dieser Wendung der Dinge entsprach vollkommen das neue preußische Zensuredikt vom 18. Oktober 1819, die landesgesetzliche Anwendung der „Karlsbader Beschlüsse“ des Deutschen Bundestags und seines Bundespreßgesetzes vom 20. September desselben Jahres. Es „genirte die Gazetten“ wie nie zuvor und war für die Zeitungsschreiber ein Maulkorbgesetz schlimmster Art. Zeitungen, die „Gegenstände der Religion, der Politik, Staatenverwaltung und der Geschichte gegenwärtiger Zeit in sich aufnahmen“, hingen von dem Stirnrunzeln dreier Ministerien ab, die die oberste Leitung der gesamten Zensurgeschäfte hatten: des Ministeriums des Äußern, des Kultus und des Innern und der Polizei. Diese drei Zensurministerien bestellten den für dieses Amt vertrauenswerten Zeitungszensor. Wenn ein Blatt von seiner Genehmigung „schädlichen Gebrauch“ machte, wurde es unterdrückt; flößte der für jede Nummer verantwortlich zeichnende Redakteur nicht das „nötige Zutrauen“ ein, so mußte der Verleger für ihn Geldkaution stellen oder einen andern nehmen. Damit der Redakteur auf alle Fälle der Polizei greifbar war, mußte er in Preußen wohnen und überdies „bekannt“ sein. Nicht nur der Verleger — womit sich die Bundesbeschlüsse begnügten —, auch der Drucker mußte auf jeder Zeitungsnummer genannt sein und war für die Beobachtung der Zensurvorschriften verantwortlich. Der Redakteur einer verbotenen Zeitung war fünf Jahre zur Stellungslosigkeit verurteilt, wenn er es nicht vorzog, den Staub seiner preußischen Heimat von den Füßen zu schütteln. Und da „frecher und unehrerbietiger Tadel und Verspottung der Landesgesetze und Anordnungen im Staate, Verletzung der Ehrerbietung gegen die Mitglieder des Deutschen Bundes und gegen auswärtige Regenten und frecher, die Erregung von Mißvergnügen abzweckender Tadel ihrer Regierungen“ mit Gefängnis- oder Festungsstrafe von sechs Monaten bis zwei Jahren geahndet wurde, so trug der Redakteur einer Zeitung tagtäglich seine Haut zu Markte, denn „frech, unehrerbietig und Mißvergnügen“ waren, um mit dem Geheimen Rat Sack zu reden, so schwankende und unbestimmte Begriffe, daß unter ihnen „alles und jedes Mißfällige subsumiert werden“ konnte und „durch das, was dann von öffentlicher Schreib- und Redefreiheit übrig blieb, die Wahrheit und das Recht nicht immer sonderlich gefördert“ worden sein dürfte. Die Verfolgungen von Männern wie Joseph Görres und Ernst Moritz Arndt, schikanöse Verfolgungen, die mit Zensurvergehen begannen und mit angeblichem Hochverrat endeten, haben dem deutschen Patriotismus Wunden geschlagen, die nie vernarbten, und der Kampf Deutschlands um die endliche Erlangung einer gesetzmäßigen Verfassung, der naturgemäß am unerbittlichsten in der Tagespresse ausgefochten wurde, hat dieser Tagespresse gerade die Bedeutung gesichert, die man ihr durch die Präventivzensur nehmen wollte. Wie kraß der Unterschied von einst und jetzt geworden war, zeigt am besten eine Kabinettsordre, die Friedrich Wilhelm III. im ersten liberalen Dezennium seiner Regierung, am 20. Februar 1804, erlassen hatte. Die Kriegs- und Domänenkammer in Hamm hatte sich durch einen Artikel beleidigt gefühlt, der die Baufälligkeit einer Ruhrbrücke und die Nachlässigkeit der Verwaltung betraf. Die Sache kam vor den König, und dieser erklärte: „Es kann nicht jedem zugemutet werden, in solchen Fällen, die eine Rüge verdienen, sich den Unannehmlichkeiten, womit offizielle Denunzialionen verbunden sind, auszusetzen. Sollte nun eine anständige Publizität darüber unterdrückt werden, so würde ja kein Mittel übrig bleiben, hinter die Pflichtwidrigkeiten der untern Behörden zu kommen, die dadurch eine sehr bedenkliche Eigenmacht erhalten würden. In dieser Rücksicht ist eine anständige Publizität der Regierung und den Untertanen die sicherste Bürgschaft gegen die Nachlässigkeit oder den bösen Willen der untergeordneten Beamten und verdient auf alle Weise gefördert und geschützt zu werden. Ich befehle Euch daher, die genannte Kammer hierdurch für die Zukunft gemessenst anzuweisen. Übrigens will ich nicht hoffen, daß über diesen Disput die Sache selbst, nämlich die Reparatur der schadhaften Brücke, wird vergessen werden.“ Nachdrücklicher und schlagender läßt sich das Recht der Presse, öffentliche Zustände auch in einer den regierenden Gewalten unwillkommenen Form zu erörtern, kaum formulieren. Zehn Jahre später hätte sich der König nur ungern an jene Kabinettsordre erinnern lassen, als ein zweiter „Brückenbau“ in Berlin selbst unliebsamstes Aufsehen machte. Unter diesem Titel hatte Professor Catel in der „Vossischen“ vom 20. September 1814 ein Spottgedicht veröffentlicht, das folgendermaßen begann:
„In China baute man unlängst an einer Brücke,
Es ging das Tagewerk mit jedem Tag — zurücke.
Bei Frühstück, Mittagsmahl und Vesperbrot verstrich
Die Zeit; zur Arbeit fand kaum eine Stunde sich.“ usw.
Darob stellte der Kabinettsrat Albrecht auf Befehl des Königs den Zensor Renfner zur Rede. Der wußte von nichts, da diese poetischen Stilübungen vom Polizeibureau zensiert wurden. Catel versicherte auf Ehre und Gewissen, daß er beileibe keinen bestimmten königlich preußischen Brückenbau damit gemeint habe, sondern nur die seit dem Frieden eingerissene Faulheit der Berliner Handwerker — schon damals also eine Nachkriegserscheinung! — habe geißeln wollen. Der König ließ ihm daraufhin zu seiner Beruhigung versichern, auch er habe „die Saumseligkeit mancher Handwerker nicht übersehen“ und sei über den Scherz keineswegs ungehalten. Etliche Monate später wäre die königliche Nachfrage gewiß von üblen Folgen für den durchaus harmlosen Professor gewesen; man hätte seine Verse ganz gewiß auf die nicht geringere „Saumseligkeit“ der Diplomaten des Wiener Kongresses gedeutet, der im September 1814 zusammentrat, um die deutsche Landkarte wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht ahnte man an höchster Stelle schon, wie treffend sie auf diesen verunglückten politischen „Brückenbau“ passen würden. Dieses lustige Gegenbeispiel aber zeigt, wie hoch bereits damals das Mißtrauen, die Unduldsamkeit gegen öffentliche Erörterung von Übelständen seitens der Tagespresse gestiegen war. Diese gereizte Stimmung wuchs mit jedem Tage, denn die Presse versuchte sich nun auch an öffentlichen Zuständen, die an Wichtigkeit einer baufälligen Ruhrbrücke oder der Saumseligkeit der Berliner Handwerker nicht nachstanden. Die überall einberufenen Provinzialstände schufen ein, wenn auch recht verschwommenes, Abbild konstitutioneller Verfassung. Der werdende deutsche Parlamentarismus ging jeden Staatsbürger an. Das Volk sollte wählen, seine Rechte kennenlernen, den Sinn der ihm gewährten oder von ihm erkämpften vorläufigen Verfassung begreifen; es sollte die Männer finden, die seine Rechte vertraten, und ihre Tätigkeit im Parlament verfolgen. Die Öffentlichkeit der Kammerverhandlungen war dazu unbedingt erforderlich; sie mußte in jahrelangen Kämpfen erst erstritten werden; in Süddeutschland gelang das zuerst. Der arbeitsame Staatsbürger konnte aber seine Tage nicht auf den Parlamentstribünen zubringen. Die Zeitung mußte ihm also berichten, was dort oben vorging. Die ministeriellen Blätter, wie die amtliche „Leipziger Zeitung“, verschwiegen gerade das, was man wissen wollte; sie wurden zum Kinderspott. Der Kampf um die Preßfreiheit war demnach eine Sache der gesamten Nation, wenn eine Verfassung jemals Leben gewinnen und das Verständnis für politische Rechte und Pflichten in das Volk übergehen sollte. Daran lag aber den meisten Regierungen sehr wenig; über diese öffentlichen Angelegenheiten wollte man eine öffentliche Meinung möglichst gar nicht aufkommen lassen. Die Verhandlungen des Deutschen Bundestags wurden in den ersten Jahren nach 1819 der Presse mitgeteilt in Form von Sitzungsprotokollen; am 5. Februar 1824 schon wurde dieses Zugeständnis an die Öffentlichkeit zurückgezogen und noch 1837 das Verbot in Erinnerung gebracht. Auch um die Verhandlungen der Landtage bekümmerte sich die Presse mehr, als den Regierungen und Souveränen gefiel. Am 5. Mai 1826 erließ Friedrich Wilhelm III. daher den Befehl: die Zeitungen hätten fortan über die Landtage zu schweigen, da solche Diskussionen „nur die öffentliche Meinung irreführten“. Was dem Publikum wissenswert sei, werde „in Gemäßheit der Gesetze künftig unter öffentlicher Autorität“ bekannt gemacht werden. Damit wurde der politische „Waschzettel“ Trumpf. Nur die „Resultate der Landtagsverhandlungen“ lernte die Öffentlichkeit kennen, in Form der „Schlußprotokolle“, wie sie vom Landtagsmarschall redigiert, vom königlichen Landtagskommissar genehmigt und schließlich noch vom Zensor zugelassen wurden, wobei es ganz im Belieben des letzteren stand, das zu unterdrücken, was ihm aus irgendeinem Grunde nicht opportun erschien. Die Namen der Redner durften überhaupt nicht genannt werden. So suchte man jede Brücke, um in dem obigen Bilde zu bleiben, zwischen Parlament und Öffentlichkeit abzubrechen.
Als Beginn einer neuen Ära begrüßte daher Preußen den Entschluß des neuen Königs Friedrich Wilhelm IV., der im Frühjahr 1841 durch sein „Propositionsdekret“ über die ständischen Ausschüsse eine, wenn auch noch umgrenzte Veröffentlichung der Landtagsverhandlungen zugestand und sie damit der Willkür des Zensors entzog. Die Namen der Redner durften aber auch jetzt nicht genannt werden; diese Errungenschaft bescherte erst das Jahr 1847; gleichzeitig damit wurde der Presse endlich auch die Mitteilung der vollständigen Landtagsberichte freigegeben.
Im übrigen war Friedrich Wilhelm IV. auf die Gazetten genau so schlecht zu sprechen wie sein Vater. Er gefiel sich zwar darin, durch Befreiung der Tagespresse vom Zensurknebel „eine größere Teilnahme an vaterländischen Interessen“ erwecken und „so das Nationalgefühl erhöhen“ zu wollen; aber was ihm im Rausch rednerischer Begeisterung an solchen Verheißungen über die Lippen strömte, nahm er im nächsten Satz gewöhnlich wieder zurück, und vereinzelte Zensurerleichterungen, die er der Buchliteratur gewährte, änderten nichts an der Tatsache, daß die Verbote unliebsamer Blätter, wie der „Rheinischen Zeitung“ von Karl Marx in Köln, der „Leipziger Allgemeinen Zeitung“, der „Hallischen (Deutschen) Jahrbücher“ von Ruge usw., ein bezeichnendes Merkmal gerade seiner ersten Regierungsjahre bilden. Als er am 31. Januar 1843 eine neue Instruktion für die Zensur unterzeichnete, leitete er sie mit der Erklärung ein, daß die meisten Zensoren seine früheren Befehle über die Behandlung der Zeitungspresse „gänzlich mißververstanden und durch ungeschickte Behandlung der Sache völlig verfehlt“ hätten. „Die dadurch veranlaßten, immer zunehmenden Ausschreitungen der Tageblätter machen daher angemessenere Instruktionen für die Zensoren unumgänglich nötig. Was Ich durch die genannten Verordnungen gewollt, das will Ich unveränderlich noch: die Wissenschaft und die Literatur von jeder sie hemmenden Fessel befreien und ihr dadurch den vollen Einfluß auf das geistige Leben der Nation sichern, der ihrer Natur und ihrer Würde entspricht; der Tagespresse aber innerhalb des Gebiets, in welchem auch sie Heilsames in reichem Maße wirken kann, wenn sie ihren wahren Beruf nicht verkennt, alle zulässige Freiheit dazu gestatten. Was Ich nicht will, ist: die Auflösung der Wissenschaft, und Literatur in Zeitungsschreiberei, die Gleichstellung beider in Würde und Ansprüchen, das Übel schrankenloser Verbreitung verführerischer Irrtümer und verderbter Theorien über die heiligsten und ehrwürdigsten Angelegenheiten der Gesellschaft auf dem leichtesten Wege und in der flüchtigsten Form unter einer Klasse der Bevölkerung, welcher diese Form lockender, und Zeitungsblätter zugänglicher sind, als die Produkte ernstlicher Prüfung und gründlicher Wissenschaft.“ Und was nun als Instruktion für die Zensoren folgte, nahm durchweg den Wortschatz des Wöllnerschen Zensuredikts und der Verordnung vom 18. Oktober 1819 wieder auf und verschärfte die alte Bedingung der „bescheidenen anständigen Form“ noch durch die weitere Forderung einer „wohlmeinenden Absicht“, die herauszufühlen nach wie vor die Aufgabe des mehr oder weniger psychologisch veranlagten Zensors blieb. Und wie wenig der König selbst auch bei der leisesten Kritik an die „wohlmeinende Absicht“ des Zeitungsschreibers zu glauben geneigt war, zeigte gleich hinterher sein Rekontre mit dem Schriftsteller, den die Mark Brandenburg und ihr Fürstenhaus als ihren ersten und damals einzigen Heimatdichter mit Jubel hätte auf den Schild erheben sollen. Willibald Alexis, der hier gemeinte, schrieb Anfang 1843 etliche Leitartikel für die „Vossische Zeitung“. Einer davon beschäftigte sich mit dem aktuellsten Stoff des Tages, mit der Preßfreiheit und den neusten Zeitungsverboten, wurde aber von den beiden amtierenden Zensoren derart zugerichtet, daß Alexis gut zu tun glaubte, den Hergang dem Könige vorzulegen, damit dieser sehe, wie die neue Zensurinstruktion gehandhabt werde. Der König, meinte er, würde so etwas gewiß nicht für möglich halten, wenn er sich nicht durch eigenen Augenschein davon überzeuge. An „wohlmeinender Absicht“ habe es bei diesem Zeitungsartikel nicht gefehlt, er habe, ganz im Sinne des Königs, dazu dienen sollen, „diese opponirenden Artikel frei zu halten von den leeren, hohlen Theorien jüngerer Schulen, welche nur negiren und einen systematischen Krieg allem Positiven erklären“. Der Erfolg dieser berechtigten Beschwerde war die bekannte Kabinettsorder vom 26. März 1843, die, ähnlich wie die Ministerialverfügung Wöllners gegen den Philosophen Kant, den Dichter des „Cabanis“, mit den Worten herunterkanzelte: „Mit Widerwillen habe ich einen Mann von Ihrer Bildung und literarischen Bekanntheit durch jenen Artikel unter der Klasse derer gefunden, die es sich zum Geschäft machen, die Verwaltung des Landes durch hohle Beurtheilung ihres Thuns, durch unüberlegte Verdächtigung ihres nicht von Ihnen begriffenen Geistes, vor der großen, meist urtheilslosen Menge herabzusetzen, und dadurch ihren schweren Beruf geflissentlich noch schwerer zu machen. Von Ihrer Einsicht wie von Ihrem Talent hatte ich Anderes erwartet und sehe mich ungern enttäuscht.“ (Der Entwurf zu dieser Kabinettsorder, von der Hand des Hausministers von Thiele, wird hier zum erstenmal mitgeteilt, vgl. das obige Faksimile.)
Berücksichtigt man bei diesem königlichen Denkzettel, daß der sonst so beredte Monarch auf frühere Einsendungen des Dichters, der ihm seine märkischen Romane „Der Roland von Berlin“ (1840) und „Der falsche Waldemar“ (1842) überreichen zu müssen geglaubt hatte, nur mit nichtssagenden Redensarten zu antworten wußte, so gewinnt dieser beleidigende, sogar nach Heinrich von Treitschkes Urteil „ungerechte“ Brief für den später im Wahnsinn endenden König eine symptomatische Bedeutung. Von der „wohlmeinenden Absicht“ dieses Königs war für die Presse nichts Ersprießliches mehr zu erwarten. Die seinem Stolze unentbehrliche Gönnermiene aber wurde bis zum letzten, bittern Augenblick beibehalten: als schon die Straßenkämpfe zwischen Volk und Militär begannen, am 17. März 1848, entwarf das preußische Ministerium endlich das Gesetz über die Preßfreiheit; der König hegte noch immer Bedenken und unterzeichnete es widerwillig erst am 18. Es wurde aber mit dem Datum des 17. veröffentlicht, damit es nicht so aussehe, als ob die Ereignisse des 18. dem Könige dieses Zugeständnis an die Forderung der verhaßten Zeitungsschreiber abgetrotzt hätten.
2. Eine kaiserin der zensur.
Die Kaiserin Maria Theresia (1717—1780) war bekanntlich eine heftige Feindin aller religiösen Aufklärung und verfolgte mit harter Unduldsamkeit alles, was Macht und Ansehen der katholischen Kirche und ihrer Diener verletzen konnte. Mit „Inquisition und Mission“ führte sie die Gegenreformation in den österreichischen Erblanden durch, und die Pflege der kulturellen Güter sah sie am liebsten ausschließlich in der Hand der Jesuiten.
Die wirksamste Waffe in der Hand des Protestantismus war das Buch; ihm galt deshalb der glühende Haß der geistlichen Machthaber. Seit 1623 war die Wiener Universität unter Verwaltung der Jesuiten; ihnen lag auch fast die gesamte Bücherzensur ob, ohne deren Genehmigung in Österreich nichts gedruckt und kein fremdes Buch verbreitet werden durfte. Gegen die katholische Kirche und ihre Vertreter durfte infolgedessen nichts, gegen die Ketzer alles geschrieben werden. Wegen Übersetzung einiger antikatholischen Streitschriften wurde der evangelische Prediger Mathias Bohil, erzählt ein Biograph des Kaisers Joseph II., eingekerkert, und er entging nur durch die Flucht schlimmerem Schicksal; man fand aber nichts darin, daß der Bischof Martin Bird in seinem „Enchiridion“ die Ausrottung der Ketzer predigte; erst der Papst selbst mußte eingreifen, um dieses Buch zu unterdrücken. Wissenschaftliche Werke hatten keinen Anspruch auf mildere Behandlung. Noch im Jahre 1750, versichert der Reformator des österreichischen Schrifttums, Joseph von Sonnenfels (der keineswegs für Preßfreiheit eintrat, sondern die Zensur noch als „eine der notwendigen Polizeianstalten“ bezeichnete), konnte es Stand und Glück kosten, wenn man sich anmerken ließ, in Montesquieus „Esprit des lois“ geblättert zu haben. Die Verfasser protestantischer und antikatholischer Schriften erwartete Verbannung und Kerker. Schon der Besitz lutherischer, ketzerischer, überhaupt unkatholischer Schriften war aufs strengste verpönt; sie standen außerhalb allen Eigentumsrechtes; jeder Geistliche durfte sie konfiszieren, wo er sie fand, jeder Privatmann war bei Strafe verpflichtet, anzugeben, wo immer er sie gesehen hatte. Wer ein neues Buch kaufte, mußte es innerhalb der Zeit von vier Wochen seinem Pfarrer zur Prüfung und Genehmigung vorlegen, sonst erhielt er drei Gulden Strafe, die sich im Wiederholungsfall empfindlich steigerte. Ein Drittel des Strafgeldes fiel dem Denunzianten zu; daher stand die niederträchtigste Spionage in voller Blüte. Haussuchungen waren an der Tagesordnung. Das Gepäck der Reisenden wurde auf den Mautämtern an der Landesgrenze und in den Städten durchsucht, alle irgendwie bedenklichen Bücher wurden ihnen weggenommen, die verbotenen verbrannt. Verkleidete Beamte der geistlichen Bücherpolizei, sogar die Präsidenten der Zensurkommission, wie Graf Saurau in Wien, besuchten als harmlose Kunden die Buchläden, schlichen sich in das Vertrauen der Händler und drangen in sie, ihnen verbotene Bücher zu verschaffen; ließen die Buchhändler sich überreden, so entdeckten sich die Spitzel als Polizisten, beschlagnahmten die Werke und denunzierten die Verkäufer.
Die Kaiserin ärgerte sich wohl gelegentlich, wenn einer der Hoftheologen und Beichtväter seine Bücherrazzia bis in den kaiserlichen Palast ausdehnte, und jagte den allzu Dreisten davon; auch hob sie wohl einmal das Verbot eines Buches des von ihr geschätzten oder — gefürchteten Göttinger Publizisten und Geschichtsschreibers von Schlözer auf, wenn sie selbst es gelesen und gut gefunden hatte. Aber für die Schmach der geistigen Knechtschaft, in der sie ihre Völker hielt, hatte sie keine Empfindung. Der beschränkte Untertanenverstand hatte das auf Treu und Glauben hinzunehmen, was ihm von einer über alle Zweifel erhabenen, von Jesuiten beherrschten Regierung als allein seligmachend verkündigt wurde. Die Absperrmaßregeln gegen die im Reich, besonders in Preußen, herrschende Cholera der Aufklärung waren großzügig organisiert — kein Wunder, daß Österreichs geistige Entwicklung um Jahrhunderte zurückblieb. An der schönen blauen Donau nahm man an dem Aufschwung des deutschen Schrifttums so wenig Anteil, daß man noch zur Zeit der großen Kaiserin diejenigen verlachte, die sich, statt des einheimischen Dialektes, der hochdeutschen Schriftsprache, des „lutherisch Deutsch“, bedienten. Noch im Jahre 1780 war, wie Lessings Freund Nicolai versichert, auf der Universität Innsbruck ein Werk wie Jöchers Gelehrten-Lexikon, das 1750/51 erschien, nicht einmal dem Namen nach bekannt, und ein hochverdienter Mann wie der schon erwähnte Sonnenfels bewarb sich bei der ihm sehr gewogenen Kaiserin vergeblich um ein Amt, weil er seiner hochdeutschen Aussprache wegen als Protestant und überhaupt als verdächtig galt. Wo jedoch keine religiösen Rücksichten bestimmend waren, bewies Maria Theresia auch in Zensurentscheidungen die unbestechliche Gerechtigkeit, die einen Teil ihres Regentenruhmes ausmacht. Als der Wiener Schriftsteller und Hofagent Joseph Rautenstrauch, der Verfasser eines viel gegebenen Lustspiels „Der Jurist und der Bauer“, ein Lebensbild der Monarchin herausgab, dessen literarischer Wert in keinem Verhältnis zu seiner prahlerischen Ankündigung stand, und ein Kritiker eine scharfe Satire dagegen losließ, hatte Rautenstrauch die Anmaßung, die Kaiserin um Verbot dieser Kritik zu bitten, erhielt aber die energische Abfertigung: „Der Rautenstrauch soll seine Händel mit jenen des Staates nicht vermengen. Sind die ihm gemachten Vorwürfe ungegründet, so zeige er es dem Publico und beschäme dadurch seinen Gegner als einen Verleumder“. In einem Punkte aber war auf die gepriesene Gerechtigkeit der Kaiserin doch kein Verlaß, das sollte eben jener Hofrat Sonnenfels erleben, als er sich in einer dringenden Zensurangelegenheit eines Tages bei ihr melden ließ. Ungemein lebhaft, wie die Kaiserin noch in ihren alten Tagen war, kam sie nach wenigen Minuten aus dem Spielzimmer, strich sich mit den Fingern Haube und Haar aus dem Gesicht, und heftig die Karten drehend fragte sie den Besucher:
„Nun, was ist’s denn? Sekieren sie Ihn schon wieder? Hat Er etwas gegen uns geschrieben? Das ist Ihm von Herzen verziehen. Ein echter Patriot muß wohl manchmal ungeduldig werden; ich weiß aber schon, wie Er’s meint. Oder gegen die Religion? Er ist ja kein Narr. Oder gegen die guten Sitten? Das glaube ich nicht; Er ist ja kein Saumagen. Aber wenn Er etwas gegen die Minister geschrieben hat, ja mein lieber Sonnenfels, dann muß Er sich selber heraushauen; da kann ich Ihm nicht helfen. Ich habe Ihn oft genug gewarnt.“
Damit machte die Kaiserin kehrt und eilte wieder an ihren Spieltisch zurück. —
So eifersüchtig Maria Theresia die Rechte der Kirche zu wahren bestrebt war, konnte sie es doch nicht verhindern, daß schon unter ihrer Regierung der Machtkampf zwischen Staat und Kirche entbrannte und mit einer Niederlage der letzteren endete. Ein wesentlicher Teil dieses Kampfes vollzog sich im Rahmen der Zensurgesetzgebung.
Bisher hatte der Protestantismus als der alleinige Hort aller Opposition, auch der politischen, gegolten; seine Bekämpfung durch die Kirche beseitigte auch das, was dem Staat gefährlich werden konnte. Deshalb ließ man die Diener der Kirche über den Geistesschatz der Nation schalten und walten. Jetzt aber dämmerte auch dem Hause Habsburg allmählich die Erkenntnis, daß die werdende absolute Souveränität bei der Kirche selbst auf Widerstand stieß, daß die beiderseitigen Vorteile sich nicht mehr in allen Punkten vereinigen ließen, und daß der Absolutismus, der das frühere Feudalsystem rücksichtslos verdrängte, der Kirche einen Teil ihrer Rechte streitig machen mußte, wenn er sich mit Erfolg durchsetzen sollte. Die politischen Ereignisse, besonders der verhängnisvolle Erbfolgekrieg, zeitigten eine ausgesprochen politische, staatsrechtliche Literatur, von der die Theologen nichts verstanden und deren mögliche Wirkung sie als Zensoren nicht beurteilen konnten, oft wohl auch mit Fleiß übersahen.
Aus solchen Gründen hatte schon Maria Theresias Vater, Kaiser Karl VI. (1711 bis 1740), nach dem Beispiel seines Vorgängers 1725 die Zensur politischer Schriften mit Einschluß der Zeitungen den Jesuiten der Universität entzogen und den Regierungsbehörden zugewiesen. Denselben Gründen konnte sich auch seine Nachfolgerin nicht verschließen. Nach anfänglicher Unsicherheit ließ Maria Theresia 1743 jene Verfügung bestehen: die Zensur der politischen Druckschriften blieb endgültig Sache der Regierung und ihrer Zensurpolizei.
Andere Hände sorgten dafür, daß sich das geistliche Netz bald noch weiter lockerte. 1745 wurde der Holländer Gerard van Swieten als Leibarzt der Kaiserin nach Wien berufen. Er war ein frommer Katholik, aber ein Gegner der Jesuiten und vor allem ein strenger Vertreter der Wissenschaft; ihm hat der geistige Aufschwung Österreichs unendlich viel zu verdanken. Auf seinem eigensten Gebiete gewann er schnell Raum, denn die praktische Kunst des Arztes war ja die einzige, die die Jesuiten nicht übten; er gewann berühmte Ärzte für Wien und wurde so Begründer der dortigen medizinischen Schule. Daß die Geistlichkeit anatomische Lehrbücher der unvermeidlichen „Nuditäten“ wegen verbot, hörte nun gänzlich auf. Bald aber dehnte Swieten seine Reformarbeit auf das ganze geistige Leben Österreichs aus und stieß nun überall auf die Schranke der geistlichen Zensur, die die wichtigsten Bildungsmittel der Öffentlichkeit vorenthielt. Unerschrocken nahm er den Kampf gegen sie auf. Der Übermut seiner Gegner selbst drückte ihm die siegreiche Waffe in die Hand; als die geistliche Behörde sich anmaßte, sogar den Reichshofrat ihrer Zensur zu unterstellen, setzte es van Swieten bei der Kaiserin durch, daß die Prüfung zunächst der philosophischen und historischen Werke der Universität abgenommen und besonderen Zensurkommissionen in Wien und in den Provinzen anvertraut wurde. Von 1753 an mußten auch alle zum Druck bestimmten Manuskripte der unterdes gebildeten Bücherzensur-Hofkommission in Wien und nicht mehr den Jesuiten der Universität vorgelegt werden, und die bisherige völlige Zensurfreiheit der geistlichen Orden für ihre eigenen theologischen und philosophischen Schriften wurde aufgehoben — eine gewaltige Kraftprobe van Swietens, die der späteren josephinischen Reform (1780—1786) mächtig vorarbeitete.
An die Spitze dieser Wiener Zensurkommission, die bisher ein Hofkavalier geleitet hatte, trat 1759 van Swieten selbst. Sie war jetzt eine rein staatliche Behörde, aber die Hälfte ihrer Mitglieder bestand noch aus Geistlichen; zwar wurden diese Kleriker nicht mehr vom Jesuitenorden, sondern von der Kaiserin gewählt, und seit 1764 war kein Jesuit mehr darunter, aber den unmittelbaren Einfluß des Ordens auf die fromme Fürstin konnte auch van Swieten nicht völlig ausschalten.
Auch konnte er sich auf seinem heftig angefochtenen Posten nur dadurch halten, daß er gegen alles, was der Religion, dem Staate, den Sitten und überhaupt der „guten Denkungsart“ gefährlich erschien, fast ebenso unduldsam vorging wie seine geistlichen Gegner, besonders nachdem er als Direktor der K. K. Bibliothek mit Hilfe seiner Unterbeamten auch die Zensur der periodischen Schriften und der schönen Literatur, der „materia mixta“, selbst zu überwachen hatte. Ihm lagen nur die „nützlichen Bücher“ der Fachwissenschaft wahrhaft am Herzen. Deshalb setzte er, den Jesuiten zum Trotz, 1753 die Freigabe von Montesquieus „Esprit des lois“ durch, und des Weihbischofs von Hontheim (Febronius) Buch über die rechtmäßige Gewalt der römischen Päpste wurde nach langjährigem, erbittertem Kampf wenigstens in den Händen der Gelehrten geduldet. Aber van Swieten selbst verbot zahlreiche Schriften von Rousseau und Voltaire, von Maupertuis und Lamettrie, Thomas Hobbes und Christian Thomasius, von Crébillon und Fielding, Boccaccio und Sterne, Swift und Holberg, den Macchiavell und Ariosts „Rime satire“, Grimmelshausens „Simplizissimus“ und „Vogelnest“ und Rollenhagens „Froschmäusler“, Philander von Sittewalds „Gesichte“ und Reuters „Schelmuffsky“ und von Erzeugnissen der neu aufblühenden deutschen Literatur Albrecht von Hallers „Kleine Schriften“ und Gedichte von Joh. Christ. Günther, Wielands „Idris“, „Agathon“ und „Sieg der Natur“ nebst seiner französischen Übersetzung, die Leipziger und Göttinger Musenalmanache, Mendelssohns „Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele“ und die beiden ersten Bände der Schriften Lessings von 1753. Im ersten Bande erregten die satirische Fabel „Der Eremit“ und das tiefsinnige Gedicht „Die Religion“ großen Anstoß, ferner die Epigramme „Turan“, „Auf die Thestylis“ und „Die Nachahmung des 84ten Sinngedichts im dritten Buche des Martials“; im zweiten Bande der siebente Brief über eine lateinische Schmähschrift des Lemnius gegen die Priesterehe, im besonderen gegen Luther, aus der Lessing einige derbe, nur lateinische, nicht etwa übersetzte Proben gegeben hatte. Einzig des „Eremiten“ wegen wurde auch später noch einmal ein Band Lessingscher Schriften in Österreich verboten. Gegen diese übertriebene Strenge van Swietens einzuschreiten war eine der ersten Regierungshandlungen des jungen Kaisers Joseph nach seiner Erhebung zum Mitregenten seiner Mutter (1765).
Van Swieten war auch der Begründer des österreichischen „Catalogus librorum prohibitorum“, des gedruckten Verzeichnisses verbotener Bücher, das zur schnelleren Unterrichtung der Behörden und Buchhändler und zur nachdrücklicheren Durchführung seiner Verbote von 1754 bis 1780 in immer wieder revidierten und bereicherten Neuausgaben im Druck erschien und alsbald ein — sehr gesuchter Führer durch die anrüchige Literatur wurde, der, wie der schon oben erwähnte Berliner Schriftsteller und Buchhändler Friedrich Nicolai mit Recht sagte, die schlechten Leute die schlechten und die klugen Leute die klugen Bücher erst kennen lehrte. So wurde die löbliche Zensurhofkommission selbst die Verfasserin des gefährlichsten aller Bücher, und es ist erstaunlich genug, daß sie erst 1777 zu dieser Erkenntnis kam und daraus den logischen Schluß zog: sie setzte den von Sammlern und Buchhändlern vielbegehrten Katalog selbst auf den Index; er war von da ab nur noch Beamten und „erga schedam“ (gegen schriftliche, nur persönlich bewilligte Erlaubnis) Gelehrten zugänglich, die ihn von Amts oder Geschäfts wegen brauchten. —
In den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts war der Geschäftsgang der Zensur in Österreich folgender:
Was an Büchern von auswärts nach Österreich gesandt wurde, landete zunächst an der Grenze auf der Büchermaut, in deren unmittelbarer Nähe der Sekretär der Zensurkommission sein Amtszimmer hatte. Ihm wurden die Bücherpakete zugestellt und die Namen der Besitzer gemeldet. Was dem Sekretär als erlaubt bekannt war, wurde bald wieder zurückgegeben; was ihm unbekannt war, also jede Neuerscheinung, oder sonstwie bedenklich erschien, überwies er den zuständigen Mitgliedern der Zensurkommission. Bücher, die schon auf dem Index standen, beschlagnahmte er.