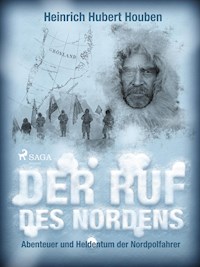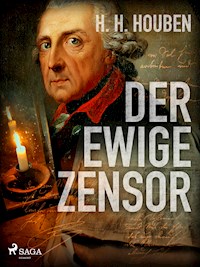Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In chronologischer Folge und nach akribischer Sammeltätigkeit hat Houben alle verfügbaren überlieferten Texte zu den von seinen Zeitgenossen mit Heinrich Heine geführten Gesprächen zusammengestellt und kann so insgesamt 825 Gesprächsdokumente versammeln. Neben seinen Briefen bieten diese Gespräche die reichhaltigste Quelle zu Heines Biografie. Dieses "erste Quellenwerk seiner Art" bietet eine wahre Fundgrube für den forschenden Germanisten wie auch den interessierten Laien und Heine-Enthusiasten.AUTORENPORTRÄTHeinrich Hubert (H. H.) Houben (1875–1935) war ein deutscher Literaturwissenschaftler und Publizist. Er studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte und promovierte 1898 über die Dramen Karl Gutzkows. Anschließend arbeitete er als Zeitungsredakteur, lehrte u. a. an der Humboldt-Akademie und der Lessing-Hochschule in Berlin und war Mitarbeiter mehrere Verlage (u. a. F.A. Brockhaus). Seit 1923 lebte er als freier Publizist und veröffentlichte zahlreiche Bücher. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehörten die Literatur des Jungen Deutschland und der Goethe-Zeit sowie die Geschichte der Zensur und die Bibliographie. Daneben machte er sich auf dem Gebiet des Aufspürens und Sammelns von Nachlässen und sonstigen Zeitdokumente verdient.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1524
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. H. Houben
Gespräche mit Heine
Gesammelt und Herausgegeben
Saga
Vorwort
Neben Goethe ist Heinrich Heine der reichste Sprecher unter allen Dichtern des neunzehnten Jahrhunderts. Der Witz, ein wesentlicher Teil seines Genies, sprudelt am frischesten, saust am schlagkräftigsten in mündlicher Wechselrede. Seit seinem ersten Semester ist seine spitze Zunge bei Gegnern gefürchtet, unter Freunden der Funke im Pulverfaß jugendlichen Übermuts. Das Bonmot ist sein Schrittmacher in der Geselligkeit von Hamburg, Berlin, München und Paris. Sein neuester Schlager hüpft wie ein Feuerwerksfrosch von einer Teegesellschaft in die andere. Freude an der Pointe, oft auch Schadenfreude, verbreiten ihn eilfertig weiter. Wo Heine auftritt, blüht die Anekdote: aus ihrem Samen wuchert üppig die Legende, die schließlich des Dichters Pariser Matratzengruft wie ein Dornröschengestrüpp überwächst. Die letzten acht Leidensjahre diente ihm, neben seinen wenigen neuen Schriften, das Gespräch als wichtigster Vermittler mit der Welt da draußen.
Heines Gespräche sind neben den Briefen die reichhaltigste Quelle zu seiner Biographie. Was da in der Zeitgeschichte „kreucht und fleugt“, alles kommt zur Sprache, und sämtliche „Prominenten“ der deutschen und französischen Literatur treten hier auf, als Helden und Liebhaber, Narren oder Intriganten; jeder hat sein Stichwort, tiefsinnig, übermütig, witzig, boshaft und immer wirksam. Aber – um Napoleons Wort umzudrehen – vom Lächerlichen zum Erhabenen ist nur ein Schritt: der Witz leuchtet wie Höhenfeuer auf Bergen, eine ernste, oft düstere, vielfach unerforschte Gedankenwelt umgibt uns, und aus dem nachgoetheschen Deutschland führen über Gipfel und durch Abgründe die Wege bis in unsere unmittelbare Gegenwart.
Seit dem Beginn meiner jungdeutschen Studien bin ich diesen mündlichen Dokumenten Heinescher Gedankenwelt nachgegangen, und das Ergebnis einer langjährigen Sammelarbeit lege ich in diesen „Gesprächen mit Heine“ vor. Mein Ziel war Vollständigkeit, soweit dieser Begriff auf geschichtliche Forschung überhaupt anwendbar ist und der immer schwieriger werdende wissenschaftliche Verkehr mit in- und ausländischen Bibliotheken, Archiven, Hütern und Besitzern literarischer Nachlässe usw. ihn überhaupt noch zuläßt. Die „Gespräche mit Heine“, das erste Quellenwerk seiner Art, stellen sich als ein, ich glaube sagen zu dürfen, wichtiger Ergänzungsband neben die Sammlungen seiner Werke und Briefe. Diese Einreihung schaltete von selbst die Wiederholung alles dessen aus, was in jenen Sammlungen bereits zu finden ist; Heines eigene, ausführliche Niederschriften über seine Gespräche mit Ludwig Börne z. B. lassen sich aus seiner bekannten Schrift über Börne nicht herausschälen, ohne einen fast vollständigen Abdruck jenes Buches zu geben; statt dessen biete ich hier die nicht weniger belangreichen Aussagen des Gegners zum erstenmal in ihrem ursprünglichen Wortlaut, und in den Briefen verstreute Gesprächfragmente und Anekdoten wurden nur dann herangezogen, wenn sie zur Kommentierung fremder Berichte dienen mußten. Lag doch eine solche Fülle unentbehrlichen, bekannten und unbekannten Stoffes vor, daß jede unnütze Wiederholung allgemein zugänglichen Textes sich von selbst verbot. Nur so war es möglich, die in Betracht kommende umfangreiche, oft überaus schwer erreichbare Heine-Literatur gleichsam in einer Nuß zu geben, und ohne die vorbildliche Unterstützung seitens der DüsseldorferLandes- und Stadtbibliothek, deren Direktor, Herr Dr. Nörrenberg, mir bei längerer Benutzung der dortigen einzigartigen Heine-Bibliothek jede Erleichterung zuteil werden ließ, wäre mein Ziel annähernder Vollständigkeit eine Illusion geblieben. Wenn diesem Buch einiges Verdienst um die Heine-Forschung zugeschrieben werden sollte, so darf ich vorab einen Teil dieser Anerkennung als Zeichen meines Dankes Herrn Dr. Nörrenberg überweisen, dessen pietätvolle und unermüdliche Sorgfalt die Düsseldorfer Heine-Sammlung geschaffen hat – das unanfechtbarste aller Denkmäler.
Das Ziel möglichster Vollständigkeit in der Wiedergabe der hier gesammelten Dokumente ist gerade Heine gegenüber eine Notwendigkeit, denn es handelt sich um einen Dichter, dessen Charakterbild in der Geschichte noch immer hin und her schwankt, von der einen Seite ebenso hoch erhoben wie von der anderen herabgezerrt wird. Jede Auswahl des Stoffes kann nur von bestimmten, vorher festgelegten Gesichtspunkten ausgehen und verfällt damit, bewußt oder unbewußt, einer Tendenz. Gegen diese Gefahr schützt allein das Streben nach Vollständigkeit, die Mitteilung alles Erreichbaren, ohne Rücksicht darauf, wie weit es im Streit der Meinungen über Heine der einen oder anderen Partei dienlich sein könnte. Wenn strenge Objektivität überhaupt etwas Menschenmögliches ist – in einer solchen Dokumentensammlung muß und kann sie walten. Ich habe mich daher auch in der Kommentierung der oft sich widersprechenden Berichte durchaus auf das rein Sachliche beschränkt, auf solche Widersprüche hingewiesen oder sie aufzuklären versucht und im übrigen nur den biographischen Faden fortgesponnen. Die weitere Ausbeutung des hier zusammengetragenen Materials muß der Einzelforschung überlassen bleiben; ihr hofft mein Buch als Handwerkszeug zu dienen.
Das Quellenverzeichnis am Schluß des Textes (S. 1079) weist die Herkunft sämtlicher Dokumente genau nach. Sie scheiden sich in gedruckte und handschriftliche. Daß längst Gedrucktes keineswegs immer als bekannt anzusprechen ist, besonders wenn es sich um Zeitschriftenliteratur oder gar Tageszeitungen handelt, weiß jeder Fachkollege, und so ist mir mancher Fund gelungen, den die Wünschelrute der Heine-Forschung bisher nicht aus seinem Versteck ans Licht gezogen hat. Daß unter den 228 aufgeführten Quellen 21 sind, die bisher völlig unbekanntes Material aus zahlreichen ungedruckten Briefwechseln Heinescher Zeitgenossen zutage fördern, darf ich wohl als ein willkommenes Ergebnis meiner Sammelarbeit hervorheben. Hier erwies sich wie stets Varnhagen von Enses Nachlaß als unerschöpflich; meine Kenntnis dieser Papiere geht noch in die Zeit zurück, da ich das Register zu seinen Tagebüchern, wie sie im Druck vorliegen, ausarbeitete, dazu die Originalhandschrift verglich und für mein „Bibliographisches Repertorium“ in Varnhagens weitschichtigem Briefwechsel neue Kunde für die Zeitschriften der Romantik und des Jungen Deutschlands suchte und fand. Der Verwaltung der Preußischen Staatsbibliothek Berlin, der Direktion ihrer Handschriftenabteilung, Herrn Prof. Dr. Degering, schulde ich für die uneingeschränkte Hergabe dieser Briefschaften wärmsten Dank; ebenso Herrn Prof. Dr. Strubell in Dresden und Herrn Prof. Dr. Ludwig Levin Schücking in Breslau für Mitteilung von mir erbetener Stücke aus dem endlich aufgetauchten Nachlaß Gustav Kühnes und dem Schückingschen Familienarchiv. Mein eigenes literarhistorisches Archiv bot ebenfalls mancherlei Ausbeute. Durch Übermittlung von Kopien in Deutschland nicht erreichbarer Druckschriften verpflichteten mich das Britische Museum in London (Herr Kustos R. F. Sharp) und die Nationalbibliothek in Wien.
Die Reihenfolge der Gespräche mit Heine, wie ich sie hier zusammengestellt habe, konnte nicht anders als chronologisch sein. Nicht nur mit Rücksicht auf den berechtigten Wunsch jedes Lesers nach stofflicher Abwechslung, sondern vor allem im Sinne des ganzen Buches. Diese Anordnung ermöglicht und belebt erst die vergleichende Kritik; das Gleichartige trifft zusammen, bestätigt und ergänzt sich gegenseitig, der eine Berichterstatter korrigiert oder widerlegt über denselben Vorgang den andern, Klatsch und Lüge verraten sich selbst, und die Wurzeln späterer Legenden liegen bloß. Um diese, für die Forschung wichtige Gegenüberstellung gleichartiger oder zusammengehöriger Dokumente zu ermöglichen, mußten die als Quellen dienenden umfangreichen Heine-Erinnerungen in Einzelgespräche zerlegt werden. War deren zeitliche Bestimmung nicht schon durch den Berichterstatter selbst gegeben, dann bot Heines Briefwechsel (in der dankenswerten Ausgabe von Fr. Hirth) vielfach zuverlässige Anhaltspunkte oder auch Berichtigungen falsch überlieferter Daten. Nicht immer war die Frage: Wann fand das Gespräch statt? einwandfrei zu beantworten; oft schieben sich mehrere Gespräche übereinander, ein späteres umrahmt ein früheres usw. In vielen Fällen blieb daher die Datierung ungewiß, und hinter den Jahreszahlen erscheinen Fragezeichen, wenn aus der Heine-Literatur kein zuverlässiger Nachweis zu gewinnen war. Berichte, die gelegentlich Gehörtes zeitlos zusammenfassen, habe ich da untergebracht, wo sie aus äußeren oder inneren Gründen am besten hinzupassen schienen; darüber mögen in Einzelfällen die Meinungen auseinandergehen. Fingierte (und als literarische Fiktionen sich bekennende) Gespräche, deren sich einige bei Karl Gutzkow, Heinrich Laube, Ferdinand Hiller, Philibert Audebrand und andern finden, kamen für meine Sammlung nicht in Betracht; ebensowenig die Phantasien des Spiritisten Johannes Bánfy. Offenbare Fälschungen habe ich nicht ganz übergangen, besonders dann nicht, wenn ihre Einreihung in den Zusammenhang den Nachweis der Erfindung ergab.
So hat sich eine Folge von 825 Gesprächen ergeben, die mit laufenden Nummern versehen sind. Am Kopf jedes Gespräches steht der Name dessen, der als Besucher oder Berichterstatter unmittelbar in Frage kommt oder mittelbar zu gelten hat. Erzählt beispielsweise Heines unzuverlässige Nichte Maria Embden, die spätere Fürstin della Rocca, Jugenderinnerungen des Dichters, so dürfen als eigentliche Gewährsleute ihre Mutter Charlotte oder ihre Großmutter Betty Heine angenommen werden. Oft genug geht aber auch die Tradition von Hand zu Hand, ehe sie einen literarischen Niederschlag findet; der wirkliche Zeuge bleibt mit und ohne Absicht anonym; in solchen Fällen mußte einfach der Erzähler verantwortlich zeichnen, auch wenn er weder der Besucher noch der ursprüngliche Berichterstatter war oder sein konnte. Nicht selten ist die Frage: Wer war hier der Besucher? gar nicht zu beantworten.
Die kleinen hochstehenden Ziffern hinter den Namen am Kopf jedes Gesprächs verweisen auf die laufenden Nummern des Quellenverzeichnisses. –
Die Behandlung der gedruckten Quellen erfordert noch eine nähere Aufklärung. Die meisten dieser Berichte über Besuche bei und Gespräche mit Heine erschienen zuerst in Zeitschriften oder Zeitungen, von Druckfehlern wimmelnd, vielleicht von der Redaktions- oder Zensurschere zerfetzt, von irgendeinem Anonymus überarbeitet. Solche Texte wurden nur im Notfall zugrunde gelegt, wenn ein zweiter Druck nicht existiert, oder in gewissen Ausnahmefällen, die im Quellenverzeichnis motiviert sind. Lag der Text in späterer Buchform vor, dann wurde deren Wortlaut wiedergegeben; die Buchtexte sind ja in der Regel von ihren Verfassern korrigiert, oft ergänzt und erweitert, und dürfen daher als zuverlässiger gelten. Immer aber wurde die erste Druckform, von wenigen unerreichbaren abgesehen, mit der zweiten verglichen. Das erwies sich besonders dann als unerläßlich, wenn zwischen dem ersten und zweiten Druck eine längere Zeitspanne lag, in der Anschauungen wechseln, frühere falsche Angaben sich durch bessere Kenntnis berichtigen, alte Freundschaften zersplittern und Feindschaften entstehen konnten, die gewisse Züge in anderm Lichte sahen. Solche Unterschiede der Lesart sind im Quellenverzeichnis genau nachgewiesen; im Text sind die betreffenden Stellen durch unauffällige Sternchen * gekennzeichnet; solch ein Sternchen hinter einem Einzelwort oder vor und hinter einer Wortgruppe bedeutet also, daß der erste Drucktext oder eine noch spätere dritte Redaktion andere Wendungen enthält, die unter den entsprechenden Quellen- und Gesprächnummern in dem angehängten Verzeichnis angegeben sind. Dort ist auch alles gesagt, was mir bei kritischer Betrachtung gewisser Quellen aufgefallen ist. Nur bei den durch Adolph Stahr und Fanny Lewald überlieferten Gesprächen waren die Abweichungen so bedeutend, daß es angebracht erschien, den Wortlaut der letzten Redaktion in den der ersten hineinzuarbeiten, wobei einige Wiederholungen unvermeidlich waren. Und bei Heinrich Laubes widerspruchsvollen Heine-Erinnerungen blieb nichts anderes übrig, als sie ihrer Entstehungszeit entsprechend aufeinander folgen zu lassen. An jenen Sternchen kann also der Leser, der für Varianten kein Interesse hat, achtlos vorübergehen. Was sich bei Vergleichung der Lesarten als offenbarer Druckfehler erwies, ist stillschweigend verbessert oder blieb unberücksichtigt. Ergänzungen, Erklärungen und Berichtigungen, die zum Verständnis des Textes notwendig waren, sind in den Text selbst eingeschoben und durch eckige Klammern [] als Zutat des Herausgebers kenntlich gemacht; umfangreichere Erläuterungen, die der zeitlichen Bestimmung oder der Kritik einzelner Gespräche dienen, sind an die entsprechenden Abschnitte, ebenfalls in eckigen Klammern, angehängt, vermitteln auch in einigen Fällen den Übergang zum nächsten Gespräch. Sternchen mit Klammer – *) – verweisen auf Anmerkungen am Fuß der Druckseite, wenn diese Anmerkungen zum Originaltext gehören. Zahlen mit Klammern – 1) usw. – sind Anmerkungen des Herausgebers, die ganz vereinzelt zur Kritik gewisser Angaben sofort nötig erschienen, in den Text selbst sich aber nicht einfügen ließen. Drei Punkte ... bedeuten, daß der Originaltext hier gekürzt ist; was dastand, hatte mit Heine überhaupt nichts zu tun oder doch nichts mit dem zufälligen Gespräch; was nur irgendwie beachtlich erschien und als Echo Heinescher Worte gelten konnte, habe ich stehenlassen, selbst auf die Gefahr mancher Wiederholungen hin, besonders in der Schilderung der Persönlichkeit des Dichters und seines Milieus.
Die fremdsprachigen Texte schließlich habe ich, von vereinzelten leicht verständlichen Sätzen abgesehen, in deutscher Sprache wiedergegeben. Wo autorisierte ältere Übersetzungen vorlagen, habe ich diese zugrunde gelegt, in allen übrigen Fällen die Übertragung aus dem Französischen, Englischen und Dänischen selbst vorgenommen. Mein Buch wendet sich ja nicht an den kleinen Kreis der Gelehrten, sondern soll jedem Freund Heines oder der Literatur überhaupt in allen Teilen verständlich sein. Von diesen fremdsprachigen Quellen bot das Buch von Alexander Weill, „Souvenirs intimes de Henri Heine“ (1883), weitaus die größten Schwierigkeiten, dieses begreiflich erscheinen lassen, daß dieses in Frankreich erfolgreiche Buch in der Heimat des Dichters so gut wie unbekannt ist und selbst bei den Heine-Forschern einem Vorurteil begegnet, das mir nicht gerechtfertigt erscheint; es ist kein Pamphlet und seine Schilderung Mathildes keine boshaftwitzige Karikatur, sondern ein Porträt mit allen Merkmalen drastischer Lebenswahrheit. Bei der Übersetzung Weills, der in geistreichen Bonmots und Pointen Heine selbst zu überbieten sucht, unterstützte mich in dankenswerter Weise ein jüngerer Studienkollege, Herr Dr. Karl Wolf in Hannover, Verfasser einer Dissertation über Gustav Kühne.
Die Ausarbeitung des Registers übernahm Herr Felix Hasselberg in Berlin; alle Benutzer meines Buches werden ihm dafür ebenso Dank wissen wie der Herausgeber.
Berlin, im Herbst 1925
Prof. Dr. H. H. Houben
Gespräche mit heine
1. Charlotte Embden-Heine74
1802
[Mitteilung ihrer Tochter Maria:] Nachdem Heine lesen und schreiben gelernt hatte, schickte man ihn in eine Mädchenschule, deren Vorsteherin eine alte fünfzigjährige Jungfer war. Der Knabe war erst vier Jahre alt, lernte alles mit der größten Leichtigkeit, aber das Stillsitzen war ihm unerträglich. Die Lehrerin bestrafte jede Unachtsamkeit aufs empfindlichste, und diese Strenge empörte ihn. Sie wurde ihm so verhaßt, daß er hin und her sann, wie er sich rächen könnte.
Eines Tages ließ die Lehrerin einen Krug mit Milch auf dem Tische stehen, und sowie er sich unbeobachtet sah, nahm er ein Tintenfaß und goß den Inhalt in die Milch. Hierauf stolzierte er in der Stube auf und nieder, die Hände auf dem Rücken, als ob nichts geschehen wäre!
Ein anderes Mal erwischte er die Schnupftabaksdose der Alten, leerte sie und füllte sie mit Sand. Als die Lehrerin ihm eine Strafpredigt hielt und ihn fragte, warum er dies getan habe, antwortete er mit Nachdruck: „Weil ich dich hasse!“
[Die „Mädchenschule“ war eine Kleinkinderbewahranstalt, in die Heine – geb. am 13. Dezember 1797 – mit vier Jahren gebracht wurde; die Vorsteherin hieß Frau Hindermans. Heine war unter einem Dutzend Mädchen „das einz’ge kleine Bübchen“, so heißt es in seinem Gedicht „Citronia“, das die Birkenrute der Frau Hindermans in drastischer Weise verewigt.]
2. Charlotte Embden-Heine74
1804
[Mitteilung ihrer Tochter Maria:] Heinrich und [seine Schwester] Charlotte waren noch ganz kleine Kinder, als sie an den Masern erkrankten und längere Zeit das Zimmer hüten mußten. Um sie zu beschäftigen, gab man ihnen eine Kiste voll bunter Lappen.
„Was wollen wir damit anfangen?“ fragte Charlotte.
„Wir wollen eine Narrenjacke davon machen“, antwortete Heinrich, und beide fingen emsig an zu nähen. Die Schwester mit ihrer angeborenen Lebhaftigkeit warf bald die Arbeit fort, aber Heinrich nähte mit großem Eifer, bis die Jacke fertig war, denn er wollte sie während der Karnevalszeit tragen.
Endlich kam der ersehnte Tag heran, aber man erlaubte ihm nicht, dieselbe anzuziehen. Ärgerlich und unmutig schenkte er sie einem Nachbarskinde.
Nach vielen Jahren, als Charlotte längst verheiratet war und in Hamburg wohnte, begegnete sie eines Tages einem gutgekleideten Matrosen, der sie ehrerbietig grüßte und folgendermaßen ansprach:
„Sie erkennen mich wohl nicht? Ich bin jener Knabe, dem Ihr Bruder einst eine Narrenjacke schenkte; damals wußte ich diese Gabe nicht zu schätzen, doch habe ich sie immer sorgfältig bewahrt. Vor nicht langer Zeit habe ich sie in siebzehn Stücke zerschnitten und unter meine Freunde verteilt, die ein Andenken von unserm berühmten Dichter besitzen wollten...“
Als meine Mutter [1855] in Paris war, erinnerte sie ihren Bruder an die Jacke und erzählte ihm ihre Begegnung mit dem Matrosen.
„Über dieses Thema werde ich dir ein Gedicht machen, und du sollst herzlich darüber lachen.“
Leider wurde dieses Gedicht nicht mehr geschrieben, der Tod ließ ihm keine Zeit dazu!
3. Betty Heine88
1805?
[Mitteilung ihrer Enkelin Maria:] Eines Tages – es war ein heißer Sommertag – studierte Heine in seinem Zimmer bei offenen Fenstern. Die Sonne schien so warm, und die hellen Strahlen liebkosten seine braunen Locken. Die Hitze wurde unerträglich. Harry legte die Feder beiseite, klappte seine Bücher zu und schritt nachdenkend zum Fenster. Sehnsuchtsvoll blickte er hinaus ins Freie. Plötzlich kam ihm der Gedanke, auf das Gesims des Fensters zu klettern und sich außerhalb desselben der Länge nach hinzustrecken. Gesagt, getan. Die Hitze überwältigte ihn, und er schlief ein.
Seine Gedanken, seine Träume führten ihn in das Reich der Phantasie, und unruhig wandte er sich zur Seite. Das Gesims war nur zwei Fuß breit, und mit Schrecken beobachteten die Vorübergehenden den schlafenden Knaben. Man benachrichtigte die Mutter, die händeringend auf die Straße eilte. Federbetten wurden ausgebreitet, Kissen und Decken herbeigeholt, denn man befürchtete das Kind könne jeden Augenblick auf die Straße fallen und sich den Kopf zerschmettern! Ihn wecken? Unmöglich; die leiseste Berührung konnte ein Unglück herbeiführen; man fürchtete ins Zimmer zu treten: das Geräusch der knarrenden Tür hätte ihn wecken können. Beobachtend standen die Leute auf der Straße und starrten zum zweiten Stock hinauf. – Jetzt bewegt er einen Arm – – hieß es, und die katholische Bevölkerung schlug ein Kreuz. Jetzt wandte er den Kopf – – die arme Mutter war nicht mehr Herr ihrer Sinne, und trotz aller Mahnungen wollte sie hinauf zu ihrem Sohn, um ihn zu retten oder mit ihm hinunterzustürzen.
Ängstlich, mit klopfendem Herzen stieg sie die Treppe hinauf – sie legte die Hand ans Schloß – es glückte, sie öffnete leise die Tür. Mit verhaltenem Atem stand sie auf der Schwelle. Leise zog sie die Schuhe aus und schlich ans Fenster. Unten staunte die Menge regungslos.
Sie streckte den Arm aus – sie wagte nicht, ihn zu umfassen – sie erhob den Blick gen Himmel, als ob sie dort oben um Hilfe flehte. – Mit festem Arm zog sie den Knaben an sich, durchs Fenster hinein, an ihre klopfende Brust.
Unten jauchzte das Volk und schrie: „Es lebe Madame Heine! Hoch!“
„Mutter, warum wecktest du mich? Engel umgaben mich, ich träumte, in einem Zauberhaine zu sein, Vögel sangen liebliche Melodien, und ich dichtete die Worte dazu.“
„Bist du mir böse?“ fragte er die weinende Mutter, deren Angst sich endlich in Tränen auflöste. Sie konnte weder schelten noch strafen, sondern küßte ihn innig. Zugleich wurde das Bewußtsein in ihr wach, daß das Kind zum Dichter geboren sei.
Meine Großmutter hat uns diese Begebenheit oft erzählt.
4. Charlotte Embden-Heine74
1805?
[Mitteilung ihrer Tochter Maria:] Schon als Kind war meine Mutter des Dichters Liebling, und des Morgens in aller Frühe, wenn die andern Mitglieder der Familie noch im tiefen Schlummer lagen, spielten Heinrich und Charlotte miteinander. Sie suchten Reime. Eines Tages quälte sich das kleine Mädchen vergebens, sie konnte die gewünschten Worte nicht finden. Sie wandte sich an den Bruder: „Dir ist es leicht, Reime zu finden, mir wird es sehr schwer, wir wollen lieber ein anderes Spiel spielen. Ich werde eine Fee vorstellen, wir bauen einen Turm, ich bewohne ihn; du bleibst draußen stehen, singst und findest Reime.“
Beinahe hätte dieses Spiel meiner Mutter das Leben gekostet.
Sie bauten einen Turm! Im Wagenschauer standen viele leere Kisten, die beiden Kinder arbeiteten unermüdlich, bis sie eine Kiste auf die andere gehoben hatten und ihr Gebäude zehn Fuß Höhe erreicht hatte. Dessenungeachtet fanden sie, daß der Turm noch immer nicht hoch genug war. Die Kleine kletterte hinauf bis an die letzte Kiste und sprang hinein. Die Fee verschwand, da die Kiste höher war als das Kind. Sobald Heinrich seine Schwester nicht mehr erblickte, wurde ihm bange, er lief nach Hause und rief um Hilfe. Charlotte versuchte sich zu befreien, die Kisten fingen an zu schwanken, und furchterfüllt kauerte sie, leise weinend, in einer Ecke. Um recht schön zu erscheinen, hatte sie ihr bestes Kleid angezogen und beim Hineinspringen bedeutend zerrissen. Sie fürchtete die Folgen, da meine Großmutter eine strenge Frau war und jeden Ungehorsam unerbittlich bestrafte.
Das Ende dieser Geschichte erzählte uns meine Mutter mit folgenden Worten: „Als man mir zu Hilfe eilte, blieb ich still und stumm in meiner Ecke sitzen, doch als ich das Klagen und Weinen meines Bruders hörte, rief ich ihm zu: ‚Ich lebe, aber mein Kleid ist zerrissen.‘ Nicht ohne Schwierigkeit wurde ich aus meinem sogenannten Turm hervorgeholt, und Heinrich umarmte mich stürmisch, überglücklich, sein Schwesterchen unbeschädigt wiederzusehen.“
1855, zwei Monate vor seinem Tode, als ich ihn zum letzten Male sah und wir von den glücklichen Tagen unserer Kindheit sprachen, erzählte er mir, daß er nie den freudigen Eindruck vergessen habe, den er damals als achtjähriger Knabe empfand.
[An diese Kinderspiele erinnert auch Heines Gedicht: „Mein Kind, wir waren Kinder.“]
5. Joseph Neunzig194
1806?
Die beiden Kinder [Harry und Charlotte] standen an einem Sonnabend auf der Straße, als plötzlich ein Haus zu brennen begann. Die Spritzen rasselten herbei, und die müßigen Gaffer wurden aufgefordert, sich in die Reihe der Löschmannschaften zu stellen, um die Brandeimer weiterzureichen. Als an Harry die gleiche Aufforderung erging, sagte er bestimmt: „Ich darf’s nicht, und ich tu’s nicht, denn wir haben heut Schabbes!“ – Schlau genug wußte der acht- bis neunjährige Knabe jedoch ein anderes Mal das mosaische Gebot zu umgehen. An einem schönen Herbsttage – es war wieder ein Samstag – spielte er mit einigen Schulkameraden vor dem Pragschen Hause, an dessen rebenumranktem Spalier zwei saftige reife Weintrauben fast bis zur Erde herabhingen. Die Kinder bemerkten dieselben und warfen ihnen lüsterne Blicke zu, aber der Vorschrift gedenkend, nach welcher man an jüdischen Feiertagen nichts von Bäumen abpflücken darf, wandten sie bald der verführerischen Aussicht den Rücken und setzten ihr Spiel fort. Harry allein blieb vor den Träubchen stehen, beäugelte sie nachdenklich aus geringer Entfernung, sprang dann plötzlich bis an das Spalier heran, biß die Weinbeeren eine nach der andern ab und verzehrte sie. „Roter Harry“ – diesen Spitznamen hatten ihm seine Kameraden wegen der rötlichen Farbe seines Haares erteilt, die später mehr ins Bräunliche überging – „Roter Harry!“ riefen die Kinder entsetzt, als sie sein Beginnen gewahrten, „was hast du getan!“ – „Nichts Böses“, lachte der junge Schelm; „mit der Hand abreißen darf ich nichts, aber mit dem Munde abzubeißen und zu essen hat uns das Gesetz nicht verwehrt.“
[Neunzig, später Arzt in Gerresheim bei Düsseldorf, war einer von Heines Schulkameraden und Universitätsfreunden. Was Heine unter seinem Namen Harry bei der Schuljugend zu leiden hatte, erzählen seine „Memoiren“.]
6. Betty Heine74
1807?
[Mitteilung ihrer Enkelin Maria:] Heinrich setzte seine Studien fort und war immer einer der ersten unter seinen Mitschülern; seine Mutter, eine große Verehrerin der schönen Künste, wollte, daß ihr Sohn ihrem Beispiel folge.
Man engagierte einen Zeichenlehrer, der arme Mann wohnte entfernt von der Bolkerstraße und war so müde, wenn er ankam, daß er sogleich einnickte. Heine hatte bedeutende Anlagen zum Zeichnen, wurde der Sache aber bald überdrüssig und suchte den Lehrer zu entfernen. Eines Tages zeichnete er einen Eselskopf auf einen Bogen Papier, befestigte das Blatt auf dem Rücken des Lehrers, der nichts bemerkte und ruhig weiterschnarchte. Beim Fortgehen wurde er von allen Gassenbuben verfolgt und verhöhnt, bis eine alte Frau ihn mitleidsvoll von diesem Aushängeschild befreite. Empört kehrte er zu Herrn Heine zurück und beklagte sich über den unerzogenen Knaben.
„Es scheint mir unmöglich,“ sagte Herr Heine, „daß mein Sohn einen solch unpassenden Scherz ausüben konnte, ohne daß Sie es bemerkten, denn Sie sind doch gewiß die Aufmerksamkeit selbst während der Lehrstunde.“
Heinrich stand ängstlich horchend in einer Ecke, denn er fürchtete die wohlverdiente Strafe seiner Tat, doch als er den Vater so sprechen hörte, näherte er sich und sagte vorlaut: „Papa, er schläft während der ganzen Stunde und träumt laut von seinen Schulden.“
[Heine besuchte seit 1. August 1804 die Normalschule im Franziskanerkloster zu Düsseldorf, Herbst 1811 bis Ostern 1814 das dortige Lyzeum oder Gymnasium; ein Musterschüler war er aber keineswegs.]
7. Betty Heine74
1807?
[Mitteilung ihrer Enkelin Maria:] Nun sollte Heine Musik studieren, und er wählte die Violine. Ein berühmter Lehrer wurde engagiert, und die Stunden nahmen ihren Anfang. Nach drei Monaten ging meine Großmutter an der Stube vorbei, wo Heinrich mit seinem Lehrer studierte, und angenehm überrascht blieb sie an der Tür stehen, den lieblichen Tönen lauschend, die ihr entgegenhallten.
Mein Sohn ist ein Wunderkind, dachte die Mutter und wollte dem Lehrer ihre Zufriedenheit beweisen. Sie trat ins Zimmer – das Wort erstarb ihr auf den Lippen, wie angewurzelt blieb sie auf der Schwelle stehen! Heinrich lag lang ausgestreckt auf dem Sofa, der Lehrer ging in der Stube auf und nieder und geigte seine schönsten Kompositionen.
Heinrich war so in Gedanken vertieft, daß er das Kommen seiner Mutter überhört hatte, und bemerkte ihre Gegenwart erst dann, als sie ihn unsanft aus seinen Träumen aufrüttelte. „Schade, daß du mich störst, die Töne der Musik kamen meiner Idee zu Hilfe, und ich war eben im Begriff, ein schönes Lied zu dichten.“
8. Charlotte Embden-Heine74
1809?
[Mitteilung ihrer Tochter Maria:] Im zwölften Jahre schrieb er sein erstes Gedicht. Während des Tages war seine Zeit so in Anspruch genommen, daß er nicht genug studieren konnte, also nahm er die Nacht zu Hilfe. Seine Stube war sehr kalt und nicht genug erwärmt, wodurch er sich eine schwere Krankheit zuzog. Später wußte er sich eine wollene Mütze zu verschaffen und einen großen Pelz, um sich gegen die Kälte zu schützen.
Eine alte Köchin versah ihn mit Wachskerzen, und als sie sie ihm verweigerte, legte er sich aufs Bitten und Schmeicheln. Als auch dies nicht half, wurde er böse, geriet in Zorn und sagte ihr derbe Grobheiten. Sie beklagte sich bei seinem Vater und nannte ihn einen bösen Buben, der alles sage, was ihm in den Kopf käme.
9. Charlotte Embden-Heine74
1810?
[Mitteilung ihrer Tochter Maria:] Meine Mutter wurde in einem Kloster erzogen, d. h. sie ging dort in die Schule, die zwar von Nonnen geleitet wurde, welche jedoch aufgeklärt genug waren, den besten Professoren der Stadt den Unterricht für Geschichte, Geographie und Literatur anzuvertrauen.
Professor B. erzählte seinen Schülerinnen eine Geschichte, die sie zu Hause niederschreiben mußten. Nach den Schulstunden setzte meine Mutter sich an die Arbeit, doch soviel sie auch nachdenken mochte, sie konnte sich des Inhalts der Erzählung nicht mehr entsinnen. Mit den Armen auf dem Tische, untätig ins Weite starrend, rollten große Tränentropfen über ihre Wangen, und so fand Heinrich sein Schwesterchen.
„Was gibt’s?“ fragte er.
„Die Geschichte, die ich niederschreiben soll, ist mir entfallen – was soll aus mir werden, wie kann ich morgen vor dem Professor erscheinen – –“ und heftiges Schluchzen verhinderte sie weiterzusprechen.
„Beruhige dich, liebes Lottchen,“ begütigte sie der Bruder, „suche nur dich zu erinnern, von welchem Gegenstande der Lehrer sprach, gib mir eine Andeutung, den geringsten Anhalt, und ich schreibe dir eine prächtige Geschichte.“
Nach einer Stunde brachte er seiner Schwester das Heft; glücklich und vergnügt, von dieser unangenehmen Arbeit befreit zu sein, legte sie es in ihre Schulmappe, ohne auch nur einen Blick hineinzuwerfen.
Den folgenden Tag legte sie ihr Heft zu den andern, und nachdem der Lehrer sie alle beisammen hatte, nahm er sie mit nach Hause, korrigierte sie und gab, je nachdem man es verdiente, gute oder schlechte Punkte. Meine Mutter trug das Köpfchen hoch und erwartete gelobt zu werden; doch zu ihrem größten Erstaunen behielt der Lehrer ihr Heft zurück. War die Geschichte zu lang – hatte er sie nicht gelesen?
Nach Beendigung der Lehrstunde ließ der Professor sie rufen. „Wer hat dies geschrieben?“ auf das Heft zeigend.
Ohne Zögern antwortete sie: „Ich!“
„Ich werde weder schelten noch dir Vorwürfe machen,“ sagte er, sie ermutigend, „nur sage mir: Wer hat dies geschrieben?“
Beschämt, eine Unwahrheit gesagt zu haben, nannte sie den wahren Verfasser.
„Dies ist ein Meisterwerk“, rief er aus.
Zwei andere Professoren hatten diesem kleinen Verhör beigewohnt und Professor B. las ihnen den Aufsatz vor. Es war eine grausige Gespenstergeschichte und mit so lebhaften Farben geschildert, daß das kleine Mädchen laut aufschrie...
Professor B. besuchte meine Großmutter und beglückwünschte sie, einen so geistreichen Sohn zu haben, der mit solcher Leichtigkeit ein solches Meisterwerk zustande bringen konnte. Der Knabe wurde gerufen, blieb jedoch kalt bei allen Lobeserhebungen, denn er glaubte nicht etwas Besonderes geschaffen zu haben. Der Lehrer wollte durchaus das Manuskript behalten, allein er bekam nur eine Abschrift.
[Gefunden hat sich dieses jugendliche „Meisterwerk“ bisher nicht.]
10. Max Heine70
1810?
Unsere Mutter, die überhaupt für eine ziemlich strenge Erziehung war, hatte von unserer ersten Jugend an uns daran gewöhnt, wenn wir irgendwo zu Gast waren, nicht alles, was auf unseren Tellern lag, aufzuessen. Das was übrigbleiben mußte, wurde der „Respekt“ genannt. Auch erlaubte sie nie, wenn wir zum Kaffee eingeladen waren, in den Zucker so einzugreifen, daß nicht wenigstens ein ansehnliches Stück Zurückbleiben mußte.
Einstmals hatten wir, meine Mutter und ihre sämtlichen Kinder, an einem schönen Sommertage außerhalb der Stadt Kaffee getrunken. Als wir den Garten verließen, sah ich, daß ein großes Stück Zucker in der Dose zurückgeblieben war. Ich war ein Knabe von sieben Jahren, glaubte mich unbemerkt und nahm hastig das Stück Zucker aus der Dose. Mein Bruder Heinrich hatte das bemerkt, lief erschrocken zur Mutter und sagte ganz eiligst: „Mama, denke dir, Max hatte den Respekt aufgegessen!“
11. Betty Heine74
1810?
[Mitteilung ihrer Enkelin Maria:] Es war Jahrmarkt; die Dienstboten erhielten die Erlaubnis, ein Tanzlokal zu besuchen, die Mutter und die Kinder mit einer alten tauben Magd blieben zu Hause. Die Kinder saßen bei der Mutter und hörten ihren Erzählungen zu, als plötzlich ein heller Lichtstrahl ins Zimmer drang und die Flammen aus dem Nachbarhause prasselnd emporschlugen.
Das Haus gehörte einem Bierbrauer, dessen ganze Malzvorräte sich entzündet hatten. Schleunige Hilfe tat not, und man eilte zum Nachbar, der noch nichts bemerkt hatte. Das Feuer wurde gelöscht, ohne viel Unheil angerichtet zu haben. Dankbar geleitete der Brauer meine Großmutter, von den Kindern gefolgt, bis an die Tür ihrer Wohnung.
Doch welche unangenehme Überraschung, die Haustür war ins Schloß gefallen, unmöglich, sie von außen zu öffnen. Man schellte und schellte, aber vergebens. Die alte Magd nähte in einer Hinterstube, ihre Taubheit verhinderte sie, uns zu hören.
„Mutter,“ sagte Heinrich, „sieh, die Tür des Wagenschauers ist unverschlossen; von hier aus können wir ins Haus gelangen.“
Eine große Reisekutsche stand hier, mit grauem Leinen behangen. Im Vorbeigehen bemerkte Heinrich, daß ein Mann unter den Wagen huschte. Weder mit einer Miene noch einem Ausruf verriet er, was er gesehen hatte. „Mütterchen,“ sagte er, „ich kehre gleich zurück, ich habe mein Taschentuch beim Nachbar vergessen.“
Die Mutter hatte keine Ahnung von dem, was ihr Sohn gesehen hatte, und wollte ihn zurückhalten, aber er lief lachend davon und berichtete dem Nachbar, was er gesehen hatte. Dieser versammelte seine Knechte, bewaffnete sie mit Knütteln und Heugabeln, folgte dem kleinen Heine in die Remise und fand den Mann, mit einem großen Messer bewaffnet, unter dem Wagen.
Er wurde hervorgezogen und geknebelt. Es war ein entlaufener Sträfling, und als die Polizeidiener ihn abholten, wandte er sich an den Knaben mit diesen Worten: „Erinnere dich, du kleine Canaille, wenn ich wieder frei werde, bringe ich dich um!“
Viele Jahre vergingen. Heine studierte in Bonn und reiste zum Vergnügen nach Aachen, um der Hinrichtung eines Missetäters vermittels der Guillotine beizuwohnen. Einer der Studenten, welcher Phrenologie studierte, erhielt die Erlaubnis, den armen Sünder im Gefängnisse zu besuchen, um wissenschaftliche Beobachtungen anzustellen.
Heines Neugier war erregt und er bat seinen Freund, ihn begleiten zu dürfen, doch wie unangenehm wurde er berührt, als der Mann einen Schrei ausstieß und Heine in ihm den Sträfling erkannte, der in der Remise festgenommen wurde. Am folgenden Tage wohnte er der Hinrichtung bei und behauptete, daß der zum Tode Verurteilte ihn erkannt und ihm einen haßerfüllten Blick zugeworfen habe.
Von dieser Zeit an konnte er nicht mehr von Hinrichtung und Schafott sprechen hören, sogar der Name Aachen versetzte ihn in nervöse Aufregung.
[Da Heine selbst diesen Vorfall nie erwähnt, dürfte die Erzählung seiner Nichte, die ebenso wie ihr Onkel Max Heine mancherlei über den Dichter zu fabulieren pflegte und es mit der Wahrheit nicht eben genau nahm, mit Vorbehalt aufzunehmen sein.]
12. Joseph Neunzig194
1812?
[Nach Mitteilung von Adolf Strodtmann:] Joseph Neunzig, der von Jugend auf ein fleißiger Schüler der Düsseldorfer Malerakademie war... porträtierte damals manchen seiner Freunde auf Elfenbein, unter ihnen auch Heine. Bei der ersten Sitzung machte ihn dieser besonders auf den... satirischen Zug am Munde aufmerksam und bat ihn, denselben ja nicht zu verfehlen. Als ihm Neunzig nach einigen Tagen das wohlgetroffene, mit einem geschliffenen Glase bedeckte Miniaturbild übergab, zeigte sich Heine sehr erfreut und rief lustig aus: „So, nun wollen wir das Bild auch in Musik setzen lassen!“
13. Joseph Neunzig194
1814?
[Nach Mitteilung von Strodtmann:] Eines Tages kam Harry mit begeisterungstrahlenden Wangen zu ihm [Neunzig] hinübergeeilt und las ihm das Gedicht „Die Grenadiere“ vor, das er soeben geschrieben, und nie vergaß dieser die tiefschmerzliche Betonung der Worte: „Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!“ Bald nachher wurde die unsterbliche Romanze von dem Düsseldorfer Tonkünstler Max Kreuzer in Musik gesetzt und von ihm dem französischen Marschall Soult gewidmet, dessen Gemahlin aus dortiger Gegend stammte.
14. Max Heine70
1814?
Als Heinrich Heine das Gymnasium in Düsseldorf besuchte, war er am Schlusse des Schuljahres einer von den Schülern, die bestimmt waren, bei dem öffentlichen Schulaktus ein Gedicht vorzutragen.
In jener Zeit schwärmte der junge Gymnasiast für die Tochter des Oberappellationsgerichtspräsidenten von A---. Diese war ein wunderschönes, schlankes Mädchen mit langen, blonden Locken. Ich bin überzeugt, daß manches seiner ersten Gedichte an diese reizende, fast ideale Erscheinung gerichtet war. Der Saal, in welchem der Schulaktus stattfand, war Kopf an Kopf gefüllt. Ganz vorn, auf prachtvollen Lehnstühlen, saßen die Schulinspektoren. In der Mitte zwischen denselben stand ein leerer goldener Sessel.
Der Oberappellationsgerichtspräsident kam mit seiner Tochter sehr spät, und es blieb nichts anderes übrig, als dem schönen Fräulein auf dem leerstehenden goldenen Sessel, zwischen den ehrbaren Schulinspektoren den Platz anzuweisen. Heine war gerade in der Deklamation des „Tauchers“ von Schiller in vortrefflichem Schwunge bis zur Stelle gelangt, wo es heißt: „Und der König der lieblichen Tochter winkt“, da wollte es sein Mißgeschick, daß sein Auge gerade auf den goldenen Sessel fiel, wo das von ihm angebetete schöne Mädchen saß. Heine stockte. Dreimal wiederholte er die Stelle: „Und der König der lieblichen Tochter winkt“, aber er kam nicht weiter. Der Klassenlehrer soufflierte und soufflierte; Heine hörte nichts mehr. Mit großen offenen Augen schaute er, wie auf eine plötzlich erschienene überirdische Gestalt, auf den goldenen Sessel hin und sank dann ohnmächtig nieder. Keiner im Saale ahnte die Ursache. „Das muß die große Hitze im Saale getan haben“, sagte der Schulinspektor zu meinen herbeieilenden Eltern und ließ alle Fenster öffnen.
Nach vielen Jahren hat er mir den Zusammenhang dieser Jugendbegebenheit erzählt, indem er sich oft mit dem Ausrufe unterbrach: „Wie war ich damals unschuldig!“
[Die Heineforschung hat festgestellt, daß der Gymnasialschüler Harry Heine einmal bei einer öffentlichen Schulprüfung Schillers „Kassandra“ deklamieren mußte, aber steckenblieb, und daß der angebliche Oberappellationsgerichtspräsident ein Kriegsrat von Ammon war.]
15. Werner193
Herbst 1814
[Über Heines Aufenthalt in der Handelsschule von Vahrenkampff auf der Neustraße zu Düsseldorf 1814 berichtet Karpeles, zum Teil nach Mitteilung von Werner:] Allzuviel von jenen Handelswissenschaften mag er... sicher nicht gelernt haben; dagegen werden verschiedene Scherze erzählt, die der junge Harry dort getrieben und die schon auf eine gewisse poetische Veranlagung schließen ließen. So pflegte er seinen Mitschülern die alten Klassiker in „Judäas lieblichen Dialekt“ zu übersetzen. Der jüdischdeutsche Homer oder Ovid rief oft in den Zwischenstunden ein schallendes Gelächter hervor. Einen andern Scherz erzählt ein etwas älterer Kamerad Heines, der nachmalige Kreisbaumeister Werner zu Bonn, der den Platz zur rechten Seite Heines in jener Handelsschule innehatte, während zur Linken ein gewisser Faßbender, der Sohn des Besitzers einer Brauerei „Zum Specht“ saß. Eines Tages erhebt sich ein plötzlicher Lärm in der Schulstube – Harry Heine fliegt von seiner Bank unter den Tisch. „Was geht hier vor?“ fragt der eintretende Lehrer. „Oh,“ antwortet der junge Faßbender zorngeröteten Gesichts im breitesten rheinländischen Dialekt, „de verdammte Jüdde sähd: ‚Em Specht, em Specht, do schläft de Mähd beim Knecht.‘ Do han ich em ene Watsch gegewe und do is hä von de Bank gefalle.“ Unter allgemeiner Heiterkeit erteilte der Lehrer den beiden Knaben eine derbe Rüge.
[Nach dem Besuch der Handelsschule in Düsseldorf wurde Heine im Herbst 1815 nach Frankfurt in die kaufmännische Lehre gegeben, dann nach Hamburg in das Bankgeschäft seines reichen Oheims Salomon Heine, der dem Neffen 1817 eine eigene Firma „Harry Heine & Co.“ gründete, die aber schon 1818 wieder aufgelöst wurde.]
16. Kaufmann Unna180
1818
[Mitteilung von Gustav Karpeles:] Ein gewisser Unna, Kommis eines bedeutenden Garderobengeschäfts von Bonfort, war von seinem Prinzipal beauftragt, einen bestimmten Betrag in dem Manufakturwarengeschäft von Harry Heine einzukassieren. Zufällig traf er es glücklich, indem er den Chef selbst anwesend fand, was sonst bei den meisten Gläubigern nicht der Fall war. Er war gerade bei guter Laune und gab ihm auf jene Schuld zwei Louisdors, welche Unna in der offenen Hand behielt. Darauf fragte Heine: „Junger Mann, Sie sind doch Kaufmann, nicht wahr?“ „Allerdings!“ war die Antwort. „Dann rate ich Ihnen, immer nehmen, nehmen, nehmen!“ „Ja,“ war die Entgegnung, „ich nehme ja; ich will aber gern noch mehr nehmen!“ „Sehr gut, sehr gut,“ erwiderte Heine, „aus Ihnen kann noch etwas werden, aber ich habe eben nicht mehr“, und drängte ihn sanft zur Tür hinaus.
17. W. Koppel180
1818
[Mitteilung von Koppel an Karpeles:] Aufsehen erregte damals in Bankierkreisen der folgende Witz von Heine, den er gelegentlich einmal bei einem Diner geäußert haben soll: „Meine Mutter hat schönwissenschaftliche Werke gelesen und ich bin ein Dichter geworden; meines Onkels Mutter dagegen hat den [Räuberhauptmann] Cartouche gelesen und Onkel Salomon ist Bankier geworden.“
[In etwas anderer Form benutzt im 1. Kapitel der „Memoiren des Herren von Schnabelewopski“, die viel Autobiographisches enthalten und zum Teil aus „Zeitmemoiren“ bestehen, mit deren Niederschrift sich Heine schon 1823 beschäftigte.]
18. Aron Hirsch180
Frühjahr 1819
[Mitteilung von W. Koppel an Karpeles:] Ein gewisser Aron Hirsch, der Hausfreund bei den Großeltern Koppels war, erzählte einst in Gegenwart seines [Koppels] Vaters, daß er als Buchhalter bei Salomon Heine beauftragt ward, Harry Heine auf der Abreise von Hamburg zu begleiten resp. für sein Fortkommen von dort zu sorgen. Unterwegs im Wagen habe er ihm ins Gewissen gesprochen, daß er seine Karriere in dem Geschäft seines angesehenen und wohlhabenden Onkels so leichtsinnig verscherzt habe. Darauf habe Heine ihm auf die Schulter geklopft und gesagt: „Sie werden noch von mir hören, lieber Hirsch!“
[Dieses Aron Hirsch, der später selbst ein vermögender Mann wurde, gedenkt Heine noch später oft in seinen Briefen an Bruder Max. – Da Onkel Salomon einsah, daß der Neffe zum Kaufmann verdorben sei, gab er ihm die Mittel, Rechtswissenschaft zu studieren. Im Herbst 1819 bezog Heine als stud. jur. die Universität Bonn.]
19. Friedrich Steinmann164
Herbst 1819
Mir war nicht bekannt, als ich im Herbst 1819 nach Bonn kam, daß Heine da sei. Am Tage nach meiner Ankunft daselbst traf ich ihn am Rheinufer, wo er mit mehreren zusammenstand und Fischern im Kahne zuschaute. Da hörte ich den ersten „Witz, den er riß“, indem er seiner Umgebung zuraunte: „Seid auf eurer Hut, daß ihr nicht ins Wasser fallet! Man fängt hier Stockfische.“ Dabei reckten sich seine Mundwinkel scharf auseinander, und der alte bekannte satirische Zug spielte um seine Lippen...
Die Mütze von brennend roter Farbe weit nach hinten auf den Kopf geschoben, der Rock – im Winter Flausch, im Sommer von gelbem Nankingzeuge, beide Hände in den Hosentaschen, mit nachlässigem Gange, stolpernd und rechts und links umherschauend – das waren die Umrisse zu Heines äußerem Bilde, wenn er über das Straßenpflaster zu Bonn schlenderte, die Mappe unter dem Arme, um ins Kollegium zu gehen, das Gesicht fein, weißer Teint, lichtbraunes Haar, ein kleines Bärtchen unter der Nase, die Gesichtsfarbe fein gerötet.
[Dieser Bonner Studienfreund Steinmann hat sich später durch dreiste Fälschungen von Gedichten und Briefen, die er Heine unterschob, übel bekannt gemacht.]
20. Wolfgang Menzel144
November/Dezember 1819
An die Stelle Haupts wurde ich... am 7. November [1819] zum Vorstand der [Bonner] Burschenschaft gewählt und nahm dieses Amt an, um den bessern Geist auf der Universität... noch solange zu nähren, als es möglich sein würde: denn ich wußte voraus, es würde nicht lange mehr dauern. Der Karlsbader Kongreß war zu Ende gegangen und seine Beschlüsse [vom 20. September 1819] drohten der patriotischen Partei gänzliche Vernichtung... Unter den vielen Jünglingen, die sich um mich drängten, gaben sich, ohne daß ich es wünschte, besonders zwei viele Mühe um mich, nämlich der kleine Jude Heinrich Heine, der einen langen dunkelgrünen Rock bis auf die Füße und eine goldene Brille trug, die ihn bei seiner fabelhaften Häßlichkeit und Aufdringlichkeit noch lächerlicher machte, weshalb man ihn unter dem Namen Brillenfuchs vielfach verspottete. Aber er war geistreich und wurde daher von uns Älteren gegen die Spötter geschützt. Der andere war Jarcke, ein protestantischer Ostpreuße, welcher einige Jahre später katholisch geworden ist und als Publizist seine Rolle in Wien gespielt hat... Dieser Jarcke hing sehr an mir und zwar aus andern Gründen, als Heine, dem es bloß darum zu tun war, sich meines Schutzes zu erfreuen, da er so viel verhöhnt wurde. Damals ahnte noch niemand, daß in diesen beiden, die man oft meine Leibfüchse nannte, das destruktive und konservative Extrem des Zeitalters auseinandertreten würde.
21. Bonner Universitätsgericht116
26. November 1819
[Am 18. Okt. 1819 hatten Bonner Studenten den Jahrestag der Völkerschlacht auf dem Kreuzberg festlich begangen. Heines Landsmann und Stubengenosse Joseph Neunzig schrieb darüber einen stark übertreibenden Bericht, der in der „Düsseldorfer Zeitung“ erschien und sehr übel vermerkt wurde. Seit dem 23. März 1819, der Ermordung Kotzebues durch den Studenten Sand, standen die Universitäten unter strenger Aufsicht. Die Burschenschaften waren verboten. Zwei Professoren und elf Studenten wurden über die Kreuzbergfeier verhört.]
Protokoll, verhandelt am Akademischen Gericht zu Bonn, den 26. November 1819. Präsentibus: Herr Professor Mittermaier, qua stellvertretender Syndikus: Oppenhoff, Universitätssekretär.
Der vorgerufene studiosus juris Harry Heine aus Düsseldorf, neunzehn Jahre alt, seit Michaelis d. J. in Bonn, gehörig die Wahrheit zu sagen ermahnt, nach vorgängiger Erklärung, daß er auf dem Kreuzberge am 18. Oktober gewesen sei, deponiert auf die Frage:
Wieviel Lebehoch wurden ausgebracht?ad. 1. „Ich erinnere mich an zwei; das erste dem verstorbenen Blücher und das zweite, wenn ich nicht irre, der deutschen Freiheit.“
Wurde der Burschenschaft kein Lebehoch gebracht?ad. 2. „Nein, ich erinnere mich nicht, ein solches gehört zu haben.“
Erinnern Sie sich noch an den Zusammenhang der gehaltenen Reden?ad. 3. „In der ersten Rede konnte ich keinen Zusammenhang finden, und den Zusammenhang der zweiten kann ich nicht angeben, weil ich mich nicht erinnere.“
Kamen in einer der Reden die Worte vor: „Auf uns ruht eine schwere Last?“ad. 4. „Diese Worte glaube ich gehört zu haben, den Zusammenhang kann ich mir aber nicht mehr ins Gedächtnis rufen.“
Geschah in einer der Reden am Schlusse die Frage, ob einer wäre, der sich dem Dienste für Vaterland usw. entziehen wolle?ad. 5. „Eine solche hervorstehende Frage erinnere ich mich nicht gehört zu haben.“
Kamen die Worte vor: „Auf uns hofft und wartet das Volk, um das gedrückte Vaterland vom Drucke zu befreien?“ad. 6. „Nein, solche Worte habe ich nicht gehört.“
Wissen Sie sonst nichts anzugeben?ad. 7. „Nein.“
Ist Ihnen nicht bekannt, daß über das Fest in der „Düsseldorfer Zeitung“ etwas stand?ad. 8. „Ich habe davon gehört.“
Von wem haben Sie das gehört?ad. 9. „In ‚vinea domini‘ [Wirtsgarten bei Bonn?] habe ich davon sprechen hören.“
Können Sie keine Spur angeben, durch wen nach Düsseldorf darüber geschrieben worden ist?ad. 10. „Ich habe den stud. Neunzig an einem Briefe nach Düsseldorf schreiben gesehen, und auf die Frage, was der lange Brief enthalte, gab Neunzig ganz unbefangen die Antwort, daß er die Burschenfeier einem Freunde beschreibe.“
Wissen Sie nicht den Namen des Freundes, an den er schrieb?ad. 11. „Nein.“
Wissen Sie nicht, was er geschrieben hat?ad. 12. „Nein, ich habe den Brief nicht gelesen.“
Haben Sie keinen Grund zu glauben, daß Neunzig den Brief absichtlich, damit er abgedruckt werde, nach Düsseldorf geschrieben hat?ad. 13. „Nein, das glaube ich nicht; Neunzig ist an sich schwatzseliger Natur.“
Hat sich Neunzig nicht gegen Sie geäußert, daß ihm das Fest mißfallen habe?ad. 14. „Nein.“
Wer ist denn sonst noch von Düsseldorfern hier auf der Universität?ad. 15. „Ich kenne sie nicht alle.“
Wissen Sie sonst nichts anzugeben?ad. 16. „Nein.“
22. Joseph Neunzig194
1819/20
[Mitteilung Neunzigs an Strodtmann:] Dem Joseph Neunzig... passierte einst das Malheur, Harry beim Spiele durch einen Steinwurf so heftig am Kopf zu verletzen, daß das Blut aus der Wunde floß... Als er später auf der Universität Bonn Harry an jenen Steinwurf erinnerte, sprach dieser mit ironischem Lächeln: „Wer weiß, wozu es gut war! Hättest du nicht die poetische Ader getroffen und mir einen offenen Kopf verschafft, so wäre ich vielleicht niemals ein Dichter geworden!“
23. Joseph Neunzig194
1819/20
Ein Israelit, welcher Medizin studierte, gestand, er zöge das Christentum dem Judentume vor und würde sich gern taufen lassen, wenn nur nicht das Dogma von der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria allzu fatal den Gesetzen der Wissenschaft widerspräche. Heine hörte aufmerksam zu, er sagte nichts, aber ein sarkastisches Lächeln umspielte seine Lippen. Überhaupt sprach er wenig; er war mehr Beobachter und Denker, als redseliger Teilnehmer an der allgemeinen Konversation; wenn er sich in letztere einmischte, geschah es meist durch kurze, schlagartig treffende Bemerkungen oder drollige Witze.
24. Johann Baptist Rousseau174
Winter 1819/20
Heine, der sein Latein in Hamburg verschwitzt hatte, wandte sich damals an Professor Heinrich mit dem Gesuch, ihm einen Philologen zu empfehlen, der ihm beistände, das Versäumte nachzuholen. Heinrich wies ihn an mich. Wir lasen jeden Morgen von sieben bis acht erst den Sallust, dann den Virgil; allmählich rückte Heine, der damals in Bonn für einen äußerst närrischen Kauz galt und von den Studenten als Idiot zum besten gehalten wurde, mit Manuskripten und der Zeitschrift „Der Wächter“ heraus, legte mir Gedichte von Freudhold Riesenharf vor, den er für einen seiner intimsten Hamburger Freunde ausgab, und bat mich um ein Urteil darüber; ihm schienen sie keinen Schuß Pulver wert. Als ich, in Heine durchaus nicht den Verfasser vermutend, mein Entzücken darüber aussprach und trotz des bestimmtesten und wohl gar massiven Einsprechens Heines jenen Riesenharf für ein Genie erster Größe halten zu müssen erklärte, fiel Heine mir plötzlich wie wahnsinnig um den Hals, weinte und jubelte durcheinander, und es wiederholte sich jene Szene Anch’ io son pittore.
[Unter dem Pseudonym „Sy. Freudhold Riesenharf“ hatte Heine 1817 seine ersten Gedichte in „Hamburgs Wächter“ veröffentlicht. Auch Rousseau wurde Schriftsteller.]
25. Johann Baptist Rousseau174
Winter 1819/20
Kleine, ziemlich muskulöse Gestalt; blonde Haare mit weißen durchmischt; hohe und bedeutsame Stirne; um den Mund immerwährend ein ironisches, gutmütiges Lächeln; die Hände hält er [Heine] meist auf dem Rücken und schlottert so einen Entengang dahin. Hält sich für schön und kokettiert im Spiegel heimlich mit sich. Er spricht gut und hört sich gern sprechen; so oft er einen Witz reißt, lacht er laut auf, dann wird seine Physiognomie, die sonst nichts auffallend Orientalisches hat, ganz jüdisch, und die ohnedies kleinen Augen verschwinden beinah.
26. Friedrich Steinmann173
1819/20
Da er [Heine] mit A. W. v. Schlegel in nähere Bekanntschaft ... getreten war, so übergab er diesem das Manuskript [seiner Gedichte] zur Durchsicht; willig übernahm dieser dieselbe und erklärte ihm offen, was er dawider auszusetzen habe; er deutete seine Erinnerungen durch Bleistiftstriche in der Handschrift an, und als Heine also dieselben wiedererhielt, hatte er keine andere Beschäftigung, als alle die kleinen Mängel... auszumerzen und zu bessern ... Stundenlang brütete er über die Änderung eines Verses, und fühlte sich belohnt genug, wenn ihm die Korrektur gelungen, und Freunde ihm ihren Beifall zollten.
27. Max Heine70
1820
Als Heine in Bonn studierte, trug er gewöhnlich einen Studentenrock von schwarzem Samt. Da der Rock ziemlich abgetragen war, so bestellte er bei seinem Schneider einen neuen Rock vom schönsten blauen Samt, und versprach seinem täglich kommenden Barbier seinen alten, welcher beständig im Vorzimmer an einem Nagel hing. Der Schneider brachte zur bestimmten Zeit den neuen schönen Rock und hing denselben an dem Nagel im Vorzimmer auf, von dem zufällig der alte Rock weggenommen war. Als Heine bald darauf rasiert wurde, sagte er dem weggehenden Barbier: „Heute können Sie den Rock draußen mitnehmen.“ Der Barbier dankte aufs verbindlichste, empfahl sich und nahm aus dem Vorzimmer den schönen neuen Rock mit.
Heine kleidete sich nun an, um in seinem schönen neuen Samtrocke spazierenzugehen, wozu ihn ein eintretender Freund einlud. Wie erschrak er, als sein neuer Rock weg war; er sagte aber nichts weiter als: „Hat der Barbier Glück!“ und zog den alten an.
Späterhin in seinem Leben, so oft von einem Menschen die Rede war, der sehr viel Glück hatte, sagte er nichts weiter als: „Hat das Barbierchen Glück!“ und erzählte dann ganz gemütlich, wie er seinen alten Samtrock und sein Barbier den neuen behalten hat.
[Strodtmann (I, 681) zweifelt diese Anekdote an, da Heine, nach dem Zeugnis von Neunzig, Steinmann und andern, nie einen altdeutschen Studentenrock getragen habe. Aber auch Maria Embden-Heine berichtet den Vorfall und fügt noch hinzu, daß seitdem die Redensart: „Hat das Barbierchen Glück gehabt!“ in der Familie sprichwörtlich geworden sei. Von Neunzig erfuhr Strodtmann einen andern, alltäglicheren Vorfall, der wohl jener Anekdote zugrunde liegt: „Eines Morgens ward Neunzig von einem Landsmanne aufgesucht, der um eine kleine Wegzehrung bat und dann auch nach Heines Wohnung frug. Neunzig zeigte ihm das Haus. Nachmittags kam Heine in sehr aufgeregter Stimmung hinüber und erzählte, sein Hauswirt habe einen fremden Menschen, den er für einen Studenten angesehn, in sein Zimmer gelassen, und dieser habe ihm seinen neuen Rock gestohlen. Der satirische Zug verschwand dabei nicht, er verzog sich vielmehr zu einem höhnischen Grinsen.“ Wenn der Pseudostudent seines Handwerks Barbier war, bestände wenigstens der traditionelle Familienscherz zu Recht.]
28. Max Heine70
1820
Als Heine in Bonn Jura studierte, kam er in der Ferienzeit nach Düsseldorf herüber. Er war sehr milde, sanft und weichherzig, aber in Zorn gebracht äußerst heftig, selbst gegen seine Gewohnheit manchmal etwas gewalttätig. Ich erinnere mich noch, daß er über die Unverschämtheit und grobe Prellerei eines Karrenschiebers, der seinen Koffer von der Post ins elterliche Haus bringen sollte, außer sich geriet; ein anderer hätte dem groben Lümmel eine Ohrfeige gegeben. Heinrich, bleich vor Zorn, faßte sich, zahlte ruhig das ausgepreßte Geld, zupfte aber mit aller Vehemenz des Kerls großen schwarzen Backenbart, indem er freundlich zu ihm sagte: „Ich glaubte, mein Bester, Sie trügen einen falschen Bart.“
So habe ich, erzählte er später, meinem schrecklichen Ärger Luft gemacht, ohne daß der Kerl mich verklage konnte.
29. Max Heine70
1820
In den sonnigen Mittagsstunden liebte Heinrich in unserm Hausgarten zu promenieren. Auf diesen Spaziergangen war ich oft im Gespräche an seiner Seite, und hier flößte er dem dreizehnjährigen Knaben die Liebe zur Poesie, zum Wissen ein; hier schöpfte ich zuerst aus dem reichen Borne seiner poetischen Seele. Der vortreffliche Bruder, frei von jedem Egoismus, bedauerte nicht die durch mich verlorenen Stunden, wenn ich auch oft wenig von seinen Mitteilungen verstand.
Heinrich liebte sehr das Arbeiten und Treiben der Spinnen zu beobachten. Einstmals standen wir vor einem großen wunderbar gearbeiteten Netze einer in der Mitte desselben lauernden mächtigen Kreuzspinne. „Sieh, Max,“ sagte er und zeigte auf die gefangenen und ausgesogenen Fliegen in dem Netze, „sieh, so geht es auch dem Dummen in der Welt. Die Spinne ist unser Lebensfeind, das Netz seine falschen und verlockenden Worte – aber der Kluge, der Entschlossene macht es so“, und damit schlug er mit einem Stocke das ganze schöne Netz rasch herunter. Auf der Erde kroch die große Kreuzspinne, er zeigte auf sie hin und sagte zu mir: „Töte sie ja nicht! Wenn man des Feindes Werk gründlich vernichtet, verstehst du, wenn man seine Pläne gänzlich vereitelt hat, braucht man ihn nicht mehr zu töten, man läßt ihn laufen.“
30. Max Heine70
1820
Von meiner frühesten Jugend an liebte ich die deutschen Dramatiker; viel mag zu dieser Neigung beigetragen haben, daß ich, fast Kind noch, sehr oft in das Theater mitgenommen wurde. Es war dies die Zeit, wo die Ritterspiele auf der Bühne in vollem Flor standen. „Johanna von Montfaucon“, „Die Kreuzfahrer“, „Die Sonnenjungfrau“ usw. waren meine Lieblingslektüre. Ich war damals dreizehn Jahre alt. Mein Bruder Heinrich bemerkte ungern diese meine Lektüre.
„Max,“ sagte er eines Tages zu mir, „solche Bücher verderben den Geschmack, ich werde dir ein anderes Buch schenken, damit magst du dich in deinen Freistunden beschäftigen. Es ist auch ein Theaterstück.“ Bei diesen Worten nahm er von seinem Tisch ein kleines, in schwarze Pappe eingebundenes Büchlein und sagte: „Dies schenke ich dir.“ Ich schlug des Büchleins Decke auf und las zum erstenmal den Titel: „Faust, von Goethe. Der Tragödie erster Teil.“
Ich blickte in die ersten Blätter hinein, die den wunderschönen Prolog enthalten, dann, nach echter Knabenart, schlug ich die letzte Seite auf, wo die Worte: „Heinrich, her zu mir,“ – „Sie ist gerettet“, mir so rätselhaft klangen. Ich sah meinen Bruder ganz erstarrt an, als wie einer, der da sagen wollte: „Die Komödie begreife ich nicht.“ Er nahm darauf das Buch zur Hand, griff rasch zur Feder und schrieb folgendes auf die innere Seite des Deckels:
„Dieses Buch sei dir empfohlen,
Lese nur, wenn du auch irrst:
Doch wenn du’s verstehen wirst,
Wird dich auch der Teufel holen.“
[Die Schlußworte des „Faust“ sind falsch zitiert; Max Heine tut’s nun mal nie anders.]
31. Johann Baptist Rousseau174
1820
Mit besonderer Liebe studierte er Byrons Schriften, und nicht zu leugnen ist es, daß sich zwischen beiden eine geistige Wahlverwandtschaft findet. Das fühlte er damals auch selbst, und erkannte es, sich zu Freunden äußernd, oftmals an.
[Heine übersetzte damals Stücke aus Byrons „Manfred“ und „Childe Harold“; sie erschienen in seinen „Gedichten“ 1822.]
32. Johann Baptist Rousseau174
Herbst 1820
Den Herbst 1820 brachte Heine in Beuel zu, dem freundlichen, Bonn gegenüber liegenden Dörflein, und begann dort in tiefster Zurückgezogenheit seine Tragödie „Almansor“... Er las es mir Szene vor Szene, wie es ihm eben aus der Feder geflossen war, vor, und gab mir zugleich manche gute, ihm durch die Praxis klar gewordene Lehre über die mögliche Formausbildung des fünffüßigen Jambus.
[Ende Oktober 1820 ging Heine nach Göttingen.]
33. von Schreeb140
Januar 1821
[Mündliche Mitteilung an Heinrich Bender:] Heine wurde aus der Göttinger Burschenschaft wegen Vergehens gegen die Keuschheit, begangen in der „Knallhütte“ zu Bowenden, ausgestoßen, und, da er trotzdem, als ob nichts vorgefallen wäre, am folgenden Tage auf dem Burschenhause erschien, aus diesem mit Gewalt hinausgeworfen.
[Am 21. Februar 1821 wurde Heine wegen Übertretung der Duellgesetze auf ein halbes Jahr relegiert. Er kehrte zunächst nach Hamburg zurück und blieb den Sommer über bei seinen Eltern, die damals in Oldesloe im südlichen Holstein lebten.]
34. O. L. B. Wolff29
März 1821
Vor vierzehn Jahren hatte ich Heine in Hamburg kennenlernen. Beide kaum von der Universität kommend, waren wir eben in das Leben getreten, mit gigantischen Hoffnungen und Plänen und einem gemeinschaftlichen großartigen Schmerz über Freunde wie Feinde, den jeder Eingeweihte leicht erraten wird; die übrigen geht er nichts an. Heines Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo waren soeben erschienen; die Leute starrten im allgemeinen das Buch an, nur wenige ahnten die Tiefe, die in demselben lag, den gepreßten Stolz, der sich großartig Luft machte, das beseligende Gefühl geistiger Herrschaft. Man wußte nur von dem Dichter, daß er sehr witzig und malitiös sei; was sollte man auch in dem guten Hamburg und vorzüglich in dem Kreise, in welchem Heine sich, durch Verhältnisse gebunden, bewegen mußte, und in dem ich mich, durch ähnliche Verhältnisse gefesselt, gleichfalls* befand, mehr von ihm wissen? In seinem Wesen lag etwas Zugvogelartiges, das die guten Hamburger, obwohl eine Nation, welche Welthandel treibt, nicht eben sehr lieben; sie können nicht begreifen, daß man in Hamburg ißt, trinkt und schläft und eigentlich am Ganges zu Hause ist, und die Sehnsucht nach der wirklichen Heimat nie zu beschwichtigen vermag...
Aber ich wollte von Heine reden. Ich kann nicht sagen, daß er damals noch im Werden gewesen sei, im Gegenteil, er war zu jener Zeit ebenso abgeschlossen wie jetzt [1835]: seine vorzüglichste Eigentümlichkeit besteht darin, von Anfang an genau gewußt zu haben, was er will, und dies mit eiserner Konsequenz zu verfolgen; denn, und das ist wahrlich viel gesagt, keiner seiner Freunde und Bekannten ist imstande, ihn auch nur der mindesten Inkonsequenz zu zeihen.
[Hierhin Nr. 817, s. Nachträge.]
35. F. W. Gubitz11
April/Mai 1821
An einem Tage des zweiten Vierteljahrs 1821 stand ein junger Mann vor mir, fragend: ob ich Gedichte von ihm aufnehmen wolle, und ich empfing schön geschriebene „Poetische Ausstellungen“.
Da ich ehemals die mir oft und wahrscheinlich gebührend als Vernachlässigung angerechnete Gewohnheit hatte, Fremde, die ihren Namen im Gespräch nicht voranschickten, danach ungefragt zu lassen, sah ich nach der Unterschrift und las: „H. Heine“.
Auf meinen Wink hatte er sich gesetzt, und da er das Wenden seiner Handschrift bemerkte, sagte er: „Ich bin Ihnen völlig unbekannt, will aber durch Sie bekannt werden.“ Ich lachte, erwiderte: „Wenn’s geht, recht gern!“ und las dann lautlos etliche Verse. Heine selbst brachte mir mehrmals diese erste wortkarge Zusammenkunft in Erinnerung, und wie ich endlich nur noch geäußert hätte: „Kommen Sie gefälligst nächsten Sonntag wieder!“ – Begreiflich konnte ich nur wenige Verse gelesen haben, es waren folgende, das Gedicht: „Der Kirchhof“ beginnend:
„Ich kam von meiner Herrin Haus
Und wandelt’ in Wahnsinn und Mitternachtsgraus.
Und wie ich am Kirchhof vorübergehn will,
Da winken die Gräber ernst und still.
Da winkt’s von des Spielmanns Leichenstein;
Das war der flimmernde Mondenschein.
Da lispelt’s: Lieb’ Bruder, ich komme gleich!
Da steigt’s aus dem Grabe nebelbleich.“
In dem Dichter denke man sich eine von schlottriger Kleidung umhüllte, krankhaft schlanke Gestalt mit blassem, abgemagertem Antlitz, dem Spuren zu frühzeitiger Genüsse nicht mangelten, und man wird es natürlich finden, daß jene Verse und der Eindruck des Persönlichen dem mir Fremden etwas Unheimliches anwehten. Unverkennbar ward mir aber, nachdem ich weiterlas, sein Dichtervermögen, und als Heine wiederkam, erklärte ich mich bedingungsweise zur Aufnahme des Beitrags bereit. In seinen ersten handschriftlichen Gedichten hatte er eine solche Menge von Häkchen an den selbst- und mitlautenden Buchstaben der Worte, und gebrauchte falsche Reime so allbequem, daß ich meinte: er könne die mir gegebenen fünf Gedichte in dieser Beziehung wohl nochmals prüfen. Er entgegnete: das sei alles dem Volkston gemäß, was ich nicht bestritt, aber noch bemerkte: daß ich nur hinweise auf übertriebene Anwendung solcher Herkömmlichkeiten, wenn sie dem Geläufigen eher hinderlich statt fördernd wären. Außerdem verhehlte ich ihm nicht: er sei in dem Gedicht: „Die Brautnacht“ so zügellos mit der Sitte umgegangen, daß manche Zensurlücke unvermeidlich, ich aber den Abdruck verweigern würde, wenn er nicht ein paar Stellen reinigen wolle. Zu nochmaligem Prüfen war er bereit, ich bin überzeugt, nicht mit dem freiesten Entschluß, doch änderte er sehr gewandt. Die ersten fünf [sic!] Gedichte (I. Der Kirchhof. II. Die Minnesänger. III. Gespräche auf der Paderborner Heide. IV. Zwei Sonette an einen Freund) erschienen im Mai 1821. „Die Brautnacht“ folgte erst einen Monat später, weil ich das Veröffentlichen wiederholt verweigern mußte, ehe Heine meine Ansicht befriedigte. Dergleichen hat sich später nur noch ein paarmal zwischen uns ereignet, und ich erzählte dies voraus, weil es den, von Heine erfundenen... Ausdruck „Gubitzen“ erklärt. Mir blieb indes die Genugtuung, daß er auch in seinen Schriften die Gedichte, bei denen er dem „Gubitzen“ nachgab, völlig so abdrucken ließ, wie der „Gesellschafter“ sie in die Lesewelt eingeführt hatte...
Das zweite, was Heine mir brachte, war der „Sonettenkranz an A. W. v. Schlegel“.
36. F. W. Gubitz11
Herbst 1821