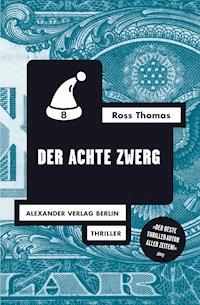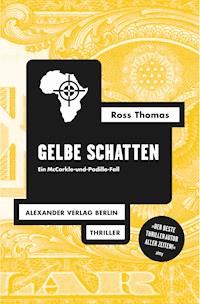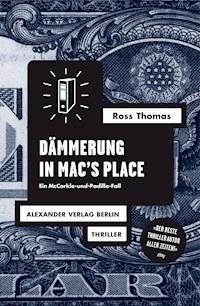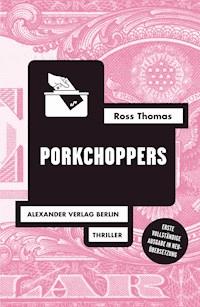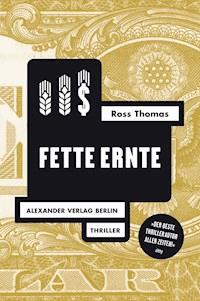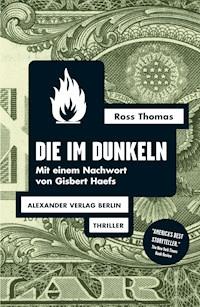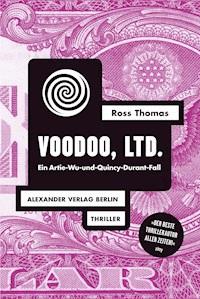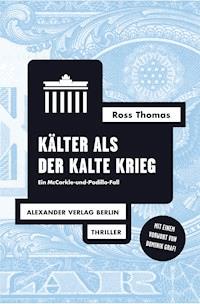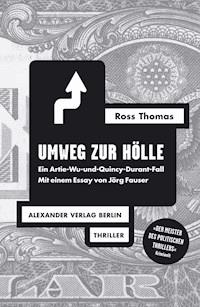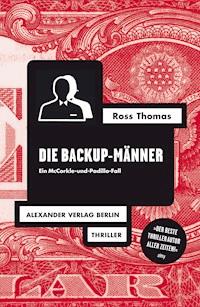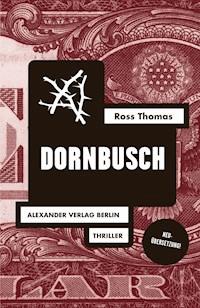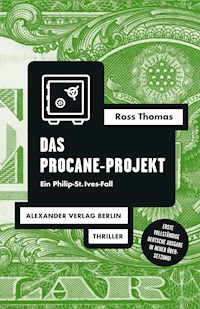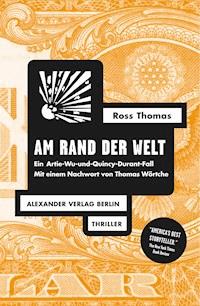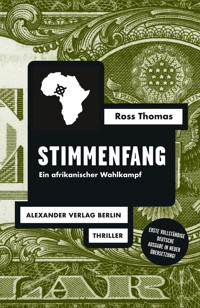6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Konstanz wird Carolina Ultor, Tochter des Molekularbiologen Martin Ultor, ermordet. Der Vater misstraut dem Wertesystem, das der deutschen Rechtsprechung zugrunde liegt, er hält es für zu milde. Er beschließt, den Mörder zu entführen und qualvoll zu töten. Die Entführung gelingt mit Hilfe von Komplizen aus dem kriminellen Milieu. Ultor bringt seinen Gefangenen in sein Ferienhaus ins Tessin, wo er einen Schlitten installiert hat, der sich auf Schienen auf eine Nagelwand zubewegt. Doch der Gefangene verhält sich völlig anders als erwartet. Ein gebildeter Mensch, der Ultor in eine intellektuelle Auseinandersetzung über Recht und Gerechtigkeit verwickelt, aus der dieser nicht herauskommt, ohne sein Selbstverständnis als gerechter Vollstrecker aufzugeben. Unterdessen ist Ultor ins Visier der Polizei geraten, die fieberhaft nach dem Entführten und dem Entführer sucht. Es entwickelt sich ein Katz-und Mausspiel zwischen Ultor und dem Konstanzer Kommissar, der Ultor im Verdacht hat, aber nichts beweisen kann. Zugleich rückt der Schlitten zur Nagelwand vor: langsam, unaufhaltsam, unerbittlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Weil schließlich Hass und Liebe die Affekte der Unlust und Lust selbst sind, so folgt auf gleiche Weise, dass das Streben, der Trieb oder das Begehren, das aus Hass oder Liebe entspringt, in seiner Stärke dem Maß des Hasses und der Liebe entsprechen wird.
Baruch de Spinoza, Ethik, Buch III, Beweis zum Lehrsatz 37, Reclam-Verlag 2007
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
KAPITEL 59
KAPITEL 60
KAPITEL 61
KAPITEL 62
KAPITEL 63
KAPITEL 64
KAPITEL 65
KAPITEL 66
KAPITEL 67
KAPITEL 68
KAPITEL 69
KAPITEL 70
KAPITEL 71
KAPITEL 72
KAPITEL 73
KAPITEL 74
KAPITEL 75
KAPITEL 76
KAPITEL 77
KAPITEL 78
KAPITEL 79
KAPITEL 80
KAPITEL 1
Vor Jahren führte ich ein seltsames Gespräch. Ein Mann fragte mich, wie es sei, bei vollem Bewusstsein an seiner eigenen Beerdigung teilzunehmen. Ich lachte verlegen und meinte, dass sich wohl schon viele Menschen mit diesem Gedanken beschäftigt hätten. Wir wüssten es nicht und würden es auch nie wissen. Der Mann lächelte, und ich weiß noch, wie ich mit einem Caipirinha in der Hand auf einem großen, braunen, schon etwas abgenutzten Ledersofa saß und mich ärgerte, weil sein Lächeln etwas Mitleidiges und etwas Trauriges hatte. Erst jetzt verstehe ich, was dieses Lächeln bedeutete. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn die Seele begraben wird, wenn Asche zu Asche und Staub zu Staub kommt. Das Leben geht weiter, aber es ist das Leben einer Hülle, einer bloßen Existenz, deren Atem längst er loschen war.
Dies ist die Geschichte meiner Katastrophe. Man kann mich der Eitelkeit bezichtigen, man kann mich des Hochmuts beschuldigen, es kümmert mich nicht. Ich habe den Sinn für Nebensächlichkeiten verloren. Aber glauben Sie nicht, ich hätte mich dieser Erzählung bedient, um vor Gericht gut dazustehen, in dem feigen Bestreben, meiner gerechten Strafe zu entgehen. Nein, so ist es nicht. Was ich will, ist Mitgefühl, nicht Verständnis. Urteilen Sie, aber verurteilen Sie mich nicht.
Gleich wird man mich beim Namen nennen, die gesichtslosen Männer an meiner Seite haben sich schon erhoben, bereit, mich in den großen Saal zu führen, wo Recht von Unrecht geschieden wird. Die Geschichte eines schrecklichen Verbrechens erhält ein würdiges Forum; es ist ein Verbrechen, das ein anderes nach sich zog. Meines.
KAPITEL 2
Mein Kopf ist schwer und müde. Was wirklich geschehen ist, ist so ungeheuerlich, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich will mich sammeln, mich erinnern. Die Ärzte haben mir geraten, ganz von vorne zu beginnen. Ich weiß nicht. Im Licht der jüngsten Ereignisse erscheint mir vieles unbedeutend. Aber sehen Sie selbst. Hier ist der Bericht.
Meine Kindheit verbrachte ich mit meinen Eltern in einem alten Patrizierhaus am Stadtrand von Konstanz, wo ich auch zur Schule ging. Keine Geschwister, kaum Freunde, eine ereignislose Zeit. Erwähnenswert ist allenfalls, dass ich zu Beginn meiner Gymnasialzeit deutlich mehr Aufmerksamkeit erhielt als manch anderer, ebenso begabter Schüler. Diese Ehre hatte ich meinem Vater zu verdanken, der es sich im Rahmen eines Elternabends offenbar nicht verkneifen konnte, die Anwesenden über meine eigenhändig konstruierte Bewässerungsanlage zu informieren. Er muss es mit Stolz und viel Pathos getan haben, denn wenig später wusste die ganze Schule davon, was mir die Anerkennung des Lehrerkollegiums, aber nur schiefe Blicke der Mitschüler einbrachte.
Als ich mich wenig später mit dem Nachbau physikalischer Experimente beschäftigte und im Zuge dessen erst ein Alkoholthermometer und dann einen Heronsbrunnen konstruierte, schienen meine Eltern gleichsam von den Kräften der Schwerkraft befreit durch Haus und Hof zu schweben. Es dauerte nicht lange, bis mein Vater mit dem Vorschlag an mich herantrat, wenn ich mich schon nicht auf der Stelle bei den umliegenden Universitäten vorstellen wolle, so müsse ich doch angesichts des bei mir zu Tage getretenen Talents wenigstens bei „Jugend forscht“ mitmachen. Ich zweifle nicht daran, dass mein Vater, als er mir diesen Plan würdevoll eröffnete, ohne freilich ein Ausscheiden auch nur in Erwägung zu ziehen, mich von Anfang an bis ins Finale phantasiert hatte. Umso tiefer war die Enttäuschung, als ich seinen blumigen Erwartungen trotzte, noch ehe sie in voller Blüte standen. Auch den Lehrern tat ich den Gefallen einer Selbstverwirklichung im Lichtkreis meiner (und damit auch ihrer) Erfolge nicht, ich war mir selbst genug. Ruhm und Anerkennung waren mir gleichgültig. Bei der Lektüre von Newtons Naturlehre ging es mir weniger um den Meister als um die mathematischen Prinzipien, und die jeweiligen Inhalte, mit denen ich mich in diesen prägenden Jahren beschäftigte, befriedigten meine Bedürfnisse voll und ganz.
In der Schule kam man zu dem Schluss, dass ich ein begabter, aber schrecklich störrischer Einzelgänger sei, der mangels sinnvoller Zukunftsperspektiven keiner weiteren Förderung bedürfe. Der Sinneswandel der Lehrerschaft war spürbar, ich nahm ihn mit Erleichterung auf und konnte mich endlich meinem schon früh formulierten Ziel widmen, Naturwissenschaftler zu werden. In Rebellion gegen meinen Vater, der Physiker war, entschied ich mich für Biologie und folgte damit dem Beispiel meiner Mutter. Innerlich blieb ich aber der Mathematik verbunden, wegen ihrer kompromisslosen Strukturiertheit und argumentativen Klarheit und weil Probleme immer eindeutig lösbar sind. Wie wunderbar erschien es mir bald, den Schwätzern, die von der Unzulänglichkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnis besessen waren, durch eine knackige, logisch zwingende Deduktion ein für alle Mal das Maul zu stopfen und ihnen zu beweisen, dass sie mit ihrer fragwürdigen Lust an der Alternative einem naiven Aberglauben aufsaßen, der auf nichts anderem beruhte als auf der Unkenntnis der mathematisch beschreibbaren Struktur der Natur.
Dass die Grundstruktur der Welt durch die Gesetze der Logik erklärbar ist, habe ich nie ernsthaft in Frage gestellt. Warum auch? Die Theorie gibt noch einige Rätsel auf, aber die werden sich mit der Zeit lösen, davon war ich überzeugt. Die Alternativen, die mir philosophische Relativisten während des Studiums aufzutischen versuchten, erinnerten mich immer wieder an meine Erlebnisse in den Sümpfen der norwegischen Tundra, die ich während des Studiums zweimal, im Winter und im Sommer, erfolglos zu durchqueren versucht hatte. In der kalten Jahreszeit unter meterhohem Schnee begraben, in der warmen weich wie ein Küchenschwamm, gab es kein Durchkommen; wo man hintrat, blieb man stecken, so wie die Relativisten immer wieder im Morast ihrer fragwürdigen Argumentationsfiguren stecken blieben. Es dauerte nicht lange, bis ich mich von diesem Geschwätz ab- und mich erfreulicheren Dingen zuwandte.
Genauso klar, zuverlässig und auf wunderbare Weise vorherbestimmt wie das Bild, das ich mir vom Aufbau der physikalischen Wirklichkeit gemacht hatte, war das Lebenspanorama, das sich nun vor mir entfaltete. Dem Studium würde eine Anstellung als Biologe in einem renommierten Forschungsinstitut folgen. Ich, Martin Ultor, würde mich der kybernetischen Modellierung zellbiologischer Prozesse widmen und dazu beitragen, die bis heute unübertroffenen Regel und Steuerkreisläufe der Natur in für den Menschen nutzbare Techniken zu übersetzen. Von meiner Mutter hatte ich die Gewandtheit im Umgang mit Menschen geerbt, und an meinen intellektuellen Fähigkeiten brauchte ich erfahrungsgemäß nicht zu zweifeln, so dass es keinen Grund zu der Annahme gab, dieses Ziel sei zu hoch gesteckt. Über die Möglichkeit des Scheiterns machte ich mir daher keine Gedanken, denn alles Weitere würde sich nun, da der richtige Weg eingeschlagen war, von selbst ergeben. Mit dieser Zuversicht war es nicht verwunderlich, dass ich gegen Ende meines Studiums die angestrebte Stelle in einem großen Biotechnologieunternehmen fand.
Vor allem aber lernte ich Natalie kennen. Sie hatte Veterinärmedizin studiert, weil sie Tiere liebte und es unerträglich fand, dass ihrem Wohlergehen so wenig Bedeutung beigemessen wurde, obwohl sie uns Menschen als Nutztiere und beste Freunde seit Jahrtausenden unschätzbare Dienste leisten.
Das alles interessierte mich herzlich wenig, aber ich ließ mir nicht gleich in die Karten schauen, denn ich fand sie ganz reizend, im klassischen Sinne schön und begehrenswert. Ihre dunklen Mandelaugen bezauberten mich über alle Maßen, der süße Duft ihres kastanienbraunen Haares ließ mich vor Liebe erzittern, und schon bald konnte ich nicht genug bekommen von diesem Duft und dem Zauber, diesem unendlichen Glück in ihrer Nähe.
Nach zwei Jahren des gegenseitigen Kennenlernens traten wir vor den Traualtar. Ein Jahr später wurde unsere Tochter Carolina geboren.
KAPITEL 3
Mit der Geburt unserer Tochter brach eine neue Zeit an. Es gibt so etwas wie eine Neigung, den Nachwuchs zu verherrlichen, und nicht selten kann man beobachten, wie eine verklärte Glückseligkeit von jungen Eltern Besitz ergreift, kaum dass von ihren Kindern die Rede ist. Solche Gefühlsduseleien hatten in meinem Verhalten freilich keinen Platz. Ich fand sie schlicht albern und sagte das auch immer laut, was mir einen schlechten Ruf und schließlich, als ich selbst an der Reihe war, das Gespött meiner Mitmenschen einbrachte. Denn mit dem Erwachen der ersten Charakterzüge meines Kindes war es um mein objektives Urteil geschehen. Von nun an leuchteten die Sterne, Verzückung machte sich breit, und die objektive Realität verschwamm in einer fast biblischen Verklärung. Ich philosophierte über das Wesen meines Kindes, gab bei jeder sich bietenden Gelegenheit Allgemeinplätze von mir, getragen vom Pathos der Liebe, einer Projektion alles nur denkbaren Guten. Ein Arsenal positiv besetzter Adjektive assoziierte ich mit ihr: süß, lieb, lustig, warmherzig und von reiner Unschuld sei sie, frei von Hinterlist, Falschheit und Tücke. Weniger erbauliche Wahrheiten, die nicht selten zum Vorschein kamen, wenn sie, müde und hungrig, sich manchmal wie eine Furie aufführte und mich mit unbändigem Zorn an den Rand der Verzweiflung trieb, hielt ich, wie die meisten Eltern, in den hintersten Winkeln meiner Seele unter Verschluss. Im Interesse des Fortbestands der eigenen Gene sieht man dem Nachwuchs so manche Unannehmlichkeit, so manche Zeit der Entbehrung und des Verzichts gnädig nach. Und das ist auch gut so.
Aber hätte ich das alles noch vor wenigen Wochen offen, frei und ohne Scham aussprechen können? Dass die objektive Wahrheit manchmal hinter der subjektiven zurückstehen muss, weil das Leben es so will? Hatte ich nicht eben noch, meine wahren Gefühle ignorierend, eitel und selbstgefällig in die Welt posaunt, dass das alles Unsinn sei?
Nun, ich habe es getan, in unentschuldbarer Verkennung des wahren Wesens der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern, ich habe es getan. Den schrecklichen Irrtum erkannte ich erst, als etwas schief gegangen war, als das Schicksal den Grundplan der Natur durchkreuzt hatte. Nie habe ich besser, tiefer und schmerzlicher begriffen, welch unermesslicher Raum sich im gemeinsamen Erleben der Beziehung zu meiner Tochter auftat, als an jenem Tag, als alles zu Ende war. Ich begriff erst, als es zu spät war.
KAPITEL 4
Am 31. März war Carolina nicht von der Schule nach Hause gekommen. Natalie hatte sie wie immer um halb zwei zum Mittagessen erwartet. Carolina war noch nie viel zu spät gekommen, das war nicht ihre Art. Schon im Kindergarten war ihre Vorliebe für Uhren aufgefallen, besonders das Ticken unserer Wanduhr hatte es ihr angetan. Wenn sie sich nach dem Unterricht verplappert hatte, kam sie eben schneller nach Hause, manchmal rannte sie sogar in vollem Lauf. Und wenn das Laufen nicht mehr half, ließ sie sich von den Eltern einer Freundin mit dem Auto abholen. Kurzum, man konnte sich darauf verlassen, dass sie auch in widrigen Situationen einen Weg fand, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Umso beunruhigender war es, als sie an diesem Tag nicht zur gewohnten Zeit am Mittagstisch erschien. Natalie rief mich gegen zwei Uhr im Büro an. Sofort spürte ich ein heftiges Ziehen in der Brust. Ich suchte nach Erklärungen für das Ausbleiben des Kindes und klang dabei so mitleiderregend, dass Natalie sofort in Tränen ausbrach. War es meine Atemnot oder ihr Schluchzen, das mich zum Handeln veranlasste? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann rief ich bei der Polizei an und bat um eine Vermisstenanzeige.
Ein ungerührter Beamter wies mich mit gespielter Freundlichkeit darauf hin, dass eine Stunde Verspätung kein ausreichender Grund für eine so weitreichende polizeiliche Maßnahme sei. Es fiel mir schwer, dem Mann nicht lauthals die Pest an den Hals zu wünschen, aber Respektlosigkeit wäre in dieser Situation nicht hilfreich gewesen. Also riss ich mich zusammen und erklärte dem Beamten, dass Carolinas Stunde nicht gleichzusetzen sei mit einer Stunde, die irgendein Mensch zu spät kommen könne. Ob ich den Mann überzeugen konnte, ist fraglich, denn das Argument, dass eine Stunde für Carolina einem Tag für den Rest der Welt entspricht, erschien mir selbst übertrieben. Nach einigem Zureden lenkte der Beamte jedoch ein und beendete das Gespräch mit dem Versprechen, sich der Sache anzunehmen. Er werde sehen, was er tun könne.
KAPITEL 5
Was mit Worten nicht gesagt werden kann, wird gewöhnlich in Bildern ausgedrückt. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, diese Bilder zu entschlüsseln. Werden sie dem Vergleich mit der Wirklichkeit standhalten? Werden sie verschwinden, wenn ich sie berühre, werden sie sich im Nichts auflösen wie die flüchtigen Schatten unserer Träume? Ich weiß es nicht, denn ich weiß gar nichts mehr. In meinem Inneren sehe ich das Bild und nichts anderes, das schreckliche Bild eines Albtraums, dessen ich nicht habhaft werden kann; ich blicke in die Tiefe und finde die existenzielle Verlorenheit in einem grenzenlosen Grauen.
Die Tage nach Carolinas Verschwinden waren ein Albtraum in diesem Sinne, ein Zerrbild, von dem wir uns durch rationales Denken, durch konsequente Analyse des Möglichen und Ausschluss des Unmöglichen nicht zu befreien vermochten. Es war ein Albtraum ohne das Bewusstsein des Morgens danach, ohne den süßen Nachgeschmack einer überwundenen Erinnerung, es war der erlebte Horror einer unbarmherzigen Realität, die grausam und unerbittlich jede Hoffnung im Keim erstickte. Angst und Beklemmung wuchsen zu einer ungeheuren Bedrohung, die selbst mein jahrzehntelang geschultes Urteilsvermögen kapitulieren ließ.
Selig sind die, dachte ich damals, die im Spiegel des Schreckens den Verstand verlieren, die dem Wahnsinn verfallen, wenn der Schrecken die Schutzwälle der Seele überwunden und die heilenden Kräfte des Ausgleichs, der Ruhe und der Versöhnung zerstört hat!
Aber weder Natalie noch ich haben diesen Ausweg gewählt. Stattdessen nahmen wir den ungleichen Kampf auf wie David gegen Goliath, nur dass uns der rettende Steinwurf versagt blieb. Wir kämpften in der schrecklichen Gewissheit, dass die Hoffnung nur ein Trugbild war, eine Fata Morgana, eine Gaukelei des Geistes, inszeniert von einem sterbenden Ich. Das Leben an der Grenze des Erträglichen ist nicht lang, und ich verlor es, als unsere Tochter auf einem Waldparkplatz bei Konstanz tot aufgefunden wurde.
KAPITEL 6
Carolina wurde neun Tage nach ihrem Verschwinden gefunden. Sie trug ein gelb gestreiftes Kleid, das über und über mit Frühlingsblumen bestickt war: Tulpen, Narzissen und Vergissmeinnicht. Die Blumen waren frisch und mit großer Sorgfalt auf den Stoff genäht. Benachbarte Blumen waren nie von der gleichen Art, so dass ein Muster aus Farben und Formen entstand, das dem Spiel der Sonnenstrahlen auf dem Waldboden glich. Auf dem Kopf trug sie einen Kranz aus Tannenzweigen, an dem elf Rosen, zehn weiße und eine rote, befestigt waren. Die Stichwunde in der Brust war medizinisch versorgt worden. Wie sich später herausstellte, hatte der Mörder Carolina das Kleid post mortem angezogen und ihr die Wunde, die von sechs Schwertlilienblättern kreisförmig umrandet war, nachträglich zugefügt. Das Kleid verströmte einen Hauch von Lavendel mit anderen natürlichen Düften, als wäre es in ein Bad aus natürlichen Blütenessenzen getaucht worden. Die Schuhe waren auffallend sauber, sogar die Sohlen glänzten, was darauf hindeutete, dass Carolina nicht mehr am Leben gewesen sein konnte, als sie in den Wald gebracht wurde. Spuren sexueller Gewaltanwendung wurden nicht gefunden, dennoch wurde von einem sexuellen Tatmotiv ausgegangen. Carolina lag in einer Mulde, die mit gelben, grünen und roten Eichenblättern ausgelegt war, die der Täter im Herbst zuvor gesammelt und chemisch konserviert haben musste.
Als ich zum Tatort gerufen wurde, um die Leiche zu identifizieren, spielten diese Details keine Rolle mehr. Zitternd bestätigte ich, dass es meine Tochter war, die wie eine Prinzessin aufgebahrt auf ihrem Teppich aus Eichenblättern lag. In ihrem Gesicht spiegelte sich eine erschöpfte Seligkeit, wie die eines Wanderers, der nach langer Reise müde, aber glücklich in der Herberge angekommen ist, und ein tiefer Friede, der mit der Erlösung von großem Leid in ihre kleine Seele gekommen sein muss, und dieser Friede stand in einem ungeheuerlichen Gegensatz zu der bestialischen Abscheulichkeit des Urhebers dieser Szene.
Der Anblick war unerträglich. Ich verlor das Bewusstsein. Im Krankenhaus teilte man mir mit, dass ich plötzlich unter lautem Wutgeschrei um mich geschlagen hätte, so dass man sich gezwungen sah, zur Sicherheit der ermittelnden Beamten und zu meiner eigenen Sicherheit medizinische Maßnahmen zu ergreifen.
KAPITEL 7
Der Fundort befand sich unweit einer Ecke, die mir besonders gefiel. Am Rande einer kleinen Lichtung führte ein Wanderweg vorbei, und etwas dahinter lag im Wald ein mannshoher Felsbrocken, den Wind und Wetter zu einem natürlichen Sessel ausgehöhlt hatten. Man konnte die Füße auf eine Abbruchkante stellen, die durch das Auseinanderbrechen eines Felsstückes infolge der winterlichen Eisbildung in den Spalten entstanden war. So hatte die Natur eine Sitzgelegenheit mit einer etwa sechzig Zentimeter hohen Lehne geschaffen, die angenehmer nicht sein konnte, besonders wenn man sie mit einer Decke auslegte. In der warmen Jahreszeit ging ich jede Woche dorthin, zuerst nur wegen der schönen Umgebung, dann um die Kräfte der Natur zu studieren, die sich beim Betrachten des Steins offenbarten. Bald kam ich auch an kühleren Tagen, aber nur der Himmel weiß, mit welchen Erwartungen ich dies wenige Tage nach Carolinas Verschwinden tat. Vielleicht war es die Hoffnung, an diesem Ort heiterer Gedanken und wunderbarer Empfindungen etwas von der verlorenen Lebensfreude wiederzufinden, jetzt, da nichts mehr davon übrig zu sein schien.
Sofort erinnerte ich mich an die Stunden, die ich mit Carolina hier verbracht hatte, wie wir Pilze gesucht hatten und sie mich auf dem steinernen Thron zum König des Waldes ausgerufen hatte. Sie hatte mir eine Krone aus Zweigen geflochten und mit Eichenblättern bestückt und ein ordentliches Zepter – es war ein schöner Weidenstock – aus einem Strauch gebrochen, damit ich regieren konnte. Dann hatte sie mich von Kopf bis Fuß mit Erde eingerieben, so dass ich vor Schmutz starrte, und wir lachten und tobten wie junge Füchse durch den Wald.
Wenn im Herbst die Berge im Feuer der untergehenden Sonne glühten, hatten wir da nicht Schönheit in Vollendung gesehen? Fühlten wir nicht ehrfürchtig und beglückt die Größe der Schöpfung, wenn sich die Mücken wie von Zauberhand zu Schwärmen zusammenschlossen, als würden lebendige Kohlen durch die Luft schießen, um sich Sekunden später im Nichts zu verlieren? Sobald der Tag sich dem Ende zuneigte, begann der große Zauber, die Zeit märchenhafter, schaurig-schöner Erlebnisse: Knorrige Buchen entließen Trolle in die nahende Nacht, Dryaden entstiegen den Stämmen windgebeugter Eichen, und der Ginsterbusch am Rande der Lichtung war in Wirklichkeit das Tageskleid einer schlafenden Elfe. Ach, wie hatten uns diese Stunden mit süßem Schauer erfüllt! Alles war so lebendig, so greifbar und konkret, kein Augenblick glich dem anderen. Mit kindlichem Entzücken hatten wir die Wunder der Natur geschaut und waren glücklich gewesen.
Aber jetzt tat alles nur noch weh. Die Erinnerungen an Liebe und Zugehörigkeit waren wie Messer, die mir ins Fleisch schnitten. Ich stand am Felsen und weinte, und in meinen Tränen ertranken die Wunder der Natur. Die sagenhaften Gewächse des Waldes, das sanfte Braun der weichen Erde, die Lichtung mit der Blumenwiese und die tausend Farben des Frühlingslichts – all das war nur noch ein Schatten, eine blasse Erinnerung an eine jäh vergangene Zeit.
Der Wald war fahl und grau, der stolze Hirsch in der Ferne todgeweiht, der Spatz auf dem Ast Katzenfutter von morgen. Modriges Fichtenholz wucherte am Boden, feuchter Morast und kalte Erde kündeten vom nahen Tod. Der halbverweste Kadaver eines Perlhuhns lag im halbhohen Gras und stank fürchterlich. Ich blickte hilfesuchend zum Himmel, der schwer und trüb war wie meine Seele. Eine Weile stand ich regungslos da. Da blähte und wölbte sich plötzlich die Erde unter mir, und unter dumpfem Grollen gebar sie eine Gestalt, so scheußlich und furchterregend, dass ich am ganzen Leibe erschauerte; ich fürchtete, es sei Grendel, der gekommen war, mich in sein dunkles Reich zu entführen. Und ich fühlte, wie all meine Liebe, meine Hoffnung und mein Glaube an das Gute in seinem schwarzen Schlund erstickten.
KAPITEL 8
Im Untersuchungsbericht der Gerichtsmedizin hieß es: „Die Tatmerkmale deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein sexuell motiviertes Tötungsdelikt hin“. Die Leichtfertigkeit, mit der dieses Dokument das Leiden meiner Tochter auf ein paar kalte Zeilen reduzierte, war entsetzlich, aber nicht weniger entsetzlich war die Leere, die sich hinter den Worten dieser seelenlosen Technokratensprache verbarg. Die Beamten haben die Sprache ihrer Seele beraubt, sie haben ihr die Kraft des gesunden, reinen Gefühls genommen, sie haben sie entkernt wie die Pflaumen fürs Kompott. In der Öffentlichkeit ist kein Platz für echte Freude, für geteiltes Leid, für ungeheucheltes Mitgefühl? Aus Gründen der Objektivität des Urteils oder der Vernunft, die das Gefühl für eine Art Gift hält? Das ist in höchstem Maße lächerlich. Denn liegt es nicht in der Natur des Menschen, das objektiv Erfahrbare stets im Lichte eines Gefühls wahrzunehmen, das jeden halbwegs komplexen Sinnesreiz so notwendig begleitet wie die Hitze das Feuer?
Es waren Gedanken wie diese, die mir in den Tagen, in denen die Angst zur Gewissheit wurde, durch den Kopf gingen, ich war empört, ungeduldig, überdreht. Die Polizei machte ihre Arbeit, wie man es von ihr erwarten durfte, aber mir ging alles viel zu zögerlich voran, und ich hätte die Ermittlungen am liebsten selbst in die Hand genommen, was natürlich unmöglich war. Das zuständige Kommissariat schickte einen Spezialisten, der mich nach allen Regeln der psychologischen Kunst zu beruhigen versuchte. Vergeblich. Zwar hielt er meinen Vorwürfen und Beschimpfungen einigermaßen stand, doch am Ende siegte die Verzweiflung. Wenigstens leistete er mir noch eine Zeitlang Gesellschaft; ich nehme an, aus Furcht, ich könnte mir das Leben nehmen.
Man versprach mir Informationen über den Fortgang der Ermittlungen, die aber kaum über das hinausgingen, was in den üblichen Pressemitteilungen zu finden war. Die Ermittlungsarbeit der Polizei dürfe nicht behindert werden, hieß es lapidar.
Die Polizei setzte eine Sondereinheit ein, kontaktierte die umliegenden Gefängnisse und forensischen Kliniken. Ziel war es, Hinweise auf mögliche Flüchtige zu erhalten. Am Tatort wurden Profiler eingesetzt, die versuchten, Tat- und Tatumgebungsmerkmale mit wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Persönlichkeitsprofil des Täters in Verbindung zu bringen. Amtshilfeersuchen an andere Bundesländer wurden gestellt und alle verfügbaren Datenbanken über Sexualstraftäter durchforstet. Hundestaffeln wurden in die umliegenden Wälder geschickt, aber keine verwertbaren Spuren gefunden. Die Polizei der Nachbarländer wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Im Laufe der Ermittlungen gingen zahlreiche Anzeigen ein, die aber alle ins Leere liefen, darunter auch eine eilig in Auftrag gegebene Genanalyse von mehreren hundert Männern.
Über die Polizeiarbeit hinaus wurde die Suche nach dem Mörder zur Farce. Presse und Fernsehen taten, was sie in solchen Fällen immer tun: Sie versorgten das gaffende Volk mit dem Stoff, der die voyeuristische Gier nach fremdem Leid befriedigt. Dem eigenen, von ängstlicher Unlust beherrschten, unscheinbaren Dasein muss der Schrecken der Vergänglichkeit genommen werden, es muss um jeden Preis an Wert gewinnen. Dieses Ziel wird in der Regel durch die Relativierung des eigenen Elends am noch größeren Elend der anderen erreicht – eine aufgeklärten Menschen unwürdige, aber weit verbreitete Form des Umgangs mit der tief sitzenden, die Schutzwälle philosophischer und religiöser Reflexion niederreißenden und deshalb unerträglichen Angst, dieses Leben könnte tatsächlich, an und für sich, sinnlos sein. Kurzum, die Berichterstattung über die Jagd nach dem Phantom war unerträglich.
Natalie und ich waren bald auf uns allein gestellt. Abgesehen von den zahlreichen Anrufen neugieriger Sensationsjournalisten, die ich brüsk zurückwies, wagte niemand einen ernsthaften Kontaktversuch. Irgendwann lief man sich auf der Straße über den Weg, aber wer es auch war, blickte verlegen zur Seite und machte sich schleunigst aus dem Staub. In der allgemeinen Hilflosigkeit tat niemand das Nötige. Ein Kopfnicken, eine freundliche Hand zum Gruß, eine flüchtige Berührung hätten genügt, um Mitgefühl zu zeigen, denn es bedarf nicht vieler Worte, um bei den Leidenden zu sein, und noch weniger bedarf es der Worte, wenn der Grund des Leidens so schrecklich, so unfassbar ist.
Aber sie sind alle geflohen und haben uns allein gelassen, weil sie nicht wussten, wie man mit großem Leid umgeht. Für diese Kunst gibt es keine Schule. Erst viel später habe ich verstanden, dass sie gar nicht anders konnten.