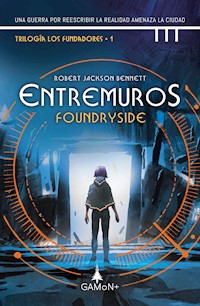9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Founders
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Finale der großen High-Fantasy-Trilogie um die raffinierte Diebin Sancia und ihren sprechenden Schlüssel Clef.
Die ehemalige Diebin Sacia Grado, der magische Schlüssel Clef und ihre Verbündeten sind der letzte Widerstand gegen die beinahe allmächtige magische Wesenheit, die die Welt zu unterjochen droht. Doch selbst, wenn sie aus einzelnen Schlachten siegreich hervorgehen, so rückt ihr Feind doch immer weiter vor: unerbittlich und unaufhaltsam. Sancia und Clef fassen einen verzweifelten Plan – und ahnen nicht, dass sich ein Verräter in ihren Reihen befindet …
Die Trilogie Der Schlüssel der Magie bei Blanvalet:
1. Die Diebin
2. Der Meister
3. Die Götter
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 753
Ähnliche
Buch
Die ehemalige Diebin Sancia Grado, der magische Schlüssel Clef und ihre Verbündeten sind der letzte Widerstand gegen die beinahe allmächtige magische Wesenheit, die die Welt zu unterjochen droht. Doch selbst wenn sie aus einzelnen Schlachten siegreich hervorgehen, so rückt ihr Feind doch immer weiter vor: unerbittlich und unaufhaltsam. Sancia und Clef fassen einen verzweifelten Plan – und ahnen nicht, dass sich ein Verräter in ihren Reihen befindet …
Autor
Robert Jackson Bennett wurde bereits mehrfach für seine Fantasy-Romane ausgezeichnet, unter anderem mit dem Edgar Award, dem Shirley Jackson Award und dem Philip K. Dick Award. Außerdem war er Finalist beim World Fantasy Award, dem Locus Award, dem Hugo Award und bei dem British Fantasy Award. Neben den Kritikern und zahllosen Lesern gehörten auch die größten seiner Autorenkollegen zu seinen Fans, zum Beispiel Brandon Sanderson und Peter V. Brett. Robert Jackson Bennett lebt mit seiner Frau und seinen Söhnen in Austin, Texas.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ROBERT JACKSON BENNETT
DIE GÖTTER
Deutsch von Ruggero Leò
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Locklands (The Founders Trilogy 3)« bei DelRey, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2022
by Robert Jackson Bennett
Published by arrangement with Robert Jackson Bennett
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-25721-7V001
www.blanvalet.de
Für Joe McKinney, der ein guter Mensch und ein viel besserer Autor war, als ich es je sein werde.
Es heißt, Politik sei die Kunst, Schmerz unters Volk zu bringen. Und das Skribieren ist natürlich die Kunst, Intelligenz unters Volk zu bringen.
Ich frage mich – manchmal begeistert, manchmal ängstlich –, was geschieht, wenn man beides kombiniert.
Orso Ignacio, Brief an Estelle Candiano
IDie Skriber-Kriege
1
»Bist du bereit?«, flüsterte eine Stimme.
Berenice öffnete die Augen. Das morgendliche Sonnenlicht glitzerte auf dem Ozean, und die Umrisse der Stadtmauern, Wälle und Geschütze schimmerten hell im Licht. Sie hatte so intensiv meditiert, dass sie einen Moment brauchte, um sich zu erinnern – bin ich in Alt-Tevanne? –, doch dann war sie wieder ganz bei Sinnen und erkannte die Stadt.
Grattiara, eine winzige Festungsenklave auf einer felsigen Landzunge, die in die Durazzo-See ragte. Wohin man auch blickte, überall nur ozeangraue Mauern, wolkenweiße Türme und kreisende Möwen. Es war im Grunde keine Stadt, eher ein Rest von Zivilisation, der sich an die Zinnen klammerte, Häuser und Hütten, die sich ausbreiteten wie Seepocken auf einem Schiffsrumpf. Sie betrachtete die kleinen Fischerboote, die zu den Molen trudelten. Die Segel erinnerten sie ein wenig an Fledermausflügel, die die ersten Strahlen der Morgendämmerung einfingen.
»Verdammt«, sagte Berenice leise, »das ist fast schon schön.«
»Fast.« Claudia kam zu ihr auf den Balkon, und ihre Augen wirkten hart und scharf unter dem dunklen Helm. Ihre Stimme glich einem Flüstern in Berenices Gedanken, leise, aber deutlich: »Wie tief sind wir gesunken, dass wir ein solches Drecksloch schön finden?«
Berenice seufzte. »Ja. Und trotzdem müssen wir es retten.«
Claudia stocherte mit einem Holzstück zwischen den Zähnen herum. »Zumindest müssen wir die Leute retten.« Sie schnippte den Zahnstocher weg. »Also, bist du bereit?«
»Ich weiß nicht. Kann sein. Wie seh ich aus?«
»Wie eine grimmige Kriegerkönigin.« Claudia grinste. »Vielleicht ein bisschen zu grimmig. Vergiss nicht, das ist eine Morsini-Festung. Der Gouverneur mag vielleicht keine furchteinflößenden Frauen.«
»Das dürfte ein unangenehmes Gespräch werden. Aber ich werde auf jeden Fall viel lächeln und mich verbeugen.« Berenice rückte ihren Schulterpanzer zurecht. Ihre Rüstung war alles andere als eine Lorica: Sie bedeckte nur die wichtigsten Stellen und ließ die Gelenke ungeschützt. Trotzdem war ihr darunter höllisch heiß in der Sonne Grattiaras.
»Das muss reichen.« Berenice hängte sich ihre Arbaleste um und vergewisserte sich, dass sie ihr skribiertes Rapier am Gürtel trug. »Sind die Arbalesten vorbereitet?«
»Wir müssen in Sichtweite zu ihnen kommen.« Claudia deutete auf eine kleine Plakette an ihrem Schulterpanzer, dann auf die gleiche an Berenice’ Rüstung. »Aber sie werden zu uns kommen, wenn wir sie rufen.«
»Gut.«
»Hältst du es immer noch für klug, bewaffnet zu diesem Gespräch zu gehen? Man wird uns zwingen, die Waffen abzugeben, bevor wir den Gouverneur sehen, oder?«
»Oh, ziemlich sicher«, erwiderte Berenice. »Aber wenn man uns auffordert, die Waffen abzulegen, können wir prima demonstrieren, wie viele wir dabeihaben.«
Claudia grinste wieder. »Wie zynisch. Aber du hast recht.«
Der Wind drehte sich, und Berenice stieg der Geruch von Fäulnis in die Nase – zweifellos aus dem Flüchtlingslager, das sich jenseits der Stadtbefestigung befand. Sie zückte ihr Fernrohr und nahm die Lager auf den Hügeln im Nordwesten in Augenschein.
Der Anblick bot einen grausamen Kontrast. Die Stadt Grattiara wirkte makellos, ihre skribierten Geschützbatterien säumten die Küste, die Türme im Inneren der Festungsanlage waren hoch und elegant. Doch nur wenige Meter davon entfernt erstreckte sich ein Gebiet mit löchrigen Zelten, improvisierten Unterkünften und verseuchten Wasserquellen – eine Mahnung daran, wie sehr sich die Welt jenseits der Festungsstadt verändert hatte.
»Da regt sich was, Capo«, flüsterte Claudia.
Berenice wandte sich um. Eine kleine Gruppe von Männern kam die Treppe vom Tor des Hauptturms herab, allesamt in Blau- und Rottönen gekleidet. Sie betrachtete den Bergfried, dessen Türme mit Arbalesten- und Kreischerbatterien bestückt waren – skribierte Modelle, die schon mindestens vier Jahre veraltet waren. Die seit Jahrzehnten immer wieder ausgebesserten Mauern hingegen wiesen überhaupt keine Skribierung auf, sondern bestanden nur aus Ziegeln und Mörtel. Keine Sigillen, Befehlsketten oder Argumente gaukelten ihnen vor, übernatürlich robust oder haltbar zu sein.
»Wenn sie erst mal hier ist«, murmelte sie, »wird sie diesen Ort überrollen wie ein Tsunami.«
»Ja«, erwiderte Claudia, die noch immer zum Flüchtlingslager hinausblickte. »Und all diese Menschen werden sterben – oder ein noch schlimmeres Schicksal erleiden.«
»Wie lange haben wir noch?«
»Nach letzter Schätzung zwei Wochen. Sie muss durch Balfi in den Norden vordringen, und das hält sie hoffentlich auf. Wir müssten noch etwa eine Woche Zeit haben, bis sie hier vor dem Tor steht, Capo.«
Berenice fragte sich, ob diese Schätzung stimmte. Wenn sie eine riesige Armee hatte, um mit ihr alles zu vernichten, was sich ihr in den Weg stellte – welche Straße würde sie nehmen, welche Flüsse, und wie schnell würde sie sich fortbewegen?
Wie sehr mich solche düsteren Fragen ermüden, dachte sie.
»Du hast mir noch immer nicht geantwortet, Ber«, sagte Claudia sanft. »Bist du bereit?«
»Gleich.« Sie ging zu der kleinen Bank am Fuß der Treppe, wo die beiden übrigen Mitglieder ihres Trupps saßen.
Diela, die Jüngere und Kleinere der beiden, ging so schnell in Habtachtstellung, dass der Helm auf ihrem Kopf verrutschte. Vittorio erhob sich träge und reckte lächelnd den großen, schlanken Körper. In den Armen hielt er eine schwere Kiste, etwa einen Meter breit und hoch, aus schlichtem Holz und mit einem verschlossenen Deckel, der an Scharnieren befestigt war.
»Alles in Ordnung?«, fragte Berenice.
»Ich bin bereit, das Ding abzustellen und aus der Sonne zu treten, Capo«, flüsterte Vittorio in ihren Gedanken. Er sah ihr in die Augen, und sein Lächeln wurde breiter. »Bist du sicher, dass man mich damit in den Bergfried lässt?«
»Ja«, antwortete sie. »Denkt beide daran: Das ist eine rein diplomatische Operation. Haltet einfach die Augen offen, die Ausrüstung griffbereit – und wenn sie uns angreifen, erinnert euch, was ihr während eurer Ausbildung gelernt habt.«
»Wenn es zum Kampf kommt, ist es sicher nicht so schwer, einen Haufen Handelshaus-Schläger abzuwehren«, sagte Vittorio grinsend. »Wir sind immerhin Schlimmeres gewohnt.«
Diela blinzelte, und Berenice spürte, wie sich im Hinterkopf des Mädchens ein Gefühl der Angst breitmachte.
»So weit wird es wohl nicht kommen«, sagte Berenice zu ihr. »Noch mal, das ist eine diplomatische Mission. Und auch wenn du noch nie gekämpft hast, Diela, weißt du trotzdem, was wir wissen. Du hast gesehen, was wir gesehen haben. Ich zweifle nicht daran, dass du es schaffen wirst.«
Diela nickte nervös. »Ja, Capo.«
»Es ist Zeit, Capo«, sagte Claudia.
Berenice blickte auf. Die Männer vom Bergfried hatten sie fast erreicht. Sie setzte ihren Helm auf, rückte ihn zurecht, sodass sie gut durchs Visier sehen konnte, und schnallte ihn fest. Ich führe diesen Krieg schon seit acht Jahren, dachte sie, und schaffe es noch immer nicht, mir diesen gottverdammten Helm richtig aufzusetzen.
Aufrecht und selbstsicher stand sie in ihrer dunklen Rüstung da und blickte zu den Morsini-Leuten, die die Treppe herabstiegen. Früher hätten ihr solche Männer Angst eingejagt oder sie zumindest beunruhigt, doch diese Zeiten waren lange vorbei. Sie hatte zu viele Schlachten und viel zu viel Tod und Schrecken erlebt, um sich über Angehörige eines Handelshauses den Kopf zu zerbrechen.
Ich bin bereit, dachte sie. Bereit für das hier!
Dennoch überkam sie das Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Sie zog erneut ihr Fernrohr aus der Tasche und spähte noch einmal hindurch, diesmal nach Süden aufs Meer hinaus.
Zuerst sah sie nichts als Wasser, dann jedoch entdeckte sie es – einen winzigen Punkt in der Ferne, direkt am Horizont.
Sancia und Clef, dachte sie. Sie bleiben auf Distanz. Aber sie sind da. Sie ist da.
Sie hörte Schritte und steckte das Fernrohr rasch wieder ein.
Gott, meine Liebste. Wie sehr wünschte ich, du wärst jetzt hier bei mir.
Von der Treppe her erklang eine Stimme, höflich und selbstsicher: »Der Gouverneur wird Euch jetzt empfangen, Generalin Grimaldi.«
»Vielen Dank«, erwiderte Berenice. »Bitte geht voraus.«
Wie erwartet forderte man sie auf, ihre Waffen abzugeben, bevor sie den eigentlichen Bergfried betraten, und sie kamen der Aufforderung ohne Protest nach. Berenice beobachtete, wie die Morsini-Wachen die Waffen an sich nahmen und neben dem Tor in einer großen Holzkiste verstauten, die sie dann verschlossen. Noch bevor sie die Frage formulieren konnte, flüsterte Claudia: »Wird schon kein Problem sein.«
»Gut«, erwiderte Berenice.
»Und das?«, fragte einer der Wachmänner und zeigte auf die Kiste in Vittorios Armen.
»Ein Geschenk für den Gouverneur«, erklärte Berenice.
»Ich muss es mir erst ansehen«, sagte der Mann, »und nehme es dann an mich.«
Berenice nickte Vittorio zu, der die Kiste auf den Boden stellte und sie öffnete.
Der Wächter spähte hinein und blickte dann ungläubig zu ihnen auf. »Seid Ihr sicher, dass Ihr die richtige Kiste habt?«
»Sind wir«, antwortete Berenice.
Der Wachmann seufzte, schloss die Kiste und hob sie grunzend an. »Wenn Ihr es sagt.«
Das Doppeltor schwang nach innen auf, und die Wachleute führten sie hindurch. Berenice war schon in vielen Einrichtungen von Haus Morsini gewesen, daher kam ihr der Bergfried vage bekannt vor: die engen, gewundenen Gänge, die Buntglasfenster, und überall sah man Wachen, Söldner und Kontraktoren in allen erdenklichen Farben und Rüstungen, auch wenn Letztere meist in ramponiertem Zustand waren.
Die vier Besucher wurden in den Hauptsitzungssaal geführt. Der musste in seiner Blütezeit ein prachtvoller Raum gewesen sein, mittlerweile waren jedoch fast alle Möbel entfernt worden, um Platz für einen riesigen Tisch zu schaffen, der mit Landkarten bedeckt war. Auf eine Geste der Wachen hin trat Berenice an den Tisch. Sie erkannte die Karten auf den ersten Blick: Sie zeigten die nördlichen Nationen Daulo und Gothian. Ein leuchtend roter Fleck durchzog die Territorien und erweckte den Eindruck, der gesamte Norden sei mit Blut bedeckt.
Berenice erkannte alles auf Anhieb, weil sie selbst täglich auf solche Karten sah. Doch den Farben und Markierungen nach waren diese hier veraltet – genau wie die Verteidigungsanlagen der Stadt.
Sie glauben, sie liegen gut in der Zeit, dachte sie. Aber sie haben keine Ahnung.
Berenice sah sich im Raum um. Im hinteren Teil saßen Söldner, Verwalter und Skriber und warteten darauf, aufgerufen zu werden. Sie musterten Berenice nur kurz und schauten dann zu dem Mann, der sich am anderen Ende des Tisches über die Karten beugte. Er wirkte gepflegt, war gut gekleidet und trug ein kunstvoll verziertes Rapier an der Seite. Sein Gesicht indes war blass und abgemagert, die Augen verrieten Erschöpfung, und sein Bart war von grauen Strähnen durchzogen. Obwohl Berenice wusste, dass Gouverneur Malti nur gut zehn Jahre älter war als sie, wirkte er weit betagter.
Vielleicht wird das ein sehr kurzes Gespräch, und wir retten schnell viele Leben, dachte sie.
Das Gefolge in Rot und Blau kündigte sie an: »Generalin Grimaldi und die Delegation des Freistaates Giva, Euer Gnaden.«
Berenice nahm den Helm ab und verneigte sich. »Danke, dass Ihr uns empfangt, Euer Gnaden.«
Claudia, Vittorio und Diela verbeugten sich ebenfalls, ließen jedoch die Helme auf.
Gouverneur Malti blickte langsam von seinen Karten auf und zog die Augenbrauen hoch. Er betrachtete sie mit einem leicht verblüfften Ausdruck. Berenice wartete darauf, dass er das Wort ergriff, doch er schien es nicht eilig zu haben.
Schließlich sagte er: »Also, das sind die mythischen Krieger aus Giva.«
Die Aussage hing in der muffigen Luft.
»Das sind wir, Euer Gnaden«, bestätigte Berenice.
»Ich habe schon geglaubt, Givaner wären Märchengestalten wie Gespenster.« Maltis Ton klang harsch und unbarmherzig wie das Surren einer Bogensehne. »Oder wie die Himmelsgeister, die in den Erzählungen meines Großvaters die Himmelstore bewachten.«
»Mein Hintern ist schweißnass«, sagte Claudia, »daher komme ich mir nicht besonders mythisch vor.«
Berenice bemühte sich um ein würdevolles Lächeln. »Mir wäre es weit lieber, wir wären wirklich mythische Gestalten. Aber wir sind aus Fleisch und Blut und freuen uns, hier im irdischen Reich mit Euch sprechen zu können.«
Gouverneur Malti erwiderte ihr Lächeln, nur wirkte seins weitaus kühler. »Gewiss. Und Ihr seid gekommen, um mit mir die hiesige Lage zu besprechen.«
»Ja, Euer Gnaden. Es geht um die Flüchtlinge vor Euren Toren.«
»Ihr wollt meine Erlaubnis, sie wegzubringen.«
»Wenn möglich, Euer Gnaden. Wir haben die nötigen Transportmittel zur Verfügung und wollen ausschließlich Leben retten. Ich könnte mir vorstellen, dass das für alle von Vorteil wäre. Es muss schwierig sein, Eure Streitkräfte zu versorgen, wenn Euch zugleich so viele vertriebene Bürger belasten.«
»Vertriebene Bürger …«, wiederholte Malti. »Was für eine Phrase.« Er ließ sich auf einen Stuhl sinken und sah zu, wie ein Wächter Vittorios Kiste auf den Tisch stellte, sich verbeugte und dann zurückzog. »Und um meine Erlaubnis zu bekommen, habt ihr mir … Geschenke mitgebracht.«
»Haben wir«, bestätigte Berenice. »Gewissermaßen.«
Maltis Blick verweilte auf der Kiste. Er stand nicht auf, um sie zu öffnen, sondern starrte sie nur stumm an, wie in Gedanken versunken.
»Ich kann’s nicht beurteilen«, flüsterte Claudia. »Läuft es gut? Es fühlt sich nämlich nicht so an.«
»Ruhe!«, erwiderte Berenice harsch.
»Wisst Ihr«, sagte Malti mit plötzlicher Heiterkeit, »ich bin immer noch nicht gewohnt, Delegationen zu empfangen. Botschafter. Gesandte. Etwas in der Art. Grattiara wurde schließlich aus anderen Gründen gebaut.« Er deutete müde auf die düsteren Backsteinmauern. »Unsere Festung soll dazu dienen, die Küste zu bewachen. Früher nutzten die Großmächte keine Verteidigungsanlagen, um sich mit Staatsleuten zu treffen. Vielmehr besuchten sie die Staaten selbst.«
»Das stimmt, Euer Gnaden«, sagte Berenice. »Aber die Welt hat sich inzwischen verändert.«
»Verändert?« Ein düsteres Grinsen huschte über Maltis Gesicht. »Vielleicht sollte man eher von Untergang sprechen.«
Alle im Raum sahen Berenice an.
»O Scheiße«, sagte Claudia. »Das ist ja finster.«
»Hier ist sie nicht untergegangen«, entgegnete Berenice gleichmütig.
»Noch nicht. Aber anderswo …« Maltis Grinsen verblasste. »Vor acht Jahren waren wir nur ein Außenposten in einem gewöhnlichen Krieg. Dann gab es plötzlich immer weniger Länder, in die Botschafter geschickt wurden, und so kamen sie hierher. Und jetzt entsendet fast keine Nation mehr Diplomaten.« Er beugte sich vor. »Aber bei anderen Delegationen wusste ich in der Regel, wohin ich mich nach deren Abreise wenden musste, um die Gespräche fortzusetzen. Ich kannte den Namen einer Stadt, einer Insel, einer Stätte oder dergleichen. Aber bei der Nation Giva? Niemand weiß genau, wo sie sich befindet, oder?«
Wieder spürte Berenice, dass aller Augen im Raum auf sie gerichtet waren.
»Giva liegt auf den givanischen Inseln«, erwiderte sie, nach wie vor in höflichem Ton.
»Oh, ich weiß«, sagte Malti. »Das hat man mir gesagt. Mir wurde auch zugetragen, dass, segelt man dorthin, die Inseln immer menschenleer und nebelverhangen sind. Und je weiter man vordringt, desto mehr Nebel kommt auf, bis man aufgeben muss.« Er grinste kalt. »Seid Ihr sicher, dass Ihr nicht die Pforten des Himmels bewacht, General Grimaldi?«
»Verdammt«, flüsterte Vittorio, »er ist nicht dumm.«
»Stimmt«, antwortete Berenice, »ist er nicht.«
»Ihr wisst doch sicher, dass unkonventionelle Verteidigungsmaßnahmen unabdinglich sind, Euer Gnaden«, sagte sie laut. Sie deutete mit dem Kopf zur Karte. »Wenn man bedenkt, was mit den Daulo-Nationen, dem Territorium Gothians und darüber hinaus geschehen ist …«
Maltis Blick war eisig. »Also könnt Ihr Nebelbänke erzeugen?«
»Wir haben skribierte Werkzeuge dafür«, erwiderte Berenice kühl. »Die gleichen wie Ihr.«
Malti wandte einen Moment lang nachdenklich den Blick ab. Dann fragte er: »Sagt mir, Generalin Grimaldi – hat Giva vor etwa sechs Monaten wirklich die feindlichen Anlagen in der Bucht von Piscio zerstört?«
Berenice spürte in ihren Gedanken, wie überrascht ihre Begleiter waren.
»Hä?«, flüsterte Claudia. »Mir war nicht klar, dass sich das schon bis hierher herumgesprochen hat.«
»Haben wir, Euer Gnaden.« Berenice war sich nicht sicher, worauf der Gouverneur hinauswollte.
»Und was war im Hafen von Varia?«, fragte Malti. »Ich habe gehört, der Feind unterhielt an der Küste eine große Festung – und nachdem ihr Givaner dort wart, soll sie völlig zerstört gewesen sein. Ist das wahr?«
Berenice zögerte, nickte dann aber.
»Wie?«, fragte er.
Sie dachte nach. »Durch Sorgfalt, Euer Gnaden.«
Malti lächelte kurz, dann wirkte sein Blick abwesend. Als er wieder das Wort ergriff, sprach er sehr leise: »Das ist höchst interessant. Mir ist nämlich nur eine einzige andere Macht bekannt, die jemals solche Erfolge gegen den Feind erzielt hat. Ich muss mich also fragen, ob es da einen Zusammenhang gibt.«
Berenice sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Dann blickte sie wieder auf die Karten auf dem Tisch – insbesondere auf einen kleinen schwarzen Flecken westlich der rot markierten Täler. Eine seltsam deplatzierte Markierung, wie ein Parasit im Körper eines Tiers, und obwohl sie im Vergleich zu dem roten Meer im Osten winzig wirkte, war das Gebiet in Wahrheit Hunderte von Kilometern breit. Maltis Berater hatten das Gelände um den Flecken herum sogar grau schattiert, um ihn vom Ödland abzugrenzen, das durch lange, unsägliche Kriege entstanden war.
Berenice sah zu Malti auf. »Giva steht allein. Wir haben keine offiziellen Verbündeten, Euer Gnaden. Schon gar nicht den, der Euch vorschwebt.«
»Aber ihr habt so vieles gemeinsam. Viele Geheimnisse und Fähigkeiten. Wie könnt Ihr mich davon überzeugen, dass Ihr nichts mit dem Teufel zu tun habt, der in den Schwarzen Königreichen schläft?«
Alle sahen Berenice an. Sie nahm wahr, wie Vittorio insgeheim die bewaffneten Wachen im Raum zählte.
»Und?«, hakte Malti nach.
Ein Bild blitzte in Berenice’ Kopf auf – eine schwarze Maske, die in den Schatten schimmerte, während Schreie durch die Nacht gellten. Und mit der Erinnerung kam eine Stimme, unmenschlich tief und grollend: Ich war an Orten, die kein lebender Mensch je zuvor betreten hat. Ich habe einen Blick auf die Infrastruktur geworfen, die die Realität möglich macht.
»Ber?«, flüsterte Claudia.
Berenice räusperte sich. »In der Nacht des Untergangs war ich in Tevanne, Euer Gnaden. Ich habe gesehen, was er getan hat. Ich erinnere mich. Und kann es nicht vergessen. Ich meine es also völlig ernst, wenn ich sage, dass ich lieber sterben würde, als der Verbündete dieses Geschöpfs zu sein.«
Malti nickte. Sein Blick wirkte noch immer distanziert. Obwohl Berenice nicht beurteilen konnte, ob er ihr glaubte, schien ihn die Antwort zumindest zufriedenzustellen. Doch dann schärfte sich sein Blick, und er sagte: »Es ist mir egal, was in Eurer Kiste ist.«
Berenice blinzelte überrascht. »Euer Gnaden, ich …«
»Gold und Wertsachen sind mir gleich«, sagte er. »Schließlich gibt es keine freien Länder mehr, wo ich diese Währung eintauschen kann. Und ich schere mich auch nicht um irgendwelche skribierten Werkzeuge oder Erfindungen, die Ihr anbieten könntet. Wir betreiben unsere Geräte und Verteidigungsanlagen mit eigenen Lexiken. Wir brauchen auch keine Definitionsplatten oder Argumente, mit denen die Lexiken die Werkzeuge in unserem Sinne manipulieren.« Er verstummte, und sein strenger Ausdruck wich großer Müdigkeit.
Berenice spürte, dass eine unausgesprochene Frage im Raum stand, und beschloss, sie zu stellen. »Was liegt Euch dann am Herzen, Euer Gnaden? Wie kann Giva Euch helfen?«
Maltis Miene erstarrte, sein Blick huschte über die Karten. »Mir helfen … Hm. Wenn Giva dem Feind schaden kann, dann versteht Ihr ihn sicher ein wenig. Zumindest besser als meine Skriber, die ihn überhaupt nicht verstehen.« Er wies verächtlich auf die Männer im hinteren Teil des Raumes.
»Wir wissen einiges über den Feind, ja«, erwiderte sie.
Erneut musterte Malti sie. »Ich habe ein … Problem«, sagte er. »Eines, das sich niemand erklären kann. Eines, das unser Feind verursacht. Es ist so schwerwiegend, dass ich bereit bin, es sogar mit Fremden wie Euch zu besprechen, obwohl es ein sehr großes Geheimnis ist.«
Berenice verstand die indirekte Bitte. »Wir hüten Geheimnisse gut, Euer Gnaden.«
»Das will ich hoffen«, sagte er leise. »Wenn Ihr mir bei diesem … Hindernis helfen könnt, gewähre ich Giva freie Fahrt durch die Gewässer vor meiner Festung.« Er seufzte, erhob sich und deutete auf eine geschlossene Tür im hinteren Teil des Raumes. »Ich kann das Problem nicht erklären, denn ich begreife es nicht. Aber ich zeige es Euch, wenn Ihr wollt.«
Nachdenklich betrachtete Berenice die Tür. Die Wendung kam überraschend. Sie hatte mit mehr Aufwand und Bestechungsgeldern gerechnet – und mit viel mehr Drohungen.
»Äh, Capo?«, meldete sich Diela. »Entspricht das deinem Plan?«
»Nicht im Geringsten.« Berenice sah Malti direkt an. Dessen Gesicht wirkte so hager und erschöpft. »Aber ich glaube nicht, dass er lügt.«
»Sofern wir ihm wirklich helfen können«, sagte Claudia.
»Wir haben alles auf eine Karte gesetzt, indem wir hergekommen sind«, erwiderte Berenice. »Jetzt müssen wir die Sache auch durchziehen.«
Sie nickte Malti zu. »Wir folgen Euch.«
Malti führte sie durch die kleine Tür und in das Labyrinth aus Gängen, das tief in den Bergfried reichte. Berenice konnte sich den Weg nicht einprägen. Sie und ihre Gefährten liefen inmitten der Eskorte des Gouverneurs, die insgesamt aus zwei Dutzend Leuten bestand. Sie sah kaum mehr als eine Reihe Schultern vor sich.
Nach einer Weile hielten sie inne, und das Gefolge machte Platz, um Berenice und ihre Leute vorzulassen. Malti stand vor einer geschlossenen Holztür. Sein Blick wirkte noch erschöpfter als zuvor. »Ich möchte Euch bitten, ruhig zu sein«, sagte er. »Und höflich.«
Sie nickte.
»Alles, was Ihr hier drinnen seht, muss ein Geheimnis bleiben. Ist das klar?«
»Natürlich.«
Malti sah sie lange an, war scheinbar hin- und hergerissen. Dann öffnete er die Tür und führte sie hindurch.
Der Raum dahinter war ein geräumiges, aber karg eingerichtetes Schlafzimmer mit einem rot-blauen Teppich und einem schönen Kleiderschrank. In der Ecke stand ein Himmelbett, daneben saß eine Frau in schlichter Kluft, eine Schüssel mit Haferbrei und einen Löffel auf dem Schoß.
In dem Bett lag ein junger Mann, etwa zwanzig Jahre alt, schrecklich abgemagert. Seine Augen wirkten stumpf und starrten mit glasigem Blick an die Ziegeldecke. Sein Mund war mit Brei verschmiert, und ein Haufen Laken in der Ecke verströmte den Gestank von Kot und Urin.
Malti näherte sich, und die Frau stand auf, verbeugte sich und trat zur Seite. Er stellte sich neben das Bett und sagte zerknirscht mit leiser Stimme: »Das ist mein Sohn. Julio.«
Berenice trat neben ihn. Der junge Mann reagierte nicht. Er blinzelte nicht einmal. Sein Atem glich einem leisen Keuchen.
»Er hat in der Schlacht bei Corfa gekämpft«, sagte Malti. »Das letzte große Gefecht, das sich Haus Morsini mit dem Feind geliefert hat. Er war gerüstet, bewaffnet und bereit – doch dann traf ihn etwas, und er wurde verrückt. Er …« Malti schluckte, und seine Stimme zitterte. »Er hat seinen Bruder getötet. Seinen kleinen Bruder. Und noch viele andere. Erst als seine Männer ihn zu Boden drückten und wegbrachten, wurde er … still. So wie jetzt. Er atmet, isst kaum, aber …«
Berenice beobachtete, wie sich die eingesunkene Brust des jungen Mannes sanft hob und senkte.
»O Scheiße«, sagte Claudia. »Hat er das, was ich vermute?«
»Ja«, antwortete Berenice.
Vittorio sah sie erschrocken an. »Und sie haben ihn hergebracht? Ihn reingelassen? Wissen sie nicht, was in ihm stecken könnte, selbst jetzt noch?«
»Ist das eine Falle, Capo?«, fragte Diela. »Wollte … Wollte sie, dass wir herkommen?«
Berenice schwieg.
Malti wandte sich ihr zu. »Wisst Ihr, was er hat?«, fragte er. »Könnt ihr Givaner ihn von der bösen Krankheit heilen, mit der der Feind meinen Sohn infiziert hat?«
Ber betrachtete den jungen Mann: die Wangenknochen, die fast die Haut zu durchdringen schienen, die dürren Arme, die kleinen, trüben Augen. Sie umfasste sein verschwitztes, fleckiges Gesicht mit beiden Händen und drehte es zu sich, um die rechte Seite zu betrachten.
Dort, über dem Ohr, entdeckte sie, wonach sie suchte: eine kleine, nässende Risswunde, die durch die Infektion leicht angeschwollen war. Zugleich glaubte sie darin einen metallischen Schimmer zu erkennen, als habe sich etwas ins Gewebe gebohrt.
Sie sah dem Jungen in die Augen und fragte sich, wer – oder was – sie daraus ansah und was die Präsenz ausspioniert hatte.
»Berechnet alles neu«, befahl Berenice. »Sie weiß, dass wir hier sind. Geht davon aus, dass wir keine zwei Tage mehr haben.« Sie wandte sich an Malti. »Wir werden das nicht hier besprechen. Hier könnte der Feind zuhören.«
»Der Feind?«, fragte er beleidigt. »Meint Ihr meinen Sohn?«
»Nein. Ich meine das Ding, das jetzt Euren Sohn kontrolliert. Die Präsenz, die ihn wahrscheinlich missbraucht, um herauszufinden, wie man Eure Festung einnehmen kann.«
Sie saßen am Tisch im Besprechungsraum: die vier Givaner, Gouverneur Malti und eine Handvoll seiner vertrauenswürdigsten Leutnants. Berenice ließ den Blick über die Karten schweifen, die vor ihnen lagen, und betrachtete die vielen Städte und Lehen, deren Namen in der roten Markierung kaum zu lesen waren. Am längsten musterte sie den roten Flecken, der sich bis zur Spitze der Halbinsel auszubreiten drohte, wo die Küstenstadt Grattiara lag. Die Lücke zwischen der Festung und dem vielen Rot wirkte sehr, sehr schmal.
All die Menschen, die dazwischen gefangen sind, dachte Berenice. Die Überlebenden haben so viel Elend durchlitten.
Sie fragte: »Kennt Ihr Euch mit Zwillings-Skriben aus?«
Gouverneur Malti blickte zu ihr auf. »Zwillings-Skriben?« Er sah sich im Kartenzimmer um, als wollte er einen Skriber zurate ziehen, dabei hatte er die Kammer vor der Besprechung eigens räumen lassen. »Ich glaube, schon. Das ist eine Skribier-Methode, die hauptsächlich der Kommunikation dient, richtig?«
»Ja«, bestätigte Berenice. »Ein Skriben-Argument, das einem Objekt vorgaukelt, ein anderes zu sein – oder ihm zu gleichen. Schreibt man die entsprechenden Sigillen auf zwei Glasscheiben, werden sie zu Zwillingen. Schlägt man dann mit einem Hammer auf die eine, zerbrechen beide. Koppelt man zwei Metallstücke mit Zwillings-Skriben, braucht man nur eins davon zu erhitzen, um beide zum Glühen zu bringen.« Sie beugte sich über die Karten. »Der Feind, gegen den ihr kämpft – den wir alle bekämpfen –, benutzt eine fortgeschrittene Form der Zwillingsbildung, um seinen Krieg zu führen. Dadurch ist es ihm gelungen, in nur acht Jahren so viele Gebiete zu erobern.«
Sie berührte die größte Karte, die die Durazzo-See und die umliegenden Länder zeigte, sowie die rote Markierung, die fast alle Gebiete im Norden umfasste.
»Der Feind hat das alles mithilfe von Zwillings-Skriben erobert?«, fragte Malti zweifelnd.
»Ja«, sagte Berenice. »Weil er weiß, wie man etwas sehr Ungewöhnliches miteinander verkoppeln kann.« Sie schaute ihn an. »Unseren Verstand.«
Malti blickte seinen Söldnerhauptmann an, der verwirrt mit den Schultern zuckte. »Verstand koppeln? Was soll das bedeuten?«, fragte der Gouverneur.
Berenice erhob sich und ging zu der Kiste, die noch auf dem Tisch stand. »Darf ich Euch endlich unser Geschenk zeigen?«
Malti betrachtete die Kiste misstrauisch, dann nickte er. Berenice öffnete sie, drehte sie um und schüttete den Inhalt aus.
Ein skribiertes Objekt landete klirrend auf dem Boden: ein seltsames Gerät aus Holz und Stahl, klobig und primitiv, mit unverkleidetem Korpus, als sei dem Konstrukteur das Aussehen egal gewesen. Doch jeder, der sich ein wenig mit ausgeklügelten Werkzeugen auskannte, wusste, dass es sich um eine Kombination zweier gewöhnlicher Dinge handelte: einer Arbaleste und einer Laterne.
»Eine … Schwebelaterne?«, fragte einer von Maltis Leutnants.
»Ja. Eine, die eine sehr spezielle Munition abfeuert«, erklärte Berenice. »Keinen Bolzen, sondern eine skribierte Plakette. Eine sehr kleine Plakette. Euer Sohn wurde mit ziemlicher Sicherheit von einem solchen Geschoss getroffen.« Sie tippte sich an die rechte Schläfe. »Es hat sich in seinen Schädel gebohrt, und dann hat sich sein Geist mit etwas gekoppelt. Mit dem Feind. Zwei Dinge wurden zu ein und demselben. Der Feind hat seinen Körper skribiert, sein ganzes Wesen, und ist mit seinem Bewusstsein verschmolzen. Seither sieht er dasselbe wie Euer Sohn, ihr Geist ist vereint. Der Feind hat ihm Befehle erteilt, die er befolgt, weil er keinen eigenen Willen mehr hat.« Berenice nahm wieder Platz. »Und Ihr habt ihn in Eure Stadt zurückgebracht. Dorthin, wo der Feind alles mit seinen Augen sehen und mit seinen Ohren hören kann und auf eine Gelegenheit zum Angriff wartet.«
Maltis aschfahles Gesicht wurde noch blasser. »Das kann nicht sein. Das ist … Das ist mein Sohn, von dem Ihr da sprecht.«
»Und Ihr wisst, was er in Corfa getan hat«, sagte Claudia. »Etwas, das er normalerweise nie tun würde, richtig? Etwas, das Ihr für verrückt gehalten habt.«
»Ihr verlangt von mir, Unfassbares zu glauben«, fuhr Malti fort. »Beim Skribieren geht es um … um Gegenstände.« Er klopfte auf den Tisch neben sich. »Um Bolzen. Schwerter. Schiffe. Mauern. Den Verstand zu skribieren ist … einfach Irrsinn!«
Claudia sah Berenice fest an. »Sagst du ihm jetzt, dass wir alle kleine Plaketten im Körper haben? Mit denen wir Gedanken und alle möglichen verrückten Dinge teilen können?«
»Ich will, dass er uns erlaubt, ihn und sein Volk zu retten«, gab Berenice zurück. »Nicht dass er uns wie Hexen verbrennt.«
Doch sie hatte weitaus persönlichere Gründe, dieses Thema nicht anzuschneiden. Andernfalls würde Malti sie zweifellos fragen, wie Giva zu dieser Technik gekommen war. Und falls sie ihm wahrheitsgemäß antwortete, konnte sie nicht verschweigen, dass sie zu den Skribern zählte, die diese Technik entwickelt hatten, ehe sie vom Feind gestohlen worden war. Somit trug sie selbst eine gewisse Schuld daran, dass nun Hunderte von Städten auf den Karten rot gefärbt waren, und an den Tausenden von Flüchtlingen außerhalb der Mauern Grattiaras, die dem Ansturm entkommen waren. Und auch am Tod all jener, die es nicht geschafft hatten.
Hör auf, ermahnte sie sich. Kämpf die Schlachten, die vor dir liegen, nicht die, die so lange zurückliegen.
»Selbst wenn Ihr die Wahrheit sagt«, fuhr Malti fort, »warum habt Ihr mir diese … diese Laterne geschenkt? Wusstet Ihr, dass dieses Leid meinen Sohn ereilt hat?«
»Nein«, sagte Berenice. »Ich habe sie Euch gebracht, um Euch vor dem zu warnen, was geschehen wird. Und um Euch zu erklären, wie alle anderen Städte gefallen sind. So wird auch Eure Festung fallen.« Sie legte die Hand auf den roten Flecken auf der Karte, als wäre er eine Wunde. »Ihr werdet zuerst nur eine Laterne sehen, die vor Euren Mauern schwebt«, sagte sie. »Sofern Ihr sie überhaupt entdeckt.«
»Sie wird wahrscheinlich nachts kommen«, mischte sich Vittorio ein. »Sie ist klein. In der Dunkelheit schwer zu sehen.«
»Sie wird auf einen Eurer Soldaten zielen«, erklärte Claudia. »Man kann die Plaketten überall hinschießen – Kopf, Hand, Rücken, das ist egal. Sie muss nur in lebendem Gewebe stecken, damit die Skribierung funktioniert.«
»Dann wird sie diesen Soldaten mit jemandem koppeln – ihn besitzen, übernehmen – und sich seiner Augen bedienen«, sagte Diela leise. Ihre Augen wirkten groß unter ihrem Helm. »Um zu sehen, welche Verteidigungsanlagen Ihr habt. Wo Eure Leute stationiert sind.«
»Wo Ihr stark seid«, sagte Vittorio. »Und wo schwach. Was Ihr befehlt und plant.«
»Der Feind wird den perfekten Zeitpunkt für seinen Angriff wählen«, ergänzte Claudia.
»Und dann wird sich der Himmel mit diesen Dingern füllen.« Berenice trat mit dem Fuß gegen die Schwebelaterne. »Sie werden über Eure Soldaten herfallen wie Heuschrecken, weil sie wissen, wo sie zu finden sind. Sie werden auf sie schießen, ihnen Plaketten einverleiben, sie zu Zwillingen machen und auf ihre Seite ziehen. Die Soldaten werden zu Euren Verteidigungsanlagen gehen und dort ihre Kameraden töten. Oder sie öffnen die Tore oder stecken die Gebäude in Brand, vielleicht sogar ihre eigenen Häuser. Einfach alles.«
»Wir nennen sie ›Wirte‹«, sagte Claudia leise. »Denn sobald eine dieser Plaketten in ihnen steckt, sind sie nicht mehr sie selbst. Sie sind dann keine Menschen mehr. Nicht wirklich.«
»Sie sind mit etwas anderem gekoppelt«, erklärte Berenice.
Ein Bild blitzte in ihrem Kopf auf: ein Mann in einer dunklen Ecke, der sich zu ihr umdreht; blasses Licht fällt auf seine Gesichtszüge, und seine Augen, die Nase und der Mund sind blutverschmiert.
»Mit etwas Ungeheuerlichem«, sagte sie leise. »Mit etwas, das wir nicht richtig verstehen.«
»Das ist alles lächerlicher Blödsinn«, knurrte ein Söldnerhauptmann. »Laternen, die zielen können? Schießen? Ich weiß noch, wie Skriber versucht haben, Laternen zu bauen, die den Leuten Obstkörbe nach Hause liefern sollten. Damals fielen überall Melonen vom Himmel. Die Vorstellung, dass eine Laterne eine Arbaleste bedienen kann, ist mehr als töricht.«
Claudia schüttelte den Kopf. »Die Laternen selbst zielen und schießen genauso wenig wie eine normale Arbaleste.«
»Ihr meint, sie werden von jemandem aus der Ferne bedient?«, fragte Malti. »Von wem?«
Die Givaner sahen einander an.
»Er ist scharfsinnig, begreift es aber nicht ganz«, sagte Diela.
»Ja«, stimmte Berenice zu. »Er begreift’s nicht.«
»Vom Feind«, sagte sie laut, wusste jedoch, dass ihre Antwort nicht zufriedenstellend klang.
»Von seiner Infanterie?«, fragte Malti. »Warum können wir dann nicht unsere Scharfschützen einsetzen, um sie auszuschalten? Um die Leute zu stoppen, die die Laternen kontrollieren, bevor sie uns angreifen können?«
»Nein.« Berenice zog auf der Suche nach den richtigen Worten eine Grimasse. »Nicht die Infanterie kontrolliert die Laternen. Alle Kräfte des Feindes – die Infanterie, die Laternen, die Schiffe, alles – wird aus der Ferne gesteuert. Von einer Stelle aus.«
»Von einem Geist«, sagte Claudia.
»Einem Wesen«, erklärte Diela. »Es sieht mit vielen Augen. Arbeitet mit vielen Händen. Kontrolliert viele, viele Anlagen – überall auf dem Kontinent, gleichzeitig.«
»Ein Geist, so skribiert, dass er an vielen Orten zugleich existiert«, sagte Vittorio. »In allem, was er erschaffen hat – in Anlagen oder Menschen.«
Malti sah sie erschrocken an. »Nein. Das ist unmöglich.«
»Habt Ihr Euch nie gefragt, Euer Gnaden, wie der Feind so perfekt manövrieren kann?«, sagte Berenice. »Wie er fast ohne Zeitverlust kommuniziert? Warum seine Kreischer immer Ziele treffen, die außerhalb der Sichtlinie seiner Artillerie liegen? Und warum er sich nicht einmal die Mühe macht, mit Euch zu verhandeln? Wieso schickt er nie Abgesandte, kündigt sich nie an und gibt sich Euch nicht zu erkennen?«
Malti starrte auf die Karte. Sein Gesicht war fast farblos, die Spitzen seines Bartes zitterten.
»Das klingt unmenschlich«, fuhr Berenice fort, »weil es unmenschlich ist.«
Der Gouverneur schluckte. Lange Zeit saß er schweigend da, dann wandte er sich der skribierten Laterne auf dem Boden zu. »Ihr seid gar nicht hier, um mich zu überreden, Euch die Flüchtlinge zu überlassen«, sagte er.
»Nein«, erwiderte Berenice. »Wir sind hier, um auch Euch zum Rückzug zu bewegen. Euch und all Eure Männer.«
»Ihr sollt mit uns kommen«, sagte Diela. »Bei uns seid Ihr in Sicherheit.«
»Es gibt keine Möglichkeit, gegen diesen Feind anzukommen«, ergänzte Claudia. »Keine Feldschlacht. Keine Belagerung. Keinen Trompetenstoß und keinen glorreichen Angriff der Soldaten.«
»Die Kriegsführung der Handelshäuser ist veraltet«, fügte Vittorio hinzu. »Das hier ist anders.«
Berenice warf ihm einen bösen Blick zu. »Die Kriegsführung hat sich geändert. Also müssen wir uns ändern. Wir alle. Auch Ihr, Euer Gnaden.«
Malti blinzelte erschüttert. Dann griff er nach einem Krug, schenkte sich einen Becher Wein ein und stürzte ihn hinunter. »Ich bin ein Morsini«, sagte er gedehnt. »Ich wurde in dem Glauben erzogen, dass Macht und Kampf die große Sprache der Welt ist, dass man seinen Wert mit Waffenstärke beweist. Zu evakuieren, meinen Posten zu verlassen ist … undenkbar.«
Berenice beobachtete stumm, wie sich Maltis Gedanken in seiner Miene widerspiegelten.
»Wohin würdet Ihr meine Leute bringen?«, fragte er. »Zu Euren Nebelbänken?«
Sie nickte. »Nach Giva. Dort hat sich der Feind noch nie blicken lassen.«
Malti barg das Gesicht in den Händen. »So weit zu fliehen … mein Gott!« Er stöhnte und sah sie an. »Sagt es mir. Könnt Ihr meinen Jungen retten?«
»Man weiß ja nie, ob so was gut geht«, sagte Claudia, die neben Berenice die Stufen des Bergfrieds erklomm. »Aber das ist gut gelaufen.«
»Kann sein.«
Sie erreichten die oberen Wehrgänge der Festung. Berenice schirmte sich die Augen mit der Hand ab und blickte aufs weite Meer hinaus.
Von allen Dingen, die ich heute verlieren könnte, dachte sie, muss es ausgerechnet eine riesige Kriegsgaleone sein.
»Müssen wir uns vor dem Jungen hüten?«, fragte Diela. »Dem Wirt?«
»Natürlich!«, sagte Vittorio. »Schließlich hat sie uns gesehen, mit den Augen des Jungen. Sie beobachtet uns.«
»Wir müssen den Jungen sofort säubern«, brummte Claudia. »Ich frage mich, warum wir das nicht gleich getan haben.«
»Zuerst müssen wir die Leute hier rausbringen.« Berenice schaute weiterhin aufs Meer hinaus. »Und ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis wir Malti davon überzeugen können, uns den Jungen retten zu lassen.«
»Warum müssen wir ihn davon überzeugen, seinen Sohn zu retten?«, fragte Diela.
»Weil das bedeutet, ihn mit einem verdammten Messer zu stechen«, brummte Vittorio. »Das erfordert vielleicht ein wenig Diplomatie.«
Berenice nickte. »Korrekt.«
»Oh«, sagte Diela sanft. »Verstehe.«
Eine unangenehme Stille breitete sich aus, denn keiner von ihnen wollte über das Thema reden.
Jeder in Berenice’ Trupp trug eine winzige skribierte Plakette in sich, die den Verstand der jeweiligen Person mit dem aller anderen verband. Das machte sie zu etwas ungewöhnlich Mächtigem: zu einem Trupp aus Soldaten, der in völliger Übereinstimmung handelte und sich des Standorts, der Fähigkeiten und Schwachstellen jedes einzelnen bewusst war.
Doch falls ihre Feindin – die Präsenz, die sich selbst »Tevanne« nannte – einen von ihnen gefangen nahm und wie den Sohn des Gouverneurs kontrollierte, würde sie durch die Skribierung Einfluss auf alle erlangen, die miteinander gekoppelt waren. Daher durfte man mit einer aktiven Verbindung niemals in Gefangenschaft geraten.
Die Lösung stellte ein Säuberungsstab dar. Dabei handelte es sich um eine skribierte Klinge, die man sich ins Fleisch stach und dann abbrach. Sobald sie im Körper steckte, zwang sie ihn dazu, alle anderen Skriben-Befehle zu ignorieren, die je auf ihn angewendet wurden – einschließlich der Skriben, die Berenice und ihrem Trupp erlaubten, als Einheit zu denken und zu fühlen. Die Wirkung einer Säuberung war unumkehrbar, doch war es besser, dauerhaft geschädigt zu sein, als in Tevannes Klauen zu geraten und die eigenen Kameraden mit ins Verderben zu reißen.
Endlich erspähte Berenice die Schlüsselwacht in der Ferne. »Wenn wir das Signal an Sancia gesendet haben«, sagte sie, »rede ich mit dem Gouverneur. Hoffentlich hatte er genug Zeit, alles zu verarbeiten, was wir ihm über Tevanne erzählt haben. Genug, um uns zu erlauben, seinen Sohn zu säubern.« Sie reichte Claudia die Hand. »Lass uns anfangen.«
Claudia griff in ihren Kürass und holte ein längliches schwarzes Kästchen hervor, etwa zwei Zentimeter breit und tief und zehn Zentimeter hoch. Ein winziger Glaspunkt war in seine Seite eingelassen. »Hoffentlich ist es erledigt, bevor Tevanne uns durch diesen Wirt weiter ausspionieren kann. Richtig?«
Berenice nahm das Kästchen, stellte es auf die äußere Kante der Zinne und öffnete den Deckel. Eine Glaslinse kam zum Vorschein. »Hoffentlich, ja.«
»Das kann doch nicht passieren, oder?«, fragte Diela. »Zwillings-Skriben sind an eine bestimmte Entfernung gebunden. Gekoppelte Objekte müssen nahe beieinander sein, damit der Effekt funktioniert. Vielleicht wurde der Junge da drinnen … deaktiviert und bleibt so lange passiv, bis der Feind wieder in der Nähe ist.«
»Aber würden wir es überhaupt merken, wenn Tevanne in der Nähe wäre?«, fragte Vittorio.
»Wir stellen die falschen Fragen.« Berenice schaute durch die Linse der Box und peilte das weit entfernte Schiff an. Dann blickte sie zu ihrem Trupp. »Die richtige Frage lautet: Wenn der Feind in der Nähe und das alles eine Falle ist, ist es dann noch einen Versuch wert, die vielen Menschen da draußen zu retten?«
Ihr Trupp tauschte besorgte Blicke aus, doch schließlich nickten alle.
»Genau. Ich stimme zu.« Berenice blickte zum Himmel hinauf und justierte dann die Linse des Kästchens, um das Sonnenlicht einzufangen. »Nehmen wir einfach mal an, wir sind in eine Falle getappt.«
»Was für eine Falle?«, fragte Claudia.
»Ich weiß es nicht«, sagte Berenice. »Wir haben bisher vermutet, dass Tevanne die übliche Strategie anwendet: eine Stadt angreifen, sie erobern, die Streitkräfte neu formieren und dann zur nächsten ziehen. Aber jetzt …«
»Ihr glaubt also, Tevanne lässt alle Städte dazwischen aus?«, vergewisserte sich Diela. »Und kommt schnellstmöglich her?«
»Wenn uns der Feind mit den Augen des Jungen gesehen hat, ja«, antwortete Berenice. »Ich bin sicher, Tevanne würde mich nur zu gern umbringen. Oder Sancia. Und sie weiß, wo ich bin, da sind …«
»… Sancia und Clef auch nicht weit«, beendete Claudia leise den Satz.
»Korrekt.« Berenice legte einen kleinen Schalter an der Seite des Kästchens um und aktivierte damit dessen Skriben. Obwohl keine Veränderung ersichtlich war, wusste sie, dass das Kästchen jetzt das Sonnenlicht vom Himmel zum Meer umlenkte, allerdings in einer ganz anderen Farbe, die nur ein bestimmtes Wesen erkennen konnte. »So. Das Signal ist gesetzt.« Sie zückte erneut ihr Fernrohr und blickte zum fernen Schiff. »Hoffentlich bemerken sie es schnell. Wenn Tevanne in diesem Wirt ist und mich gesehen hat, haben wir höchstens zwei Tage Zeit, um Tausende unschuldige Menschen zu evakuieren. Wir müssen uns beeilen.« Berenice beobachtete den Flecken am Horizont und wartete darauf, dass er sich bewegte.
»Wenn Tevanne kommt«, sagte Claudia, »wird sie sicher ein Todesschiff schicken.«
Berenice spürte, wie ein kalter Angstschauer ihren Trupp durchlief. Auch sie zitterte und blickte instinktiv zum Himmel im Norden, als ob sie damit rechnete, ein solches Schiff in den Wolken schweben zu sehen. »Ja. Ziemlich sicher.«
»Verrogelte Hölle«, murmelte Vittorio.
»Mir ist aufgefallen, dass du dem Gouverneur nichts von ihnen erzählt hast«, sagte Claudia.
»Wir wollten, dass er unsere Hilfe annimmt.« Berenice blickte durch das Fernrohr zur Galeone. »Nicht dass er völlig verzweifelt.«
Der winzige Punkt am Horizont regte sich, dann drehte er ganz langsam bei.
»Sie fahren los. Auf geht’s.« Berenice senkte das Fernrohr und lief die Treppe hinunter. »Claudia, du kommst mit. Wir säubern den Jungen. Ihr anderen holt eure Waffen am Tor des Bergfrieds, dann holt ihr das Waffenarsenal, das wir an der Küste versteckt haben. Bringt es zu den äußersten Mauern. Ich rede mit dem Gouverneur, damit wir eine Verteidigung aufbauen können.«
»Ich dachte, wir haben zwei Tage Zeit, bis Tevanne hier ist?«, hakte Diela erstaunt nach. »Warum sollen wir uns zuerst auf die Belagerung einrichten?«
»Wieso hat Giva so lange durchgehalten, Diela?«, fragte Berenice in lehrmeisterlichem Ton.
»Hm … weil wir nachdenken, begreifen, notfalls Opfer bringen und einander unsere Tage und Stunden schenken?«, fragte Diela.
Berenice setzte den Helm auf und schnallte ihn fest. »Aber auch, weil wir gottverdammt paranoid sind. Also, komm mit.«
Auf der Galeone öffnete Sancia ihre Augen in der Finsternis.
Sie lauschte auf das Knarren, Ächzen und das tropfende Wasser im kaum erhellten Schiffsinneren. Alles um sie herum vibrierte: der Boden, die Rumpfwände, die Luken. Alles bebte, während das große Schiff durch die Gewässer der Durazzo-See fuhr.
Sie blinzelte und versuchte, sich zu erinnern, wo sie war und was sie hier tat.
Ich bin schon mal durch so ein Schiff geschlichen, dachte sie, und habe einen schlafenden Teufel darin gefunden.
Sancia richtete den Blick auf die Kammer zu ihrer Rechten: eine riesige Blase aus Stahl und Glas, die im Bauch des Schiffes schwebte und ein komplexes bewegliches Gerät enthielt. Es sah aus wie ein umgekippter Stapel riesiger Münzen.
Ein Lexikon: eine Vorrichtung, die die Realität dazu bringen konnte, sich selbst zu widersprechen, und das Einzige, was das Schiff über Wasser hielt.
Nur bin ich diesmal hier drin, dachte sie, während der Teufel draußen die Welt verschlingt.
Sie stand auf und näherte sich der Glaswand. Dahinter ragte ein kleiner goldener Schlüssel aus einem Mechanismus an der Seite des Lexikons.
Sie berührte die Zwillingsplakette, die sie an einer Schnur um den Hals trug. Eine Präsenz erklang in ihrem Kopf, intelligent und synkopisch: »Alles gut, Kind?«
»Ja, Clef«, erwiderte Sancia. »Ich warte nur. Was weder schwer noch aufregend ist, im Vergleich zu dem, was du tust.«
»Ich schiebe nur dieses große Stück Müll durchs Wasser. Ärgere ein paar Schweinswale. Und ein paar Möwen. Igitt … Mistviecher! Sie kacken mich ständig an, ich spüre es.«
»Kein Signal von Grattiara?«
»Bis jetzt nicht«, antwortete Clef. »Ich hoffe, Ber hat eine schöne Zeit. Vielleicht bekommt sie Tee oder diese leckeren kleinen Kekse, die man hier immer serviert.«
»Was kümmert es dich, wie ein Keks schmeckt, Clef?«, fragte Sancia.
»Hey, ein Schlüssel darf doch wohl träumen, oder?«
Sancia hielt die Plakette noch ein wenig länger umfasst. Obwohl man sie »Geistplakette« nannte – ein Begriff, der fast arkane Kräfte suggerierte –, war sie mit den schlichtesten Skriben an Bord versehen und kaum mehr als ein Stück hitzebeständiger Stahl, der mit dem Objekt neben Clef im Lexikon gekoppelt war.
Normalerweise konnte Sancia seine Stimme nur hören, wenn sie ihn am Leib trug. Doch da sie den Zwilling der Geistplakette berührte, deren Skriben ihr weismachten, zugleich Clef und Sancia zu berühren, konnte sie seine körperlose Stimme auch über große Entfernung hinweg hören.
Wie die Glieder einer Kette, dachte sie abwesend.
Sie stand im Dunkeln und stellte sich vor, was Berenice und ihr Trupp jetzt taten: Womöglich sprachen sie mit dem Gouverneur und trugen leidenschaftlich ihre Argumente vor. Oder sie hatten sie verraten – die Morsinis waren schon immer dumme Bastarde gewesen –, und sie kämpften darum, die Festung unter Kontrolle zu bringen.
Immerhinkann die Einnahme von Grattiara kaum schwerer sein als die anderen Dummheiten, die wir angestellt haben, dachte sie.
Wie sehr ihre Knochen schmerzten! Wie sie es hasste, in der Dunkelheit des Schiffes festzusitzen!
»Hey, es ist auch schön, mit dir hier zu sein, Kind«, sagte Clef.
»Hm? Oh. Tut mir leid.« Sancia vergaß oft, dass Clef die Geistwanderung viel besser beherrschte als Menschen. Obwohl Letztere seine Emotionen normalerweise nicht lesen konnten, schnappte er ihre Gedanken und Gefühle auf, ohne dass sie es merkten.
Sie sah ihn böse an. »Du weißt ganz genau, dass nicht du das Problem bist.«
»Ja, ich weiß.«
»Ich bin bloß deine Fracht. Etwas, das du beschützt, während woanders wirklich Gefahr droht.«
»Und du weißt, dass du damit meine gesamte Beziehung zu dir umschreibst, oder?«, erwiderte Clef. »Ich hab ein verdammtes Jahr lang an deinem Hals gehangen. Wenigstens hattest du immer Arme und Beine und, du weißt schon, ein Geschlechtsteil und so.«
Sancia grinste. »Das stimmt wohl. Ich genieße es, all das zu haben.« Ihr Grinsen verblasste. »Ich hab eben nur geglaubt, in einem Skriber-Krieg zu kämpfen würde …«
»… mehr wie ein richtiger Kampf sein ?«
»Ja.« Sie spürte hinter sich eine Präsenz – Polina näherte sich von unten. Sancia drehte sich um und sah sie aus dem Gang treten, wie immer mit strenger Miene und zusammengekniffenen Augen.
»Hallo, Pol«, sagte Clef. »Wie war die Reise? Einer deiner Ärzte scheint unter einem heftigen Anfall von Seekrankheit zu leiden. Es würde mich ja nicht so sehr stören, wenn er mir nicht ständig auf die Planken kotzen würde.«
»Halt die Klappe, Schlüssel«, schnauzte Polina. Sie verabscheute es zutiefst, Clefs Stimme im Kopf zu hören. Auch sie trug eine Zwillingsplakette, die sie mit Sancia verband, daher bekam sie alle Unterhaltungen der beiden mit.
Mehr Glieder, dachte Sancia. Und eine viel, viel längere Kette.
Polina nickte ihr gebieterisch zu. »Wie lange sind sie fort?«
»Du weißt, dass du nicht in meiner Nähe sein musst, um mit mir zu reden, oder?«, fragte Sancia. »Das ist im Grunde der Sinn von Geistwanderung.«
»Ist mir bewusst«, antwortete Polina. »Trotzdem ziehe ich es vor, dich aufzusuchen und mich auf normale Weise mit dir zu unterhalten – damit ich menschlich bleibe.«
»Wir sind alle noch Menschen, Polina«, meinte Sancia seufzend. »Wir reden nur ein bisschen anders, das ist alles.«
»Sag das den Wirten in Tevannes Armee. Wie lange?«
Sancia musterte Polina. Zu ihrer Enttäuschung hatte sie sich in den acht Jahren, seit sie dem Tod und Verderben entkommen waren, kein bisschen verändert: Nach wie vor hatte sie ein wettergegerbtes Gesicht, stechende graue Augen und das Haar zu einem festen Dutt hochgesteckt. Polina schien wie dafür gemacht zu sein, in düstere Katastrophen zu segeln und zu überleben.
»Berenice und ihr Trupp sind seit zwei Stunden an Land«, erwiderte Sancia. »Es ist noch viel zu früh, um sich Sorgen zu machen.«
Polinas allgegenwärtiges Stirnrunzeln verstärkte sich. »Mir gefällt das nicht. Wir haben schon mal versucht, mit diesen Idioten vom Handelshaus zu reden. Sklavenhalter zur Vernunft zu bringen ist ungefähr so sinnvoll, wie mit diesem … diesem Ding zu diskutieren.« Sie schauderte.
»Wenn es funktioniert, retten wir Tausende von Leben«, sagte Sancia laut, damit Polina ihre Verärgerung mitbekam.
»Tausende von Menschen. Wie viele kann die Schlüsselwacht aufnehmen?«
»Sie ist eine Galeone von Haus Dandolo«, sagte Clef. »Hier passen etwa dreitausend Passagiere rein.«
Polina schüttelte den Kopf. »So viele haben wir noch nie in einer einzigen Operation nach Giva gebracht. Das wird ja eine tolle Heimreise – sofern alles gut geht.«
»Tevannes Truppen sind auf der anderen Seite der Halbinsel«, sagte Sancia. »Dutzende von Festungen liegen zwischen Grattiara und ihnen. Solange sich die Armee nicht plötzlich in die Luft schwingen und herfliegen kann, bleiben uns noch ein paar Stunden Zeit.«
»Stimmt«, sagte Polina. »Aber das alles macht mich nervös. Wenn ein Hirte versucht, ein verlorenes Lamm zu retten, ist der Rest der Herde am meisten gefährdet.« Sie kehrte unter Deck zurück. Sancia spürte ihre Präsenz wie ein Stück warmen Boden unter den nackten Fußsohlen.
»Zumindest ist es gut zu wissen, dass ihr euch trotz Geistwanderung nicht verändert«, sagte Clef. »Denn sie benimmt sich immer noch so lächerlich wie …«
»Ich kann dich hören, verdammt!«, schnauzte Polina. »Ich bin nicht so weit weg!«
»Ja, ja«, brummte Clef.
Sancia seufzte.
»Kopf hoch, Kleine«, sagte Clef.
»Du hältst jetzt doch nicht etwa irgendeine blöde Rede, oder?«
»Nein. Denn du musst dich konzentrieren. Bei den Mauern des Bergfrieds regt sich was.«
Sancia setzte sich auf. »Ist das gut oder schlecht?«
»Wenn ich das wüsste. Aber es tut sich was.«
Sie griff nach der Geistplakette um ihren Hals. »Zeig’s mir.«
»Gib mir eine Sekunde. Ich ziehe dich rein.«
Es war ein merkwürdiges Gefühl, als Clef gewissermaßen an ihre Gedanken klopfte. Sie willigte ein, öffnete ihren Geist für ihn und sah … die riesige Bucht von Grattiara vor sich, die gewaltige Festung auf den Klippen, die armseligen, rauchenden Lager auf den Hängen. Der Anblick strömte aus Dutzenden Quellen in ihre Gedanken, über die vielen Sensoren und Sehhilfen, die sie für Clef auf dem Schiff installiert hatten. Einige Eindrücke konnte sie nicht ganz nachvollziehen, da Clef die Realität mit Sinnen erfasste, die ihr Gehirn nicht zu interpretieren wusste. Daher konzentrierte sie sich auf eine spezielle Vision und musterte Grattiara aus der Ferne.
Sie blickte auf die Brüstungen der äußeren Mauern, dann hinauf zum höchsten Hügel, auf dem der Bergfried stand. Dort, auf der Spitze eines Turms, bewegte sich eine kleine Gruppe von Menschen.
»Gottverdammt«, sagte Sancia. »Du kannst weit sehen, Clef.«
»Ich nicht. Aber das Schiff und der ganze Mist, den ihr eingebaut habt. Meine Sicht reicht nicht aus, um zu erkennen, ob das Ber ist, aber …«
»Da ist das Signal!«, rief Sancia.
Die Spitze des Turms leuchtete plötzlich in rötlich grünem Licht auf – ein Licht, das menschliche Augen niemals wahrnehmen würden. Die Vorrichtungen auf der Schlüsselwacht hingegen waren eigens zu diesem Zweck skribiert worden.
»Sie hat es geschafft«, meinte Clef staunend. »Verdammt. Das ging ja schnell.«
»Dann lass uns aufbrechen«, entgegnete Sancia. »Aber bleib wachsam, nur für den Fall.«
»Verstanden.«
Sie löste sich aus der Vision und fiel in ihren eigenen Körper zurück. Dann spürte sie, wie ein Ruck durch das Schiff ging, als es beidrehte. Es war nach wie vor seltsam zu wissen, dass Clef es steuerte. Er war schon immer unglaublich geschickt darin gewesen, skribierte Objekte zu manipulieren. Doch ihn in einem Lexikon zu platzieren, das eine Kriegsgaleone kontrollierte, ließ ihn im Grunde selbst zu dem Schiff werden. Sein Bewusstsein durchdrang jedes Werkzeug am Rumpf – einschließlich des Rumpfs selbst, der natürlich ebenfalls skribiert war. Der Name der Galeone ging sogar auf diese bizarre Kopplung zurück: Für die Givaner war sie die Schlüsselwacht, ob Clef sie nun steuerte oder nicht.
Dass er jeden Aspekt dieses unergründlich komplizierten Schiffes kontrollieren musste, schien ihn nicht sonderlich zu stören. Das Einzige, worüber er sich beklagte, war, dass er auch die Latrinen reinigen musste.
Sancia lehnte sich wieder an die Wand der Lexikonkammer. Ich bin auf einem Geisterschiff, dachte sie, auf dem mein Freund spukt.
Sie lauschte dem Knarren der Galeone. Seltsam, dass sie einen Krieg gegen ein ähnliches Gebilde führten, das nur in viel größerem Maßstab funktionierte: Es war ein gewaltiger Verbund aus skribierten Werkzeugen, Schöpfungen und Wirten, alle gelenkt von einem Geist, der gewissermaßen einmal Sancias Freund gewesen war.
»Du denkst wieder an ihn«, sagte Clef.
»Ich weiß.«
»Vieles hat sich verändert. Auch er.«
»Ich weiß!«
»Er würde wollen, dass du das hier tust.«
Sancia sah ihr Spiegelbild in der Glaswand des Lexikons. Sie wusste, dass sie in Wahrheit noch keine dreißig Jahre alt war. Die Frau mit dem grau melierten Haar jedoch, den faltigen Augen und den Altersflecken, die sich in der Glaswand spiegelte, war weit über fünfzig.
Sie schloss die Augen.
»Ich weiß, Clef. Ich weiß, wie sehr sich alles verändert hat.«
Berenice und ihr Trupp teilten sich auf, als sie die untere Etage des Bergfrieds erreichten. Vittorio und Diela machten sich auf den Weg in die Stadt, während Berenice und Claudia zu den Sitzungsräumen des Gouverneurs gingen.
»Baut alles auf und sagt mir, wenn ihr was Ungewöhnliches seht«, befahl Berenice, während sie durch die engen Gänge eilten.
»Was gilt denn als ungewöhnlich, Capo?«, fragte Vittorio.
»Alles, verdammt noch mal! Tevanne kennt diese Stadt vermutlich in- und auswendig. Jeder Hinweis darüber, wie viel sie weiß, wäre hilfreich.«
Berenice war sich bewusst, dass ihr Vorteil begrenzt war. Tevannes wertvollste Einheit – die Monstrositäten, denen Sancia den Spitznamen »Todesschiffe« gegeben hatte, obwohl die neueren Versionen überhaupt nicht wie Schiffe aussahen – brauchten weder Sabotage noch Spione, um erfolgreich zu sein. Eine Waffe, die eine Kleinstadt in Sekundenschnelle auslöschen konnte, war im Vorfeld nicht auf Aufklärung angewiesen.
»Diela«, sagte Berenice. »Bau den Todesschiff-Detektor auf, sobald du vor Ort bist. Ich will wissen, wenn sich eine dieser Abscheulichkeiten in einem Radius von sechs Kilometern um uns herum befindet.«
»Verstanden, Capo.« Obwohl Diela nicht mehr in der Nähe war, hörte Berenice ihre Stimme nach wie vor deutlich in ihrem Kopf.
Sie kehrte mit Claudia in den großen Sitzungssaal zurück. Ein paar von Maltis Skribern und Söldnern lungerten dort noch herum, der Gouverneur selbst jedoch war nicht anwesend.
»Der Gouverneur wird in Kürze zurück sein«, sagte ein Mitglied des Gefolges. »Er bittet Euch darum, in der Zwischenzeit hier zu warten.«
Claudia lehnte sich mit verschränkten Armen an den großen Kartentisch. »Wenn Tevanne wirklich ein Todesschiff schickt«, sagte sie, »was, zum Teufel, sollen wir dann tun? Die Kreischer fügen ihm nicht mal eine Delle zu – falls wir es überhaupt treffen.«
»Am besten sind wir schon weg, bevor sie hier ankommt«, erwiderte Berenice.
»Und wenn wir noch hier sind?«
»Clef«, antwortete Berenice schlicht.
Claudia starrte sie an. »Was, zum Teufel? Ber, das ist uns bisher erst einmal gelungen!«
»Also ist es grundsätzlich möglich«, hielt Berenice dagegen. »Somit können wir’s noch mal schaffen.«
Ein langer, schrecklicher Schrei hallte durch den Bergfried.
Im Versammlungsraum wurde es still. Berenice und Claudia richteten sich auf. Sie blickten aufmerksam zur Tür, die zu den Privaträumen des jungen Mannes führte.
»Was war das?«, fragte einer der Skriber nervös. »Das klang wie ein … ein …«
Die beiden Frauen sahen einander an.
»Das kam von …«, sagte Claudia.
»Von dahinten, ganz sicher«, vollendete Berenice den Satz.
Sie rannten zur Tür, rissen sie auf und eilten den Gang entlang.
Als sie das Zimmer des Gouverneurssohns erreichten, standen fast ein Dutzend Söldner vor der offenen Tür und stierten mit staunenden Mienen hinein. Obwohl Berenice einen Kopf kleiner war als die meisten von ihnen, drängte sie sich an ihnen vorbei und spähte ins Zimmer.
Das Himmelbett war leer. Malti und die Frau, die sich um seinen Sohn gekümmert hatte, lagen mit aufgeschlitzten Kehlen auf dem blutdurchtränkten Teppich.
Berenice musterte den Gouverneur. Das skribierte Rapier an seiner Seite fehlte. Er war dem Tode nahe, Blut floss aus der durchtrennten Kehle. Mit traurigem Schrecken im Blick streckte er ihr die Hand entgegen, doch dann erschlaffte sein Arm, und seine Blick war leer.
»Scheiße«, sagte Berenice laut. »Scheiße, Scheiße, Scheiße!«
»Blut«, meldete Claudia. »Hier draußen auf dem Boden.«
Berenice drängte sich an der Söldnerschar vorbei und trat zu ihr in den Gang. Claudia blickte auf die Spritzer und zeigte den Korridor entlang. »Er ist in diese Richtung geflohen. Oder sie.«
»Vittorio, Diela«, sagte Berenice. »Bestätigt, dass ihr das hier mitbekommen habt.«
»Bestätigt, Capo.« Vittorios Stimme war noch immer klar zu hören, wenn auch schwächer als zuvor – eine Folge der Entfernung zwischen ihnen.
»Verdoppelt euer Tempo. Tevanne muss in der Nähe sein.«
»Bestätigt, Capo«, sagte Diela mit zittriger Stimme.
Berenice griff in ihren Stiefel und zog einen der drei Säuberungsstäbe heraus, die sie darin aufbewahrte. Es war ein winziges Ding, das eher an einen Meißel als an eine Waffe erinnerte. Claudia tat es ihr nach und hielt ihren Stab wie einen Dolch vor sich. Dann rannten sie in die dunklen Gänge und folgten den Blutflecken auf dem Boden.
»Tevanne steckt in ihm«, sagte Claudia. »Sie hat ihn benutzt. Sie war wirklich hier.«
»Ist sie noch immer«, knurrte Berenice. »Wir müssen sie fangen, bevor sie die Stadt weiter schwächen kann.«
Sie bogen links ab, dann rechts und wieder links. Die Geräusche im Bergfried wurden leiser und verklangen schließlich ganz.
»Also ist Tevanne nicht weit«, sagte Claudia, »aber sicher ist nur eine kleine Streitmacht in der Nähe, oder? Weniger als ein Dutzend Wirte. Es kann sich doch unmöglich eine ganze Armee hinter einer Bergkuppe verstecken!«
»Claudia, ich hab keine Ahnung.«
Noch eine Abzweigung, dann noch eine. Schließlich hielten sie inne: In einem nahen Gang war etwas zu hören, ein leises, unbeholfenes Schlurfen.
»Jetzt wünschte ich, wir hätten richtige Waffen«, sagte Claudia, »statt – du weißt schon – die kleinsten Messer der Welt.«
»Wenn wir jetzt unsere Arbalesten rufen, würden sie uns nie erreichen, stimmt’s?«, fragte Berenice.
Claudia schüttelte den Kopf. »Wir müssen in Sichtweite sein. Sie schaffen es nicht durch all diese Gänge.«
Sie erreichten eine Ecke. Das Schlurfen war jetzt sehr laut, noch dazu war nun ein gleichmäßiges leises Kratzen zu hören wie von einer Nadel auf einer Schultafel. Berenice drückte sich mit dem Rücken an die Wand und spähte um die Ecke.
Eine Gestalt schlurfte humpelnd den Gang hinunter, weg von ihnen. Sie konnte kaum etwas sehen – das Licht war matt, und am Ende des Ganges befand sich nur ein Buntglasfenster. Dennoch glaubte sie, ein Rapier in der Hand der Gestalt zu erkennen, dessen Spitze über den Boden schleifte.
Berenice kniff die Augen zusammen und dachte nach. »Claudia, sag mir, dass wir unsere Rüstung verstärkt haben, damit sie einem skribierten Rapier standhält.«
»Einer normalen Morsini-Klinge?«, hakte Claudia nach. »Sicher. Aber … Mist, ich würde es nicht drauf ankommen lassen.«
Berenice trat in den Gang, den Säuberungsstab in der rechten Hand wie einen Dolch erhoben, und folgte der Gestalt.
Die hielt in der Bewegung inne und drehte sich langsam um. Ihr Gesicht war im trüben Licht nicht zu sehen, doch offenbar musterte sie die Verfolgerin.
Berenice ging weiter, die linke Armschiene erhoben, um jeden Schlag abzufangen, den Säuberungsstab in der rechten.
Doch die Gestalt rührte sich nicht. Erst als sie sich ihr bis auf drei Meter genähert hatte, beugte sie sich schließlich vor und flüsterte: »Ssaaanciaa !«
Berenice bekam eine Gänsehaut. »Verrogelte Hölle!«
»Ich bin hinter dir«, sagte Claudia, »bleibe aber auf Abstand.«
Berenice näherte sich vorsichtig, die Augen auf das Rapier in der Hand des Geschöpfs gerichtet. Sie hatte schon früher gegen Wirte gekämpft und wusste, dass sie oft verwirrt und dumm wirkten – aber nur, solange ihr Meister ihnen keine Aufmerksamkeit widmete. Wenn Tevanne wollte, konnten sich ihre Wirte blitzschnell bewegen.
Dieser Wirt jedoch stand da wie erstarrt und stierte sie einfach nur an, während sie sich langsam näherte. Plötzlich stürzte er sich auf sie.
Das Rapier blitzte auf und sauste auf ihren Hals zu.