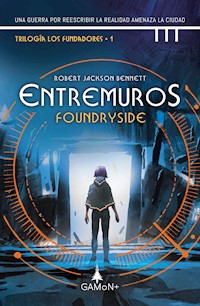4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die göttlichen Städte
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Seit dreizehn Jahren wartet Sigrud je Harkvaldsson im Exil darauf, dass sein Name vom Vorwurf des Verrats reingewaschen wird und seine alte Gefährtin Shara ihn zurück in ihren Dienst ruft. Nun ist es dafür zu spät, denn Shara Komayd, ehemalige Premierministerin von Saypur, ist tot - ermordet von einem skrupellosen Attentäter.
Dürstend nach Rache, schlägt Sigrud alle Vorsicht in den Wind und reist nach Ahanashtan, um die Fährte des Mörders aufzunehmen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 826
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
1. Gefällte Riesen
2. Vorboten des Krieges
3. Drecksarbeit
4. Weißt du nicht, dass wir uns im Krieg befinden?
5. Alles, was ich noch hatte
6. Alte Heimat
7. Alte Bekannte
8. Zielübungen
9. Zu viel Nacht, zu wenig Mond
10. Eine Straße durch den Himmel
11. Traumlandschaften
12. Botschafter
13. Der Mann ohne Hoffnung
14. Götterdämmerung
15. Göttin der Zeit
16. Mach die Augen zu. Wenn du morgen früh aufwachst, werde ich da sein
Über das Buch
Seit dreizehn Jahren wartet Sigrud je Harkvaldsson im Exil darauf, dass sein Name vom Vorwurf des Verrats reingewaschen wird und seine alte Gefährtin Shara ihn zurück in ihren Dienst ruft. Nun ist es dafür zu spät, denn Shara Komayd, ehemalige Premierministerin von Saypur, ist tot – ermordet von einem skrupellosen Attentäter.
Dürstend nach Rache, schlägt Sigrud alle Vorsicht in den Wind und reist nach Ahanashtan, um die Fährte des Mörders aufzunehmen …
Über den Autor
Robert Jackson Bennett wurde 1984 in Baton Rouge, Louisiana, geboren und wuchs in Texas auf. Er studierte an der University of Texas in Austin, wo er auch heute noch mit seiner Frau und seinem Sohn lebt. Für seine Romane hat er bereits zahlreiche Preise erhalten, darunter zweimal den begehrten SHIRLEY JACKSON AWARDS in der Kategorie ›Bester Roman‹ sowie eine PHILIP K. DICK AWARD CITATION OF EXCELLENCE.
ROBERT JACKSON BENNETT
DIE STADT DER TRÄUMENDEN KINDER
Roman
Aus dem Amerikanischen von Eva Bauche-Eppers
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2017 by Robert Jackson BennettPublished by Arrangement with Robert Jackson BennettTitel der amerikanischen Originalausgabe: »City of Miracles«Originalverlag: Broadway Books, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House LLC, a Penguin Random House Company, New York
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Michelle Gyo, Limburg an der LahnTitelillustration: © Katarzyna OleskaUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5015-9
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für Harvey:Hallo, Baby. Willkommen auf der Erde. Dieser Ort ist ziemlich klasse, und ich empfehle dir, eine Weile zu bleiben. Man weiß nie, vielleicht könnte es sogar noch besser werden. Vielleicht. Wenigstens bemühen wir uns. Wir bemühen uns.
Alle politischen Karrieren enden mit einer Niederlage.Manche Karrieren sind lang, andere nur kurz. Manche Politiker treten still und würdevoll ab, andere mit einem Eklat.Aber beliebt oder verhasst, mächtig oder schwach, weitblickend oder kurzsichtig, einflussreich oder unbedeutend – früher oder später endet jede politische Karriere mit einer Niederlage.
AUSSENMINISTERIN VINYA KOMAYD IN EINEM BRIEF AN PREMIERMINISTERIN ANTA DOONIJESH, 1711
1. Gefällte Riesen
Die Haltung des jungen Mannes drückt erst eisige Ablehnung aus, dann besinnt er sich doch auf seine gute Kinderstube, als Rahul Khadse ihn anspricht und um eine Zigarette bittet. Augenscheinlich hat der junge Mann gehofft, hier in der Gasse hinter dem Hotel ungestört seine Pause verbringen zu können, kostbare Minuten der Erholung von seinen beruflichen Pflichten, und die Störung ärgert ihn. Ebenso augenscheinlich sind die beruflichen Pflichten des jungen Mannes gewichtiger Natur: die schwarze, schmal geschnittene Dreivierteljacke, die schwarzen Stiefel, die tief gebräunte Haut und das schwarze Kopftuch weisen ihn als Militärangehörigen oder Agenten einer Spezialeinheit der Polizei aus, auf jeden Fall ist er jemand, der entweder vom saypurischen Staat oder dem Kontinent dafür bezahlt wird, dass er bewacht und beschützt.
Doch der junge Mann glaubt, nicht vor Rahul Khadse auf der Hut sein zu müssen, mustert ihn vielmehr mit einer gewissen Herablassung. Und wer wollte es ihm verdenken, weshalb sollte er diesen alten Knaben mit der verschmierten Brille, der abgeschabten Aktentasche und dem verwaschenen, schlecht gebundenen Kopftuch auch als potenziell gefährlich einstufen?
»Na gut«, sagt der junge Mann resigniert. »Warum nicht.«
Khadse deutet eine Verbeugung an. »Danke, junger Herr. Vielen Dank.« Er verneigt sich nochmals, etwas tiefer, als der junge Mann in die Jacke greift, um sein Zigarettenetui herauszuholen.
Der junge Mann bemerkt nicht, dass Khadses Blick seiner Hand in die Jacke folgt, dort den Kolben der Pistole entdeckt, der aus dem Schulterhalfter ragt. Er bemerkt nicht, dass Khadse seine Aktentasche behutsam auf den Boden stellt oder dass, während er in seiner Demutshaltung verharrt, die rechte Hand nach hinten zur Hüfte wandert und das Messer zieht. Er bemerkt auch nicht, dass er selbst es Khadse ermöglicht, den entscheidenden Schritt näher zu kommen, indem er ihm das aufgeklappte Zigarettenetui hinhält.
Er bemerkt es nicht, weil er jung ist. Und die Jungen sind immer so bedauernswert unbedarft.
Der junge Mann reißt die Augen auf, als die Messerklinge exakt zwischen der fünften und sechsten Rippe linksseitig in seinen Brustkorb dringt, die Lunge durchsticht und den Herzbeutel kitzelt. Khadse lehnt sich nach vorn, legt die linke Hand über den offenen Mund des jungen Mannes und rammt ihm den Hinterkopf gegen die Ziegelmauer.
Der junge Mann wehrt sich, und er ist stark, aber diesen Tanz kennt Rahul Khadse nur allzu gut. Ohne das Messer loszulassen, tritt er rechts neben den jungen Mann, zieht halb abgewendet die Klinge heraus und springt, als sein Opfer an der Mauer herunterrutscht, behände zur Seite, um nicht von dem Blutschwall getroffen zu werden.
Der junge Mann röchelt, und Khadse schaut sich in der Gasse um. Es ist ein regnerischer Tag in Ahanashtan, trist und neblig, wie oft zu dieser Jahreszeit, und es sind nur wenige Menschen unterwegs. Von diesen wenigen beachtet keiner den abgerissenen alten Mann in der Gasse hinter dem Hotel Golden, der über seine Brille hinweg kurzsichtig in die Gegend blinzelt.
Der junge Mann ringt nach Atem. Hustet. Khadse legt das Messer hin, kniet sich breitbeinig über den Sterbenden, krallt eine Hand in sein Gesicht und schmettert den Kopf gegen die Mauer, wieder und wieder und wieder.
Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen.
Als der junge Mann sich nicht mehr rührt, streift Khadse braune Handschuhe über und durchwühlt seine Taschen. Die Pistole entlädt er und wirft sie weg – er benutzt selbstredend seine eigene Waffe – und sucht weiter, bis er gefunden hat, was er braucht: einen Hotelschlüssel mit der Zimmernummer 408.
Der Schlüssel ist voller Blut. Er wischt ihn an den Kleidern des Toten ab, dann auch das Messer, und steckt beides ein.
Das war leicht, denkt Khadse.
Jetzt kommt der schwierige Teil. Oder das, was gemäß der Behauptung seines Auftraggebers der schwierige Teil sein soll. Offen gesagt fällt es Khadse einigermaßen schwer zu unterscheiden, welche Anweisungen seines Auftraggebers er ernst nehmen soll und welche ignorieren. Warum? Nun, weil Rahul Khadse der Meinung ist, dass sein derzeitiger Auftraggeber nicht alle Tassen im Schrank hat. Verrückt ist. Übergeschnappt. Ballaballa.
Man muss schon verrückt sein, um einen Auftragsmörder, denn nichts anderes ist Khadse, auf eine der umstrittensten politischen Persönlichkeiten dieser Zeit anzusetzen, eine Frau, die so geachtet, so prominent und so einflussreich ist, dass die ganze Welt mit angehaltenem Atem das Urteil der Geschichte abwartet, bevor man sich an eine kritische Analyse ihrer Amtszeit als Premierministerin heranwagt.
Eine Gestalt aus dem Stoff, aus dem Legenden sind. Zum einen, weil schon ihre Abstammung Legende ist, zum anderen, weil sie, wie allgemein bekannt, zu ihrer Zeit höchstselbst einige Legenden getötet hat.
Möglicherweise ist auch Khadse nicht bei klarem Verstand gewesen, als er sich auf die Sache eingelassen hat. Oder die Herausforderung hat ihn gereizt. Wie dem auch sei, er ist entschlossen, den Auftrag auszuführen.
Rahul Khadse geht zur Gassenmündung, biegt dann nach rechts ab auf die Hauptstraße und steigt die Treppe zu Ashara Komayds Hotel hinauf.
*
Das Hotel Golden ist eine der ersten Adressen in Ahanashtan, hochgerühmtes Relikt einer Ära, in der Saypur als Siegermacht auf dem Kontinent nach Belieben schalten und walten, Blockaden und Embargos verhängen und den verarmten Einheimischen Prunkbauten vor die Nase setzen konnte.
Man tritt ein und wähnt sich in die Vergangenheit versetzt, in das glanzvolle, feudale Saypur, wie Khadse es gekannt hat, auch wenn es ein wenig nach Mottenkugeln riecht, wie ein ausgestopfter Vogel im Naturkundemuseum.
Khadse bleibt im Foyer stehen und tut so, als müsse er seine Brillengläser putzen. Marmorfußböden, Bronzebeschläge und Topfpalmen. Er zählt die anwesenden Personen: der Portier, der Empfangschef des Restaurants, ein Zimmermädchen, drei junge Damen an der Rezeption. Keine Wachen. Jedenfalls keine Kollegen des jungen Mannes, der eben in der Gasse hinter dem Hotel sein Leben ausgehaucht hat. Khadse ist ein alter Hase und hat seine Hausaufgaben gemacht. Er kennt den Einsatzplan der Sicherheitskräfte, weiß, wie viele es sind und wo sie postiert sind. Seine Leute haben das Hotel über Wochen hinweg observiert und jeden Schritt dieser diffizilen Unternehmung vorbereitet. Doch von jetzt an ist er auf sich allein gestellt.
Er geht die Treppe hinauf, vom Saum seines langen Mantels tropft Regenwasser. Bis hierher ist alles glattgegangen. Khadse bemüht sich, nicht an seinen Auftraggeber zu denken, an dessen Marotten, das Geld. Normalerweise denkt Khadse mit großem Vergnügen an die pekuniäre Seite eines Auftrags, aber diesmal nicht.
Hauptsächlich, weil die Summe unvorstellbar ist, selbst für Khadse, der sich problemlos sehr hohe Summen vorstellen kann und tatsächlich in seiner Freizeit kaum etwas anderes tut. Er arbeitet nicht zum ersten Mal für diesen Auftraggeber und wurde immer großzügig entlohnt, aber wo die Grenze der Verhältnismäßigkeit überschritten wird, sollte der kluge Mann anfangen, sich Sorgen zu machen.
Und die Bekleidungsvorschriften – sehr, sehr merkwürdig.
Denn als Khadse sich seinerzeit die erste Vorauszahlung abholte, fand er neben dem Geld einen zusammengefalteten schwarzen Mantel und ein Paar blankpolierte schwarze Schuhe sowie einen Brief mit der strikten Anweisung, bei der Ausführung aller künftigen Unternehmungen diese Kleidungsstücke zu tragen, ausnahmslos. Der Tenor der Instruktionen ließ keinen Zweifel daran, dass eine Zuwiderhandlung seinen Tod zur Folge hätte.
Was soll’s, hatte Khadse gedacht. In Ordnung. Mein neuer Auftraggeber ist eben verrückt. Ich habe schon früher für Verrückte gearbeitet. Ist halb so schlimm. Dann aber probierte er die Sachen an und stellte fest, dass sowohl der Mantel wie auch die Schuhe passten wie nach Maß gefertigt, und das war schon ein bisschen beunruhigend, weil Khadse seinem neuen Auftraggeber noch nie begegnet war, geschweige, dass er ihm seine Schuhgröße verraten hätte.
Er bemüht sich, nicht darüber nachzudenken, während er die Treppe in Angriff nimmt. Will nicht daran denken, dass er auch jetzt – natürlich – genau diese Kleidungsstücke anhat, so formell, so schwarz, so perfekt. Will nicht daran denken, wie absurd das Ganze ist oder an die Forderung des Auftraggebers, Khadse solle die Tat allein ausführen, ohne seine üblichen Helfer im Schlepp.
Die dritte Etage. Noch eine Treppe höher, dann ist er am Ziel.
Ich hätte diesen verdammten Auftrag bestimmt nicht angenommen, denkt er, wenn es nicht um die Komayd ginge. Und das ist die reine Wahrheit: Als Ashara Komayd Premierministerin wurde, siebzehn Jahre ist das her, bestand ihre erste Amtshandlung darin, sämtliche Verfechter einer Politik der eisernen Faust aus dem Ministerium für äußere Angelegenheiten zu entfernen. Solche wie Khadse, die in den unruhigen Zeiten viel erlebt hatten, auch viel Unschönes.
Er erinnert sich noch wortwörtlich an ihr Memo, diese wichtigtuerische, gespreizte Ausdrucksweise, die Komayd kultiviert hat: Wir müssen nicht nur bedenken, was wir tun, sondern auch, wie wir es tun. Demzufolge wird unser Haus eine Phase der Umstrukturierung durchlaufen, wir werden uns von Grund auf neu organisieren, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Im Klartext hieß das, Ashara Komayd befreite sich von Altlasten, setzte jedem, der von ihrer Tante und Amtsvorgängerin Vinya Komayd rekrutiert worden war, eiskalt den Stuhl vor die Tür – und Khadse war immer einer von Vinyas Favoriten gewesen.
Von einer Minute zur anderen stand er nackt im kalten Wind, arbeitslos nach einem Jahrzehnt treuer Dienste, und im Handumdrehen vergessen. Auch dass die Komayd selbst vor – wie viel? – dreizehn Jahren aus dem Amt geschasst worden war, konnte Khadses Groll nicht beschwichtigen. Politiker fallen weich, es sind die Fußsoldaten wie Khadse, die auf dem harten Boden der Realität landen. Sogar Komayds persönlicher Haudrauf, dieser klobige, einäugige Ochsenschädel von einem Dreyling, selbst dem hatte man einen kuscheligen Druckposten verschafft. Er genoss seinen Ruhestand als irgendein Hochwohlgeboren in den Dreylanden – auch wenn Khadse zu Ohren gekommen war, dass der Trottel es geschafft hatte, sich selbst den weichgepolsterten Stuhl unter dem Hintern wegzuziehen.
Ich hätte die Alte auch für lau abgemurkst, denkt Khadse. Zwölf Jahre im Staatsdienst und dann Peng!, mach’s gut, Rahul, du bist Vergangenheit, du und alles, wofür du geschuftet, gekämpft, geblutet hast, ich habe vor, die Gelder des Ministeriums für eine idealistische Wattebausch-Politik zu verschwenden und lasse die denkende Welt als rauchenden Krater hinter mir zurück.
Er hat die vierte Etage erreicht und betritt den Flur. Eine zweite Agentin, eine Frau, jung, athletisch, wie ihr Kollege schwarz gekleidet, steht in Habachthaltung an der Ecke. Wie von Khadse erwartet.
Er nähert sich ihr mit kleinen, schlurfenden Schritten, in der Hand einen fettfleckigen Zettel mit einem Namen und einer Zimmernummer, seine Miene drückt ratlose Verwirrung aus. Khadse macht einen Bückling, verströmt Unterwürfigkeit aus allen Poren. »Entschuldigung, ich glaube … ich glaube, ich bin in der falschen Etage?«
»Allerdings«, antwortet die Agentin. »Dieses Stockwerk ist privat.«
»Das fünfte Stockwerk ist privat?«, fragt Khadse erstaunt.
Man sieht der jungen Frau an, dass sie am liebsten die Augen verdreht hätte. »Das Hotel hat keine fünfte Etage, guter Mann.«
»Nein?« Er schaut sich hilflos um. »Aber wo …?«
»Sie befinden sich in der vierten Etage.«
»Du meine Güte. Aber dies ist das Hotel Golden, oder?«
»Ja. In der Tat.«
»Aber ich … Ach je.« Khadse lässt den Zettel fallen, der vor die Füße der Agentin flattert.
Mit einem ergebenen Seufzer bückt sie sich, um ihn aufzuheben.
Sie sieht nicht, dass Khadse mit einem lautlosen Schritt hinter sie tritt. Sieht nicht, wie er das Messer zückt. Hat keine Zeit zu reagieren, als der Stahl ihre Halsschlagader trifft.
Die Blutfontäne ist phänomenal. Khadse tänzelt zur Seite, um nicht davon getroffen zu werden. Ihm schießt der Gedanke durch den Kopf, dass die Gabe, stets äußerlich unbefleckt seine Arbeit zu erledigen, eins seiner kuriosesten, aber auch wertvollsten Talente ist. Die Agentin fällt auf die Knie, ihr Mund ist weit aufgerissen, aber es dringt kein Laut heraus. Khadse vollführt eine artistische Drehung auf einem Bein und setzt mit einem Tritt gegen den Hinterkopf den Schlusspunkt hinter ihr Leben.
Sie kippt um, verströmt ihr restliches Blut auf den Flurläufer. Wieder stellt Khadse seine Aktentasche hin und zieht die braunen Handschuhe an. Er wischt das Messer ab, steckt es ein, dann durchsucht er die Kleidung der Toten. Auch bei ihr findet er einen Zimmerschlüssel, dieser für die Nummer 402, den er an sich nimmt, dann umfasst er ihre Fußgelenke und zieht sie hinter die Ecke, wo man nicht gleich über die Leiche stolpert.
Schnell jetzt. Schnell, schnell.
Er legt das Ohr an die Tür von Nummer 402 – in dieser Etage befinden sich nur Suiten –, hört kein Geräusch und schließt auf. Er schleift den leblosen Körper durch den kleinen Vorraum ins Wohnzimmer und deponiert ihn hinter der Couch. Dann säubert er seine braunen Handschuhe, zieht sie aus und macht im Hinausgehen die Tür hinter sich zu. Auf dem Flur nimmt er seine Aktentasche an sich, und als er über die Blutlache hinwegsteigt, muss er sich beherrschen, um nicht ein fröhliches Liedchen zu pfeifen. Khadse konnte immer gut mit dem Messer umgehen. Gelernt hat er es auf die harte Tour, als nach einem Auftrag in Jukoshtan ein Festländer an seinem Gang Anstoß nahm und wild entschlossen war, Khadse die Kehle durchzuschneiden. Khadse überlebte mit einer Narbe am Hals und einer Vorliebe für Messerarbeit dicht am Mann. Behandle die Festländer so, wie sie dich behandeln würden, pflegt er sich Kollegen gegenüber zu äußern.
Zimmer 408 liegt, wie er erwartet hat, genau neben der Fürstensuite, in der seit einem Monat Ashara Komayd ihr Büro eingerichtet hat. Was sie dort tut – nichts Genaues weiß man nicht, aber es wird kolportiert, sie arbeite für eine wohltätige Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Waisenkinder von der Straße zu holen und ein Zuhause für sie zu finden.
Wohingegen Khadses Auftraggeber angedeutet hat, es ginge um weit mehr als das.
Aber wer weiß, was davon zu halten ist, denkt Khadse und dreht vorsichtig den Schlüssel im Schloss von Nummer 408. Der Spinner hat auch behauptet, dieses Hotel wäre mit massiven Sicherheitsvorkehrungen gespickt, aber ich würde zwei Grünschnäbel, denen noch die Eierschalen hinter den Ohren kleben, nicht gerade als massive Sicherheitsvorkehrung bezeichnen.
Wieder bemüht Khadse sich, den Gedanken an den Mantel und die Schuhe zu verdrängen, die er anhat und die ihn angeblich vor Komayds Abwehrmaßnahmen schützen sollen. Demnach sind diese Maßnahmen so beschaffen, dass Khadse sie nicht sehen kann, was ihm ganz und gar nicht gefällt.
Gequirlte Scheiße, weiter nichts, denkt er und macht leise die Tür hinter sich zu, nachdem er eingetreten ist. Nichts weiter als ein Haufen Blödsinn.
Das Hotelzimmer ist verlassen, aber er kennt sich aus, er könnte sich blind zurechtfinden: Da hinten der Schreibtisch, auf dem die Waffen liegen, dort das Bett und daneben das Nachtschränkchen mit den aufgestapelten Tagesberichten. In diesem Raum besprechen die Agenten den Einsatzplan, hier steht das Fernrohr, durch das sie vom Balkon aus die Straße beobachten, und wer Freischicht hat, kann hier ein Nickerchen halten.
Khadse begibt sich auf leisen Sohlen zur Wand, legt das Ohr daran und lauscht konzentriert. Er ist zu fast hundert Prozent sicher, dass die Komayd sich im Nebenzimmer aufhält, zusammen mit ihren zwei Leibwächtern. Ein ungewöhnlich aufwendiger Personenschutz für eine Ex-Premierministerin, aber schließlich hat die Komayd auch mehr Morddrohungen erhalten als so ziemlich jeder andere Mensch auf der Welt.
Er kann die zwei Leibwächter hören. Er hört, wie sie sich räuspern, ab und zu ein unterdrücktes Husten. Aber nichts, kein Laut, verrät Komayds Anwesenheit.
Bedenklich.
Sie müsste dort sein. Im Zimmer nebenan. Er hat seine Hausaufgaben gemacht.
Khadse überlegt kurz, dann geht er zum Balkon. Die Flügeltüren haben Glaseinsätze, vor denen dünne weiße Gardinen hängen. Er schiebt sich dicht an den äußeren Flügel heran und späht zum Nachbarbalkon hinüber.
Seine Augen werden groß.
Da ist sie.
Da sitzt sie, leibhaftig. Die Frau, Nachfahrin des Kaj, Überwinder der Götter und Eroberer des Kontinents, die Frau, die persönlich vor nunmehr zwanzig Jahren zwei Götter getötet hat.
Wie klein sie ist. Wie zerbrechlich. Ihr Haar ist schlohweiß – vorzeitig, denn so alt kann sie noch gar nicht sein, oder? –, und sie sitzt zusammengesunken auf einem zierlichen, verschnörkelten schmiedeeisernen Stuhl, wärmt die schmalen Hände an einem dampfenden Teebecher und blickt auf die Straße hinunter. Khadse ist so fasziniert von ihrer Zartheit, ihrer Unscheinbarkeit, dass er beinahe sein Vorhaben vergisst.
Das ist nicht gut, denkt er, als er sich abwendet. Nicht gut, dass sie da draußen ist, so exponiert. Viel zu gefährlich.
Er denkt weiter, und eine kalte Hand greift nach seinem Herzen. Die Komayd ist im Kern immer noch eine Agentin, auch nach all den Jahren. Und aus welchem Grund würde ein Agent die Straße im Auge behalten wollen? Weshalb dieses Risiko eingehen?
Die Antwort liegt auf der Hand. Die Komayd wartet auf etwas oder jemanden. Einen Boten mit einer Nachricht, vielleicht. Nun weiß Khadse nicht, was für eine Nachricht es sein könnte oder wann mit ihrem Eintreffen zu rechnen ist, doch er muss befürchten, dass Komayd ihren Platz verlässt, das Zimmer, das Hotel gar, und dann wäre die ganze Mühe umsonst gewesen.
Khadse wirbelt herum, kniet sich hin und öffnet seine Aktentasche. In dieser Aktentasche befindet sich etwas sehr Neues, sehr Gefährliches und sehr Perfides: die modifizierte Version einer Anti-Personen-Mine, so umgebaut, dass die gesamte Sprengkraft konzentriert in eine Richtung wirkt. Außerdem ist die Ladung für diesen speziellen Einsatz verstärkt worden. Während eine reguläre APM nicht stark genug ist, um Mauern zu durchschlagen, hat diese so viel Wumm, dass sie damit kein Problem haben sollte.
Khadse nimmt die Mine aus der Tasche und befestigt sie mit der gebotenen Vorsicht an der Wand zu Ashara Komayds Suite. Der Aktivierungsprozess besteht aus drei einfachen Schritten, er leckt sich nervös über die Lippen, während er die entsprechenden Verrichtungen vornimmt, dann stellt er den Zeitzünder auf vier Minuten. Vier Minuten sollten ihm genügen, um sich in Sicherheit zu bringen. Für den Fall, dass irgendetwas anders läuft als geplant, hat er noch ein weiteres neues Spielzeug in petto: einen Fernzünder, der es ihm ermöglicht, die Sprengung früher auszulösen, wenn es nötig sein sollte.
Er hofft inständig, dass es nicht nötig sein wird, denn es könnte bedeuten, dass er noch nicht weit genug weg ist, aber sei’s drum – was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen.
Er steht auf, sieht ein letztes Mal zu Komayd hinüber, murmelt: »Leb wohl, verdammtes Miststück!«, und schlüpft aus dem Hotelzimmer.
Durch den Flur, vorbei an den Blutflecken im Teppich, dann die Treppe hinunter. Die Treppe hinunter ins Foyer, wo die Leute nichtsahnend ihren belanglosen alltäglichen Beschäftigungen nachgehen, gähnend in Zeitungen blättern, mit Kaffee einen Brummschädel bekämpfen oder sich darüber klar zu werden versuchen, was sie mit ihrem freien Tag anfangen sollen.
Keiner nimmt von Khadse Notiz. Keiner schaut hin, als er durch das Foyer eilt und auf die Straße tritt, wo leichter Regen fällt.
Khadse ist ein Profi, er müsste abgebrüht sein, völlig ruhig. Sein Herz dürfte nicht so rasen, dass es sich fast überschlägt, aber er kann nichts dagegen tun.
Komayd. Endlich. Endlich. Endlich.
Eigentlich ist jetzt höchste Zeit, dass er sich von dem Ort, der bald ein Tatort sein wird, entfernt, in südlicher oder östlicher Richtung. Doch er kann nicht widerstehen. Er geht nach Norden, wo es an der Ecke des Hotels rechts in die Straße geht, die Komayd so interessiert beobachtet hat. Er will sie noch einmal sehen, seinen bevorstehenden Triumph auskosten.
Die Sonne bricht zwischen den Wolken hindurch, als Khadse um die Ecke biegt. Die Straße liegt da wie ausgestorben, zu dieser Stunde sind die meisten Leute auf der Arbeit. Er geht dicht an den Häusern gegenüber entlang, zählt in Gedanken die Sekunden, hält Abstand zum Hotel und mustert es nur verstohlen aus dem Augenwinkel.
Sein Blick wandert an dem Gebäude hinauf. Dann hat er sie entdeckt, auf ihrem Balkon im vierten Stock. Sogar von hier unten sieht man den Dampf, der aus dem Teebecher aufsteigt.
Er stellt sich in eine Türnische, um sie zu beobachten, sein Blut singt vor freudiger Erwartung.
Gleich ist es so weit. Gleich.
Dann setzt die Komayd sich aufrecht hin. Sie runzelt die Stirn.
Khadse tut es ihr gleich. Sie hat etwas gesehen.
Er schiebt sich einen halben Schritt vor, will herausfinden, was ihre Aufmerksamkeit erregt hat.
Dann sieht er es: Ein Mädchen, eine Festländerin, starrt zu Komayds Balkon hinauf und gestikuliert aufgeregt. Das Mädchen hat helle Haut, eine Stupsnase, ihr Haar ist kraus und buschig. Khadse hat sie noch nie zuvor gesehen, was schlecht ist. Sein Team hat akribische Vorarbeit geleistet. Sie sollten jeden kennen, der mit der Komayd zu tun hat.
Und diese Handbewegungen – drei Finger, dann zwei. Khadse weiß nicht, was die Zahlen bedeuten, aber die Bedeutung der Gesten ist klar – eine Warnung.
Während die Unbekannte der Komayd Zeichen gibt, schaut sie nach rechts und links und sieht Khadse.
Sie erstarrt. Ihr Blick und Khadses verkrallen sich ineinander.
Ihre Augen haben eine sehr, sehr ungewöhnliche Farbe. Sie sind weder richtig blau noch richtig grau, noch richtig grün oder braun – genaugenommen haben sie überhaupt keine benennbare Farbe.
Khadse schaut nach oben, zu der Komayd, und die Komayd sieht nach unten, blickt ihn an.
Ihr Gesicht verzieht sich angewidert, und obwohl es unmöglich ist – Auf diese Entfernung? Nach so langer Zeit? –, könnte er schwören, dass sie ihn erkannt hat.
Er sieht, wie sich ihre Lippen bewegen, sie formen ein Wort: »Khadse.«
»Scheiße«, sagt Khadse.
Seine rechte Hand fliegt zur Jackentasche, wo der Fernzünder steckt.
Er schaut zu der Fremden hin, aber sie ist verschwunden. Die Stelle auf dem Bürgersteig, wo sie gestanden hat, ist leer.
Khadse blickt sich nach allen Seiten um, er hat das unbehagliche Gefühl, sie könnte sich aus dem Hinterhalt unversehens auf ihn stürzen, aber nein. Sie ist weg. Einfach weg.
Dann sieht er wieder zu Komayds Balkon – und das Unmögliche ist geschehen.
Die hellhäutige Festländerin steht da oben neben Komayd, hilft ihr aufzustehen, drängt offensichtlich zur Eile.
Er glaubt, seinen Augen nicht trauen zu können. Wie um alles in der Welt kann sie so blitzschnell dorthin gekommen sein? Wie kann sie hier unten verschwinden und mir nichts dir nichts auf der anderen Straßenseite vier Stockwerke weiter oben wieder auftauchen? Das ist unmöglich.
Das Mädchen stößt mit einem Fußtritt die Balkontüren auf und schiebt Komayd hindurch.
Ich bin aufgeflogen, schießt es ihm durch den Kopf. Sie haben Lunte gerochen.
Khadses Hand schließt sich um den Fernzünder.
Er ist noch zu nahe am Explosionsherd, um sich sicher fühlen zu können, aber wenn er nicht handelt, ist das Attentat gescheitert, und das darf nicht sein: Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen.
Khadse drückt den Knopf.
Die Druckwelle wirft ihn zu Boden, überschüttet ihn mit Trümmerteilen; seine Ohren klingeln, die Augen tränen. Es fühlt sich an, als hätte ihm jemand mit beiden Händen links und rechts gegen den Kopf geschlagen und dazu noch in den Bauch getreten. Seine ganze rechte Seite schmerzt – die Wucht der Detonation hat ihn gegen die Hausmauer geschleudert, es ging so schnell, dass ihm erst jetzt bewusst wird, was passiert ist.
Die Welt dreht sich vor seinen Augen. Khadse rappelt sich mühsam auf.
Alles erscheint ihm verschwommen und weit weg, auch die Schreie und das Gebrüll. Die Luft ist erfüllt von Staub und Rauch.
Khadse zwinkert heftig, schaut durch einen Tränenschleier zum Hotel. Die rechte obere Ecke des Gebäudes ist komplett weggesprengt worden, ein schwarzes, zerklüftetes Loch gähnt dort, wo Komayds Balkon gewesen ist. Die Mine hat nicht nur Komayds Suite zerstört, sondern auch noch Zimmer 408 und das halbe Stockwerk daneben.
Keine Spur von Komayd oder der jungen Festländerin. Er unterdrückt den Impuls, hinzugehen und sich zu überzeugen, dass sein Werk vollbracht ist. Er steht nur da, hat den Kopf in den Nacken gelegt und bestaunt die Zerstörung.
Ein Festländer – Bäcker, nach Schürze und Mütze zu urteilen – rüttelt ihn an der Schulter und stammelt: »Was war das? Was ist passiert?«
Khadse wendet sich ab und geht davon. Seelenruhig, als wäre nichts geschehen, marschiert er in südlicher Richtung die Straße hinunter, während von allen Seiten Menschen herbeiströmen, Streifen- und Rettungswagen unter Sirenengeheul zum Unglücksort rasen und sich auf den Bürgersteigen die Scharen der Schaulustigen drängen, die gebannt nach Norden blicken, auf die Rauchsäule, die über dem Hotel Golden steht.
Er spricht nicht, schaut nicht links noch rechts, setzt nur beharrlich Fuß vor Fuß, wagt kaum zu atmen.
Endlich ist er bei seiner sicheren Unterkunft angelangt. Nachdem er sich vergewissert hat, dass in seiner Abwesenheit niemand versucht hat, in das Haus einzudringen, schließt er auf, geht hinein und sofort zum Radio. Er schaltet es ein, bleibt fast drei Stunden davor stehen und lauscht dem Geplapper und der Musik.
Wartet, wartet, bis endlich die ersten Meldungen über die Explosion in der Innenstadt das Programm unterbrechen. Wartet, wartet, bis der Nachrichtensprecher endlich sagt:
… soeben bestätigt, dass Ashara Komayd, die ehemalige Premierministerin von Saypur, bei dem Vorfall ums Leben gekommen ist …
Khadse atmet langsam aus.
Dann setzt er sich, schwerfällig wie ein alter Mann, auf den Fußboden.
Und dann, zu seinem eigenen Erstaunen, fängt er an zu lachen.
*
Sie nähern sich dem Baum bei Tagesanbruch, der Frühnebel hängt noch in den Zweigen. Sie sind mit Äxten bewaffnet, zwei Mann mit einer Zugsäge, sie tragen Schutzhelme auf dem Kopf und den Schnappsack über der Schulter. Der Baum ist mit einem Klecks gelber Farbe markiert, die am Stamm herabgetropft ist. Sie studieren die Umgebung, kalkulieren die Fallrichtung und dann, wie Chirurgen vor einer schwierigen Operation, gehen sie ans Werk.
Er lässt den Blick an dem Baumstamm hinaufwandern, während seine Kameraden mit den Vorbereitungen beschäftigt sind. Diesen jahrhundertealten Riesen zu fällen, denkt er, ist fast so, als würde man ein lebendiges Stück Zeit abschneiden.
Sie beginnen mit dem Fallkerb. Den Sohlenschnitt machen sie mit der Zugsäge, je ein Mann an jedem Ende zieht die Säge vor und zurück, die beidseitig geschliffenen Zähne fressen sich in das weiche weiße Fleisch, Holzfasern spritzen auf ihre Hände, Arme und Stiefel. Nach dem Sohlenschnitt kommen für das Kerbdach die Äxte zum Einsatz, fahren auf und nieder wie Kolben einer Maschine, hacken im schrägen Winkel große Stücke Holz aus dem Stamm.
Die Männer halten inne, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen und zu begutachten, was sie bis hierher geschafft haben. »Wie sieht’s aus, Dreyling?«, will der Vorarbeiter wissen.
Sigrud je Harkvaldsson lehnt die Axt an den Nachbarbaum. Er wünscht sich, sie würden ihn mit dem Namen ansprechen, den er ihnen genannt hat – Bjorn –, aber sie tun es nur selten.
Er kniet sich hin und legt den Kopf in den Fallkerb, dabei ist er sich vage der Masse Holz bewusst, die tonnenschwer über ihm schwebt. Dann kneift er die Augen zusammen, steht auf, schwenkt die Hand nach links und sagt: »Zehn Grad Ost.«
»Bist du sicher, Dreyling?«
»Zehn Grad Ost«, wiederholt er.
Die anderen sehen sich an und grinsen. Dann machen sie sich daran, den Kerb mit gezielten Hieben entsprechend zu korrigieren.
Anschließend gehen sie um den Stamm herum und beginnen, sich auf der Rückseite mit der Zugsäge nah, aber nicht zu nah, an den Fallkerb heranzuarbeiten.
Erschöpft sein Partner an der Säge, wartet Sigrud schweigend, bis ein anderer seinen Platz eingenommen hat, dann geht die Arbeit weiter.
»Bist du verdammt nochmal ein Automat, Dreyling?«, fragt der Vorarbeiter.
Sigrud sägt und schweigt.
»Würde ich deinen Brustkorb öffnen, fände ich nur Räderwerk?«
Sigrud schweigt.
»Ich hatte vor dir schon Dreylinge unter meinen Leuten, aber keiner von ihnen konnte schaffen wie du.«
Wieder keine Antwort.
»Jugend, vielleicht«, sinniert der Vorarbeiter. »Jung zu sein wie du, das könnte den Unterschied machen.«
Sigrud sagt immer noch nichts, auch wenn die letzte Bemerkung ihm einen leichten Schock versetzt hat, denn wie man es auch dreht und wendet – jung ist er nicht mehr.
In Abständen unterbrechen sie die Arbeit und lauschen: horchen auf das dumpfe, unwillige Knirschen, ähnlich den Lauten eines kalbenden Gletschers. Für Sigrud hört es sich an wie ein innerer Dialog: Ich will nicht – ich kann nicht – ich muss …
Und dann hören sie es: ein vielfaches scharfes Knallen, wie das Reißen starker Harfensaiten. »Baum fäll!«, brüllt der Vorarbeiter und alle halten die Helme fest und springen aus der Gefahrenzone. Der altehrwürdige Riese stürzt, Äste und Zweige brechen, Erde stiebt hoch, prasselt wieder herab. Die Männer warten, bis der Staub sich gelegt hat, dann kehren sie zurück. Die Schnittfläche am Stammende leuchtet frisch und weiß.
Sigrud betrachtet den Stumpf, der als einziges noch eine Weile Zeugnis ablegen wird für das Werden, Wachsen und Sterben eines lebenden Geschöpfs an dieser Stelle. Sein Blick wandert über die unzähligen Jahresringe. Wie eigenartig, dass ein solcher Koloss, der jahrhundertelang Wind und Wetter getrotzt hat, innerhalb weniger Stunden von einer Handvoll Idioten mit Äxten und Säge zu Fall gebracht werden kann.
»Was gibt es zu gaffen, Dreyling?«, erkundigt sich der Vorarbeiter. »Hast du dich verliebt? Los, fang an, das verdammte Ding zu entasten, oder ich sorge dafür, dass Ordnung in deinen vernebelten Hirnkasten kommt!«
Die anderen Holzfäller, die auf dem gefällten Baum herumklettern, grienen und kichern. Er weiß, was sie über ihn denken, dass er nicht der Hellste ist, vielleicht als Kind einmal zu oft auf den Kopf gefallen. Sie tuscheln untereinander, dass dies der Grund dafür ist, dass er so maulfaul ist, nie seine Handschuhe auszieht und eins seiner Augen sich nicht mit dem anderen bewegt, sondern starr nach rechts schielt. Und es muss auch der Grund dafür ein, dass er an der Säge nicht müde wird – er hat nicht genügend Grips, um zu merken, dass er außer Puste ist. Kein normaler Sterblicher könnte dermaßen schuften, ohne irgendwann umzufallen.
Ihr Gerede lässt ihn kalt. Besser, sie halten wenig von ihm als zu viel. Bewunderung und Schulterklopfen erregen Aufmerksamkeit, die er nicht brauchen kann.
Er holt mit der Axt aus und trennt mit einem Hieb einen dicken Ast vom Stamm. Dreizehn Jahre rastloser Wanderschaft als Tagelöhner, von einer Gelegenheitsarbeit zur nächsten. Die Aussicht, jetzt schon wieder weiterzuziehen, hat nichts Verlockendes, auch möchte er keinesfalls irgendwelche Behörden auf sich aufmerksam machen, deshalb schweigt er zu allen Frotzeleien.
Und stellt sich stattdessen selbst immer und immer wieder dieselbe Frage: Wird sie heute nach mir schicken? Wird dieser Tag der Tag sein, an dem sie mir sagt, dass ich zurückkommen kann?
*
Die Holzfällermannschaft hat ihr Tagessoll erfüllt, deshalb tritt man am Abend bester Laune den Rückweg zum Lagerplatz an. Schon von halber Höhe des Berges aus kann man die Kochfeuer sehen. Ihr Weg führt durch die breiten, in die Wälder geschlagenen Schneisen, trostlose, von traurigen Stümpfen übersäte Einöden, der Werkzeugkarren rumpelt scheppernd über Wurzelhöcker. Sie gehen schneller, je näher sie dem Lager kommen. Ihr Schlag liegt nicht weit außerhalb von Bulikov, deshalb ist der Schlauchwein annehmbar und macht die miserable Verpflegung erträglich.
Doch als sie das Lager erreichen, herrscht nicht der übliche Trubel, kein Gejohle und Gelächter und Gesang zur Feier eines weiteren heil überstandenen Tags im Holz. Die wenigen Kameraden, die sie sehen, stehen zusammen wie Trauergäste bei einer Beerdigung und unterhalten sich mit gedämpfter Stimme.
»Was bei allen Höllen ist heute Abend los? Ahoi, Pavlik!«, sagt der Vorarbeiter und grüßt einen Mann mit beeindruckendem Schnauzbart, der an ihnen vorbeiwill. »Was ist passiert? Hat’s wieder einen erwischt?«
Pavlik schüttelt den Kopf, die Schnurrbartenden schwingen hin und her wie Uhrenpendel. »Nein. Keinen von uns jedenfalls.«
»Was meinst du damit?«
»In Ahanashtan soll es ein Attentat gegeben haben. Krieg liegt in der Luft. Wieder einmal.«
Die Männer schauen sich an. Wie ernst soll man das nehmen?
»Pah!« Der Vorarbeiter spuckt aus. »Noch ein Attentat … Sie machen ein Gewese, als wäre das Leben von irgendeinem Politiker mehr wert als das von anderen Menschen. Zu guter Letzt ist es doch immer wieder nur viel Lärm um nichts.«
»Tja, ich würde dir recht geben, wenn es irgendeinen Politiker getroffen hätte«, meint Pavlik. »Aber es war nicht irgendeiner. Es war die Komayd.«
Schweigen senkt sich über das Lager. Dann lässt sich eine tiefe Stimme vernehmen: »Komayd? Was ist mit Komayd?«
Die Männer sehen zu Sigrud hinüber, der neben dem Karren steht. Alle merken, dass sein Blick schärfer und klarer ist, als man es bei ihm kennt, er hält sich aufrechter und wirkt größer – sehr groß sogar, als wäre er unbemerkt um mindestens zwei Handspannen gewachsen.
»Was soll mit ihr sein?«, antwortet Pavlik. »Tot ist sie, was sonst.«
Sigrud starrt ihn an. »Tot? Sie ist … Sie ist … tot?«
»Sie und ein Haufen anderer Leute. Die Meldung kam heute Morgen über den Telegrafen. Sie haben das Hotel in die Luft gesprengt, in dem sie war. In Ahanashtan. Vor sechs Tagen. Zahlreiche Tote.«
Sigrud geht langsam auf Pavlik zu. »Wie kann man sich dann sicher sein? Steht es fest, dass sie tot ist? Weiß man es genau?«
Pavlik schaut Sigrud entgegen und sagt nichts. Erst als der Dreyling über ihm aufragt wie eine der Kiefern, die sie jeden Tag fällen, findet er die Sprache wieder. »Nun, äh … Ja, man hat die Leiche gefunden, heißt es. Oder was davon übrig war. Man plant ein Staatsbegräbnis mit allem Drum und Dran, die Zeitungen sind voll davon!«
»Warum die Komayd?«, will einer wissen. »Sie war vor mehr als zehn Jahren Premierministerin. Warum jemanden ermorden, der längst nicht mehr im Amt ist?«
»Was weiß ich.« Pavlik zuckt mit den Schultern. »Alte Liebe rostet ja bekanntlich nicht, alter Hass vielleicht auch nicht. Kann sein, dass einer noch von früher ein Hühnchen mit ihr zu rupfen hatte. Als sie noch im Amt war, hat sie ziemlich vielen Leuten auf die Füße getreten, und es wird gemunkelt, die Liste der Verdächtigen reicht zwei Mal ums Karree.«
Sigruds Blick kehrt von dem Frager zu Pavlik zurück, ein Auge mustert den Mann durchdringend, das andere schaut unbeteiligt in die Gegend, als hätte es mit der ganzen Sache nichts zu tun. »Also weiß man noch nicht«, sagt er ganz ruhig, »wer ihr das angetan hat?«
»Falls sie es wissen, verraten sie’s nicht«, antwortet Pavlik.
Sigrud schweigt, und der Ausdruck von Bestürzung auf seinem Gesicht wandelt sich zu grimmiger Entschlossenheit, als hätte er in dieser Sekunde eine Entscheidung getroffen, die längst überfällig war.
»Genug davon«, sagt der Vorarbeiter. »Los, den Karren abladen! Dreyling, komm her und pack mit an!«
Die anderen Männer beeilen sich zu gehorchen, Sigrud aber bleibt stehen wie zu Stein geworden. Der Vorarbeiter hebt die Augenbrauen.
»Bjorn? Bjorn! Verdammt! Setz deinen Arsch in Bewegung!«
»Nein«, sagt Sigrud leise.
»Wie? Nein? Nein was?«
»Nein zu allem hier. Ich bin das nicht, nicht mehr.«
Der Vorarbeiter marschiert zu ihm und packt seinen Arm. »Du bist verdammt noch mal alles, was ich dir sage, Ar…«
Sigrud macht eine heftige Bewegung, der Kopf des Vorarbeiters fliegt in den Nacken, und dann liegt der Mann lang auf der Erde, röchelt, hustet und umklammert mit beiden Händen seinen Hals. Die Umstehenden brauchen einen Moment, bis sie begriffen haben, dass Sigruds Faust ihn an der Kehle getroffen hat, so schnell, dass das Auge kaum folgen konnte.
Sigrud tritt an den Karren, nimmt eine Axt heraus und stellt sich über den am Boden Liegenden. Er hält die Axt am ausgestreckten Arm und lässt sie langsam sinken, bis die Spitze der Klinge fast die Nase des Vorarbeiters berührt. Der Mann hört auf zu husten und schielt aus weit aufgerissenen Augen auf den blinkenden Stahl.
Die Axt bleibt lange so in der Schwebe. Dann scheint Sigrud ein wenig in sich zusammenzusinken, seine Schultern sacken herab. Er wirft die Axt zu Seite und verlässt den Kreis, und keiner der Männer hält ihn auf.
*
Sigrud hat sein Zelt und seine Habseligkeiten zusammengepackt und verschnürt, bevor man sich am Feuer einig geworden ist, was man tun soll. Auf dem Weg aus dem Lager macht er noch einmal Halt, um sich aus dem Werkzeug einen Spaten herauszusuchen. Erst jetzt findet der Vorarbeiter seine Stimme wieder, auch wenn es nur ein ersticktes Krächzen ist: »Hat der Hundsfott sich verpisst? Ich will ihn haben! Ich bringe ihn um!«
Sigrud läuft hangabwärts, schräg über den Kahlschlag, eine vergewaltigte Landschaft, auf der vereinzelt zerzauste Bäume stehengeblieben sind, bleich und grau im Mondschein. Erst als er den noch unberührten Wald erreicht, im tiefen Fichtenschatten, wird er langsamer. Er kennt diese Gegend, kennt das Terrain. Er versteht sich aufs Kämpfen unter erschwerten Bedingungen, viel besser als die Männer, die eben noch seine Kameraden gewesen sind.
Am Rand einer schmalen Schlucht legt er eine Verschnaufpause ein, seine Stiefel balancieren auf einer knorrigen Wurzel. Sein Herz schlägt wie ein Hammer. Alles kommt ihm unwirklich vor und fern und entsetzlich falsch.
Tot. Tot.
Er schüttelt sich, ein Versuch, den Kopf frei zu bekommen. Er spürt Tränen auf den Wangen und schüttelt sich wieder.
Sie kann nicht tot sein. Sie kann einfach nicht tot sein.
Er hält den Atem an und lauscht: Alles still, noch verfolgt man ihn nicht.
Er blickt zum Mond auf, schätzt seine Position und dringt tiefer in den Wald ein. All seine früheren Fähigkeiten melden sich zurück: Seine Füße finden von selbst weiche Nadelpolster statt trockener Zweige, die knistern und knacken, er meidet instinktiv mondbeschienene Stellen, damit kein Blinken von Metall ihn verrät, und bei jedem Windstoß hebt er witternd den Kopf, ob da ein fremder Geruch ist, der auf einen Verfolger hindeuten könnte.
Kerben in Baumstämmen und abgeschlagene Äste sind von ihm angebrachte Markierungen, denen er jetzt folgt, zurück zu der Stelle, an der er etwas vergraben hat. Keinen Schatz und doch wertvoll: sein früheres Leben, der Mann, der er einmal war.
Endlich gelangt er zu einer schiefen, abgestorbenen Kiefer mit einer langen, diagonal verlaufenden Narbe in der schuppigen Borke. Er setzt seinen Rucksack ab und fängt an zu graben, viel zu schnell, mit viel zu viel Kraftaufwand, eine unkluge Vergeudung von Energieressourcen, aber er ist innerlich so aufgewühlt, dass er nicht anders kann.
Endlich stößt der Spaten mit einem dumpfen Geräusch auf Widerstand. Sigrud kniet sich hin und scharrt mit den Händen den Rest Erde von einem in Leder eingewickelten Kasten, ungefähr einen halben Meter breit und fünfzehn Zentimeter hoch. Er hebt ihn mit zitternden Händen heraus und versucht ihn auszupacken, aber seine Arbeitshandschuhe erweisen sich als hinderlich. Er wirft einen Blick über die Schulter, dann zieht er sie aus.
Das vernarbte Mal in der Innenfläche der linken Hand glänzt im Mondlicht, ein wie mit dem Brandeisen ins Fleisch geprägtes Sigel, zwei stilisierte Hände, welche wiegen und wägen. Seit Monaten, seit er sie vor den Augen der Welt verborgen hat, sieht er zum ersten Mal seine eigenen Hände unverhüllt.
Er schlägt das Leder auseinander. Der Kasten ist aus dunklem Holz gefertigt, die Schließe blank und glänzend. Er hat dieses Paket mehrfach ein- und wieder ausgegraben, jedes Mal, wenn er weiterziehen musste, es aber nie geöffnet.
Im Innern des Kastens befinden sich allerlei Gegenstände, und seinen Arbeitskameraden würden die Augen aus dem Kopf fallen, wenn sie sie sehen könnten – in erster Linie wahrscheinlich wegen der siebentausend Drekelmark in kleinen, festen Rollen, ungefähr das Dreifache von dem, was ein Waldarbeiter im Jahr verdient. Diese verstaut er an verschiedenen für solche Zwecke vorbereiteten Stellen seiner Kleidung: in den Manschetten von Hemd und Jacke, seiner Hose sowie in dem falschen Boden seines Rucksacks, den er eigenhändig eingenäht hat.
Als Nächstes kommen die sieben unterschiedlichen, in Wachspapier eingewickelten Pässe an die Reihe, die dem Inhaber ungehindertes Reisen auf dem gesamten Kontinent und in Saypur ermöglichen. Er sortiert die Namen und Identitäten: sämtlich Dreyling, selbstredend, weil er seine Herkunft nicht verleugnen kann, auch wenn er sich Haare und Bart geschoren hat, um sich von seinem alten Leben zu distanzieren – ganz zu schweigen von dem Erwerb eines Glasauges. Wiborg, überlegt er und fächert die Dokumente auf wie ein Kartenspiel, Micalesen, Bente, Jenssen … Welcher von euch ist aufgeflogen? Nach wem von euch wird noch gefahndet, nach all den vielen Jahren?
Flüchtig fragt er sich, warum er tut, was er tut, was als Nächstes kommt, aber es ist einfacher, nicht zu planen, nicht zu denken, sondern immer weiterzumachen, unaufhaltsam wie ein bergabrollender Stein.
Außer den Passierscheinen gibt es eine Bolzenschusspistole, ein handliches Gerät nach dem System einer Armbrust, das für den Krieg nicht taugt, wohl aber für den einzelnen, lautlosen Todesschuss, vorausgesetzt die Mechanik funktioniert nach den Monaten unter der Erde noch einwandfrei. Der nächste Gegenstand scheint auf den ersten Blick nur ein zusammengerolltes Lammfell zu sein, doch zum Vorschein kommt nach dem Auspacken ein altes, liebevoll gepflegtes Messer in einer schwarzen Lederscheide. Er faltet das Stück Lammfell sorgsam zusammen und legt es zurück in den Kasten – man weiß nie, was man noch einmal gebrauchen kann – und zieht das Messer aus der Hülle.
Die Klinge ist so schwarz wie Erdöl. Sie hat einen tückischen Glanz – so schillert Stahl, der viel Blut gekostet hat.
Damslethknochen, denkt er. Er fasst eine Kiefernnadel an einem Ende zwischen Daumen und Zeigefinger und köpft sie mit einem präzisen Streich. Bewahrt die Schärfe, denkt er. Jahrzehntelang.
Heute, und das ist traurige Gewissheit, gibt es keine Damslethwale mehr. Schuld ist zum Teil die Waljagd, die er selbst in jungen Jahren betrieben hat, aber auch eine Veränderung des Klimas spielt eine Rolle. Das kälter gewordene Wasser hat die Organismen getötet, die ihre Nahrungsgrundlage waren, oder die Bestände so drastisch reduziert, dass es auf dasselbe hinauskam. Jedenfalls hat er nie eine andere Damslethwaffe außer seiner eigenen gesehen und auch nie von einer anderen gehört, die noch existiert.
Er schiebt die Klinge in die Scheide zurück und schnallt sie an seinen rechten Oberschenkel. Die Handgriffe sind ihm augenblicklich wieder gewärtig und wecken Erinnerungen an alte Zeiten im Dienst des saypurischen Ministeriums, den Schattenkrieg gegen immer neue Gegner.
Und Erinnerungen an sie, die Frau, die dabei allezeit und überall an seiner Seite gewesen ist.
»Shara«, sagt er leise.
Sie standen sich näher als Liebende – denn was ist Liebe? Nur ein flüchtiges, unbeständiges Gefühl. Sie waren Kameraden, Kampfgefährten auf Gedeih und Verderb, von dem Moment an, als sie ihn aus der Hölle von Slondheim befreite, bis zu den Tagen des Wiederaufbaus nach der Schlacht um Bulikov.
Er lässt den Kopf hängen, seine Schultern sinken kraftlos herab. Ich kann es nicht glauben. Ich weigere mich, es zu glauben …
In all den Jahren der Verbannung hat er an der Überzeugung festgehalten, dass Ashara Komayd – oder nur »Shara« für ihre Freunde – eines Tages mit ihm Verbindung aufnehmen würde. Dass sie ihn unter all dem lichtscheuen Gesindel, den Gelegenheitsarbeitern, -dieben, -mördern aufspüren würde, mit ihrem unvergleichlichen sechsten Sinn. Eine geheime Botschaft würde ihn erreichen, auf ebenso geheimen Pfaden, und ihm sagen, sie habe ihr Versprechen eingelöst und seinen Namen reingewaschen, seiner Rückkehr stünde nichts mehr im Wege. Er könne noch einmal mit ihr zusammenarbeiten, bei einem letzten gemeinsamen Fall, oder aber den Dienst quittieren und endlich nach Hause gehen, in die Dreylande, in die Heimat.
Es war eine romantische Vorstellung. Etwas, wovor sie oft genug gewarnt hatte. Vor seinem geistigen Auge sieht er sie in einer Grenzerhütte irgendwo am Rand von Jukoshtan am Fenster sitzen – vor dreißig Jahren muss das gewesen sein, bei irgendeinem langweiligen und langwierigen Einsatz. Sie bläst über ihren heißen Tee und sagt leise: Wir sind beide nicht unentbehrlich, Sigrud, du nicht, ich nicht. Weder im Hinblick auf unsere Arbeit noch für die Leute, in deren Auftrag wir sie verrichten … Sie hebt den Kopf und schaut ihn an, ihre dunklen Augen sind groß, der Blick ist hart. Sollte ich je in eine Lage geraten, in der ich entscheiden muss, was mir wichtiger ist, dich zu retten oder der Erfolg des Einsatzes, würde ich mich für Letzteres entscheiden, und von dir erwarte ich nichts anderes. Unsere Arbeit verlangt von uns mitunter, die Gebote der Menschlichkeit zu missachten, aber das darf uns nicht daran hindern, zu tun, was getan werden muss.
Er lächelt schief. Der Sigrud von damals hatte genauso gedacht; durch eine harte Schule gegangen, huldigte er einem brutalen Pragmatismus. Im Lauf der Jahre war er weicher geworden, vielleicht durch ihren Einfluss.
Er betrachtet das Spiel des Mondlichts auf der schwarzen Klinge. Und worauf warte ich jetzt? Wer soll mich jetzt rufen?
Er wendet sich wieder dem Kasten zu. Zögert.
Ich will es nicht ansehen müssen, denkt er beklommen.
Aber er weiß, es führt kein Weg daran vorbei.
Er nimmt den letzten Gegenstand heraus, ein Blatt Papier, das ganz unten im Kasten gelegen hat. Es ist ein vergilbter Zeitungsausschnitt mit der Fotografie einer jungen Frau. Sie steht an Deck eines Schiffs und schaut mit einer Mischung aus Belustigung und Herablassung in die Kamera. Obwohl es ein Schwarzweißfoto ist, besteht kein Zweifel daran, dass das Haar der Frau hellblond ist, und ihre Augen sind blassblau hinter der merkwürdigen Brille auf ihrer Nase. Auf ihrer Brust prangt ein Firmenwappen mit den Buchstaben »SDC«.
Die Bildunterschrift lautet: SIGNE HARKVALDSSON, LEITERIN DER TECHNISCHEN ABTEILUNG DER SOUTHERN DREYLING COMPANY.
Sigrud vertieft sich in das Gesicht seiner Tochter, grobkörnig auf schlechtem Zeitungspapier.
Er erinnert sich an den Anblick, als er sie zum letzten Mal sah, dreizehn Jahre ist das jetzt her: Kalt und bleich und still lag sie da, auf dem Gesicht einen Ausdruck leichten Missbehagens, als wäre die Austrittswunde der tödlichen Kugel in ihrer Brust nur Ursache einer geringfügigen Unpässlichkeit.
Wie gut er sich erinnert, an sie und das Blutbad, das er in einem Anfall berserkerhafter Raserei angerichtet hat.
Ich war nicht da, um dich zu retten, sagt er zu der Fotografie. Ich war nicht da, um Shara zu retten. Nie war ich da, wenn es darauf ankam.
Er steckt den Zeitungsausschnitt in die Jackentasche und klopft beschwichtigend darauf, wie ein Appell an die Erinnerung, nun wieder einzuschlafen.
Geistesabwesend nimmt er das Messer in die frei gewordene Hand, seine Finger umschließen den Griff so fest, als wollten sie ihn zerquetschen, dann wirft er sich urplötzlich nach vorn und rammt das Messer tief in den Stamm der toten Kiefer. Ein Schluchzen steigt aus seiner Kehle, doch er besitzt noch die Geistesgegenwart, es herunterzuwürgen, bevor der Laut ihn verraten kann.
Wahrhaft elend die Kreatur, denkt er, der nicht einmal zu Weinen erlaubt ist!
Er spannt alle Muskeln und Sehnen an, stemmt sich gegen das Messer, um es noch tiefer in den Stamm zu bohren, dann gibt er auf, hängt an dem Messergriff und atmet tief.
Seine Instinkte übernehmen. Du hast dich im Lager benommen wie ein Idiot, tadelt er sich selbst. Tarnung aufgeflogen. Wieder einmal. Wie dumm er ist, unfähig, sich zu beherrschen.
Vorbei. Nicht mehr daran denken. Konzentration auf das Naheliegende. Aufstehen und weitergehen. Weiter und immer weiter.
Er zieht das Messer aus dem Stamm, steckt es in die Scheide und schultert den Rucksack. Dann marschiert er hügelan in die Dunkelheit.
*
Stunde um Stunde wandern, wachsam, umsichtig, durch den nächtlichen, pfadlosen Forst. Wenn die Wipfel ein Stück Himmel freigeben und er die Sterne sehen kann, orientiert er sich, korrigiert wenn nötig die Richtung und geht weiter.
Irgendwann kurz vor Tagesanbruch überkommt ihn wieder die Erinnerung.
Jukoshtan, denkt er, 1712. Im Ministerium hatte es eine Panne gegeben oder ein Leck, sämtliche Informanten und Netzwerke waren kompromittiert, und niemand konnte überblicken, wie schlimm die Lage wirklich war.
Er und Shara mussten sich trennen, weil das Ministerium einen Maulwurf in den Reihen der Agenten vermutete, und Sigrud stand als Ausländer ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Ich habe Vorbereitungen getroffen, damit du die Stadt verlassen kannst. Sharas Worte an ihrem letzten gemeinsamen Tag damals. Danach bist du auf dich allein gestellt.
Seine Antwort bestand in einem grimmigen Knurren.
Ich werde zurückgehen und ihnen klarmachen, dass du es nicht gewesen bist, Sigrud. Ich weiß nicht, ob ich mir Gehör verschaffen kann, aber ich werde mich bemühen. Und sobald dein Name reingewaschen ist, noch in derselben Sekunde, werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, um dich zu finden und dir Nachricht zu geben.
Schöne Worte, doch er war skeptisch geblieben, denn er glaubte, er wäre für sie wenig mehr als ein nützliches Werkzeug in ihrem Arsenal. Und wenn es nicht klappt?, fragte er. Wenn sie dich einsperren oder liquidieren?
Sie verlor ihren Gleichmut, was nur selten vorkam, ihre Augen blitzten. In dem Fall, Sigrud, will ich, dass du deiner Wege gehst. Kehre allem hier den Rücken und beginne ein neues Leben, dein Leben. Forsche nach dem Verbleib deiner Familie oder fang noch einmal ganz von vorne an, wenn du denkst, es wäre besser so, aber geh. Geh fort. Du hast genug bezahlt, genug getan. Vergiss mich und geh.
Das überraschte ihn. Sie hatten so viel Zeit miteinander verbracht, zwei einsame Menschen, Verbündete in einem einsamen Krieg im Schatten, dass er überzeugt war, sie dachte nie an ein anderes Leben – schon gar nicht was ihn betraf, ihren grimmigen Vollstrecker, den im Hinterhalt Lauernden, mit einem Messer zwischen den Zähnen. Aber sie hatte nicht gewollt, dass er immer nur das sein sollte – ihr Schlagetot.
Schon damals hat sie sich deinetwegen Gedanken gemacht, sinnt er und bleibt stehen. Sie hat sich für dich ein gutes, ein wertvolles Leben gewünscht.
Er senkt den Blick auf die Hände. Rau und zernarbt und schmutzig. Die meisten dieser Narben stammen nicht von der Arbeit im Holz, sondern von dreckigen, brutalen Kämpfen Mann gegen Mann an dreckigen, brutalen Orten.
Seine Gedanken wandern zu Shara. Seiner Tochter. Seiner Familie. Alle verloren, alle fort oder tot.
Er dreht die Hände hin und her. Wie hässlich ich bin, denkt er. Habe ich wirklich geglaubt, dass ich in dieser Welt etwas Schönes vollbringen könnte? Habe ich wirklich geglaubt, dass den Menschen, die mir nahestehen, etwas anderes als Schmerz und Tod beschieden sein könnte? Er blickt zu dem fahlen Mond hinauf, der über ihm am Himmel steht. Was bleibt mir zu tun? Was bleibt mir jetzt noch zu tun?
Er senkt den Kopf und weiß es, weiß es mit schmerzlicher Klarheit.
*
Das Kitz ist schnell gefunden und erlegt, mit einem Schuss seines Bolzenschnellers. Sigrud hatte befürchtet, seine waidmännischen Fähigkeiten wären eingerostet, aber das Wild hier oben in den Tarsils ist tatsächlich wild und weiß nichts von Menschen, nichts von ihren Listen und Fallen.
Das erlegte Tier über der Schulter, steigt er zum Gipfel hinauf. Er hat nicht vor, es zu essen – die Verwendung als Nahrung würde das Töten rechtfertigen. Der Sinn des Rituals, das er vollziehen muss – wie schon einmal, vor vierzig Jahren –, liegt darin, einen Frevel zu begehen, ein widerwärtiges Unrecht.
Im düsteren Grau der Stunden zwischen Nacht und Tag entkleidet Sigrud sich bis zur Taille. Dann trennt er dem Kitz mit großer Sorgfalt den Kopf vom Rumpf und bricht es auf. Seine Hände sind stark und grausam, wühlen in dem zarten Körper, zerren, reißen. Die herausgenommenen Eingeweide legt er vor der geöffneten Körperhöhle auf einen Haufen, das kleine, wunderschöne Herz obenauf.
Dann stapelt er Zweige und Reiser um die Opferstelle, entzündet alles mit einem Schwefelholz und schaut zu, wie die Flammen langsam über die blutgetränkte Erde rings um die groteske Szene kriechen. Die Hitze versengt das Fell des einst anmutigen, zierlichen Geschöpfs.
Er denkt zurück an das letzte Mal, als er dieses Ritual vollzogen hat, damals war der Anlass die Ermordung seines Vaters. Der Ascheschwur. Kennt man in den Dreylanden die alten Bräuche noch? Oder bin ich schon so sehr ein Relikt aus vergangenen, blutigen Zeiten, dass außer mir niemand mehr davon weiß?
Bei Sonnenaufgang ersterben die Flammen. Die Überreste des Rehkitzes sind zu schwarzen Klumpen verschmort. Sigrud beugt sich vor, greift in das feuchte, heiße Erdreich und schmiert sich eine Handvoll, mit Blut und Asche vermengt, ins Gesicht, auf die Brust, die Schultern und Arme.
Eine schändliche Tat wurde begangen, denkt er. Und ich bin davon besudelt.
Dann wühlt er in den Resten dessen, was einmal die Eingeweide des Kitzes gewesen sind, und hebt das verkohlte Herz heraus. Er hält es in den Händen und wischt die Asche ab. Es erinnert ihn seltsam an das Gefühl einer kleinen Kinderhand in der seinen.
Weinend nimmt er einen Bissen.
Und ich werde noch mehr schändliche Taten begehen, denkt er. Bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist oder ich nicht mehr kämpfen kann.
Von den sechs ursprünglichen Gottheiten des Kontinents setzten nur vier Kinder in die Welt – Taalhavras, der Gott von Ordnung und Wissen, Jukov, der Gott der Heiterkeit, Olvos, Göttin der Hoffnung, und Ahanas, die Göttin der Fruchtbarkeit. Ungeachtet ihrer geringen Zahl, pflegten sie lebhaft Beziehungen und Verhältnisse untereinander, denen Dutzende, wenn nicht Hunderte des göttlichen Fluidums teilhaftige Nachkommen entsprossen. Feen, Kobolde, zaubermächtige Menschenwesen bevölkerten den gesamten Kontinent. Diese Nachkommen wurden auf eine Weise gezeugt, die das Vorstellungsvermögen von uns Sterblichen übersteigt – unter anderem schien das Geschlecht der göttlichen Eltern nicht von Bedeutung zu sein, ebenso wenig zeigten sich Folgen von Inzucht –, aber wir müssen sie in jeder Hinsicht als Kinder der Götter betrachten.Eine der Lieblingsfragen, mit denen moderne Historiker sich befassen, ist die, was genau mit diesen Abkömmlingen geschah. Sind sie verschwunden, als der Kaj den Kontinent betrat und die Gottheiten eliminierte? Gottgedachte – von einer einzelnen Divinität auf dieselbe Weise wie ein Mirakel erschaffene Wesen – überlebten bewiesenermaßen den Tod ihres Erzeugers nicht. Einige der gezeugten Kinder hingegen schienen eine größere Eigenständigkeit zu besitzen und existierten auch nach dem Verlust der Eltern weiter – allerdings nur, bis sie von den Schergen des Kaj aufgespürt und exekutiert wurden. Verfügten sie über eigene göttliche Fähigkeiten, waren quasi Miniaturversionen ihrer Erzeuger? Ist es dem Kaj gelungen, sie vollständig auszumerzen? Oder fanden sie eine Möglichkeit, sich zu verbergen? Wir wissen es nicht genau. Doch falls es einigen gelungen ist, sich der Verfolgung zu entziehen, sind sie bis jetzt nicht in Erscheinung getreten.
DR. EFREM PANGYUI: »ÜBER DAS LEBEN DER DIVINITÄTEN«
2. Vorboten des Krieges
Die nackten Füße des Jungen trommeln auf den Asphalt, sein Atem geht keuchend, brennt in der Brust. Er duckt sich unter einer Markise hindurch, schwingt sich um einen Laternenpfahl, schlittert in eine kopfsteingepflasterte Gasse. Eine alte Frau mit Einkaufstasche mustert ihn drohend, als er an den Apfelkisten vor einer Obsthandlung vorbeiflitzt, ein Ladenbesitzer ruft: »Obacht!« Der Junge schenkt keinem von beiden Beachtung, hat nur Augen für die nächste Hausecke, die nächste Straßenmündung. Die Sonne brennt vom Himmel, sein Gesicht ist schweißüberströmt.
Er rennt, als ginge es um sein Leben, und vielleicht ist es ja so. Er muss ihn abschütteln, muss, muss.
Eigentlich sollte es ganz leicht sein: Im labyrinthischen Gewirr der Straßen und Gassen Bulikovs kann man sich ohne Weiteres auf dem alltäglichen Weg nach Hause verirren. Dieser spezielle Verfolger jedoch hat es geschafft, ihm auf den Fersen zu bleiben, und das macht dem Jungen Angst.
Um eine Ecke und noch eine, dann die Treppe hinunter, quer über eins der Trümmergrundstücke und in die nächste Seitenstraße … Der Junge bleibt stehen, japst und stolpert in eine Gassenmündung. Er wartet, atmet schwer und schiebt den Kopf vorsichtig um die Hausecke.
Nichts. Die Straße ist leer.
Vielleicht hat er ihn abgehängt. Vielleicht ist er ihn los.
»Endlich«, sagt er.
Dann passiert etwas mit dem Licht. Der helle Sonnenschein verblasst.
Zu seinen Füßen wirbeln die Schatten, bilden einen Strudel.
»O nein«, flüstert der Junge.
Er sieht auf, und vor seinen Augen entfaltet sich ein bizarres Schauspiel, das für ihn jedoch nicht unerwartet kommt, er hat damit gerechnet, sich davor gefürchtet. Der klare Sommerhimmel über ihm verdunkelt sich, als würde es schon Abend, dichte Schwaden aus Indigo, dunklem Purpur und Schwarz ziehen heran, mischen sich in das helle Blau. Er steht da wie angewurzelt und schaut zu, wie die Finsternis an die Sonne herankriecht, sie verdeckt und übermalt, als hätte es sie nie gegeben.
Sterne funkeln in dieser neuen Dunkelheit über seinem Kopf, ferne, kalt glitzernde Sterne. Der Junge weiß, wenn er noch länger wartet, wird der ganze Himmel pechschwarz sein, und diese Sterne sind dann das letzte und einzige Licht, das es noch gibt.
Der Junge wirbelt herum und rennt weiter durch die Gasse. Nach wenigen Schritten endet die Finsternis wie abgeschnitten, als wäre er unter einer Gewitterwolke hervorgekommen; die Sonne scheint wieder, und der Himmel ist blau.
Aber viel zu nah, denkt der Junge. Viel zu nah, viel zu nah …
Panik steigt in ihm auf. Es geht nicht anders, er muss zu einem seiner Tricks Zuflucht nehmen. Er tut es nicht gern so wie jetzt, im Laufen, doch er weiß sich nicht anders zu helfen.
Er kneift die Augen zu, stellt sich die Umgebung vor, in der er sich befindet, sucht nach ihnen.
Es dauert eine Weile, sie zu finden – dies ist keins von Bulikovs Vergnügungsvierteln, deshalb sind Theater oder Restaurants oder Bars hier dünn gesät, aber dann sieht er eins in der Nähe aufleuchten: Ein kugeliges Gespinst, strahlend hell, silbrig schimmernd, flimmernd, schaukelt es vergnügt mitten in der Tristesse und Nüchternheit eines Bulikovs bei Tage.
Er greift danach. Hält fest.
Wird eins damit.
Die Welt um ihn verschiebt sich wie eine Theaterkulisse.
Er hört die letzte Zeile in seinem Kopf: »… und die Schäferin sagt natürlich: ›Na ja, mit seinem Vater hat es auch keine große Ähnlichkeit!‹«
Plötzlich werden die Ohren des Jungen überschwemmt von einem herrlichen, wundervollen, fröhlichen Geräusch: prustendes Männerlachen, ein echtes Tränen-in-den-Augen Lachen, ein Halt-mich-fest-ich-kann-nicht-mehr Lachen und der Junge ist bei ihnen und lacht mit.
Fast hätte er vergessen, wieso er hier ist. Er macht die Augen auf und sieht den Schankraum einer Fischerkneipe am Soldaufer und eine ausgelassene Runde von Flussfischern in ihrer schmutzigen Arbeitskluft, die sich nach dem Fang eine Flasche Pflaumenwein genehmigen. Keinem ist das unvermittelte Auftauchen des jungen, hellhäutigen Festländers aufgefallen, der sich aus dem Nichts materialisiert zu haben scheint. Sie benehmen sich, als wäre er schon immer da gewesen, und einer bietet ihm sogar einen Schluck aus seiner Flasche an, was der Junge höflich ablehnt.
Eigentlich ist es noch viel zu früh am Tag für eine weinselige Feier, doch er ist dankbar dafür. Wein stimmt heiter, wer heiter ist, lacht, und Lachen öffnet ihm …